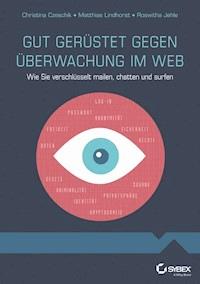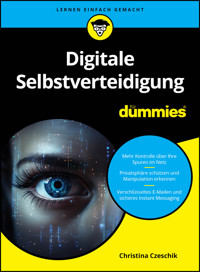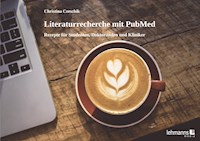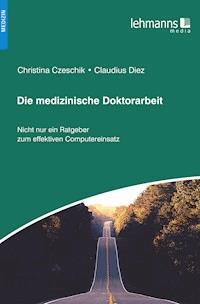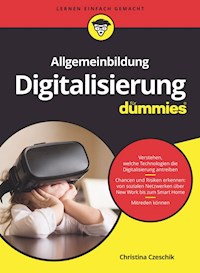
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
"Die Digitalisierung geht nicht mehr weg." - Ein grundlegendes Verständnis der Prinzipien der Digitalisierung und ihrer wichtigsten Anwendungen ist deshalb die Voraussetzung, um im Beruf und als Privatperson informierte Entscheidungen treffen zu können - ob es nun um Kryptowährungen, New Work oder den Schutz der eigenen Daten in sozialen Medien geht. In diesem Buch wird das Thema Digitalisierung anschaulich und unterhaltsam aufbereitet. Der Fokus liegt auf der fundierten und leicht verdaulichen Vermittlung der Grundlagen, die es Ihnen ermöglicht, nach der Lektüre eigenständig auf dem Laufenden zu bleiben und neue Entwicklungen mit ihren Konsequenzen zu verstehen und einzuordnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Allgemeinbildung Digitalisierung für Dummies
Schummelseite
BEGRIFFE UND KONZEPTE DER DIGITALISIERUNG
Hier lernen Sie ein paar wichtige Begriffe und Konzepte kennen, mit deren Hilfe Sie Sachbücher und Zeitungsartikel besser verstehen werden:
Was ist ein Algorithmus?
Ein Algorithmus ist eine Vorschrift, die aus klaren und voneinander abgrenzbaren Schritten besteht.
Ein Algorithmus für einen Computer kann zum Beispiel beschreiben, mit welchen Handlungsschritten bestimmte Arten von Daten verarbeitet werden. Aber es gibt auch Algorithmen in der physischen Welt: zum Beispiel Kochrezepte, auch wenn wir sie normalerweise nicht als Algorithmus bezeichnen.
Was ist maschinelles Lernen?
Beim maschinellen Lernen leitet der Computer aus Erfahrungen Wissen ab. Diese Erfahrungen kommen üblicherweise aus einem sogenannten Trainingsdatensatz. Das so trainierte Computerprogramm kann sein neu erworbenes Wissen dann auf neue Daten anwenden.
Was ist künstliche Intelligenz?
Man unterscheidet schwache und starke künstliche Intelligenz.
Eine schwache künstliche Intelligenz ist ein Programm, das komplexe, aber fest umrissene Probleme genauso gut wie oder besser als der Mensch lösen kann. Schwache künstliche Intelligenz beruht meist auf maschinellem Lernen. Beispiele sind Routenplaner und Navigationssysteme, Sprachassistenten oder Systeme zur Gesichtserkennung.
Eine starke künstliche Intelligenz ist in der Theorie ein digitales System, das sich wie ein Mensch flexibel an ganz unterschiedliche Anforderungen anpassen und diese intelligent lösen kann. Eine echte starke künstliche Intelligenz wurde in der Realität bisher nicht entwickelt.
Was ist Verschlüsselung?
Bei der Verschlüsselung wird eine Information mithilfe eines Schlüssels unleserlich gemacht. Wenn sie mit demselben Schlüssel wiederhergestellt werden kann, spricht man von symmetrischer Verschlüsselung; wenn man zur Wiederherstellung einen anderen Schlüssel braucht, handelt es sich um asymmetrische Verschlüsselung. Die Wissenschaft von der Verschlüsselung heißt Kryptografie.
Ein im Internet sehr wichtiges System der Verschlüsselung ist die Public-Key-Kryptografie, ein asymmetrisches System. Hierbei können Nachrichten mit einem Public Key (der öffentlich zugänglich sein darf) verschlüsselt und mit einem Private Key (den nur die berechtigte Person besitzen darf) wieder entschlüsselt werden. Auf einer Umkehrung dieses Prinzips beruht auch die digitale Signatur (die übrigens nichts mit einer eingescannten manuellen Unterschrift zu tun hat).
Was ist die Blockchain?
Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, also eine, die gleichzeitig auf vielen verschiedenen Computern gespeichert wird. In der Blockchain wird durch einen sogenannten Konsensmechanismus sichergestellt, dass alle Computer des Netzwerks stets den gleichen Stand der Blockchain als korrekt anerkennen. In anderen verteilten Datenbanken wird dies durch eine zentrale Verwaltung sichergestellt, in der Blockchain jedoch durch einen Algorithmus. Dies ist die Innovation der Blockchain.
Die Blockchain ist beispielsweise die technologische Basis von Kryptowährungen wie Bitcoin. Sie hat auch andere Anwendungsbereiche, ist jedoch herkömmlichen Datenbanken oft in Effizienz und Energieverbrauch unterlegen.
Was ist ein Quantencomputer?
Herkömmliche Computer arbeiten mit Bits. Dies sind die kleinsten Informationseinheiten, und jedes Bit hat den Wert 0 oder 1.
Quantencomputer dagegen arbeiten mit Qubits. Ein Qubit muss nicht, wie in einem herkömmlichen Computer, durch eine elektrische Schaltung hergestellt werden. Es entspricht stattdessen einem ganz realen Atom. Ein Qubit kann auch den Wert von 0 oder 1 haben, es kann jedoch auch beide Werte gleichzeitig annehmen. Diese Eigenschaft heißt Überlagerung. Außerdem können zwei miteinander verschränkte Qubits sich gegenseitig auch über große Entfernungen in ihren Zuständen beeinflussen. Dies heißt Verschränkung (und wurde einst von Albert Einstein als »spukhafte Fernwirkung« bezeichnet).
Was sind Virtual Reality und Augmented Reality?
In der Virtual Reality (VR) oder virtuellen Realität wird mithilfe von Bild und Ton und oft auch mit dem Tastsinn eine Parallelwelt geschaffen, in die der Nutzer eintreten kann. Das geschieht beispielsweise durch ein Headset, auch VR-Brille genannt, und Controller für die manuelle Interaktion mit dieser künstlichen Welt. Ziel ist es, die physische Welt in der Wahrnehmung des Nutzers komplett verschwinden zu lassen, sodass er Sinneseindrücke ausschließlich aus der virtuellen Welt bekommt.
In der Augmented Reality (AR) dagegen werden Elemente aus einer virtuellen Welt in die physische Realität eingeblendet. Dies kann ebenfalls mit einer dafür konstruierten Brille geschehen, die aber den Blick auf die reale Welt frei lässt. Andere Möglichkeiten sind etwa Head-up-Displays, die beispielsweise beim Autofahren ins Blickfeld projiziert werden, oder AR-Anwendungen auf Smartphones, wie etwa das Spiel Pokémon Go.
Was ist ein Roboter?
Mit dem Wort Roboter können sehr unterschiedliche Arten von Maschinen bezeichnet werden. In der Populärkultur stellt man sich unter einem Roboter oft eine menschenähnliche Maschine mit Kopf, Armen und Beinen vor. Eine solche wird in Fachkreisen als humanoider Roboter bezeichnet und kommt heutzutage beispielsweise zu Unterhaltungs- und Informationszwecken zum Einsatz.
Industrieroboter haben oft gar keine Ähnlichkeit mit humanoiden Robotern und bestehen beispielsweise nur aus einem Greifarm mit Basis.
Das US-amerikanische Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) versucht sich an einer allgemeinen Definition: »Ein Roboter ist eine autonome Maschine, die in der Lage ist, ihre Umgebung wahrzunehmen, Berechnungen durchzuführen und darauf aufbauende Entscheidungen zu treffen und Handlungen in der realen Welt durchzuführen.«
Was ist das Internet of Things?
Das Internet of Things (IoT) oder Internet der Dinge bezeichnet die Gesamtheit von Geräten im Alltagsleben und der Industrie, die miteinander vernetzt sind. Das Internet of Things wurde dadurch möglich, dass Computerchips immer kleiner und leistungsfähiger wurden und daher heutzutage auch in Alltagsgegenstände eingebaut werden können.
Wichtige Komponenten des Internet of Things sind Sensoren und Aktoren, mit denen Geräte ihre Umwelt wahrnehmen und beeinflussen können. So entstehen Regelkreise. Ein einfaches Beispiel für einen solchen Regelkreis ist ein Thermostat, der mit seinem Sensor die Raumtemperatur wahrnimmt und mit seinem Aktor die Heizung höher oder niedriger regelt. Im Internet of Things (hier: Smart Home) könnte dieser dann etwa noch mit dem Fensteröffner und dem Bewässerungssystem der Zimmerpflanzen vernetzt sein.
Was ist ein soziales Netzwerk?
Ein soziales Netzwerk ist eine Plattform im Internet, auf der Menschen auf verschiedene Art und Weise miteinander in Beziehung treten können: Verbindungen knüpfen und lösen, Nachrichten austauschen, eigene Inhalte oder solche aus anderen Quellen teilen, diese bewerten und darüber diskutieren und so weiter.
Die Begriffe »soziale Medien« und »soziale Netzwerke« werden häufig gleichbedeutend verwendet. Von sozialen Medien spricht man, wenn man eher die dort geteilten Inhalte betonen möchte, also Fotos, Videos und so weiter. Von sozialen Netzwerken spricht man, wenn es eher um die Verbindungen der Nutzerinnen und Nutzer untereinander geht.
Was ist New Work?
Der Begriff New Work stammt ursprünglich von dem deutsch-amerikanischen Philosophen Frithjof Bergmann. Dieser hatte vielfältige Lebenserfahrung sowohl im nationalsozialistischen Deutschland (aus dem er als Kind mit seinen Eltern geflohen war), in Österreich, den USA und auch im damaligen Ostblock gesammelt und verschiedene Berufe ausgeübt. Er stellte fest, dass sowohl die kommunistische als auch die kapitalistische Wirtschaftsordnung die Menschen nicht glücklich zu machen schienen. Daher entwarf er die Idee von New Work: Menschen sollten in die Lage versetzt werden, ihre Talente innerhalb ihrer Arbeit auszuleben. Das, so Bergmann, werde sie glücklich und produktiv machen.
Heutzutage wird New Work aber häufig als Oberbegriff der Veränderungen verwendet, die die Digitalisierung der Arbeitswelt gebracht hat – also Verzicht auf feste Arbeitsorte, flexible Arbeitszeitmodelle, wechselnde Arbeitsinhalte und so weiter. Diese stimmen zum Teil mit der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs überein, zum Teil auch nicht.
Was ist informationelle Selbstbestimmung?
Informationelle Selbstbestimmung ist das Recht eines Menschen, selbst über die Weitergabe und die Verwendung seiner persönlichen Informationen (im Datenschutzrecht sagt man auch, seiner personenbezogenen Daten) zu bestimmen. Der Begriff existiert seit dem sogenannten Volkszählungsurteil aus dem Jahre 1983.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht nicht ausdrücklich im Grundgesetz, wird aber von den Gerichten als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 2 des Grundgesetzes) verstanden.
Es gibt in anderen Ländern Konzepte, die dem der deutschen informationellen Selbstbestimmung sehr ähnlich sind, aber auch Länder, in denen das Verhältnis eines Menschen zu seinen persönlichen Daten ganz anders betrachtet wird.
Allgemeinbildung Digitalisierung für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Print ISBN: 978-3-527-71876-4ePub ISBN: 978-3-527-83446-4
Coverfoto: © Martinan – stock.adobe.comKorrektur: Frauke Wilkens, München
Über die Autorin
Dr. med. Christina Czeschik, M.Sc., ist Ärztin und Medizininformatikerin. Sie hat in der Medizin im Bereich der Elektro- und Neurophysiologie promoviert und ihr Masterstudium in der Medizininformatik mit einer Arbeit zu Machine Learning und Netzwerkanalyse abgeschlossen.
Nach Stationen in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen arbeitet sie heute im öffentlichen Gesundheitsdienst. Seit 2015 ist sie freie Autorin und schreibt über Digitalisierung, digitale Gesundheit, Informationssicherheit und digitale Privatsphäre, auch im Blog auf ihrer Webseite www.serapion.de. Unter dem Pseudonym Jo Koren schreibt sie Science-Fiction. Sie lebt im Ruhrgebiet.
Widmung
Meinen Kindern.
Danksagung
Dieses Buch wäre nicht entstanden ohne die vielen Gespräche auf Treffen und Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs und seines Umfelds, die ich in den letzten zehn Jahren geführt oder denen ich zugehört habe. Viele davon waren inspirierend, manche besorgniserregend, nicht wenige philosophisch und einige völlig unverständlich. Letztere waren vielleicht die wichtigsten, weil sie mich immer wieder in zuvor unbekanntes Territorium geführt haben. Alle Fehler und Ungenauigkeiten in diesem Buch gehen auf mein Konto, nicht das meiner Gesprächspartnerinnen und -partner.
Ich danke auch meinen Redakteurinnen und Redakteuren, Auftraggeberinnen und Auftraggebern der letzten Jahre, die mir immer wieder den Anstoß und die Gelegenheit gegeben haben, mich in neue Themen einzuarbeiten oder bekannte Themen in neuem Licht zu betrachten.
Meiner Lektorin bei Wiley-VCH, Andrea Baulig, danke ich für die Idee zu diesem Buch und die gute Betreuung bei seiner Entstehung.
Allen mir nahestehenden Menschen danke ich für ihr Verständnis für aufgeschobene Verabredungen, unkonzentrierte Telefonate und generelle Zerstreutheit. Vielleicht wird es beim nächsten Buch besser.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Widmung
Danksagung
Einführung
Törichte Annahmen über die Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Was heißt Digitalisierung?
Kapitel 1: Digitale Welt – was bringt uns das?
Die reale Welt in Zahlen abbilden
Informationen (fast) umsonst übermitteln und vervielfältigen
Informationen intelligent verarbeiten
Teil II: Daten und Algorithmen – die Welt als Einsen und Nullen
Kapitel 2: Wo wohnt Information?
Information existiert nur auf einem Träger
Vom Rauchzeichen zum Telegrafen
Eine gute Idee: Das Relais
Logisch: 1 ist NICHT 0
Ein Saal voller Flipflops
Hier können Sie Ihre Bits registrieren
Daten auf der Flucht
Ein Netzwerk für (fast) alles: Das Internet
Vom Internet zum World Wide Web
Kapitel 3: Algorithmen: Mit Daten Dinge tun
Kochrezepte für den Computer
Große Datenmengen: Mehr ist manchmal einfach mehr
So lernen Maschinen
Meine Geheimnisse gehören mir: Kryptografie
Kapitel 4: Computer mal anders: Quanten, DNA und andere
Ternäre Logik: Flip, Flap, Flop
Biologische Computer
Quantencomputer und die spukhafte Fernwirkung
Die Antwort ist 42: Deep Thought
Teil III: Digitalisierung zum Anfassen – Schnittstellen zur physischen Realität
Kapitel 5: Virtual und Augmented Reality
Virtuelle Realität: Eine Dimension mehr
Augmented Reality: Die bessere Realität
Kapitel 6: Internet of Things und Industrie 4.0
Sensoren und Aktoren: Wir regeln das
Kybernetik: Alles ist ein System
Das hilfreiche Zuhause
Cyber-Physical Systems: Maschinen im Internet
Kapitel 7: Robotik
Wie sehe ich aus? Design eines Roboters
Die Gesetze der Robotik
Kapitel 8: Nanotechnologie
Viel Spielraum nach unten
Maschinen auf Kohlenstoffbasis
Teil IV: Digitalisierung in Aktion – Anwendungsbereiche
Kapitel 9: Soziale Medien und Netzwerke
Smileys, Emoticons, Emojis
Die Geburt des Blogs
Vom Onlinetagebuch zum (We)Blog
Der Aufstieg von Facebook
Feeds, Likes und Dopamin
Nichts verpassen: Soziale Netzwerke unterwegs
Alte und neue soziale Netzwerke
Triff mich im Livestream
Werbung in sozialen Netzwerken
Soziale Netzwerke und Datenschutz
Dezentrale Netzwerke
Kapitel 10: Digitales Arbeiten und New Work
Homeoffice und mobiles Arbeiten
Digitale Nomaden
New Work oder gar kein Work?
Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)
Geld, kontrolliert von Algorithmen
Kapitel 11: E-Commerce, digitale Zahlungsmittel und Kryptowährungen
Der Siegeszug von Amazon und eBay
PayPal und die Kontensperrung
Kryptowährungen: Ohne Netz und doppelten Boden
Micropayments: Kleinvieh macht mehr Mist
Kapitel 12: Digitale Gesundheit
Wertvolles Gut: Gesundheitsdaten
Telematikinfrastruktur
Quantified Self: Wer bin ich – und wie kann ich das messen?
Wir sind Cyborgs
Schluss mit Wartezimmern?
Kapitel 13: Smarte Mobilität und autonomes Fahren
Wissen, wo es langgeht
Autonome Automobile
Teil V: Digitalisierung und wir – gesellschaftliche Auswirkungen
Kapitel 14: Informationelle Selbstbestimmung und Überwachung
Vom Volkszählungsgesetz zur Verfassungsbeschwerde
Bürger unter Beobachtung
Post Privacy: Nichts zu verbergen?
Bitte vergiss mich
Kapitel 15: Nudging und Bevormundung
Nicht schubsen!
Unter uns Denkfaulen
Lieber nichts verlieren als etwas gewinnen
Soziale Einflüsse und Normen
Falsche Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten
So geht Nudging
Kapitel 16: Digitale Bohème und digitales Prekariat
Selbst und ständig
Der Mensch als Automat
Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung
Kapitel 17: Informationsflut und ständige Erreichbarkeit
Ein Online-Brain für die digitale Welt
Nie wieder Langeweile?
Langeweile macht kreativ
Transaktionsgedächtnis: Wissen, wo was steht
Ihr Smartphone: Risiken und Nebenwirkungen
Kapitel 18: Digitale Helfer und Verlust zwischenmenschlicher Kontakte
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 19: Zehn hörenswerte Vorträge zur Digitalisierung
Hirne hacken: Menschliche Faktoren in der IT-Sicherheit
Ich sehe, also bin ich … Du
Embracing Post Privacy
Bias in Algorithmen
Digitale Entmündigung
Hold Steering Wheel! Autopilots and Autonomous Driving
Quantum Computing: Are we there yet?
Virtual Reality für Arme
Computer, Kunst und Kuriositäten
What the cyberoptimists got wrong – and what to do about it
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile von Kryptowährungen
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Unterschiede zwischen herkömmlichen Zahlungsdienstleistern (zum Be...
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Eine Rechenmaschine mit Holzperlen
Abbildung 2.2: Konstruktionszeichnung von Charles Babbages Analytical Engine aus...
Abbildung 2.3: Schnitt durch ein elektromagnetisches Relais mit offengelegter Sp...
Abbildung 2.4: Sie im Keller Ihrer Villa in Süditalien, DIAVOLO morsend
Abbildung 2.5: In Reihen angeordnete Sitze im Kino
Abbildung 2.6: Schaltzeichen für ein Flipflop
Abbildung 2.7: Vereinfachte Darstellung des TCP/IP-Schichtenmodells
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Eine »Wenn … dann … sonst«-Schleife in der russischen Programmier...
Abbildung 3.2: Datenpunkte der Fotos von Gurken (eckig) und Kirschen (rund)
Abbildung 3.3: Datenpunkte der Fotos von Gurken (eckig), Kirschen (rund) sowie v...
Abbildung 3.4: Berücksichtigte Nachbarn des unklassifizierten Objekts (Stern) fü...
Abbildung 3.5: Datenpunkte der Fotos von Gurken und Kirschen, wenn die Klassifik...
Abbildung 3.6: Aufbau einer Nervenzelle (Neuron)
Abbildung 3.7: Einfaches neuronales Netz mit nur einer Schicht, auch Perzeptron...
Abbildung 3.8: Neuronales Netz mit zwei Schichten
Abbildung 3.9: Kirschen
Abbildung 3.10: Gurken
Abbildung 3.11: Prinzip der Public-Key-Verschlüsselung
Abbildung 3.12: Kassenbuch (Hauptbuch) in der Buchhaltung
Abbildung 3.13: So gelangt eine Transaktion in einen Block in der Blockchain und...
Abbildung 3.14: Entwicklung des Bitcoin-Kurses
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Das Problem des Handlungsreisenden (Hamilton-Pfad)
Abbildung 4.2: Prinzip für die Lösung des Problems des Handlungsreisenden mit DN...
Abbildung 4.3: Ausschnitt aus einem Quantencomputer
Abbildung 4.4: Die vom Supercomputer Deep Thought berechnete Antwort »nach dem L...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Eine Landschaft in Pixel-Art
Abbildung 5.2: Eine (abstrakte) Landschaft in Voxel-Art
Abbildung 5.3: MRT-Bilder des Kopfes in verschiedenen Schnittebenen
Abbildung 5.4: Mit dem 3D-Drucker erzeugtes Modell eines Gehirns
Abbildung 5.5: In 3D gerenderte Treppen mit realistischem Schattenwurf
Abbildung 5.6: Oculus Rift
Abbildung 5.7: Sichtfeld des linken Auges, Sichtfeld des rechten Auges sowie zwe...
Abbildung 5.8: Head-up-Display im Auto (Illustration) mit Anzeige von Geschwindi...
Abbildung 5.9: Smartphone, auf dem Pokémon in der Umgebung angezeigt werden
Abbildung 5.10: Google Lens übersetzt die Beschriftung einer Tasse.
Abbildung 5.11: AR in der Logistik – hier in einem Lagerhaus
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Beispiele für Anwendungen im Smart Home
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Roboter aus dem Originaltheaterstück von Karel Čapek, 1929
Abbildung 7.2: Industrieroboter
Abbildung 7.3: Roboter Nao auf dem Spielfeld beim RoboCup
Abbildung 7.4: Kindchenschema am Beispiel eines Roboters mit großem Kopf, großen...
Abbildung 7.5: Gesellschaftliche Akzeptanz eines Roboters abhängig von der Ähnli...
Abbildung 7.6: Industrieroboter mit Sicherheitskäfig
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Rastersondenmikroskopie
Abbildung 8.2: Eine molekulare Maschine – die Proteinherstellung im Ribosom der...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Vorläufer der Smileys, scherzhaft vorgeschlagen für den Gebrauch ...
Abbildung 9.2: Einige der heute in sozialen Netzwerken und Messengern am häufigs...
Abbildung 9.3: Frühes Onlinetagebuch aus dem Jahr 1995
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Idealisierte Darstellung von einem Co-Working-Space
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Aufbau eines Cochlea-Implantats
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Sensoren der Einparkhilfe am Heck eines Autos
Abbildung 13.2: Konzept für einen autonomen Kleinbus, bei dem gar kein Platz für...
Abbildung 13.3: Unübersichtliche Verkehrssituation in einer Innenstadt
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
7
8
9
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
257
258
259
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Einführung
Wir Menschen sind ziemlich gut darin, Werkzeuge zu erfinden und zu benutzen, besser jedenfalls als unsere nächsten Verwandten im Tierreich. (Das macht unseren Verwandten das Leben ziemlich schwer, aber das wäre Stoff für ein anderes Buch.)
Auch der Computer war einst so ein Werkzeug: Menschen stellten fest, dass manche Probleme doch recht mühsam zu lösen waren, und entwarfen ein Ding, das ihnen Arbeit ersparen sollte.
Dieses Ding blieb dann auch für ein paar Jahrzehnte genau das: ein nützliches Werkzeug für bestimmte Arbeiten, das aber nicht besonders viel Auswirkung auf andere Lebensbereiche hatte. Wie auch? Der Computer wusste nichts von der komplexen Welt um ihn herum, sondern konnte nur sauber formulierte und eng umgrenzte Probleme für seine Anwender lösen, wenn auch zugegebenermaßen sehr effizient.
Allerdings gab es immer mal wieder Menschen, deren Intuition ihnen sagte, dass in den großen und schwerfälligen Computern der Anfangsjahre ein größeres, aufregenderes Potenzial schlummerte. Man müsste nur die komplexe Welt in den Computer bringen – vielleicht in viele kleine, berechenbare Probleme zerlegen, und dann würde der Computer alle diese Probleme für uns lösen.
Der Mensch selber, so die Idee, macht ja auch nichts anderes, als den lieben langen Tag kleine und größere Probleme zu verstehen und zu lösen. Im Gegensatz zum Menschen würde ein Computer aber weder von schlechter Laune noch von Müdigkeit oder Toilettenpausen abgelenkt.
So begann man nach und nach, die Probleme der Alltagswelt in die Sprache der Computer zu übersetzen. Gleichzeitig machte die unermüdliche technologische Weiterentwicklung die Computer leistungsfähiger, kleiner und billiger und somit vielseitiger einsetzbar.
Je leistungsfähiger die Computer wurden, desto mehr wurde klar: Sie nehmen uns zwar viel Arbeit ab, aber dafür entsteht für uns neuer Aufwand – der Aufwand, die unordentliche Welt um uns herum in die geordnete Sprache der Computer zu übersetzen. Schon im Jahr 1952 beschwerte sich die Computerpionierin Grace Hopper (von der Sie später noch mehr lesen werden) in einem Aufsatz darüber, was für »stumpfe Arbeit« das sei.
Eine mögliche Lösung: dem Computer beizubringen, seine komplexe Umwelt wie ein Mensch wahrzunehmen und zu verarbeiten. Aber trotz aller Bemühungen und Fortschritte bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind wir sogar heute von solchen wirklich intelligenten Maschinen noch weit entfernt.
Langsam keimte also die Einsicht: Wenn der Computer uns nicht entgegenkommt, müssen wir ihm entgegenkommen. In anderen Worten – um den Aufwand zu verringern, der bei der Übersetzung der realen Welt in das digitale Verständnis des Computers entsteht, muss die reale Welt sich an die digitale annähern.
Und schon sind wir in der Gegenwart angekommen. Computer helfen uns in praktisch allen Lebensbereichen – und weil wir diese Hilfe nicht mehr missen möchten, passen wir umgekehrt unser Leben an den Computer an.
Das ist die digitale Welt, und dieses Buch ist Ihr Reiseführer.
Törichte Annahmen über die Leser
Sie als Leserin oder Leser dieses Buches müssen keine technischen Vorkenntnisse mitbringen, um es zu verstehen, und schon gar keine Berufserfahrung in einem technologischen Feld.
Damit Sie den Ausführungen in diesem Buch folgen können und hoffentlich Spaß daran haben, ist es völlig ausreichend, wenn Sie mit wachen Augen durch die Welt von heute gehen.
Wenn das der Fall ist, haben Sie mit der einen oder anderen digitalen Anwendung, die in diesem Buch (vor allem in den Teilen III und IV) beschrieben wird, schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt: Sie schreiben beispielsweise E-Mails, nutzen ein soziales Netzwerk oder bezahlen Ihre Rechnungen im Onlinebanking. Keine dieser Erfahrungen ist wirklich Voraussetzung für das Verständnis dieses Buches, aber sie werden Ihnen helfen, sich in den Herausforderungen und Entwicklungen wiederzufinden, die in den jeweiligen Kapiteln beschrieben werden.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch besteht aus sechs Teilen. Jeder Teil ist auch für sich allein verständlich, Sie müssen das Buch also nicht von vorn bis hinten lesen.
Die Ausführungen in Teil II bauen aufeinander auf. Daher ist es sinnvoll, wenn Sie Teil II tatsächlich von vorn anfangen zu lesen.
Überall im Buch finden Sie auch Verweise auf andere Buchstellen, wenn diese zum Verständnis hilfreich sind.
Teil I: Was heißt Digitalisierung?
In Teil I bekommen Sie einen ersten Überblick über das Thema Digitalisierung. Was bedeutet der Begriff überhaupt, und warum beschäftigen wir uns damit?
Teil II: Daten und Algorithmen – die Welt als Einsen und Nullen
In diesem Teil werden die Grundlagen für den Rest des Buches gelegt. Hier geht es sozusagen um das Baumaterial der digitalen Welt: Daten, ausgedrückt im binären Zahlensystem. Wie können aus so etwas Einfachem so komplexe Anwendungen entstehen, wie sie uns heute umgeben?
Wenn Einsen und Nullen das Holz sind, aus dem die digitale Welt gebaut wird, dann sind Algorithmen Säge und Hammer – unverzichtbar, aber bei falschem Einsatz auch schädlich. Auch mit ihnen befassen wir uns in Teil II.
Schließlich bekommen Sie auch noch einen kurzen Überblick über Konzepte der Digitalisierung, die nicht nur auf Einsen und Nullen beruhen: von ternären über biologische bis hin zu Quantencomputern.
Teil III: Digitalisierung zum Anfassen – Schnittstellen zur physischen Realität
Computer stehen nicht nur auf dem Schreibtisch und denken für uns nach. Immer wichtiger werden auch die Möglichkeiten von Computern, die physische Umgebung direkt zu beeinflussen – etwa durch den Einsatz von Robotik – oder von ihr beeinflusst zu werden, etwa durch Sensoren im Internet der Dinge. Um diese Themen geht es in Teil III.
Teil IV: Digitalisierung in Aktion – Anwendungsbereiche
Die Digitalisierung durchdringt mittlerweile unser ganzes Leben. Alle ihre Anwendungsbereiche zu besprechen, würde jedes Buch sprengen (und Ihre Lesezeit auch). Daher steigen wir in Teil IV in einige ausgewählte Bereiche ein, die
durch die Digitalisierung neu geschaffen wurden – etwa digitale soziale Netzwerke;
in denen digitale Anwendungen mittlerweile besonders weit verbreitet sind – etwa im Zahlungsverkehr;
oder in denen durch die Digitalisierung besonders große Veränderungen passiert sind oder noch anstehen – wie etwa in der Gesundheitsversorgung oder in der Fortbewegung.
Teil V: Digitalisierung und wir – gesellschaftliche Auswirkungen
Für uns als Gesellschaft eröffnet die Digitalisierung neue Chancen, die aber zu Gefahren werden, wenn sie zu weit getrieben werden. In jedem dieser Spannungsfelder müssen wir entscheiden, wo wir uns platzieren wollen:
zwischen Privatsphäre und Vertraulichkeit und dem Teilen von Informationen bis hin zur Überwachung
zwischen sanfter Beeinflussung unserer täglichen Gewohnheiten und Bevormundung durch Akteure mit eigenen Interessen
zwischen Freiheit in der Arbeit und der Auflösung schützender Strukturen im Arbeitsleben
zwischen freier Verfügbarkeit von Information und ständiger Erreichbarkeit und Reizüberflutung
zwischen der Allgegenwart von digitalen Helfern und dem Verlust menschlicher Kontakte
Darum geht es in Teil V.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Mit diesem Teil schließen alle Bücher der … für Dummies-Reihe ab. In diesem hier finden Sie im Top-Ten-Teil zehn Empfehlungen von spannenden Vorträgen, die Sie als Aufzeichnungen im Netz abrufen können. Wenn Sie möchten, können diese für Sie ein Sprungbrett sein, um sich mit dem einen oder anderen Thema aus diesem Buch noch tiefer auseinanderzusetzen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Damit Sie sich besser zurechtfinden und wichtige Informationen gleich erkennen, sind bestimmte Texte in diesem Buch mit Symbolen gekennzeichnet:
Bei der Lupe finden Sie Definitionen von häufig verwendeten Begriffen.
Hier finden Sie Beispiele, die die Aussagen aus dem Haupttext mit Leben füllen.
Der Finger mit dem Faden markiert Infos und Hintergründe, die besonders wichtig oder interessant sind und die Sie sich vielleicht merken möchten.
Beim Techniker finden Sie Exkurse, die ein technisches Thema vertiefen, aber nicht unbedingt zum weiteren Verständnis des Textes notwendig sind.
Die Menschen hinter der Digitalisierung haben oft interessante Geschichten erlebt. Ein paar davon finden Sie in diesem Buch, gekennzeichnet mit dem Anekdotensymbol.
Mit diesem Symbol werden Sie vor gängigen Missverständnissen oder Fallgruben der digitalen Welt gewarnt.
Wie es weitergeht
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Buch? Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse [email protected]. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen!
Teil I
Was heißt Digitalisierung?
IN DIESEM TEIL …
… erfahren Sie, was digitale Informationen sind und was Digitalisierung bedeutet (und warum sie uns nützt).
… lernen Sie die Anfänge digitaler Technologien kennen und welchen Einfluss sie noch heute auf unsere Welt haben.
… bekommen Sie einen Überblick über die effiziente Verarbeitung, Übermittlung und Analyse von digitalen Informationen.
Kapitel 1
Digitale Welt – was bringt uns das?
IN DIESEM KAPITEL
Probleme, die durch Digitalisierung gelöst werden können
Definition von digital und Digitalisierung
Warum digitale Abbilder unvollständig sind, und warum das (meistens) nicht schlimm ist
Was man mit digitalen Informationen machen kann und mit analogen nicht
Wir modernen Menschen sind seit ungefähr 300.000 Jahren auf dem Planeten Erde unterwegs. Wir werden geboren, verlieben uns, pflanzen uns fort, führen Kriege gegeneinander, werden krank und wieder gesund und verdienen auf die eine oder andere Art und Weise unseren Lebensunterhalt.
Dabei mussten und müssen unsere Vorfahren und Zeitgenossinnen sich vor allem mit einer Tatsache abfinden:
Das Leben ist mühsam.
Unsere Existenz ist eine Aneinanderreihung von Umwegen, Unfällen und Straßenverkehrsämtern, die fünf Minuten vor unserem Eintreffen schließen (während wir noch einen Parkplatz suchen).
Viele der Probleme, die uns im täglichen Leben begegnen, lassen sich einer von zwei Ursachen zuordnen:
Uns fehlt hier und jetzt eine Information, die an einem anderen Ort vorhanden ist.
Wir müssen uns mit etwas beschäftigen, wozu wir zu wenig Ressourcen haben – oder einfach keine Lust.
In anderen Worten, wir suchen nach mehr Effizienz: Die Mühe, die wir aufwenden, soll zu einem möglichst guten und angenehmen Leben führen.
Effizienz bedeutet unter anderem, nicht notwendige Dinge einzusparen.
Sie möchten Ihrer Freundin drei Straßen weiter mitteilen, dass Sie sich das Buch »Mediterrane Küche für Dummies« zu Weihnachten wünschen.
Wenn Sie sie zu Fuß besuchen, um ihr die Nachricht zu überbringen, dann verbrauchen Sie damit Zeit und Energie, um Ihren Körper dorthin zu bewegen – überflüssigerweise. Sie benötigt ja nur die reine Information und nicht Ihre körperliche Anwesenheit (es sei denn, sie wollte Ihnen bei der Gelegenheit auch gleich die Haare schneiden).
Schneller und mit weniger Energieaufwand teilen Sie ihr per Kurznachricht auf dem Handy mit: »Mediterrane Küche für Dummies wäre toll. Nie wieder angebrannte Lasagne!«
Ziel ist also, den in Ihrem Kopf existierenden Wunsch nach »Mediterrane Küche für Dummies« so effizient wie möglich zu übermitteln. Dazu muss die Information allerdings zuerst in einer Form vorliegen, die die elektronische Übertragung in Computernetzwerken erlaubt.
Die Wörter »Daten« und »Information« sind uns im Alltag so geläufig, dass jeder von uns wohl eine ungefähre Vorstellung davon hat, was sie bedeuten.
Da wir in diesem Buch jedoch sehr viel von »Daten« und »Information« sprechen und ihnen ganz genau auf den Grund gehen werden, ist es wichtig, diese Begriffe einmal so gut es geht zu definieren.
Das Wort »Daten« ist ursprünglich die Mehrzahl von »Datum«, und dieses wiederum bedeutet auf Latein »das Gegebene«. Es gibt keine fachübergreifend anerkannte Definition von »Daten«, aber die International Organization for Standardization (ISO) definiert sie als »wieder interpretierbare Darstellung von Informationen in formalisierter Art«. Diese Definition ist für das Buch, das Sie hier gerade lesen, ganz brauchbar.
Das Wort »Information« kommt vom lateinischen »informatio«, das einerseits »Vorstellung« oder »Begriff« bedeutet, andererseits auch »Erläuterung« oder »Unterweisung«. Die Definitionen des Begriffs »Information«, die in verschiedenen Wissenschaften verwendet werden, sind noch vielfältiger als die des Begriffs »Daten«. Für unsere Zwecke können wir aber die einfache Definition verwenden, dass Informationen Daten sind, die miteinander in Zusammenhang gebracht werden, sodass sie einen Nutzwert haben. Da ein Zusammenhang oder Kontext von einem Beobachter abhängig ist, können Daten also einfach so herumliegen, aber Informationen gibt es nur dort, wo jemand sie zur Kenntnis nimmt.
Und schließlich gibt es auch noch Wissen: Das sind Informationen, die miteinander so in Zusammenhang stehen, dass ein menschlicher Akteur sie nutzen kann, um Entscheidungen zu treffen oder Pläne zu formulieren.
Nebenbei: Weil »Datum« im Alltagsgebrauch meistens nur noch im Sinne eines bestimmten Tages im Kalender verwendet wird, spricht man von »Daten« im hier beschriebenen Sinn normalerweise nur in der Mehrzahl. Es wäre aber auch korrekt, von einem einzelnen »Datum« zu sprechen, wenn die Verwechslung mit einem Kalendertermin ausgeschlossen ist.
Nach dieser Begriffsklärung wissen wir, wovon wir sprechen, wenn es um Daten und Informationen geht. Dabei müssen wir beim Unterschied zwischen Daten und Informationen nicht übermäßig pingelig sein: Digitale Daten, die für einen Beobachter oder Nutzer relevant und sinnvoll sind, sind Informationen und bleiben trotzdem Daten. Daher werden beide Begriffe hier auch manchmal synonym verwendet.
Auf Seite 125 des Buches »Mediterrane Küche für Dummies« steht die Angabe »180° C Umluft«. Das ist ein Datum.
Im Lasagne-Rezept steht »Die Lasagne bei 180° C Umluft 30 bis 40 min überbacken«. Das ist eine Information.
Sie haben bemerkt, dass an Ihrem Ofen die Umluftfunktion kaputt ist und Sie mit Ober- und Unterhitze backen müssen. Daher müssen Sie den Ofen auf 200° C statt 180° C einstellen und ihn vor dem Backen vorheizen. Das ist Wissen.
Die reale Welt in Zahlen abbilden
Die Übertragung von Informationen über Computernetzwerke ist bis heute die effizienteste und am vielseitigsten einsetzbare, die uns zur Verfügung steht.
Damit Information von Computern verarbeitet und übertragen werden kann, muss sie als Folge von Einsen und Nullen ausgedrückt werden. Anders gesagt: Als Abfolge von »An«- und »Aus«-Zuständen, wobei 1 für An und 0 für Aus steht. Diese Eigenschaft nennt man binär.
Auch wenn man dies modernen Apps nicht mehr ansieht, beruhen alle heutigen Computer und ihre Anwendungen immer noch auf dem Prinzip des Binärcomputers. Dieser wurde in den 1930er- und 1940er-Jahren erfunden und seither weiterentwickelt.
Den ersten bekannten Binärcomputer baute der Ingenieurstudent Konrad Zuse um 1935 herum in Berlin-Kreuzberg, im Wohnzimmer seiner Eltern.
Nach eigener Aussage wollte er eine Maschine bauen, die ihm das Rechnen abnehmen sollte – weil er selbst zu faul dazu war. Er begründete damit eine Tradition, die bis heute überdauert: Viele nützliche digitale Technologien stammen von Leuten, die zu faul waren, um Dinge von Hand zu erledigen.
Grundlage für die heutigen Computer sind allerdings nicht die Rechenmaschinen Z1 bis Z4 von Konrad Zuse, sondern die Architektur, die John von Neumann wenige Jahre später in den USA entwickelte.
Bei Zuses Rechnern war das Programm nicht im selben Speicher wie die Daten abgelegt, sondern auf einem unveränderlichen Filmstreifen. Bei von Neumanns Architektur liegen dagegen Daten und Programm im gleichen Speicher, sodass die Befehlsabfolge auch während der Laufzeit geändert werden kann.
Wie bei vielen erfolgreichen Erfindungen streiten Fachleute sich übrigens bis heute darüber, wer der eigentliche Erfinder war und wer die wichtigsten Beiträge zur Entwicklung des Computers geleistet hat. Halten wir einfach fest, dass die heutige Computertechnologie das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Leistung vieler (größtenteils fauler) Menschen ist.
Wenn Informationen aus der realen Welt (man spricht auch von analog vorliegenden Informationen) mit dem Computer verarbeitet werden sollen, müssen sie also in Zahlenwerten abgebildet werden. Dieser Vorgang ist die Digitalisierung.
Digitale Informationen sind solche, die als Zahlenwerte ausgedrückt werden können. Digitalisierung bedeutet, digitale Abbilder von analog vorliegenden Informationen oder von real existierenden Objekten zu schaffen.
Was heißt eigentlich »digital«?
Das deutsche Wort »digital« geht auf das lateinische »digitus« zurück – das bedeutet »Finger«. Diese alte Bedeutung von »digital« hat sich in der Medizin noch erhalten. Da kann eine digitale Untersuchung auch eine sein, die man mit dem Finger durchführt.
In Bezug auf Informationen und Objekte bedeutet digital aber, dass man sie durch Zahlen darstellen kann – also durch etwas, das man an den Fingern abzählen kann (siehe auch das englische Wort »digit« für »Ziffer«).
Digitale Abbilder sind unvollständig
Digitale Abbilder sind meist weniger komplex als die Objekte, die ihnen zugrunde liegen. Anders gesagt: Die Realität kann nur unvollständig abgebildet werden. Wenn Sie etwa, wie im obigen Beispiel, Ihrer Freundin Ihren Weihnachtswunsch per Textnachricht mitteilen, dann werden Informationen eingespart.
Bei einem persönlichen Besuch hätte Ihre Freundin womöglich noch viele weitere verbale, aber sicherlich auch nonverbale Signale von Ihnen erhalten: Dass Sie heiser sind und Ihre Nase läuft, dass Ihre Jacke feucht ist, weil es auf dem Weg geschneit hat, dass Sie nach verbrannter Lasagne riechen …
Dieser Verlust an Informationen ist eine der wichtigsten Begleiterscheinungen der Digitalisierung, die auch gesellschaftliche Konsequenzen hat. Über gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung schreibe ich in Teil V dieses Buches ausführlicher.
… dürfen es aber auch sein
Diese Unvollständigkeit von digitalen Informationen dient aber auch der Effizienz: Die reale Welt ist voll von Informationen, die für uns keine Rolle spielen. Manche davon waren für Menschen für den größten Teil ihrer Geschichte unter fast keinen denkbaren Umständen relevant, wie etwa das Magnetfeld der Erde. Daher haben wir keine Fähigkeiten entwickelt, um diese wahrzunehmen.
Bei den Informationen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, ist unser Nervensystem ständig damit beschäftigt, Relevantes von Irrelevantem zu trennen. Im besten Fall gelangt nur das Relevante in unser Bewusstsein – aber das klappt auch nicht immer.
Haben Sie schon einmal versucht, ein wichtiges Telefongespräch oder eine Videokonferenz zu führen, während nebenan zwei Kollegen die neueste Schlagzeile diskutieren oder Ihre Kinder sich zanken? Dann wissen Sie, dass (jedenfalls für den Moment) irrelevante Informationen ganz schön viel geistige Bandbreite fressen können.
Die Digitalisierung von Informationen birgt also auch die Chance, Irrelevantes einzusparen. Wenn Sie digital an einer Besprechung teilnehmen – also als Videokonferenz –, dann sehen die anderen Teilnehmerinnen nicht, was Sie für eine Hose anhaben, und sie riechen auch nicht, welches Duschgel Sie am Morgen benutzt haben. Diese Informationen spielen im Kontext der morgendlichen Videokonferenz aber auch keine Rolle. Das digitale Abbild Ihres wirklichen Selbst kann sich verbal zu den Fragen Ihrer Kollegen äußern und vielleicht noch ein paar Informationen durch Mimik vermitteln – das reicht.
Digitale Abbilder der Welt
Übrigens: Wenn wir hier von real existierenden Objekten auf der einen Seite und digitalen Abbildern auf der anderen Seite sprechen, heißt das natürlich nicht, dass die digitalen Informationen nicht real sind. Sie sind ja in der gleichen physischen Welt gespeichert, in der wir und die Dinge um uns herum existieren.
Es ist aber für unseren Verstand anschaulicher, wenn wir digitale Informationen als Abbilder der Welt um uns herum betrachten. Digitale Informationsverarbeitung ist sehr abstrakt, und seit sie existiert, bemühen Menschen sich, sie begreifbarer zu machen. Daher verschieben wir auf unserem (digitalen) Desktop Dokumente in den Papierkorb, obwohl wir in Wirklichkeit weder etwas schieben noch einen Desktop, Dokumente oder einen Papierkorb vor uns haben.
Informationen (fast) umsonst übermitteln und vervielfältigen
Wenn die Digitalisierung von Informationen erst einmal geschafft ist, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten:
Digitale Informationen können mit sehr viel weniger Energieaufwand als analoge Informationen verschickt werden und damit von überall aus zugänglich werden.
Digitale Informationen können auch – ebenfalls mit sehr viel weniger Energieaufwand – beliebig vervielfältigt werden.
Das löst das erste Problem, das unseren Alltag oft so umständlich macht: Dass uns Information nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung steht.
Bevor es Navis gab, war es leicht, sich mit dem Auto in einer fremden Stadt zu verfahren. Das Problem: Die Informationen über das Straßennetz waren zwar vorhanden, aber zu Hause im Atlas – oder im Stadtplan im Handschuhfach, also während des Fahrens unerreichbar.
Dienste wie OpenStreetMap, Google Maps und Apple Maps können dieses Problem lösen, weil ihnen die Informationen über das Straßennetz digital zur Verfügung stehen und sie sie digital verarbeiten und reibungslos an das Smartphone der Autofahrerin übermitteln können.
Und manche Informationen, die früher schon zur Verfügung standen, aber zu einem hohen Preis, werden durch die einfache digitale Übermittlung und Vervielfältigung erst erschwinglich.
Eine Reihe von berühmten Museen wie das Rijksmuseum in Amsterdam, das Pergamon-Museum in Berlin und die Uffizien in Florenz bieten kostenlose virtuelle Touren an. Hier spart man bei einer Teilnahme nicht nur die Eintrittsgebühren, sondern vor allem die Kosten und den Zeitaufwand der Anreise nach Amsterdam, Berlin beziehungsweise Florenz.
Videostreaming-Dienste wie Netflix oder Prime Video von Amazon bieten Tausende von Filmen und Serien für eine Monatsgebühr, die zu Zeiten der Videotheken gerade mal für zwei bis drei VHS-Kassetten gereicht hätte.
Informationen intelligent verarbeiten
Aber das ist noch nicht alles: Wenn Informationen erst mal digital vorliegen, dann können sie auch automatisiert verarbeitet werden. Damit löst sich das zweite Problem, das unseren Alltag mühsam macht: Es nimmt uns Arbeit ab, die vorher nur von Menschen erledigt werden konnte.
Digitale Daten können automatisiert verarbeitet werden und nehmen Menschen damit langweilige, repetitive Arbeit ab.
Sie können auch mit Verfahren verarbeitet werden, die zu Ergebnissen kommen, die dem menschlichen Verstand gar nicht zugänglich gewesen wären – etwa weil die Datenmengen zu groß sind.
Das sind die Verfahren des Machine Learning und der künstlichen Intelligenz, von denen Sie später in diesem Buch noch lesen werden.
Einen fundierten Einstieg in das Thema künstliche Intelligenz bietet »Künstliche Intelligenz für Dummies« von Ralf Otte.
Teil II
Daten und Algorithmen – die Welt als Einsen und Nullen
IN DIESEM TEIL …
… lernen Sie, mit welchen Technologien früher und heute Informationen gespeichert und übermittelt wurden.
… warum Computer heutzutage mit Einsen und Nullen rechnen.
… wie das Internet funktioniert.
… was ein Algorithmus ist und welche Algorithmen uns innerhalb und außerhalb von Computern begegnen.
… was Machine Learning, künstliche Intelligenz, Verschlüsselung und die Blockchain-Technologie sind.
Kapitel 2
Wo wohnt Information?
IN DIESEM KAPITEL
Wie und womit man Information festhalten kann
Wie die Träger von Information sich von mechanischen zu elektronischen weiterentwickelt haben
In Teil I haben Sie gesehen, dass Dinge und Abläufe der realen Welt in Computern abgebildet werden können. Computer sind dabei nicht nur Desktoprechner oder Laptops, die irgendwo herumstehen, sondern alle Geräte, die mit Rechenchips ausgestattet sind. Die Abbildungen der realen Welt im Computer sind digitale Daten oder, wenn sie miteinander in Zusammenhang stehen, digitale Informationen.
Kurz gesagt:
Digitale Informationen sind solche, die man als Abfolge von Zahlen darstellen kann.
Digitalisierung ist die Umwandlung von nichtdigitalen in digitale Informationen.
Bei der Digitalisierung gehen fast immer Teile der Information verloren. Daher versucht man, Verfahren zur Digitalisierung so zu gestalten, dass nur unwichtige Anteile verloren gehen und alles für den Empfänger Relevante erhalten bleibt.
Der Vorteil von digital vorliegenden Informationen ist, dass man sie effizienter übermitteln und automatisiert mit Computern verarbeiten kann.
Als Sie nach Hause kommen, finden Sie eine Karte Ihres Paketboten im Briefkasten vor. Er hat sie nicht angetroffen und Ihr Paket in die Postfiliale gebracht. Auf der Karte ist handschriftlich eingetragen, dass Sie das Paket am nächsten Tag ab 14 Uhr in der Filiale abholen können.
Sie öffnen daraufhin die Kalender-App auf Ihrem Handy und tragen sich eine Erinnerung für den nächsten Tag um 14 Uhr ein. Sie haben die Information von der Karte damit digitalisiert. Die Kalender-App kann sie speichern und automatisiert verarbeiten: beispielsweise um 13:45 Uhr einen Alarmton abspielen, um Sie daran zu erinnern, dass Sie gleich Ihr Paket abholen können.
Es sind bei diesem Vorgang auch Informationen verloren gegangen: beispielsweise dass der Paketbote einen blauen Kugelschreiber verwendet und eine schwungvolle Handschrift hat.
Die Qualität eines Digitalisierungsverfahrens muss sich also daran messen lassen, wie viele relevante Informationen dabei verloren gehen: je weniger, desto besser.
Wenn Sie Ihre Lasagne aus dem Ofen holen, riechen Sie ein komplexes Aroma, das aus vielen einzelnen Geruchsstoffen zusammengesetzt ist. Die Geruchsstoffe sind kleine Moleküle, die an die Riechzellen Ihrer Nase andocken. Wenn beispielsweise Vinyldithiin an eine Ihrer Riechzellen bindet, empfinden Sie einen an Knoblauch erinnernden Geruch.
Auch ein Geruch lässt sich digitalisieren. Hierzu hat etwa die im Silicon Valley ansässige Firma Aromyx den EssenceChip entwickelt. Auch andere Unternehmen arbeiten an Riechchips. Da aber die Vielfalt der menschlichen Geruchsrezeptoren noch gar nicht vollständig bekannt ist, geht bei jeder Digitalisierung von Geruch sehr viel relevante Information verloren.
Je nachdem, wie fein Ihre Nase ist und wie schnell die Entwicklung von Riechchips voranschreitet, werden Sie wahrscheinlich niemals in Ihrem Leben einen künstlich erzeugten Geruch wahrnehmen, der exakt so ist wie der Duft der Lasagne in Ihrer Küche.
Information existiert nur auf einem Träger
Wie Sie an diesen beiden Beispielen (und den Beispielen aus Teil I) schon sehen, kann Information nicht im luftleeren Raum existieren – sie muss immer an einen Träger gebunden sein.
Im ersten Beispiel war das die Postkarte vom Paketboten beziehungsweise der Speicher Ihres Smartphones mit der Kalender-App. Im zweiten Beispiel sind die kleinen, in der Luft schwebenden Moleküle die Träger der Geruchsinformation – oder der digitale Speicher, in dem Geruchsinformationen des Riechchips abgelegt werden.
Digitale Informationen unterscheiden sich von analogen dadurch, dass sie als Zahlenfolgen ausgedrückt werden können. Der Träger von digitalen Informationen muss also irgendetwas sein, in dem man Zahlenfolgen so festhalten kann, dass man sie zu irgendeinem späteren Zeitpunkt wieder ablesen kann.
Hebel, Walzen, Rechenschieber
Das geht auch mechanisch: Sie kennen bestimmt die bunten Rechenschieber, mit denen Kinder in der Grundschule das Addieren und Subtrahieren lernen. Auf jedem Holzstab sind zehn Holzperlen aufgereiht (siehe Abbildung 2.1).
Abbildung 2.1: Eine Rechenmaschine mit Holzperlen
Auch mit diesem Rechenschieber könnten Sie eine digitale Information festhalten. Wenn wir noch mal die Benachrichtigung des Paketboten aus dem obigen Beispiel nehmen: Sie könnten auf dem Rechenschieber 14 Perlen nach links schieben und alle anderen Perlen nach rechts, um die Information festzuhalten, dass Sie um 14 Uhr an der Postfiliale sein sollen.
Sie könnten sich sogar ein System ausdenken, mit dem Sie die Adresse der Postfiliale mit der Anordnung der Perlen auf dem Rechenschieber codieren.
Eine viel komplexere mechanische Rechenmaschine konstruierte der englische Mathematiker Charles Babbage in den 1830er-Jahren, die Analytical Engine (siehe Abbildung 2.2).
Die Analytical Engine und ihr Vorläufer, die Difference Engine, hatten einen Speicher, der komplett aus aufgestapelten Zahnrädern bestand. Diese waren mit Zahlen von 0 bis 9 beschriftet – es handelte sich also um eine Rechenmaschine, die im Dezimalsystem arbeitete.
Die Programme für diese Maschine wurden auf