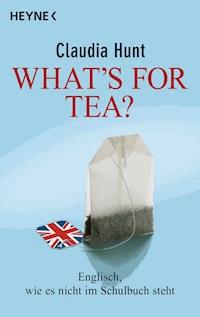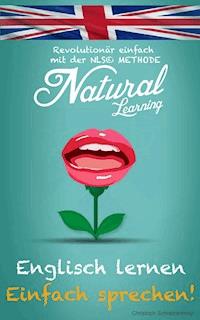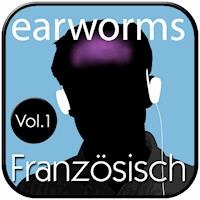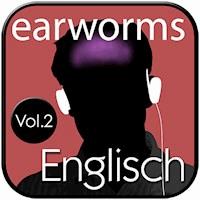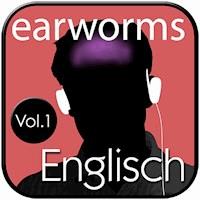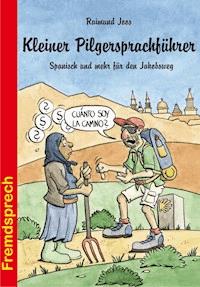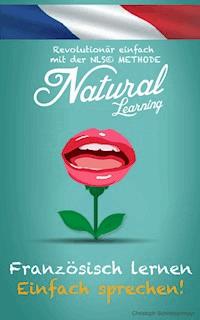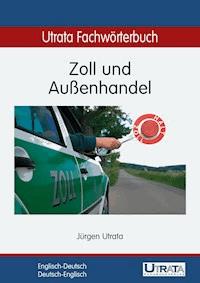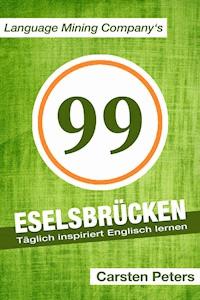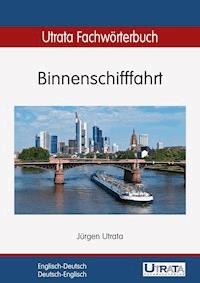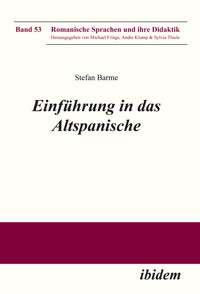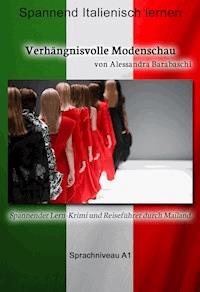32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Sprache: Deutsch
Gegenstand dieser Studie sind die allgemeinsprachlichen Fehler von Lernenden der französischen Rechtssprache im Hochschulkontext: Welche allgemeinsprachlichen Sprachschwierigkeiten bringen die Lernenden in den fachsprachlichen Unterricht mit, die im fachsprachlichen Unterrichtscurriculum berücksichtigt werden sollten? Anne Jeannin untersuchte eine Stichprobe von Klausuren mit der Methode der Fehleranalyse. Die Studie situiert sich an der Kreuzung zwischen (Fehler-)Linguistik, Fachsprachenforschung sowie nah an der fachspachlichen Fehlerlinguistik. Die forschungsinterne Relevanz der Arbeit wird auch durch die noch immer hochaktuelle Feststellung von Hans Fluck aus dem Jahre 1992 deutlich: „Es fällt auf, daß lediglich die Wirtschaftssprache der gängigsten Fremdsprachen fehlerlinguistisch bereits einigermaßen erfaßt worden ist; Studien zu den Fehlern in verschiedenen Fächern […] stellen derzeit das vielleicht dringendste Desideratum einer fachsprachlichen Fehlerlinguistik dar.“ Fluck beklagte Defizite bei der Fehleranalyse im fachsprachlichen Unterricht – mit diesem Buch unternimmt Jeannin den Versuch, auf die Beseitigung dieser Defizite hinzuarbeiten. Sie arbeitet sieben Fehlerkategorien heraus, die nach quantitativer deskriptiv-statistischer Auswertung besonders repräsentiert sind und deren qualitative Untersuchung die zehn fachsprachlich merkmalarmen Grundregeln ergibt, denen (nicht nur) der Francais-juridique-Unterricht Beachtung schenken sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Prämisse der Arbeit – Intention
1.2. Vorstellung des Forschungsgegenstands
1.3. Das français juridique und sein Vermittlungskontext
1.3.1. Bildungspolitik: Der institutionelle Rahmen der französischen Rechtssprache
1.3.2. Die Geografie des français juridique
1.3.3. Die Akteure des français juridique
1.3.3.1. Die Lernenden
1.3.3.2. Die Lehrenden
1.3.4. Die Inhalte in den français juridique-Kursen
2. Überlegungen zum Norm- und Fehler-Konzept
2.1. Die Schwierigkeit einer Normdefinition
2.1.1. System und Norm
2.1.1.1. Dogmatismus vs. Laxheit
2.1.2. Stilnorm und usage
2.1.3. Zwischen Objektivität und Intuition: der native speaker als Maßstab?
2.1.3.1. Regelwerk und Muttersprachler-Kompetenz
2.2. Der Fehlerbegriff und seine Problematik
2.2.1. Der Fehler als Verstoß gegen das Sprachsystem
2.2.1.1. Verstoß gegen Regeladäquanz und Akzeptabilität
2.2.1.2. Verstoß gegen usage und Situationsadäquanz
2.2.2. Der Fehler als Normabweichung
2.2.2.1. Fehlergraduierungen vs. Richtig-Falsch-Urteile
2.2.2.2. Verletzung der Wohlgeformtheit
2.2.2.3. Zielsprache und Sekundärsprache
2.2.3. Der Fehler als Lernchance
2.3. Fehler und Fachsprache
2.3.1. Die Sprache des Rechts
2.3.1.1. Der juristische Wortschatz
2.3.2. Allgemein- und Fachsprache
2.3.3. Der fachsprachliche Fehler
2.3.3.1. Fazit
3. Die Methode der Fehleranalyse
3.0. Kurze Geschichte der Fehleranalyse
3.1. Ziele und Analyseprozesse
3.2. Fehlererhebung
3.2.1. Beschaffung authentischer Daten und Eingrenzung der Materialgrundlage
3.2.2. Konkrete Datenerhebung und Stichprobenbeschreibung
3.2.3. Methodik
3.3. Fehleridentifikation
3.3.1. Subjektivität und (relative) Objektivierung der Fehleridentifikation
3.3.2. Rekonstruktion der Aussageintention
3.4. Fehlerbeschreibung und –klassifizierung
3.4.1. Die Schwierigkeiten der linguistischen Fehlerbeschreibung
3.4.2. Klassifizierungsraster
3.4.2.1. Klassifizierungsraster nach Fehse et al. (1977)
3.4.2.2. Raster nach Götze, Grimm & Gutenberg (2006)
3.4.3. Eigene Zusammenstellung
3.4.3.1. Valenzfehler
3.4.3.2. Ergänzung des phonographemischen und lexikalischen Bereichs
3.4.3.3. Ergänzung aus der surface strategy taxonomy
3.4.3.4. Klassifikation und Typologie
3.4.3.5. Vorstudie
3.4.3.6. Das Problem der mehrfachen Merkmalzuordnung
3.4.3.7. Götzes Methodologie
3.5. Fehlererklärung
3.5.1. Psycholinguale Fehlerquellen
3.5.2. Interlinguale Fehler
3.5.3. Intralinguale Fehler
3.5.4. Plurikausalität von Fehlern
3.6. Fehlerbewertung
3.7. Fehlertherapie
3.8. Rückblick
4. Empirische Studie: Untersuchung der Stichprobe und Auswertung der Daten
4.1. Quantitative Darlegung der Fehlerfrequenz
4.1.1. Eingrenzung der untersuchten Fehleranzahl: Identifizierung der Fehler und Fachsprachlichkeit
4.1.2. Darlegung der quantitativen Ergebnisse
4.1.3. Gesamtergebnis der primären Fehlerkategorie
4.1.4. Gesamtergebnis der alternativen Fehlerkategorie
4.2. Qualitative Darlegung der Datenergebnisse im phonographemischen Bereich
4.2.1. PHON/Substitution: Veränderung der Lautmorphologie
4.2.1.1. Änderung der lautlichen Morphologie aufgrund orthographischer Fehler
4.2.1.1.1. Änderung der lautlichen Morphologie aufgrund von accent-Fehlern
4.2.1.1.1.1. Accent-Addition
4.2.1.1.1.2. Accent-Omission
4.2.1.1.1.3. Accent-Substitution
4.2.1.1.2. Änderung der lautlichen Morphologie aufgrund einer cédille-Omission
4.2.1.1.3. Änderung der lautlichen Morphologie aufgrund einer Buchstaben-Modifikation
4.2.1.1.3.1. Buchstaben-Addition
4.2.1.1.3.2. Buchstaben-Omission
4.2.1.1.3.3. Buchstaben-Substitution
4.2.1.2. Änderung der lautlichen Morphologie aufgrund fehlerhafter Bildung
4.2.2. ORTHOAcc: accent-Fehler
4.2.2.1. ORTHOAcc/Omission
4.2.2.2. ORTHOAcc/Addition
4.3. Qualitative Darlegung der Datenergebnisse im lexikalischen Bereich
4.3.3. à/de
4.3.3.1. à statt de
4.3.3.2. de statt à
4.3.4. dans
4.3.4.1. à statt dans / dans statt à
4.3.4.2. en statt dans / dans statt en
4.3.4.3. dans statt de und sur
4.3.5. avec / de / en / à cause de statt par - par statt de / à / dans / en
4.3.6. pour
4.3.6.1. pour statt dans / de /en / pendant / à
4.3.6.2. à / de / sur statt pour
4.3.7. sur
4.3.7.1. sur statt de / à
4.3.7.2. de / à statt sur
4.3.8. Sonstige Präpositionenwahlfehler
4.3.9. Locutions prépositives
4.3.10. Fazit
4.4. Qualitative Darlegung der Datenergebnisse im morphosyntaktischen Bereich
4.4.1.1. SUBST/KongruenzG
4.4.1.1.2. Maskulin statt feminin
4.4.1.2. ADJ/KongruenzG
4.4.1.2.1. Participe passé employé comme adjectif
4.4.1.2.2. Adjectifs possessifs, démonstratifs, interrogatifs et indéfinis
4.4.1.2.3. „Reine“ Adjektive
4.4.2. Syntaktischer Bereich: Komma-Auslassungsfehler (INTERPKomma/Omission)
4.4.2.1. Koordination
4.4.2.1.1. Wortaufzählungen
4.4.2.1.2. Syntagmenaufzählungen
4.4.2.1.3. Nebensatzaufzählungen
4.4.2.1.4. Koordination mit anderen Konjunktionen als et, ou, ni
4.4.2.2. Subordination
4.4.2.2.1. Die Apposition
4.4.2.2.2. Der explikative Relativsatz
4.4.2.2.3 Parataktische und korrelative Satzteile
4.4.2.3. Wortgruppen in syntaktisch ungewöhnlichen Stellungen
4.4.2.3.1. Adverbialbestimmungen
4.4.2.3.1.1. Am Satzanfang
4.4.2.3.1.2. Zwischen zwei Satzkonstituenten
4.4.2.3.2. Die Phrase segmentée
4.4.2.3.3. „Ce que …, c’est…“
4.4.2.3.4. Mit dem Verb oder Substantiv verbundene Wortgruppen am Satzanfang
4.4.2.4 Freie Satzteile
4.4.2.4.1 Die Proposition incidente
4.4.2.4.2 Mit dem Satz syntaktisch absolut unverbundene Konstrukte
4.4.2.5. Ellipse
4.4.3. Ausblick
4.4.4. Schlusswort
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang 1: komplette tabellarische Stichprobendarstellung
Anhang 2: Fragestellungen der untersuchten Texte
Anhang 3: Belehrung über die Wahrung des Datenschutzes
Anhang 4: Etappe 1 – Handschriften sammeln
Anhang 5 - Etappe 2: Eingabe des Textes in digitale Form und Verarbeitung der Texte in Tabellenform
Anhang 7: Fehse et al. 1977, 46f. (Original)
Anhang 8: Fehlerquellen nach Legenhausen (1975: 28-52)
Impressum
ibidem-Verlag
À Maxime, mon fils chéri, dont ce livre est la petite sœur.
À mon oncle, Philippe Jeannin (1956-2009).
À tous ceux qui ont croisé mon chemin de thésarde et l’ont enrichi.
Merci.
Abkürzungsverzeichnis
Allgemeine Abkürzungen
§
Paragraph
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
d.h.
das heißt
ebd.
ebenda
etc.
etcetera
m. E.
meines Erachtens
Tab.
Tabelle
u.a.
unter anderen
u.ä.
und ähnliches
usw.
und so weiter
vgl.
vergleiche
z.B.
zum Beispiel
Abkürzungen Fehlerkategorien
Erklärung: Fehler aufgrund der…
Adjektivfehler
ADJ/Addition
Hinzufügung eines Adjektivs
ADJ/Bildung
Bildung des Adjektivs
ADJ/KongruenzG
Kongruenz des Genus' des Adjektivs
ADJ/KongruenzN
Kongruenz des Numerus' des Adjektivs
ADJ/Omission
Auslassung des Adjektivs
ADJ/Stellung
Stellung des Adjektivs
ADJ/Wahl
Wahl des Adjektivs
ADJ-ADV/Substitution
Ersetzung eines Adjektivs durch ein Adverb oder eines Adverbs durch ein Adjektiv
Adverbfehler
ADV/Bildung
Bildung des Adverbs
ADV/Omission
Auslassung des Adverbs
ADV/Stellung
Stellung des Adverbs
ADV/Wahl
Wahl des Adverbs
Artikelfehler
ART/Addition
Hinzufügung eines Artikels
ART/Bildung
Bildung des Artikels
ART/KongruenzG
Kongruenz des Genus' des Artikels
ART/KongruenzN
Kongruenz des Numerus' des Artikels
ART/Omission
Auslassung des Artikels
ART/Wahl
Wahl des Artikels
Interpunktionsfehler
INTERPApostroph/Addition
Hinzufügung eines Apostrophs
INTERPApostroph/Omission
Auslassung eines Apostrophs
INTERPKomma/Addition
Hinzufügung eines Kommas
INTERPKomma/Omission
Auslassung eines Kommas
INTERPSilbentrennung/Bildung
Abtrennung der Silben
INTERPZeichen/Addition
Hinzufügung eines sonstigen Zeichens
INTERPZeichen/Omission
Auslassung eines sonstigen Zeichens
INTERPZeichen/Wahl
Wahl des Zeichens
Kollokationsfehler
KOLLOK/Bildung
Kollokationsbildung
KOLLOK/Wahl
Kollokationswahl
Konjunktionsfehler
KONJ/Addition
Hinzufügung einer Konjunktion
KONJ/Bildung
Bildung der Konjunktion
KONJ/Omission
Auslassung der Konjunktion
KONJ/Stellung
Stellung der Konjunktion im Satz
KONJ/Wahl
Wahl der Konjunktion
Modusfehler
MOD/Bildung
Bildung des Modus'
MOD/Wahl
Wahl des Modus'
Verneinungsfehler
NEG/Addition
Hinzufügung einer Negation
NEG/Bildung
Bildung der Negation
NEG/Omission
Auslassung der Negation
NEG/Wahl
Wahl der Negationsform
Rechtschreibfehler
ORTHOAcc/Addition
Hinzufügung eines Accents
ORTHOAcc/Omission
Auslassung eines Accents
ORTHOAcc/Substitution
Ersetzung eines Accents durch einen anderen
ORTHOCédille/Addition
Hinzufügung einer cédille
ORTHOCédille/Omission
Auslassung einer cédille
ORTHOGroß/Addition
Hinzufügung eines Großbuchstabens
ORTHOGroß/Omission
Auslassung eines Großbuchstabens
ORTHOLettre/Addition
Hinzufügung eines Buchstabens
ORTHOLettre/Omission
Auslassung eines Buchstabens
ORTHOLettre/Substitution
Ersetzung von Buchstaben durch andere
ORTHOMorphem/Addition
Hinzufügung eines Morphems
ORTHOMorphem/Omission
Auslassung eines Morphems
ORTHOMorphem/Substitution
Ersetzung eines Morphems durch ein anderes
ORTHOTiret/Addition
Hinzufügung eines Bindestrichs
ORTHOTiret/Omission
Auslassung eines Bindestrichs
Partizipfehler
PART/Bildung
Bildung des Partizips
PART/KongruenzG
Kongruenz des Genus' des Partizips
PART/KongruenzN
Kongruenz des Numerus' des Partizips
PART/Omission
Auslassung des Partizips
PART/Stellung
Stellung des Partizips im Satz
Partikelfehler
PARTIK/Bildung
Bildung der Partikel
PARTIK/Omission
Auslassung der Partikel
PARTIK/Stellung
Stellung der Partikel im Satz
Passivfehler
PASS/Bildung
Bildung des Passivs
PASS/Substitution
Ersetzung der Aktivform durch die Passivform
PASS/Wahl
Ersetzung der Passivform durch die Aktivform
Fehler der Phonographemie
PHON/Substitution
der abweichenden Schreibung, die zu einer fehlerhaften Aussprache führt
Präpositionsfehler
PRÄP/Addition
Hinzufügung einer Präposition
PRÄP/Bildung
Bildung der Präposition
PRÄP/Omission
Auslassung der Präposition
PRÄP/Stellung
Stellung der Präposition im Satz
PRÄP/Wahl
Wahl der Präposition
Pronomfehler
PRON/Addition
Hinzufügung eines Pronoms
PRON/Bildung
Bildung des Pronoms
PRON/Omission
Auslassung des Pronoms
PRON/Stellung
Stellung des Pronoms im Satz
Substantivfehler
SUBST/Bildung
Bildung des Substantivs
SUBST/KongruenzG
Kongruenz des Substantivs (Genus)
SUBST/KongruenzN
Kongruenz des Substantivs (Numerus)
SUBST/Omission
Auslassung des Substantivs
SUBST/Wahl
Wahl des Substantivs
Syntaxfehler
SYNT/Addition
Hinzufügung einer Wortgruppe im Satz
SYNT/Omission
Auslassung einer Wortgruppe im Satz
SYNT/Permutation
Vertauschung von Wortgruppen im Satz
Tempusfehler
TEMP/Bildung
Tempusbildung
TEMP/Wahl
Tempuswahl
Valenzfehler
VA/Addition
Hinzufügung von Elementen in der Valenz des Adjektivs
VA/Bildung
Bildung der Valenz des Adjektivs
VA/Omission
Auslassung von Elementen in der Valenz des Adjektivs
VA/Wahl
Wahl der Valenz des Adjektivs
VN/Addition
Hinzufügung von Elementen in der Valenz des Substantivs
VN/Bildung
Bildung der Valenz des Substantivs
VN/Omission
Auslassung von Elementen in der Valenz des Substantivs
VN/Wahl
Wahl der Valenz des Substantivs
VV/Addition
Hinzufügung von Elementen in der Valenz des Verbs
VV/Bildung
Bildung der Valenz des Verbs
VV/Omission
Auslassung von Elementen in der Valenz des Verbs
VV/Wahl
Wahl der Valenz des Verbs
Verbfehler
VERB/Addition
Hinzufügung eines Verbs
VERB/Bildung
Bildung des Verbs (Grundfom)
VERB/KongruenzG
Kongruenz des Genus' des Verbs
VERB/KongruenzN
Kongruenz des Numerus' des Verbs
VERB/Omission
Auslassung des Verbs
VERB/Stellung
Stellung des Verbs im Satz
VERB/Wahl
Wahl des Verbs
1. Einleitung
1.1. Prämisse der Arbeit – Intention
„Si tu proposes un cours d’introduction au français du droit en amont, peut-être que ça fera baisser le taux de suicide chez les étudiants qui viennent ensuite chez moi“: Dies waren die scherzhaften Worte eines Kollegen, der – als ich mich mit ihm über die Planung eines fachsprachlichen Einführungskurses an unserem Sprachenzentrum unterhielt – über die Schwierigkeiten und Sprachdefizite seiner Studierenden in den Kursen des französischen Rechts klagte. Er unterrichtete französisches Recht in französischer Sprache und sah in dem Einführungskurs eine gute Vorbereitung auf die nächsten weitaus schwierigeren Stufen des in Jena angebotenen Programms „Law and Language“ („Droit et langue“). Er klagte jedoch nicht vorrangig über mangelnde Kenntnisse der fachsprachlichen Terminologie, sondern vor allem über das allgemeinsprachliche Niveau der Studierenden. Aus diesen Gesprächen sowie aus meiner Praxis in besagtem Einführungskurs kristallisierte sich bei mir der folgende Untersuchungsfokus heraus: Wo liegen die allgemeinsprachlichen Problembereiche, wie kann man sie identifizieren und sie dann in den betreffenden Kursen am Sprachenzentrum wieder aufgreifen?
Es kommen Studierende zu Kursen an das Sprachenzentrum, die auf Grundlage ihrer Fremdsprachenbildung in der Schule eigentlich über der elementaren Sprachverwendung liegen, aber dennoch ergänzenden allgemeinsprachlichen Input für ihre selbstständige bis kompetente Sprachverwendung brauchen (vgl. Trim & Quetz 2001: 41). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit möchte ich hervorheben, dass mir die Relevanz und das Vorliegen von Positivkompetenzen – damit meine ich die Kann-Beschreibungen aus dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (vgl. Trim & Quetz 2001) – bewusst ist, dennoch stellen diese nicht die Grundlage meiner Arbeit dar. Bestimmte allgemeinsprachliche Defizite und dadurch bedingte Fehlerquellen sind mir wiederholt in der Praxis aufgefallen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit bzw. der Bedarf seitens der Studierenden, dass auch in français juridique-Kursen – über das Spezifische des français juridique hinaus – die Vermittlung allgemeinsprachlicher Inhalte den Wortschatz und die Grammatik betreffend, integriert werden sollten. Um die benötigten allgemeinsprachlichen Inhalte einzugrenzen, liegt der vorliegenden Arbeit ein umfangreicher Fehlerdatensatz zugrunde, welcher auf lexikalische sowie grammatisch-strukturelle Kompetenzlücken hin untersucht wird.
Natürlich hätte ich mich im Einklang mit dem Geiste der Zeit dafür entscheiden können, den Fokus auf die Positivkompetenzen der Studierenden zu legen, d.h. das zu untersuchen, was sie können (vgl. Trim & Quetz 2001). Doch Fehler und Kompetenzen sind zwei Seiten einer Medaille. Selbstverständlich kann man trotz vieler Fehler eine gute Performanz erreichen und einen inhaltlich fundierten Gedankenprozess durchaus kompetent ausdrücken. Selbstverständlich sind Fehler ganz und gar nicht die einzige Grundlage zur Beurteilung sprachlicher Performanz. Dennoch ist unbestritten, dass Fehler tatsächlich sprachpraktische Kompetenzdefizite zum Vorschein kommen lassen, deren Untersuchung eine sinnvolle und wichtige Vorarbeit auf dem Wege zur Erstellung von speziellen fachsprachlichen Sprachkompetenzen für Juristen darstellt. Da das Forschungsinteresse, welches der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegt, aus langjähriger Praxiserfahrung mit Studierenden erwachsen ist, soll ihr Erkenntnisgewinn praxisorientiert dazu beitragen, allgemeinsprachliche Defizite zu diagnostizieren und sich diesen studierenden- und bedarfsorientiert zu widmen. Deshalb fokussiert die vorliegende Arbeit speziell auf die oben ausgeführten allgemeinsprachlichen Aspekte. Trotz der weithin geforderten Kompetenzorientierung richtet sie somit ihren Blick primär darauf, wie korrekt Studierende schreiben. Denn auch wenn Kursangebote auf Kompetenzen ausgerichtet sind, brauchen Lehrende trotzdem eine Handreichung, um den Sprachstand ihrer Studierenden individuell bestimmen zu können. Dies wiederum ermöglicht es ihnen dann, Studierende dort „abzuholen“, wo sie sprachlich zu verorten sind. Nicht zuletzt trägt eine solche Diagnose auch zur Verbesserung des Unterrichts bei, denn Lehrende können so gezielt wiederkehrende allgemeinsprachliche Schwierigkeiten bedarfsorientiert in die Kursplanung aufnehmen.
Wenn ich oben betont habe, dass diese Untersuchung eine sinnvolle und wichtige Vorarbeit auf dem Wege zur Erstellung von speziellen fachsprachlichen Sprachkompetenzen für Juristen darstellt, so sei dies auch wie folgt begründet: Es gibt bundesweit für français juridique-Kurse zwar einheitliche Regelungen in Bezug auf die Abdeckung bestimmter Lernbereiche (droit constitutionnel, droit civil etc.), aber keine hinsichtlich konkreter Themen oder des zu erwerbenden Wortschatzes bzw. der zu erwerbenden Grammatik. Lehrende sind bei diesen Entscheidungen auf sich allein gestellt und vermissen ein bundesweit einheitliches Curriculum, welches diese Bereiche strukturiert abdeckt. Die vorliegende Untersuchung soll – im Rahmen einer längerfristigen Vision – also letztlich zur Entwicklung eines einheitlichen Curriculums für den Unterricht der französischen Rechtssprache beitragen. Zusammenfassend ist es somit das Ziel der vorliegenden Arbeit zu diagnostizieren, welche allgemeinsprachliche Schwierigkeiten bei der Formulierung rechtsfachsprachlicher Texte auftreten, welche Elemente der sogenannten Allgemeinsprache (siehe Kapitel 2.3) Probleme darstellen, wenn Studierende der Rechtswissenschaften sprachliche Produktionen mit rechtswissenschaftlicher Aufgabenstellung hervorbringen.
Eine fachsprachliche Varietät wie die Sprache des Rechts setzt in starkem Umfang standardsprachliche Kompetenzen voraus. Wodurch unterscheiden sich nun fachsprachliche von allgemeinsprachlichen Kompetenzen? Welchen Anteil haben rechtssprachliche Fehler an der Gesamtzahl der Fehler? Dieses Verhältnis lässt sich ähnlich vorstellen wie das aus den Kulturwissenschaften stammende Eisberg-Modell (Grimm, Meyer & Volkmann 2015: 60): Die rechtssprachlichen Anteile stellen die Spitze des Eisbergs dar, welcher standard- und fachsprachliche Kompetenzen vereint: beispielsweise Fachvokabular oder grammatikalische Schwerpunksetzungen der Rechtssprache, z.B. den häufigeren Einsatz von Passivkonstruktionen als in der französischen Standardsprache. Die Allgemeinsprache hingegen ist die Basis und stellt somit den unteren, tragenden Teil des Eisberges dar. Im fachsprachlichen Unterricht kommt neue Lexik hinzu, dennoch werden keine grundsätzlich neuen grammatischen Kompetenzen gebildet. Dieser tragende Teil des Eisbergs spielt beim Erlernen einer Fachsprache eine erhebliche Rolle und sollte m. E. in diesem Kontext beachtet und diagnostiziert werden – dies soll die vorliegende Arbeit bestätigen oder entkräften.
1.2. Vorstellung des Forschungsgegenstands
Basierend auf den sieben zentralen W-Fragen (siehe Abb. 11) stelle ich hier einleitend sowohl den Gegenstand meiner Arbeit vor als auch die damit verbundene Fragestellung, die dazugehörige These, die zu untersuchenden Daten, die zur Untersuchung benutzte Methode sowie die Platzierung der Arbeit in der Forschungslandschaft, ihre forschungsinterne und ihre allgemeingesellschaftliche Relevanz.
Die sieben zentralen W-Fragen
1) Was ist der Gegenstand der Arbeit? (Thema)
2) Was will ich über den Gegenstand herausfinden? (Fragestellung)
3) Welche These würde ich bezüglich der Fragestellung formulieren?
4) Welches Material/Texte/Daten möchte ich dazu untersuchen?
5) Mit welchen analytischen Werkzeugen/Methoden möchte ich arbeiten?
6) Welchen Platz nimmt die Arbeit in der Forschungslandschaft ein? (Nähe und Ferne zu anderen Forschungsansätzen)
7) Warum ist das Thema relevant (forschungsintern und allgemein)?
Abbildung 1: Die sieben zentralen W-Fragen
Wie bereits oben erwähnt, sind die allgemeinsprachlichen Fehler von Lernenden der französischen Rechtssprache im Hochschulkontext Gegenstand meiner Arbeit. Mein Anliegen ist es, herauszufinden, welche allgemeinsprachlichen Schwierigkeiten die Lernenden in dem fachsprachlichen Unterricht haben und ich möchte zu dieser Fragestellung folgende These formulieren: Die sprachlichen Kompetenzen, welche die Lernenden in den fachsprachlichen Unterricht mitbringen, reichen nicht aus und müssen daher im Curriculum der französischen Rechtssprache erweitert werden. Dazu untersuche ich eine Stichprobe von schriftlichen Produktionen (Klausuren), die Studierende nach einem Kurs der französischen Rechtssprache (i.d.R. 30 Unterrichtsstunden) geschrieben haben. Diese schriftlichen Produktionen werden zuerst einmal per Fehleranalyse untersucht, um in einem zweiten Schritt die allgemeinsprachlichen Fehler herauszufiltern, zu klassifizieren und statistisch auszuwerten. Die numerisch stark gehäuft auftretenden Fehlerbereiche werden anschließend qualitativ untersucht.
Zum Forschungshintergrund (siehe Frage 6) situiert sich die vorliegende Arbeit mit ihrem Interesse am allgemeinsprachlichen Anteil einer Fachsprache an der Schnittstelle zwischen den Disziplinen der Fehlerlinguistik und Fachsprachenforschung. Sie situiert sich nahe an der fachsprachlichen Fehlerlinguistik, die „in der Anwendung der Methoden und Erkenntnisse der Fehlerlinguistik auf den (fremd-)fachsprachlichen Unterricht sowie in der Erweiterung und Erneuerung der Fehlerlinguistik durch spezielle, aus dem fachsprachlichen Unterricht erwachsende Fragestellungen“ besteht und die „somit eine Subdisziplin der Fehlerlinguistik einerseits und der Fachsprachenforschung andererseits und am Kreuzungspunkt der beiden Wissenschaften angesiedelt“ ist (Lavric 1998: 970).
Was die forschungsinterne Relevanz der vorliegenden Arbeit betrifft (Frage 7 – Teil 1), berufe ich mich auf Fluck (1992: 213), dessen Behauptung immer noch hoch aktuell ist: „Es fällt auf, daß lediglich die Wirtschaftssprache der gängigsten Fremdsprachen fehlerlinguistisch bereits einigermaßen erfaßt worden ist; Studien zu den Fehlern in verschiedenen Fächern […] stellen derzeit das vielleicht dringendste Desideratum einer fachsprachlichen Fehlerlinguistik dar.“ Fluck stellt weiterhin fest, dass es „Defizite bei der Fehleranalyse im fachsprachlichen Unterricht“ (ebd.) gibt, was schließlich ein weiterer Beleg ist für die Sinnhaftigkeit dieser Arbeit und ihre Untersuchung von Fehlern im rechtsfachsprachlichen Lernkontext. Letzterer gehört zur allgemeingesellschaftlichen Relevanz genauso wie der bildungspolitische Anteil der vorliegenden Arbeit (siehe Kapitel 1.1.). Der Nutzen fachsprachlichen Unterrichts wird in zahlreichen Studienordnungen belegt, u.a. in der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg (1994: 207ff.2) festgeschrieben und wurde wie folgt auf der Webseite der Universität beschrieben:
Im Rahmen eines zusammenwachsenden Europas, in dem Studienaufenthalte im Ausland immer häufiger werden und in dem die Niederlassungsfreiheit die Berufsausübung auch im Ausland ermöglicht, […] [gewinnt] die Beschäftigung mit einer anderen Rechtsordnung zunehmend an Bedeutung.
Weiterhin bestehe das Ziel der Kurse darin, die „Auseinandersetzungen mit einer fremden Rechtsordnung, deren systematischen Zusammenhängen sowie ihre Gegenüberstellung mit der eigenen Rechtsordnung zu ermöglichen“, da deren „rechtsvergleichende Ansätze den Zugang zu jeder anderen Rechtsordnung erleichtern“ und daher „von großem Nutzen“ seien (Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 1994: ebd.).
Bevor in Kapitel 2 und 3 der vorliegenden Arbeit sowohl der theoretische als auch der methodische Hintergrund der weiter ausgeführten Untersuchung ausführlich erläutert werden, werden im Vorfeld zur Kontextualisierung die Stellung des Faches français juridique an deutschen Universitäten und sein Vermittlungskontext vorgestellt.
1.3. Das français juridique und sein Vermittlungskontext
Die französische Rechtssprache (français juridique) ist an deutschen Universitäten ein eher kleines Nischenfach. Nicht alle deutschen Universitäten, die eine juristische Fakultät besitzen, bieten solch einen Unterricht an (siehe Tab. 1 in 1.3.2.). Die französische Rechtssprache wird einerseits in den Fakultäten selbst, aber auch an den Sprachenzentren der Universitäten unterrichtet. Im ersten Fall erteilen deutsche oder französische Juristen diesen Unterricht in französischer Sprache – hier könnte man also von droit français sprechen. Dies bedeutet, dass das Juristische stark im Vordergrund steht, auch wenn Vokabellisten u.ä. durchaus in solchen Lehrveranstaltungen genutzt werden. Im zweiten Fall erteilen Französisch-Lehrer diesen Unterricht, wobei der juristische Inhalt den Rahmen für einen Sprachkurs mit Berücksichtigung aller vier Sprachfertigkeiten bildet: Es werden darin nämlich andere Medien genutzt als nur juristische Texte, nämlich Zeitungsartikel, Videos, Audio-Dokumente, didaktisch reduzierte Gesetzestexte etc.
Das français juridique an deutschen Universitäten ist nicht nur ein Nischen-, sondern auch ein von Disparitäten gekennzeichnetes Fach, das im sprachpraktischen Unterricht an der Universität qualitativ wie quantitativ sehr unterschiedlich fokussiert wird: Unterschiedliche Anforderungen, Inhalte und Lehrerprofile ergeben bundesweit ein sehr heterogenes Gesamtbild; dies wird im Folgenden in Form einer Bestandsaufnahme aufgezeigt. Dazu wird ein Umriss der institutionellen und geografischen Situation des français juridique (1.3.1 und 1.3.2) und seiner Akteure (1.3.3) dargestellt sowie das breite Spektrum der vermittelten Inhalte (1.3.4).
1.3.1. Bildungspolitik: Der institutionelle Rahmen der französischen Rechtssprache
Unter den bildungspolitischen Institutionen auf Bundes-, Landes- und Universitätsebene herrscht Übereinstimmung bezüglich der Sinnhaftigkeit fachsprachlichen Unterrichts für Studierende der Rechtswissenschaften in Deutschland. So formuliert das Bundesgesetzblatt vom 11. Juli 2002 zur Sprachenausbildung angehender Juristen, dass „der erfolgreiche Besuch einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder eines rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses nachzuweisen [ist].“ (Gesetz zur Reform der Juristenausbildung 2002: 2592 § 5a, Abs. 2).
Doch trotz der Übereinstimmung der Bildungsinstitutionen bezüglich der Notwendigkeit der sprachpraktischen Ausbildung und der Auseinandersetzung mit den Rechtsordnungen anderer Länder bestehen deutschlandweit große Unterschiede in den Leistungsan-forderungen an die Studierenden. So ist beispielsweise in Baden-Württemberg
nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 JAPrO2002 die regelmäßige Teilnahme an einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder an einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs (§ 3 Abs. 5 S. 2 JAPrO 2002) Zulassungsvoraussetzung zur Ersten juristischen Staatsprüfung.
Hinzugefügt wird, dass „‚ein ‚Sitzschein‘ genügt, da eine Benotung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 JAPrO 2002 nicht erforderlich ist.3“ Im Gegensatz dazu müssen Studierende in Thüringen nach §16 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ThürJAPO einen Leistungsschein erbringen:
(2) Der Bewerber muss ferner mit Erfolg an […] einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs teilgenommen haben. […] [Es können] weitere Leistungsnachweise […] vorgelegt werden.4
Recht unterschiedlich sind auch die Programme, die in Deutschland im Rahmen des français juridique angeboten werden. Eine Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen (FFA) bieten zum Beispiel die Universitäten Münster, Passau, München, Bielefeld und Trier an. In dieser Konstellation scheinen Juristische Fakultäten und Sprachenzentren miteinander zu kooperieren und den Unterricht gemeinsam zu gestalten. Weitere Programme werden überwiegend von den Juristischen Fakultäten angeboten. Dies betrifft zum Beispiel das Programm „Droit et langue“ in Jena, die Französische Rechtsschule in Freiburg/Breisgau sowie umfangreiche integrierte Studienangebote in Partnerschaft mit französischen Universitäten, wie z.B. das deutsch-französische Studienprogramm der Universität Erlangen mit der Universität Rennes oder der Universität Köln mit der Pariser Sorbonne. An der Universität Saarbrücken wurde sogar eine eigene Institution gegründet, das „centre juridique franco-allemand“. Es beschreibt den Bildungsauftrag der dort angebotenen Studiengänge als „die gemeinsame Ausbildung von französisch- und deutschsprachigen Studierenden, die Kenntnisse im Recht des Nachbarlandes erwerben möchten5.“ Darüber hinaus hat die juristische Fakultät Jena ein fakultatives Programm ins Leben gerufen, bei dem die Studierenden 4 Seminare in 4 unterschiedlichen Rechtsbereichen mit jeweils einer abschließenden Klausur besuchen können. Dies wird genau beschrieben, inklusive der Notenstufen zur Bewertung der Prüfungsleistungen. Die Disparität des Faches äußert sich bundesweit durch die große sowohl qualitative als auch quantitative Verschiedenheit der Leistungserwartungen.
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen (GeR) sowie das daran angelehnte Evaluationsstandard-Tool UNIcert® beschreiben fachsprachliche Kompetenzen in ihren Leistungsbeschreibungen: Sie erscheinen allerdings erst ab dem Niveau B2: „UNIcert®-Stufe III – Fachsprache“und „UNIcert®-Stufe IV – Fachsprache“. Für das Niveau III (GeR B2) ist definiert, dass der Lerner „über allgemeinwissenschaftliche und fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf höherem Niveau [verfügt], die ihn/sie befähigen, zu ausgewählten Themen in entsprechenden Kommunikationssituationen durch variablen Einsatz sprachlicher Mittel zu kommunizieren“.6 Für das Niveau IV (GeR C1) ist definiert, dass der Lerner „über allgemeinwissenschaftliche und fachbezogene sprachliche Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem professionellem Niveau [verfügt] und eine umfassende kommunikative fremdsprachliche Kompetenz [besitzt], um in allen allgemeinen sowie studien-, berufs- und fachbezogenen Situationen – nahezu wie akademisch gebildete Muttersprachler – korrekt, flüssig und adäquat reagieren zu können“7 (vgl. auch Eggensperger & Fischer 1998).
Die institutionnelle Verankerung des français juridique zeigt, dass es als notwendiges, wünschenswertes und erwünschtes Fach im Rahmen des juristischen Studiums an deutschen Universitäten angesehen wird. Nun stellt sich die Frage nach seiner Verbreitung in Deutschland, welche der folgende Abschnitt in den Fokus nimmt.
1.3.2. Die Geografie des français juridique
Um das Wirkungsfeld der französischen Rechtssprache einkreisen zu können, erscheint es sinnvoll, den Blick auf die geografische Verbreitung dieses Faches zu lenken (siehe Abb. 2). Hierzu wurde zunächst eine Recherche zu den existierenden Juristischen Fakultäten an deutschen Universitäten durchgeführt (siehe Abb. 2). Anschließend wurde über das Internet detailliert überprüft, ob die Juristischen Fakultäten français juridique-Kurse anbieten, und wenn ja, wo diese angesiedelt sind: an der Juristischen Fakultät, am Sprachenzentrum oder an beiden Institutionen (siehe Tab. 1).
Insgesamt besitzen 43 deutsche Universitäten eine Juristische Fakultät. 37 davon hatten im Wintersemester 2012/13 mindestens einen Fachsprachenkurs Französisch für Juristen in ihrem Kursangebot. Die Kurse verteilen sich auf 29 Juristische Fakultäten und 19 Sprachenzentren. Somit bilden 69% der Juristischen Fakultäten und 48% der Sprachenzentren, das sind insgesamt 56% – also etwas über die Hälfte – dieser Institutionen, den Rahmen dieses kleinen Faches. Angesichts der bildungspolitischen Bedeutung, eine fremde Rechtsordnung und ihre Sprache kennen zu lernen, und der etablierten Position des Französischen in Deutschland sowie in den Institutionen der EU erscheint dies gering – bei dieser Feststellung ist jedoch die Konkurrenz der englischen Sprache zu beachten.
Tabelle 1: Vorhandensein des français juridique an der juristischen Fakultät bzw. am Sprachenzentrum
[Stand: Wintersemester 2012/13]
43 Universitäten
Jura-Fakultät
Sprachenzentrum
Augsburg
X
Bayreuth
X
X
Berlin FU
X
Berlin HU
X
X
Bielefeld
X
X
Bochum
X
X
Bonn
X
Bremen
Dresden
X
Düsseldorf
X
Erlangen
X
Frankfurt/Main
X
Frankfurt/Oder
Freiburg
X
Gießen
X
Göttingen
X
Greifswald
X
Hagen
Halle
X
X
Hamburg
Hannover
X
Heidelberg
X
X
Jena
X
X
Kiel
Köln
X
Konstanz
X
Leipzig
X
X
Mainz
X
Mannheim
X
Marburg
X
München
X
Münster
X
X
Osnabrück
X
Passau
X
X
Potsdam
X
X
Regensburg
X
Rostock
X
Saarbrücken
X
Siegen
Trier
X
Tübingen
X
Wiesbaden
Würzburg
X
Total
29
19
Abbildung 2: Geografie des français juridique – Juristische Fakultäten in Deutschland
1.3.3. Die Akteure des français juridique
1.3.3.1. Die Lernenden
Um die Implementierung der französischen Rechtssprache an deutschen Universitäten zu beschreiben, sollte man sich selbstverständlich auch mit den Akteuren des Faches befassen – den Lernenden und den Lehrenden. Dabei wird in diesem Beitrag folgenden Fragen nachgegangen: 1. Wer lernt die französische Rechtssprache? 2. Zu welchem Zweck? 3. Mit welchen Voraussetzungen? Um hierauf Antworten zu ermitteln, wurden Studierende des Kurses „Französisch als Fachsprache für Juristen und Politikwissenschaftler“ am Sprachenzentrum der Universität Jena turnusmäßig zum Semesterbeginn mithilfe eines quantitativen Erhebungsinstruments befragt. Zwischen Oktober 2009 und Oktober 2012 hat eine Gesamtmenge von 48 Studierenden an der Befragung teilgenommen. 23 von diesen 48 Probanden waren in den Rechtswissenschaften immatrikuliert. Diese kleine Studie erhebt natürlich keinen Anspruch auf Repräsentativität. Da aber bundesweit fast ausschließlich Jura-Studierende français juridique-Kurse besuchen, beschränkt sich der vorliegende Beitrag für diese Profilbildung ‚in Miniatur‘ auf die Juristen: Es waren 14 Frauen und 9 Männer, alle deutsche Muttersprachler, mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren und durchschnittlich im 4. Studiensemester zur Zeit der Kursteilnahme (siehe Abb. 3 und Abb. 4).
Abbildung 3: Studiensemester bei der Teilnahme am français juridique-Kurs (N=23)
Abbildung 4: Alter bei der Teilnahme am français juridique-Kurs (N=23)
Wichtige Elemente für den erfolgreichen Besuch eines Sprachkurses sind neben den individuellen Voraussetzungen insbesondere auch die Motivation für und die Erwartungen der Studierenden an den Kurs. So wurden die Studierenden hinsichtlich ihrer individuellen Voraussetzungen zunächst dazu befragt, wie lange und wo sie Französisch gelernt haben. Dabei stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Befragten 6 bis 7 Jahre Französisch als zweite Fremdsprache in der Schule gelernt hatten (siehe Abb. 5).
Abbildung 5: Anzahl der schulischen Lernjahre bei den studentischen Französischlernenden (N=23)
Darüber hinaus wurden die Studierenden gebeten, sich selbst anhand der Kompetenzstufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) einzuschätzen (siehe Abb. 6). Das GeR-Kompetenzraster war den Studierenden in den meisten Fällen bekannt. Zur Sicherheit wurde ihnen jedoch die vom Europarat ausgegebene Kurzübersicht zusammen mit dem Fragebogen zur Verfügung gestellt (siehe Abb. 7).
Abbildung 6: Selbsteinschätzung (in der Reihenfolge: Schreiben, Sprechen, Hören, Lesen)
Die Studierenden schätzen sich in den rezeptiven Kompetenzen höher ein (mehrheitlich B2) als in den produktiven (mehrheitlich B1). Insgesamt kann man eine erhebliche Heterogenität feststellen (A2-C1), die aber nicht spezifisch für die Sprachkurse des français juridique ist.
Abbildung 7: Raster zur Selbstbeurteilung (Trim & Quetz 2001: 36)
Die Studierenden wurden zudem zu ihrer Motivation und zu ihren Erwartungen befragt. Überraschend war hierbei die Erkenntnis, dass einige der Befragten angaben, durch die Teilnahme am Kurs ihre Französisch-Kenntnisse allgemein auffrischen bzw. verbessern zu wollen – im Grunde eine „allgemeinsprachliche“ Zielsetzung (siehe Abb. 8). Bezüglich der Erwartungen der Studierenden an den Sprachkurs kristallisieren sich drei Lernzielkategorien heraus: 1. die Studierenden wollen einen Gesamtüberblick über das juristische System Frankreichs gewinnen, 2. Vokabeln/Terminologie lernen und 3. insgesamt ihr Französisch verbessern.
Abbildung 8: Motivation
1.3.3.2. Die Lehrenden
Eine Internetrecherche ergab, dass insgesamt 73 Lehrende im Bereich der französischen Rechtssprache bzw. des französischen Rechts an deutschen Universitäten lehren: 25 an Sprachenzentren und 48 an juristischen Fakultäten. Darunter sind 55 Franzosen und 17 Deutsche. Dabei beträgt der Muttersprachleranteil an Sprachenzentren 68%, an juristischen Fakultäten sogar 79%. Aufgrund des Daseins der französischen Rechtssprache als Nischenfach erweisen sich die wissenschaftlichen Biografien der Lehrenden in diesem Bereich als sehr heterogen: Man findet sie in Anstellungsverhältnissen an Universitäten als Lektoren, Doktoranden, Honorarkräfte/externe Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Mitarbeiter. Sie sind für die meisten entweder Französisch-Lehrer ohne juristische Ausbildung oder Juristen ohne fremdsprachendidaktische Ausbildung. Die Franzosen haben ein Deutsch-, FLE8- bzw. Jura-Studium in Frankreich und/oder in Deutschland absolviert. Die Lehrenden des français juridique bzw. des französischen Rechts sind Französisch-Lehrer, Anwälte, Staatsanwälte, Universitätsprofessoren aus Frankreich oder Deutschland. Trotz dieser jeweiligen Unterschiede im beruflichen Werdegang haben alle Lehrende doch eine Gemeinsamkeit: Sie haben ‚Ausbildungslücken‘ entweder im Bereich der Rechtswissenschaften oder mit Bezug auf die Fremdsprachendidaktik. So müssen sich beispielsweise die an Sprachenzentren stark vertretenen Französischlehrer nach dem Prinzip des learning by doing an die rechtswissenschaftlichen Inhalte dieser Sprachkurse „herantasten“.
Die soeben angesprochene Problematik beschreiben auch Buhlmann & Fearns (2000: 115ff.): Der Lehrende der französischen Rechtssprache muss einen Unterricht konzipieren und erteilen, „für den er in der Regel nicht eigens ausgebildet ist“ (ebd.: 115). Darüber hinaus verfügt
der Lehrer […] häufig nicht über die Fachkompetenz in dem Fach, dessen Sprache er unterrichten soll, meist kennt er auch die methodischen Möglichkeiten im Fachsprachenunterricht nicht und überschätzt von daher gesehen die Rolle der Fachkompetenz. (ebd.)
Buhlmann & Fearns (2000: 115) sind der Meinung, dass „im Fachsprachenunterricht […] ein Träger von Fachkompetenz ausreichend ist: Ist der Lerner fachkompetent, so benötigt der Lehrer keine besondere Fachkompetenz (das gilt besonders für die zweisprachige Unterrichtsituation)“. Diese Position erscheint durchaus diskussionswürdig und wird mit Sicherheit nicht von allen Lehrenden geteilt, vor allem, weil fachliches Wissen bei den Lernenden nicht per se vorausgesetzt werden kann. Dies entspricht auch den unterrichtspraktischen Erfahrungen der Autorin dieses Beitrages. Man kann jedoch sicherlich der Behauptung zustimmen, dass der Lehrende „einen Mangel an Fachkompetenz durch Befolgung bestimmter didaktischer und methodischer Prinzipien ausgleichen [kann]“ – ohne dabei jedoch zu vergessen, „dass Sprache […] nicht Mittel, sondern Ziel [ist]“ und dass er „Sprachlehrer, kein Fachlehrer, kein Wissensvermittler“ (ebd.: 122) ist.
Eine weitere Problematik stellt die Positionierung der Lehrenden in einem derartigen Unterrichtssetting dar. Der Lehrende „unterrichte[t] die Fachsprache, nicht das Fach, dadurch tritt er in den Hintergrund“ (ebd.: 118, Hervorhebung im Original). Somit müssen sich Lehrende eher in der Rolle des Vorbereiters und Begleiters von Lernprozessen verstehen, ohne den Anspruch zu erheben, diese jederzeit bestimmen oder kontrollieren zu können.9 Diese Situation verschärft sich nach Buhlmann & Fearns durch den Umstand, dass „der Lehrer […] sich oft der Situation gegenüber [sieht], daß er einen Fachsprachenkurs geben muß, für den es kein, nicht ausreichendes oder nicht befriedigendes Material gibt“ (Buhlmann & Fearns, zitiert aus Fluck 1992: 185). Diese Einschätzung sei im Hinblick auf die aktuelle Lehrwerklage jedoch an dieser Stelle eingeschränkt, da auf dem deutschen Lehrbuchmarkt durchaus drei nützliche Lehrwerke10 für die „Einführung in die französische Rechtssprache“ existieren, wenngleich diese quantitativ wie qualitativ recht unterschiedliche Inhalte aufweisen. Als sehr geeignet für die Konzipierung von Unterrichtsstunden für einen Rechtssprachkurs erscheint dabei das Lehrwerk von Géraldine Citerne-Hahlweg (2010). Es überzeugt durch effektive Stoffreduzierung, klare Lernziele und zahlreiche Sprachübungen.
1.3.4. Die Inhalte in den français juridique-Kursen
Eine Recherche bezüglich der Inhalte, die in den français juridique-Kursen vermittelt werden, ergab, dass es insgesamt 28 Sprachkurse dieser Art an den Sprachenzentren deutscher Universitäten gibt, in denen sich ein großes Spektrum an Inhalten und Themen findet (siehe Abb. 9)11. Diese Ergebnisse stammen aus insgesamt 18 im Wintersemester 2012/13 online verfügbaren Kursbeschreibungen.
Das französische juristische System, das Verfassungsrecht und die französischen Institutionen, die Terminologie und die Arbeit an Fachtexten genießen offensichtlich eine große Beliebtheit. Dass das Spektrum an Themen jedoch insgesamt sehr breit gefächert ist, kann u.a. mit dem Umstand erklärt werden, dass bisher kein einheitliches Curriculum der französischen Rechtssprache existiert.
Abbildung 9: Inhalte und behandelte Themen der Einführungen in die französische Rechtssprache
Von insgesamt 28 Lehrveranstaltungen wird bei 20 eine GeR- bzw. Unicert-Niveaustufe in der Kursbeschreibung angegeben. Wo dies nicht der Fall ist, wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer/innen eine gewisse Anzahl an Französisch-Lernjahren bzw. gute Französisch-Kenntnisse vorweisen können. In manchen Fällen müssen Studierende einen Test bestehen, um teilnehmen zu können (C-Test). Abb. 10 zeigt die angegebenen Niveaustufen der 20 genannten Kurse.
Abbildung 10: Die GeR- bzw. Unicert-Stufen in den Kursen des français juridique
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Niveaustufen, der heterogenen Inhalte und der ungleichen Leistungsanforderungen bestätigt sich der eingangs postulierte Eindruck, dass das Fach français juridique an deutschen Universitäten und spezifisch an deutschen Sprachenzentren insgesamt recht heterogen und ohne einheitlichen Fokus unterrichtet wird. Kurzum: Ausschlaggebend für das, was Studierende in einem Kurs zur französischen Rechtssprache lernen, ist das an der jeweiligen Universität konzipierte Curriculum. Darüber hinaus ist es für jeden Sprachlehrer, der anfängt, sich mit diesem Fach zu befassen, recht schwierig, dessen dichten Stoff zu erschließen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und die zu lernenden Vokabeln einzugrenzen. Perspektivisch wäre es daher sinnvoll, mit Lehrenden der französischen Rechtssprache ein einheitliches Curriculum für den Unterricht des français juridique an deutschen Hochschulen zu entwerfen. Zu diesem Überblick des français juridique-Vermittlungskontexts fehlen aber noch die Evaluationsmodi. Diesen widmet sich die vorliegende Arbeit, die sich mit einer Klausuren-Stichprobe befasst, aus der ein Fehlerkorpus als Forschungsgegenstand extrahiert und untersucht wird.
1 Nach einer Mitteilung von Simon Bohn, der sich auf Komponenten der Lasswell-Formel stützt.
2 www.jura-hd.de [Zugriff: 20.2.2013] (vgl. Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Prüfung des französischen Rechts und der zugehörigen Rechtssprache vom 14. Juli 1994, Mitteilungsblatt der Universität Heidelberg Nr. 11/1994 vom 17.10.1994, S. 207 ff.)
3 http://www.jura.uni-tuebingen.de/studium/flv [Zugriff: 28.1.2014]
4 http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/einrichtungen/dez1/ordnungen/fak2/rewi23.pdf [Zugriff: 28.1.2014]
5 http://www.cjfa.eu/das-cjfa/studiengange/ [Zugriff:14.4.2014].
6 http://www.unicert-online.org/de/niveaustufenbeschreibungen (deutsch.doc) S. 3 [letzter Zugriff 18.5.2016]. Hervorhebungen von der Autorin dieser Dissertation.
7 http://www.unicert-online.org/de/niveaustufenbeschreibungen (deutsch.doc) S. 4 [letzter Zugriff 18.5.2016]. Hervorhebungen von der Autorin dieser Dissertation.
9 Zur Situation des Fachsprachenlehrers siehe auch Fluck 1992: 185ff.
10 Schmidt-König (2011), Schlichting/Volmerange (2011), Citerne-Hahlweg (2010).
11 Die Themen mit einer einzigen Benennung wurden nicht berücksichtigt (Arbeitsrecht, Jugendgerichtsbarkeit, Urheberrecht, Internetrecht etc.).
2. Überlegungen zum Norm- und Fehler-Konzept
2.1. Die Schwierigkeit einer Normdefinition
Zu einer empirischen Studie gehört zu allererst eine grundsätzliche Vorüberlegung zum Gegenstand der Untersuchung. Bevor Fehler gesammelt und ausgewertet werden können, muss zuerst erläutert werden, was man unter „Fehler“ versteht; der Fehler soll als Begriff definiert werden. Die Definition eines Fehlers hängt eng mit der einer Norm zusammen und dies stellt zunächst die erste Hürde dar: die „Schwierigkeit einer Normdefinition“ (Mayr 1985, 55). Um den Begriff des Fehlers definieren zu können, muss man zuerst klar stellen, was als Norm gelten soll; „la notion de faute présuppose […] le choix d’une norme” (Berling 2002: 36). Berling erwähnt das français standard und den sogenannten bon usage als Norm. Hier gilt es vorerst zu erklären, was man darunter verstehen kann, was denn dieses „tertium comparationis“ sein soll, wie Kielhöfer (1975a: 21) es ausdrückt. Damit verbindet sich die Frage, womit eine Äußerung denn verglichen werden soll, um dann als einwandfrei als Fehler bestimmt werden zu können.
Die Normdefinition ist aber weder einfach noch unumstritten, denn „personne ne peut plus prétendre aujourd’hui que la langue française serait une et unie dans son usage, comme le laissent entendre certains manuels d’enseignement“ (Coste 1971: 25). Die Begriffe „Register“, „Niveau“, „Stilebene“, „deskriptiv/präskriptiv“ und „Norm/System“, die sich automatisch aus dieser Diskussion herauskristallisieren, seien Teil des Problems, dessen Lösung eine Grundbedingung für Unterricht, Lernzielkontrolle und Fehleranalyse darstellt (vgl. Mayr 1985: 35).
2.1.1. System und Norm
Die Literatur über diese Thematik unterscheidet gern zwischen Sprachsystem und Sprachnorm, räumt aber auch gleich ein, dass diese Abgrenzung zwischen Norm und System schwierig ist. Das System erscheint als eine komplexe abstrakte Sprachstruktur, die eine bestimmte Anzahl immanenter Regeln für sämtliche mögliche sprachliche Äußerungen aufstellt (Krainz 1980: 30). Anders ausgedrückt: „La structure d’une langue spécifie donc le nombre des éléments avec lesquels on doit opérer et la façon dont chacun peut se lier aux autres. […] la formation des signes […] n’est que l’exploitation des possibilités de signes.“ (Hjelmslev 1966: 64). Dieser Auffassung ist Berling offensichtlich auch. Sie schreibt nämlich, dass „la norme est à considérer comme un état intermédiaire entre la langue en tant que système théorique avec ses structures abstraites et potentielles et la parole en tant qu’énoncés réalisés, engendrés par ce même système“ (Berling 2002: 29). Hingegen vertritt Wilkins, den Mayr zitiert, folgende Auffassung: „In order to use and understand a language we need a communicative as well as a grammatical competence“ (Wilkins 1974: 19, zitiert nach Mayr 1985: 39).
Es gilt hier, sich zuerst einmal der „grammatical competence“ zu widmen und zu prüfen, wie sie theoretisch im sprachlichen Anwendungskontext erfasst wird. Bei Halliday et al. weist die „Sprachspanne“ (the stretch of language) grammatische Strukturmuster innerhalb einer hierarchischen Ordnung auf: Satzgefüge, Satz, Gruppe, Wort, Morphem (Kielhöfer 1975a: 29). Diese Struktur als bedeutungstragende Relation sei eine Kettenrelation auf der syntagmatischen Achse, in der alle sprachlichen Konstituenten eine Struktur aufweisen. Das System sei eine „geschlossene Teilmenge innerhalb der Klasse, aus der eine Auswahl getroffen werden muss“. Mit Klasse ist gemeint eine „Menge der Einheiten, die in gleicher Weise an einer Position der Struktur operieren können“. Die Klassen haben kategoriale und die Unterklassen subkategoriale Merkmale (wie zum Beispiel die Transitivität als subkategoriales Merkmal der Unterklasse der transitiven Verben). Die Menge der Wahlmöglichkeiten stellen die Termini des Systems dar, und Klasse und System stehen in einer Auswahlrelation zueinander, sodass die Systemauffassung von Halliday zusammenfassend als „System von Systemen“ beschrieben werden kann (Kielhöfer 1975a: 30).
Zur Erfassung der Sprache als System und Norm erscheint Christine Krainz´ Zusammensetzung verschiedener Modelle sehr hilfreich (Krainz 1980: 28-30). Sie schildert die Sicht Coserius, Hjelmslevs und Pollaks über Norm und System mit folgenden Schemata (Abb. 11-13):
Abbildung 11: Die vier Ebenen der Sprache nach Eugenio Coseriu: Sistema, norma y habla. In: Teoria del lenguaje y linguistica general. Madrid 1962. S. 11-101. Schema nach Christine Krainz (1980: 29).
Abbildung 12: System und Norm nach Louis Hjelmslev: Essais linguistiques. Paris 1971. Schema nach nach Krainz (1980: 30)
Abbildung 13: System und Norm nach Wolfgang Pollak: Die sprachliche Normproblematik in linguistischer, soziologischer und didaktischer Sicht. In: „Linguistik und Didaktik“ 13/1973, S. 53-58.
Schema nach Krainz (1980: 29).
Krainz resümiert dies so: „Das System ist also die Gesamtheit der Oppositionsstrukturen einer Sprache, während die Norm die Sprache als soziale Institution kennzeichnet.“ Das System konstituiere also die Summe der möglichen sprachlichen Realisierungen und Sprachfunktionen, die Norm die üblichen Realisierungen der Funktionen (vgl. Krainz 1980: 30). Die Sprache besteht aus fest kodifizierten präskriptiven Regeln als Rahmen (System), die nicht alle durch den üblichen Sprachgebrauch (usage) genutzt werden und zudem von ihm manchmal durch konkrete Sprachhandlungen (actes) modifiziert und umgangen werden können.
2.1.1.1. Dogmatismus vs. Laxheit
Diese im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Ansichten teilt natürlich nicht jeder. Die Immortels der Académie française würden dies (zumindest in der traditionell von ihnen vertretenen normkonservativen Auffassung) nicht unterschreiben. Diesbezüglich stellt Grebe (1966: 146) über das Verhältnis von Sprachnorm und Sprachwirklichkeit fest, dass „je mehr Sprachwirklichkeit sichtbar wird, desto weniger Normen bleiben bestehen. Und umgekehrt kann man sagen: je weniger Sprachwirklichkeit sichtbar wird, desto leichter war es, Bücher über die ‚Sprachdummheiten‘ zu schreiben. Es war der Nährboden der dogmatischen Sprachpfleger“. Insgesamt gesehen, so Jäger (1971: 165), beruhe „die kodifizierte Norm auf einem kleinen Ausschnitt aus dem tatsächlichen Sprachgeschehen“. Er fügt ironisch hinzu: „Die kodifizierte Norm richtet sich nach Texten, die sich nach der kodifizierten Norm richten: im biologischen Bereich nennt man so etwas Inzucht“.
Summa summarum steht die Literatur überwiegend auf dieser Linie des zwar angestrebten Standards der Zielsprache (vgl. Krainz 1980: 38), aber auch einer Argumentation „gegen eine Selektion nach sprachpuristischen Kriterien“ (Krainz 1980: 38). In der Dualität „Sprachgebrauchsregularitäten vs. sprachnormierende Verhaltensforderungen“ stehen die meisten auf der Seite des Gebrauchs gegen die Präskription, weil die „Sprachnormierung präskriptiver Art […] die Literatursprache vergangener Jahrhunderte zum Vorbild [nimmt]“ und „die kommunikativen Möglichkeiten einschränkt“, was zum Ziel hat, „sprachliche Veränderungen – als gesellschaftspolitisch relevant – möglichst zu unterdrücken.“ (Krainz 1980: 48). Darüber hinaus, trotz aller prinzipiellen „sprachliche[n] Konservativität und Normentreue“ (Jäger 1973: 274), scheint es doch so zu sein, dass „les grammaires se contredisent entre elles“ und dass „les grammairiens sont rarement d’accord entre eux“ (Rojas 1971: 109).
Schmitt (2002: 64-65) spricht sich deshalb gegen eine „norme absolue“ aus und für „des principes moins idéologiques, moins doctrinaires, moins dogmatiques“. Er lehnt jegliche Intoleranz in der Evaluation von Fehlern ab und will gegen eine „norme aristocratique et chauvine“ kämpfen, da die Sprache aus seiner Sicht „est et restera un fait social“. Ich kann mich dem anschließen, allerdings mit einigen bémols. Schmitt nennt in seinem Aufsatz neue Gebrauchsformen, wie zum Beispiel bruisser (für bruire) oder conclusionner (für conclure), die über mein Akzeptanzvermögen hinausgehen, und damit wären wir auf die Subjektivität des Muttersprachlers verwiesen. Auch wenn clôturer (für clore) und solutionner (für résoudre) mir als sehr gebräuchlich im code oral erscheinen, würde ich sie im schriftlichen Gebrauch nicht als richtig betrachten. Diese „évolution du système actuel“ (Schmitt 2002: 52) muss nicht in jedem Fall aufgrund antipuristischer Haltung angenommen werden. Das Larousse-Wörterbuch akzeptiert solutionner als „expression orale courante“. Es wäre bei einer schriftlichen Produktion für eine „expression soignée“ besser, das Verb résoudre zu nutzen1.
Ohne ein Anhänger der Académie française zu sein und indem man sich doch an gewissen Regelwerken der Norm orientiert (wie z.B. am Larousse), denn diese sind ohnehin „des autorités plus importantes que l’Académie française en ce qui concerne les questions de norme et d’usage“ (Berling 2002: 31), darf man sich im schriftlichen wie auch im mündlichen Sprachgebrauch hie und da gegen die Akzeptanz eines malgré que + subjonctif oder sogar eines conclusionner sträuben. Es gilt natürlich, wie hier gezeigt, den code écrit und den code oral zu unterscheiden. Der mündliche Sprachgebrauch ist flexibler, während die Schriftsprache relativ streng bleibt.
Mayr unterscheidet einerseits zwischen einem Norm-System-Begriff der theoretischen Linguistik und einem der angewandten Sprachwissenschaft (Mayr 1985: 36) einerseits und auch andererseits zwischen der linguistischen Kompetenz, die „die Beherrschung eines sprachimmanenten Regelsystems, das sich aus empirischen Sprachäußerungen durch Abstraktion gewinnen lässt“, und der kommunikativen Kompetenz, „der Fähigkeit, seine linguistische Kompetenz situations-, rollen-, handlungsadäquat für sprachliche Kommunikation einzusetzen“ (Mayr 1985: 39). Es geht eben um die Vereinigung von Theorie und Praxis, denn die Sprachnorm ist ein „Bündel von sprachlichen Regeln, das dem in der betreffenden Gruppe tatsächlich üblichen Sprachgebrauch unterliegt“ (Jäger 1973: 275). Und genau darum geht es, wenn man versucht, die Sprachnorm zu definieren: zum einen die Regeln, das System, das „Soll“ zu beachten – und dabei helfen „Autoritäten“, wie zum Beispiel Robert, Grévisse oder Larousse –, und andererseits nicht im Gegensatz, sondern in Verbindung dazu das „Ist“, die Gebrauchsnorm zuzulassen, dem Sprachgefühl Raum zu geben, sich dem, was nicht immer streng nach Vorschrift funktioniert, zu öffnen, wie zum Beispiel dem usage, wie zum Beispiel dem Stil.
2.1.2. Stilnorm und usage
Denn es gibt nicht nur das grammatische System und die linguistische Norm, sondern das Thema der Sprachnorm und des Fehlers führt wie von selbst auch zum Begriff der Stilnorm hin (Kielhöfer 1975a: 48). Am Beispiel des Satzes Il posa le verre devant soi erklärt Kielhöfer, dass eine Aussage einerseits grammatisch und semantisch richtig und andererseits doch nicht korrekt sein kann, und dass die Entscheidung darüber, wie konkurrierende Systeme (wie hier soi und lui) verteilt werden, „von der Stilnorm geregelt“ wird (ebd.), die „im code oral und im code écrit wie auch in verschiedenen begrenzten Teilsprachen [variiert]. Mit den Variationen der Norm variiert auch der Begriff des Fehlers (und das Maß der Inadäquatheit) […]“ (ebd.). Kielhöfer erwähnt Enkvist (1972), für den „sich ein bestimmtes Inventar von linguistischen Merkmalen [jeder Teilsprache] zuordnen [lässt], das sie von anderen Teilsprachen unterscheidet“ (Kielhöfer 1975a: 48). Infolgedessen sei es so, dass „linguistische Einheiten und Regeln […] stilistische Selektionsmerkmale zeigen [können], die bei ihrer Wahl berücksichtigt werden müssen“ (ebd.).
Stil sei eine schwer fassbare Größe und gehöre didaktisch zu den schwierigsten Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts. Dabei gerieten Auslandsaufenthalt und Klassenunterricht vielfach in Kollision (vgl. Kielhöfer 1975a: 52). Die Stilnorm ist nicht so greifbar wie eine klar definierte grammatische Regel. Wie zum Beispiel sollte man mit Neologismen von Lernern umgehen? Es kommt immer wieder die Feststellung, dass nicht durchgängig absolut und definitiv zu entscheiden sei, was komplett richtig bzw. komplett falsch sei: „Der Unterschied von der Sprachnorm zur Stilnorm ist fließend, denn der Unterschied zwischen dem, was man überhaupt nicht sagen kann, und dem, was man in bestimmten Kontexten und Situationen vielleicht doch sagen könnte, ist vielfach nicht genau anzugeben“ (Kielhöfer 1975a: 26f.). Dabei ist Stil aber unumgänglich aufgrund seiner sozialen Funktion: „Wie alle sozialen Institutionen verlangt sie [die Stilnorm] verbindliche Verhaltensweisen von Menschengruppen. Der Sprachteilnehmer, der inadäquat in entsprechender Gesellschaft die Äußerung d)2 […] gebraucht, disqualifiziert sich durch sein sprachliches Verhalten.“
Somit kann man feststellen, dass nicht nur objektive Regeln eine Rolle spielen. Wie schon oben dargestellt, gibt es verschiedene Bezeichnungen, um die subjektive Seite der Sprachnorm zu benennen. Das, was Pollak als Gebrauchsnorm bezeichnet, nennt Hjelmslev usage. Auch er unterscheidet zwischen Norm („sprachimmanent normierender Einfluss des Sprachsystems“) und usage („Gebrauchsregularitäten“). Er fügt aber eine zusätzliche Kategorie hinzu, die er acte („konkrete sprachliche Handlung“) nennt. Und gerade das ist m.E. die Aufgabe der Fehleranalyse: Eine konkrete sprachliche Handlung im Lichte des usage und der Norm zu beleuchten. Hjelmslev – mit seiner pragmatischen Ansicht – bringt es wunderbar auf den Punkt: „Norme, usage et acte sont intimement liés ensemble et se ramènent naturellement à ne constituer qu’un seul objet véritable: l’usage, par rapport auquel la norme est une abstraction et l’acte une concrétisation. C’est l’usage seul qui fait l’objet de la théorie de l’exécution; la norme n’est en réalité qu’une construction artificielle et l’acte d’autre part n’est qu’un document passager“ (Hjelmslev 1971a: 68).
Kielhöfer stellt außer Hallidays Grammatikmodell auch die lexikalische System-Gebrauchs-Theorie vor (Kielhöfer 1975a: 36ff.). Hier geht es nicht mehr um System und um Norm, sondern um Gebrauch, eben um usage. Denn „Hallidays Grammatik- und Lexistheorie ist keine Diagnostik von Systemverstößen auf dem Gebiet der Lexis“. Bei der lexikalischen System-Gebrauchs-Theorie gibt es einfach nur falsche Kollokationen, denn „das Grundmuster für die Relation lexikalischer Einheiten ist das der Kollokation“ (Kielhöfer 1975a: 36). Der Gebrauchstheorie liegt ein Kollokationsmodell zugrunde (Wittgenstein 1953 und Leisi 1952, zitiert nach Kielhöfer 1975a: 37), was bedeutet, dass die Bedeutung einer lexikalischen Einheit ihr Gebrauch sei. Das heißt, dass lexikalische Adäquanz sich am Gebrauch verifizieren lasse (ebd.). Ist eine Kollokation konventionalisiert und entspricht sie dem intendierten Gebrauch, so ist ihre Bedeutung richtig. Eine operationalisierbare Definition von Richtigkeit wäre in diesem Sinne eine Kombination aus semantischer Kongruenz und Wortinhalt. Kielhöfer unterstreicht aber gleich die Schwäche dieses Kollokationsbegriffs: „Er differenziert die Fehler nur graduell, von wahrscheinliche bis unwahrscheinliche Kollokation. Er markiert nicht den prinzipiellen Unterschied zwischen unwahrscheinlich und falsch“ (ebd.). Als Beispiel führt er folgende Ausdrücke an (ebd.: 38):
nappe de neige -> unwahrscheinlich
Il alla au téléphone et choisit. -> falsch (richtig: composa le numéro).
Es gebe wohl Kollokationsregeln, die festlegen, welche Einheiten miteinander verknüpft werden dürfen, aber bei dem Verstoß choisit werden andere Regeln verletzt als in nappe de neige. Die Kollokation (der Wortgebrauch) werde von der Wortbedeutung gesteuert, und sobald semantische Kompatibilität zwischen lexikalischen Einheiten vorhanden sei, sei eine Verknüpfung möglich; nur „dass nicht alle semantisch möglichen Kollokationen auch realisiert werden, geht auf normative Restriktionen zurück“. Am Beispiel von nappe de neige, das nur in ganz bestimmten (poetischen) Kontexten akzeptiert werden kann, zeigt Kielhöfer die Problematik der System-Norm-Abgrenzung, nämlich dass „die Unterscheidung […] nur intuitiv durchzuführen“ sei (Kielhöfer 1975a: 38).
In der Tat schreibt auch Schlieben-Lange (1977: 176) darüber, dass die Linguistik „auf dem Gebiet der Sprachbeschreibung teilweise sehr komplexe Modelle anbieten“ kann, ohne sagen zu können, „inwiefern diese Modelle zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit beitragen können“. Das Fazit dazu sieht bei Kielhöfer (1975a: 29) folgendermaßen aus: Hallidays Grammatikmodell sei sehr praktikabel; die Gebrauchstheorie und das Kollokationsmodell sowie das Modell der Bedeutungsanalyse im Gegensatz dazu zwar realitätsnah, aber nicht sehr nützlich. Darüber hinaus, so Kielhöfer, erfolge „die Feststellung der richtigen Kollokation, d.h. semantischer Kompatibilität […] durch die Kompetenz des Native Speakers, der aufgrund des Kontextes, der Situation und seiner inhärenten Kenntnis semantischer Regularitäten die Entscheidung über lexikalische Richtigkeit“ treffe (ebd.: 43).
Vom System zur Norm, von der Norm zum usage