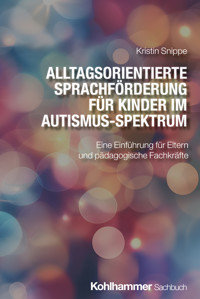
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen, ist eine besondere Aufgabe. Sprache kann für sie ein Schlüssel zur Selbstbestimmung sein. Doch wie können wir ihnen erfahrbar machen, dass sie durch Sprache wirksam sind? Wie können wir für sie Freude an der Kommunikation erlebbar machen? Dieses praxisorientierte Buch richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Eltern. Mit vielen Praxisbeispielen zeigt die Autorin, wie Sprachförderung alltagsnah gestaltet werden kann. Sie beschreibt einen Ansatz, der alle Lebenssituationen autistischer Kinder umfasst. Als besondere Themen werden die Einbindung der Unterstützten Kommunikation und die Beschäftigung der Kinder mit der digitalen Welt beleuchtet. Kristin Snippe ist Logopädin, Lehrkraft und Master der Psychologie kindlicher Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mit autistischen Kindern und verbindet fundiertes Wissen mit erprobten Strategien für eine gelingende Sprachförderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort der Autorin
1 Autismus-Spektrum
1.1 Autismus-Spektrum – Was ist das?
1.2 Wie kommt es zur Diagnose?
1.3 Wie entsteht Autismus?
2 Alltag mit Menschen im Autismus-Spektrum
2.1 Wie autistische Menschen ihren Alltag wahrnehmen
2.2 Die Situation der Eltern autistischer Kinder
2.3 Die Perspektive von Pädagoginnen und Pädagogen
3 Sprachentwicklung und Autismus
3.1 Wie das Kind zur Sprache kommt
3.2 Von Beginn an anders: Sprachentwicklung autistischer Kinder
3.3 Echolalien – eine ganz besondere Ressource
3.4 Sprachverständnis
3.5 Kommunikation beobachten und Sprachentwicklung einschätzen
3.6 Mehrsprachigkeit im Autismus-Spektrum
4 Grundprinzipien der Sprachförderung autistischer Kinder
4.1 Sicherheit ist wichtig
4.2 Struktur: Die Übersicht behalten
4.3 Sprechen: Weniger ist mehr
4.4 Ziele: Realistisch und bedeutungsvoll
4.5 Motivation: Der Sprache einen Sinn geben
5 Alltagsorientierte Sprachförderung im Autismus-Spektrum
5.1 Warum ist eine alltagsorientierte Sprachförderung wichtig?
5.2 Prinzipien alltagsorientierter Sprachförderung: Naturalistischer Ansatz
5.3 Sprachanbahnung: Über die Handlung in die Sprache
5.4 Genauer und komplexer: Wortschatz und Grammatik
5.5 Klar gesagt: Artikulation und Lautbildung
5.6 Soziale Kommunikation stärken
5.7 Lesen und Schreiben
6 Unterstützte Kommunikation
6.1 Was ist »Unterstützte Kommunikation«?
6.2 Grundprinzipien der Unterstützten Kommunikation
6.3 Kommunikation über Bilder und Symbole
6.4 Kommunikation über Körpersprache und Gebärden
6.5 Elektronische Hilfen
7 Digitale Technologien in der Sprachförderung
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Die Autorin
Kristin Snippe ist Logopädin, Lehrkraft und Master der Psychologie kindlicher Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mit autistischen Kindern und verbindet fundiertes Wissen mit erprobten Strategien für eine gelingende Sprachförderung.
Kristin Snippe
Alltagsorientierte Sprachförderung für Kinder im Autismus-Spektrum
Eine Einführung für Eltern und pädagogische Fachkräfte
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-044174-3
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-044175-0epub:ISBN 978-3-17-044176-7
Vorwort der Autorin
Als ich begann, logopädisch mit autistischen Kindern zu arbeiten, wusste ich noch nicht viel über Autismus. Ich hatte »Buntschatten und Fledermäuse« von Axel Brauns gelesen. Das gab mir ein erstes Gefühl für Autismus und für die Bedürfnisse meiner kleinen Klienten.
Viele Klientinnen und Klienten, bei denen ich in der Rückschau vermute, dass sie autistisch waren, waren damals nicht diagnostiziert. Ihre Eltern kamen in die logopädische Praxis, weil die Sprachentwicklung ausblieb. Die Kinder fingen nicht mit dem Sprechen an oder lautierten unverständliche Phrasen oder Neuschöpfungen vor sich hin.
Als ich etwas später in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitete, näherte ich mich dem Thema Autismus immer mehr an – über die Praxis und über die Fachliteratur. Ich lernte viel von den Kindern, mit denen ich arbeitete. Dass sie nichts ohne einen guten Grund machten. Dass viele von ihnen ganz besondere Interessen hatten – manchmal für bestimmte Themen (Katzen, Bagger, Züge), manchmal für besondere Oberflächen oder Geräusche. Ich lernte Kinder kennen, die den ganzen Tag herumrannten, und Kinder, die sich stundenlang mit einer Sache beschäftigten. Und ich lernte Kinder kennen, die um sich schlugen und schrien, wenn etwas Unvorhergesehenes passierte, eine Anforderung gestellt wurde oder die wegrannten, wenn die Neonröhren im Schulraum flackerten. Während ich als junge Therapeutin Schritt für Schritt lernte, mit diesem Verhalten umzugehen, lernte ich auch zu verstehen. Heute beantworte ich keine Frage nach »Was mache ich, wenn das Kind ...« ohne zu fragen: »Warum macht das Kind das? Was gibt es für einen guten Grund? Wie geht es dem Kind dabei?«. Ich habe gelernt, Kontakt zu Kindern aufzunehmen, die noch keine Idee von gegenseitiger Interaktion zu haben schienen oder für die Kommunikation bedrohlich oder überfordernd schien. Ich habe nach und nach gelernt, die besonderen Bedürfnisse meiner autistischen Klienten zu identifizieren. Aber auch, ihre Interessen zu erkennen und zu teilen. Ihren Fokus zu übernehmen und mich gemeinsam mit ihnen über Dinge zu begeistern, die neurotypischen Erwachsenen oft unwichtig oder sogar absurd erscheinen (Papierschnipsel, die durch die Luft fliegen, Wasserhahn an/aus, verschiedenste Arten von Kirchenglocken). Ich habe gelernt, dass ich zu Beginn der Therapie nicht die Kinder in meine Welt zwingen, sondern mich in ihre Welt begeben sollte. Über diesen gemeinsamen Fokus, und über das Teilen der Begeisterung meiner Klienten, habe ich schließlich gelernt, Kommunikation und Sprache mit den Kindern aufzubauen. Viele Kinder haben mit mir sprechen gelernt – und ich mit ihnen kommunizieren.
In diesem Buch möchte ich allen, die mit autistischen Menschen und besonders mit autistischen Kindern arbeiten, leben und ihren Alltag erleben, einen Zugang dazu bieten, wie wir mit ihnen Sprache und Kommunikation aufbauen und fördern können. Dabei geht es mir nicht darum, Autismus zu »heilen«, Menschen aus dem Autismus »herauszuholen« oder sie grundlegend zu ändern. Es geht mir darum, unsere Kommunikation für sie übersichtlich zu gestalten, vorhersehbar, verständlich und bedeutsam. Es geht darum, Wege zu eröffnen, dass autistische Kinder Kontakte zu anderen aufnehmen können, wenn sie es wünschen. Und darum, dass sie ihre Bedürfnisse äußern können und eine höhere Kontrolle über ihre Umwelt und ihren Alltag erlangen. Nicht zuletzt geht es um Spaß – gemeinsam Spaß an der Interaktion zu haben, zu entdecken, wie kleine gemeinsame Routinen uns zum Lachen bringen, uns zusammenschweißen und unsere Beziehungen stärken.
Ich werde in diesem Buch Sprachentwicklung und Sprachförderung so darzustellen, dass die Methodik und die Hintergründe allgemein verständlich, aber auch fachlich korrekt und aussagekräftig sind. Dazu werde ich mitunter ins Detail gehen und Hintergründe erklären. Ich werde möglichst oft auf Fachbegriffe verzichten oder, wenn sie notwendig sind, diese erklären. Ich werde in jedem Kapitel Beispiele geben und verständliche Literatur zum Weiterlesen empfehlen.
Es ist mir wichtig, wertschätzend und respektvoll über Menschen im Autismus-Spektrum zu schreiben. Dazu orientiere ich mich an Formen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als für autistische Menschen am wenigsten offensiv gelten. Ich werde »autistische Menschen«, »autistische Kinder« etc. oder »Menschen/Kinder im Autismus-Spektrum« schreiben. Ich werde von »neurodiversen« und »neurotypischen« Menschen schreiben.
Sollten Ihnen trotz meines Bemühens um eine respektvolle und wertschätzende Sprache »Schnitzer« auffallen, nehmen Sie gern Kontakt zu mir auf – diese können in eventuellen neuen Auflagen korrigiert werden.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an diesem Buch. Ich hoffe, dass es sich leicht liest und Erkenntnisse, Gedanken, Impulse zum Handeln und zum Hinterfragen bringt. Und ich freue mich, wenn es hilft, Kommunikation aufzubauen und zu fördern, autistische Kinder und Erwachsene zu verstehen und Ideen für sie und mit ihnen zu entwickeln.
1 Autismus-Spektrum
Karl, vier Jahre
Karl ist ein vierjähriger Junge. Er liebt seine Spielzeugautos und verbringt Stunden damit, sie immer wieder ein- und auszupacken. Er zeigt auch ein starkes Interesse an bestimmten Details, wie zum Beispiel den Rädern der Autos, die er mit großer Hingabe untersucht. Als seine Großeltern ihm ein neues Auto schenken, löst er zuerst ein Rad ab. In Bezug auf seine Sprachentwicklung zeigt Karl Schwierigkeiten. Mit vier Jahren spricht er noch nicht. Er geht zwar in einen Kindergarten, spielt dort aber nicht mit den anderen Kindern.
Karls Eltern haben früh bemerkt, dass sich sein Verhalten von anderen Kindern unterscheidet. Sie haben ärztliche Hilfe gesucht, als er drei war. Bis dahin diskutierten sie oft, ob Karl nicht nur einfach sehr schüchtern sei. Zuerst wurde er von der Kinderärztin zur Logopädie überwiesen. Eine Sprachtherapeutin hat die Familie nach einem halben Jahr an einen Kinder- und Jugendpsychiater für eine Autismus-Diagnostik empfohlen.
Karls Großeltern sind der Meinung, dass Karls Verhalten auf die Erziehung seiner Eltern zurückzuführen sei. Sie glauben, dass die Eltern zu nachsichtig seien und Karl zu sehr in seinen wiederkehrenden Handlungen unterstützten. Sie verstehen nicht, dass Karls Verhaltensweisen Anzeichen für eine Entwicklungsbesonderheit sein könnten und betonen stattdessen die Bedeutung einer konsequenteren Erziehung.
1.1 Autismus-Spektrum – Was ist das?
Gleich zu Beginn dieses Buches nähern wir uns einer der großen Fragen: Was ist Autismus eigentlich? Mit einer Erläuterung der Diagnosekriterien nach den gängigen Klassifikationssystemen würden wir es uns sicher am leichtesten machen. Ich möchte aber anders anfangen. Um diese Frage zu erörtern, hilft es, weitere Fragen zu stellen.
♦
Was ist Autismus als Diagnose?
♦
Was ist Autismus bezogen auf die Neurologie und Kognition?
♦
Was bedeutet Autismus für autistische Menschen?
Kristien Hens und Raymond Langenberg plädieren dafür, die Frage »Was ist Autismus?« aus drei verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Autismus habe eine medizinische, eine kulturelle und eine individuelle Bedeutung (Hens & Langenberg 2018, 8).
Wir werden uns allen drei Perspektiven nur kurz annähern, denn das Ziel dieses Kapitels ist nicht, die Frage bis ins Kleinste zu beantworten. Es geht vielmehr darum, fachliches Wissen zum Thema Autismus zu vermitteln, aber auch ein Gefühl für autistische Menschen und ihre Belange zu bekommen. Nicht zuletzt wollen wir mit Mythen aufräumen und Theorien kennenlernen, die uns dabei helfen, besser über das Thema nachzudenken und darüber ins Gespräch zu kommen.
Reflexionsfrage:
Was ist Autismus für Sie? Welche Ideen haben Sie dazu? Was davon ist Faktenwissen? Was könnten Mythen sein?
Die medizinische Sichtweise
Autismus wird in der medizinischen Diagnostik anhand von bestimmten Kriterien identifiziert, die in Diagnosesystemen festgelegt sind. Diese heißen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) und ICD-11 (International Classification of Diseases). Das in Deutschland geltende Diagnosesystem ICD-11 setzt folgende Merkmale für eine Autismus-Diagnose voraus: »Anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie [...] eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind« (WHO 2022, 6 A02). Es geht also um Besonderheiten im Sozialverhalten, in der Kommunikation und um wiederkehrende Handlungen.
Wichtig ist auch, dass die Symptome sich bereits im frühen Kindesalter zeigen (auch wenn sich einige weitere erst im Laufe des Lebens entwickeln können) und dass die Einschränkungen zu einer Beeinträchtigung in alltäglichen Settings (z. B. Familie, Kindergarten, Schule) führen. Es werden diagnostische Untergruppen gebildet, je nachdem, ob das Kind in seiner Intelligenz und seiner Sprachentwicklung beeinträchtigt ist. Wie genau diese Diagnose gestellt wird, klären wir in Kapitel 1.2 (▸ Kap. 1.2). Aus medizinischer Sicht ergibt sich eine Diagnose also aus einer defizitorientierten Sicht: Wenn bestimmte Defizite in der Entwicklung vorliegen und diese zu Beeinträchtigungen im Alltag führen, und wenn dies alles durch keine anderen Gründe oder Bedingungsgefüge erklärbar ist, kann eine Diagnose gestellt werden. Mediziner betrachten Autismus als eine neurologische Entwicklungsstörung, bei der es zu Unterschieden in der Struktur des Gehirns und seiner Funktion kommt. Der aktuelle medizinische Begriff, den die ICD-11 vorgibt, ist »Autismus-Spektrum-Störungen«. Dabei sollten wir das Spektrum aber nicht als lineares System betrachten. Es geht hier nicht darum, dass jemand nur ein bisschen autistisch oder sehr autistisch sein könnte.
Was heißt »Autismus-Spektrum?«
Autismus ist eine kategoriale Diagnose. Das heißt: Man ist autistisch oder nicht. Der Begriff des »Autismus-Spektrums« führt oft zu Missverständnissen. Häufig wird vermutet, dass das »Spektrum« bedeutet, dass jemand ein bisschen autistisch sein kann und jemand anders sehr autistisch ist. Die Idee »Sind wir nicht alle ein bisschen autistisch?« – ist falsch. Man ist autistisch oder nicht. Der Begriff des Spektrums bezieht sich nicht darauf, wie stark ausgeprägt der Autismus bei einer Person ist. Es geht darum, dass verschiedene Merkmale bei individuellen autistischen Personen qualitativ unterschiedlich ausgeprägt sein können.
In der medizinischen und pädagogischen Welt werden häufig noch die Begriffe »high-functioning« und »low functioning« verwendet. Diese sind nicht nur sehr eindimensionale, leistungsbezogene Begriffe, sie blenden auch die Rolle der Umwelt aus. Dass ein Mensch »high functioning« oder »low functioning« wäre, würde bedeuten, dass der Mensch zum einen rein daran gemessen wird, wie er sich den äußeren Leistungsansprüchen anpassen kann. Zum anderen würde man davon ausgehen, dass das »Funktionieren« im Alltag eine reine Sache des autistischen Menschen und seiner spezifischen Veranlagung wäre. Umwelteinflüsse, die Frage des pädagogischen Settings und die Verantwortung anderer Menschen (insbesondere pädagogischer Personen) in diesen Settings werden hier ausgeblendet. Wenn man Flexibilität, Personalschlüssel und Fortbildungen zu Autismus betrachtet, ergibt es vielleicht eher Sinn, von »High-functioning-Settings« und »Low-functioning Settings« zu sprechen.
Reflexionsfrage:
Haben Sie schon einmal gesehen, wie sich das Umfeld einer autistischen Person auf ihr tägliches Leben auswirkte, sei es positiv oder negativ? Was denken Sie, können Pädagogen tun, um das Leben für autistische Personen einfacher zu gestalten?
In diesem Zusammenhang spreche ich mich auch betont kritisch zum Begriff »autistische Züge« aus. Dieser Begriff wird im pädagogischen Alltag sehr häufig verwendet. Zu sagen, ein Kind habe »autistische Züge«, lässt vermuten, dass jemand ein bisschen autistisch sein könnte. Das widerspricht dem Autismus als kategorialer Diagnose (man ist autistisch oder man ist es nicht). Häufig wird der Begriff verwendet, wenn Fachpersonen in Sozialberufen ständig wiederkehrendes Verhalten bei einem Menschen sehen, aber (bisher) keine offizielle Autismus-Diagnose vorliegt. Für Eltern und Angehörige ist dieser Begriff sehr verwirrend. Nicht alle Eltern wissen, dass der Erzieher im Kindergarten oder die Sprachtherapeutin keine Autismus-Diagnose fällen können und dürfen. Der leichtfertige Umgang mit dem Begriff »Autismus« kann Eltern vor den Kopf stoßen. Vielen ist klar, dass es sich um etwas dauerhaftes handelt. Um Missverständnisse und Kompetenzüberschreitungen zu vermeiden, sollte der Begriff »Autismus« in Bezug auf einen Menschen nur verwendet werden, wenn tatsächlich eine Autismus-Diagnose vorliegt. Im sonstigen Fall ist es ratsam, sich auf eine genaue Beschreibung des Verhaltens zu beschränken. Ähnliches gilt für die Idee, Kindern einen »Pseudo-Autismus« zu attestieren. Dieser Begriff wird mitunter verwendet, wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten nach extremem Medienkonsum zeigen. Besonders dramatisch ist hier, dass der Begriff »Autismus« in diesem Fall nicht für eine genetisch bedingte Besonderheit, sondern für Auffälligkeiten in Folge eines Versagens in der Betreuung des Kindes attestiert wird. Diese bedenklichen Ideen wurden zuletzt um 1970 von Bruno Bettelheim geäußert (nachzulesen in ▸ Kap. 1.3).
Die kulturelle Sichtweise
Jessica Nina Lester und Michelle O'Reilly (2021) betonen in ihrem Buch über die verschiedenen Sichtweisen auf Autismus, dass Autismus immer auch eine soziale Konstruktion sei (S. 59 ff). Dabei gehe es nicht darum, die Realität der Betroffenen zu leugnen. Vielmehr ist das medizinische Verständnis von Autismus eng an unser soziales Verständnis von Normalität geknüpft. Das, was als »normal« angesehen wird, verändert sich aber mit der Zeit und zeigt Unterschiede von Kultur zu Kultur. Auch sei die Idee einer »normalen Gesellschaft« sehr anzuzweifeln, da sie die breite Diversität in der Gesellschaft ignoriere. Außerdem, so die Autorinnen, sei das soziale Umfeld stark daran beteiligt, wie die einzelne Person Autismus erlebe. Wenn ein autistisches Kind eine Schule oder einen Kindergarten besucht, wird sein Erleben und Verhalten zum Beispiel sehr stark davon abhängen, welche Art von Struktur und welches Verständnis für seine Bedürfnisse es dort erlebt.
Francesca Happé und Uta Frith (2020) schreiben darüber, wie sich das Verständnis von Autismus über die Jahrzehnte verändert hat. Noch um 1980 wäre ein Kind, das auf andere zugeht und sehr freundlich wirkt, nicht als autistisch eingeordnet worden (S. 218). Die Autorinnen beobachten eine Entwicklung der Definition von Autismus von einem sehr eng gefassten Verständnis zu einem weiteren Konzept. Autismus hat sich von einer sehr seltenen Disposition zu einem häufiger vorkommenden Phänomen entwickelt. Früher fand man in der Fachliteratur fast ausschließlich Informationen zum Autismus im Kindesalter. Heute betrachten wir die ganze Lebensspanne (S. 219). Nach wie vor ist aber die Versorgung autistischer Erwachsener mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten sehr viel schlechter aufgestellt. Statt von einem »Autismus« werden wir, so die Autorinnen, in Zukunft wohl von vielen Konzepten von Autismus sprechen. Autismus wird ein Sammelbegriff für verschiedene Dispositionen werden. Diese führen alle zu ähnlichen Schwierigkeiten im praktischen und sozialen Alltag. Das bedeutet auch, dass das Verständnis von Autismus sich von der Idee der Entwicklungsstörung wegbewegen wird. Der Fokus wird sich, so die Autorinnen, mehr dorthin bewegen, dass wir anerkennen, dass Menschen im Autismus-Spektrum mit ihren Besonderheiten vor allem durch die Anforderungen der neurotypischen Welt eine Einschränkung erfahren.
Eine kulturelle Veränderung, die die medizinische Sicht in Frage stellt oder zuweilen ergänzt, ist in diesem Zusammenhang die wachsende Selbstvertretung aus der autistischen Community. Viele Menschen im Autismus-Spektrum nutzen Blogs und die sozialen Medien, um ihre Sicht auf Autismus zu teilen. Die Neurodiversitätsbewegung bietet damit eine alternative Sichtweise auf das Thema an. Kernbotschaft ist, dass unterschiedliche Verdrahtungen des Gehirns normal seien. Die Vertreter:innen plädieren für die Anerkennung dieser genetischen und biologischen Vielfalt und fordern, dass der Fokus auf Fähigkeiten, statt auf Defiziten liegen sollte. »Neurodivers« schließt nicht nur autistische Menschen, sondern zum Beispiel auch Menschen mit ADHS oder anderen Besonderheiten der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung ein. Die Abgrenzung erfolgt gegenüber einer Welt, die auf Werten der »neurotypischen« Menschen beruht. Fähigkeiten und Beeinträchtigungen entstehen so jeweils abhängig vom situativen und sozialen Kontext. Die Neurodiversitätsbewegung setzt sich damit für die Rechte autistischer Menschen ein und verweigert die generelle Bezeichnung als »Störung«. Theunissen (2024) stellt in seinem Artikel zum Autismus in der Schulpädagogik ein alternatives Autismus-Konzept vor, das ursprünglich von der größten Selbstorganisation autistischer Menschen, dem Autistic Self Advocacy Network (ASAN), entwickelt wurde. Dieses Konzept eignet sich für eine pädagogische Annäherung, die die Ressourcen und Bedarfe autistischer Menschen im Blick behält.
Merkmale eines alternativen Autismus-Konzeptes (ASAN nach Theunissen, 2024)
1.Wahrnehmungsbesonderheiten
2.Atypisches Lern- und Problemlösungsverhalten sowie spezielle Denkmuster
3.Motorische Besonderheiten
4.Bedürfnis nach Ordnung, Routine und Regelmäßigkeit
5.Sprachliche Besonderheiten
6.Soziale Besonderheiten
7.Emotionale Besonderheiten
8.Stärken, außergewöhnliche Fähigkeiten und individuelle (spezielle) Interessen
Reflexionsfrage:
Vergleichen Sie das Konzept nach ASAN mit den Diagnosekriterien in Kapitel 1.2 (▸ Kap. 1.2). Welche Vorteile sehen Sie in der Anwendung von diesem alternativen Autismus-Konzept für die pädagogische Arbeit?
Die individuelle Sichtweise
Wenn man darüber schreibt, was Autismus ist, darf man sich nicht nur auf wissenschaftliche Definitionen zurückziehen. Damit würden wir die Erfahrung autistischer Menschen auslassen. Was Autismus für autistische Menschen bedeutet, stellt sicher keine generell kollektive Erfahrung und Wahrnehmung dar. Das Erleben bleibt individuell. Trotzdem ist es unverzichtbar, um einen empathischen, verstehenden und vor allem respektvollen Zugang zum Thema zu erreichen. Viele autistische Personen erzählen zum Beispiel, dass das Aufnehmen von Blickkontakt zu einer Vielzahl fremder Personen unangenehm, belastend und anstrengend sei. Das bedeutet für die therapeutische Zielsetzung, dass ein Blickkontakt-Training mit dem Ziel des Transfers in alle Alltagssituationen nicht im Sinne des autistischen Klienten ist. Die individuelle Sichtweise hilft, autistische Perspektiven einschätzen zu können. So können therapeutische Interventionen gestaltet werden, die nicht darauf abzielen, autistische Personen dazu zu bewegen, neurotypisches Verhalten nachzuahmen. Es geht vielmehr darum, ihnen eine größere Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Um eine Vorstellung verschiedener Innensichten von Autismus zu bekommen, hilft der Blick in Blogs, Biografien, die sozialen Medien und natürlich das direkte Gespräch mit autistischen Personen.
In ihrem Blog »The Other Side« schreibt Sonia Boue (2021) darüber, wie sie sich als Spätdiagnostizierte ihre autistische Identität erarbeitet. Sie teilt ihr persönliches Verständnis dessen, wie sie ihre tägliche Welt erlebt. Boue erklärt, dass die Autismus-Diagnose häufig eine Wende im Leben autistischer Personen darstelle. Eine späte Diagnose könne bedeuten, dass die autistische Person das eigene Scheitern und das Erleben von Defiziten in ein neues Verstehen von sich selbst umforme. Sie erzählt, dass sie in vielen Situationen von ihrer Außenwelt als zu langsam beurteilt wurde. Ihre Umwelt habe nicht verstanden, dass sie ganz im Gegenteil alles um sich herum viel zu schnell verarbeitet habe. Sie diskutiert Begriffe und Fachbegriffe und wir dürfen sie dabei begleiten, wie sie zum Beispiel die Begriffe »Sozial beeinträchtigt« und »Neurotypisch« zuerst annimmt, dann reflektiert, ablehnt und durch für sie passendere Begriffe ersetzt. Auch die Innensicht auf den eigenen Autismus ist also nicht statisch. Sonia Boue erzählt, dass sie ihre Außenwelt mitsamt den neurotypischen Anforderungen oft als »feindlich« wahrnimmt und dass das Maskieren ihrer autistischen Individualität (also das Vortäuschen, dass sie neurotypisch sei) eine Menge Energie beansprucht. Sich daran abzuarbeiten, sich neuro-normativen Ansprüchen anzupassen, um eine neurotypische Person »nachzuäffen«, lehnt sie ab. In seinem Buch »Unmasking Autism« beschreibt Devon Price (2022) seinen eigenen Weg zur autistischen Identität. Er stellt die Folgen eines konsequenten Maskierens des Autistisch-Seins im Alltag deutlich dar: Erschöpfung, Burnout, Ablehnung der eigenen Besonderheiten bis zum Selbsthass. Price lässt uns durch Interviews mit autistischen Menschen deren Erleben ihrer autistischen Identität kennenlernen und zeigt Wege auf, wie wir Autismus neu denken und eine inklusive Gesellschaft formen können.
In den sozialen Medien und Biografien finden sich nicht nur Diskussionen über das Erleben des eigenen Alltags, sondern auch Reflektionen eigener Erfahrungen in therapeutischen und pädagogischen Settings. So beschreibt Axel Brauns (2004) seine Erfahrungen in der Sprachtherapie, und Peter Schmidt gibt uns einen Eindruck »Wie ich als Autist die Schulzeit (über)erlebt habe« (Schmidt 2020, 5 – 13). Der autistische Blogautor James Ward-Sinclair sagt, dass es für ein umfassendes Verständnis von Autismus entscheidend ist, so viele verschiedene Stimmen und Meinungen wie möglich zu bekommen (Ward-Sinclair 2017, o.S.).
Zum Weiterlesen: Autismus aus Sicht autistischer Personen
Bücher
Brauns, Axel (2004): Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt. München: Goldmann Verlag.
Zimmermann, Maria (2023): Anders, nicht falsch. Zürich: Kommode Verlag.
Schreiter, Daniela (2014): Schattenspringer. Wie es ist, anders zu sein. Nettetal: Panini Verlag.
Price, Devon (2022): Unmasking Autism. The power of embracing our hidden neurodiversity. London: Monoray.
Blogs
Sonia Boue: The other side. https://soniaboue.wordpress.com
James Ward-Sinclair: Autistic and unapologetic. https://autisticandunapologetic.com
Nicole Bornhak: Unbemerkt. https://www.unbemerkt.eu/de/
Quellen
Boue, S. (2021): The other side. Abrufbar unter https://soniaboue.wordpress.com
Brauns, A. (2004): Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt. München: Goldmann Verlag.
Hens, K., & Langenberg, R. (2018): Experiences of Adults Following an Autism Diagnosis. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97973-1
Lester, J. N., & O'Reilly, M. (2021): The Social, Cultural, and Political Discourses of Autism (1st ed. 2021.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-024-2134-7
Happé, F., & Frith, U. (2020): Annual Research Review: Looking back to look forward – changes in the concept of autism and implications for future research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218 – 232. https://doi.org/10.1111/jcpp.13176
Price, D. (2022): Unmasking Autism. The power of embracing our hidden neurodiversity. London: monoray.
Schmidt, P. (2020): Wie ich als Autist die Schulzeit (über)erlebt habe. Schriftenreihe einer für alle – Die inklusive Schule für die Demokratie. Abrufbar unter https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/wie-ich-als-autist-die-schulzeit-ueb-erlebt-habe
Ward-Sinclair, J. (2017): Autistic and Unapologetic. Abrufbar unter: https://autisticandunapologetic.com
World Health Organization – WHO (2022): International classification of diseases ICD-11 – deutsche Version. Abrufbar unter https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html abgerufen am 03. 05. 2024
1.2 Wie kommt es zur Diagnose?
Eine Frage vorweg: Wozu überhaupt eine Diagnose? Diese Frage ist ein äußerst berechtigter und oft von Fachpersonen und Eltern diskutierter Aspekt. Die Frage stellt uns vor die Herausforderung, die Vor- und Nachteile einer Diagnose sorgfältig abzuwägen.
Wozu ist die Autismus-Diagnose da?
♦Grundlage für passende therapeutische und pädagogische Interventionen
♦Finanzierung von und Zugang zu Hilfen in verschiedenen Lebensbereichen
♦Ausschluss anderer Ursachen für die Besonderheit, die einen anderen Umgang damit erfordern (z. B. medizinisch)
♦Identitätsbildung für die betroffene Person (»Warum bin ich anders?«)
♦Besseres Verständnis durch Mitmenschen
♦Erleichterung der Schuldfrage für Eltern (Verhalten ist nicht Ergebnis »falscher Erziehung«)
Reflexionsfrage:
Wann ist es für Sie im Schul- oder Alltagsleben nützlich, das Verhalten einer Person mit einer Diagnose zu verstehen? Haben Sie dadurch eine Idee, was diese Person braucht? Wann behindern Diagnosen eher, als dass sie helfen?
Es gibt gerade unter Eltern die Bedenken, dass eine Diagnose stigmatisierend wirken könnte. Einige Eltern und Experten befürchten, dass sie das Kind auf eine bestimmte Art und Weise »etikettieren« könnte, was möglicherweise negative Auswirkungen auf die soziale Integration und das Selbstwertgefühl eines Kindes haben könnte. Andererseits ermöglicht eine klare Diagnose die gezielte Unterstützung und maßgeschneiderte Interventionen für die betroffene Person. Hierdurch können individuelle Bedürfnisse besser erkannt und effektiver adressiert werden. Wenn wir wissen, dass eine Person im Autismus-Spektrum ist, können wir uns z. B. besser herleiten, welche Gründe sie für ihr Verhalten und welche Bedürfnisse sie im Alltag hat. Auch für die autistische Person selbst kann es hilfreich sein, die eigenen Besonderheiten mit der Diagnose zu verbinden. Sie kann so einen Teil der eigenen Identität in Worte fassen. Den Begriff »Autismus« oder »Neurodivers« für sich zu verwenden, bedeutet, eine Gemeinschaft von Menschen zu finden, die die Diagnose teilen und denen es ähnlich geht.
Es ist wichtig, diese Diskussion um das Diagnostizieren aufrechtzuerhalten und eine ausgewogene Perspektive einzunehmen. So können wir sicherzustellen, dass Menschen die bestmögliche Unterstützung erhalten, ohne dabei unnötige Etikettierungen oder Einschränkungen zu verursachen. Eine Diagnose sollte sorgfältig durchdacht sein und die neurodiverse Person ins Zentrum des Prozesses stellen.
Autismus ist eine klinische Diagnose. Das bedeutet, dass die Diagnose (noch) nicht durch einen Gentest (auch wenn Autismus genetisch ist) oder ein anderes bildgebendes Verfahren (zum Beispiel eine Kernspintomographie oder einen Bluttest) gefällt wird. Die Autismus-Diagnose wird durch die Beobachtung des Verhaltens einer Person und durch Befragungen ermittelt. Darum kann es sehr kompliziert und langwierig sein, bis eine klare Diagnose ausgesprochen wird.
Adams und Matson (2018) betonen, dass in der Vergangenheit Diagnosen für Entwicklungsunterschiede, insbesondere im Autismus-Spektrum, üblicherweise erst ab Eintritt ins Schulalter gestellt wurden. In jüngster Zeit zeigt sich jedoch ein deutlicher Wandel hin zur frühen Kindheit. Dies ist auf mehrere maßgeblichen Faktoren zurückzuführen.
Eine entscheidende Rolle spielen hierbei zwei Faktoren: Ein gesteigertes Bewusstsein für Autismus und eine verbesserte Infrastruktur. Es gibt heute mehr diagnostische Einrichtungen und geschultes pädagogisches Personal, das frühzeitig auf Entwicklungsbesonderheiten aufmerksam wird. Cervantes, Matson und Goldin (2018) betonen, dass die meisten Eltern Anzeichen von Autismus bei ihren Kindern im ersten oder zweiten Lebensjahr erkennen und dass eine zuverlässige Diagnose bereits im Alter von 2 Jahren gestellt werden könne.
Es fällt auf, dass viele Kinder, die später als autistisch diagnostiziert werden, zunächst in sprachtherapeutische Praxen kommen, weil sie Schwierigkeiten im Spracherwerb haben. Nicht selten sind es die Sprachtherapeuten selbst, die aufgrund ihrer Expertise frühzeitig Anzeichen für Autismus erkennen. Die Kinder werden dann zur genauen Diagnostik weiterverwiesen. Eine frühzeitige Diagnosestellung und die darauf aufbauende maßgeschneiderte Unterstützung sind sehr wichtig für die positive Entwicklung des Kindes. Adams und Matson (2018) betonen, dass die frühe Diagnose sich nicht nur positiv auf die individuellen Fortschritte des Kindes auswirkt, sondern auch die Belastung der Familie reduzieren kann.
Reflexionsfrage:
Wann hatten Sie als Eltern das erste Mal das Gefühl, das etwas mit Ihrem Kind anders ist? Was hat die Diagnose für Sie verändert?
Selbst wenn eine eindeutige Autismus-Diagnose noch nicht gestellt werden kann, ist eine Verdachtsdiagnose oder das Erkennen von Hinweisen auf das Autismus-Spektrum hilfreich, um entsprechende Anpassungen und Unterstützungen zu ermöglichen. Falls das Kind ohnehin bereits in ergo- und logopädischer Behandlung ist, können die Fachkräfte gezielt erkunden, ob Autismus-spezifische Methoden beim Kind wirksam sind. Unabhängig davon, ob die Diagnose bereits endgültig gesichert ist, könnten diese Methoden bereits weiterhelfen. Es ist wichtig, individuelle Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und adäquat zu adressieren.
Aber wie wird die Diagnose nun gestellt? In Europa erfolgen Autismus-Diagnosen gemäß der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD). Diese Klassifikationssysteme legen die spezifische Symptomatik sowie die Ausschlusskriterien fest, anhand derer eine Autismus-Diagnose gestellt wird. Die Kriterien, die für die Diagnose von Autismus maßgeblich sind, wurden sorgfältig formuliert und dienen als Richtlinien für Fachleute in der Diagnostik. Die aktuelle Version der ICD ist die ICD-11.
Zu den Kernkriterien für die Diagnose von Autismus gehören nach dieser Klassifikation anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, dass autistische Menschen Schwierigkeiten haben können, auf soziale Signale zu reagieren oder eigenständig soziale Interaktionen zu beginnen. Ebenso sind Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation von zentraler Bedeutung. Dies kann sich in Herausforderungen beim Aufbau und der Aufrechterhaltung von Gesprächen, beim Verstehen von nonverbaler Kommunikation oder in einer eingeschränkten Fähigkeit, Emotionen angemessen auszudrücken, äußern.
Diagnosekriterien nach ICD-11 (Entwurfsfassung von 2022)
♦Anhaltende Defizite, wechselseitige soziale Interaktionen zu initiieren und aufrechtzuerhalten
♦Eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person untypisch oder exzessiv sind
♦Beginn in der frühen Kindheit oder wenn soziale Anforderungen die Fähigkeiten des Kindes übersteigen
♦




























