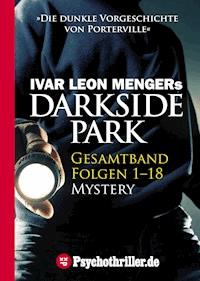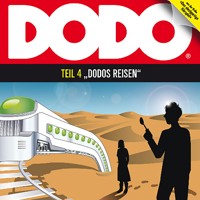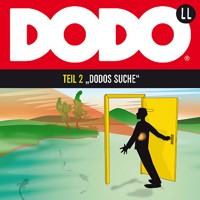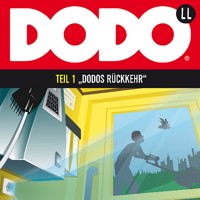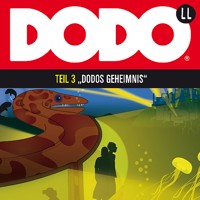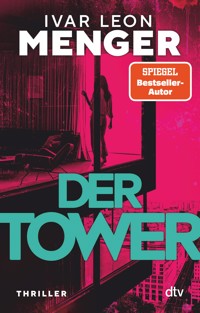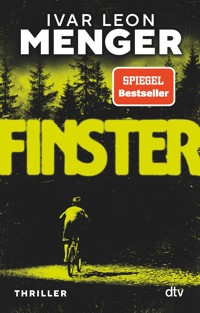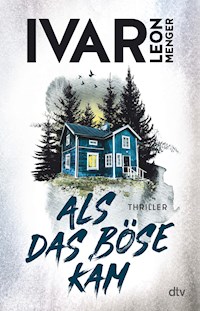19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als das Böse kam: Sie leben in völliger Isolation tief in den Wäldern einer kleinen Insel: Mutter, Vater und zwei heranwachsende Kinder in einer Blockhütte, das Festland ist in der Ferne kaum sichtbar. Die 16-jährige Juno und ihr Bruder verbringen die Zeit mit Fischfang, Kuchenbacken und sonntäglichen Gesellschaftsspielen. Und in ständiger Angst. Denn schon auf der anderen Uferseite lauert das Böse. Fremde können jederzeit auftauchen. Und die wollen Rache nehmen für etwas, das der Vater ihnen vor langer Zeit angetan haben soll. Die Fremden werden kommen, um die ganze Familie auszulöschen. Aus diesem Grund hat der Vater einen geheimen Schutzraum gegraben. Dort können sie sich sicher fühlen. Noch … Angst: Irgendetwas an Viktor stimmt nicht, das spürt Mia schon bei ihrem ersten Date im Edelrestaurant auf dem Dach des Kanzleramts. In den Tagen darauf geschehen merkwürdige Dinge, die sich irgendwann nicht mehr mit dem Zufall erklären lassen. Mias anfängliche Beunruhigung weicht einer lähmenden Angst. Doch dann beschließt sie, den Spieß umzudrehen. Ein tödliches Spiel beginnt ... Finster: Mai 1986. Ein 13-jähriger Junge verschwindet spurlos vom Jahrmarkt in Katzenbrunn. Das passiert nicht zum ersten Mal. Seit Jahren werden in dem kleinen Dorf im Odenwald immer wieder Kinder als vermisst gemeldet. Hans J. Stahl, Kriminalkommissar a. D., beschließt daraufhin, die Ermittlungen an den seither ungelösten Fällen wieder aufzunehmen und auf eigene Faust weiterzuführen. Er kehrt zurück nach Katzenbrunn, das vor allem für seine psychiatrische Klinik bekannt ist. Dabei stößt er auf verstörende Geheimnisse. Während er den wenigen Spuren nachgeht, verschwindet ein weiterer Junge. Stahl läuft die Zeit davon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Als das Böse kam: Sie leben in völliger Isolation tief in den Wäldern einer kleinen Insel: Mutter, Vater und zwei heranwachsende Kinder in einer Blockhütte, das Festland ist in der Ferne kaum sichtbar. Die 16-jährige Juno und ihr Bruder verbringen die Zeit mit Fischfang, Kuchenbacken und sonntäglichen Gesellschaftsspielen. Und in ständiger Angst. Denn schon auf der anderen Uferseite lauert das Böse. Fremde können jederzeit auftauchen. Und die wollen Rache nehmen für etwas, das der Vater ihnen vor langer Zeit angetan haben soll. Die Fremden werden kommen, um die ganze Familie auszulöschen. Aus diesem Grund hat der Vater einen geheimen Schutzraum gegraben. Dort können sie sich sicher fühlen. Noch …
Angst: Irgendetwas an Viktor stimmt nicht, das spürt Mia schon bei ihrem ersten Date im Edelrestaurant auf dem Dach des Kanzleramts. In den Tagen darauf geschehen merkwürdige Dinge, die sich irgendwann nicht mehr mit dem Zufall erklären lassen. Mias anfängliche Beunruhigung weicht einer lähmenden Angst. Doch dann beschließt sie, den Spieß umzudrehen. Ein tödliches Spiel beginnt ...
Finster: Mai 1986. Ein 13-jähriger Junge verschwindet spurlos vom Jahrmarkt in Katzenbrunn. Das passiert nicht zum ersten Mal. Seit Jahren werden in dem kleinen Dorf im Odenwald immer wieder Kinder als vermisst gemeldet. Hans J. Stahl, Kriminalkommissar a. D., beschließt daraufhin, die Ermittlungen an den seither ungelösten Fällen wieder aufzunehmen und auf eigene Faust weiterzuführen. Er kehrt zurück nach Katzenbrunn, das vor allem für seine psychiatrische Klinik bekannt ist. Dabei stößt er auf verstörende Geheimnisse. Während er den wenigen Spuren nachgeht, verschwindet ein weiterer Junge. Stahl läuft die Zeit davon.
Von Ivar Leon Menger ist bei dtv außerdem erschienen:
Der Tower
Ivar Leon Menger
Als das Böse kam – Angst – Finster
Buch 1: Als das Böse kamBuch 2: AngstBuch 3: Finster
Thriller
Buch 1: Als das Böse kam
Und als sie sah, wo sie war,
da fing sie so bitter an zu weinen,
denn von allen Seiten war Wasser,
sie konnte gar nicht an Land kommen.
Hans Christian Andersen
Erster Teil
1
Mutter steht in der Küche und backt Blaubeerkuchen. Das Haus duftet nach warmem Karamell, obwohl alle Fenster und Türen weit offen stehen. Ein Sommerwind zieht durch die Räume, eine angenehme Abwechslung zur Nachmittagshitze, die sich in unserem Gefängnis breitmacht.
Ich habe mir eine Kochschürze umgebunden und helfe Mutter beim Abspülen, während Boy unseren Kaffeetisch im Esszimmer deckt.
»Was spielen wir heute?«, frage ich und stelle die saubere Teigschüssel zurück in den Küchenschrank.
»Monopoly?«, antwortet Mutter, sie wirft mir einen verschmitzten Blick zu. Wir wissen, dass Vater regelmäßig einen Tobsuchtsanfall kriegt, wenn seine Figur auf einem unserer Hotels landet. Dann schießt das Spielbrett durch die Luft und es regnet Geldscheine. Ein Vergnügen für uns Kinder.
Doch heute müssen wir etwas anderes spielen.
Damit mein Plan funktioniert.
»Wir könnten doch Risiko rausholen«, sage ich so beiläufig wie möglich.
Mutter zieht die Augenbrauen zusammen. Ich weiß, dass sie das Spiel nicht mag. Nicht ohne Grund versteckt sie die Pappschachtel in ihrem Schlafzimmer, in der untersten Schublade ihrer Kommode. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass mein Bruder und ich es einfach vergessen.
»Das ist ein sehr dummes Spiel.« Mutter legt das Geschirrtuch zur Seite und verschränkt die Arme. »Haben wir euch nicht beigebracht, dass man mit Gewalt keine Konflikte löst?« Sie blickt mich ernst an. »Frieden und Freiheit sind kostbar, Juno. Unsere Familie lebt hier schon mit genug Angst.«
»Aber es macht mir doch so eine Freude«, lüge ich und verberge meine Hände in den aufgenähten Vordertaschen meiner Schürze. Mein rechter Zeigefinger beginnt schon zu zittern, windet sich wie ein Regenwurm im Schnabel eines Singvogels. Das macht er seit meiner Kindheit. Immer, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Ich kann es einfach nicht kontrollieren.
»Außerdem lernen wir dabei doch strategisches Denken. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man angegriffen wird.« Ich komme in Fahrt. »Falls die Fremdlinge auf unserer Insel auftauchen. Vater will, dass wir uns verteidigen können.«
»Was will ich?« Vater betritt die Küche, unter dem Arm ein Bündel Brennholz. Er zieht sich Handschuhe über, öffnet die Befeuerungskammer des Backofens und legt einen Scheit Holz nach. »Das riecht wirklich köstlich.«
»Deine Tochter will Risiko spielen«, sagt Mutter.
»Prima Idee!«, ruft Boy, der in die Küche gestürmt kommt, die Besteckschublade aufreißt und den Tortenheber und vier Kuchengabeln herausholt.
»Von mir aus gern«, sagt Vater und nimmt meinen Bruder in den Schwitzkasten. »Aber dann bist du heute fällig, mein Sohn!«
Sie rangeln miteinander und kitzeln sich beinahe zu Tode.
Ich blicke zu Mutter hinüber und beobachte, wie sie ihre Schürze aufknüpft, den Stoff über die Stuhllehne legt und mit der Handfläche die einzelnen Falten glattstreicht. Ich spüre, dass sie über meinen Vorschlag nicht erfreut ist. Wahrscheinlich hat sie eine andere Reaktion von Vater erwartet. Sie schüttelt den Kopf. Vielleicht wundert sie sich auch nur, warum gerade ich Risiko vorgeschlagen habe. Ein Spiel, bei dem man mit etwas Würfelglück die ganze Welt erobern kann. Mutter weiß, dass ich es genauso hasse wie sie.
Die Eieruhr klingelt. Der Blaubeerkuchen ist fertig.
»Ich nehme die grünen!«, sagt Boy und verteilt die Farben der restlichen Spielsteine an uns. Mutter Gelb, Vater Schwarz und mir schiebt er natürlich die rosafarbenen Steine zu. Er klappt das Spielbrett auf und legt es in die Mitte des Esstischs.
Mutter schneidet den Kuchen in gleich große Stücke und reicht jedem von uns einen Teller. Sofort stopft sich Boy eine Gabel Blaubeerkuchen in den Mund. Vater mischt den Stapel mit den Gebietskarten, während ich unauffällig die bunte Weltkarte studiere.
Sechs Kontinente, zweiundvierzig Länder. Ich fliege über Namen wie Peru, Sibirien, Grönland, Skandinavien, Brasilien, Kongo, Mitteleuropa, Indien, West-Australien, Ontario.
»Weltherrschaft oder Auftrag?«, fragt Vater und verteilt die Karten an uns. Boy nimmt die Würfel aus der Schachtel und lässt sie über das Spielbrett rollen, er ruft: »Weltherrschaft!«
Mutter nimmt die Gebietskarten auf. Auch ich sehe mir meine Karten an. Wir beginnen, unsere Armeen auf die Gebiete zu verteilen. Ich habe Glück, in fast jedem Land von Australien habe ich einen Stein liegen. Leicht zu verteidigen, wenn es mir wirklich ums Spielen ginge.
»Das ist unfair!«, sagt Boy und deutet auf meinen lilafarbenen Kontinent. »Die Karten sind nicht gut gemischt!«
Vater trinkt einen Schluck Bohnenkaffee.
»Wo ist Venezuela?«, fragt Boy, seinen grünen Stein in der Hand. Mutter deutet auf ein hellblaues Land. »Direkt neben Peru.« Das Spielbrett füllt sich mit bunten Steinen. »Und wo ist China?« Boy sucht die verschiedenen Kontinente ab. Vater zeigt ihm die hellgrüne Fläche im Osten der Weltkarte.
»Weststaaten?«
»Hier links«, sage ich.
Boy hatte schon immer Schwierigkeiten, seine Länder zu finden. So wie heute. Darauf hatte ich gehofft. Ich habe mittlerweile fast alle Armeen verteilt und halte nur noch zwei Gebietskarten in der Hand. Ich starre auf das Spielfeld.
Mutter bemerkt es und lächelt mich an. »Juno, was suchst du?«
Mein Moment ist gekommen.
»Wo liegt Nordland?«, frage ich und beuge mich weit über die Weltkarte. »Und Südland? Ich kann sie nirgends finden.«
Vater stellt die Kaffeetasse auf den Unterteller und rückt sich die Brille zurecht. Ich blicke zu Mutter hinüber, deren Gesicht plötzlich kreidebleich wird.
»Du hast recht, Juno!«, ruft Boy und sucht hastig das ganze Spielbrett ab. »Wieso sind die da nicht drauf?«
Mutter springt vom Esstisch auf, stapelt das benutzte Geschirr auf ihrem Unterarm und stampft zur Tür. Am Türrahmen bleibt sie stehen, dreht sich zu Vater um. Ihr Hals ist puterrot.
»Verstehst du jetzt, warum ich dieses Spiel verbrennen wollte?«
Dann verschwindet Mutter in der Küche.
2
Ich heiße Juno. Ich bin sechzehn Jahre alt und verstecke mich seit hundertvierundvierzig Monaten auf der Insel. Niemand weiß, dass wir seit zwölf Jahren in der Blockhütte auf der Mitte des Sees leben. Außer den Wächtern, die uns in die Wälder gebracht haben, als ich noch ein kleines Mädchen war.
Ich liebe frisch geschlüpfte Entenkinder, Knospentriebe im Frühling, Trollblumen in meinem geflochtenen Haar, honigsüße Brombeeren, das Röhren von Elchen in der Morgendämmerung, den Duft von Sommerregen auf Felsstein, den Funkentanz von brennendem Birkenholz, die ersten Schneeflocken auf meiner Zunge.
Und ich mag Boy, meinen kleinen Bruder, der heimlich meine Aufgaben übernimmt, wenn mir der Mut dazu fehlt. Obwohl ich zwei Köpfe größer bin.
Unser Leben auf der Insel ist einfach. Jeder Tag gleicht dem anderen. Am Morgen werden wir von Mutter unterrichtet, in allen Fächern, die man für das Überleben braucht. Lesen und Schreiben, Tier- und Naturkunde, Rechnen (ich konnte Vater davon überzeugen, dass sie es nicht nur Boy beibringt), Wundversorgung, Fährtenlesen und Hauswirtschaftslehre. Für mich bedeutet das, dass ich stricken und häkeln gelernt habe und unsere Wäsche waschen, das Geschirr abspülen, Feuer machen und Gemüsesuppe kochen kann. Außerdem fällt es mir leicht, alle Lebewesen und Pflanzen zu bestimmen, die bei uns auf der Insel leben. Mein Bruder hingegen ist nur für die sonntägliche Lebensmittelbeschaffung eingeteilt. Weil ich es immer noch nicht über das Herz bringe, zu töten.
Bis zum Abendessen steht uns freie Zeit zur Verfügung. Dann dürfen wir malen, Wildblumen pflücken, die Bücher aus der Wohnstube lesen, Schallplatten hören oder am großen Felsen unten am Seeufer spielen. Außer am Montag. Da ist es uns strengstens verboten.
Boy greift zu einem Steinbrocken und hämmert mehrmals auf den Schädel der Rotfeder ein, bis das Fischlein zu zittern anfängt. Ein letzter Schlag, die Augen werden starr. Entschlossen nimmt Boy das Küchenmesser, setzt einen schnellen Stich ins Herz und lässt die Rotfeder ausbluten. Kurz und schmerzlos, so wie er es gelernt hat. Es ist der einzige Weg, auf der Insel zu überleben. Vater darf nur einmal im Monat, wenn der Vollmond hoch über den Wäldern steht, auf die andere Seite des Sees rudern, um im Dorf der Wächter die wichtigsten Einkäufe zu erledigen. Mehl, Zucker, Eier, Milch und Bohnenkaffee.
Ich blicke zu Boy. Mein Bruder grinst, entfernt den Haken aus dem Maul und lässt unseren Fang zu den Forellen im Plastikeimer gleiten. In mein geliebtes Sandeimerchen, das mit der Maus im gepunkteten Sommerkleid drauf.
Es ist mein einziges Erinnerungsstück an unsere Flucht aus Südland.
Ich werfe erneut die Angel aus. Eine Rotfeder fehlt uns noch für die Frikadellen, die Mutter zum Abendbrot zubereiten wird.
»Warum hast du das gemacht?«, fragt Boy in die Stille hinein. »Wegen dir ist unser Spielesonntag ausgefallen.«
»Risiko ist ein dummes Spiel«, sage ich knapp, weil mir auf die Schnelle keine bessere Antwort einfällt. Tatsächlich plagt mich seit dem Nachmittag ein schlechtes Gewissen, da ich weiß, wie sehr mein Bruder sich auf den Sonntag gefreut hat. »Außerdem hat sich Mutter ja wieder beruhigt.«
»Aber jetzt müssen wir wieder eine ganze Woche warten!«
Auf der anderen Seite des Sees, im Schatten des Fichtenwaldes, entdecke ich eine Bewegung. Zwei Rehe, die durch das Unterholz traben. Auch Boy bemerkt die Tiere. Wir beobachten, wie sie ihre Köpfchen heben, fluchtbereit die Ohren spitzen. Für einen kurzen Moment verharren sie wie auf einem Ölgemälde. Dann sehen sie zu uns herüber, als könnten sie uns wittern.
Boy wirft einen Stein ins Wasser. Unversehens galoppieren die Rehe davon und verschwinden im Dickicht.
Er dreht sich zu mir. »Ich habe lange darüber nachgedacht, Juno. Wenn Vater und Mutter eingeschlafen sind, werde ich rüberrudern. Heute Nacht.«
»Bist du verrückt?«, flüstere ich. »Du bringst uns alle in Gefahr!«
»Du willst es doch auch.«
»Tue ich nicht!«
Boy kneift die Augen zusammen, überprüft meinen rechten Zeigefinger. »Und die Zeichnung unter deiner Matratze?«
Ich balle die Hand zur Faust. Er muss das Bild gefunden haben, das ich gestern Nachmittag am großen Felsen gemalt habe. Es zeigt Häuser, die bis hoch in den Himmel ragen, wo ein silberglänzender Vogel seine Kreise zieht, über einem Meer aus Schirmen, die wie gestreifte Pilze aus dem Sandboden sprießen, dazu spielende Kinder am Wasser.
Bäume habe ich keine gezeichnet.
»Ich habe dich beobachtet, Juno«, sagt Boy und rückt näher zu mir heran, er wedelt mit seinem rechten Zeigefinger vor meinem Gesicht herum. Dann drückt er mir den Finger auf die Lippen. »Du lügst!« Metallischer Fischgeruch steigt mir in die Nase. »Wenn du meinen Plan verrätst, werde ich Vater dein Bild zeigen.«
Ich würde ihm gern antworten, dass ich mich nicht von einem Zwölfjährigen erpressen lasse, schließlich dienen die Gebote nur unserer Sicherheit, doch dann zerschneidet das Heulen der Sirenen meine Gedanken.
Boy schreit auf. Ich lasse die Angel fallen, springe auf, greife den Arm meines Bruders und renne mit Boy über den Sandweg, durch das kleine Waldstück bis zu unserem Gemüsegarten. Nur noch wenige Meter bis zum Haus, vorbei an den hohen Lautsprechermasten. Der grelle Ruf der Warnsirenen bohrt sich in meine Ohren. Ich stolpere über den Stiel einer Schaufel, Boy reißt mich nach oben. Mutter erwartet uns im Türrahmen, klatscht mit weit aufgerissenen Augen in die Hände.
»Schnell, Kinder, schnell!«
Wir stürmen in den Flur, während hinter uns die Eingangstür ins Schloss knallt. Mutter schiebt eine Eisenstange vor das Türblatt und folgt uns in die Küche. Vater hat den Esstisch zur Seite geschoben, den Teppich zusammengerollt.
Ein Loch klafft im Fußboden.
Boy klettert als Erster hinein, danach verschwinden Mutter und Vater unter der Erde. Ich gehe einen Schritt auf die Luke zu.
»Verdammt, Juno! Worauf wartest du?«, brüllt Vater.
Mein Herz klopft wie ein ausgehungerter Specht. Ich nähere mich dem Loch im Boden. Hitze durchflutet meinen Körper. Ich wische die Finger an meinem Kleid ab, setze den linken Fuß auf die Leiter. Dann den rechten.
»Los, beeil dich!«
Mit beiden Händen umklammere ich das Eisengeländer und steige nach unten. Ein kühler Hauch weht über meine Beine. Ich klettere weiter hinab, bis meine Fußspitzen endlich den Erdboden erreichen. Vater zwängt sich an mir vorbei und schließt die schwere Holzklappe über uns. Mit einem Schlag ist es dunkel. Die Kälte unseres Verlieses umhüllt mich wie ein unsichtbarer Mantel.
»Bitte, Licht!«, flüstere ich und höre, wie Vater das Kellerloch mit dem Stahlbolzen verbarrikadiert.
»Setz dich zu mir, Juno«, sagt Mutter. Ich folge ihrer Stimme ans andere Ende des Raumes. Sie ergreift meine Hand und zieht mich auf ihren Schoß. Ich kuschele mich an sie, nähre mich von ihrer Körperwärme. Möchte tief in sie hineinkriechen, wieder zurück in ihren Bauch.
»Gesichert!«, ruft Vater. Ich höre das erlösende Klicken eines Lichtschalters. Die Glühbirne flackert auf. Eine Träne auf Mutters Wange.
»Werden sie uns töten?«, sagt Boy, der sich in die Ecke des Schutzraums verkrochen hat, die Arme um die Beine geschlungen.
»Wir müssen leise sein«, flüstert Vater und blickt zur Luke hoch. »Vier Fremdlinge, schwarz gekleidet. Sie sind schon auf dem See.«
Vater nimmt das Gewehr von der Wand und geht in die Mitte des Kellerraums. Dort lässt er sich auf den ausrangierten Wohnzimmersessel fallen. Der grün karierte, in dem mir Mutter Däumelinchen vorgelesen hat. Damals, in den ersten Nächten, vor dem knisternden Kaminfeuer, als ich nicht einschlafen konnte.
Vater nickt mir zu. Ich verstehe, was er mir sagen möchte. Ich schleiche zu Boy und nehme ihn in den Arm. Mein Bruder zittert am ganzen Körper.
Auch Mutter steht auf und geht zu der breiten Regalwand hinüber, die mit den wichtigsten Vorräten gefüllt ist. Über fünfzig Konservendosen, ein Korb mit frischen Äpfeln und Birnen, fünf Flaschen hochprozentiger Alkohol, drei Säcke Kartoffeln, eine Kiste mit langstieligen Kerzen, Streichhölzer, eingelegter Fisch in Marmeladengläsern, ein Gaskocher und fünfzehn Wasserkanister. Das ist unsere Überlebensration für zwei Wochen. Mutter zieht den Erste-Hilfe-Koffer aus dem Regal und setzt sich zu uns auf den Fußboden.
»Kinder, was haben wir gelernt?« Sie öffnet den Verschluss des grünen Plastikkoffers. »Was müssen wir tun, wenn uns kein Ausweg mehr bleibt?«
»Damit sie euch nicht foltern?«, sagt Vater und blickt erneut zur verriegelten Luke hoch. Er zieht eine Patronenkugel aus der Hosentasche und legt sie in das Gewehr ein.
»Euer Vater hat vor vielen Jahren eine sehr schwere Bürde auf sich genommen, als er vor dem Tribunal ausgesagt hat. Er hatte sich für die Wahrheit entschieden. Und damit Gerechtigkeit über unser Familienwohl gestellt.« Mutter klappt den Kofferdeckel auf und öffnet eine Packung Kompressen. Sie schneidet mit der Schere ein quadratisches Stückchen Stoff ab. »Allein durch Vaters Zeugenaussage wurden die gefährlichsten Finstermänner Südlands verhaftet und für Jahrzehnte ins Gefängnis gesteckt.« Mutter wischt sich mit dem Tuch die Tränen aus den Augen. »Deshalb suchen sie uns auf der ganzen Welt.«
»Sie wollen sich rächen.« Vater entsichert das Gewehr. »An mir und meiner Familie.«
»Aber die Wächter aus Nordland behüten uns doch immer noch, oder?«, fragt Boy und ergreift meine Hand. Seine Finger sind feucht und kalt. Ich drücke sie leicht und stelle mir vor, dass warmes, goldenes Licht durch meine Arme in seinen Körper fließt.
»Natürlich, mein Junge«, antwortet Mutter und streicht ihm über das Haar.
»Und warum kommen sie dann nicht?«
»Wir leben zu weit draußen«, antworte ich. »Das dauert Stunden, bis die Wächter aus dem Dorf bei uns sind.«
»Kann man unsere Sirene denn so weit hören?«
»Der Alarm gilt doch nur uns«, antworte ich. Manchmal verhält sich Boy immer noch wie ein Kleinkind. Ich drücke seine Hand fester. »Damit wir uns alle im Schutzraum versammeln, das weißt du doch!«
»Vater hat die Sirene gleich wieder abgestellt«, sagt Mutter und greift erneut in den Erste-Hilfe-Koffer. Erst jetzt fällt mir die Stille auf.
»Habt keine Angst, Kinder«, flüstert sie, während sie mehrere Salbentuben, Spritzen und Verbandszeug zur Seite schiebt. »Bis Rettung eintrifft, wird uns Vater verteidigen.« Sie zögert einen Moment. Ihre Hände zittern, als sie das längliche Tablettenröhrchen herauszieht. »Denn ihr seid alles, was wir lieben.«
»Falls ich ihren Angriff nicht überleben oder sie versuchen sollten, zu euch in den Schutzraum zu kommen«, Vater rückt seine Brille zurecht und blickt erneut zur Kellerdecke hinauf, »dann wisst ihr, was zu tun ist, um euch vor ihnen zu schützen?«
»Juno und ich nehmen die Trostpillen«, sagt Boy.
Mein Herz macht einen Sprung. Das ist der Moment, auf den ich mich am meisten freue.
»Richtig.« Mutter dreht den Schraubverschluss auf. Boy und ich strecken ihr die Handflächen entgegen. Nur eine Pille für jeden. Am liebsten würde ich mir das Kügelchen sofort in den Mund stecken, das nicht nur unsere Seele beruhigen soll, sondern auch süßer als die reifsten Kirschen schmeckt.
Und dann warten wir. Lauschen in die Stille. Warten, dass die Haustür eingeschlagen wird. Oder eine Fensterscheibe. Ich atme durch den Mund. Zähle bis zehn. Mutter tupft mir mit dem Mullstück die Perlen von der Stirn. Niemand spricht ein Wort. Vater blickt auf seine Uhr. Ich schließe die Augen und konzentriere mich auf jedes Geräusch. Höre das Herz in meiner Brust pochen. Ich kann sogar das Pulsieren in meinen Ohren spüren. Boy zieht die Beine enger an den Oberkörper und lehnt seinen Kopf an meine Schulter. Ich fühle seine heißen Atemstöße auf dem Oberarm. Ein seltsames Rascheln. Wenige Meter über uns. Waren das Schritte in der Küche? Haben die Fremdlinge unsere Insel schon erreicht? Ich starre nach oben, beobachte die Tragebalken, die Vater mit Metallschrauben an der Mauer montiert hat. Für den Bau unseres Schutzraums hat er fast ein halbes Jahr gebraucht. Jetzt hängen dort zahlreiche Spinnennetze. Feiner Sand rieselt auf uns herab. Ich kneife die Augen zusammen und reibe mir mit den Fingern den Staub aus den Lidern. Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich weiße Pünktchen durch den Kellerraum schweben. Wie tanzende Elfen, denke ich. Sie sind gekommen, um uns zu beschützen.
»Ich bin sehr stolz auf euch!«, ruft Vater und klopft sich auf die Oberschenkel. »Wie immer vorbildlich.« Er erhebt sich aus seinem Sessel. »Es war nur eine Übung. Macht euch keine Sorgen, Kinder, es kommen keine Fremdlinge zu uns auf die Insel.« Vater hängt das Gewehr zurück an die Wand. »Das habt ihr wirklich gut gemacht!«
Erleichtert atmet Boy aus, lässt meine Hand los. »Das wusste ich die ganze Zeit!«
Ich glaube ihm nicht. Obwohl auch ich gehofft hatte, dass es nur ein unangekündigter Testlauf war. So wie jedes Jahr. Doch Mutters echte Tränen hatten mich verunsichert.
»Dürfen wir trotzdem?«, frage ich und schiele auf die bernsteinfarbene Tablette in meiner Hand. Mutter nickt mir zu. Ich will gerade danach greifen, als Vater uns unterbricht.
»Aber vorher möchte ich die sieben Gebote hören.«
Augenblicklich beten Boy und ich die Regeln herunter, wir können sie im Schlaf.
»Wir müssen uns verstecken, wenn Onkel Ole kommt.«
»Wir dürfen niemals lügen.«
»Niemand darf Vaters Bibliothek betreten«, sagt Boy und blickt hämisch zu mir herüber. Dabei habe ich mir nur ein paar alte Fotoalben und Mutters Lieblingsroman aus dem Bücherregal genommen. Den mit der schönen Frau auf dem Titelbild, eng umschlungen in den Armen eines dunkelhaarigen Mannes. Ich hatte mich gerade an den Schreibtisch gesetzt und die ersten Kapitel von Juliette oder die Liebe meines Lebens gelesen, als Vater hinter mir auftauchte. Ich fühlte mich peinlich ertappt. Dabei muss die Buchseite eingerissen sein. Mutter war so erbost darüber, dass uns seitdem das Betreten von Vaters Arbeitszimmer strengstens untersagt ist. Auch wenn ich das bis heute ungerecht finde. Es war wirklich nur ein winziger Riss.
»Wir müssen sofort in den Schutzraum, wenn die Sirene ertönt. Egal, was wir gerade tun.«
»Wir dürfen keine fremden Beeren essen«, sage ich und erinnere mich an Boy, der drei Tage lang mit Fieber und Krämpfen im Bett lag. Da wir aus Sicherheitsgründen keinen Doktor aus dem Dorf rufen durften, beteten wir jede Nacht zu Gott, dass er überlebt. Kurz nach Boys Genesung wurde die fünfte Regel eingeführt.
»Wir müssen immer kurz und schmerzlos töten.«
»Und das siebte und wichtigste Gebot der Wächter: Keiner darf unsere Insel ohne die Erlaubnis von Mutter oder Vater verlassen«, sage ich und starre zu Boy hinüber. »Ansonsten werden wir beide dafür bestraft.«
»Damit wir besser aufeinander aufpassen«, zischt Boy zurück.
»Ausgezeichnet, Kinder!« Vater ist zufrieden. »Ihr dürft euch eure Belohnung nehmen.«
Hastig stopfen wir uns die Trostpillen in den Mund. Ich schließe die Augen und lasse die geleeartige Ummantelung mit dem süßen Geschmack nach reifen Walderdbeeren, Holunder und Kirschen noch lange auf der Zunge zergehen, bevor ich die dicke Tablette hinunterschlucke, die daruntersteckt.
Ich wünschte, wir hätten jeden Monat einen Testalarm.
Nach dem Abendessen liege ich aufgewühlt in meinem Bett, starre an die Zimmerdecke und muss an meinen Bruder denken. Das Sekundenticken des Weckers macht mich ganz kribbelig. Ich wälze mich zu meinem Nachttischchen, auf dem meine Uhr, mein schwarzer Glücksstein, Vaters geschnitzter Elch und eine Vase mit Wildblumen stehen. Mein Blick klebt an dem Sekundenzeiger. Es ist gleich halb zwölf. Hat Boy tatsächlich vor, heute Nacht unser Familiengebot zu brechen und auf die andere Seite zu rudern?
Ich schlage die Bettdecke zurück und schlüpfe in meine Hausschuhe. Die Tür quietscht, als ich sie öffne und den Flur im ersten Stock betrete. Boys Kinderzimmer liegt am Ende des Gangs, direkt neben dem Bad. Ich schleiche zu seiner Zimmertür. Der Holzboden unter meinen Füßen knarzt. Falls Vater aufwacht und mich entdeckt, werde ich einfach ins Badezimmer huschen.
Vorsichtig drücke ich Boys Türklinke hinunter und betrete den Raum. Das Dachzimmer riecht nach feuchten Kiefernnadeln und Moosglöckchen, ein Windhauch streift mein Gesicht. Ich starre auf das offen stehende Sprossenfenster. Der bellende Alarmruf eines Habichtskäuzchens hallt durch die Nacht. Ich springe ans Fenster und suche das Seeufer ab. Wie ein feingewebter Teppich aus Diamanten tanzt der Mondschein über die Wasseroberfläche. Mein Blick wandert zum großen Felsen. Und da entdecke ich es. Vaters Boot, es liegt noch immer an unserem Steg. Erleichtert drehe ich mich zu Boys Bett um.
Er schläft. In meiner Panik hatte ich nicht darauf geachtet. Ich schließe das Fenster und sinke neben seinem Bett auf die Knie. Dann falte ich die Hände, rattere eilig das Vaterunser herunter und bedanke mich bei Gott, dass mein Bruder mich nicht allein auf der Insel zurückgelassen hat. Ich richte mich wieder auf und ziehe die Bettdecke über seine Schultern. Für einen kurzen Augenblick beobachte ich ihn beim Schlafen. Auch wenn wir uns nicht besonders ähnlich sehen, wir tragen dieselbe Sehnsucht in uns.
Doch schon bald, kleiner Bruder, werden wir gemeinsam zu unserem Abenteuer aufbrechen und die verbotene Welt da draußen erkunden. Das verspreche ich dir.
Egal, wie viele Fremdlinge auf uns lauern.
3
Heute ist Montag. Onkel-Ole-Tag. Ich schaufle eine große Schüssel warmen Haferbrei in mich hinein. Das letzte Mal blieb er für zwei Stunden in unserem Haus und ich hatte vergessen, davor zu frühstücken. Boy und ich warteten ungeduldig in unserem Versteck, während mein Magen wie eine tollwütige Wildkatze knurrte. Onkel Ole hätte uns fast bemerkt.
Ich spielte noch mit Puppen, als der alte Mann das erste Mal bei uns auf der Insel auftauchte. Mit schwarzem Schlapphut und Regenmantel. Ich erinnere mich gut, wie ich am Fenster stand und neugierig das kleine Motorboot beobachtete, das aus dem Nebel auftauchte. Mutter riss mich vom Fenster weg und rannte mit mir ins Schlafzimmer. Dort verschanzten wir uns stundenlang im Kleiderschrank. Heute kann ich Mutters Aufregung und ihre Angst verstehen. Sie konnte ja nicht ahnen, dass Onkel Ole kein Fremdling ist.
Seitdem kommt Onkel Ole jeden Montag über den See zu uns und bringt Vater Post und Zeitungen. Doch zur Sicherheit müssen wir uns noch immer verstecken, da der Alte zwar ein harmloser Dorfbewohner ist, aber kein Wächter. Sie sind die Einzigen, denen wir vertrauen dürfen.
Ich beeile mich, spüle die letzten Haferreste aus der Schüssel und räume das gesäuberte Geschirr in den Schrank.
»Gehst du mit raus zum Felsen?«, flüstere ich Boy zu, der auf dem Sofa liegt und in einem Naturkundebuch blättert.
»Aber Onkel Ole kommt doch jeden Moment«, antwortet Boy, ohne aufzublicken. »Das erste Gebot? Montags dürfen wir nicht raus.«
»Nur ganz kurz«, sage ich und gehe ein paar Schritte auf meinen Bruder zu. »Wir passen auf. Bitte, Boy!«
Er sieht von seinem Buch auf, und ich ziehe die Augenbrauen hoch. Boy erkennt sofort, dass mir etwas auf dem Herzen liegt, und schlägt das Buch zu. Wir schlüpfen in unsere Schuhe und laufen hinaus in den Garten. Die Luft ist feucht und kühl. Die Sonne steht dicht über den Wäldern, auf den Salatblättern im Gemüsebeet liegt noch der Morgentau. Wir rennen über den Sandweg weiter durch das winzige Waldstück, bis vor uns der riesige Felsen auftaucht. Er steht verlassen am Seeufer, als hätte ihn ein Troll beim Ballspielen dort vergessen. Mit wenigen Griffen klettern wir auf die Spitze des Felsens und lassen uns auf die Aussichtsfläche fallen.
Ich blicke auf den braunschwarzen Waldsee hinunter, unsere Beine baumeln mehrere Meter über der Wasseroberfläche. Seltsamerweise wirkt der See heute überhaupt nicht gefährlich, sondern anziehend, fast magisch.
Eine Entenfamilie zieht schnatternd an uns vorbei. Wie gern würde ich jetzt auch darin schwimmen, hinüber auf die andere Uferseite, doch das haben wir nie gelernt.
»Danke, dass du nicht gegangen bist«, sage ich und lege meine Hand auf Boys Schulter. »Gestern Nacht.«
Boy lässt den Kopf sinken. »Daran war nur der blöde Alarm schuld. Der hat mir Angst gemacht. Außerdem ist es gegen die sieben Gebote, die Insel zu verlassen. Ich wollte nicht, dass du wegen mir bestraft wirst. Das war eine dumme Idee.«
»Nein«, sage ich und werfe einen Stein ins Wasser, der so schwer wiegt wie der in meinem Magen. »Du hattest recht, Boy. Mit der Zeichnung unter meinem Bett, mit deiner Vermutung.«
Er hebt den Kopf.
»Auch ich möchte die Insel verlassen. Wenigstens für einen Tag.«
»Seit wann?«
»Manchmal habe ich diese seltsamen Träume. Von hohen Häusern und Menschen unter bunten Schirmen, dazu spielende Kinder am Strand. Es fühlt sich an wie eine Erinnerung. An damals, an Südland. Boy, unsere Insel, das kann doch nicht alles sein.«
»Hast du deshalb unseren Spielesonntag kaputt gemacht?«
»Du hast dich doch auch darüber gewundert, warum Nordland und Südland nicht auf dem Spielbrett eingezeichnet sind.«
Boy blickt nachdenklich über das Wasser. Er wirkt älter, reifer. Nicht wie zwölf. »Du glaubst, die Länder Ontario und Australien gibt es wirklich?«
»Ich möchte es zumindest herausfinden.«
»Und was, wenn dich die Fremdlinge dabei erwischen?«
»Wir müssen eben vorsichtig sein.«
»Wir? Juno, wir können hier nicht abhauen!«, zischt Boy und reißt ein Grasbüschel aus der Felsspalte. »Das haben uns die Wächter verboten. Außerdem werden Mutter und Vater vor Sorge sterben. Und dann werden sie uns suchen, auf der anderen Seite des Sees, in ganz Nordland. Stell dir vor, was die Fremdlinge uns antun, wenn sie uns erwischen. Willst du das riskieren?«
»Wir könnten einen Brief schreiben und Mutter versprechen, dass wir am Abend wieder zurückkommen.«
»Angenommen, deine prächtige Idee mit der Nachricht klappt«, Boy dreht sich zu mir um, »wie wollen wir uns denn da drüben verteidigen? Etwa mit Vaters Gewehr?«
Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich habe den Plan aber wieder verworfen, da ich nicht damit umgehen kann. »Wir werden schon einen Weg finden.«
Plötzlich höre ich Onkel Ole, das Knattern seines Motorbootes. Er scheint nicht mehr weit von unserer Insel entfernt.
»Mist! Runter vom Felsen!« Mein Puls rast. Hoffentlich hat er uns nicht entdeckt. Hastig klettern wir hinab und rennen zurück zum Haus. »Warum ist er heute so früh?«, keuche ich, während mich Boy überholt und kurz darauf zwischen den Fichten verschwindet. Mein linkes Bein brennt, ich bleibe erschöpft stehen und blicke auf mein Knie. Es blutet. Ich muss es mir beim Hinabsteigen aufgerissen haben. »Boy, warte auf mich!«
Ich stütze die Arme auf die Oberschenkel und atme zweimal tief durch. Der Schmerz wird stärker. Ich drehe mich zum Felsen um und erschrecke. Onkel Oles Boot liegt befestigt am Steg, er muss schon auf der Insel sein und geradewegs zu unserer Blockhütte laufen. Aber weit kann er noch nicht sein. Onkel Ole braucht einen Gehstock. Sein Rücken bereitet ihm Probleme, hat uns Vater erklärt. Trotzdem kann ich jetzt nicht einfach zum Vordereingang hineinspazieren, sonst wird er mich sehen.
Ich entscheide mich für die Hintertür, die zu unserem Vorratsraum in der Küche führt. Kurzentschlossen springe ich über einen Stapel Kaminholz und renne los. Ich höre noch, wie unsere Eingangstür geöffnet wird, dann Vaters wütende Stimme. Boy wird leise zurechtgestaucht und auf sein Zimmer geschickt, weil er draußen war. Dabei ist alles meine Schuld.
Ich erreiche die Rückseite unseres Hauses und lasse mich gegen die Wand fallen. Ich hole tief Luft und rutsche in die Hocke, stütze mich auf dem Erdboden ab. Ein Stein bohrt sich in meine Handfläche, ich beiße die Zähne zusammen. Wenn ich mich beeile, kann ich es noch rechtzeitig ins Haus schaffen.
Gebückt schleiche ich unter den weißen Sprossenfenstern entlang. Meine Kniescheibe brennt wie Feuer. Nach wenigen Metern habe ich die Hintertür erreicht. Zaghaft richte ich mich auf und blicke durch das Küchenfenster. Ich erkenne Vater, der Onkel Ole auf einen Stuhl hilft, während Mutter am Spülbecken steht und ein Glas mit Wasser füllt. Ich bin zu spät. Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier am Hintereingang zu warten.
»God morgon. Ihr seid heute die Ersten auf meiner Tour«, höre ich Onkel Ole dumpf durch die Scheibe, während er sich schwerfällig auf den Stuhl fallen lässt. »Sovit gott?«
»Ja, tack.«
»Ich dachte, dieser Brief ist sicher wichtig.«
»Danke, Ole. Auf den haben wir schon lange gewartet.« Vater nimmt den blauen Umschlag entgegen und legt ihn zu seiner wöchentlichen Zeitung. »Wenn wir gewusst hätten, dass du früher kommst, hättest du einen frischen Kaffee bekommen.«
»Macht euch keine Umstände.«
»Und was macht dein Rücken? Immer noch so wetterfühlig?«, fragt Mutter, während sie ihm das Glas Wasser auf den Tisch stellt.
»Ach, das Klima. Damit bin ich aufgewachsen, so etwas härtet ab.« Er lacht kurz auf und trinkt einen Schluck. »Es ist doch wie im Leben.« Onkel Ole blickt aus dem Fenster. »Heute Sonnenschein, morgen Regen.« Er sieht mir direkt in die Augen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Vor Schreck lasse ich mich fallen und lande in einem Busch aus Brennnesseln. Meine Oberarme beginnen fürchterlich zu jucken.
Ich höre, wie ein Glas auf dem Küchenboden zerspringt.
»Alles in Ordnung, Ole?«, ruft Mutter.
»Was ist passiert?« Auch Vaters Stimme wirkt besorgt.
»Beweg dich nicht, ich werde die Scherben sofort wegwischen. Nicht, dass du dich schneidest.«
Eine Schranktür wird geöffnet, das schabende Geräusch eines Handbesens, mit dem Mutter die Glassplitter auf ein Kehrblech schiebt.
»Herregud! Wer ist das Mädchen?«, höre ich Onkel Ole durch die Holzwand fragen. Mir bleibt das Herz stehen. »Da war doch eben ein Kind am Fenster!«
Ein kurzer Moment der Stille, dann lacht Vater nervös auf. »Ein Mädchen? Jetzt siehst du aber Gespenster. Wie soll denn ein Kind auf unsere Insel kommen?«
»Ein Mädchen mit langen Haaren.«
»Ole, da musst du dich geirrt haben. Bei uns auf der Insel?«, pflichtet Mutter Vater bei. »Du hast ja noch nicht mal deine Brille auf.«
»Die brauche ich nur zum Lesen. Ich habe Augen wie ein Luchs, müsst ihr wissen. Und das mit über siebzig Jahren.«
»Also, ich habe nichts am Fenster gesehen. Das war bestimmt nur eine optische Täuschung, eine Spiegelung in der Scheibe.«
»Oder ein vorbeifliegender Vogel.«
Für einen kurzen Moment schweigt Onkel Ole. Bitte, bitte, lieber Gott, lass ihn glauben, dass er sich getäuscht hat.
Ich höre ein erleichtertes Lachen. »Wahrscheinlich habt ihr recht. In meinem Alter beginne ich schon Geister zu sehen. Die warten nur darauf, mich endlich zu holen.«
Jetzt lacht auch Vater. Ich schicke ein Stoßgebet gen Himmel. Ein Stuhl wird nach hinten geschoben. Ein schmerzvolles Stöhnen, als sich Onkel Ole erhebt. »Bitte entschuldigt die Scherben. Ich werde euch das Glas natürlich ersetzen.«
»Du willst schon wieder gehen?«
»Ja. Ich muss leider gleich weiter zu Familie Sjöberg. Wir sehen uns nächsten Montag.«
Dann verlassen sie die Küche. Ich kratze mir über die Arme, die mittlerweile mit roten Flecken übersät sind. Dafür hat mein Knie aufgehört zu bluten. Ich krieche um die Hausecke, höre, wie die Vordertür geöffnet wird. Wie ein Kapuzineräffchen aus Boys Naturkundebuch haste ich auf allen vieren unter den Fenstern entlang, bis ich mich wenige Meter vor unserer Eingangstür hinter einem Busch flach auf den Boden werfe. Onkel Ole humpelt die Eingangstreppe herunter. Bei jedem Schritt knarzen die morschen Holzbretter.
»… ist möglich. Ich vermisse sie wirklich sehr«, sagt Onkel Ole. »Seit sie mit ihren Eltern weggezogen ist.« Er scheint verändert, traurig. »Å andra sidan, ihr habt vollkommen recht. Vielleicht sollte ich meine Enkeltochter einfach mal anrufen, damit sie mich übers Wochenende besuchen kommt.«
»Mach das. Und danke für die Post.« Vater streckt Onkel Ole freundlich die Hand hin. »Bis nächsten Montag, Ole.«
Der alte Mann schüttelt sie, hebt zum Abschied den Gehstock und humpelt mit eiligen Schritten hinunter zum Wäldchen und dann zum Steg. Eine Familie Wildgänse fliegt über unsere Köpfe hinweg.
Als Onkel Ole außer Hörweite ist, dreht sich Vater blitzartig zu Mutter um. »Verdammt, er muss Juno gesehen haben!«
»Zum Glück konntest du ihn davon überzeugen, dass es nur Einbildung war«, sagt Mutter. »Und sogar eine, die ihn an seine Enkelin erinnert hat.«
»Enkelin?« Vaters Stimme bebt. »Ach was, Ole hat doch nicht mal Kinder!«
Das wird großen Ärger geben, schießt es mir durch den Kopf. Zimmerarrest. Wenn nicht Schlimmeres.
»Nein, er hat uns angelogen.« Vater rückt sich die Brille zurecht. »Was, wenn er jetzt überall herumerzählt, dass ein Kind auf unserer Insel lebt?« Vater winkt Onkel Ole noch ein letztes Mal zu, dann schiebt er Mutter in den Flur. Die Eingangstür knallt hinter ihnen zu.
Mein Herz rast. Warum bin ich nicht einfach in meinem Versteck geblieben? Vater hat recht. Durch meine Neugier habe ich uns alle in Lebensgefahr gebracht. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass Onkel Ole auf dem Rückweg den Fremdlingen in die Hände fällt. Und wenn er ihnen von mir erzählt, werden sie kommen und uns alle töten.
Ich muss sofort etwas unternehmen, darf keine Zeit verlieren. Angestrengt denke ich nach, kratze über die juckenden Stellen auf meinem Unterarm. Vielleicht kann ich meinen Fehler irgendwie geradebiegen, wenn ich Onkel Ole einfach darum bitte, mich nicht zu verraten. Ihm muss doch klar sein, was für uns auf dem Spiel steht. Ich habe den Gedanken kaum zu Ende gedacht, da rennen meine Beine auch schon hinunter zum See.
Onkel Ole ist gerade dabei, sein Motorboot loszubinden, als ich endlich am Ufer ankomme. »Onkel Ole!«
Der alte Mann lässt das Seil fallen und dreht sich überrascht zu mir um. Mit weit geöffneten Augen blickt er mich an, als hätte er ein Feenwesen zwischen den Blütenblättern entdeckt.
»Ich weiß, dass du mich am Küchenfenster gesehen hast. Aber du darfst niemandem von mir erzählen!« Ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu. »Bitte, Onkel Ole!«
Er zieht seinen Schlapphut vom Kopf und wischt sich mit der Handfläche über die Stirn. Seine Hand ist faltig und grau, wulstige Adern durchfließen seine Haut. Er kneift die Augen zusammen und blickt hinauf zu unserer Blockhütte und wieder zurück zu mir. Aus der Nähe betrachtet, wirkt Onkel Ole älter, als ich dachte. Mit leicht geöffnetem Mund mustert er mich von oben bis unten. Wie eine träge, uralte Riesenschildkröte, denke ich und blicke auf die dünnen Speichelfäden, die an seinen Lippen kleben. Die wenigen Zähne, die ihm noch geblieben sind, wirken gelblich und stumpf.
»Wer bist du?«, fragt er endlich und lässt sich prustend auf die Bootskante sinken. Ein säuerlicher, fauliger Geruch steigt mir in die Nase. »Dein Gesicht. Du kommst mir von irgendwoher bekannt vor.«
»Juno«, antworte ich knapp. »Wie die Göttin.«
»Wie kommst du auf die Insel, mein Kind?«
»Ich wohne hier. Mit meinen Eltern.«
»Und wieso habe ich dich noch nie gesehen?«
Fieberhaft denke ich darüber nach, ob ich ihm wirklich unser Familiengeheimnis anvertrauen soll, das uns die ganzen Jahre vor den Fremdlingen geschützt hat. Aber mir bleibt keine andere Wahl. »Du darfst niemandem verraten, dass wir auf der Insel leben. Sonst töten sie uns alle!«
»Wer will euch töten?«
»Sie bezahlen Geld für denjenigen, der uns findet.«
»Jösses! Auf euch ist ein Kopfgeld ausgesetzt?«, fragt Onkel Ole überrascht und zieht die buschigen Augenbrauen nach oben. »Und wie viel bekommt man da?«
Ich verstehe nicht, was er mit Kopfgeld meint. Aber ich erinnere mich gut, wie uns Mutter letztes Jahr im Schutzraum erklärt hat, dass die Fremdlinge allen Dorfbewohnern Nordlands eine Truhe mit Goldmünzen versprochen haben, wenn sie unser Versteck verraten. »Die Wächter haben uns vor vielen Jahren hierhergebracht. Weil Vater vor dem Tribunal gegen die Fremdlinge ausgesagt hat, damals in Südland.«
»Sørlandet? Du meinst Südland, den norwegischen Landesteil?«, fragt Onkel Ole und blickt wieder zu unserer Blockhütte. Er wirkt irritiert.
Auch ich bin verwirrt und verstehe nicht, wovon er redet. »Nein. Da, wo der Strand ist. Und das Meer.«
»Bei uns in Schweden?«
»Südafrika«, sprudelt es aus mir heraus, da es das südlichste Land auf dem Spielbrett ist, an das ich mich erinnern kann. »Oder vielleicht auch Argentinien.«
Jetzt runzelt Onkel Ole die Stirn. Er glaubt mir nicht. Ich muss alles auf eine Karte setzen.
»Vater sagt, wir leben hier unter einem Zeugenschirm oder so ähnlich. Mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein.« Als Beweis halte ich ihm meinen rechten Zeigefinger vor die Nase. Der Finger bewegt sich keinen Millimeter. »Ich lüge nicht. Seit ich ein kleines Mädchen war, verstecken wir uns hier auf dieser Insel in Nordland vor den Fremdlingen. Aber du bist doch keiner, oder?«
»Zeugenschutz?«, murmelt Onkel Ole. »Und es gibt eine hohe Belohnung für euch?«
»Ja, ganz viele Goldmünzen.«
Onkel Ole lächelt mich an. Endlich scheint er es zu kapieren. Erleichtert atme ich aus. Wieder blickt Onkel Ole zu unserem Haus hoch, während er in seiner Jackentasche wühlt und ein schmales, dünnes Gerät herauszieht. Die schwarze Vorderseite des Apparats glänzt wie die Seeoberfläche bei Nacht.
»Keine Angst, mein Kind. Ich werde euch nicht verraten«, sagt Onkel Ole und legt seinen Daumen auf das Gerät, das ein kurzes Piepsen von sich gibt. »Versprochen.« Dann hält er das seltsame Ding direkt vor mein Gesicht.
»Was ist das?«
»Bitte nicht lächeln«, sagt Onkel Ole. Doch das fällt mir schwer, schließlich ist mir gerade ein Stein in der Größe eines Felsbrockens vom Herzen gefallen. In letzter Sekunde habe ich unsere Familie gerettet.
Ich schließe die Augen, denke an Mutter und Vater, die bestimmt sehr stolz auf mich sein werden, atme tief durch und versuche meine Mundwinkel zu entspannen, die sich mit aller Gewalt nach oben ziehen. Dann öffne ich die Augen wieder. Ein grelles Licht blendet mich.
»Danke«, sagt Onkel Ole knapp und steckt das Kästchen zurück in die Jackentasche, zieht den Reißverschluss zu.
Jetzt lächelt er nicht mehr. Irgendwie scheint die Fröhlichkeit aus seinem Gesicht verschwunden.
Wortlos schiebt er das Boot ins Wasser, klettert hinein und lässt sich auf die Mitte der Holzbank fallen. Das Boot wackelt gefährlich hin und her.
»Du darfst deinen Eltern niemals erzählen, dass wir uns unterhalten haben«, zischt Onkel Ole und startet den Motor. »Niemals. Hast du das verstanden, Juno?« Aus eisigen Augen starrt er mich an. »Ansonsten werde ich euch alle verraten. Dich und deine ganze Familie.«
Mir wird schlecht.
4
Ich liege auf meinem Bett und warte auf das Frühstück, das mir Mutter vor die Zimmertür stellen wird. Mein Magen knurrt.
Es ist Dienstag, zwei Tage Zimmerarrest. Vaters Strafe, weil ich nicht rechtzeitig in meinem Versteck war. Mutter wollte sogar eine ganze Woche verhängen, so wütend war sie. Dabei hätte ich ihr gern erklärt, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Ich habe alles geregelt, wie eine erwachsene Frau. Und solange ich meinen Mund halte – und das werde ich –, wird uns Onkel Ole nicht verraten. Das hat er mir versprochen.
Niemals lügen.
Die sieben Gebote werden schließlich in ganz Nordland gelten, denke ich, und schlurfe erleichtert zum Fenster. Ich blicke hinunter in den Garten, auf die frisch gemähte Rasenfläche direkt vor unserem Hauseingang. Gleich daneben, zwischen den zwei haushohen Birken, hat Vater unser Gemüsebeet angelegt. Mit Salat, Sellerie, Kartoffeln, Tomaten, Kräutern und Beerensträuchern.
Mutter kniet mit einem Bastkörbchen davor und pflückt Erdbeeren. Wahrscheinlich die süße Beigabe für meinen Haferbrei. Ich klopfe gegen die Fensterscheibe. Doch Mutter scheint mich nicht zu hören, ich klopfe energischer. Sie dreht sich zu mir um und blickt regungslos zu mir hoch. Ich winke ihr zu, schenke ihr ein Lächeln. Doch Mutter erwidert meinen Gruß nicht und widmet sich wieder dem Beet.
Enttäuscht wandert mein Blick auf die andere Seite des Sees. Die Sonne steht schon hoch über den Kieferwäldern, flutet mein gesamtes Kinderzimmer mit Licht. Ich trete näher an das Sprossenfenster heran und lehne mich mit der Stirn gegen das warme Glas. Zimmerarrest ist so langweilig. Aber Mutter hat recht, ich habe es nicht anders verdient. Ich streiche mit dem Zeigefinger über die Scheibe und zeichne die Silhouette des großen Felsens nach. Warum bin ich auch immer so neugierig? Seit einigen Wochen verspüre ich den unerklärlichen Drang, alles über die fremde Welt da draußen zu erfahren. Ich kann nicht erklären, was der Auslöser dafür war. Vielleicht meine wiederkehrenden Träume in der Nacht von den turmartigen Häusern, den merkwürdigen Silbervögeln am Himmel, den lachenden Mädchen aus Südland. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur erwachsen geworden. Denn zu meiner eigenen Überraschung beginne ich damit, die Dinge des Lebens zu hinterfragen. Auch Mutters Erziehungsmaßnahmen, die uns angeblich nur schützen sollen. Dabei kann ich mittlerweile schon ganz gut allein entscheiden, was gut für mich ist und was nicht. Immerhin bin ich schon sechzehn. Und ich will endlich Antworten. Zu meinen Fragen über Nordland und Südland.
Und über Jungs. Damit meine ich nicht meinen kleinen Bruder, Gott bewahre, sondern eher jemanden wie den geheimnisvollen Richard Blackwood, den hübschen, jungen Mann aus Mutters Juliette-Roman. Auch hier kann ich nicht sagen, woher diese unerwartete Sehnsucht kam, die mein inneres Gleichgewicht ins Wanken gebracht hat. Aber auf einmal war sie da.
Aus dem Augenwinkel bemerke ich einen Vogelschwarm, der wie eine schwarze Nebelwolke am Himmel vorbeizieht und seine Runden über dem See dreht, vor dem großen Felsen.
Ich erstarre.
Unser Boot – es ist weg! Sofort überfällt mich Panik, ich muss an die gestrige Standpauke denken, die uns Vater gehalten hat, kurz nachdem ich zurück ins Haus kam. So garstig hatten wir ihn noch nie erlebt. Sogar Mutter hat uns angefaucht, warum wir nicht in unserem Versteck geblieben sind. Boy hat sich auf den Küchenboden geworfen und immerzu gerufen, dass es ja nicht seine Schuld war. Doch es hat ihm nichts genützt, er kennt unsere Regeln. Wenn ein Gebot gebrochen wird, werden beide Kinder bestraft. Ich finde das ungerecht und Boy hat mir leidgetan. Früher hätte ich ohne Murren einfach klein beigegeben. Aber nicht gestern.
Ich habe Vater angeschrien, dass es ungerecht ist, wenn mein Bruder für meine eigene Dummheit büßen muss. Daraufhin hat mir Mutter eine Ohrfeige verpasst. Das hat sie bisher noch nie getan. Man konnte ihr anmerken, dass sie selbst überrascht war. Doch ich habe mich dadurch nur stärker gefühlt, gerechter.
»Es ist alles eure Schuld!«, rief ich trotzig. »Wenn ihr uns einfach sagen würdet, wie lange wir noch auf dieser blöden Insel bleiben müssen, dann wären wir auch nicht so neugierig!«
»Was ist bloß in dich gefahren, Juno?«
»Auf eure Zimmer. Alle beide!«
Ich streiche mir über die Wange und blicke hinunter zum Steg. Es war keine Einbildung, unser Boot ist weg. Keine Frage, Boy muss heute Nacht von der Insel geflohen sein. Ohne mich. Ich presse die Lippen zusammen und beobachte Mutter, die eine Handvoll Erdbeeren in das Körbchen legt. Bis jetzt scheint sie es nicht bemerkt zu haben. Ich halte den Atem an. Mutter steht auf, schüttelt sich die Erde von der Schürze und geht mit wankenden Schritten auf das Haus zu.
Ich muss an die Höchststrafe denken, die mich erwartet, wenn unser siebtes Gebot gebrochen wird, die wichtigste Regel. Mir läuft ein Schauer über den Rücken.
Ich will nicht in den Schutzraum.
Doch das blüht mir, wenn Boys Flucht von der Insel auffliegt. Hektisch sehe ich mich in meinem Zimmer um. Ich muss etwas unternehmen. Vielleicht sollte ich mich verstecken? Im Kleiderschrank, unter meinem Bett? Wenn Vater glaubt, dass beide Kinder gemeinsam von der Insel geflohen sind, werden sie ganz bestimmt nicht genauer in meinem Zimmer nach mir suchen. Ich werde einfach so lange in meinem Versteck verharren, bis Boy zurückkommt.
Mit wenigen Schritten bin ich am Kleiderschrank und schiebe Gummistiefel, den Schlafsack, meine alte Puppe Mirabell, Grimms Märchenbuch und die bemalte Zigarrenkiste zur Seite, in der ich meine gesammelten Schätze vom See aufbewahre. Dann klettere ich auf das untere Regalbrett und schließe die Türen hinter mir. Es ist dunkel. Erschöpft lasse ich mich gegen die Schrankwand fallen, ziehe die Beine an meine Brust und versuche so geräuschlos wie möglich durch die Nase zu atmen. Es riecht nach frischer Kernseife und gebeiztem Holz. Ich muss mich beruhigen. Ich muss einen Plan entwickeln.
Wie wird Mutter reagieren, wenn sie bemerkt, dass ich nicht in meinem Zimmer bin? Wird sie zuerst Vater rufen oder gleich zu meinem Bruder ins Zimmer stürzen?
Irgendetwas streift mein Gesicht, wahrscheinlich der grüne Winterpullover mit den Rentieren, den mir Mutter zum vierzehnten Geburtstag gestrickt hat. Ich schiebe die kratzige Wolle zur Seite, der Kleiderbügel quietscht auf der Metallstange, die über mir hängt. Ich beuge mich vor und blicke durch den Spalt zwischen den Schranktüren. Staubkörner schweben im strahlenden Sonnenlicht. Ich kneife die Augen zusammen, doch ich kann nur die Bettkante und einen Teil meines Dachfensters erkennen. Also, Juno, wie lautet dein Plan? Jede Minute kann Mutter im Flur auftauchen, um mir den Frühstücksbrei zu bringen.
Ich stelle mir vor, wie sie die Tür aufschließt und mein leeres Zimmer betritt. Wie ihr das Tablett aus den Händen gleitet und das Geschirr auf dem Boden zerspringt, wie sie im Raum umherstiefelt und nach Vater ruft. Sie werden sich fragen, wie ich aus dem abgesperrten Zimmer verschwinden konnte. Und dann wird Vater auf das offene Sprossenfenster deuten, die einzig logische Fluchtmöglichkeit, die mir bleibt. Mein Herz setzt aus.
Das Fenster! Es ist verschlossen.
Mit beiden Füßen drücke ich die Schranktüren auf, klettere hinaus und stürze ans andere Ende des Zimmers. Mit wenigen Handgriffen habe ich den kleinen Metallverschluss entriegelt und öffne das Fenster. Kühler Wind streift meine glühenden Wangen. Ich hole tief Luft. Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Verärgert beiße ich mir auf die Unterlippe.
Ein Bettlaken, schießt es mir durch den Kopf – ich muss irgendeine Art von Seil am Rahmen befestigen und aus dem Fenster baumeln lassen, damit meine vermeintliche Flucht überzeugend wirkt.
Eigentlich neige ich nicht zu spontanen Bauchentscheidungen, dabei entstehen die meisten Fehler. Da bin ich mir sicher. Vater sagt, bei meinem Rechentalent würde ich später bestimmt komplizierte Maschinen bauen. Oder Brücken und Blockhütten.
Ich mag keine Überraschungen. Nicht einmal an meinem Geburtstag. Mittlerweile haben Mutter und Vater meine Sonderlichkeit akzeptiert und überreichen mir meine Geschenke unverpackt. Seit meinem dreizehnten Geburtstag. Ich kann es nicht erklären, aber es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.
Ich höre einen Schlüssel im Türschloss und drehe mich um. Die Tür wird entriegelt, die Klinke heruntergedrückt. Mutter taucht in meinem Zimmer auf, in der Hand das Frühstückstablett.
»Was machst du da?«
»Nur etwas frische Luft hereinlassen«, antworte ich knapp, verschließe das Fenster und springe auf meine Matratze. Ich bete, dass Mutter nicht zum See hinunterblickt und den leeren Bootssteg entdeckt.
Sie geht ein paar Schritte auf mich zu, stellt das Tablett auf meinen Nachttisch ab.
»Hör mal, Juno«, sagt Mutter und setzt sich zu mir auf die Bettkante. »Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht schlagen.« Sie streicht mir über die Stirn. »Ich hatte einfach Angst. Verstehst du das?«
Ich bin überrascht und halte einen Moment inne. Mutter hat sich noch nie bei mir entschuldigt.
»Und ich wollte nicht gemein werden«, sage ich und schlinge meine Arme um ihren Oberkörper. Ich drücke sie fest an mich.
Dann weinen wir beide. Es tut gut.
Nach einer Weile löst sich Mutter von mir und sieht mir in die Augen. »Bedrückt dich etwas? Juno, du weißt, du kannst mit mir über alles reden. Wir sind doch eine Familie.«
Ich denke über das Gespräch mit Onkel Ole am Seeufer nach. Und über das fehlende Boot. Es gibt so viel, über das ich mit Mutter sprechen möchte. Doch bei jedem Thema werde ich streng bestraft.
»Schon gut«, sagt Mutter. »Ich habe dir Erdbeeren gepflückt. Die liebst du doch so.« Sie lächelt sanft und reicht mir die Schale. »Also wieder Frieden?«
»Boy ist abgehauen.«
»Wie bitte?«
»Mit dem Boot«, sage ich und deute auf das Dachfenster.
»Das kann gar nicht sein.« Mutter fixiert meinen rechten Zeigefinger. Er rührt sich nicht. »Dein Bruder ist in seinem Zimmer. Die Tür ist abgeschlossen.«
Mutter steht auf und geht zum Fenster. Gleich wird es mächtig Ärger geben. Doch stattdessen dreht sie sich zu mir um und lächelt. »Vater ist gestern auf die andere Seite gerudert, Juno. Gleich nachdem Onkel Ole fort war. Er besorgt unsere Monatseinkäufe im Dorf. Schon vergessen?«
»Vollmond«, sage ich leise und bereue, dass ich nicht eine Sekunde länger nachgedacht habe.
»Vater wird bestimmt bald zurück sein. Vielleicht bringt er uns dieses Mal sogar …«, Mutter hält inne, starrt regungslos aus dem Fenster. Hinunter auf das funkelnde Wasser. »Wie kommst du überhaupt darauf, dass Boy die Insel verlassen will?«
Ich drücke die Fingernägel in meine Handballen. So fest, dass es schmerzt. »Wegen gestern Abend«, presse ich heraus.
»Blödsinn«, sagt Mutter knapp und zieht die Vorhänge zu. Warmes orangefarbenes Licht legt sich wie ein Schleier über die Zimmerwände, meinen Kleiderschrank, den gestreiften Teppich, den Nachttisch, über unsere Gesichter. Mutter setzt sich wieder zu mir auf die Bettkante. »So ein Risiko würde dein Bruder doch niemals eingehen.«
Ich aber schon, denke ich. Mutter seufzt, als könnte sie meine Gedanken lesen. Ich lasse mein Kinn auf die Brust sinken und falte die Hände in meinem Schoß. Bitte, lieber Gott, lass sie nicht weiterfragen.
»Juno, sieh mich an.« Mutter ergreift meinen rechten Zeigefinger, umschließt ihn mit der Faust. »Ihr Kinder plant doch nicht etwa, auf die andere Uferseite zu rudern?«
Ich schweige. Sie drückt die Faust stärker zu, und ich spüre, wie das Blut in meinem Finger zu pulsieren beginnt.
»Nein, Mutter.«
»Ich erinnere mich an die Zeit, als ich so alt war wie du, Juno. Ich dachte, mit sechzehn wäre ich erwachsen.« Sie rutscht näher zu mir heran. »Und ich wüsste als Einzige, wie die Welt da draußen funktioniert. Deshalb wollte ich sie erkunden. Dabei war ich nur ein kleines, dummes Mädchen.«
Ich konzentriere mich auf meinen Zeigefinger, der wie in einer Schraubzwinge in Mutters Faust klemmt.
»Dir wachsen Flügel, mein Kind. Doch für unsere Familie ist das zu gefährlich, verstehst du? Vor diesem Moment habe ich mich immer gefürchtet. Wir besitzen nur ein einziges Boot. Wenn einer von euch beiden hinüberrudert, kommt Vater nicht mehr von der Insel. Er kann euch nicht suchen. Und nicht retten, wenn die Fremdlinge …« Sie stockt, lässt meinen Zeigefinger los. »Ich würde vor Kummer sterben, wenn dir da draußen etwas passiert.« Mutter fasst sich mit der Hand an die Kehle. »Möchtest du das?«
Ich hasse es zu lügen.
Doch dann balle ich meine rechte Hand zur Faust.
5
Mutter wäscht das Blut aus Vaters Hemd. Dicht gedrängt stehen wir um das Waschbecken in der Küche herum und beobachten, wie sie mit Kernseife in kreisenden Bewegungen über den Stoff reibt. Doch die Flecken lassen sich nur schwer entfernen. Genauso wenig wie mein Wunsch, die Insel zu verlassen. Daran wird auch dieses Theaterstück nichts ändern, das Mutter seit dem Frühstück für uns aufführt.
»Die Fremdlinge haben ihn schwer verletzt«, erklärt sie und hält das Hemd unter den Wasserhahn. »Vater konnte sich nur mit letzter Kraft befreien und vor ihnen flüchten.«
»Sie sind ihm doch hoffentlich nicht bis zur Insel gefolgt, oder?«, fragt Boy, während er auf seinen Fingernägeln kaut, als wären es Karottenstäbchen. »Sie wissen nicht, wo wir leben?«
Ich würde meinem Bruder gern sagen, dass er sich nicht sorgen muss. Dass Mutter nur versucht, uns Angst zu machen. Denn das glaube ich. Sie ahnt, dass wir mit dem Gedanken spielen, die Insel zu verlassen. Mein Zeigefinger hat es ihr verraten. Doch da erneuter Zimmerarrest unsere Sehnsucht offenbar nicht vermindern kann, blieb ihr keine andere Wahl, als uns mit diesem schauderhaften Trick davon zu überzeugen, dass Vater auf seiner Rückkehr aus dem Dorf von den Fremdlingen angegriffen wurde. Und wie erwartet fällt Boy darauf herein. Aber ich bin keine zwölf mehr. Ich spiele also mit, trete von einem Fuß auf den anderen und gebe das verängstigte Mädchen. Obwohl ich mir sicher bin, dass es sich um Holzlack handelt, den sie aus Vaters Hemd wäscht. Es hat denselben Farbton wie der Anstrich des Geräteschuppens hinter unserem Haus. Frisches Blut ist heller, das weiß ich. Zumindest bei Fischen.
»Vater kennt den Wald gut. Er hat sich hinter einem großen Baumstumpf versteckt, bis die Fremdlinge fort waren«, sagt Mutter und reibt die Seife fester in den Stoff.
»Deshalb kam er erst so spät in der Nacht zurück?«
»Euer Vater durchlitt Todesängste.« Mutter lässt das Hemd ins Waschbecken fallen und verschließt den Abfluss mit einem Stöpsel. Sie öffnet den Wasserhahn. »Er konnte nicht einfach zur Insel zurückrudern. Das hätte die Fremdlinge sofort zu uns geführt.«
Ich blicke zu meinem Bruder und erkenne die Furcht in seinen Augen. Er greift nach Mutters Arm. »Und jetzt sind sie auf der anderen Seite und suchen nach uns?«
»Ja, mein Junge. Wir gehen davon aus, dass sie immer noch im Wald sind.«
Ein geschickter Schachzug, denke ich. Sie wollen uns davon abhalten, über den See zu rudern. Ich staune über mein Kombinationsvermögen. Noch bis vor wenigen Tagen hätte ich genauso verängstigt reagiert wie Boy. Wie ein kleines Kind. Doch das bin ich nicht mehr. Ich stelle Fragen und finde Lösungen. Seit dem Zusammentreffen mit Onkel Ole fühle ich mich reifer, mutiger. Ich habe das Problem wie eine erwachsene Frau geklärt und gehandelt. Wie gern würde ich Mutter von meiner Heldentat berichten, dann könnte sie mit dieser albernen Wascherei aufhören.
»Das ist keine Übung, Juno.«
»Natürlich nicht, Mutter«, antworte ich und verknote die Hände hinter meinem Rücken. »Sonst hätten wir auf unseren Zimmern bleiben müssen.«
»In der Tat«, sagt Mutter und dreht den Wasserhahn ab. »Es ist überlebenswichtig, dass ihr das versteht.« Sie deutet auf das halb gefüllte Waschbecken. Wie eine einsame Insel ragt Vaters Hemd aus dem rostbraunen Wasser heraus. »Das hier ist bedeutsamer als Zimmerarrest.«
»Ja, Mutter.«
»Und wie geht es Vater?«, fragt Boy und blickt zur Holztreppe hinüber, die ins erste Stockwerk führt.
»Er braucht jetzt Ruhe, Kinder. Bitte stört ihn nicht.«
»Wird seine Wunde wieder verheilen?«
»Ich musste sie nähen«, antwortet Mutter. »Aber Vater ist über den Berg. In ein paar Tagen wird er wieder auf den Beinen sein.«
»Ich werde ihm gleich ein Bild malen«, sagt Boy. »Von unserer Familie. Oben in meinem Zimmer.«
»Über das Geschenk wird er sich sicherlich sehr freuen.« Mutter streicht meinem Bruder über die Wange.
»Und ich werde Vater einen Blumenstrauß pflücken«, füge ich schnell hinzu. Das ist meine Chance, endlich raus in den Garten zu kommen. Trotz Zimmerarrest. Vielleicht sogar bis hinunter an den See. »Darf ich?«
Mutter nickt mir zu. Dann dreht sie sich wieder zum Waschbecken und widmet sich Hemd und Kernseife. Boy und ich sehen uns kurz an, dann rennen wir los. Jeder mit einem anderen Ziel. Doch bevor ich zur Haustür hinauslaufe, nehme ich einen Umweg über das Wohnzimmer. Ich steuere auf den Sessel zu, in dem Vater montags seine Wochenzeitung liest. Dahinter, auf dem schmalen Fensterbrett, liegt es, zwischen Drachenbaum, Palmlilie und Korallenkaktus. Immer griffbereit. Ich schnappe mir das Fernglas und verschwinde hinaus in den Garten. Ich halte ihre Lügen einfach nicht mehr aus, ich muss schnellstens einen Weg finden, um von dieser Insel zu verschwinden.
Das Bündel Wildblumen liegt vor mir auf dem Felsen. Zur Absicherung habe ich mein rechtes Bein über die stacheligen Stängel gelegt, damit der Blumenstrauß nicht vom Wind fortgeweht wird. Mir bliebe keine Zeit, neue zu pflücken. Mutter würde skeptisch werden, wenn ich so spät zurückkäme. Aber ich bin ja nicht wegen der Blumen ans Seeufer gerannt.
Ich nehme Vaters Fernglas, das mir um den Hals baumelt, und blicke hindurch. Auf die andere Seite des Sees. Sofort wird mir schwindelig. Die Sicht ist verschwommen, milchig grün. Alles dreht sich. Mein Oberkörper beginnt zu schwanken, ich reiße mir das Fernglas von den Augen. Rasch stütze ich mich am Stein ab und fixiere für einige Sekunden meine roten Sandalen, die fünf Meter über der dunklen Wasserfläche baumeln.
Nachdem sich meine Augen etwas beruhigt haben, greife ich erneut zum Fernglas. Es liegt schwer in meiner Hand. Bevor ich abermals hindurchblicke, verdrehe ich zuerst das Zahnrädchen, das zwischen den Gläsern angebracht ist. So blind muss sich Vater also fühlen, wenn er seine Brille verlegt hat, denke ich und schraube das kleine Einstellungsrad bis zum Anschlag.
Jetzt erkenne ich jedes einzelne Laubblatt der Birke, sogar den weißen Ringelkork der Rinde, meterweit entfernt, auf der anderen Seite des Sees. Ich schwenke mit dem Fernglas weiter nach links in den dichten Kiefernwald. Ein dünner Streifen Sonnenlicht zwängt sich durch die Bäume, fällt auf moosbewachsene Felsspalten und verwitterte Baumstümpfe. Ich sehe sogar einen Semmelstoppelpilz am Fuße einer Kiefer. Und dann, nur wenige Zentimeter nach rechts, habe ich ihn endlich gefunden: Onkel Oles schmalen Trampelpfad. Den Weg zum Dorf, meinen Weg zur Freiheit.
Alles ist so dicht vor meinen Augen, als könnte ich danach greifen.
Mein Plan steht fest. Ich werde noch diese Woche auf die andere Seite rudern. Heimlich, wenn Mutter und Vater schlafen. Ich werde Boy wecken und mit ihm die fremde Welt da drüben erkunden. Dort, wo die Bäume grüner, die Häuser größer und die Menschen ehrlicher sind. Mutter hat mich lange genug wie ein unreifes Kind behandelt. Das wird mir von Tag zu Tag klarer. Aber ich will keine Märchen mehr hören. Über die bösen Fremdlinge, die Vater angegriffen haben. Ich muss meine Erfahrungen selbst machen. Schließlich bin ich kein dummes Mädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau mit eigenen Wünschen und Sehnsüchten. Aber Mutter versteht das nicht. Für sie zählen nur Gehorsam und Strafe, in ihrer Nähe fühle ich mich einsam und unverstanden. Hätte ich mehr Mut, würde ich sie anschreien.
Ich schaue mit dem Fernglas zu unserem Steg hinüber und beobachte Vaters Ruderboot, das sanft auf den Wellen schaukelt. Seit Boy und ich denken können, wurde uns strengstens untersagt, in das Boot hineinzuklettern. Auch nicht zum Spaß. Wir könnten dabei kentern und ertrinken. Deshalb weiß ich nicht, wie es funktioniert.