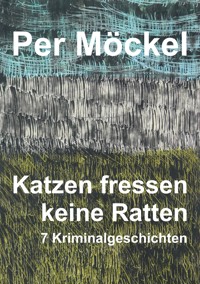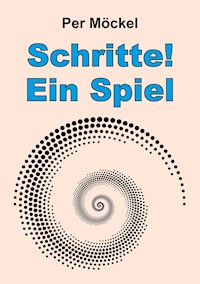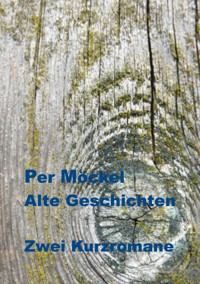
4,99 €
Mehr erfahren.
Zwei Kurzromane Gründung und einziges Konzert des Lerchen-Quartetts Im Schatten eines Berges Die erste Erzählung aus Lörrach berichtet von einem frisch verwitweten Cellisten im Rentenalter, der sich wieder ins Leben stürzen will, weil er Geld verdienen muss und nicht allein bleiben mag. Er beschließt nach einigen Fehlschlägen, ein Streichquartett zu gründen und organisiert mit alten Freunden Proben und ein Konzert, was sich alles aber ganz anders anlässt als er vermutet hat ... Die zweite Erzählung spielt in Basel und Umgebung und ist ein auf Tatsachen beruhender Krimi; die Heldin ist eine junge Frau, die, um an richtig viel Geld zu kommen, beschließt, einen Drogenproduzenten aus der Stadt auszurauben und selbst ins Geschäft einzusteigen. Doch es sind schon andere Akteure auf der Szene, die ebenfalls Verbindungen in der Regio haben und sich nicht so einfach hinausdrängen lassen. Die Heldin ist gezwungen, eine ganz andere Art von Auseinandersetzung zu führen als sie erwartet hatte, und sie darf da-bei vor nichts zurückschrecken ... Mit einem Vorwort
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Per Möckel
Alte Geschichten
Zwei Kurzromane
© 2024 Per Möckel, Wiesentalstr. 4, 79694 Utzenfeld
Titelbild: Per Möckel
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Softcover978-3-384-32237-1copy
Hardcover978-3-384-32238-8copy
E-Book978-3-384-32239-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Gründung und einziges Konzert des Lerchen-Quartetts
1. Kapitel: Plan und Auswahl, Thema und Seitenthemen
2. Kapitel: Proben – Variation
3. Kapitel: Aufführung – Reprise
Im Schatten eines Berges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alte Geschichten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Im Schatten eines Berges
Alte Geschichten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Vorwort
Da nun die Person, die das Vorbild für die Protagonistin von „Im Schatten eines Berges“ gewesen ist, nicht mehr lebt und auch schon eine oder zwei andere Figuren ihre Vorbilder durch den Tod verloren haben, können wir einige Bemerkungen zum Material der Geschichte machen, ohne jemanden bloßzustellen. „Im Schatten eines Berges“ ist als erste einer Reihe von Erzählungen mit ganz unterschiedlichen Themen entstanden, deren Grundlage lange und eingehende Gespräche mit beteiligten Frauen und Männern gewesen sind und deren Erlebnisse und oft auch deren Erscheinung wir später geschildert haben.
Dabei sind oft Handlungen und Einstellungen zur Sprache gekommen, die in einem Leben am Rande der Gesellschaft verbreitet sind. Es fällt auf, wie oft Kriminelle sich in ihren Taten als passiv Beteiligte, als Schwache und Ausgelieferte erleben, denen im Grunde nichts als Verschulden zugerechnet werden könne. Während sie bei der polizeilichen Aufarbeitung von Geschehnissen und vor Gericht als Täter behandelt und geschildert werden, haben sie selbst von sich oft nicht diesen Eindruck eines Aktivseins, eines Handelns. Vielmehr, wie etwa auch „Rita“ in unserer Erzählung, erleben sie sich selbst als Opfer. Aktiv erscheinen sie sich selber in der Phase der Vorbereitung, der Planung, der Ausarbeitung, sobald diese aber abgeschlossen ist, scheint es, als seien die Geschehnisse bereits Wirklichkeit und unumgänglich geworden, als treibe das Schiff ihres Alltags darauf zu, unaufhaltsam wie ein Boot auf einem großen Fluss, und als könne dem Geschehen selbst nicht mehr ausgewichen werden, ganz gleich wie man sich persönlich dazu stellen mag, ja oftmals, obwohl man sich inzwischen, in der Phase des Herannahens, anders entschlossen zu haben scheint. Doch die Pläne sind bereits wie Fakten geworden; es ist, als sei doch alles schon geschehen und nicht mehr zu ändern. Deshalb die Aussage vieler Täter, dass nicht sie etwas getan hätten, sondern dass „es“ geschehen sei wie das Sich-Auswirken einer autonomen Macht, der Macht des Faktischen. Diese Macht wird auch manchmal bewusst angewandt oder heraufbeschworen, wenn zum Beispiel Frauen glauben, dadurch, dass sie sich einem Mann hingegeben haben, seien für ihn gewisse Worte, Einstellungen oder Handlungen nun einfach nicht mehr möglich oder ein Kind zum Beispiel ändere in einer Beziehung alles von Grund auf. Doch neigen Männer dazu, gerade diese Frauen dann rücksichtslos zu behandeln, um sich selbst und anderen zu beweisen, dass sie sich „von so etwas“ nicht bestimmen lassen. Andererseits stammt aus derselben Quelle auch der Druck, den oft Täter ausüben, um Opfer oder Komplizen dazu zu veranlassen, bestimmte Worte auszusprechen oder bestimmte Handlungen auszuführen, weil sie wissen, dass diese Tatsachen dann wie Felsbrocken auf den weiteren Handlungen der Betroffenen lasten. Später folgt dann die innere Abwehr solcher Geschehnisse. Man kann es, manchmal schon unmittelbar darauf, von sich selbst nicht mehr glauben, dass man gewisse Dinge getan haben soll – ein verbreitetes Phänomen in Gesellschaften, die eben einen Krieg beendet haben. Darum auch die immer wiederkehrende Aussage, „man habe das alles ja gar nicht gewollt“, womit viele Täter Vorwürfen begegnen, so als bedeute das Nicht-Wollen zugleich, dass man also auch nicht bestraft werden könne. Besonders Mädchen, die zum ersten Mal vor Gericht stehen, sind oft empört über Vorwürfe, die man ihnen macht, und halten die Aussage, sie hätten das ja nicht gewollt oder doch nur getan, was ihnen jemand anderer gesagt habe, für einen Schutz vor Strafverfolgung.
Besonders schwer erträglich ist für alle Menschen offenbar die Vorstellung von sich selbst als eines schlechten Menschen, einer Person mit Willen zum Bösen. Selbst mehr- fach hart bestrafte Täter sind der Meinung, im Grunde seien sie gute Menschen, und durch ihre Taten hätten sie im Grunde doch Gutes bewirkt: eine alte Ungerechtigkeit beseitigt, den Grad der Ordnung in einem bestimmten Bereich der Wirklichkeit erhöht oder wenigstens dafür gesorgt, dass einige bestimmte Tatsachen nun endlich gesehen werdn könnten als das, was sie wirklich sind, im Grunde also positive Effekte. Das Bild von sich selbst, dass man andere verletzt, dass man andere bestohlen, betrogen, verraten hat, ist äußerst schwer auszuhalten. Selbst schlimme Straftaten müssen irgendwie erträglich gemacht werden, sonst kann man nicht leben. Das macht es natürlich auch so schwer, das eigene Verhalten zu ändern, denn man folgt meist dem Weg, den das eigene Verhalten der Vergangenheit vorgegeben hat; auch die Vergangenheit gewinnt schnell diesen Charakter des Unausweichlichen, dem man sich selbst ausgeliefert sieht. So erscheint es logisch, dass für einen selbst alles, was danach und dazukommt, nur der Nachklang, nur die Auswirkung eines fast anonymen, abstrakten Geschehens ist, eines Verhängnisses, das niemand verhängt hat, mit dem man selbst so gut wie nichts mehr zu tun hat. Insofern sind die Anstalten voller Menschen, die sich selbst nicht anders vorkommen als unschuldig und das auch so erzählen.
Der erste Schritt auf einem Weg in die Kriminalität findet oft in früher Jugend statt, wenn eine Person eine beunruhigende Entdeckung bei sich selbst macht, nämlich die, dass bei einem selbst bestimmte Gefühle oder instinktive Reaktionen einfach nicht existieren. Es wird erwartet und unterstellt, dass man seine Familienmitglieder liebt oder Freunde schützt, sie nicht betrügt oder bestiehlt und für sie eintritt, dass man Einzelnen oder einer Gruppe gegenüber Loyalität, Freundschaft, Verbundenheit empfindet, aber tief im Inneren ist man frei davon, solche Bindungen zu fühlen, was einen umgekehrt von ebensoviel Hemmungen und Skrupeln freimacht. Man weiss, dass man Liebe oder Freundschaft empfinden müsste, aber an der erwarteten Stelle im eigenen Inneren befindet sich nichts. Man kann nicht fühlen, sondern nur konstruieren. Das führt oft dazu, dass man in seiner Sprache die Verbundenheit, die man nicht empfinden kann, besonders betont. Zuhörer sollten immer misstrauisch sein, wenn jemand erklärt, er könne etwas doch „seiner eigenen Mutter“ oder „seinen eigenen Kindern“ nicht antun. „Seine Mutter“ und „seine eigene Mutter“ ist genau dieselbe, ebenso „seine Kinder“ und „seine eigenen Kinder“ – zu welchem Zweck diese besondere Betonung? Der Sprecher erwartet, dass andere aufgrund seiner Aussage bestimmte Gedanken einfach nicht denken können. Und diese Freiheit von Einschränkungen führt einen oft dazu, sie auszunutzen, was dann langsam in die Katastrophe führt. Wie einer unserer Gesprächspartner uns später sagte: „Wenn ich jemanden bestehle, dann bestehle ich bevorzugt meine Freunde. Das ist leichter, denn sie sichern sich nicht dagegen, gerade von mir bestohlen zu werden, und ich habe noch dazu den Vorteil, später Mitgefühl zeigen und sogar meine Hilfe anbieten zu können.“
„Rita“ hat mir ihre Laufbahn erzählt; diese Bahn hat ein natürliches Gefälle, das stets die Versuchung ausübt, ihr nachzugeben; wir haben uns damals am Spalenberg in Basel und in einigen Beizen der Umgegend getroffen – sie heißen alle anders – und einige der Geschehnisse sind, falls ich mich richtig erinnere, sogar in der lokalen Presse geschildert worden. Während der neunziger Jahre – der Leser wird bemerken, dass damals noch einige Währungen existieren, die kurz darauf im Euro aufgegangen sind – war die Herstellung von Rauschmitteln nach eigenem Rezept und in der eigenen Wohnung noch eine relativ neue Sache, obwohl diese Praxis in Übersee schon in großem Umfang geübt worden ist. Rita und ihr Kreis haben US-amerikanische und britische Gang-Mitglieder sehr bewundert und immer so sein wollen wie sie. Deshalb auch die englischen Tarnnamen und die Neigung, besonders rücksichtslose Gewalt anzuwenden. „Rita“ macht sich besonders wegen der Überwältigung und der Aufbewahrung ihres ersten Opfers viele Gedanken, ist aber nicht überrascht, als diese Klügeleien später durch die Aktionen ihrer Gegner ohne weiteres über den Haufen geworfen werden. Sie ist, schon bevor sie ihre Aktion beginnt, bereit, „zu tun, was getan werden muss“, und will auch so gesehen werden. Besonders eindrucksvoll fanden wir den Zwang, den eine Schusswaffe, selbst die bloße Anwesenheit einer Schusswaffe, die noch nicht in Anschlag gebracht worden ist, in einem Geschehen ausübt. Ist eine Waffe da, verbreitet sie scheinbar von ganz allein einen Druck, auch abgefeuert zu werden, so wie ein mitgenommenes Messer scheinbar von ganz allein seinen Träger dazu bestimmt, es auch zu benutzen, sodass er danach, nicht völlig ohne Grund, behaupten wird, „es“ sei dann eben geschehen, ohne seinen Willen.
Auf diese Gespräche sind noch viele weitere gefolgt, die alle sehr aufschlussreich waren und es auch noch heute sind. Dabei interessieren uns vor allem die alltäglichen Vorgänge in einem Betrieb, einer Gedankenwelt, einer bestimmten Gegend, in der sich Menschen bewegen.
So ist es auch bei dem Helden der Erzählung „Gründung und einziges Konzert des Lerchen-Quartetts“, Axel Michaelis, eines Profi-Musikers, der nach dem Tod seiner Frau, obwohl schon im Rentenalter, vor dem Nichts steht. Als Künstler hat er nie viele Gedanken an seinen Ruhestand oder auch nur an nachlassende Kräfte verschwendet, also muss er nun sehen, sich irgendwie als Dienstleister fortzubringen. Einige Versuche später kehrt er trotz gewisser Skrupel zu seinem erlernten Beruf als Musiker zurück und ist sogar entschlossen, zum Unternehmer zu werden und ein Streichquartett ins Leben zu rufen. Doch beginnt es allmählich zum Problem für ihn zu werden, dass sein Leben, sein Interesse sich möglicherweise schon längst von der Kunst abgewandt hat. Ob Frauen sich einem Witwer wirklich in starkem Maße zuwenden oder ob das ein Mythos ist, bleibt im Ungewissen. Wie ein Streichquartett arbeitet, haben wir von einem steinalten Violinisten erfahren, von dem wir auch die Versuchung zum Nihilismus übernommen haben.
Die Erzählung handelt von den letzten beiden Stationen einer langen Reise, von dem Punkt, an den man zuletzt gelangt, wo man, wie es heißt, schaut, was man geglaubt hat. Was zählt wirklich, wovon lebt man am Ende? Ist man am Ende wirklich ganz allein? Der alte Herr, der uns die Geschichte eines Freundes anvertraut hat und der wir im großen und ganzen gefolgt sind, ist sehr im Zweifel gewesen, was und wieviel am Ende von einem übrigbleibt, wie sehr man am Schluss tatsächlich noch der ist, der man sein ganzes Leben lang zu sein geglaubt hat. Die Hoffnung ist, dass einem die entscheidenden Wendungen und Verwandlungen des Lebens noch bevorstehen, auch wenn man an einen unzerstörbaren Kern in einem selbst nie hat glauben können.
Der alte Hund, der in der Geschichte auftaucht, ist ein Porträt unseres eigenen schwarzen Spaniels mit Namen Tassilo, den meine Mutter damals als ganz jungen Hund bekommen und bis zu seinem Tod sehr liebgehabt hat.
Wir hoffen, dass diese Erzählungen das Interesse des Lesers finden werden.
Per Möckel
Gründung und einziges Konzert des Lerchen-Quartetts
1. Kapitel: Plan und Auswahl, Thema und Seitenthemen
„Papperlapapp“, sagte seine Frau, und er schämte sich, weil ihm dabei einfiel, wie er in der Nacht darüber nachgedacht hatte, was wohl ihr letztes Wort sein würde. Er strich über sein Bärtchen.
„Du bist noch immer ein schöner Mann“, sagte seine Frau, und, absichtlich oder nicht, ihre Stimme brach. Ihre Wangen waren flach und dünn, fleckig und ohne Farbe. „Denkst du an den Hund?“ Er musste auf den Gang hinausgehen, als die Schwester kam, aber er war nicht wütend. Die Schwester war frisch, fest, rund und roch nach Seife. Er war auf der Hut davor, sentimental zu werden; er suchte nach solchen Kontrasten, das war ein Merkmal seiner Stimmung, auch seine Frau hatte ihm das gesagt. Bei der anderen Nachtschwester wäre es ihm weniger leicht gefallen: deren Gesicht unter der Haube, und dem schweren braunen Haar war buttergelb, der Kittel steif wie Leder, und sie roch nach Schweiß und Pfefferminze; im ganzen wirkte sie kränker als ihre Schützlinge. Eine alte Frau – eine sehr alte, denn er selbst war schon alt – schob einen Ständer mit drei Infusionsflaschen daran vorbei. Die grauen Zöpfe trug das Wesen um den Kopf gelegt, und unter den lebhaften braunen Augen schlug der offene Bademantel wie ein schlaffes Segel hin und her. Alles war ihm peinlich, alles. Die Krankheit seiner Frau, von der feststand, dass sie tödlich sein würde, sein Herumkriechen im Zimmer und auf dem Gang, die Blicke der anderen Heimbewohner im Speisesaal und im Aufenthaltsraum. Er hatte Angst davor, überall Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, von seiner Frau, von der Hochzeitsreise, vom Krieg. Alles setzte ihm zu. Ein Leben lang hatte er gegen seine Sentimentalität gekämpft und nun fehlte nur noch eine Tasse Tee oder Schnaps, und der Stausee würde den Damm überfluten.
Er lachte; ein Leben lang – das war es doch schon, oder nicht?
„Sie können wieder hineingehen, wenn Sie wollen“, sagte die Schwester; es war der zweite Nachtvogel. Sicher; sie hatte seiner Frau die Spritze gegeben.
„Sie schläft.“ Aber in einer Viertelstunde würde sie wieder erwachen. Er sah nur kurz ins Zimmer hinein. Rund um den kleinen Kopf auf dem Kissen war ein Schleier aus Schweiß. Das Haar sah wirr aus. Die Spritze machte seine Frau immer zuerst kurz unruhig. Er beschloss, auf dem Gang zu warten, bis sie erwachen würde. Sie hatte es nie leiden können, im Schlaf beobachtet zu werden.
Er ging über das blasige grüne Linoleum auf das Ärztezimmer zu, vorbei an vielen Grünpflanzen, alles Erbstücke von Heimbewohnern, die hier gestorben waren. Keine Krankenhaus-pflanzen, aber durch ihre Herkunft vielleicht noch bedrückender. Die sehr alte Frau erschien am Ende des Ganges, eine gelbe Kanne in der Hand, und begann, die Pflanzen zu gießen. Der Mantel und die Schläuche wogten hin und her. Aus einer offenen Tür trat etwas wie Nebel auf den Gang hinaus, ein feuchter, beißender Geruch. Die Ärztin, eine junge Frau mit Krisseihaar, einem runden geröteten Gesicht und Augen, die zugingen wie die einer großen Puppe, saß an dem niedrigen Tisch und rauchte. Sie sah auf ein leeres Spielbrett und einige Notizzettel hinab.
Als Michaelis eintrat – ohne zu klopfen, das hatte er vergessen – blickte sie langsam auf und sah mit zerstreuter Miene herüber. Als sie Michaelis erkannte, seufzte sie und lehnte den Kopf auf die Hand, in der sie die Zigarette hielt. „Herr Michaelis“, sagte sie, „sind Sie schon wieder hier drin?“ Sie war keine der Heimärzte, sondern wurde für besondere Gelegenheiten und als Spezialistin geholt. In diesem Raum bewegte sie sich mit der Ungezwungenheit von Leuten, denen klar ist, dass diejenigen, die aufräumen, nicht wissen werden, wer die Unordnung verursacht hat. Ein Ascheflöckchen rollte über ihren Ärmel auf den Tisch hinab.
„Ich kann Ihnen nichts Neues sagen.“ murmelte sie, um Michaelis' Frage zuvorzukommen.
„Darf ich mich setzen?“
„Bitte.“
Die niedrigen Polster waren schaumig-klebrig wie eine Süßigkeit, die Michaelis als Kind gekannt hatte. „Dr. Müller – guten Abend – Sie haben also heute Nachtdienst?“
Dr. Müller zog an der Zigarette und nickte. Der Rauch floss in ihr Haar und in ihre Ohren. Sie sah auf die Uhr. „Zeit für die Spritze.“
„Sie hat sie gerade bekommen. Ich glaube, Dr. Beckmann war da.“
Dr. Müller nickte.
„Meine Frau hat vorhin gefragt. Wie lange wird sie noch leben?“
„Drei Wochen.“ Sie sagte das bestimmt, aber lächelnd. Es war eine Art Spiel, dass er so fragte. Am Anfang hatte Dr. Müller ausführliche Antworten gegeben, dann gar keine, und jetzt irgendwelche. Zwei Tage zuvor hatte sie gesagt: ein halbes Jahr. Fragen Sie mich so etwas nicht, hatte sie bestimmt. Fragen Sie mich nicht nach Zahlen.
„Meine Frau hatte gestern ihren sechsundsiebzigsten Geburtstag.“ sagte Michaelis, uns nach einer Weile: „Gefällt Ihnen dieses Altersheim? Ich meine, glauben Sie, es ist ein angemessener Aufenthalt? Meine Frau ist Sängerin gewesen, wissen Sie.“ Da fing es doch schon wieder an!
„Sie hatten versprochen, zu verreisen“, sagte Dr. Müller. „Das war, glaube ich, vor zwei Wochen. Sie könnten auch jetzt noch fahren. Ihrer Frau würde es gut tun, und es würde ihr vieles leichter machen. Dieses Heim ist nicht sehr gemütlich. Ich glaube sogar, sie hasst es. Sie hat mir so etwas gesagt. Daran, fürchte ich, sind Sie selbst schuld.“
„Ja, wahrscheinlich. Meine Frau hat noch einige Freundinnen, wissen Sie. Aber wir, die Damen und ich, haben uns nicht verstanden.“
„Dann haben Sie einen Fehler gemacht. Männer brauchen doch weiter nichts zu tun als brav zu sein und sich anständig zu benehmen…“ sagte Dr. Müller, um Michaelis zum Lachen zu bringen. Ihr Gesicht war rot und leer, vielleicht ein wenig gereizt.
„Wir hätten sogar beinahe unseren Namen geändert, als wir hierher kamen“, sagte Michaelis, „vielleicht, um keine Spuren zu hinterlassen, damit uns niemand aufsucht.“
„Was für ein Unsinn. Aber Sie haben es nicht getan.“
„Nein, es ist auch niemand gekommen.“
„Sie hätten Stunden geben sollen.“ sagte Dr. Müller. „In Basel vielleicht. Singen ab sechzig oder so etwas.“
Michaelis seufzte und ging hinaus. Draußen, zwischen den Pflanzen, musste er lachen. Als er ans Bett seiner Frau kam, war sie wach und sah ihn an. Ihr hageres Gesicht war im Grunde wenig verändert, immer noch mokant, beinahe scharf, die grauen Wimpern und Augen, ihr Lächeln, die grauen, durchsichtigen Zähne, für die sie sich immer ein wenig geschämt hatte. Michaelis betrachtete alles abwechselnd distanziert und voller Liebe, die Stelle an ihrem Hals, wo der Puls klopfte, die kleinen runden Ohren; den prüfenden Blick. Die Augen lachten leise.
„Setz dich“, sagte sie und klopfte leicht auf die Decke. Er hatte schon immer gedacht, dass seine Frau so viele kleine Gesten für ihn habe, die sie genauso gut für ein Hündchen hätte haben können. Das hatte er bei anderen gesehen, und es hatte ihn geärgert.
„Was willst du also anfangen?“ fragte sie, mit langen Pausen sprechend. Er hob die Brauen; in dem polierten Kasten eines Geräts am Bett konnte er sein Gesicht erkennen, das Bärtchen, den Rollkragen seines schwarzen Pullovers. Er sah albern aus. Das Haar war wirr. Die Augen zwei flache dunkle Flecke.
„Nichts mehr“, sagte er, „ich werde hierbleiben, bis… ich weiß nicht. Hier bin ich versorgt, ich habe meine…“
„Unsinn.“ antwortete sie. „Du bist fünfzehn Jahre jünger als ich. Fünfzehn – und selbst mein Alter ist heute kein Alter mehr, wenn man nicht wie ich das Pech hat, todkrank zu sein.- Du wirst dich also nicht hier vergraben.“
„War das nicht deine Idee, ursprünglich, mein Schatz?“
„Mag sein. Aber von hier aus sieht man es besser. Von hier aus sieht man es besser.“
Das hatte er oft, oft gehört. Er schämte sich. Die Krankheit seiner Frau dauerte nun schon lange, und es schien ihm, als sei all sein Gefühl aufgebraucht worden. Als er sich auf dem Bett niederließ, verzog sie das Gesicht.
„Entschuldige.“
„Es geht vorbei. Was denkst du?“
„Nichts.“
Sie schwieg ebenfalls eine Weile. „Weißt du noch, wie es mit deiner Karriere aussah, als wir uns kennenlemten? Axel? Denkst du noch manchmal daran?“
„Sicher; oft.“
„Du warst sehr bequem.“
„Ja.“
Es entfiel ihr, was sie noch hatte sagen wollen; der Schmerz vertrieb die Gedanken aus ihrem Kopf. Michaelis konnte fühlen, wie sie ihre Fassung verlor und wiedergewann, obwohl er die ganze Zeit auf seine Hände starrte. Schließlich ließ sie ihre Finger über die seinen gleiten; und er sah auf. „Axel“, sagte sie, „willst du mir etwas versprechen?“
„Sag, was es ist.“
„Erst musst du es mir versprechen.“
„Nein, erst musst du es sagen. Um den Hund kümmere ich mich.“
Sie überlegte. „Ich glaube, du weißt es schon.“
„Was ist es?“
„Du musst mir versprechen, dass du nicht allein bleibst.“
Er schwieg.
„Das ist nicht gut für dich, glaub es mir. Ein Mann allein…“
„Aber – bitte, mein Schatz, ich bitte dich –“
Sie wehrte ab und sagte etwas mit ihrer neuen rauhen Stimme, die sie bekommen hatte, als ihre alte volle Stimme erloschen war. Sie sprach eine ganze Weile sehr leise, ohne dass Michaelis etwas verstehen konnte. „Jetzt habe ich für uns gebetet“, sagte sie. Michaelis schwieg. Das war so ihre Gewohnheit. Sie hatte vor jedem Auftritt zu Santa Cecilia gebetet, weil es Musik werden sollte, und zu Santa Egizia, ihrer Namenspatronin, weil sie selbst die Ausführende sein würde. Sie war eine gründliche Frau.
„Du lachst mich aus“, sagte sie und blickte Michaelis forschend an.
„Bestimmt nicht.“
„Doch, du lachst. Immer, wenn ich gebetet habe, hast du gelacht.“ Er schwieg und streichelte ihr Gesicht. „Axel“, sagte sie wieder, „wirst du mir nun etwas versprechen?“
„Was denn?“
„Du bist nicht alt, und du bist gesund. Kehr doch ins künstlerische Leben zurück. Willst du?“
„Ich fürchte, das hängt nicht davon ab, ob ich will, weißt du…“
„Richtig. Aber willst du es denn?“ Er wusste es nicht.
„Du warst immer ein großartiger Quartettspieler. Ich habe dich immer bewundert. Und ich habe immer geglaubt, dass dort deine eigentliche Begabung liegt. – Dann könntest du dieses Etablissement verlassen.“
„Wann?“
„Wenn du ein Quartett finden könntest.“
„Was ist das für eine Idee?“
„Oder gründe eins. Das ist noch besser –“ Sie hustete lange und ließ die Tränen über ihr Gesicht fließen. Ihre Lider waren schwer von der Anstrengung, die Augen nass und kalt. „Du könntest es nach mir nennen, Axel. Das Egizia-Magnusco-Gedächtnis-Quartett. Willst du mir das versprechen?“
Michaelis sah auf, blickte im Zimmer umher, und als er zur Tür sah, stand dort die junge Ärztin, deren Augen sagten: – Tun Sie 's doch. —
“Ideen.“ sagte er. Dr. Müller verließ den Raum.
„Willst du's auch nicht versuchen?“
Er schwieg.
„Und das andere, dass du nicht allein bleiben sollst; willst du mir das versprechen, wenigstens das?“
„Wenigstens das? Nimm an, ich wäre krank, würdest du es dann tun?“
„Nein. Aber das ist etwas ganz anderes.“
„Etwas ganz anderes, natürlich.“ Sie überlegte. „Ich muss dich nämlich warnen. Du wirst sonst leicht ein Opfer deines Selbstmitleids und deiner Bequemlichkeit. Ruhe: es ist so. Was ist? Keine Angst, ich habe keiner meiner Freundinnen gesagt, dass sie dich in Arbeit nehmen soll. Ist auch nicht nötig, sie kommen von selbst, sobald ich nicht mehr bin. Aber dann sei du wenigstens klug und wäge ab. Triff eine gute Entscheidung.“
Das lange Sprechen hatte sie erschöpft, aber sie lächelte, ja sie grinste sogar. Sie sah beinahe wieder so aus wie als Mädchen. „Armer Axel; es wird nicht leicht für dich werden.“ Sie schwitzte und sah aus dem Fenster.
Es war noch sehr früh, draußen war alles noch dunkel. Michaelis öffnete das Fenster ganz kurz. Ende Februar; an den Büschen hingen gefrorene Blätter; die Wiesenhügel, die nach Lörrach hinabgingen, waren kaum zu sehen.
Die Stadt rauschte, und der Fluss war unsichtbar. Den Himmel bedeckten dünne, dichte Wolken, die geronnen aussahen; es mochte halb fünf sein. Vor dem Tor unten lachten zwei Krankenschwestern, die ihre Jacken um die Schultern hängen hatten.
„Wie gut das duftet!“ sagte Egizia. Michaelis wandte sich um und schloss das Fenster. „Nein, laß offen, bitte. Du kannst gleich zumachen. Komm her.“
Er setzte sich aufs Bett und umarmte die Kranke. Sie streichelte seinen Rücken. Schließlich sagte sie: „Jetzt wird mir kalt.“
Er stand auf, schloss das Fenster und setzte sich wieder. Sie lächelte wieder so wie zuvor und sagte zu ihm: „Mein kleiner Seemann.“
Dann sahen sie einander lange an. Vor Wochen hatte Michaelis ihr ein paar dicke rote Kerzen geschenkt, weil sie das kahle fleischlose Licht der Lampen nicht mochte. Dennoch hatten sie sie erst einmal angezündet, am Tag zuvor, um Geburtstag zu feiern.
In der Zeit der Krankheit hatten sie wieder angefangen, nachts oder ganz früh zusammen zu sein, wie am Anfang, als sie geheiratet hatten. Es gibt Stunden innerhalb eines Tages, die man so selten betritt wie manche Zimmer eines Hauses.
Dann begann Egizias Blick zu erlöschen, und ihr Gesicht wurde ängstlich. Das Atmen tat ihr weh, und sie begann stark zu schwitzen. Ein seltsamer, hässlicher Geruch verbreitete sich im Zimmer, als zerbrächen Egizias innere Gefäße. Ihre Finger zitterten über die Decke hin, über Michaelis Hände, und er hielt sie fest. Ihr Blick kam noch einmal zurück; zwei große Tränen rollten aus ihren Augen, während sie in Michaelis' Gesicht sah und, ohne zu lächeln, wie eine Fremde langsam von einem Auge zum anderen blickte. Der Schweiß glitt von ihrer Stirn in ihr Haar und ihr Ohr und verging.
Sie öffnete den Mund und sank zurück, und eine Locke hing ihr bis an die Lippen. Ihre Augen wurden starr, sie atmete noch zwei oder drei Mal unhörbar und ohne dass sich ihre graue Brust bewegt hätte. Dann war alles still. Michaelis sah, dass die Kerzen nicht brannten, sondern dass seine Frau bei einem anderen Licht gestorben war. Er erschrak ein wenig, und erst lange Zeit später, als ihm die Beine einschliefen, erhob er sich, und ging, um die Schwester zu suchen.
Nachdem der Doktor den Tod bestätigt hatte, war Michaelis in sein Zimmer, nun also ehemals seines und das seiner Frau, hinaufgestiegen, durch den Flur mit gelbem Linoleum,durch den mit blauem und rotem in den mit kalkfarbenem, über wacklige Parkettleisten, an Türen vorbei, hinter denen alte Weiber schnarchten.
Axel und Egizia – das wäre eine guter Name gewesen für ein Artistenpaar, obwohl Axel kein Name schien für einen alten Menschen; im Grunde war kein Name, in dem ein X vorkam, für alte Menschen geeignet, nur für junge, außer Alexius, ein Name für russische Patriarchen; bärtige Felixe und achtzigjährige Xaveren gab es nicht oder sollte es nicht geben. Ajax, überlegte er, Maxentius, Max vielleicht: Maximilian.
Er stand an der Zimmertür. Es war fünf Uhr, und hinter den Türen begannen, eine nach der anderen, die Uhren zu schlagen, leise klingelnd oder stumpf und hölzern, und es würde sich lange hinziehen, bis auch die letzte sich gemeldet haben würde.
Nebenan, bei der alten Schurick, schlug es bereits sieben, ein schnelles verstohlenes Hämmern, dass man den Betrug nicht merken sollte. Michaelis trat ein, machte aber kein Licht. Er zog sich aus wie immer, hängte den Anzug über den gepolsterten Bügel, die Krawatte neben die anderen und legte sich ins Bett, wie immer die Füße ganz langsam in die Kälte vorschiebend wie in das Maul eines großen Fisches; ja, ganz wie er es als Kind im Wasser getan hatte, wenn er mit seinen Eltern ins Schwimmbad von Eckemförde gegangen war, wo ölige Schleier auf dem Wasser trieben und sein Vater gesagt hatte: das ist nur vom Sumpf, Junge, vom Torf, das ist nichts Schlimmes.
Maximilian: nicht der Kaiser, sondern der Kurfürst von Bayern, den hatte er lieber. Den Dreißigjährigen Krieg. Und nun war seine Frau gestorben. Er lachte halblaut, den Mund ins Kissen gepresst.
Die Heizung knackte; unten vor dem Tor – das Krankenzimmer hatte nach derselben Seite hinausgesehen – kam der Bäckerjunge mit seinem Karren Wasserwecken an. Michaelis war nicht hungrig; er schlief ein.
Um zwölf erwachte er – von dem schönen Gong der Uhr war nur noch ein Klickerieren übrig. Er zog denselben Anzug an und gelangte durch leere Gänge – es war Essenszeit – wieder in den Krankenbereich.
Das Bestattungsunternehmen war schon dagewesen. Man hatte seine Frau in einem Nebenraum der Kapelle aufgebahrt. Michaelis verlangte einen anderen Sarg, und als die Firma sich am Telefon unwillig zeigte, sagte er, er werde dann eben eine andere Firma beauftragen. Diese Leute wollten sich in ihrem Geschäft nicht stören lassen und glaubten, sie hätten durch Gewohnheit ein Recht auf alle Leichen, die das Altersheim zustande brachte. Gespräche, vor allem der Ton, in dem sie geführt wurden, harsch mit diesen, gramvoll und lämmergleich mit den Gratulanten, offiziell mit Pfarrer und Heimleitung, und alles ohne Kaffee und ohne Essen, denn etwas zu sich zu nehmen weigerte er sich – das war seine Art, seine Erinnerung an den letzten Augenblick zu erhalten – diese Gespräche erschöpften ihn so sehr, dass er sich um fünf Uhr, wieder zur Essenszeit, im Zimmer hinlegte, fast in der Gewissheit, nun sei sein Zeitpunkt gekommen und er habe nur noch die paar Verfügungen treffen müssen.
In der Nacht machte er sich eine Liste von allem, was zu erledigen war. Gesellschaft und Schlaftabletten lehnte er ab. Als er vom Balkon am Ende des Stockwerks zurückkam, merkte er, dass jemand in seinem Zimmer aufgeräumt hatte. Er fragte sich, wer es sein würde; denn sie würde gewiss zurückkommen.
Die Heimleiterin sagte, sie habe schon jemanden, der ab der folgenden Woche mit ihm sein Zimmer teilen werde. So, antwortete Michaelis, wenn er sich jedoch recht besinne, haben er und seine Frau die Miete bis Ende April bereits bezahlt, dann werde man weitersehen, doch bis dahin —
Er kleidete sich so bunt, wie er es wagte, um der natürlichen Anziehungskraft, die Trauer auf Fremde und besonders auf fremde Frauen ausübte, keinen Vorschub zu leisten. Mochten sie ihn für herzlos halten. Sein Herz war seine Angelegenheit.
Die Wirkung war nicht ganz die beabsichtigte. Die Damen hielten ihn für einen Verzweifelnden und eilten herbei, um ihn zu retten. Es blieb jedoch alles ganz äußerlich, zumindest hoffte er das.
Es floss alles an ihm vorbei. Die Leute, die aus und ein gingen, beachtete er kaum. Zum Essen ließ er sich viel Zeit; die Mahlzeiten waren wie weite stille Teiche, auf die er hinausfuhr, um innezuhalten und sich umzusehen. Er aß alleine in seinem Zimmer. Frauen brachten ihm Konfekt und ganze Mahlzeiten, und begegneten sich zwei, während er noch in der Tür stand, bei Auftritt und Abgang, dann schloss Michaelis die Augen und kam sich lächerlich vor.
Er empfand fast nichts, und manchmal wurde ihm sehr bange deswegen. Off saß er am Fenster und sah ins Zimmer hinein: das breite Bett, das man wie ein Gebäude umgehen musste, der hohe schwere Schrank, dessen Türen manchmal in der Nacht von selbst aufgingen und an das Fußende des Bettes schlugen zwei große Gewichte, zwischen denen man hindurch musste, und hinter denen der Fenstertisch mit den drei Stühlen fast wie auf einem Balkon wirkte, links und rechts Bücher- und Notengestelle, Plattenspieler, drei Pflanzen – von denen keine, das war gewiss, den Krankenflur zieren würde – Teewagen, Geschirrschränkchen.
Vor der Schlafpassage, wie ein eigenes Zimmer, der Rest: Schreibtisch, Toilettentisch, zwei Ölbilder einander gegenüber, zwei Porträts, die die Augen ineinander tauchten, irritierend, weil das Licht auf dem Bild nicht von derselben Seite kam wie im Zimmer. Eine altmodische gestreifte Tapete aus hartem rauhem Papier, über das Michaelis gern mit dem Finger gefahren war, wenn er auf seine Frau gewartet hatte.
Es war ein kühler Raum aus drei Päckchen, eines immer flacher als das vorige; schwierig zu durchqueren, fünf Lampen an den Wänden: zwei im Vorraum bei der Garderobe und am Schminktisch, zwei am Bett, eine über dem Schreibtisch, und alle mit kugeligem gelbem Licht, das nicht sehr weit reichte. Und in einer Nische, hinter einem Vorhang, das Bad mit seinen rosafarbenen Kacheln, die eine kindische Alte vor Jahren mit Tierfiguren beklebt hatte.
Unter dem Bett waren allerlei Gerätschaften verstaut: Bügelbrett, Nähkästchen, Staubsauger und dergleichen. Es war Michaelis Aufgabe gewesen, sich zu bücken und heraus zu fischen, was seine Frau benötigte.
Er hatte viel Besuch aus dem Haus, doch war es ihm, als vergehe die Zeit ungeheuer langsam. Er begann, Spaziergänge zu machen. Rund um das Heim mit seinen fünf Stockwerken waren knisternde Wiesen und im Reif erstarrte Wälder, die Blätter scharrten aneinander wie Papier, und nur die bunten Stämme und die Büsche schienen echt; wenn Michaelis zurückkam, wunderte er sich, dass nur eine halbe Stunde vergangen war.
Draußen fühlte er sich frei. Sein Atem stieg die Zweige hinauf und verging im Nebel, der über dem Wald hing. Der Himmel war dicht und voller Wolken wie ein Zimmer, und unter den Wolken, schleifend über Wald und Stadt, wehte langsam der Nebel, sehr langsam, weit hinter dem Fluss zurückbleibend.
Es hätte Michaelis nichts ausgemacht, wenn alles so geblieben wäre: die verhüllten Tage, das langsame Essen, das Teetrinken am Nachmittag, die gleichgültigen Besuche, und immer eins nach dem anderen, die lange Morgendämmerung nach einer gedämpften kalten Nacht voller Geräusche im Haus; Heizungsluff, vermischt mit Zigarettenrauch, das war für ihn der Geruch des Reisens, des Unterwegsseins, das erinnerte ihn an Eisenbahnen und lange Autofahrten. Das alles war für ihn vorbei. Der Nebel war voller Vögel, Krähen und Elstern zumeist, die selbst aus den harten Wiesen noch Würmer und Larven ziehen konnten, und die im Laub wühlten, um Mäuse und Grillen zu finden oder um ein wenig an einem Igel herumzupicken.
Manchmal, wenn die Luft dicht war, zog der Geruch einer nicht ganz nahen Schweinemästerei herüber. Egizia und er hatten den Geruch von Schweineställen gemocht, weil beide als Kinder welche gekannt hatten; es war damals sehr seltsam gewesen, so etwas herauszufinden; es war ein Geheimnis. Sie hatten gern Schweine gesehen.
Auch ans Geld musste er häufig denken. Das Zimmer hatten sie sich nur leisten können, weil Egizia aus einer Stiftung einen monatlichen Betrag erhalten hatte, zusätzlich zu ihrer beider schmalen Rente, so dass nun weit mehr als die Hälfte der Summe fort war. Früher waren sie beide anspruchsvoll gewesen, zum Ausgleich sozusagen für das strenge Leben, das sie geführt hatten, und weil sie lange Zeit selten zusammen gewesen waren. Und trotz allem kein Vermögen, keine Rücklagen, nichts, was nicht schon aufgebraucht gewesen wäre, sogar, schließlich, der Stolz. Axel, sagte sich Michaelis, du brauchst Geld, du brauchst ein billiges Zimmer und musst Geld verdienen. Pflege brauchst du nicht, weil du nicht krank bist, also ein ganz gewöhnliches Zimmer. Dass er so mit sich sprach, sich selbst ansprach, war neu für ihn, und es gefiel ihm nicht.
Es war ihm, als habe diese Geschichte mit dem Quartett schon von Anfang an festgestanden, fast noch bevor seine Frau davon gesprochen hatte, ja, es war ihm, als sähe nicht nur sie, sondern auch andere ihm zu, wie er allmählich dahin fand, die Sache ins Werk zu setzen, so als könne er gar nicht anders als einen Plan auszuführen, den ein anderer, ganz weit draußen, schon vor langer Zeit für ihn gefasst habe, uns als sei das andererseits nur ein Vorwand, den er für sich selbst erfunden habe, um endgültig anzufangen.
Man musste gut sein, um mit einem Quartett Geld zu verdienen, und es war mühsam. Er konnte es versuchen, aber er brauchte außerdem eine Arbeit. Möglicherweise konnte er durchkommen, wenn er eine Stelle zu 620,-- DM annahm; ein kleineres Zimmer und ein Mittagstisch, dazu alle zwei Wochen eine Maschine Buntes in einer Wäscherei – so hatte er als Student gelebt. Vor allem ein Zimmer, in dem er würde üben können; oder einen ruhigen Ort, am besten gleich einen Saal, in dem auch die anderen Platz hätten. Ein Zimmer, so wie er es sich in Zukunft leisten konnte, war möglicherweise nicht recht präsentabel.
Nein, das Quartett war Luxus, das andere hatte Vorrang. Er hatte nichts – oder besser: das, was er hatte, wurde erst zu etwas, wenn er noch mehr dazu legen konnte. Dann, warum nicht, das Quartett – man musste die Zeit irgendwie ausfüllen. Und vielleicht war irgendwann wirklich Geld damit zu verdienen. Er würde es versuchen, am besten gleich mehrere Dinge auf einmal; das war genau das, was ihm jetzt wohltäte. Am Samstag die Tageszeitungen – das schrieb er sich auf.
Seine Rentenangelegenheiten waren in Unordnung, es widerstrebte ihm, die Mappen vorzunehmen und sich Klarheit zu verschaffen. Auch kam er sich, wenn er tat, was seine Frau sagte, immer wie ein braver Junge vor, und das widerstrebte ihm noch mehr. Bis Ende April hatte er Zeit für alles; danach wohl nur noch für Dinge, die sein mussten.
Am vierten Tag wurde seine Frau beerdigt. Es war einer der ersten Tage, an denen wärmere Luft ging, und an allen Zweigen glänzten die Knospen, aber das Gras war noch grau und verfilzt. Es kamen viele Frauen, aber kaum Herren, und keiner der Kränze verriet die Trauer um eine Sängerin. Michaelis hatte kaum Karten geschrieben. Die Anzeige in der Zeitung stammte vom Heim, Frau Dr. Dornseiff war ihm zuvorgekommen. Unter der Last der Trauernden brach eine Ecke des Grabes ein.
Er brauchte die Leute. Noch immer kam Besuch, und nun hatte jedermann Michaelis' Aufmerksamkeit.
Es war Samstagmorgen. Als Michaelis erwachte – nach einem Schlaf von der Art, nach dem man mit der Gewissheit erwacht, dass eine Entscheidung gefällt worden ist – machte sich dicht neben ihm am Fenstertisch eine Frau zu schaffen, in großen leisen Filzpantoffeln, in Schürze und Teekleid.
Er sah das Wesen zunächst nur von hinten, wie es, einer Puppe gleich, lautlos den Tisch deckte und dabei leise summte und sich wiegte. Die Blumen auf dem Tisch verbreiteten ihren Duft. Hinter der Zimmertür hörte er ein Scharren, als ständen dort kleine Wesen und tuschelten. Es duftete nach Kaffee, Speck und Eiern, und obwohl Michaelis, was ihm sehr peinlich war und ihm sehr gewöhnlich vorkam, das Wasser im Mund zusammenlief, stellte er sich schlafend, bis das auftoupierte Wesen, nachdem es wohl eine Viertelstunde im Zimmer gestanden und versonnen auf ihn heruntergestarrt hatte, fortgeschlichen war.
Er wollte sich eben leise erheben, als sich die Türklinke krachend bewegte und jemand anderer eintrat, stumm, hager und entschlossen. Es war Margret Eyß, die entschiedenste Freundin seiner Frau. Sie ließ einen Blick durch den Raum gleiten und ging dann mit mürrischer Miene zum Tisch. Als sie sich darüberbeugte und den Deckel von der Kaffeekanne hob, öffnete Michaelis die Augen. Margret sah vorwurfsvoll auf ihn herab, aber nur eine Sekunde, dann schmolz ihr Blick, und ihre Hand wanderte vom Tisch herauf an ihre Brust und spielte an ihrer Brosche.
Auch sie war für die frühe Stunde sehr sorgfältig gekleidet.
„Guten Morgen“ sagte sie.
Michaelis nickte und zeigte mit einem Finger unter der Decke hervor auf den Tisch. „Was ist das?“
„Ein Frühstück, so scheint es“, antwortete Margret kühl.
„Oh“, seufzte Michaelis, „Sie machen sich zu viele Gedanken um mich.“
Sie schwankte einen Moment und sagte dann: „Sie müssen vor allem wieder zu Kräften kommen.“
„Danke.“
Sie lächelte, halb einer Krankenschwester gleich, und ging zögernd aus dem Raum.
Etwas aber war im Zimmer geblieben. Michaelis, der in den kalten rauchigen Morgen hinaussah, hörte ein Scharren und Schnauben, und dann berührte etwas seine Hand. Es war der Hund Admiral, der schwarze Spaniel. Die ganze Zeit, die letzten Tage hatte Michaelis nicht ein einziges Mal an ihn gedacht; und das war nicht recht gewesen.
Auch der Hund war alt, er war schon alt gewesen, als sie ihn von einer Freundin geerbt hatten, und nun war er reichlich steif und sein Fell hatte viele weiße Fäden. Er war verwirrt und ängstlich und hechelte ein bißchen, während er, von einer Pfote auf die andere tappend, vor dem Bett saß und Michaelis mit blanken Augen ansah.
Er war Michaelis' Hund. Jeder hatte angenommen, Admiral sei der Hund seiner Frau, und Margret Eyß hatte ihn wohl bei sich gehabt – sie, die Hunde nicht ausstehen konnte – weil sie dasselbe dachte; aber er und Admiral wussten es besser.
Und doch hatte Michaelis ihn ganz vergessen. Er hielt die Hand aus dem Bett, und der Hund schmiegte seine Schnauze hinein. Seine Nase war trocken. Er schnaubte, und seine Lefzen blähten sich auf. Die Augen, braun und kalt, wanderten hin und her, und die Brauen wanderten mit. Sooft Michaelis sich bewegte zuckten die Ohren des Hundes.
„Mein Guter“, sagte Michaelis, „mein Feiner.“
Und er streichelte ihn, der leise zitterte. Die Schwanzspitze – denn man hatte Admiral nicht kupieren lassen – schlug kaum merklich hin und her. Sein Fell war staubig. In einem Sonnenstrahl, der von irgendeinem Fenster hier herein und durch einen Glastopf steil herabfiel, sah man, dass die Decke eigentlich tiefdunkles Braun war, kein Schwarz, und nun hing Staub darin, und die Krallen waren lang geworden.
Michaelis klopfte Admiral leicht auf den Rücken und auf die Seiten, wo er immer hohl klang, immer etwas unheimlich leer. Michaelis stand auf, wie immer zum Schlafen in Pyjama, Schal und Mantel gehüllt, und der Hund schnüffelte an seinen Beinen.