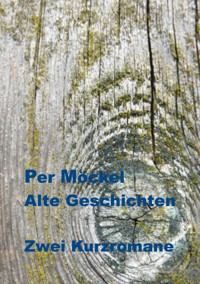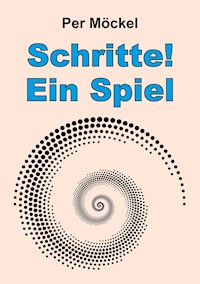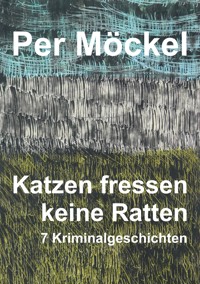
4,99 €
Mehr erfahren.
Dieser Band enthält Sieben Kriminalgeschichten Die Geschichten spielen meist im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich, im Zweiten Weltkrieg, aber auch in der Gegenwart. Solange Krieg und Frieden dauert – die Geschichte eines Mannes, der den Verursacher eines Unfalls, nach dem seine Frau ins Koma gefallen ist, aufspürt, um ihn zu töten. Augen eines Esels – ein junger Tierarzt wird nach und nach in die Machenschaften von Kriminellen hineingezogen, bis er keinen Ausweg mehr weiß. Ihre Spuren – eine Schülerliebe, bei der das Mädchen plötzlich verschwindet, lässt den jugendlichen Liebhaber die Verschwundene suchen und finden; was er jedoch findet, ist anders als alles, was er sich vorgestellt hat. Nachttresor – ein Detektiv soll ein entführtes junges Mädchen suchen und durchstreift dabei den ganzen Dinkelberg, bis er auf ein schreckliches Geheimnis stößt. Post-Produktion – ein ehemals erfolgreicher deutscher Schlagerstar, nun in Amerika ansässig, wird Zeuge eines Verbrechens und beschließt, Nachforschungen über Opfer und Täter anzustellen, die ihn weiter führen als er es geplant hat. Zertrennliche Freunde – zwei junge Männer, die zusammen aufgewachsen sind, beginnen gemeinsam eine kriminelle Karriere, solange, bis die Polizei einen der beiden zwingt, für sie zu arbeiten, und bis der Freund herausbekommt, welches Spiel tatsächlich gespielt wird. Katzen fressen keine Ratten – Kindheit im Lyon des Zweiten Weltkriegs. Eine kriminelle Familie, die durch die Bedrohung von allen Seiten zu einer radikalen Machtdemonstration gebracht wird – und ein Leben unter falschem Namen, das jahrzehntelang dauert. Mit einem Vorwort
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Per Möckel
Katzen fressen keine Ratten
Sieben Kriminalgeschichten
vom selben Autor ist bereits erschienen:
Schritte! (ISBN 978-3347452534)
Schönau, Schlechtnau, Todtnau. Unheimliche Geschichten (ISBN 978-3347953550)
Alte Geschichten. Zwei Kurzromane (ISBN 78-3384322371)
© 2024 Per Möckel, Wiesentalstr. 4, 79694 Utzenfeld
Titelbild: Per Möckel
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Softcover
978-3-384-40463-3
Hardcover
978-3-384-40464-0
E-Book
978-3-384-40465-7
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Solange Krieg und Frieden dauert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Augen eines Esels
1
2
3
4
5
6
7
Ihre Spuren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nachttresor
1
2
3
Post-Produktion
1 Hinter den Kulissen
2 Vor den Kulissen
3 In der Tiefe
4 Personalien
5 Eine Seele voller guter Absichten
6 Augen in den Büschen
7 Der Park
Zertrennliche Freunde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Katzen fressen keine Ratten
Katzen fressen keine Ratten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Katzen fressen keine Ratten
Katzen fressen keine Ratten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Vorwort
Die sieben in diesem Band versammelten Geschichten haben alle einen wahren Kern; zwar gehen sie nicht alle auf sämtliche geschilderten Ereignisse zurück, aber ihre Grundzüge sind mir alle von Bekannten erzählt worden oder ich habe sie selbst erlebt. Dennoch sind sie alle dem Genre der Kriminalgeschichte zuzurechnen.
Die erste Erzählung Solange Krieg und Frieden dauert ist ein Bericht über die Situation eines Mannes, dessen Frau seit langem in der Uniklinik Freiburg im Koma liegt. Er hat nach einiger Zeit einen neuen Alltag gefunden und liest nun seiner Frau den im Titel genannten langen Roman vor; es gelingt ihm, darin eine Art Glück zu empfinden. Wenn er damit fertig sein wird, hat er sich vorgenommen, den Verursacher dieses Zustandes zu finden und zu töten. Aber über diesen Zeitpunkt hinaus vermag sein Verstand nicht zu dringen. Mit Zähigkeit gelingt es ihm offenbar, nach langer Zeit mehr Erfolg bei seiner Suche zu haben als die Polizei, die sich nach und nach auch wieder anderen Fällen zuwenden muss, was der Ehemann der Komapatientin nicht tun kann. Und was würde sie Patientin selbst über ihre Lage denken? Heißt Fortschreiten also auf den Tod zuschreiten?
Die zweite Erzählung Augen eines Esels berichtet von einem jungen Tierarzt, der, zu Hause und glücklich in seiner Arbeit auf einem Gestüt, vom Vater eines Pferdebesitzers Schritt für Schritt, nachdem man seinen kleinen Finger genommen hat, in Machenschaften und Verbrechen hineingezogen wird, bis er keinen Ausweg mehr aus der Situation sieht als einen radikalen Schritt.
Auf diese Geschichte folgt Ihre Spuren, die eine Erinnerung an eine Schülerliebe in Schopfheim darstellt und später die Auswirkungen des damals neuen Instruments des Zeugenschutzprogramms vorführt. In einer verwirrenden Situation zur Zeit der sowjetischen Besetzung Afghanistans, die ungeahnte Auswirkungen auf Deutschland hat, spielt die Liebe zweier Schüler auf einmal eine Rolle, die nicht zu ahnen war, und die Schüler selber verändern sich auf unheimliche Weise.
Die Erzählung Nachttresor führt vor, was geschehen kann, wenn die Abneigung und die Konkurrenz zwischen zwei Schwestern dazu führt, dass die eine der anderen alles ersetzen soll, um was sie die Schwester betrogen zu haben scheint. Der Dinkelberg und seine Natur nach den verheerenden Sturm Lothar spielen hierbei eine wichtige Rolle wie eine weitere handelnde Person.
Post-Produktion geht zurück auf den Bericht eines Bekannten, der als Junge und junger Mann einige Erfolge im deutschen Showgeschäft hatte, dann aber allmählich aus der öffentlichen Aufmerksamkeit herausgeraten ist. Aber auch danach muss man ja leben, und so ist der Held dieser Geschichte dem Ruf nach Amerika gefolgt. Hier wird er Zeuge eines Verbrechens und der nachfolgenden Vertuschungsversuche und beschließt, aus den wenigen Fakten, die ihm bekannt geworden sind, das beste zu machen und Opfer und Täter zu identifizieren und, wenn möglich, der Gerechtigkeit zuzuführen. Hierbei merkt er, dass er im Getriebe seiner Umgebung offenbar niemandem trauen kann …
Zertrennliche Freunde schildert die Verbindung zweier junger Männer aus Karlsruhe, so wie sie mir einer der beiden geschildert hat, als sie schon weit in die Vergangenheit gerückt war. Die Vorgänge spielen innerhalb einer kurzen Stunde in der Nacht, als die Freundschaft an ihr Ende kommt, wobei sich zeigt, woraus sie in ihrer Tiefe wirklich bestanden hat.
Die letzte und titelgebende Erzählung Katzen fressen keine Ratten beruht auf dem Bericht eines Zeitzeugen, den ich in einem Altenheim in Freiburg getroffen habe. Es hatte den alten Mann viel Zeit gekostet, um die so tief in ihm verborgene Geschichte zu erzählen, da er sich vorgenommen hatte, sie nie, nie zu berichten. Da aber nun der letzte lebende Zeuge der Vorgänge gestorben war, fühlte er sich nach Jahrzehnten befreit von dem Zwang zu schweigen und entschloss sich, sein Herz zu öffnen. Sein Bericht schildert die Stadt Lyon und ihre Bewohner während des Zweiten Weltkriegs und zeigt vor allem, dass und wie sich Kinder in einer Situation der Besetzung und des Herannahens der Fronten verändern, während die Erwachsenen sich selbst in furchtbare Zwänge hineinmanövrieren, eine Situation, die gerade auch uns Zeitgenossen zum Beispiel aus einer Stadt wie Kiew bekannt sein könnte.
Ich hoffe, dass diese Geschichten Ihr Interesse finden und bin sicher, dass auch Sie in Ihrer Erinnerung viele Geschichten haben, an die Sie sich möglicherweise gar nicht mehr erinnern, die aber Sie selbst und Ihre Zeit und auch zurückliegende Zeiten, die Sie erlebt haben, sehr anschaulich machen könnten, wenn sie erzählt würden. Ich habe mich immer für Geschichten interessiert und freue mich darauf, auch in Zukunft welche zu hören.
Ich wünsche viele anregende Stunden beim Lesen!
Per Möckel
Solange Krieg und Frieden dauert
1
„Glaube ich auch“, antwortete ich, „vielen Dank, dass Sie es mir gesagt haben.“ Und ich erhob mich umständlich und ging ins Patientenzimmer zurück. Ich blieb dort einige Stunden und las weiter aus dem dicken Buch, während meine Frau, von den Maschinen in Betrieb gehalten wie eine weitere komplizierte Vorrichtung, atmete und schlief. Mittlerweile, das hatte mir der Arzt eben gesagt, mussten die Funktionen mehrerer Organe durch Apparate aufrechterhalten werden; zwar hielt sich meine Frau noch, aber in den letzten Wochen hatte sie stark abgebaut.
Niemand kann sagen, aus welchem Grund sich manche Körperfunktionen lange erhalten oder warum andere nach kurzer Zeit ausfallen. Ein Körper im Koma ist wie ein Lastensegler. Er überfliegt Berge und Hänge, wird von der Thermik hinaufgetragen oder gleitet langsam hinab, um dann wieder aufzusteigen, ohne Antrieb, dem Spiel der Luftströmungen ausgesetzt, die ihn weiterund weitertragen. In diesem Zustand war meine Frau schon seit mehr als zwei Jahren, und eine Menge Personal hatte sich mir gegenüber schon anerkennend geäußert, welche Lebenskraft meine Frau doch zeige, ohne zugleich die Fähigkeit zu entwickeln, diesen Zustand der tiefen Bewusstlosigkeit zu verlassen und ins Leben zurückzukehren.
Frau Meister, die ihren Mann ebenfalls seit Jahren besuchte, hatte mir erklärt, sie fürchte das Erwachen ihres Mannes, denn sie wisse nicht, als welche Person er wieder zurückkommen werde. Die Familie ihres Mannes habe sie näher kennengelernt, und wo ihr Mann freundlich und warmherzig gewesen sei, da seien seine Eltern kalt und schroff gewesen, und sie habe immer gefürchtet, eines Tages werde er genauso sein, so wie es bei seiner älteren Schwester geworden sei.
Stumm verbrachte Frau Meister die Stunden am Bett ihres Mannes, während ich, nachdem ich wochenlang geweint und gejammert hatte, nun schon seit langem meiner Frau vorlas. Als wir jung gewesen waren, hatten wir, die wir beide Bücher liebten, uns vorgenommen, dicke Romane zu lesen, für die wir uns beide zuvor nicht reif gefühlt hatten, wie etwa Stifters Nachsommer oder Witiko oder David Copperfield, von denen man immer nur glaubt, man wisse schon, worum es gehe, und die einen dann immer wieder aufs tiefste überraschen.
Eines Tages hatte ich etwas gelesen über das alte indische Epos der Bhagavadgita, ihren Inhalt und ihre Form, und hatte beschlossen, mich von nun an nicht mehr mit Sekundärliteratur zufriedenzugeben, sondern die Quellen selbst zu studieren, und mir selbst versprochen, sie meiner Frau vorzulesen, denn wir interessierten uns beide für Epen.
Die Gita, wie sie auch genannt wird, ist nur ein Ausschnitt eines viel längeren Epos, des Mahabharata, dem sie offenbar später hinzugefügt worden ist und das hunderttausend Doppelverse lang sein soll und den Kampf zweier königlicher Familien, der Kaunas und der Pandavas, in der Schlacht von Kurukshetra darstellt. Ich habe Abschnitte des langen Epos gelesen, aber das ganze nicht geschafft.
Die Gita stellt also nur einen Ausschnitt des Geschehens dar, genaugenommen nur einen Augenblick, als nämlich Arjuna, Königssohn und Bogenschütze, der erste der Pandavas, Zweifel am Krieg und an seiner Aufgabe als Kämpfer im Krieg bekommt und vom Gott Krishna, der sein Wagenlenker ist, über beides belehrt wird.
Es ist also nur ein Augenblick, denn um beide herum tobt die Schlacht, aber es ist ein langer Augenblick, so lang wie nur im Epos ein Augenblick lang sein kann, und die Begegnung bringt zwei Figuren zusammen, die beide ihre ganze Geschichte und die Geschichte ihrer Häuser mit sich tragen, so wie es auch im ganz gewöhnlichen Leben bei der Begegnung zweier Liebender geschieht. Das bringen sie alles mit, und deshalb muss es auch alles erzählt werden, so wie in der Ilias auch oft zwei Helden in der Schlacht einander begegnen und dann auch immer alles erzählt werden muss, was zu den Figuren gehört, unbekümmert darum, dass um sie herum der Kampf weitergeht; und ebenso ringt der Bogenschütze Arjuna mit der Frage, ob es besser sei, zu kämpfen oder sich zu enthalten, zu töten oder nicht zu töten, überhaupt zu handeln oder nicht zu handeln, und der Gott sagt ihm bei all diesen Fragen immer, dass zwar das eine gut sei und das andere auch, nur sei eines von beiden immer das Schwerere, und Arjuna, als Königssohn, wählt dann immer das Schwerere. Das liegt in seiner Natur.
Diese Geschichte hatte ich meiner Frau vorgelesen und dafür einige Wochen gebraucht. Nun hatte ich, schon vor einiger Zeit, angefangen, ihr Tolstojs Krieg und Frieden vor- zulesen und hatte dabei sorgfältig auf die Übersetzung geachtet, die ich vorlesen wollte. Ich wählte eine Ausgabe, bei der die französische Konversation nicht übersetzt wurde, denn meine Frau und ich liebten Französisch und würden damit keine Mühe haben. So kam ich auf die Übersetzung von Marianne Kegel aus dem Jahre 1926. Jeden Nachmittag las ich daraus weiter vor, jeweils meist ein Kapitel, also etwa sechs Seiten.
Damals, wie gesagt, lag meine Frau schon zwei Jahre bewusstlos, und während der ganzen Zeit arbeitete ein Teil meiner Fantasie daran, mir das Geschehen zu verdeutlichen und es zu verstehen.
Meine Frau war von einem Auto angefahren und auf die Straße geschleudert worden. Zwei Jahre zuvor im April war das geschehen. Seit dem Aufprall hatte sie im Koma gelegen, ohne Bewusstsein, der Unfallfahrer aber hatte sich entfernt, was leicht für ihn war, denn es war dunkel gewesen und die Straße lag abseits. Die Polizei hatte ihn nicht auffinden können.
Tag für Tag hatte ich gehofft, meine Frau würde irgendwann erwachen und ihr altes Leben wieder aufnehmen, bis mir die Ärzte klargemacht hatten, dass das nicht geschehen würde. Vielmehr habe meine Frau nach und nach eine neue Lebensform gefunden und würde, sollte sie doch wieder erwachen, ganz anders leben und vielleicht, ja sogar wahrscheinlich, eine ganz andere Person sein als zuvor. Ich tat mich schwer damit, das zu akzeptieren, und versuchte, gerade auch durch die Lektüre, unser bisheriges Leben irgendwie fortzuführen. Ich wusste, dass sie es sich vorgenommen hatte, irgendwann Krieg und Frieden zu lesen, und beschloss, dass nun der geeignete Zeitpunkt gekommen sei.
Täglich las ich also Abschnitte von fünf bis sechs Seiten und arbeitete mich weiter vor. Die ganze Zeit aber grübelte ich, in einer Ecke meines Gehirns, auf der rechten Seite am Hinterkopf, daran, den Unfallfahrer doch noch aufzuspüren. Und wenn ich ihn gefunden hätte, würde ich ihn töten.
2
Man sollte glauben, dass ich nun irgendwann, nachdem ich mich in die neue Form des Alltags hineingefunden hätte, auch würde gelernt haben, dieses neue Leben zu akzeptieren, aber das Gegenteil war der Fall.
Mehrmals versuchte ich nachzurechnen, was diese Komaversorgung im Bett der Uniklinik am Tag kostete, und rechnete für das Bett allein täglich fünfzehnhundert Euro, für die Maschinen und die Medikamente noch einmal fünfzehnhundert Euro, für die die Organtätigkeit ersetzenden Apparate ebenfalls fünfzehnhundert Euro, und noch einmal dasselbe für die Schwestern, Pfleger und Ärzte, sodass ich pro Tag auf sechstausend Euro kam oder, pro Jahr, auf über zwei Millionen Euro, und das erschien mir eine so hohe Summe, dass sie meinen Horizont überstieg. Eine so kostspielige Lebensform, schien mir, würde meine Frau niemals gewählt haben, und es würde weder ihr noch mir noch unseren Familien gelingen, solche teuren Tage mit Leben zu füllen.
Das Kennzeichen aller anderen Formen, sein Leben zu führen, war, dass man fähig war, seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder dabei unterstützt wurde. Hätte es sich um eine Form gehandelt, die etwa aus einem Schweben in der Unentschiedenheit oder im Schweigen bestanden hätte, einfach aus dem Nicht-Eingreifen oder Sich-Heraushalten aus allem, wie man sich eben ein Koma vorstellt, dann hätte ich es in dieser Form annehmen können, so aber, indem Leben lediglich bedeutete, immense Kosten zu verursachen und ungeheure Mengen an Material und Menschen zu binden, die anderswo ebenso hätten verwendet werden können, um krankhafte Zustände und Defekte tatsächlich zu bessern und in neue Selbständigkeit zu überführen, schien es mir geradezu obszön, und ich wusste, dass meine Frau diesen ihren Zustand nicht als eine den anderen gleichwertige Lebensform oder als weiteren Lebenszustand neben den üblichen Aggregatzuständen anerkannt hätte; sie hätte sich selbst gesehen als gieriges und gefräßiges Ungeheuer, das ohne zu zögern vielen anderen wegnahm, was diese zum Leben benötigt hätten. An die Versicherung, an anonyme Geldsummen, an ein Vermögen, das niemandem gehörte und niemandem zustand, dachte ich nicht und glaubte ich auch nicht, sondern ich sah nur, dass es anderen weggenommen würde. Das machte mich besonders wütend und bestärkte mich in meinem Entschluss.
Zunächst hatte mich die Polizei noch ausführlich informiert, denn noch hatte sie nach dem Fahrer eines Wagens gesucht, der mit einer gewissen Routine diese Straße zu dieser Uhrzeit befuhr, zum Beispiel als Schichtarbeiter, und also auch später dort wieder anzutreffen sein würde.
Dann gingen sie davon aus, dass der Zusammenprall Spuren am Fahrzeug hinterlassen haben müsse, Kratzer, Dellen, Schrammen, die in einer Werkstatt ausgebessert werden müssten und vielleicht, zur Erklärung, für Spuren eines Wildunfalls ausgegeben werden konnten und so möglicherweise zunächst niemandem besonders aufgefallen waren.
Dann aber, als weder ein regelmäßiger Fahrer noch beschädigte Fahrzeuge aufzufiinden waren, hörte die Polizei allmählich auf, mich zu informieren, und ein Bekannter sagte mir später, es sei auch möglich, dass das Unfallfahrzeug mit leichten Schäden schon ins Ausland weiterverkauft und nicht mehr greifbar sei.
Dann, so schloss ich, lebte also der Unfallverursacher sein Leben weiter, mit dieser schrecklichen Schuld darin, und das musste einfach Auswirkungen auf sein Leben haben.
Er lebte schlicht weiter, als sei nichts geschehen, und in diesem Fall würde es sehr schwer sein, ihn zu finden. Jedoch konnte es auch sein, und das schien mir viel eher möglich, dass er, um mit dieser Last in seinem Leben fertigzuwerden, er seinen Alltag anpassen würde, also Gewohnheiten ablegen, die ihm nun unpassend erschienen, oder neue Gewohnheiten annehmen, die ihm zu fehlen schienen.
Zum Beispiel würde er also entweder aufhören zu trinken oder damit beginnen, er würde sich mit seiner Frau oder seinen Kindern versöhnen oder sich mit ihnen entzweien, Karriere machen oder seinen Beruf verlassen. Auf keinen Fall würde er, das wünschte ich mir, alles beim alten lassen, denn das wäre eine so große Herzenskälte, Roheit und Leere, dass er schon um ihretwillen den Tod verdient hätte. So erwartete ich und suchte nach einem Menschen, der in der zurückliegenden Zeit sein Leben, oder einen Teil davon, grundlegend geändert hätte, und den würde ich dann ermorden.
Wie ein Mord allerdings kam mir das, was ich vorhatte, zunächst nicht vor, sondern wie ein Opfer, und ich sah diesen Menschen als ein Opfertier, ein Rind oder einen Widder, und den geänderten Teil seines Lebens wie einen Schmuck des Opfertiers, als Kranz oder Band, das ihn eben als Opfertier kennzeichnete und nicht zuließ, ihn anders zu behandeln. Wütend war ich natürlich auch, aber mich selbst sah ich nicht als wutschnaubenden Rächer, sondern als den Hersteller eines ausgleichenden gerechten Zustandes, und meine grüne Schutzkleidung auf der Intensivstation erschien mir wie die Lederschürze eines Opferers und mein Buch wie ein Beil.
Natürlich war das alles Täuschung, Teil einer Selbstansicht, die mich von vornherein von aller Schuld freisprechen sollte, aber an die Zeit danach dachte ich überhaupt nicht. Meine Frau würde gestorben sein und ich würde den Mörder getötet haben, was aber danach kam und was mit mir geschehen würde, kümmerte mich überhaupt nicht.
Ohnehin bin ich der Ansicht, dass selbst die schlimmsten und grausamsten Täter in ihren eigenen Augen nur immer die Welt besser gemacht und größere Ordnung hineingebracht haben, sodass sie, die Welt, ihnen eigentlich dankbar sein müsste.
Nun, nach zwei Jahren, beschäftigte sich nur noch ein Mensch bei der Polizei mit dem Fall, ein Herr Pergmann, der gewiss jedesmal, wenn er sich vorstellte, das P in seinem Namen besonders hervorheben musste. Er schilderte mir, wie die Polizei zur Stunde des Unfalls alle Durchkommenden auf der Straße angehalten und befragt hatte, er erkundigte sich nach dem Zustand meiner Frau und wünschte mir Glück. Alle gewöhnlich in Frage kommenden Personen habe man ausgeschlossen.
Über die Familie und die Bekanntschaften meiner Frau hatten sie mich schon eingehend befragt, ebenso alle genannten Personen, sie hatten meine eigenen Bewegungen nachgezeichnet, und ich konnte niemanden angeben, Verwandten oder Bekannten, der sein Benehmen mir gegenüber in der zurückliegenden Zeit verändert hätte. Auch schienen die Besucher am Krankenbett meiner Frau, so wenige es waren, nicht ungewöhnlich.
Es gibt, glaube ich, keinen Platz auf der Welt, der so einsam und still ist wie der Platz am Bett eines Kranken. Mein Platz war so still, dass ich von draußen die Baumaschinen im Hof der Klinik, weiter entfernt die Straßenbahn, den Autoverkehr und die Schritte der Frauen mit ihren neuen Frühlingsschuhen hören konnte. Stimmen, Gemurmel war auf den Gängen, Rascheln und Klirren der Tabletts, das Seufzen, Klicken und Arbeiten der Maschinen, und hätte ich in die Körper hineinhören können, hätte die Tätigkeit der Organe wohl ebenso geklungen.
Die Stille war wie ein Vorhang, wie eine Wand, wie ein angefüllter Raum, in den von außen alle Klänge einfielen und der selbst nach allen Seiten Klänge aussandte. Und die Zeit verging langsam, bis zum Stillstand langsam, weil stets die Hoffnung an ihr hing wie ein Uhrgewicht, der nächste Zug eingepresster Luft in der bewusstlosen Lunge möchte der erste des Erwachens oder der letzte des Sterbens sein. Ein Vergehen oder ein Näherkommen gab es nicht, sondern nur ein unbewegliches Jetzt, sodass ich, wenn ich dann doch das Buch niederlegte und ging, niemals sagte: nun bin ich so und so lange bei meiner Frau gewesen, sondern immer nur empfand, dass ich mich niedergelassen und mich erhoben hatte, so als sei Zeit inzwischen gar nicht vergangen, so wie man sich nie an eine durchschlafene Nacht erinnert.
In ihrer Jugend hatte meine Frau zwei oder drei Verehrer gehabt, aber keinen, der noch bis in die letzte Zeit an ihr gehangen hätte oder vielleicht mit seinem schließlich selbstgewähltem Leben unzufrieden gewesen wäre. Unzufrieden waren trotzdem alle mit ihrem Leben, das empfand ich jetzt, aber alle diese Personen hatten sich am entsprechenden Abend an anderen Orten aufgehalten.
Bei manchen hatte es einges Aufwands bedurft, um festzustellen, wo sie gewesen waren, weil sie selbst sich nicht erinnern konnten oder sogar, wie Leute manchmal sind, Freude daran hatten, andere zu schwierigen Nachforschungen zu veranlassen: endlich jedoch war es bei allen geklärt worden.
So musste ich, nach einiger Zeit, annehmen, dass ein Fremder der Schuldige und der Unfall zufällig und unbeabsichtigt geschehen sei. Was allerdings danach gekommen war, das Sichverstecken und Verborgenhalten, das Nichthervortreten, war nicht zufällig, sondern beabsichtigt, und rechtfertigte, so weit es mich betraf, den Tod des Fahrers. Diesen Tod stellte ich mir dann und wann vor.
Während meiner Zeit in der Armee hatte man uns Richtschützen der Infanterie verschiedene Methoden gezeigt, wie jemand im Nahkampf getötet werden konnte, darunter ein Schlag in die Nieren mit dem Klappspaten, den jeder Infanterist mit sich führte, und später hatte ich gelesen, wie leicht jemand zu Tode kam, wenn durch einen Schlag oder einen Griff sein Kehlkopf beschädigt wurde.
Auf andere Weise war es ziemlich schwierig, jemanden ums Leben zu bringen, oftmals Glückssache, deshalb konzentrierte ich mich darauf, den Gegner, wenn ich seiner einst habhaft werden würde, mit einem Schlag gegen die Kehle zu töten, also mit so wenig Aufwand wie möglich. Danach würde ich mich der Polizei stellen, denn sonst hätte die Geschichte kein Ende.
Da meine Frau zu diesem Zeitpunkt schon tot wäre, würde ich niemanden hinterlassen, der darunter zu leiden hätte, und niemanden, an dem sich jemand anderer hätte rächen können. Was dann mit mir geschehen würde, war mir gleichgültig. Auch zweifelte ich nicht daran, dass ich diesen Menschen ausfindig machen würde, wie lange es auch dauern mochte.
Jedoch rechnete ich auch mit der Möglichkeit, dass das nicht geschehen würde, etwa wenn der Verursacher nur ganz zufällig des Weges gekommen wäre und dem Vorkommnis, das er möglicherweise gar nicht bemerkt hatte, keine Bedeutung zugemessen hätte, sodass Schuldgefühle bei ihm gar nicht aufgekommen wären. Das wäre dann so gewesen als sei das alles im Grunde gar nicht geschehen, ohne Ursachen und ohne Folgen. Dann freilich würde meine Suche im Nichts verlaufen.
3
Soweit also hatte ich mich im Geiste vorbereitet, während mein eingeschränktes Leben mit Besuchen, Vorlesen und den sonstigen häuslichen Verrichtungen weiterlief.
Ganz am Rande meines Bewusstseins, eher aber wie mit einer Art von statistischer Wahrscheinlichkeit, rechnete ich auch damit, dass mein eigenes Leben sich, von außen angestoßen, von Grund auf ändern könnte, etwa indem ich mich frisch verliebte und meine Frau allmählich in der Vergangenheit zurücklassen würde oder aus anderen Gründen zum Beispiel gezwungen wäre, die Region oder gar das Land zu verlassen.
Denn es konnte zum Beispiel auch ein Krieg ausbrechen oder ich konnte einem Unglück zum Opfer fallen. Alle Überlegungen dieser Art bewegten sich aber nur wie in großer Entfernung um mich her wie am Horizont meines Bewusstseins.
Nein, ich konzentrierte mich eigentlich nur auf drei Dinge: mein Vorhaben forrtzuführen, die Suche nach dem Schuldigen und die Art, wie er zu töten wäre. Angst hatte ich dabei, jemanden vorschnell zu identifizieren und hinzurichten, der sich später doch als unschuldig erweisen würde. Das erschien mir als der schlimmste aller möglichen Irrtümer, und deshalb wollte ich diesen Fall unbedingt vermeiden.
Klar und ohne jeden Zweifel musste ich mir selbst bewiesen haben, dass dieser bestimmte Mensch der Schuldige sei, anders würde ich ihn nicht berühren können, sondern selbst in seine Situation geraten. Ganz von fern schloss ich auch nicht die Möglichkeit aus, dass dieser Mensch selbst schon auf der Suche nach mir wäre, um seine Tat irgendwie wieder auszugleichen und gutzumachen, ohne sich dem Gesetz zu überantworten. Auch so etwas hielt ich für möglich und achtete deshalb sehr darauf, wer meine Bekanntschaft suchte.
Weiter stellte sich natürlich auch die Frage, wie ich jemanden würde töten können, wenn ich gerade eben den Roman Krieg und Frieden meiner Frau bis zu Ende vorgelesen hätte, ob diese zwei Dinge wohl zusammenstimmen könnten oder ob sich da nicht ein tiefer Missklang ergeben würde. Doch ich sagte mir selbst, dass sich diese Frage in der Situation selber lösen würde. Ich war bereit, Schuld auf mich zu nehmen und zu verantworten, aber ich war nicht bereit, zu vergessen oder etwas in der Fülle des Geschehens untersinken zu lassen.
So hatten wir schon zwei Jahre gelebt, und in dieser Zeit hatte es dann und wann Ereignisse gegeben, die so ausgesehen hatten als würden sie Folgen haben: ab und zu, in sehr großen Abständen, hatte meine Frau einen Finger oder ein Auge bewegt, was ich in der ersten Zeit immer für ein Zeichen des bevorstehenden Erwachens genommen hatte, das aber nie gefolgt war.
Der Arzt hatte dazu jeweils gesagt, wir könnten gar nicht wissen, was ein Komapatient wahrnehme oder fühle, und ich selbst hatte mir vorgestellt, ein Bewusstsein im Koma bewege sich durchaus, tauche auf und ab, nähere sich dem Traum und dem Wachsein und sei so auf einer Art Kurs wie ein Fahrzeug tief unter dem Meer, in seiner eigenen Sphäre, ohne jedoch mit anderen kommunizieren zu können, was doch das Entscheidende an allen anderen Bewusstseinszuständen ausmache.
Jetzt, wo ich all das als etwas Zurückliegendes berichte, frage ich mich, ob nicht meine Frau mit einer besonderen Form der Aufmerksamkeit diese meine Überlegungen aus meiner Stimme herausgehört hatte. Freilich hatte sie, wenn das der Fall war, sich nicht bemerkbar gemacht oder gar ein Gespräch darüber mit mir angefangen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wie ein Gespräch darüber, ob man ihretwegen einen Menschen töten solle, hätte aussehen können.
Sicher war ich nur insofern als ich selbst am Ende dieser Überlegung, wie Suche und Handlung dann selbst unmöglich geworden sein und mein Leben beendet haben würde, denn mit der Schuld, einen Menschen nach Plan getötet zu haben, würde ich nicht weiterleben können. Meine Frau würde also tot sein, ihr Mörder auch, ebenso ich selbst, und die ganze Geschichte wäre dann zugleich geschehen und auch nicht geschehen, denn alle Beteiligten würden aufgehört haben zu existieren.
Insofern sah ich es als ein Glück an, keine Kinder zu haben, die danach hätten weiterleben müssen, denn dann hätte sich das alles doch auf bestimmte Weise fortgesetzt. Bei alldem hätte ich doch immer gern ein Kind gehabt, denn der Gedanke, dass mit mir, ausgerechnet mit mir, alles zu Ende sein und mein Name erlöschen würde, war mir immer furchtbar gewesen. Und vielleicht würde es mir sogar unmöglich sein, den Fahrer zu finden, da doch die Polizei mit ihrem ganzen Apparat es nicht vermocht hatte.
Über all das hinaus leitete mich jedoch auch der Gedanke, meiner Frau mit meinem Vorlesen einen Genuss zu bereiten und sie in Kontakt mit dem gewöhnlichen Leben zu halten. Zum Beispiel war ich vor Monaten, noch ziemlich am Anfang, zu der Szene gekommen, wo Pierre das Haus seines sterbenden Vaters betritt und es fraglich ist, ob er wie schon immer als der uneheliche Sohn gelten oder, nach einer schriftlichen Bitte seines Vaters an den Kaiser, als legitimer Sohn und damit als Erbe seines Vermögens betrachtet werden soll. Zwei Figuren beschließen, dieses Schriftstück aus dem Mosaik-Portefeuille verschwinden zu lassen und geraten so in Streit, dass das Dokument schließlich doch seinen Weg machen kann. Pierres Vater, der alte Fürst Besuchow, hat schon sechs Schlaganfälle gehabt und ist entsprechend geschwächt, bis er endlich an einem weiteren Anfall stirbt.
Ich war im Zweifel gewesen, ob meiner Frau diese Schlaganfallgeschichte in ihrem Zustand zuzumuten sei, hatte sie aber dann doch vorgelesen, weil dadurch die Geschichte Pierres erst beginnen konnte und weil sie nun einmal dazugehörte, ganz ähnlich wie auch Pierre selber in der Erzählung ein halbes Dutzend Mal den Eindruck hat, das, was er tue oder was mit ihm geschehe, ereigne sich, „weil es eben so sein müsse“. Diese Passivität, die auch später noch dann und wann erwähnt wird, schien mir stets überaus realistisch, ebenso wie das Vorgehen der Ärzte bei meiner Frau, ihre Maßnahmen und Verrichtungen, eben so sein müsste und es keine andere Möglichkeit gebe.
Langsam, kapitelweise, arbeitete ich mich vor und las besonders gern die Vorgänge bei der Armee, die Szenen der Schlacht von Austerlitz zum Beispiel. Aus meiner eigenen Zeit bei der Bundeswehr hatte ich meiner Frau einige Geschichten erzählt und dabei vieles erwähnt, was auf Truppenübungsplätzen vorgekommen war und was mich bei der Lektüre des langen Romans daran erinnerte.
Zum Beispiel hatte ich selbst die Beobachtung gemacht, dass das Wetter sehr großen Einfluss auf den Ablauf beliebiger Geschehnisse hatte und es zu jedem, aber auch zu jedem Vorkommnis immer eine große Zahl an Meinungen gibt, die es bald in diesem, bald in jenem Licht erscheinen lassen. Ganz so wie es in jenem Drama heißt: „Sie wissen, wie groß die weibliche Klatschsucht ist: fast so groß wie die der Männer.“ Und tatsächlich ist diese Redefreudigkeit, der Drang, etwas Besonderes, aber auch etwas Typisches zu sagen, bei Soldaten äußerst ausgeprägt, wie es eine Redewendung gut ausgedrückt: gossip till the cows come home.
Dass meine Frau sich für Natalja, die Komtesse Rostowa, begeistern würde, eine Figur, die der Autor mit besonderer Liebe schildert, wusste ich. Diese Figur, dachte ich mir, ist in der Heimat des Romans gewiss so beliebt wie Jeremias Gotthelfs Vreneli in der Schweiz, und es hätte mich nicht gewundert, wenn es in Russland ebenso ein Goldstück mit Namen Natascha gegeben hätte.
Lange zitterte mir das Herz während der Kapitel, in denen sich Anatol Kuragin der jungen Rostowa in der Oper nähert und den Plan fasst, sie zu entführen und irgendwo auf dem Lande zu heiraten, so wie andere Paare der europäischen Literatur ihre Hoffnung auf den Schmied von Gretna Green setzen mochten. Auch dieser Anatol ist keine wirkliche Schurkenfigur, so wie es derartige in dem langen Roman eigentlich gar nicht gibt, sondern er ist nur auf zerstörerische Weise dumm und bedenkt nie, dass seine Handlungen auch Folgen haben können. Dabei, denn auch er muss ja ein Leben führen und weiterleben, steht er vor sich selbst jedesmal völlig schuldlos da und sieht sich in allem gerechtfertigt. Besonders unheimlich ist für den Leser Nataschas Beobachtung, dass zwischen ihr und Kuragin die gewohnte moralische Schranke, die einer jungen Frau im Gespräch und im Umgang mit einer Person immer sagt, was zu sprechen und zu tun schicklich und angebracht ist, überhaupt nicht besteht, sodass mit dieser Figur tatsächlich alles möglich ist und das Schlimmste nur gerade eben noch verhindert werden kann.
Ebenso, wo, weit vorher, die berühmte Stelle, wo Fürst Andrej Bolkonski, auf dem Schlachtfeld, mit der Fahne in der Hand getroffen wird und gestürzt ist, während er den Tod nahen fühlt, der dann glücklicherweise doch nicht eintritt, zum ersten Mal den hohen, reinen, leeren Himmel wahrnimmt, durch den ein paar leichte Wolken schwimmen, ähnlich wie, aber doch ganz anders, an einer Stelle bei den Buddenbrooks, und wie er fühlt, dass dieser Himmel sich über allem und allen wölbt und wie der Fürst sich vornimmt, diesen Eindruck nie wieder zu vergessen, oder wie an einer Stelle die kleine Natascha, eine freudige Nachricht erhaltend, wie ein Ziegenböckchen jauchzend auf und ab springt, ganz so wie Mädchen es heute noch tun, oder die Schreckensvision eines Militärlazaretts, in dem den Eingelieferten nicht nur nicht geholfen, sondern alles dafür getan wird, sie in der elendesten und schmutzigsten Weise verfaulen und verrotten zu lassen.
In dieser Lektüre konnte ich mich verlieren, aber dabei verfehlte ich niemals, in einem hinteren Winkel meines Gehirns, rechts im Hinterkopf, darüber nachzudenken, wie der Unglücksfahrer schließlich doch aufzuspüren sei. Schichtarbeiter, dachte ich, kann er nicht sein, wenn er zu dieser Tageszeit regelmäßig fährt, denn Schichten enden viel früher oder viel später. Es muss sich also um einen Angestellten handeln, einen Büromenschen, vielleicht auch um den Eigentümer einer Firma.
Die beiden Orte, die die Straße verband, waren recht klein. Bei allem war ich mir darüber klar, dass ich ein Laie war und bei allen Nachforschungen, so ergebnisarm und ungeschickt sie auch sein mochten, eine breite Spur von Hinweisen auf mich selbst hinterlassen würde. Ich konnte nicht hoffen, weiter zu kommen als die Polizei gekommen war, und wenn, konnte ich nicht erwarten, irgendein Resultat dadurch zu erzielen. Aus irgendeinem Grund war ich längere Zeit sicher, der Fahrer komme aus einem der beiden Orte, vielleicht nur, um ein begrenztes Feld zur Untersuchung zu haben.
Ich stellte mich sogar selbst eine Woche lang an die Straße, jeweils nach dem Besuch bei meiner Frau, und notierte die Kennzeichen aller durchkommenden Fahrzeuge. Die Kriminaltechnik hatte Splitter eines zinnoberroten oder signalroten Lacks an der Kleidung meiner Frau gefunden. In jenen Jahren hatte es sich mehr und mehr durchgesetzt, Autos nur noch in schwarz, weiß und grau zu lackieren, und ein farbiger Lack, wiewohl rot am verbreitetsten unter den doch weiterhin verwendeten war, schien selten. Hellblaue oder grasgrüne oder orangefarbene Fahrzeuge wie in meiner Kindheit gab es fast gar nicht mehr, alle wollten seriös sein. Dieser Lack war einer, der vor allem bei Nissan-Fahrzeugen verwendet wurde, aber nicht ausschließlich.
Eine Liste solcher Fahrzeuge hatte die Polizei aufgestellt und abgearbeitet, aber ohne Erfolg. Doch sagte ich mir, diese Farbe sei besser als grau, denn graue Töne mit oder ohne Effekt musste es zu Hunderten geben. Auf meiner eigenen Liste kennzeichnete ich deshalb rote Fahrzeuge mit einem Ausrufezeichen. Weiter wurde ich vorstellig bei Kirchengemeinden, fragte nach Haus- und sonstigen Kreisen und besuchte mehrere Gottesdienste, um mit den Pfarrern ins Gespräch zu kommen.
Immer, wenn man mir sagte: das hat der und der übernommen oder da würden Sie am besten den und den fragen, aber der ist ja leider schon lange nicht mehr bei uns, wurde ich aufmerksam, und es gelang mir, zwei oder drei Namen von Leuten zu erfahren, die etwa ein oder einhalb Jahre zuvor in die Gemeinde eingetreten waren oder sie verlassen hatten. Von den Gemeindesekretärinnen erfuhr ich dann auf Umwegen die Adressen und erschien dort, um einen Blick auf die verwendeten Autos zu werfen. Zinnoberrote Wagen waren jedoch nicht darunter.
Ebenso fragte ich bei den Tankstellen und Autowerkstätten nach, wo man hier Wildunfälle oder sonstige Schäden reparieren lassen oder selbst reparieren könne, ohne dass die Versicherung informiert werden müsste, denn das würde ja nur die Beiträge in die Höhe treiben.
Der Kunde einer dieser Werkstätten, ein älterer, ziemlich steifer Herr, der sich nur mühsam bewegen konnte, sagte mir, es gebe eine Art Privatwerkstatt für Leute, die aus Leidenschaft an ihren Wagen herumschrauben wollten, und der Besitzer, ein junger Mann, könne Teile, Werkzeug, Farbe und Anleitungen besorgen.
Jedes Jahr kämen viele, um dort Winterräder aufzuziehen oder das Öl zu wechseln, und dort sollte ich fragen. Die Halle, auf dem Gebiet eines ehemaligen Bauernhofs gelegen, in der sonst Landmaschinen gestanden hatten, lag ziemlich außerhalb.
4
Als ich mich dem Hof näherte, dunkelte es bereits, eine schwere, blaue, winterliche Dunkelheit. Die Halle bestand aus Wellblech und war etwa acht mal zwölf Meter groß. An einer Schmalseite war ein Rolltor, drinnen war ein gegossener Betonboden; an den Wänden standen Fässer und Kanister, es war ein Farbsprühgerät vorhanden, eine Hebebühne, die allerdings schadhaft aussah, Reifen, Felgen, Werkzeuge aller Art, Schweißgerät, Druckluft, Bleche und Schablonen.
Auf den ersten Blick schien die Halle leer zu sein, aber nach ein paar Augenblicken trat aus dem Schatten an der Längsseite ein junger Mann mit langem blondem Haar, in einem sehr verschmutzten Overall und Rollkragenpullover, mit einem verschwitzten Gesicht und braunen Augen, und fragte, was ich wollte.
„Ich komme wegen meines Wagens, Herr -“, sagte ich, weil ich seinen Namen nicht wusste, „Ich habe Ihre Adresse von einem Kunden der Werkstätte Eilmann“, und ich beschrieb den älteren Herrn, der dem jungen Mann auch gleich bekannt vorkam.
„Und worum geht’s?“ fragte er.
Ich erklärte, ich hätte einen Wildunfall gehabt – notfalls war ich bereit, meinen Wagen mit einem Hammer zu bearbeiten, falls er ihn sehen wollte – und ich suchte eine Möglichkeit, die Motorhaube auszudellen. Während des Gesprächs versuchte ich zu erfahren, ob er schon einmal einen zinnoberroten Wagen gehabt hätte oder ob schon vor längerer Zeit ein Wildunfall bei seinen Kunden vorgekommen sei. Beides verneinte er. Zwar habe er einen roten Wagen gehabt, einen karminroten Renault-Kastenwagen, der komme aber wohl nicht in Frage, und Wildunfälle kämen zum Glück auch nur selten vor.
Eher könne es geschehen, dass jemand seinen Wagen neu lackieren wolle. Ich fragte, wieviel Farbe man für ein Fahrzeug wie meins notwendig sei, was sie koste und wie lange eine Bestellung dauern könne. Das sei ganz verschieden. Einmal habe ein Kunde, ein junger Mann, einen Wagen richten und mit einer ganz neuen Farbe versehen wollen, das habe ihn etwa achthundert Euro gekostet.
Komplizierte Farbe, graumetallic; da müsse man etwas vom Lackieren verstehen, denn mit dem Pinsel sei so etwas nicht zu machen. Die Farbschichten darunter müssten ebenfalls behandelt werden, sonst werde das nichts mit dem neuen Lack.
„Und wie hat der Wagen vorher ausgesehen?“
Er sei rot gewesen, ein starkes Rot, signalrot oder feuerwehrrot, ein Standardrot.
„Und wann war das?“ fragte ich.
„Schon länger her, an die zwei Jahre, würde ich sagen. Warum wollen Sie das wissen?“
Ich wurde ziemlich aufgeregt und fragte nach diesem Kunden, da er offensichtlich, anders als ich, Erfahrung auf diesem Gebiet hatte, was mir vielleicht nützen könne. Auch ich wolle meinen Wagen neu lackieren, sagte ich. Doch wusste der junge Mann nichts über den Kunden, denn er sei nur ein einziges Mal dagewesen.
„War er denn aus dieser Gegend?“ fragte ich.
Das schon, meinte der junge Mann nach einer Weile, er habe das Kennzeichen des Landkreises gehabt. Er begann sich bereits über meine Fragen zu wundern, deshalb beeilte ich mich, seine Gedanken zu zerstreuen.
„Und ging es nur um den Lack oder war an dem Wagen sonst noch etwas zu tun? Ich bin nämlich in all diesen Arbeiten ziemlich ungeschickt.“ sagte ich.
Das wusste er nicht. An diesem Abend sei er früh gegangen, und der Kunde sei ganz ohne Voranmeldung bei ihm erschienen, als er schon im Aufruch gewesen sei. Das Auto habe er nur flüchtig gesehen.
„Wer hat ihn denn hergeschickt“ fragte ich.
Das wisse er nicht, nehme aber an, es sei ebenfalls jemand von der Tankstelle gewesen. Was ich denn nun tun wolle und wann ich käme? Ich ließ alles im Ungewissen und ging.
Zurück bei den Tankstellen fragte ich nach einem Kunden, der wenige Jahre zuvor ein rotes Auto besessen habe, später aber mit einem grauen zur Inspektion gekommen sei.
Bei den ersten zwei Tankstellen wusste man nichts, bei der dritten aber, vielleicht weil ich vorgab, den Gesuchten zu kennen und in ähnlichen Schwierigkeiten zu stecken, nannte mir der Tankwart einen Namen und eine Adresse.
„Aber das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, weil Sie es ja wohl schon wissen.“ fügte er hinzu; sein Ton drückte Zweifel aus.
Dennoch hörte ich aufmerksam zu und bedankte mich.
„Ja, wenn Sie eine Sau angefahren haben“, sagte er, „dann kann der Schaden sehr groß sein, so groß, dass Sie selber damit nicht zurandekommen. Und wenn die Achse oder der Rahmen beschädigt sind, weil Sie vielleicht hinterher noch an einen Baum gefahren sind, dann kann es leicht schon ein Totalschaden sein, das geht manchmal sehr schnell. Umgekehrt, wenn Sie da nichts tun und später einen Unfall bauen, wird die Versicherung den Wagen untersuchen und nicht zahlen, wenn es schon vorher so beschädigt war. Wie sieht es denn aus?“
Ich erfand auf die Schnelle ein paar Schäden und fragte, wie das Ausbeulen einer Motorhaube zu machen sei.
„Ganz vorsichtig, denn das dauert lange“, sagte er, „Sie geben immer nur ein paar Schläge ab, bis das Blech von selbst etwas tut. Ist es gerissen oder ganz umgebogen, kann man natürlich nichts mehr selbst machen, und auch sonst muss man sehen, ob der Lack gesplittert ist, das muss dann in jedem Fall von einem Fachman gemacht werden, sonst rostet das Teil in zwei Wochen.“
Ohnehin könne man nicht so viel sparen, wie allegemein angenommen werde. Rechne man allen Aufwand dazu, den man selbst treiben müsse, damit etwas Gutes daraus entstehe, dann sei es gar nicht viel, eher das gute Gewissen oder der Stolz des Heimwerkers.
Dem stimmte ich zu.
Zurück in der Selbstschrauberwerkstatt weihte mich der junge Mann in ein paar Geheimnisse der Lackierkunst ein, die insbesondere darin bestanden, mehrere Farbschichten übereinanderzulegen und Farbnasen und Wellen zu vermeiden. Manchmal mache man das auch, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, aber das sei sehr schwierig und müsse gut überlegt sein. Die Hauptsache sei eine dichte, gleichmäßige Schicht, das sei schwierig genug.
„Und wenn man sich mittendrin umentscheidet?“ fragte ich. „Das kommt bei mir schon mal vor. Ich fange mit einer Farbe an, nach einer Weile aber denke ich, anders wäre es doch schöner, und beginne dann noch einmal von vorne.“
Der junge Mann wiegte bedenklich den Kopf. „Da muss man sich schon vorher entscheiden, das nimmt einem keiner ab. Zur Not kann man ja zuerst ein Stück Holz oder Plastik besprühen, um die Wirkung zu testen. In der Werkstatt jkönnen Sie ja auch nicht mittendrin kommen und sagen -“
Ob er selber so etwas schon mal gemacht habe? „Selten, vielleicht zweimal in meiner ganzen Zeit.“
Ich versuchte, noch mehr über den Mann zu erfahren, der damals sein Auto frisch lackiert hatte, aber der junge Mann wusste wohl wirklich nicht mehr. Es würde mir nichts übrigbleiben als den Wagen zu suchen.
Aus der kleinen Gruppe roter Wagen war nun ein Heer grauer Wagen geworden. Das Schwierigste, sagte der junge Mann noch, seien die verwinkelten Blechstellen im Kofferraum und an den Türen, da bleibe am ehesten die alte Farbe sichtbar. Er rate deshalb auch jedem, der einen gebrauchten Wagen kaufen wolle, dort nachzusehen. Auch bei den Metallic-Farben gebe es die verschiedensten Töne und Effekte, dieser junge Mann aber habe ein helles Beton-Grau gewollt, eines mit Glimmer-Effekt aus einem besonderen Metallmehl, also insgesamt einem matten Schimmer, kein Glitzern oder Leuchten, sondern etwas Gedecktes.
Der junge Mann sei aus Köberlingen gewesen, das falle ihm jetzt ein; er habe erwähnt, dass er bald zu Hause sein würde, denn er sei von der Halle nach Hause gelaufen, um den Wagen noch vierundzwanzig Stunden trocknen zu lassen. Das ganz sei zwei Jahre zuvor geschehen, im April, regnerisch, stürmisch.
Am nächsten Tag, noch bei ausreichender Helle, ging ich durch die wenigen Straßen Köberlingens, sah aber keinen betongrauen Wagen. Der Mann mochte die Farbe wiederum gewechselt haben, fiel mir ein. Dann würde sich die Spur gewiss verloren haben. Also musste ich darauf rechnen, dass der Wagen noch immer betongrau sei.
Mehrere Tage lang kam ich immer wieder, bis ich am Eingang einer Straße, vor einem schmucken neuen Haus einen Wagen in dieser Farbe sah, bei dem auch der Metalleffekt zu stimmen schien. Es war ein Renault-Modell, ein Kangoo, und ich ging näher heran, um es mir anzusehen. Allerdings fiel mir auch ein, dass niemand von einem Kastenwagen gesprochen hatte.
Ich bemerkte, dass der Lack nicht überall gleichmäßig deckend aufgetragen worden war, so wie man es bei hausgemachten Lackierungen erwarten konnte. Kaum hatte ich eine Minute bei dem Wagen gestanden, als jemand die Haustür öffnete. Es war ein junger Mann im Trainingsanzug, mit kurzem schwarzem Haar und ebensolchem Bart. „Was wollen Sie?“ fragte er. Sein Gesicht war abweisend und kalt
„Ich suche schon lange einen solchen Wagen“, sagte ich. „deshalb frage ich mich, ob Sie wohl diesen hier verkaufen würden. Er ist ja nicht ganz neu, nicht wahr?“
„Nein, er ist fünf Jahre alt.“
„Sonst aber in Ordnung? Keinen Unfall gehabt?“
„Nein.“ Das kam ohne Zögern.
„Darf ich ihn mir mal ansehen?“
Er hatte die Schlüssel in der Tasche. Ich öffnete die Schiebetüren, die Fahrer-, die Beifahrertür, das Handschuhfach.
„Scheckheftgepflegt?“
Er ließ mich das Heft durchsehen. Im Ordner steckte eine Kopie des Fahrzeugscheins.
„Das ist leichtsinnig“, sagte ich und bemerkte, dass im Fahrzeugschein die Farbe als signalrot angegeben wurde. Auf dem Beifahrersitz, in den Fußräumen, auf der Rückbank war viel Schmutz: Brotkrümel, Holzspäne, Papierfetzen, Fruchtkerne, Bonbonpapier.
„Da müsste wohl mal gründlich gesaugt werden.“
Er nickte und sagte: „Ich fahre oft große Strecken und mag es gern, beim Fahren zu essen.“
„Man sieht´s. Wieviel fahren Sie so im Jahr?“
„Ich weiß nicht genau.“ Der Kilometerstand zeigte 197 000.
„Aber wird er noch eine Weile halten?“ fragte ich. „Kann ich ihn ein Stück fahren?“
„Moment“, meint er. „ich komme gleich, ich ziehe mir eine Jacke an.“
Gleich darauf saßen wir im Wagen und ich merkte, dass das Getriebe ziemlich schwer ging. Die Pedale waren jedoch in Ordnung und auch sonst war der Wagen in einem Zustand, der seinem Alter entsprach. Ich versuchte, mich an alle Tipps, von denen ich gehört hatte, zu erinnern, sah in den Kofferraum, betrachtete die Schweißnähte, besah die Kotflügel, die Schwellen, die Türen, ob Rost daran sei. „Warndreieck und Verbandskasten fehlen“, sagte ich.
„Ich bin noch nie deshalb angehalten worden.“
„Das macht´s nicht besser. Ich sehe mir den Motor an.“
Die vordere Stoßstange aus schwarzem Hartgummi hatte einen hellen senkrechten Streifen in der Mitte, und die Motorhaube hatte an der Vorderseite, wo sie zum Kühler hinabbog, einen kaum wahrnehmbaren Grat. Der Motor war in Ordnung, soweit ich das beurteilen konnte, das Scheibenwasser aufgefüllt, die Batterien ohne Ablagerungen, die Kabel unbeschädigt und nicht locker.
„Gut.“
„Wollen Sie den Wagen noch von jemand anderem durchsehen lassen?“
„ich glaube, er ist in Ordnung. Wieviel kann er laden?“
„Mehrere hundert Kilo. Ausgereizt habe ich das nie.“
„Ich werde vielleicht die Rückbank ausbauen und die Ladefläche vergrößern. Ich brauche ihn für alltägliche Fuhren, er muss also immer anspringen. Hatten Sie damit schon Probleme? Denn wenn er nicht zuverlässig ist, wäre das für mich ein Grund, vom Kauf zurückzutreten.“
„Gekauft wie gesehen, das wissen Sie. Lassen Sie ihn doch von einem Fachmann beurteilen, wenn Sie nicht selbst einer sind. Ich fand ihn immer zuverlässig.“
„Was würden Sie dafür haben wollen?“ Es war eine Szene, bei der Männer sich selbst wie richtige Männer vorkommen.
„Mal sehen – ich würde sagen viertausendfünfhundert. Er macht bestimmt noch seine zweihunderttausend Kilometer, wenn man ihn nicht schlecht behandelt.“
„Das wäre in Ordnung.“
„Im Motorraum, in einer schlecht zugänglichen Ecke, habe ich einen nicht überlackierten Flecken roten Lacks entdeckt. Haben Sie den Wagen neu lackieren lassen?“
„Ja, das ist gemacht worden, gleich zu Anfang. Die ursprüngliche Farbe war ein schreckliches Rot mit einem Leuchteffekt. Einen anderen hatten sie nicht, aber ich wollte auf jeden Fall eine andere Farbe haben.“
Ich hätte nun gerne das Auto für eine Nacht mitgenommen, daran herumgefeilt und die Motorhaube unter die Lupe genommen, aber das ging nicht.
5
Also kaufte ich den Wagen; wir unterzeichneten einen Privat-Kaufvertrag, und einige Tage später brachte ich das Fahrzeug zu dem leidenschaftlichen Schrauber auf den Hof, um prüfen zu lassen, ob ander Motorhaube schon einmal ein Schaden ausgebessert worden sei.
„Ja, das kann sein“, sagte der Mann, „aber dann hat jemand die Delle mit viel Sorgfalt bearbeitet, aber kein Fachmann. Man muss dann sogar die Stelle, wo der Lack gewesen ist, besonders auffüllen, grundieren und streichen, wenn der Riss bis in die untersten Schichten durchgeht, denn der Rost ist immer schnell da.“
An einem Kotflügel feilte ich die graue Lackierung ab und sammelte eine Messerspitze Staub von dem roten Lack darunter, den ich bei der Polizei vorbeibrachte.
Pergmann, bei der Polizei, nahm das Tütchen entgegen und sagte: „Laboruntersuchung? Wissen Sie, was das kostet? Vielleicht bringen Sie die Probe zu einem privaten Untersucher und zahlen das selbst, das wäre viel einfacher für mich. Wo haben Sie den Kram überhaupt her?“ Und ich sagte es ihm.
Er blätterte die Akten durch und meinte dann: „Ja, das Kennzeichen steht auf meiner Liste, und der Name auch. Aber es ist kein Zinnoberrot, und es ist auch kein Nissan-Lack, sondern einer von Renault. Was haben Sie noch?“ Ich erzählte von dem Schaden und dem fraglichen Zeitpunkt. Pergmann sagte: „Sie haben recht, der Name Eilbach steht auf meiner Liste. Wir haben den Mann aber ausgeschlossen, und nicht ohne Grund. Diese Untersuchung muss ich erst beantragen. Und selbst, wenn die Kosten bewilligt werden, was soll ich dem Labor sagen, damit es hinterher nicht heißt: ich hab´s doch gleich gewusst, dass es nichts ist damit?“
Das wusste ich nicht und wiederholte nur noch einmal, was ich an Vermutungen hatte, was jedoch nicht ausreichte. „Was kostet die Untersuchung?“
„Nun, sie werden den Lack verbrennen und die Flamme chromatographieren. Und für einen anderen Teil werden sie mit Chemie arbeiten. Trotzdem müssen Sie die Ergebnisse noch in unserem Labor vergleichen lassen, sonst können sie ja nichts darüber sagen. Das ganze kostet, sagen wir, zweitausend Euro, bevor Sie auch nur ein einziges Ergebnis haben.“
„Könnten Sie nicht die Daten zu den ursprünglichen Lacksplittern an das Labor übermitteln, wenn ich die Untersuchung selbst bezahle? Farbe und Hersteller, zu Vergleichszwecken.“
Wieder blätterte Pergamnn in den Akten. „Das glaube ich nicht. Die Daten gehören ja nicht uns, sondern sind Bestandteil der Ermittlung, ein Asservat. Die Probe Nummer zwölf ist analysiert worden, leider stehen hier nicht die Bezeichnungen der Methoden. Aber der Hersteller – da gibt es nur Hinweise.
Manche Lacke werden in ähnlicher Zusammensetzung von vielen Firmen verwendet. Sehen Sie, die Kurve hat hier, hier, hier bestimmte Spitzen, das soll darauf hinweisen, dass es eine Farbe ist, die auch von Nissan verwendet wird, aber von „ausschließlich“ steht hier nichts.“
„Na also!“
„Das hat gar keine Bedeutung.“
„Aber man kann doch auf diese Weise feststellen, ob die Proben vom selben Hersteller stammen?“
„Zunächst müsste man feststellen, ob die Probe überhaupt verwendbar ist. Sie kann ja verunreinigt sein. Man müsste sie erst vorbereiten.“
„Aber auch Ihre erste Probe hat ja verunreinigt sein können.“
„Dann müsste man sie möglicherweise noch einmal untersuchen.“
„Aber sie ist doch schon verbraucht?“
„Wir haben noch ein paar Splitter mehr. Trotzdem: Splitter sind etwas anderes als Feilstaub.“
„Gut, gut. Sie müssen also einen Auftrag schreiben, damit die untersuchenden Behörde die Kosten autorisiert. Können Sie angeben, wie hoch die Kosten sind?“
„Wenn das Ergebnis als Beweis zu einem Schuldspruch führt, kann man sie eventuell später geltend machen, wenn alles zusammengerechnet wird.“
„Also wieviel?“
„Das steht hier nirgends, Aber das Labor ist immer teuer. Ich würde sagen, das Ganze kostet mindestens fünftausend Euro. Teure Maschinen, Fachpersonal.“
„Bitte führen Sie die Untersuchung durch, ich bezahle sie,“
„Wie gesagt, ich muss sie erst beantragen. Allerdings wüsste ich gar nicht, wie ich das begründen sollte.“
„Das wäre doch nichts anderes als die Aussage eines weiteren Sachverständigen, den würde ich ja möglicherweise ebenfalls selbst bezahlen.“
„Gut, ich versuche es.“
„Und wie lange rechnen Sie bis zu einer Antwort?“
„Ich schreibe Ihnen.“
Also gab ich die Probe ab und wartete. Zwei Wochen später erhielt ich einen Brief, dass die Untersuchung weitere drei Wochen später durchgeführt werden könnte und viertausend- achthundertsiebenunddreißig Euro und sieben- unddreißig Cents kosten würde.
Ich sagte zu.
Sechs Wochen später hatte ich den Bericht, der besagte, die beiden Proben stimmten in fünf Punkten überein, wo an die zwanzig möglich gewesen wären. Und es handele sich zu siebenundzwanzig Prozent um dieselbe Farbe.
„Der Hersteller der Farbe sitzt in Nanterre“, sagte ich zu Pergmann. „Wir haben Untersuchungen aus seinem Labor. Er versorgt Konstrukteure in Frankreich und Deutschland, die ihm ihre Spezifikationen mitteilen. Darunter sind Nissan und Renault, das ist richtig, aber auch Subaru und Mitsubishi, sogar eine spezielle Charge von Ford.
Aber diese Farben, so ähnlich sie einander auch sind, unterscheiden sich in vielen Punkten doch erheblich.“
„Ja, für den Chemiker.“
„Auch für Ermittler. Wir können tatsächlich nicht sagen, ob es dieselben sind, und leider keine Schlüsse daraus ziehen.“
Das verstand ich, aber im Grunde bestärkte mich das nur noch. Ich fühlte und wusste, dass dieser Mann den Unfallwagen gefahren hatte. Da gab es für mich keine Zweifel. Mir schien es als sei ich ein großes Stück weitergekommen und könne nun endlich neue Gedanken haben.
Mit „Krieg und Frieden“ war ich inzwischen bis zu der Szene gekommen, wo der alte Fürst Bolkonskij, in seine Generalsuniform bekleidet und mit seinen „Orden und Sternen“ geschmückt, wütend aus dem Haus zu seiner Landwehr stürzt, bald aber von drei Männern, die ihn bei seinem Pferd gefunden haben, ins Haus zurückgetragen wird, weil er inzwischen einen Schlaganfall erlitten hat, an dem er später, kaum noch seiner Sprache und seines Körpers mächtig, stirbt. Seiner Tochter, Prinzessin Marja, kann er noch ein paar zärtliche Abschiedsworte sagen, während sie sich Vorwürfe macht, weil sie sich gewünscht hat, es möchte doch endlich mit ihm zu Ende gehen und für sie ein neues Leben beginnen.
Es ist eine tränenreiche Szene, und in der zurückliegenden Zeit hatte ich bemerkt, dass mich traurige Szenen in Büchern mehr bewegten und viel eher zu Tränen rührten als Vorgänge in der wirklichen Welt. So rührte mich auch meine Frau als Komapatientin nicht so sehr wie ihre frühere Erzählung vom Schicksal einer entfernten Bekannten von uns, von der ich seit Jahren nichts mehr gehört hatte. Fast war es so als hätten Erfindung, Wirklichkeit und Hörensagen die Plätze getauscht, sodass die Wirklicheit in Ferne und Folgenlosigkeit gerutscht sein.
Die Schläue und Durchtriebenheit der Bauern von Bogutscharowo, die die Prinzessin Marja nicht in die fragwürdige Sicherheit von Moskau abreisen lassen wollen, weil der französische Bezirkskommandant den Bewohnern der Landschaft Sicherheit versprochen hat, empörte mich viel mehr als die Vorgänge um mich herum, bei denen ich sogar helfend und ohne mich zu verausgaben hätte eingreifen können. Wütend las ich, dass bereits in diesem Krieg von den Franzosen massenweise gefälschte Banknoten in Umlauf gebracht worden waren, um die Wirtschaft des Feindes zu zerstören.
Am Zustand meiner Frau änderte sich derweil nichts. Jedoch kam sie mir im Ganzen vertrocknet und brüchig vor. Die Beatmungsapparatur schien die Luft in einen rissigen Sack hineinzublasen, der sich im Rhythmus des Geräts aufblähte und zusammenfiel. Ihr Gesicht schien mir sehr braun und trocken wie Rinde, mürbe wie eine Trockenfrucht, und die Atmung erschien mir kaum wie eine Funktion, die der Körper sonst schmerzlos und von allein ausführte, sondern wie eine fremde, hinzugekommene, berechnete Bewegung, aus der nichts folgen konnte als eine Lungenentzündung.
Klar war es jedoch auch, dass sich Ärzte und Pflegepersonal während dieser zwei Jahre äußerst umsichtig verhalten hatten, sonst hätte meine Frau nach dieser Zeit nicht in so gutem Zustand sein können. Überhaupt schien mir das Wort Zustand äußerst angebracht, so wie man ein veraltetes Ding beschreibt, zum Beispiel ein Möbelstück, das man in die Werkstatt bringt, um es erneut verwendbar machen zu lassen.
Andererseits hatte ich immer den Eindruck, dass mein Vorlesen gehört würde; nie schien es mir so, dass es in meiner Frau ungehört verhalle. An dem Schicksal der jungen Komtess Rostowa schien meine Frau Anteil zu nehmen, denn ich wusste, hätten wir den langen Roman gemeinsam lesen können, würde ihr diese Figur besonders gefallen haben.
Als junges Mädchen hatte meine Frau den „Stillen Don“ von Scholochow gelesen, die ganze vierbändige, in rote Schutzumschläge gehüllte Ausgabe, und ich, viel später, hatte ebenfalls versucht, mir diese Geschichte zu eigen zumachen, es aber nicht vermocht, weil es mir schlechterdings nicht gelungen war, mich für die Figuren zu interessieren. Auch die Vorgänge, die Rekrutierungen, Transporte, Märsche, Urlaube, Gefechte, die neuen Transporte, Beförderungen, erneuten Gefechte, eins nach dem anderen angeführt und alle in demselben Ton erzählt, ließen mich völlig kalt.
Dennoch hatte ich das Gefühl, diese Lektüre, dieses gewichtige Stück Literatur sei Teil des Lebens meiner Frau wie eine Reise oder eine Bekanntschaft.
Tag für Tag trabte ich auf die Intensivstation wie die Kuh auf die Weide, denn auf gewisse Weise nährte ich mich auch von diesem Zustand; er erhielt mich in Bewegung, und die Aussicht, ihn durch einen Mord zu beenden, der dem Tod meiner Frau folgen würde, schien mir passend und abschließend, denn über ihn hinaus konnte ich mir nichts vorstellen.