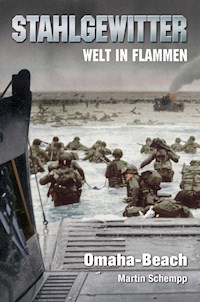9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1943 und nach der Katastrophe von Stalingrad zeichnet sich ab, dass die strategische Lage sich für das Deutsche Reich weiter verschlechtern wird. Die industrielle Kapazität der USA wirkt sich auf die zunehmende Stärkung der Sowjets in Form von Lkw- und Panzerlieferungen aus, und selbst die Eigenproduktion Russlands übersteigt die des Reichs und der deutschbesetzten Gebiete. Von Offensive zu Offensive verringert sich die Breite der Angriffsstreifen der Wehrmacht immer mehr – der deutschen militärischen Führung ist klar, dass nur ein großer Gewaltstoß, der zu einem glänzenden Sieg führen muss, die Rote Armee überhaupt davon abhalten kann, kurzfristig weitere Großoffensiven gegen die geschwächten deutschen Fronten zu starten. Und beide Seiten haben den Frontbogen von Kursk im Auge... »Alternativer Beobachter« ist eine Buchreihe des UNITALL Verlages. In jedem Band wird eine militärhistorisch bedeutende Schlacht in Romanform aufgegriffen. Allerdings weichen Verlauf und Ausgang ab von dem, was in unserer Realität geschah. Im Anhang zu jedem Roman spekuliert der Autor über die Auswirkungen seiner alternativen Geschichte auf den weiteren Kriegsverlauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ALTERNATIVER BEOBACHTER
Operation Zitadelle geglückt!
Russische Großkampfverbände im Kursker Bogen vernichtet!
Military-Fiction-Roman
von
Martin Schempp
Inhalt
Titelseite
Widmung
Die Ausgangslage
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Ausblick
Vita
Empfehlungen
Compact Geschichte
Alternativer Beobachter
Inferno – Europa in Flammen
Stahlzeit
Impressum
Widmung
Für meine Frau Sylva, die mir beigebracht hat, wie man Romane schreibt.
Die Ausgangslage
1943 war das Jahr, in dem sich das Stimmungsbarometer im Deutschen Reich erstmals änderte. Nach den erfolgreichen Feldzügen der vergangenen Jahre in Polen, Frankreich, Norwegen, Afrika und auf dem Balkan verdichtete sich die Befürchtung, dass der Krieg wohl doch nicht so schnell zu gewinnen sei, wie ursprünglich erhofft. Zwar beherrschte die Wehrmacht einen Großteil Europas und saß in den eroberten Ländern fest im Sattel, doch zeigten sich im Frühjahr 1943 erste Zeichen des Verfalls: Rommel befand sich in Afrika auf dem Rückzug, der U-Boot-Krieg im Atlantik kippte, und die Alliierten erlangten endgültig die absolute Luftherrschaft über dem Reich.
Auch in Russland zogen sich dunkle Wolken zusammen. Die Winteroffensiven der Roten Armee setzten der Wehrmacht schwer zu. Zwar konnte der Gegner im darauffolgenden Sommer immer wieder zurückgedrängt werden, die Zeit, in der die Deutschen die Initiative in den Händen hielten, war jedoch endgültig vorbei. Statt agiert wurde an der Ostfront nur noch reagiert. Der Verlust der 6. Armee in Stalingrad im Februar 1943 war schließlich die bis dahin schlimmste Niederlage der deutschen Wehrmacht mit ungeahnten militärischen und psychologischen Folgen.
Was in einer solchen Situation dringend benötigt wurde, waren Siege oder wenigstens Teilerfolge, welche die Moral der Truppe und der Bevölkerung wieder heben würden. Ein solcher Teilerfolg war Feldmarschall Erich von Manstein im März 1943 gelungen, als er die sowjetische Winteroffensive aufhielt und die bereits verlorene Stadt Charkow zurückeroberte.
Eine Möglichkeit für einen schnellen Sieg sah die deutsche Generalität am Frontbogen von Kursk. Diese etwa hundertfünfzig mal zweihundert Kilometer große Ausbuchtung nach Westen war entstanden, als die Russen sich in einem überraschenden Vorstoß westlich von Kursk zwischen die beiden Heeresgruppen Mitte und Süd geschoben hatten. Ein Plan wurde ausgearbeitet, der vorsah, durch eine Zangenbewegung von Norden und Süden auf Kursk vorzustoßen, die russische Zentralfront sowie die Woroneschfront einzuschließen und zu vernichten. Damit sollte nicht nur ein dringend benötigter Erfolg errungen werden, sondern dem hart bedrängten Ostheer etwas Luft verschafft werden.
Die Diskussionen, ob und wie Unternehmen Zitadelle verwirklicht werden sollte, dauerten seit April 1943 an. Hitler konnte sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden, und auch unter den deutschen Generälen gab es Gegner. Größter Befürworter und Motor hinter Zitadelle war Manstein. In einer Vielzahl von Telefonaten, Briefen und Besprechungen versuchte der Feldmarschall, den Führer zu überzeugen. Bislang erfolglos. So zerrann wertvolle Zeit, welche die Sowjets nutzten, um den Kursker Bogen zu einem nie dagewesenen Bollwerk der Verteidigung auszubauen. Hatte ein Angriff der Wehrmacht hierauf überhaupt noch einen Sinn?
Kapitel 1
Anfang Mai 1943, München
Zwei Tonnen polierte und Respekt einflößende Eleganz rollten vom Flughafen Riem in Richtung Münchener Innenstadt. Nur das Flüstern des großen Achtzylindermotors und das Surren der Reifen waren zu hören. Die schwarze Horch-Limousine mit ihren schwungvollen Kotflügeln, die an Skisprungschanzen erinnerten, fuhr die Prinzregentenstraße entlang. Der Feldmarschall auf dem Rücksitz sah gedankenverloren hinaus auf die von Alleebäumen und Cafés gesäumte Prachtstraße, die um 1900 vom Prinzregenten Luitpold als bürgerliche Nobelstraße in Auftrag gegeben wurde. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht, als er hinter der Isarbrücke die Spaziergänger im Englischen Garten beobachtete, die sich die warme Frühlingssonne auf die Gesichter scheinen ließen. Ein Bild wie im tiefsten Frieden, das Münchens zerbombte Straßenzüge zwar nicht verschwinden ließ, sie aber doch für einen unbeschwerten Moment ausblendete. Am Hofgarten bog der Horch von der Prinzregentenstraße ab und gewährte seinem Passagier einen Blick auf den in der Mitte des Parks stehenden Diana-Tempel. Der Feldmarschall rückte sein Ritterkreuz mit dem Eichenlaub zurecht und sog den Geruch von Lederpolster und Holzverkleidung durch seine große, ein wenig hakenförmige Nase. Dann schüttelte er den Kopf. München. Eine faszinierende Stadt, gewiss. Bunt, voller Kultur und Geschichte. Und trotzdem – er verstand München nicht, verstand dieses ganze Land nicht. Bayern. Er war Preuße. Bayern kam ihm vor wie eine schwere Algebra-Aufgabe, zu deren Lösung er keinen Ansatz fand, keinen Zugang. Er mochte flaches Land, die sandigen Böden der Uckermark, die duftenden märkischen Kiefernwälder. Er liebte es, im Pferdesattel die Strände an Nord- und Ostsee entlangzureiten. Berge hingegen empfand er als bedrohlich und sah keinen Sinn darin, auf lebensgefährlichen Pfaden irgendwelche Gipfel zu besteigen. Als wortkarger, reservierter Preuße konnte er mit der plumpen Zutraulichkeit der Bayern nichts anfangen. Er kleidete sich klassisch zurückhaltend, während man hier kurze Lederhosen und gestrickte Wadenwärmer trug und sich einen Hut mit Gamsbart aufsetzte. Zuhause gingen die Menschen sonntagnachmittags zum Tanztee in ein vornehmes Hotel, in Bayern tanzten sie jauchzend im Kreis und schlugen sich mit den Händen auf Schuhsohlen, Oberschenkel und Gesäß. Und erst die Sprache, die mehr Ähnlichkeit mit Italienisch oder Mandarin hatte als mit Deutsch. Nein, dieses Land und seine Einwohner würden ihm ewig ein Rätsel bleiben.
Dass sich genau in diesem Moment seine Nackenhaare aufstellten, sein Mund austrocknete und sich seine Bauchdecke spannte, hatte jedoch nichts mit seinem schwierigen Verhältnis zu Bayern zu tun. Es lag an dieser Konzentration nationalsozialistischer Macht, die sich vor ihm auftat, als der Horch vom Karolinenplatz kommend rechts in die Arcisstraße einbog. Nach ihrer Machtergreifung 1933 hatte die NSDAP begonnen, das ehemals vornehme Viertel rund um den Königsplatz in ihre Verwaltungszentrale umzuwandeln. Sie richtete in Wohn- und Geschäftshäusern Büros ein und zog mehrere Monumentalbauten hoch. Darunter die Parteizentrale, das Verwaltungsgebäude und den Führerbau. Auf letzteren steuerte der Horch zu. Als der Feldmarschall seine abgegriffene lederne Aktentasche zur Hand nahm, fielen ihm auf dem Gehweg gegenüber Kinder auf, die Seilhüpfen spielten. Während zwei von ihnen ein langes Seil schwangen, führte dazwischen das dritte mit erstaunlicher Geschicklichkeit seine Kunststücke vor. Alle drei waren vollkommen in ihrer Welt des Spiels versunken, mit vor Konzentration offenen Mündern und zusammengezogenen Augenbrauen. Reine kindliche Unschuld, nur wenige Meter neben dem Ursprung von Terror, Gewalt und Tyrannei. Wie bizarr.
Der Horch stoppte, der Fahrer stieg aus, öffnete dem Passagier mit der kräftigen Figur und dem schütteren weißen Haar die Tür und salutierte. Es war nicht das erste Mal, dass der Feldmarschall vor dem Führerbau stand. Und auch nicht das erste Mal, dass ihm diese vulgäre Machtdemonstration missfiel. Ein dreistöckiger, aus hellem Granit errichteter Beweis für die Stil- und Geschmacklosigkeit der Nationalsozialisten. Von einem untalentierten Architekten als gescheiterte Mischung aus tausend Jahren Baugeschichte verbrochen.
Hitler hatte sich in dem Gebäude Büros sowie einen Besprechungsraum einrichten lassen, der wie schon so oft auch heute das Ziel des Feldmarschalls war. Und wie schon so oft ging es auch heute um das Unternehmen Zitadelle. Vermutlich würde die Operation erneut verschoben werden. Eine militärische Katastrophe. Der Feldmarschall schluckte seinen Ärger hinunter und trat durch das von mächtigen Säulen eingefasste Portal. Die beiden schwarz uniformierten Wachen am Eingang präsentierten das Gewehr und zeigten sich unbeeindruckt von Rang und Auszeichnungen des Feldmarschalls. Zu viele hohe Offiziere hatten sie schon mit erhobenem Haupt hineingehen und als gebrochene Männer wieder herauskommen sehen.
Auch der Unteroffizier an seinem Schreibtisch hinter der doppelflügeligen Eingangstür sah ohne aufzublicken die Papiere des Feldmarschalls durch, griff zum Telefonhörer, und ein paar Sekunden später erschien ein Ordonnanzoffizier und bat den hohen Besucher höflich, aber mit offen zur Schau getragener Arroganz, ihm zu folgen.
Die Hausherren hatten es geschafft, den Führerbau innen ebenso zu verschandeln wie außen. Vor Pathos triefende Ölgemälde spiegelten an kahlen Wänden das Kunstverständnis der NSDAP wider, allgegenwärtige Hakenkreuzfahnen und Hitlerbüsten die politische Ausrichtung.
Während die beiden Männer die rote Marmortreppe hinaufschritten, ahnte der Feldmarschall, was ihn oben erwartete – ein missmutiger Führer, der ihn zwar als einen seiner besten Generalstäbler brauchte, ihn aber im Grunde zutiefst hasste. Weil der Feldmarschall im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden nie ein Blatt vor den Mund nahm und Hitler immer wieder dessen militärisches Unvermögen vor Augen hielt. Diese Erzfeindschaft sollte heute allerdings nicht zu sehr eskalieren. Denn er hatte für Hitler in Sachen Zitadelle eine Überraschung parat. Der Ordonnanzoffizier klopfte an der hohen Holztür des Besprechungsraums an, trat mit seinem Besucher an der Seite ein und meldete: »Generalfeldmarschall von Manstein, mein Führer.«
Die fünf Männer, die um einen wuchtigen Kartentisch aus Eiche standen, blickten auf. Manstein erkannte Generaloberst Guderian, den Inspekteur der Panzertruppe, Generaloberst Zeitzler, Generalstabschef des OKH, Feldmarschall von Kluge, Chef der Heeresgruppe Mitte, Generaloberst Jeschonnek, Chef des Generalstabs der Luftwaffe, und natürlich Adolf Hitler. Der trug wie immer seine typische graugrüne Jacke, diese merkwürdige Mischung aus Abendgarderobe und Uniform, einzig mit dem Eisernen Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg und einem kleinen Parteiabzeichen geschmückt. Hitler stach damit aus dem Kreis seiner Generäle in ihren martialischen, mit Orden behängten Uniformen heraus. Manstein tippte auf Absicht. Der Führer wollte auf diese Weise seinen bescheidenen Charakter und seine asketische Lebensweise herausstreichen. In Wirklichkeit lieferte er jedoch ein Beispiel dafür, dass Bescheidenheit die höchste Form von Arroganz sein kann. Schweigend schritt Hitler auf Manstein zu. Mit seinem Seitenscheitel, den in die Stirn hängenden schwarzen Haaren und dem lächerlichen zweifingerbreiten Schnauzbart ähnelte er einem Zirkusclown. Aber keinem fröhlichen. Hitler versuchte, seinem maskenhaft starren Gesicht ein Lächeln abzuringen, was aber nicht recht gelang und in einer Grimasse endete.
Manstein nahm Haltung an und hob bewusst nicht den rechten Arm, sondern grüßte militärisch knapp, indem er die flache rechte Hand an die Schläfe legte. Zu seiner Überraschung reichte ihm Hitler die Hand. »So, da ist er ja, der Herr Generalfeldmarschall.« Die Maske versuchte erneut ein Lächeln. »Wir hörten bereits von dem Nebel, der Sie in Berlin festhielt. Aber egal, jetzt ist unser wichtigster Mann ja hier.«
Jeder im Raum registrierte die falsche Höflichkeit Hitlers. Nein, das war nicht der Führer, wie man ihn kannte. Auch Manstein ließ sich nichts vormachen. Die zuckenden Gesichtszüge Hitlers und seine angespannte Nackenmuskulatur verrieten mehr als Worte.
Hitler drehte sich um und deutete Richtung Kartentisch. »Nun, die Herren kennen sich ja alle untereinander, sodass wir gleich zum Thema der heutigen Besprechung kommen können.« Dann wandte er sich der auf dem Tisch ausgebreiteten Russlandkarte zu.
Der Besprechungsraum maß rund acht mal zehn Meter. Boden und Wände waren mit dunklem Eichenholz belegt und verliehen ihm die typische düstere Atmosphäre, mit der sich der Führer gerne umgab. Heute hatte allerdings jemand die schweren roten Vorhänge zurückgezogen, sodass die Sonne nicht nur auf den in der Mitte stehenden Kartentisch scheinen durfte, sondern auch Mansteins goldenes Krimschild am Oberarm glänzen ließ. Sogar die Fenster waren gekippt und ließen die Geräusche des Frühlings herein. Frische, feuchte Mailuft verdrängte den sonst in diesem Raum herrschenden abgestandenen Muff. Was hatte Hitler vor? Manstein grüßte die vier Generäle durch stummes Kopfnicken und legte seine Aktentasche auf ein hölzernes Sideboard, das an der Wand gegenüber dem Tisch aufgestellt war.
Mit seiner kehligen, schnarrenden Stimme übernahm Hitler das Wort. »Meine Herren, wie ich bereits sagte, geht es heute Morgen wieder einmal um das leidige Unternehmen Zitadelle. Sie wissen, dass ich kein großer Freund davon bin. Damit es aber nicht heißt, der Führer würde nicht auf seine Generäle hören, habe ich Sie zu dieser Besprechung gebeten, um endlich eine Entscheidung zu treffen, ob und wann Zitadelle stattfinden soll.« Er gab Zeitzler ein Zeichen.
Der Generalstabschef des Oberkommandos des Heeres machte einen Schritt nach vorn und kam wie gewohnt kurz angebunden und ohne Umschweife zur Sache. »Mein Führer, meine Herren. Generaloberst Model von der 9. Armee hat uns Luftbilder vorgelegt, die ein unerwartetes Ausmaß russischer Verteidigungsanstrengungen an den beiden Flanken des Kursker Bogens zeigen. Der Feind hat eine hohe Zahl frischer Truppen herangezogen und baut sein Stellungssystem in großer Eile aus. Es scheint so, als ahnten die Russen etwas von unserem geplanten Zangenangriff. Generaloberst Model verlangt deshalb eine weitere Verschiebung der Operation, gegebenenfalls deren Abbruch. Er argumentiert, seine 9. Armee sei nicht stark genug, um die bis zu zwanzig Kilometer tiefen russischen Stellungen zügig zu durchbrechen. Er rechnet, wenn überhaupt, mit mindestens einer Woche. In dieser Zeit könnten sich die Russen einer Umklammerung entziehen.« Zeitzler sah zu Hitler und fuhr sich über die Glatze. »Ich persönlich, mein Führer, plädiere jedoch trotz Models Bedenken dafür, Zitadelle wie geplant zu beginnen. Unsere Truppen sind stark genug. Dass die Russen einen Zangenangriff ahnen, überrascht mich nicht. Dafür bietet sich der Kursker Bogen geradezu an. Wir dürfen allerdings keine Zeit verlieren. Je später wir angreifen, desto stärker wird der Feind.«
Manstein mochte den erfahrenen Panzermann Zeitzler. Der hatte das Kriegshandwerk von der Pike auf gelernt und war mit Manstein in operativen Dingen fast immer einer Meinung. Wie er diesen ständigen Kampf gegen Hitlers Sturheit und Weltfremdheit aushielt, war Manstein jedoch schleierhaft. Die täglichen Streitereien und Wortgefechte hinterließen deutliche Spuren, in das freundliche Gesicht Zeitzlers mit dem kurz gestutzten Schnauzbärtchen hatten sich seit der letzten Besprechung wieder neue Sorgenfalten gegraben.
Eine Ordonnanz in weißem Jackett brachte ein Tablett mit einer Wasserkaraffe und Gläsern herein. Dann war Hitler dran. Wie üblich begann seine Rede mit einem langen Monolog über die Stärke der Wehrmacht, die Schwäche des Gegners, die Leistungsfähigkeit der deutschen Rüstung, die Unzulänglichkeit der russischen Industrie, die herausragende Qualität deutscher Soldaten und Waffen, die Minderwertigkeit des bolschewistischen Materials. Hitler ließ seine Hände sprechen und setzte sein Talent als Redner ein. Er sei überzeugt, diesen Krieg zu gewinnen und nicht nur Russland, sondern einmal ganz Europa zu beherrschen. Im Augenblick sei es jedoch klüger, auf große Operationen wie Zitadelle zu verzichten und den Feind lieber mit kleinen Unternehmen zu beschäftigen und ihn zu schwächen. Er legte eine Pause ein, um dem Gesagten Gewicht zu verleihen, und beendete seinen Vortrag mit den Worten: »Außerdem ist das Wetter im Mai unsicher, und der deutsche Panzer braucht festen Boden. Deshalb bin ich dafür, zu warten, bis der Russe am Kursker Bogen von sich aus angreift. Wenn er sich verausgabt hat, schlagen wir aus der Hinterhand zu und vernichten ihn.«
Manstein musste innerlich lächeln. Hitler, der keinen Handbreit Boden freiwillig aufgab, redete plötzlich davon, den Gegner kommen zu lassen, zurückzuweichen. Dabei hielt er das Schlagen aus der Hinterhand, in dem die Wehrmachtsgeneräle wahre Meister waren, für eine militärische Schwäche. Stehen und halten, lautete seine Devise. Die in der Regel zu Katastrophen führte.
Der Grund seines Sinneswandels lag auf der Hand – der Zauderer hatte wieder einmal Angst vor einer mutigen, weitreichenden Entscheidung, die in der Tat gewisse Risiken barg. Aber ohne kalkulierte Risiken, das hatte ihm Manstein immer wieder erklärt, funktioniert keine erfolgreiche Kriegsführung. Zu Hitlers Ärger gab der bisherige Verlauf des Russlandfeldzugs Manstein recht. Dennoch wollte er Operation Zitadelle, deren Initiator und größter Befürworter Manstein war, heute beerdigen.
In Erwartung einer scharfen Erwiderung richtete Hitler seinen Blick auf den Feldmarschall. Doch der schwieg. Er wollte erst die anderen reden lassen und seinen Trumpf bis zum Schluss aufheben.
Die peinliche, lange Sekunden währende Stille wurde von einer unüberhörbar aus Westpreußen stammenden Stimme beendet. Der Stimme von Guderian. »Ich bin diesbezüglich, zumindest teilweise, durchaus Ihrer Ansicht, mein Führer. Die Panzertruppe ist von den harten Winterschlachten erschöpft und braucht eine Pause zur Auffrischung. Außerdem müssen neue Rekruten ausgebildet werden. Durch eine Verschiebung von Zitadelle können wir weitere Waffen und Soldaten an die Front bringen. Danach aber sollten wir unbedingt am Kursker Bogen angreifen, bevor uns die Russen zuvorkommen. Mein Vorschlag: Wir bilden einen Schwerpunkt und konzentrieren sämtliche Panzereinheiten auf einem der beiden Flügel.« Der Inspekteur der Panzertruppe stemmte seine Hände in die Hüfte, sein breites, listiges Gesicht sah erwartungsvoll in die Runde.
»Verschieben? Wieder einmal? Was für eine … krasse Fehlentscheidung!« Günther von Kluge bekam große Augen und stolperte vor Aufregung über seine eigenen Worte. »Dann auch noch wegen des Gejammers irgendeines Armeegenerals? Ich muss schon bitten, mein Führer. Werden die Heeresgruppen-Kommandeure denn überhaupt nicht mehr gefragt?« Rot vor Zorn donnerte Kluge mit der flachen Hand auf die Kante des Kartentischs, dass die roten und blauen Fähnchen, die auf der Karte Freund und Feind voneinander trennten, in die Luft sprangen und ihre zugewiesenen Positionen aufgaben. Kluge in Hochform. Manstein kannte den temperamentvollen Preußen gut und wusste, dass der Feldmarschall es hasste, wenn er übergangen wurde. Schon gar nicht von einem rangniedrigeren Offizier. Kluges ohnehin schmaler Mund verengte sich zu einem Schlitz. »Ich halte die pessimistischen Folgerungen Models für übertrieben und bin für einen sofortigen Beginn von Zitadelle. Ein erneutes Verschieben bringt dem Feind mehr Vorteile als uns, weil er in der Zwischenzeit seine Truppen und Stellungen um ein Vielfaches mehr verstärken kann als wir. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass uns die Russen zuvorkommen und möglicherweise den Orel-Bogen im Bereich meiner Heeresgruppe Mitte stürmen. Dann müssten wir Einheiten von der Kursker Front abziehen und diese entscheidend schwächen.« Kluge sah Hitler in die Augen. »Nein, mein Führer, ich bin ganz und gar nicht Ihrer Meinung.«
Von Mansteins Platz aus sah man durch die hohen Fenster hinab auf die Brienner Straße, wo das Palais Barlow, die Parteizentrale der NSDAP, und die beiden Ehrentempel mit ihren quadratischen Säulen zu erkennen waren. Das Palais stammte aus dem beginnenden 19. Jahrhundert und diente als Adelswohnsitz, bevor es 1930 die Nationalsozialisten übernahmen. Was seine geschmackvolle klassizistische Fassade erklärte. Hingegen entstanden die Ehrentempel auf Initiative Hitlers zum Gedenken an die Gefallenen seines misslungenen Putsches von 1925. Vor den Eingängen der beiden protzigen, keinem Stil zuzuordnenden Bauwerke hatte man Ehrenwachen postiert, vor denen jeder, der an den Tempeln vorbeiging, die rechte Hand zum Gruß heben musste.
Hitlers Stimme und sein rollendes R fingen Mansteins Gedanken wieder ein. Der Feldmarschall wusste, was jetzt kommen würde. Wenn Hitler von seinen Generälen mit den besseren Argumenten militärstrategisch ausmanövriert und in die Ecke gedrängt wurde, wechselte er das Terrain und begab sich auf die politische Ebene. Dort fehlten den Generälen aufgrund von Hitlers Geheimniskrämerei die nötigen Informationen, um dagegenhalten zu können. Auf diese Weise konnte der Führer Argumente in die Diskussion bringen, deren Wahrheitsgehalt sich nicht überprüfen ließ und die kaum zu entkräften waren. Es war ein Merkmal von Hitlers unsäglichem Führungsstil, seine Umgebung über seine Pläne im Dunklen zu lassen. Damit brauchte er sich nicht festzulegen und konnte jederzeit seine Absichten wechseln.
Tatsächlich ging Hitler zur Situation in Südeuropa über. Die Niederlage der Wehrmacht in Afrika zeichne sich ab, danach hätten die Alliierten genügend Truppen zur Verfügung, um in Süditalien oder Griechenland zu landen. In diesem Fall benötige er alle verfügbaren deutschen Einheiten, auch die für Zitadelle vorgesehenen. Der italienische Bundesgenosse wackle, durch einen möglichen Kriegseintritt Italiens an der Seite der Alliierten könnte sich diese Situation noch verschärfen. Immer wieder blickte Hitler, während er sprach, Manstein an, dessen Schweigen ihn sichtlich aus dem Konzept brachte. Nervös fuhr er an seiner Hosennaht entlang. »Nun … Herr von Manstein, Sie haben sich bis jetzt noch nicht geäußert. Wie beurteilen Sie die Situation?«
»Ich schließe mich den Herren Zeitzler und von Kluge an, mein Führer«, sagte Manstein ruhig, füllte seine Lungen mit Sauerstoff und warf einen letzten Blick hinaus in den Frühling. »Außerdem gebe ich zu bedenken, dass sich die russische Armee jeden Tag besser von den im Winter erlittenen Verlusten erholt und sowohl ihre Moral als auch ihren Kampfwert steigert. Wie Herr von Kluge sehe auch ich die Gefahr eines russischen Angriffs vor Beginn von Zitadelle. Meines Erachtens jedoch eher im Bereich meiner Heeresgruppe Süd«, er fuhr mit der Hand über die auf dem Tisch ausgebreitete Landkarte, »die hier weit ins Donez-Becken hineinragt. Dieser Frontvorsprung fordert die Russen geradezu heraus, ihn mit einer Offensive abzuschneiden. Auch aus diesem Grund sollte Zitadelle so schnell wie möglich stattfinden.«
Hitler verzog keine Miene, er hatte keine andere Antwort erwartet. Das wird sich gleich ändern, dachte Manstein. »Nicht nur Sie, mein Führer, auch Ihre Generäle können in politischen Dimensionen denken und wissen um eine bevorstehende alliierte Landung in Südeuropa. Gerade deswegen müssen wir mit Zitadelle unbedingt losschlagen, bevor diese Landung erfolgt. Und nicht warten, bis wir überrascht werden.«
Ein Funkeln in Hitlers schwarzen Rabenaugen bestätigte, dass Mansteins Anspielung getroffen hatte. »Was meint die Luftwaffe dazu?«, knurrte er, auf Hilfestellung von Jeschonnek hoffend.
Doch Görings gutaussehender, schlanker Generalstabschef, der ungeschminkt auf jedes Werbeplakat für Haarwasser oder Frisiercreme passen würde, setzte wie immer sein gewinnendes Lächeln auf und erklärte ohne mit der Wimper zu zucken: »Auch wir sehen keine weitere Verstärkung unserer Verbände im Falle eines Aufschubs. Luftflotte 6 steht im Norden unter Generaloberst von Greim bereit, Luftflotte 4 im Süden unter Feldmarschall von Richthofen. Unsere Aufklärung zeigt, dass die Russen an der Südfront tatsächlich eine Offensive vorbereiten. Je früher Zitadelle losgeht, desto besser. Wir können zwar nur achtzehnhundert Flugzeuge gegen die doppelte Anzahl des Feindes einsetzen, verfügen aber über die besseren Maschinen und Piloten, die darüber hinaus mehr Einätze pro Tag fliegen können als die Russen.«
Das Funkeln in Hitlers Augen verwandelte sich in ein böses Blitzen. Unruhig trat er von einem Bein aufs andere. Dass sich selbst Jeschonnek so offen gegen den Führer stellte, überraschte Manstein. Leuchtete doch der Stern des Generalobersts schon lange nicht mehr so hell am nationalsozialistischen Firmament. Die personell und materiell total überforderte Luftwaffe konnte Hitlers utopische und von Göring großspurig zugesagten Forderungen schon seit Jahren nicht mehr erfüllen. Und anstatt seinen unschuldigen Stabschef zu decken, machte Göring Jeschonnek zum Sündenbock. Die letzte Ohrfeige erhielt er vergangenen Winter, als die Luftwaffe trotz übermenschlicher Anstrengungen die von Göring versprochene Versorgung der 6. Armee in Stalingrad nicht gewährleisten konnte.
Hitler nahm eine gläserne Wasserkaraffe und goss sich ein Glas ein. Da der Führer keinen Kaffee mochte, gab es während solcher Besprechungen nichts als Leitungswasser zu trinken. Manstein seufzte. Ein starker Kaffee hätte ihm jetzt gutgetan. In München existierten auch im fünften Kriegsjahr kleinere Röstereien, die sich ihre Bohnen über irgendwelche Umwege aus Südamerika oder Afrika organisierten und feinsten Kaffee daraus fabrizierten. Manstein war sich sicher, dass genügend Päckchen davon irgendwo hier im Führerbau gehortet wurden.
Hitler stellte sein Glas ab und musterte die Anwesenden. Sein Blick ging von Mann zu Mann, bis er an Manstein hängen blieb. »Es wundert mich, Herr Feldmarschall, dass gerade Sie gegen das Schlagen aus der Hinterhand sind. Soweit ich mich erinnere, hatten Sie zu Beginn der Planung für Zitadelle sogar ausdrücklich dafür plädiert.« Ein schwacher Schatten von Triumph glitt über Hitlers Gesicht. Sein Gedächtnis war legendär. Er konnte Produktionszahlen und Statistiken herunterbeten und vergaß auch nach Jahren nicht das kleinste Detail.
»Das ist korrekt, mein Führer, es bezog sich jedoch nicht auf den Kursker Bogen, sondern auf das Donez-Becken. In diesem weiten Raum können wir den Sowjets ausweichen, sie ausbluten lassen, einkesseln und dann mit dem Rücken zum Schwarzen Meer vernichten.« Manstein schenkte sich ebenfalls ein Glas Wasser ein. Die Pause als Waffe beherrschte er mittlerweile genauso gut wie der Führer. »Dazu ist aber eine bewegliche Operationsführung notwendig, und man muss zunächst Gelände preisgeben. Beides lehnten Sie damals ab, weil Sie kein Vertrauen mehr in die Kriegskunst Ihrer Generäle haben.«
Hitlers Gesichtsfarbe nahm die der dunkelroten Vorhänge an. Seine Mundwinkel zuckten, noch beherrschte er sich.
»Aus diesem Grund«, fuhr Manstein fort, »bleibt jetzt nur der Angriff, das Schlagen aus der Vorhand.« Ein Schluck Wasser. »Was ich übrigens bereits im März vorschlug, als der Boden noch gefroren war und unsere Panzer getragen hätte.«
Wieder einmal wurde der Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht vorgeführt. Man musste kein Psychologe sein, um zu sehen, dass Hitler wie ein Topf brodelnden Wassers kurz vor dem Überkochen stand. Der Führer ballte beide Fäuste und ließ stoßweise Luft ab. »Was Sie alle nicht kennen«, zischte er und senkte drohend wie ein Stier den Kopf, »sind die industriellen und politischen Gegebenheiten. Ich kann die kriegswichtige Industrie am Donez nicht aufgeben, weil das Reich diese Güter und Rohstoffe dringend braucht. Weiterhin hätte das Aufgeben des Donez-Beckens eine fatale Signalwirkung für meine Bündnispartner Rumänien und Bulgarien.«
»Wir würden industrielle und politische Fakten selbstverständlich berücksichtigen, wenn wir sie kennen würden«, antwortete Manstein. »Solange Sie, mein Führer, uns jedoch über Ihre militärischen Ziele im Unklaren lassen und wir die politische Entwicklung aus dem Völkischen Beobachter erfahren müssen, wird uns das nicht gelingen. Ein Dialog zwischen Führung und Generalität wäre wünschenswert und sinnvoll.«
Ein paar Sekunden lang hörte man im Besprechungsraum keinen Laut. Nur das Gezwitscher der Amseln drang durch die gekippten Fenster von außen herein. Niemand wagte zu atmen. Würde Hitler jetzt in einem seiner berüchtigten Wutanfälle wie eine Silvesterrakete durch die Decke gehen?
Der Führer beugte sich über den Kartentisch, presste beide Hände gegen das Holz, als wollte er es zerquetschen, blickte erst nach unten, warf dann den Kopf in den Nacken und verkündete mit bebender, aber beherrschter Stimme: »Da Sie alle offensichtlich so an dieser Operation hängen, sage ich Zitadelle nicht ab, sondern verschiebe sie nur. Und zwar so lange, bis unsere neuen schweren Panzer und Jagdpanzer einsatzbereit sind. Sie werden die Verstärkungen des Russen mehr als ausgleichen. Mein Entschluss steht, es gibt dazu keine Alternative.«
Wieder ein Schluck Wasser.
»Möglicherweise doch, mein Führer.«
Zehn verblüffte Augenpaare fuhren zu Manstein herum. Der Führer hatte das letzte Wort gesprochen, die Besprechung war zu Ende. Wollte der Feldmarschall partout seine Karriere beenden?
Hitler war zu verdutzt für eine scharfe Zurechtweisung und sah Manstein ungläubig an. Der stellte sich vor den Kartentisch und deutete mit je einer Hand auf die beiden Seiten des Kursker Bogens. Der Augenblick war gekommen, um die Angel nach der Forelle auszuwerfen, die vor ihm im Teich schwamm.
»Die Alternative zum geplanten Angriff über die Flanken«, seine Hände wanderten in die Mitte, »ist ein zentraler Stoß in den Kursker Bogen hinein. Zwei Angriffsspitzen. Die 9. Armee und parallel dazu die 4. Panzerarmee. Die Armeegruppe Kempf wird integriert, die 2. Armee deckt die Flanken. Da die Russen zwei Attacken über die Seiten erwarten, werden sie von einem zentralen Stoß überrascht. Unsere Aufklärungsfotos zeigen, dass sie ihre Stellungen in der Mitte des Bogens vernachlässigen und nur schwach ausgebaut beziehungsweise besetzt haben.« Mansteins Hände glitten weiter nach Osten, um sich dort zu teilen. »Nach der Einnahme von Kursk schwenkt die 9. Armee nach Norden, die 4. Panzerarmee nach Süden. Sie bilden gemeinsam mit der 2. Armee zwei Kessel und vernichten die Russen. Die detaillierte Planung habe ich in meiner Aktentasche dabei.«
Zwei, drei Sekunden lang stand die Zeit im Besprechungsraum still. Nur das Kratzen von Stiefelsohlen auf dem Holzboden war zu vernehmen. Danach brach ein Tumult los, wie auf einem Schulhof ohne Aufsicht. Hitler starrte Manstein mit offenem Mund an, Kluge und Zeitzler vergaßen gar in ihrer Entrüstung die Anwesenheit des Führers und gingen, ohne dessen Antwort abzuwarten, wie zwei Wölfe gleichzeitig auf Manstein los.
»Ein Stoß durch die Mitte?«
»Niemals … das wird niemals funktionieren!«
»Sie wollen im Ernst einen Frontalangriff durchführen?«
»Das … das ist doch der reine Irrsinn, völlig undurchführbar!«
»Was denken Sie sich dabei, Herr Feldmarschall?«
Manstein blieb gelassen. »Was ich mir dabei denke? Nun, dass mein Plan kalkulierbare Risiken enthält und die Russen dort trifft, wo sie es nicht erwarten«, antwortete er kühl und drehte sich zu Hitler um. »Außerdem haben Sie, mein Führer, Mitte April selbst die Möglichkeit eines zentralen Stoßes in Verbindung mit einem Hauptangriff von Norden prüfen lassen.«
Die Forelle hatte den Angelhaken gesehen und umkreiste ihn neugierig, zeigte sich aber nervös und voll Misstrauen.
Hitlers Zähneknirschen drang durch den ganzen Raum. »Sie haben Ihre Hausaufgaben gut gemacht, das muss ich Ihnen lassen, Herr von Manstein. Aber Ihr Plan … dieser Plan ist völlig undurchführbar.«
»Da bin ich mir nicht so sicher, mein Führer.« Guderian hatte bis jetzt nur die Augenbrauen zusammengezogen, angestrengt die Landkarte fixiert und noch nichts zu Mansteins Variante gesagt. »Sie wissen alle, meine Herren, dass mir als Panzergeneral der überraschende, schnelle Angriff stets die liebste Option ist. Ich gebe dem Plan des Herrn Feldmarschalls deshalb eine realistische Chance. Lassen Sie mich erklären weshalb.« Der Generaloberst berührte mit seinem linken Zeigefinger seinen rechten ausgestreckten Daumen. »Erstens schrumpft die dreifache Überlegenheit der Russen bei der Anzahl der Panzer auf die zweifache, wenn man unsere Panzerjäger und Sturmgeschütze dazuzählt.« Er streckte seinen rechten Zeigefinger aus. »Zweitens kann die Panzertruppe zusätzlich hundertfünfzig Tiger, zweihundert der neuen Panther und neunzig Ferdinand-Panzerjäger bereitstellen.« Der Mittelfinger kam an die Reihe. »Drittens besitzen unsere fast siebenhundert Panzer IV inzwischen die stärkere 7,5-Zentimeter-Langrohrkanone und sind damit dem T-34 ebenbürtig, der ohnehin nur zwei Drittel der russischen Panzer stellt.«
»Was ist mit den neuen, anscheinend so gefährlichen Panzerbüchsen der Russen?«, platzte Kluge dazwischen.
Guderian grinste schelmenhaft und streckte seinen rechten Ringfinger aus. »Und viertens haben sich die neuen Seitenschürzen der Panzer IV bei Versuchen bestens gegen Nahkampfmittel bewährt.«
Die Forelle näherte sich mit einer kräftigen Bewegung ihrer Schwanzflosse dem Angelhaken, an den Guderian unbeabsichtigt einen fetten Köder gehängt hatte. Noch zögerte sie, zuzuschnappen.
Hitler hatte den Ausführungen des Inspekteurs der Panzertruppen mit wachsendem Interesse zugehört. Was Manstein nicht überraschte, denn der technikvernarrte Führer vertrat die Meinung, dass die überlegenen deutschen Waffen die zahlenmäßige Unterlegenheit der Wehrmacht auf jedem Kriegsschauplatz mehr als wettmachten. Eine am Kartentisch geborene Illusion.
In diesem Moment landeten zwei weitere Angelhaken im Teich: die von Zeitzler und Kluge. Mit bebender Stimme wiesen beide Generäle auf das Rückgrat der sowjetischen Armee hin, deren moderne, zahlenmäßig haushoch überlegene Artillerie, die Mansteins Angriff in Stücke schießen würde. Außerdem hätte ein zentraler Stoß lange Flanken zur Folge, ein gefundenes Fressen für die schnellen russischen Panzerkorps.
Der Feldmarschall hatte beide Gegenargumente erwartet und sich darauf vorbereitet. »Die russische Artillerie ist nach Norden und Süden auf die Flanken des Kursker Bogens ausgerichtet.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf die Landkarte. »Wenn wir durch die Mitte angreifen, packen wir sie von hinten und berauben sie damit ihrer Wirkung. Und die zugegeben langen Flanken decken wir durch die schwächeren Infanteriedivisionen.«
»Dann haben Sie für Ihre Angriffsspitze zu wenig Truppen«, entgegnete der gewiefte Stratege Zeitzler.
»Nicht, wenn ich dort zusätzlich zu meinen eigenen Reserven auch noch die von Models 9. Armee und die der Heeresgruppe Mitte zum Einsatz bringe.«
Kluges Augen traten noch ein Stück weiter aus ihren Höhlen und gaben seinem Gesicht etwas Fischiges. »Sämtliche Reserven einsetzen?«, rief er aufgeregt und fuchtelte mit den Händen vor Manstein herum. »Damit dünnen Sie den gesamten südlichen Bereich der Ostfront dermaßen aus, dass Sie einem russischen Angriff dort nichts entgegenzusetzen hätten. Die Russen könnten sogar bereits während des zeitraubenden Umgruppierens angreifen, das Ihr Plan voraussetzt. Was machen Sie dann?«
»Dann, lieber Herr Kollege, weichen wir erst einmal zurück, überlassen dem Feind vorübergehend das Donez-Gebiet und schnappen ihn uns, wenn Zitadelle gewonnen ist.« Manstein nahm einen langen Schluck aus seinem Wasserglas und fixierte Hitler. »Ich rechne damit, dass Kursk nach zwei Tagen eingenommen ist und beide Kessel nach zwei weiteren Tagen vernichtet sind. Ein derart schneller und umfassender Sieg wird uns für eine gewisse Zeit die operative Handlungsfähigkeit an der Ostfront zurückgeben. Ich darf Sie daran erinnern, mein Führer, dass die Wehrmacht 1941 zu Beginn des Russlandfeldzugs schon einmal um ein Vielfaches unterlegen war. Der Feind besaß damals zweimal so viele Flugzeuge und dreimal so viele Panzer. Dennoch standen wir bald vor Moskau.«
In diesem Moment biss die Forelle zu und hing am Haken. Jetzt galt es, die Angelschnur behutsam einzuholen und zu verhindern, dass sie riss. Denn noch gab die Forelle nicht auf und wehrte sich.
Hitler mäkelte am launischen Mai-Wetter herum und an den für die Panzerwaffe notwendigen trockenen Pisten. Er zeigte auf die Flüsse und die Höhen vor Kursk, die sich den deutschen Angreifern entgegenstellten. Natürliche Hindernisse, leicht zu verteidigen. Die Gesichtsmuskeln des Führers zuckten, seine Nackenmuskulatur arbeitete, die Rabenaugen hetzten über die Landkarte. Seine Gedanken standen in der Luft wie Schrifttafeln: Einerseits lockte ihn die Aussicht auf einen schnellen, großen Sieg mit weitreichenden Folgen. Andererseits scheute sein zaudernder Charakter das damit verbundene Risiko. Und er hasste Manstein. Dessen preußisch-aristokratisches Gehabe, dessen militärisches Können, dessen Selbstbewusstsein. Jeder im Besprechungsraum traute ihm zu, dass er einzig und allein deswegen Manstein auflaufen lassen würde.
Dann wurde Hitler auf einmal ruhig. Offenbar hatte er einen Entschluss gefasst. Er fing Mansteins Blick auf. »Ihr Plan, Herr Feldmarschall, ist kühn und durchaus erfolgversprechend. Sollte er allerdings misslingen, wird er abertausende von deutschen Soldaten das Leben kosten. Unnötigerweise. Weil Sie einen Fehler gemacht haben.« Zwei Sekunden Pause, ein Schluck Wasser. »Deshalb stelle ich Ihnen folgende Frage: Wenn Sie so von Ihrem Plan überzeugt sind, würden Sie dafür auch ihr eigenes Leben, ihre eigene Existenz riskieren?«
Aus dem Augenwinkel heraus sah Manstein, wie draußen auf der Brienner Straße ein Fußgänger von einem Posten der Ehrenwache zusammengestaucht wurde, weil er beim Passieren der Tempel nicht den rechten Arm gehoben hatte. Beider Schicksal entschied sich in dieser Sekunde. Seines und das des Passanten. Nur, dass die Auswirkungen für Manstein gravierender waren. Militärisch, persönlich. Unter Umständen lebensbedrohend. Zehn Augenpaare richteten sich auf ihn, untermalt vom unschuldigen Gezwitscher der Amseln. Würde der Feldmarschall kneifen?
Ein Raunen ging durch den Raum, als Manstein erwiderte: »Unter der Bedingung, dass ich vollkommen freie Hand bekomme, bin ich einverstanden, mein Führer.«
Hitlers Augen blitzten auf. »Genehmigt. Als Angriffszeitpunkt lege ich den 5. Juni fest. Sie dürfen tun und lassen, was Sie für richtig halten, um Ihrem Plan zum Erfolg zu verhelfen.« Die Forelle war gefangen. Ob der Preis zu hoch war, würde sich bald herausstellen. »Sollte es sich jedoch abzeichnen«, fuhr Hitler fort, »dass Ihr Vorhaben misslingt, befehle ich Ihnen hiermit ausdrücklich, das Unternehmen Zitadelle sofort abzubrechen und sämtliche Divisionen in ihre Ausgangsstellungen zurückzuführen. Tun Sie das nicht, sehe ich mich gezwungen, Sie wegen Befehlsverweigerung vor ein Kriegsgericht zu stellen.«
Kapitel 2
Anfang Mai 1943, Nürnberg, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, MAN
Der Schrecken wog 26 Tonnen, erwies sich als schnell, robust, zuverlässig, schwer bewaffnet und hieß T-34. Als dieser Panzer im Sommer 1941 zu Beginn des Russlandfeldzugs vor den deutschen Angriffsspitzen auftauchte, war er zu diesem Zeitpunkt allen Panzern der westlichen Welt weit überlegen. In vorbildlicher Weise vereinigte er Beweglichkeit, Schutz und Feuerkraft.
Die deutschen Panzerdivisionen hatten dem T-34 zunächst nichts entgegenzusetzen. Ihre Panzer III und IV mussten mit ihren kurzen Stummelkanonen auf mindestens hundert Meter an ihn herankommen, konnten aber schon jenseits von fünfhundert Metern selbst abgeschossen werden. Sie stellten die letzten Vorkriegsentwicklungen dar und waren im Grunde alte Eisen.
Kein Wunder, dass in allen Wehrmachtsstäben bis hinauf zum Heereswaffenamt die Alarmglocken schrillten. Denn auf einen Schlag wurde das Versäumnis der Deutschen deutlich: Von den überwältigenden Erfolgen der Blitzkriege gegen Polen und Frankreich in Sicherheit gewogen, sahen sie keinen Grund, oberhalb der bewährten Panzertypen ein neues, stärkeres Modell zu entwickeln. Die wenigen Entwürfe zu diesem Thema kamen über das Stadium von Prototypen nicht hinaus. Was also tun gegen die neue Bedrohung? Schnell war klar, dass alle Bemühungen einer Kampfwertsteigerung der Panzer III und IV keine Perspektive besaßen. Wenn man der deutschen Panzertruppe ihren früheren technischen Vorsprung wiedergeben wollte, musste man ihr neue Typen zur Verfügung stellen. Deshalb stieß auch der Vorschlag von Frontoffizieren, den T-34 einfach nachzubauen, auf Ablehnung. Was die Wehrmacht brauchte, war ein neuer überlegener, schwerer Kampfpanzer.
Und so erhielt bereits im Juli 1941 der Waffenhersteller Rheinmetall-Borsig in Düsseldorf den Auftrag für einen Panzerturm und eine Kanone mit einer Durchschlagsleistung von hundertvierzig Millimeter Panzerung auf tausend Meter Entfernung. Mit der Konstruktion des Fahrgestells wurden im November 1941 die Daimler-Benz AG in Berlin und die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, MAN, beauftragt. Der Panther, wie der neue Panzer heißen würde, sollte maximal sechsunddreißig Tonnen wiegen und mit einem Siebenhundert-PS-Motor auf der Straße mindestens fünfzig Stundenkilometer schnell sein.
Anfang Mai 1942 lagen die Konstruktionszeichnungen für beide Modelle vor. Die Vorschläge von Daimler-Benz und MAN hätten verschiedener nicht sein können: Der Daimler-Benz-Panther sah dem T-34 täuschend ähnlich – vorn am Chassis aufgesetzter eigener Turm, abgeschrägte Seiten und Front, Blattfederung, Dieselmotor, Heckantrieb. MAN hingegen entwarf einen Panther mit mittig platziertem Rheinmetall-Turm, Drehstabfederung, Benzinmotor, Frontantrieb und ebenfalls abgeschrägter Panzerung. Beide Modelle wogen dabei fünfundvierzig Tonnen und waren mit der neuen 7,5-Zentimeter-Kanone 42 L/70 von Rheinmetall-Borsig bewaffnet. Für den Daimler-Panther sprachen der sparsame Dieselmotor, die niedrige Bauhöhe, die einfache Wartung der Blattfedern und der wegen des Heckantriebs geräumigere Kampfraum. Auf der Habenseite der MAN-Variante standen aufgrund der größeren Tanks die höhere Reichweite, der Fahrkomfort der Drehstabfederung, der leichte und kompakte Benzinmotor sowie die direkte Bedienung von Lenk- und Schaltgetriebe des Frontantriebs.
Hitler stimmte sofort für den Daimler-Panther, der unter dem Strich das gefälligere Modell war. Das Problem: Daimler-Benz konnte zu diesem Zeitpunkt weder den Dieselmotor noch den Turm liefern. Dagegen standen für MAN das bewährte Zwölfzylinder-Triebwerk von Maybach sowie der neue Rheinmetall-Turm zum Einbau bereit. Da das ganze Projekt unter enormem Zeitdruck durchgepeitscht wurde und die ersten Panther nur ein Jahr später, im Mai 1943, zur Truppe gelangen sollten, entschied sich der Panther-Ausschuss unter Vorsitz von Oberst Thomale und Professor von Eberhorst für die MAN-Konstruktion.
Dass nicht einmal acht Monate später in Nürnberg die ersten vier Panther ausgeliefert werden konnten, war in jener Zeit der Materialknappheit und begrenzten Fertigungskapazitäten eine herkulische Leistung der Heeres- und Rüstungsstellen sowie der Industrie. Zwei Fahrzeuge bekam die Panzerabteilung 51 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr zu Schulungszwecken, eines die Heeresversuchsstelle Kummersdorf zur Erprobung, das vierte blieb bei MAN.
Ab diesem Zeitpunkt lief die Panther-Fertigung parallel in vier Werken an: bei Henschel in Kassel, bei Daimler-Benz in Berlin, bei MNH in Hannover und bei MAN in Nürnberg.
Federführend als Konstrukteur blieb MAN. Das Unternehmen hatte sich in nicht einmal zwanzig Jahren von einer mittelständischen Maschinenfabrik zu einem der wichtigsten deutschen Motoren- und Waffenhersteller entwickelt.
Der Startschuss zu diesem phänomenalen Durchmarsch fiel 1898. In diesem Jahr fusionierte die Maschinenfabrik Augsburg mit der Nürnberger Eisengießerei und Maschinenfabrik Klett zur MAN. Zunächst betätigte sich das neue Unternehmen im zivilen Sektor, baute die Wuppertaler Schwebebahn und die Müngstener Brücke bei Solingen, die höchste deutsche Eisenbahnbrücke. 1915 fusionierte MAN mit dem Schweizer LKW-Hersteller Sauerer und belieferte erstmals auch die Reichswehr. Die Geschäfte liefen hervorragend, aus vierhundert Arbeitern zauberte man zwölftausend. Nach dem Ersten Weltkrieg belasteten jedoch Reparationszahlungen MAN erheblich. Die Zahl der Beschäftigten sank auf siebentausend. Durch die Weltwirtschaftskrise brach das zivile Geschäft komplett ein, die Firma stand vor dem Aus. Dann kamen 1933 die Nationalsozialisten an die Macht. Sie starteten ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm und vergaben an MAN Großaufträge für U-Boot-Dieselmotoren, Panzer, Kanonen und Granaten. MAN war gerettet, in den riesigen roten Backsteinhallen am Stammsitz Nürnberg liefen die Maschinen auf Hochtouren.
Eine dieser Hallen war das Ziel des jungen, dunkelhaarigen Mannes, der Anfang Mai die Tür des Konstruktionsbüros hinter sich schloss und den Fabrikhof überquerte. Seine schlanke Gestalt passte gut zu seiner drahtigen Figur, der man ansah, dass sie selten ruhte und meistens in Bewegung war. Deshalb hatte man dem jungen Mann den Spitznamen Der Hai gegeben. Haie atmen, indem sie bei geöffnetem Maul Wasser und damit Sauerstoff über ihre Kiemen streichen lassen. Wenn sie nicht ersticken wollen, müssen sie ständig schwimmen.
Zunächst passierte der junge Mann eine Reihe von flachen, weiß getünchten Produktionshallen, in denen die Teile hergestellt wurden, die MAN selbst für den Panther fertigte. Ihre Dächer sahen aus wie die Zähne einer Säge und ließen durch schräggestellte Fenster das Tageslicht von oben ins Innere. Unübersehbar stachen die Schäden der Bombenangriffe ins Auge – von Ruß geschwärzte Fassaden, eingestürzte Mauern, zugeschüttete Bombentrichter, aufgehäufte Ziegelsteine, durch Sperrholz ersetzte Glasscheiben, die den Fensterfronten das Aussehen eines Schachbretts gaben. Kaum ein Monat verging ohne Bombenalarm. Tagsüber kamen die Amerikaner, nachts die Briten.
Wie immer, wenn der Hai an der Trafostation vorbeikam, hielt er kurz inne und betrachtete die Tafel mit den Namen der bei den Angriffen ums Leben gekommenen MAN-Leute. Es waren viele. Zu viele. Die meisten kannte er. Bis jetzt hatte der Hai Glück gehabt. Immer wenn die Bomben fielen, hatte er keine Schicht. Aber das konnte sich jederzeit ändern.
Schon von weitem drang das Knallen, Schlagen, Hämmern, Donnern, Kreischen und Jaulen aus der circa hundertsechzig mal siebzig Meter großen roten Backsteinhalle an seine Ohren. Eine von drei Hallen, fast doppelt so groß wie ein Fußballfeld, in denen der Panther montiert wurde. Wie die Druckwelle einer Explosion fiel der tosende Lärm über den Hai her, als er die massive Eisentür öffnete und ins Halleninnere trat. Auch nach den zweieinhalb Jahren, die er inzwischen bei MAN arbeitete, hatte er sich nicht an diese wahnsinnige Lautstärke gewöhnt. Er massierte kurz sein Trommelfell und ging dann an der Vormontage entlang, wo die von anderen Herstellern gelieferten Baugruppen geprüft und zusammengesetzt wurden. Turm und Waffe kamen von Rheinmetall aus Düsseldorf, der Motor von Maybach, das Lenkgetriebe von ZF, beide aus Friedrichshafen. Die Seiten-Höhenrichtmaschine stammte von Lohmann aus Litzmannstadt, die Schwingarme von den Siepmann-Werken aus Belecke am Möhnesee, die Ketten vom Altmärkischen Kettenwerk, Alkett.
Ein paar Meter weiter standen zwei aufgebockte Panzerwannen an zwei Bohrwerken, die mittels acht Spindeln die Löcher für das Laufwerk bohrten. Gegenüber machte sich eine Säulenbohrmaschine unter schrillem Heulen daran, ein Turmgehäuse mit Öffnungen zu versehen. Glühende Metallspäne flogen durch die Luft, schmutzig weiße Kühlflüssigkeit tropfte auf den Betonboden. Ein ätzender Geruch drang dem Hai in die Nase, als ob jemand heißes Metall in saure Milch geworfen hätte.
Dem Funkenregen einer Trennscheibe ausweichend, quetschte er sich an der Station vorbei, welche die Bohrungen für Seitenvorgelege und Leitradschwinge anbrachte, dann erreichte er eine gewaltige U-förmige Maschine, die gerade den Sitz des Turmdrehkranzes einer darunter aufgebockten Wanne ausfräste.
Schließlich gelangte er zum Beginn der Fertigungslinie, wo die vorbereiteten Wannen mittels eines Krans, der an massiven Laufschienen an der Decke hing, sowie Zügen und Umlenkrollen auf die Taktstraße gehievt wurden. Dort erfolgte an mehreren Stationen die Endmontage der kompletten Fahrgestelle, bevor diese vorn und hinten angehoben und auf die Ketten gestellt wurden. Ganz am Ende der Taktstraße setzte ein weiterer Kran den Turm auf das Fahrgestell. Damit war der Panther fertig und konnte von einem Heeresinspekteur abgenommen werden.
Der Hai sprang über eine am Boden ausgelegte Panzerkette und erreichte die Abteilung, welche die Seitenvorgelege montierte. Hier im hinteren Teil der Halle war der Lärm erträglicher, man konnte sich sogar unterhalten, wenn man seine Stimmbänder genügend strapazierte. Ein dicker und zwei dünne Arbeiter waren gerade dabei, die letzten Schrauben eines Seitenvorgeleges festzuziehen, das sie am Bug eines Panther fixiert hatten. Als der Dicke den Hai kommen sah, legte er seinen Drehmomentschlüssel auf den Boden, fuhr sich mit der Hand über die schweißnasse Stirn und grinste ihn herausfordernd an. »Na, Herr Dokter, misch’mer uns mal wieder unters g’meine Volk?«
Sein Gegenüber grinste zurück. »Sie sollen mich nicht immer Doktor nennen, Herr Obermaier. Sie wissen doch, ich bin nur ein kleiner Ingenieur. Es gibt hier nur einen Doktor. Und den muss ich gerade Gott sei Dank nicht sehen.«
Alfons Obermaier, Werksmeister und eingeborener Franke, zog seine Mundwinkel noch ein Stück höher und sagte schelmisch. »Ja, ja, unser Chef, der is’ immer für a schlechte Nachricht gut. Und Sie, mein lieber Herr Janssen, sind zwar tatsächlich bloß a einfacher Ingenieur, versteha aber mehr vom G’schäft als der gute Dokter Pauli.«
»Das mag schon sein«, antwortete Joachim Janssen mit unverkennbar hanseatischem Zungenschlag, »aber was nützt es? Dr. Pauli ist nun mal Konstruktions- und Fertigungsleiter.« Er straffte die Schultern und deutete auf die Pantherwanne. »Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Wie sieht es denn mit den Vorgelegen aus? Immer noch derselbe Ärger?«
Obermaier nickte. »Der gleiche Mist wie bisher. Die brecha bei der Truppe in Grafenwöhr schneller, als die sie dort austauschen könna. Des Einradien-Lenkgetriebe is’ halt nix für den Panther.«
»Sie sagen es, Herr Obermaier.«
Bei einem Panzer wird eine Kurve eingeleitet, indem die kurveninnere Kette abgebremst wird. Für enge Kurven wird die Kette ausgekuppelt. So kann der Panzer in jedem Gang eine Kurve mit einem bestimmten Radius fahren. Daher die Bezeichnung Einradien-Lenkgetriebe. Je kleiner der Gang, desto kleiner der Radius. Beim Panther betrug der kleinste Radius immer noch achtzig Meter. Zu viel für scharfe Kurven, weshalb mit Kettenbremse und schleifender Kupplung nachgeholfen werden musste. Dabei traten Kräfte auf, welche die Seitenvorgelege überforderten. Die saßen links und rechts außen am Bug oder Heck eines Panzers und dienten dazu, die Antriebsdrehzahl des Lenkgetriebes auf das Triebrad der Kette zu untersetzen.
»Den Grund, dass die Dinger ständig kaputt gehen, kennen wir alle«, fuhr Janssen fort und steckte beide Hände in die Taschen seines hellgrauen Arbeitskittels. »Wegen der Materialknappheit bekommen wir miesen Stahl, und der ist so spröde, dass die beiden Stirnradpaare, die die Kräfte übertragen, brechen. Außerdem gehen die Lager kaputt. Ein Umlaufgetriebe wäre deshalb besser, weil es die Zahnräder nicht so belastet.« Er blickte zum Hallendach, als käme von dort göttliche Hilfe. »Aber Dr. Pauli will das nicht bauen. Wegen der Zeitverzögerung. Deshalb habe ich ihm ja auch vorgeschlagen, einfach die Stirnräder dicker zu dimensionieren und die Lager zu verstärken.«
»Soll ich rat’n?«, sagte Obermaier sarkastisch. »Der Pauli will net. Wega der Zeitverzögerung.«
»Genau. Weil die stärkeren Zahnräder extra bei ZF bestellt werden müssten.«
»Aber des kost’ Zeit. Und die hat der Pauli net. Der hat nur Angst vorm Speer und dem Ministerium und will auf Teufel komm raus die Termine halta. Selbst wenn er dafür Murks an die Truppe ausliefert.«
Janssen kickte einen beim Erkalten dunkelblau angelaufenen Drehspan zur Seite. »Ich kann ihn ja in gewisser Weise verstehen. Keine Nullserie, keine Erprobungsfahrzeuge. Der Zeitdruck ist immens. Bei den Zulieferern und in der Endfertigung gibt es laufend Probleme, weil Material, Maschinen und Arbeitskräfte fehlen. Dann müssen wir die Produktion ständig anhalten, weil die Änderungswünsche der Truppe direkt von Grafenwöhr aus kommen und sofort berücksichtigt werden sollen. Deshalb hinken wir dem Zeitplan sowieso schon gewaltig hinterher.«
Obermaier steckte die Daumen in den Ledergürtel vor seinem gewaltigen Bier- und Knödelbauch. »Deswega gibt es ja Chefs. Dass die mal den Kopf herhalta, wenn’s sei muss. Aber der Pauli steckt mit seim Kopf so tief im Anus vom Minister Speer, dass er auch die engsten Termine zusagt, nur um sich ka Blöße zu geba. Dafür nimmt er in Kauf, dass vorn an der Front unsere Leut’ sterb’n, weil ihre Panzer liegableiba.«
»Genauso ist es, Herr Obermaier. Aber was sollen wir machen?«
»Amol den Rauch neilasse, wie man bei uns sagt, Herr Dokter.«
»Vielleicht sollten wir das wirklich mal tun«, sagte Janssen, bevor er dem Werksmeister die Hand gab. Dann machte er sich durch das Inferno in der Halle auf den Rückweg.
*
»Na, da sieht aber jemand mal wieder extrem unzufrieden aus.« Der Mittvierziger mit dem Pferdegesicht und den grau melierten Schläfen sah von dem auf seinem Schreibtisch ausgerollten Bauplan auf und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Kommst du von der Fertigung?«
Janssen knallte die Tür des kleinen Zweimannbüros zu, das er sich mit dem Kollegen Aichinger teilte, als wollte er sie aus der dünnen Holzwand herausbrechen. »Verdammt, Franz, so geht das nicht weiter! Die Vorgelege brechen immer noch, und kein Mensch tut etwas dagegen.«
Franz Aichinger legte den Rechenschieber weg und musterte seinen Kollegen, mit dem er damals nach dessen Ankunft bei MAN sofort Freundschaft geschlossen hatte. Joachim Janssen, genannt der Hai. Sechsundzwanzig Jahre alt, in Hamburg als Sohn eines Ingenieurs und einer Geisteswissenschaftlerin geboren. Vater im Ersten Weltkrieg gefallen. Mutter wurde während der Wirtschaftskrise in den 1920er- und 30er-Jahren arbeitslos, schlug sich seitdem als Kontorangestellte durch. Von ihr hatte Janssen seinen Intellekt und seine soziale Ader, vom Vater die technische Begabung. Keine Einberufung, sondern direkt nach dem Maschinenbaustudium wegen seines Talents und seines exzellenten Abschlusses in den Fächern Motoren und Getriebe zu MAN nach Nürnberg befohlen. Ein integerer Mensch, ein Moralist, der in seinem Beruf eigentlich Gutes tun wollte: Turbinen für Staudämme entwerfen, um abgelegene Regionen mit Strom zu versorgen, Bewässerungsanlagen bauen, um Trockengebiete fruchtbar zu machen, effiziente Schiffsantriebe konstruieren. Oder strapazierbare Getriebe für Feuerwehr und Krankenwagen. Janssens Vater wurde als Offizier im Ersten Weltkrieg verwundet. Wäre er rechtzeitig ins Lazarett gelangt, hätte er überlebt. So aber blieb der Sanka unterwegs mit kaputtem Getriebe liegen, und Janssens Vater verblutete. Dass er, anstatt Menschen zu helfen, nun Kriegsgerät bauen musste, mit dem Menschen umgebracht wurden, ließ den Hai schlecht schlafen.
»Die Vorgelege brechen, als wären sie aus Holz statt aus Stahl, ihre Lager zerspringen.« Janssen stützte sich mit den Händen auf dem Resopalschreibtisch ab, der Kopf an Kopf mit dem von Aichinger stand. An den Stirnseiten des winzigen, fensterlosen Büros hatten sie ihre Zeichenbretter aufgestellt. »Und das ist nicht alles. Aus Grafenwöhr melden sie Motorbrände, Startschwierigkeiten, mangelnde Leistung und unruhigen Motorlauf.«
»Ist ja nun nichts Neues, Joachim«, brummte Aichinger.
»Das ist ja gerade die Sauerei. Pauli weiß das alles und unternimmt nichts dagegen.«
Aichinger verdrehte die Augen. »Auch das ist nichts Neues.«
»Dabei könnten wir die Misere beheben, wenn wir dürften.« Gereizt schwamm der Hai in dem engen Büro auf und ab. Fünf Meter hin, fünf Meter zurück. »Hochwertiger Stahl ist knapp, ebenso Naturkautschuk, Zink und Kupfer. Wir müssten deshalb zunächst die Zahnräder der Vorgelege, die Pleuel und Pleuellager verstärken und dickere Benzinleitungen einbauen. Die Zylinderlaufbuchsen bräuchten glattere Oberflächen und alle beweglichen Teile im Motor geringere Fertigungstoleranzen.« Janssen blieb stehen und hob beide Hände. »Geschieht das nicht, sind Pleuellagerschäden, gebrochene Pleuel und Kolbenfresser unausweichlich. Verdammt nochmal, die Motoren werden im Einsatz keine hundert Kilometer halten.«
Aichinger hatte sich die Tirade des Freundes regungslos angehört. »Wenn die Panther verrecken, müsste das doch ganz in deinem pazifistischen Sinn sein«, sagte er mit sarkastischem Unterton. »Unzuverlässige Panzer, weniger tote Russen.«
»Eben nicht«, schnaubte der Hai und schwamm weiter. »Unzuverlässige Panzer bedeuten tote deutsche Soldaten.«
»Tja, dann sitzt du in der Klemme, du Gutmensch. Entweder tote Russen oder tote Deutsche.«
Janssen ließ sich in den Schreibtischstuhl fallen. »Und was soll ich nun tun, Franz?«
»Was würde dir deine Mutter raten?«
»Wahrscheinlich, dass ich meine Arbeit einfach so gut wie möglich machen soll.«
»Ein weiser Rat. Den ich dir übrigens auch gebe.« Er beugte sich zu Janssen vor. »Hör mal, mein Freund. Wenn du Pauli weiterhin so nervst, ist seine Geduld bald am Ende, und du stehst ruck, zuck in einem Schützengraben an der Ostfront. Was dir Pauli ja schon angedroht hat. Du bist zwar gut, und er braucht dich, aber niemand ist unersetzbar.«
Janssen steckte einen Bleistift in einen großen Metallspitzer, begann ihn gedankenverloren zu drehen und ignorierte die Graphit- und Holzkrümel, die auf die Schreibtischplatte rieselten. »Schon, aber meine Mutter hat mich auch zu Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit erzogen, zu Moral und Verantwortung. Deshalb kann und darf ich kein minderwertiges Gerät bauen, verstehst du?«
»Jetzt pass mal gut auf, du Moralist. Wenn ich als dein Gruppenleiter nicht dauernd meine schützende Hand über dich halten würde, hättest du schon längst einen Stahlhelm auf. Im Gegensatz zu dir kann ich es mir aber leisten, Pauli als Lieblingsfeind zu haben.« Er klopfte mit den Fingerknöcheln auf seine linke Wadenprothese, die ihm 1918 ein englischer Granatsplitter eingebracht hatte. »Wobei die mit Sicherheit irgendwann auch Krüppel an die Front schicken werden. Egal – du solltest dich auf jeden Fall zurückhalten. Tot nützt du den deutschen Panzersoldaten nichts, ebenso wenig deiner Mutter. Wie geht es ihr überhaupt?«
Janssen zuckte die Schultern. »So wie immer. Sie klagt nicht, obwohl das Geld hinten und vorne nicht reicht. Das Loch, in dem sie haust, ist im Winter eiskalt und im Sommer heiß wie die Hölle. Ihr Kontorleiter macht ihr weiterhin den Hof. Er ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Würde sie ihn heiraten, wäre sie alle Sorgen los. Aber sie liebt ihn nicht. Sie liebte nur meinen Vater.«
»Und sie liebt dich. Mach also keinen Scheiß. Übrigens: Von deinem Bleistift ist jetzt gleich nichts mehr übrig, wenn du so weiterdrehst. Pauli könnte das als Vergeudung von kriegswichtigem Material auslegen.«
*
Nach neunzehn Uhr waren die winzigen Büros und schmalen Flure der Konstruktionsabteilung dunkel und leer. Alle Ingenieure, technische Zeichner, Sekretärinnen, insgesamt knapp zwanzig Personen, waren nach Hause gegangen. Alle bis auf Joachim Janssen, der in dieser Nacht für die Bereitschaft eingeteilt war. Falls es während der Nachtschicht technische Probleme gab und man einen Ingenieur brauchte.
Janssen konnte die Stille in dem zweistöckigen Backsteingebäude fast greifen, nur die Geräusche aus den Fertigungshallen drangen ihm gedämpft ans Ohr. Er hatte seinen Arbeitskittel an den Haken gehängt, sich einen Aquavit eingegossen und eine Platte aufgelegt. Aquavitflasche und Plattenspieler verwahrte er in seiner untersten Schreibtischschublade. Für Nächte wie diese. Als er den Kümmelschnaps an die Lippen setzte, musste er lachen. Seine Kollegen hatten dafür nichts übrig. Obstler ja. Und dazu Unmengen von Bier, das sie aus diesen monströsen Krügen tranken. Ihm war trockener Rotwein lieber. So wie er Jazz dieser Blasmusik vorzog, die er sich anhören musste, wenn ihn die lieben Kollegen mal wieder in ein Bierzelt zerrten. Und erst das Essen. Kein Fisch, nur Schweinshaxen oder Schlimmeres. Er schüttelte sich. Als Hanseat in Franken hatte man es nicht leicht.
Auf eine Sache konnte er sich jedoch verlassen: Aquavit und Jazz hatten sich stets als guter Kompost für sein Gehirn bewährt, als wirkungsvolle Dünger für seine Gedanken. Und auch diesmal ließen sie ihn nicht im Stich. Nach dem dritten Aquavit und der fünften Jazzplatte hatte der Hai bezüglich seines moralischen Dilemmas einen Entschluss gefasst. Denn Dr. Ulf Pauli, Konstruktions- und Fertigungsleiter von MAN Nürnberg, würde sich in Kürze für eine Woche in Berlin aufhalten.
Kapitel 3
Anfang Mai 1943, Ostpreußen, Masurische Seenplatte, Bunkeranlage Mauerwald
Die Region Masuren im südlichen Teil Ostpreußens ist Gift für Menschen, die ein ausgeglichenes Klima bevorzugen. Die Winter dort sind lang und kalt, die Sommer kurz und heiß, die Jahreszeiten dazwischen oft nur andeutungsweise vorhanden. Wer keine hohe Luftfeuchtigkeit verträgt, ist in Masuren ebenfalls fehl am Platz. Denn zum einen verregnet es im Durchschnitt jeden dritten Tag, zum anderen sorgen die rund zweitausendfünfhundert masurischen Seen für dauerhaft feuchte Luft. Deshalb sind die Winter feucht, lang und kalt, die Sommer feucht, kurz und warm.
Was die sowohl deutsch-, als auch polnischstämmigen Bewohner Masurens nicht weiter stört, sind sie doch nichts anderes gewohnt. Ganz im Gegensatz zu den Neuankömmlingen, die ab Sommer 1941 ihre Quartiere am Ufer des Mauersees bezogen, des mit rund einhundert Quadratkilometern zweitgrößten Sees Masurens. Die meisten von ihnen kamen aus Deutschland und verwünschten schon bald das anstrengende masurische Klima. Damit erschöpfte sich auch schon der Widerstand gegen die neue Heimat, da man sie bezüglich ihres Umzugs nicht nach ihrer Meinung gefragt hatte. Man hatte sie einfach versetzt. In die neu gebaute Bunkeranlage Mauerwald, in das Hauptquartier des OKH, des Oberkommandos des Heeres.
Nachdem Hitler 1940 im ostpreußischen Rastenburg sein Führerhauptquartier Wolfsschanze eingerichtet hatte, wollte er das bisher in Wünsdorf/Brandenburg residierende OKH in seiner Nähe haben und ordnete, achtzehn Kilometer östlich von Rastenburg, den Bau der Anlage Mauerwald an. Die geriet größer als die Wolfsschanze und umfasste zweihundertfünfzig Gebäude und Bunker, in denen vierzig Generäle mit tausend Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften wohnten und arbeiteten. Unterteilt war Mauerwald in Bezirk Fritz mit allen operativen Dienststellen, Bezirk Quelle mit Verwaltung und Logistik sowie Bezirk Anna, die Fernmeldezentrale.
Was innerhalb der scharf bewachten Anlage kaum jemand wusste: Anfang 1943 war unter strengster Geheimhaltung der militärische Nachrichtendienst der Ostfront, die Abteilung Fremde Heere Ost, ebenfalls nach Mauerwald gezogen. Insgesamt rund fünfzig Personen – Feindlagebearbeiter, Vernehmungsexperten, Rechercheure, Funker, Dolmetscher, Statistiker, Zeichner und der Leiter der Abteilung, Oberst Reinhard Gehlen.
Zwischen hohen Kiefern stand im Bezirk Fritz die Verhörbaracke der Abteilung. Ein dünner, schlecht isolierter Holzbau mit Flachdach aus Teerpappe, auf das an diesem Tag Anfang Mai schon den ganzen Morgen die Sonne knallte. Drinnen dampfte stickige, sauerstoffarme Luft vor sich hin. Nur wenige Sonnenstrahlen fanden den Weg durch die heruntergelassenen Rollläden ins Innere und schienen schmale Streifen von Staub aufzuwirbeln.
Der Offizier im Verhörraum Nummer zwei trug die khakifarbene russische Sommeruniform. Die kleinen gelbbraunen Schulterklappen mit dem silbernen Stern wiesen ihn als Generalmajor aus, die rote Paspelierung als Angehörigen der Panzertruppe. Quer über seine breite Brust spannte sich ein Leibriemen, oberhalb der linken Brusttasche prangte eine Reihe Ordensspangen. Sein breiter brauner Ledergürtel wurde durch eine goldene Schnalle zusammengehalten, die Beine steckten in hohen weichen Lederstiefeln. Seine Mütze mit dem braunen Schirm, dem roten Band und dem roten Stern hatte er auf den Tisch vor sich gelegt.
Unruhig gingen die Augen des Generalmajors an den Holzwänden der Baracke entlang, als wollte er die Astlöcher zählen. Seine Finger tanzten auf der Tischplatte Ballett, seine Mundwinkel bewegten sich unablässig. Der Generalmajor war schwer genervt. Von seiner Gefangennahme vor drei Tagen, von den unzähligen Verhören bei Regiment, Division und Heeresgruppe, die er seitdem über sich hatte ergehen lassen müssen. Vor allem aber von diesem deutschen Leutnant, der ihm nun schon seit geschlagenen fünf Minuten stumm wie ein Fisch gegenübersaß und in irgendwelchen Dokumenten blätterte. Der Generalmajor schwitzte. An Rücken und Achseln seiner Uniform hatten sich dunkle Schweißflecken ausgebreitet. Und dieser verdammte Deutsche bekam nicht einmal eine winzige Schweißperle auf die Stirn. Unfassbar. Aber egal – auch dieses vierte Verhör würde den Fritzen nichts bringen. Außer Name, Rang und Einheit hatte er ihnen bis jetzt nichts verraten, strikt auf die Haager Landkriegsordnung gepocht. Er hatte dichtgehalten. Und das würde so bleiben. Aber dieser Deutsche da, der machte ihn wahnsinnig.
Der junge Leutnant auf der gegenüberliegenden Seite des Resopaltisches war klein, schmächtig und hatte blonde, struppige Haare. Eine schwarze Augenklappe bedeckte sein linkes Auge. In seiner viel zu weiten Uniform sah er aus wie ein kleiner Junge, der die Sachen seines großen Bruders auftragen musste. Noch kaum benutzt und ohne Auszeichnungen, wirkte seine Uniformjacke wie ein frisch geschorenes Schaf. Ohne aufzublicken eröffnete er die Unterhaltung; mit schleppender Stimme, als würde ihm jedes Wort schwerfallen, las er aus seinen Unterlagen vor: »Generalmajor Juri Koskow, Kommandeur der 3. Panzerbrigade in der 1. Gardearmee unter General Kusnezow, Südwestfront.« Erst jetzt sah er sein Gegenüber an. »Wurden Sie als Gefangener gut behandelt, Herr Generalmajor?«
»Ja, ja, sicher doch«, raunzte der Russe und konnte sich gerade noch beherrschen.
»Hat man Ihnen Ihre Wertgegenstände gelassen?«
Das war zu viel. Dem bulligen siebenundvierzigjährigen Generalmajor Juri Koskow platzte der Kragen. Seine Pranke krachte auf den Tisch, und sein voluminöser Bariton hieb auf den schmalen Deutschen ein wie ein Schwert: »Ja, ja, verflucht nochmal! Wie oft soll ich es denn noch sagen? Alles in Ordnung, kein Anlass für irgendwelche Beschwerden!«
Seelenruhig sah der Leutnant auf das Blatt Papier vor sich und notierte ein paar Stichwörter. Automatisch rieb er dabei seine Augenklappe. Auf einmal zuckte er zusammen und blickte Koskow an. »Fahrradunfall auf dem Weg ins Büro«, sagte er leicht verlegen. »Vor dem Krieg war ich nämlich Buchhalter.« Er räusperte sich und sah wieder in seine Unterlagen. »Nun denn, Herr Generalmajor, eine unserer Patrouillen hat Sie also auf einer Erkundungsfahrt am Donez gefangengenommen.« Er schüttelte den Kopf. »Was für ein Pech.«