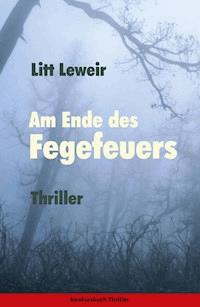
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvolles Busunglück vor vielen Jahren. Die Eltern kommen um, die drei Geschwister werden auseinandergerissen. Lisa, die Jüngste, noch ein Baby zur Zeit des Unglücks, wurde adoptiert. Sie weiß nicht, dass sie adoptiert ist. Michael, der Zweitälteste, wächst bei den Großeltern in einem katholischen Dorf im Schwarzwald auf. Man sagte ihm, seine Geschwister seien tot. Erst als die Großmutter 2011 stirbt, erfährt er, dass seine Geschwister leben. Er macht Lisa in Berlin ausfindig. Sie steckt in einer unglücklichen Liebesgeschichte und in der Vorbereitung zu einer Operation. Doch was ist mit dem ältesten Bruder Matthias? Gemeinsam machen sie sich auf die Suche, nach Matthias, nach ihrer Vergangenheit. Nach und nach klärt sich das furchtbare Geheimnis auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Litt Leweir
Inhaltsverzeichnis
Litt Leweir
Am Ende des Fegefeuers. Thriller
Zum Buch
Erster Teil: Bruchstücke
September 1972
Freitag, 16. September 2011
September 1972
Freitag, 16. September 2011
Herbst 2009
September 2011
Freitag, 16. September 2011
September 2011
Freitag, 16. September 2011
Samstag, 17. September 2011
September 1972
Samstag, 17. September 2011
September 1972
Samstag, 17. September 2011
November 2009
September 2011
Samstag, 17. September 2011
Samstag, 17. September 2011
Samstag, 17. September 2011
Herbst 2009
Sonntag, 18. September 2011
Montag, 19. September 2011
Dienstag, 20. September 2011
Der Anfang vom Ende der Welt
Mittwoch, 21. September 2011
Donnerstag, 22. September 2011
Freitag, 23. September 2011
Samstag, 24. September 2011
Sonntag, 25. September 2011
Montag, 25. September 2011
Montag, 26. September 2011
Donnerstag, 6. Oktober 2011
Dienstag, 11. Oktober 2011
Freitag, 14. Oktober 2011
Freitag, 21. Oktober 2011
Es begann …
Montag, 31. Oktober 2011
Dienstag, 1. November 2011
Februar 1972
Mittwoch, 2. November 2011
Donnerstag, 3. November 2011
August 1972
Freitag, 4. November 2011
September 1972
Montag, 26. Dezember 2011
5. September 1972
Samstag, 31. Dezember 2011
Dienstag, 10. Januar 2012
Mittwoch, 6. September 1972
Dienstag, 10. Januar 2012
Zur Autorin
Impressum
Am Ende des Fegefeuers. Thriller
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch:
Ein furchtbarer Unfall vor vielen Jahren hat sie auseinandergerissen. Die Fernsehübertragung der Olympischen Spiele 1972 in München, der Tag vor der Geiselnahme, der Familienvater zerschlägt den Fernseher mit einer Bierflasche. Zwei Tage später wehen die Fahnen der Olympischen Spiele auf Halbmast und auch Matthias’ Familie ist nicht mehr die gleiche. Erst knapp vierzig Jahre später erfahren die Geschwister voneinander.
Lisa kann das Ende ihrer Liebesbeziehung mit Bettina nicht akzeptieren. Und dann erhält sie auch noch eine bedrohliche Diagnose und muss sich auf eine OP vorbereiten. Michael, der in einem Hospiz arbeitet und erwachsene Kinder hat, meint, alles in seinem Leben unter Kontrolle zu haben, doch das Gegenteil ist der Fall. Noch wissen sie nicht, dass sie Geschwister sind.
Lisa, zum Zeitpunkt des Unglücks ein Baby, wurde adoptiert. Sie weiß nicht, dass sie adoptiert ist. Der ältere Bruder Michael blieb bei den Großeltern in dem winzigen Dorf im Schwarzwald. Man sagte ihm, seine Geschwister seien tot. Erst als die Großmutter stirbt, erfährt Michael, dass seine Geschwister nicht bei dem Unglück umgekommen waren. Warum hatte man ihn belogen? Er hat das Dorf schon lange verlassen und lebt in Berlin. Auch in Berlin macht er schließlich Lisa ausfindig. Doch was ist mit dem ältesten Bruder Matthias? Was geschah vor dem Unglück in dieser Familie, was zwischen den Geschwistern? War es wirklich ein Unfall? Gemeinsam machen sich Lisa und Michael auf die Suche, nach Matthias, nach ihrer Vergangenheit. Nach und nach klärt sich das schreckliche Geheimnis, über das niemand sprechen will, auf.
Erster Teil: Bruchstücke
To make a prairie it takes a clover and
A bee –
One clover, and a bee,
And reverie.
The reverie alone will do.
If bees are few.
Emily Dickinson
September 1972
Ich wurde am Sonntag, den dreizehnten August 1961 geboren, am Tag, als die Berliner Mauer errichtet wurde. Und ich starb am sechsten September 1972, vermutlich noch bevor Avery Brundage in seiner Rede im Münchner Olympiastadion »The games must go on« sprach. Aber das weiß ich nur, erinnern kann ich mich daran nicht. Der letzte Tag meines Lebens, an den ich mich erinnern kann, ist der vierte September 1972, ein Montag.
Ich erinnere mich an eine junge Frau, gerade mal sechzehn Jahre alt. Ich sehe sie auf dem Bildschirm unseres Fernsehers. Ich beobachte, wie diese junge Frau Anlauf nimmt, sich mit einem Fuß abstößt und mit Kopf und Rücken voran über eine 1,90 Meter hohe Holzlatte springt. Die Latte vibriert heftig, bis ein Kampfrichter seine Hand darauf legt. Das Stadion jubelt.
Vielleicht ist es der Jubel, den mein Vater nicht aushält. Er steht von der Ofenbank auf, die Bierflasche noch in der Hand, geht zum Fernseher und schaltet ihn aus. Dann bleibt er eine Weile mitten in der Stube stehen und blickt mich an. Seine Augen sind glasig, wenn jemand ihn darauf anspräche, würde er sicher sagen, das komme vom Bier. Ich weiß nicht, wie lange er da steht und mich ansieht. Aber ich weiß genau, warum. Ich sehe den Vorwurf in seinen Augen, seine Verzweiflung, seinen Zorn. Ich kann ihn denken hören: Warum er und nicht du, warum er und nicht du, immer wieder und wieder. Schließlich dreht er sich um, schmettert die Bierflasche in den Fernseher und rennt davon.
Von einem Moment zum anderen bewegt sich nichts mehr da vorne. Die Wettkämpfe sind ausgesetzt. Niemand schwimmt, läuft, rudert und springt mehr. Die Flaggen wehen auf Halbmast. Ich sehe es noch vor mir, als wäre es erst gestern gewesen. Dabei habe ich es gar nicht gesehen. Nicht damals.
Warum ich und nicht er? Warum ich? Was habe ich getan?
Ich starre auf den Fernseher. Die Großmutter steht vom Sessel auf und geht aus der Stube, das geborstene Glas knirscht unter ihren Schlappen.
Dann ist mein Leben vorbei.
Freitag, 16. September 2011
Michaels Nachtdienst ist fast zu Ende. Er steht in der Küche und drückt einmal einen silbernen Knopf an einer vollautomatischen Kaffeemaschine. Einmal ist für schwach. Die Maschine brummt. Michael wartet, bis sich der Becher mit Kaffee gefüllt hat. Dann nimmt er ihn weg, stellt einen zweiten auf das Gitter und drückt dreimal. Dreimal ist für stark. Demnach ist zweimal für normal. Normal fällt heute Morgen aus. Michael kippt einen Schuss Milch in den Becher mit dem schwachen Kaffee, der starke ist für ihn selbst, er trinkt ihn am liebsten schwarz. Einen Moment bleibt er an die Arbeitsplatte gelehnt stehen und sieht hinaus. Es ist noch dunkel. Michael schließt die Augen, atmet tief durch. Er fühlt sich klar und ruhig. Er nimmt die Becher und trägt sie über den Flur vorbei an zwei geschlossenen Zimmertüren bis zu der einen, die einen Spaltbreit offen steht. Eine Frau blickt auf, als er das Zimmer betritt. Sie sitzt auf einem Stuhl und hält die Hand eines Mannes, der in einem Bett liegt. Es ist ein Pflegebett. Es gibt noch ein zweites Bett in dem Zimmer, ein gewöhnliches Einzelbett mit einem Rahmen aus Kiefernholz. Michael hat so eines schon einmal bei Ikea gesehen. Es ist sehr preiswert und sieht trotzdem gut aus. Lange halten muss es nicht. Er stellt den Becher der Frau auf den Nachttisch. Dann setzt er sich auf den zweiten Stuhl neben dem Bett.
»Danke«, sagt die Frau. Sie lächelt. Michael blickt auf die Hand des Mannes in der Hand der Frau, dann auf den Nachttisch mit dem schwachen Kaffee. Der Kaffeebecher gehört der Frau, sie hat ihn mitgebracht. Ihn ziert ein Cartoon von Uli Stein, eine Maus, die aufrecht in einem Bett sitzt und sich streckt. Das Bett steht vor einem Fenster, die Vorhänge sind aufgezogen. Ist die Tasse kalt, liegt hinter dem Fenster nur dunkelblaue, sternenlose Nacht. Füllt man eine heiße Flüssigkeit hinein, geht die Sonne auf und der Schriftzug »Guten Morgen« erscheint im oberen Bereich des Fensters. Jetzt ist die Tasse nicht voll genug, die Sonne ist zwar aufgegangen, aber die Schrift nicht zu sehen.
Auf dem Nachttisch neben dem Becher steht eine Schale mit geschmolzener Sahne. Sie füllen sie in die Plastikbehälter von Pralinenpackungen und frieren sie ein. Die gefrorenen Sahnestücke kühlen und fetten die trockenen, wunden Lippen und Münder der Sterbenden.
Der Mann im Pflegebett braucht keine Pralinensahne mehr. Die Frau lässt seine Hand los, greift nach ihrem lustigen Kaffeebecher, trinkt einen Schluck und hält ihn in beiden Händen, so als würde sie sich daran wärmen. Sie lächelt immer noch, doch Michael entgeht nicht die Träne in ihrem Augenwinkel. Er legt eine Hand auf ihre Schulter und sie berührt sie für einen Moment.
Er fühlt sich wohl. Wie immer, wenn es vorbei ist. Unglaublich warm und klar und unglaublich erleichtert. Glücklich, denkt er manchmal. Menschen in den Tod zu begleiten, macht ihn glücklich. Aber er traut sich nicht, jemandem davon zu erzählen. Selbst wenn er von seinem Beruf erzählt und ihn jemand mitleidig ansieht und ihm sagt, wie schwer seine Arbeit doch sein muss. Nicht einmal Fiona hat er erzählt, wie glücklich es ihn manchmal macht, wenn es wieder einer geschafft hat.
Das Glücksgefühl ist immer noch da, als er später sein Fahrrad aufschließt und nach Hause fährt, eine Stunde nach Dienstschluss. Er hat auf die Ärztin gewartet, sich Zeit gelassen für die Übergabe an den Frühdienst, der sich um den Rest kümmern und dafür sorgen wird, dass die Männer vom Bestattungsinstitut respektvoll mit dem Leichnam umgehen.
Auf dem Nachhauseweg lässt er die Nacht noch einmal nachwirken.
Er stellt sein Fahrrad im Hinterhof ab und steigt hinauf in seine Wohnung. Bevor er sich auszieht und duschen geht, wirft er einen Blick in Klaras Zimmer, natürlich nicht ohne vorher anzuklopfen. Es ist leer, Klara ist nicht da. Klara ist nie einfach so da, sie meldet sich vorher an, was in letzter Zeit immer seltener geschieht. Nur einmal war sie einfach so da, als er nach Hause kam, aber das ist drei Jahre her. Und sie war nicht alleine. Er erinnert sich an die junge Frau im T-Shirt, die plötzlich in der Küche stand, Michaels Kaffeekanne in der Hand. An ihren verlegenen Blick, denn Michael kam gerade aus der Dusche und trug nichts. Ihren Namen hat er vergessen, es war ihre einzige Begegnung. Und später hörte er von Klara die Namen zahlreicher anderer junger Frauen, ein paar davon ist er sogar begegnet. Beim Essen, auf Geburtstagsfeiern, beim Frühstück. Immer vollständig angezogen, außer einmal, an Klaras letztem Geburtstag am Strand des Plötzensees. Aber da trug er zumindest eine Badehose.
Seit jener Begegnung mit der fremden jungen Frau in seiner Küche sieht er jedes Mal nach, wenn er nach Hause kommt. Eigentlich braucht Klara kein Zimmer mehr bei ihm. Er könnte daraus ein Gästezimmer machen. Oder ein Arbeits- und Gästezimmer. Wahrscheinlich würde es Klara nicht viel ausmachen. Sie lebt mittlerweile in einer WG.
Vielleicht wird er das tun, in diesem Jahr noch, vielleicht auch erst im nächsten. Er hat keine Eile. Und sowieso nur selten Gäste. Und sein Schreibtisch steht eigentlich ganz gut im Schlafzimmer.
Jetzt setzt er sich daran, öffnet eine schwarze Kladde mit Gummizug, blättert ein wenig darin. Er weiß nicht, wie viele Einträge es sind, er hat sie schon lange nicht mehr gezählt. Anfangs hat er sie noch nummeriert, aber das schien ihm dann doch zu makaber. Er blättert die Seite mit dem letzten Eintrag um, streicht das Blatt glatt, nimmt den schwarzen Füller mit der schwarzen Tinte, den er eigens für diesen Zweck gekauft hat, und schreibt:
»Wolfgang, 39 Jahre, Pankreaskarzinom, 16. September 2011.«
∞
Lisa sitzt auf dem Sofa. Sie fühlt sich benommen, ein Druck liegt auf ihren Ohren, sie schüttelt den Kopf, versucht die Benommenheit und den Druck abzuschütteln, doch es hilft nichts. Sie überlegt, ob sie aufstehen soll, den Kopf zur Seite neigen, auf einem Bein hüpfen, damit es herausläuft aus ihrem Kopf, das Unheil, das sie in den letzten Tagen überschwemmt hat. Aber der Kontakt zu ihrem Körper ist abgebrochen und sie weiß nicht, wie sie ihn wieder herstellen kann. Sie mag jetzt auch nicht darüber nachdenken. Sie denkt besser überhaupt nicht. Das Telefon liegt noch in ihrer Hand. Sie versucht zu spüren, wie es in ihrer Handfläche liegt, und tatsächlich fühlt sie den leichten Druck. Sie hat noch nicht aufgelegt, sie hört ein leises Tuten. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen und drückt auf die Taste mit dem roten Hörer, dann ist es still.
Sie starrt auf das Telefon, erinnert sich an das Gespräch, das sie vor ein paar Minuten geführt hat, und Angst schießt in ihr Herz. Sie fühlt sich wie in einem Flugzeug, das eben in ein Luftloch gesackt ist. Das tiefer sinkt, abstürzt … Das Telefon gleitet ihr aus der Hand und fällt zu Boden.
Jetzt ganz ruhig bleiben, sagt eine Stimme in ihrem Kopf. Was hat die Ärztin am Telefon gesagt: »Sie können ruhig auch am Wochenende vorbeikommen, wenn Sie reden wollen.«
Was hat sie noch gesagt?
Lisa hebt das Telefon auf. Die Nummer, die sie am liebsten wählen möchte, ist für sie tabu. Warum eigentlich? Es sind doch besondere Umstände. Aber sie wird sie ohnehin nicht erreichen, höchstens die Mailbox. Sie überlegt, was sie sagen könnte. »Bitte ruf zurück, es ist etwas passiert« oder »Bitte ruf mich an, ich brauch dich!« Nein, das geht so nicht.
Sie wählt eine andere Nummer, eine Mailbox springt an.
Lisa weiß nicht, was sie sagen soll. Und selbst wenn sie es wüsste, könnte sie es nicht. Sie kann jetzt nicht sprechen. Es geht einfach nicht. Sie stellt den Apparat zurück in die Ladeschale, blickt auf den gepackten Koffer, der mitten im Wohnzimmer steht, und ignoriert das Telefon, das zu klingeln begonnen hat.
»Lisa, du musst jetzt gehen«, sagt sie laut, wie um ihre Stimme zu testen. Fast ist sie überrascht, dass sie überhaupt noch funktioniert. Sie klingt merkwürdig, fremd, gar nicht wie ihre eigene. Ihr Mund ist trocken. »Sonst verpasst du noch deinen Zug.«
September 1972
Hat er es wirklich getan? Hat mein Vater die Flasche geworfen oder habe ich nur gedacht, er würde sie werfen? Und wenn er sie geworfen hat, traf sie den Fernseher? War es Glas, das unter den Schlappen meiner Großmutter knirschte? Und wenn es zerborstenes Glas war, woher kam es? War es Mattscheibenglas oder Bierflaschenglas? Knirschte überhaupt etwas? Was ist meine Erinnerung wert? Und will ich mich überhaupt erinnern?
Ich erinnere mich an die ersten Minuten nach meinem Tod. Ich erinnere mich, wie ich am Abhang stehe. Nein, ich stehe dort, jetzt, in diesem Augenblick. Ein Bus liegt zwischen langbeinigen Tannen auf dem Rücken und zappelt wie ein umgekippter Käfer. Ja, das ist genau das, was ich in jenem Moment denke. Oder jetzt, wer kann das schon so genau unterscheiden? Ich denke an einen umgekippten Maikäfer. Aber er zappelt nur mit einem Bein. Nur einer der Reifen dreht sich noch. Es riecht nach verbranntem Gummi, Benzin und ein klein wenig nach Moos und Erde. Und nach etwas, was ich erst nicht identifizieren kann. Ob es Blut ist? Ich sehe kein Blut. Aber vielleicht kann ich es nur nicht erkennen. Die Welt hat alle Farbe verloren, vielleicht war sie auch immer schon schwarz-weiß. Ich kann mich jedenfalls an keine Farbe erinnern. Ich sehe nur Grau. Ein grauer Bus, graue Tannen, ein grauer Himmel, eine graue Straße …
Hinter mir hält ein Wagen, ein Mann steigt aus, stellt sich neben mich, schlägt die Hände vors Gesicht, rennt weg. Ich höre die Reifen seines Wagens quietschen, als er davonfährt. Eine ganze Weile stehe ich am Abhang und frage mich, was jetzt wohl geschehen wird. Soll ich hier warten? Wird mich jemand abholen? Wird sich der Himmel öffnen und der liebe Gott eine Leiter herablassen? Aber wahrscheinlich wird mich da oben niemand haben wollen. Eher wird sich der Boden auftun und mich verschlucken. Aber auch das geschieht nicht. Eine ganze Weile geschieht gar nichts. Nur das Rad dreht sich weiter, Rauch und Staub kräuseln sich durch die Sonnenlichtstreifen. Irgendwann steht das Rad still, irgendwann höre ich Sirenen, dann das Zuschlagen von Türen und aufgeregte Stimmen. Doch niemand sieht mich, niemand nimmt mich wahr. Sie rennen an mir vorbei. Also bin ich wirklich tot?
Freitag, 16. September 2011
Nach zehn Nachtdiensten hat Michael jetzt acht Tage frei. Er wird heute nicht schlafen, sondern versuchen, in einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus zu kommen. Er macht ein wenig Ordnung, geht mit dem Staubsauger durch die Wohnung, stellt die Spülmaschine an und wischt über die Flächen in der Küche. Gegen elf bringt er den Müll hinunter und geht einkaufen. Lebensmittel, ein paar Brötchen und eine Zeitung. Auf dem Rückweg öffnet er den Briefkasten und ein Stapel Papier fällt ihm entgegen. Er hat keine Lust, die Werbung auszusortieren, und nimmt einfach alles mit.
Oben angekommen, legt er die Post zur Seite, er erwartet nichts. Er kocht Kaffee, schmiert sich die Brötchen und setzt sich aufs Sofa, um Zeitung zu lesen. Sein Kater Peter lässt sich auf seinem Schoß nieder und schnurrt, als Michael ihm den Nacken krault. Nach einer Weile fallen Michael doch die Augen zu.
Das Klingeln des Telefons lässt ihn hochschrecken. Als er das Gerät endlich findet, hat es aufgehört und der Anrufbeantworter ist angesprungen. Die Nummer auf dem Display ist ihm unbekannt, die Vorwahl hingegen vertraut. Er wartet die Ansage ab. Niemand sagt etwas. Wer ihn aus der Gegend wohl anruft? Eigentlich hat er gar keinen Kontakt mehr dorthin. Wieder ein Klassentreffen? Er versucht sich zu erinnern, wie viel Zeit seit dem Abi vergangen ist, aber er ist zu müde zum Denken, ihm fällt nicht einmal sein Abi-Jahrgang ein. Er setzt sich auf das Sofa und sieht die Post durch. Ein Anzeigenblatt, das Faltblatt einer Pizzeria, Prospekte vom Supermarkt, Baumarkt und dergleichen, ein Kontoauszug wie jede Monatsmitte. Und ein weißer Umschlag mit einem Sichtfenster. Der Absender kommt aus seinem Heimatort. Also doch wieder ein Klassentreffen? Dr. Gernot Sonneburg, Rechtsanwalt und Notar. Das sagt ihm nichts, was aber nicht bedeutet, dass er nicht doch einen Klassen- beziehungsweise Abi-Jahrgangskameraden dieses Namens gehabt haben könnte. War nicht erst letztes Jahr Klassentreffen? Nein, jetzt fällt es ihm wieder ein. Es war vor drei Jahren, er ist Abi-Jahrgang 1983. Dann kann doch nicht jetzt schon wieder Klassentreffen sein, oder?
Michael öffnet den Umschlag und entfaltet ein Blatt:
»Sehr geehrter Herr Weber,
wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Großmutter väterlicherseits, Frau Elfriede Weber, am 14. September 2011 verstorben ist und sprechen Ihnen hiermit unsere aufrichtige Anteilnahme aus. Sie und Ihre Geschwister sind die einzigen überlebenden direkten Nachfahren von Frau Weber. Überdies liegt ein Testament von Frau Weber vor, in dem Sie drei als Erben eingesetzt sind. Weitere Verwandte, die Anspruch auf das Erbe hätten, sind nicht bekannt. Ich bin der Nachlasspfleger Ihrer Großmutter und als solcher beauftragt, die Erben von Frau Weber ausfindig zu machen.
Wir bitten dringend um Ihren Rückruf in dieser Angelegenheit. Falls Sie Kontakt zu Ihren Geschwistern haben, bitten wir Sie, diese zu informieren und sie ebenfalls zu bitten, uns dringend anzurufen.
Die Beisetzung Ihrer Großmutter findet am kommenden Donnerstag, den 22. September 2011 um fünfzehn Uhr statt.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gernot Sonneburg«
Michael wählt die Telefonnummer, die im Briefkopf steht.
»Sonneburg Rechtsanwälte und Notare, Steiner, guten Tag.«
»Michael Weber, ich hätte gerne Herrn Doktor Sonneburg gesprochen.«
»Welchen Herrn Doktor Sonneburg möchten Sie denn sprechen?«
»Doktor Gernot Sonneburg.«
»Einen Moment bitte.«
»Hallo Michi, schön, dass du dich so schnell meldest. Entschuldige, dass mein Brief so förmlich war, aber ich hab lange überlegt, wie ich es machen soll …«
Der Mann spricht weiter, doch Michael hört ihm nicht zu, er überlegt krampfhaft, welcher seiner vielen Klassenkameraden der Mann am Telefon wohl sein könnte, denn anders kann er sich die vertraute Anrede nicht erklären.
»… Bist du noch dran, Michi? Du weißt nicht, wer ich bin?«
»Ich vermute, wir sind zusammen zur Schule gegangen.«
»Mehr als das.«
Michael denkt nach.
»Gernot Schmidt«, hilft ihm der Mann am anderen Ende der Leitung auf die Sprünge.
»Gernot, natürlich, ich bin gerade etwas müde im Kopf, ich hatte Nachtdienst.«
»Bist du Arzt oder so was?«
»Krankenpfleger.«
»Macht ja nichts.«
Michael lacht. »Nein, macht nichts.«
»Nein, ich meine, dass du dich nicht erinnerst. Ich heiße ja jetzt anders.«
»Du hast geheiratet?«
»Ja, vor einem halben Jahr.«
»Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere mich noch gut an dich. Natürlich.«
»Natürlich.« Der Mann lacht trocken. »Wie schön, ich erinnere mich auch noch gut an dich.«
Michael weiß nicht, wie er auf die Ironie in der Stimme des Mannes reagieren soll. Des Mannes, der Gernot ist. Gernot, den er seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat, denn als Michael seine Großeltern mütterlicherseits noch regelmäßig besuchte, war Gernot nicht da.
»Bist also wieder da«, stellt Michael fest.
»Ja, schon eine ganze Weile.« Gernot räuspert sich. »Tut mir leid mit deiner Großmutter, aber ich nehme an, ihr standet euch nicht sehr nah.«
»Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt. Sie muss ja steinalt gewesen sein.«
»Hunderteins.«
Michael schnalzt mit der Zunge. »Als ich sie zuletzt gesehen habe, war sie Anfang sechzig, und da kam sie mir schon alt vor. Jetzt erscheint mir das noch ziemlich jung.«
»Tja, so ändert sich die Wahrnehmung.«
Die beiden Männer schweigen.
»Und wie geht es jetzt weiter?«, fragt Michael.
»Du hast nicht zufällig Kontakt zu deinen Geschwistern?«
»Zu meinen Geschwistern?« Michael lacht. »Du weißt doch genau, dass meine Geschwister tot sind.«
»Nach allem, was ich weiß, sind sie noch am Leben.«
»Quatsch, Gernot.«
»Kein Quatsch, Michi.«
∞
Der Regionalzug nach Rostock ist voller, als Lisa gedacht hätte. Sie steht eine Weile im Gang, ehe sie sich traut, eine junge Frau zu fragen, ob der Platz neben ihr frei ist. Die junge Frau nickt, nimmt ihren Rucksack weg und Lisa lässt sich in den Sitz fallen. Schräg gegenüber sitzen vier Mädchen. Lisa schätzt sie auf vierzehn, fünfzehn. Sie kichern und kreischen und können kaum eine Minute still sitzen. Normalerweise hätte Lisa sich gestört gefühlt, aber heute ist sie froh über die Ablenkung. Sie beobachtet, wie sie ständig die Plätze wechseln und sich gegenseitig mit ihren Mobiltelefonen fotografieren. Als an einer der Haltestellen der Geruch nach Mist hereinzieht, packen sie ein Duftspray aus. Von dem widerlich süßlichen Geruch wird Lisa fast schlecht. Dann doch lieber frische Landluft, denkt sie.
Wenn sie nicht die Mädchen beobachtet, blickt sie auf den blauen Bildschirm am anderen Ende des Abteils. Dort werden die Haltestellen mit den Ankunftszeiten angezeigt. Die junge Frau neben ihr studiert fotokopierte Seiten mit Zeichnungen und Gleichungen, eine Weile versucht Lisa, daraus schlau zu werden, aber es gelingt ihr nicht. In Fürstenberg wird der Zug bedeutend leerer, auch die vier Mädchen steigen aus. Lisa setzt sich auf einen frei gewordenen Platz am Fenster. Sie fühlt sich wohler, als sie es noch vor zwei Stunden für möglich gehalten hätte. Anscheinend schafft sie es tatsächlich, ihre Angst und ihren Schmerz hinter sich zu lassen, von Haltestelle zu Haltestelle entfernt sie sich weiter davon.
Es ist gut, dass sie gefahren ist, trotz allem. Zwei Tage lang hat sie mit der Entscheidung gerungen, seit Bettinas Absage.
Erst wollte sie auch ihren Arzttermin gestern absagen. Sie hat sich mit einer Flasche Wein betrunken und die halbe Nacht durchgeheult. Und am anderen Morgen beschlossen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Sie würde einfach ihr Leben weiterleben, wie geplant, auch ohne Bettina.
Es wäre besser gewesen, sie hätte den Arzttermin verschoben. Jetzt möchte sie den Kopf in den Sand stecken. Wenigstens heute und morgen und übermorgen. Bis Montag.
In Rostock hat ihr Intercity Verspätung, sie hat Angst, ihren Bus zu verpassen, aber in Ribnitz-Dammgarten steht er noch vor dem Bahnhof, mit einer langen Schlange davor, in die Lisa sich einreiht.
Es fängt an zu regnen. Sie denkt an das Meer, das sie bald sehen wird, die Ostsee, die sie so liebt. Und an Ahrenshoop, den kleinen Ort, in den sie sich vor ein paar Jahren so heftig verliebt hat, dass sie ihn immer wieder besuchen muss, dass sie davon träumt, irgendwann einmal dort hinzuziehen.
Zum Glück geht das Einsteigen schnell. Lisa findet noch einen Platz für sich und ihren Koffer. Der Bus füllt sich immer mehr mit Schulkindern auf dem Nachhauseweg und Reisenden mit großen Koffern. Mittlerweile gießt es in Strömen und der Busfahrer weist niemanden ab. Endlich geht es los, eine Viertelstunde zu spät, aber Lisa hat ja keine Eile, die Busfahrt ist die letzte Etappe ihrer Anreise.
An den nächsten Haltestellen stehen auch Menschen und Lisa rechnet damit, dass der Busfahrer vorbeifahren wird, doch er lässt niemanden im Regen stehen. Lisa kann kaum glauben, wie viele Menschen in diesen Bus passen. Und wie freundlich und hilfsbereit sie trotz der Enge sind. Und alle kommen auch wieder heraus. Unversehrt und mit Gepäck. Auch Lisa.
Der Ort wirkt grau. Aber so ist das mit Geliebten, sie zeigen sich nicht immer von der besten Seite. Das hat sie auch Bettina begreiflich zu machen versucht. Es ist gar nicht notwendig, dass du immer perfekt bist. Und es ist erst recht nicht notwendig, dass du dich meinetwegen verbiegst. Du darfst hässlich sein und krank und schwach. Es darf in dir regnen.
So hat sie es ihr nicht gesagt, sie hat es anders formuliert. Vielleicht hätte Bettina es besser verstanden, wenn sie es so formuliert hätte. Vielleicht kann sie das ja noch tun. Ihr einen Brief schreiben und es ihr noch einmal erklären.
Ich liebe diesen Ort auch im Regen, könnte sie schreiben, weil ich weiß, in welcher Pracht er sich zeigen kann. Er ist so schön, dass Maler sich in ihn verliebt haben, in sein Licht, seine Farben …
Sie hat Bettina schon so oft geschrieben, hat ihr eigentlich alles schon gesagt. Wozu es tausendmal wiederholen? Vielleicht schreibt sie ihr trotzdem noch einmal. Aber nicht jetzt. Jetzt muss sie sich um andere Dinge kümmern. Um sich selbst. Sie muss dafür sorgen, dass sie überlebt. Das ist Herausforderung genug. Und das Einzige, um das sie sich jetzt zu kümmern hat.
Der Weg von der Bushaltestelle zur Kurverwaltung ist kurz, doch es gießt noch immer in Strömen. Sie ist nass bis auf die Haut, als sie die Zimmervermittlung betritt. Die Frau hinter dem Schreibtisch ist freundlich, sie sind immer freundlich hier.
»Was haben Sie denn für ein Wetter mitgebracht?«, scherzt sie.
»Das frage ich mich auch«, erwidert Lisa.
Lisa füllt das Formular für die Kurtaxe aus.
»So, jetzt können Sie sich erst mal trocken legen«, sagt die Frau und schiebt Lisa Kurkarte und Schlüssel hin.
Es sind nur ein paar Schritte zu ihrem Zimmer, ein Doppelzimmer mit Küchenzeile, eigentlich gebucht bis Dienstag, aber sie wird wohl Sonntag wieder fahren. Soll sie ihren Koffer überhaupt auspacken? Sie lässt ihn erst einmal stehen.
Sie legt sich aufs Bett, schließt die Augen. Als sie sie wieder öffnet, sieht sie ihren Bauch, wie er sich hebt und senkt mit ihrem Atem, und erneut packt sie die Angst. Sie versucht, an etwas anderes zu denken, an Bettina, aber das ist auch nicht gut. Geht weiter, Gedanken! Aber wohin? Egal, einfach weitergehen, nur nicht stehen bleiben! Sie ist müde, am liebsten würde sie liegen bleiben, einfach hier liegen bleiben und eine Woche lang schlafen und überhaupt nicht mehr denken. Aber das stimmt so auch nicht. Sie wird das, was sie sich wünscht, nicht bekommen, besser sie schminkt es sich ab.
Es sind nur ein paar Schritte zum Strand, an der Kurverwaltung vorbei, die Düne hinauf. Doch die Ostsee muss warten, es regnet noch und ihr ist nach Kaffee. In einer Bäckerei an der Dorfstraße gibt es guten und günstigen Kaffee und Kuchen. Sie holt sich einen Cappuccino, ein Stück Mohn-Käsetorte und die Ostsee-Zeitung und setzt sich damit neben den Fischteich auf die große Terrasse. Der Regen prasselt auf die Markise, aber bald nimmt Lisa ihn nicht mehr wahr. Sie isst ihren Kuchen, trinkt ihren Kaffee und vertieft sich in die Zeitung. Als sie wieder auftaucht, ist es heller geworden und hat aufgehört zu regnen. Sie macht sich auf zum Strand.
Als ihr Blick auf den Sand, die Dünen und die Ostseewellen fällt, verschlägt es ihr den Atem. Es ist zu schön, um es auszuhalten. Und auf einmal kann sie Bettina verstehen und ihre Angst vor dem Glück.
Herbst 2009
»Es gibt drei Gründe, warum ich dir schreibe: Weil du in einer offenen Beziehung lebst, wegen deines Profils und …«, lautete der einzige Satz, den eine Nachricht in Lisas Postfach auf einer Kontaktplattform im Internet enthielt.
Lisa lebte zu dem Zeitpunkt in gar keiner Beziehung, ihr Profil war veraltet. Sie wollte auch keine. Sie war mit ihrem Kopf ganz woanders, insbesondere bei einem bevorstehenden Umzug. Außerdem hatte sie ihre letzte unglückliche Verliebtheit gerade erst überwunden und es ging ihr zum ersten Mal seit Langem wieder richtig gut. Deshalb dauerte es auch ein paar Tage, bis sie schließlich doch auf die Nachricht reagierte: »Es gibt einen Grund, warum ich dir antworte: Ich möchte wissen, was der dritte Grund ist …«
Die Absenderin schrieb zurück, den dritten Grund nannte sie nicht. Überhaupt schien sie eine Menge auszulassen. Ihre Mails waren jedenfalls voller Auslassungspunkte und in einer ganz eigenen Sprache verfasst, grammatisch nicht immer korrekt. Zeitweilig dachte Lisa, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache wäre. Sie stellte sie sich als gebildete und sprachbegabte Ausländerin vor. Die vielen Auslassungen und der kreative Umgang mit der Sprache steigerten ihre Neugier auf die fremde Frau. Es entwickelte sich ein Mailkontakt. Er war nicht sehr intensiv, meistens vergingen einige Tage zwischen den einzelnen Mails. Einmal ließ die Antwort der Frau besonders lange auf sich warten und Lisa machte sich Sorgen, dass sie das Interesse verloren haben könnte. Da merkte sie, dass ihr der Kontakt ans Herz gewachsen war. Sie mochte die Mails dieser Frau, die so wunderbar um den heißen Brei herumschreiben konnte. Und natürlich wusste Lisa auch so, was sie wollte. Und irgendwann sprach sie es dann auch deutlich aus: »Ich wünsche mir eine lustvolle Liaison mit Respekt und Achtung zum gelebten Leben, dessen Ereignissen und Verpflichtungen, und … Ein Kennenlernen schließt für mich auch ein nettes Kennenlernen ein … Ich liebe Gespräche.«
Nach Lisas Umzug trafen sie sich im Raucherpavillon eines griechischen Restaurants in Pankow. Nach kurzer Zeit waren sie in ein Gespräch vertieft, das Lisa alles um sie herum vergessen ließ. Die Frau trank reichlich Retsina, Lisa Bier. Irgendwann – es war schon spät – nahm die fremde Frau Lisas Hand und strich mit dem Daumen über ihren Handrücken. Sie sah Lisa tief in die Augen und machte ihr Komplimente. Dann küsste sie Lisas Hand. Nach einer Weile mit noch mehr tiefen Blicken und Komplimenten fragte Lisa: »Wohnst du hier in der Nähe? Nimmst du mich mit zu dir?«
September 2011
Warum ich mich gerade jetzt erinnere? Es ist wegen Elias. Elias kann nämlich Tote sehen. Und er kann mit ihnen sprechen. Jedenfalls halbwegs. Wie dieser Junge in diesem Film mit Bruce Willis, The Sixth Sense. Ich hab mir so gewünscht, dass dieser Junge aus dem Film heraussteigt und mit mir spricht. So wie die Foots es irgendwann getan haben. Aber er ist nicht herausgekommen. Der Film war zu Ende und er war weg. Vielleicht wären die Foots auch irgendwann weg gewesen, so wie all die anderen auch, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Die ich verloren habe. Auch die Foots waren bereits blass und durchsichtig geworden und ich dachte schon, bald lösen sie sich ganz auf. Doch dann kam Elias. Elias hat mir die Foots zurückgebracht. Und Elias hat angefangen, mit mir zu sprechen. Obwohl er nicht tot ist. Jedenfalls glaube ich nicht, dass er tot ist.
Viele Nichttote reden, wenn sie in meiner Nähe sind. Erst habe ich gedacht, sie reden mit mir. Aber das stimmt nicht. Sie reden auf mich ein. Vielleicht sehen und hören sie mich auch nicht, wissen nicht, dass ich da bin. Sie führen Selbstgespräche. Vielleicht ist es ihnen aber auch egal, was ich sage. Ich kann sie noch so oft bitten, endlich den Mund zu halten. Oder ihnen verbieten, mich anzufassen, es hilft nichts. Dabei können sie mich doch gar nicht anfassen. Man kann Gespenster nicht anfassen. Und doch berühren sie mich an Stellen, an denen Menschen einander nicht berühren sollten. Außer sie haben diese ganz spezielle Beziehung zueinander. Wie Simon und Mark. Oder wie Sam und Rachel.
Ich verstehe diese Welt nicht. Ich verstehe die Welt der Foots, aber nicht die, in der ich einfach berührt werde, obwohl ich doch tot bin. Und ich frage mich, ob sie wohl die Hölle ist, diese Welt, oder ob ich einfach nur Albträume habe. Ich habe es weiß Gott verdient, in der Hölle zu sein, auch wenn ich mich verflucht noch mal nicht mehr erinnern kann, warum. Was habe ich eigentlich verbrochen? Wen habe ich ermordet? Und warum fühle ich mich dann trotzdem manchmal wie im Himmel? Wenn Laura mich umarmt. Wenn ich neben Mark und Simon auf dem Sofa sitze und Simon mir den Arm um die Schulter legt. Wenn ich Sams kleine Tochter Rebecca auf meinem Schoß schaukle. Wenn dieser fremde Mann, zu dem ich einmal in der Woche gebracht werde, mich auf eine hölzerne Bank setzt und darauf trommelt, bis meine Seele vibriert. Wenn Elias an meine Tür klopft, das Schachbrett aufstellt und versteht, wie ich meine Figuren gezogen haben möchte. Wenn Elias mich versteht und ich gar nichts mehr verstehe. Auch nicht, wie Elias mir die Foots zurückbringen konnte. Wie er wissen konnte, wie sehr ich mich nach ihnen gesehnt habe.
Heute ist Elias hier. Er klopft an meine Tür, stellt das Schachbrett auf und schiebt mich an den Tisch.
Freitag, 16. September 2011
Michael betritt ein Berliner Mietshaus und steigt die Treppe zum Hinterhaus hinauf. Auf jeder Etage studiert er die Klingelschilder. Im Dachgeschoss findet er den Namen, den er sucht. Er steht eine Weile vor der Tür, fragt sich, ob er wirklich klingeln soll, ob es nicht viel zu viel für sie beide wäre, ob es nicht besser wäre, ihr erst einmal einen Brief zu schreiben.
Aber die Frau, die angeblich seine tote Schwester ist, scheint auf Briefe nicht zu reagieren, jedenfalls hat sie nicht auf Gernots Brief reagiert. Aber vielleicht ist sie ja gar nicht seine Schwester. Vielleicht ist das alles nur ein großer Irrtum.
»Und warum heißt sie jetzt anders?«, hat Michael Gernot gefragt.
»Ich vermute mal, sie wurde adoptiert.«
»Adoptiert?«
»Ja, wäre doch nicht unwahrscheinlich, oder?«
»Und das lässt sich nicht genauer herausfinden?«
»Jedenfalls nicht durch Akteneinsicht. Adoptionsakten sind besonders geschützt. Aber immerhin haben sie ihren Namen und ihre Adresse rausgerückt. Aber es geht ja schließlich um ein Haus und ein Grundstück. Da liegt es auch in ihrem Interesse, dass sie gefunden wird.«
»Vielleicht hat sie auch einfach nur geheiratet.«
»Könnte sein. Jedenfalls lebt sie in Berlin. Gleiche Postleitzahl wie du.«
»Im Ernst?«
»Soll ich dir die Adresse geben?«
Michael klingelt an der Tür und bereut es im selben Moment. Er hält den Atem an, wartet, lauscht. Nichts, sie scheint nicht da zu sein. Gott sei Dank! Er setzt sich für ein paar Minuten auf eine Treppenstufe und denkt nach. Dann geht er schnell nach Hause und ruft Fiona an.
»Kannst du dich um Peter kümmern? Ich muss für ein paar Tage verreisen.«
»Ist etwas passiert?«
»Meine Großmutter ist gestorben.«
»Ich dachte, du hast keine Verwandten mehr.«
»Das dachte ich bis heute Morgen auch.«
September 2011
Elias kommt und geht. Manchmal kommt er am Nachmittag und bleibt bis lange nach dem Sonnenuntergang. Manchmal sitzt er schon neben meinem Bett, wenn ich aufwache. Manchmal geht er weg, ich weiß nicht, wohin. Und wenn er am nächsten Tag nicht wiederkommt, fange ich an, mir Sorgen zu machen. Am dritten Tag bin ich mir schon sicher, dass er nie mehr wiederkommt. Am vierten bin ich der Verzweiflung nahe. Aber so lange ist er selten weg. Und bisher ist er immer wiedergekommen. Wenn er weg ist, versuche ich mich daran zu erinnern, dass er bisher immer zurückgekommen ist. Aber es gelingt mir nur schwer. Ich habe kein Vertrauen. Ich wünschte, er würde mir sagen, wohin er geht und wann ich wieder mit ihm rechnen kann, dann könnte ich mich darauf einstellen. Aber er erzählt es mir nicht, er geht einfach weg, und ich weiß nicht, wie ich ihn bitten soll, mir Bescheid zu sagen. Er darf doch kommen und gehen, wie er will.
Wenn er nicht da ist, bin ich alleine mit diesen ganzen Irren, den Halbtoten oder Ganztoten, was weiß ich, den Zombies und Freaks. Die halten es nicht aus, dass sie das verdammte Licht nicht finden können, das vermute ich jedenfalls. Warum sollten sie sonst so einen Rabatz machen. Manchmal schreien sie den ganzen Nachmittag herum und poltern. Einer ist besonders schlimm, der schlägt auch. Einmal hat er ein Loch in die Tür geschlagen. Der ist ein richtiger Poltergeist. Zum Glück kann ich weggehen. Manchmal gehe ich zu den Foots, sitze bei ihnen im Wohnzimmer und sehe mit ihnen fern. Oder ich esse mit ihnen zu Abend. Manchmal nerven mich sogar die Foots. Wenn sie sich streiten zum Beispiel, und sie streiten sich oft. Manchmal will ich auch einfach allein sein, dann gehe ich los. Manchmal gehe ich langsam. Manchmal laufe ich und dann kommt es mir fast so vor, als wäre ich noch am Leben, ich kann dann sogar meinen Atem hören. Das habe ich früher schon immer so gemacht, als ich wirklich noch gelebt habe. Wenn ich es nicht ausgehalten habe, bin ich einfach losgegangen, durch den Wald spaziert, irgendeinen Waldweg lang, oder ich bin die Asphaltstraße hinaufgerannt, bis ich nicht mehr konnte. Bis mir die Luft wegblieb. Heute gehe ich meistens langsam, aber doch lange genug, dass ich müde werde. Und dann kehre ich zurück mit einer wohligen Erschöpfung in meinen Gliedern, die es ja genau genommen gar nicht mehr gibt, und dann klettert Laura zu mir ins Bett und nimmt mich in den Arm. Oder Simon, manchmal auch Sam, obwohl Sam ja eigentlich tot ist. Aber das haben wir schließlich gemeinsam.
Lange Zeit hat es mir gereicht, einfach bei ihnen zu sein, ihnen beim Leben zuzusehen, ihren Gesprächen zu lauschen. Ich war auch früher schon ein schweigsamer Junge. Vielleicht weil ich nie groß Hoffnung hatte, dass irgendjemand versteht, was ich zu sagen habe. Doch neuerdings ist mir nach Reden. Manchmal erzähle ich den Foots aus meinem Leben, erzähle, wie es früher so war, als ich noch am Leben war. Und in den Jahren danach.
Aber heute will ich nicht mehr reden.
Die Foots sind in ihrer Welt. Und Elias ist auch nicht da. Am Abend haben sie ihn abgeholt und er ist noch nicht wieder zurück. Am liebsten wäre ich auch nicht da. Ich bin müde, will schlafen. Und wenn ich nie wieder aufwachen würde, wär’s mir auch recht. Aber ich kann nicht schlafen. Ich erinnere mich.
Freitag, 16. September 2011
Kurz nach einundzwanzig Uhr kommt Michael am Freiburger Hauptbahnhof an. Nach nur sechseinhalb Stunden und mit nur wenigen Minuten Verspätung. Es gab Zeiten, da brauchte Michael für diesen Weg zehn, zwölf Stunden. Meistens auf dem Rücksitz irgendeines alten PKWs, zusammengepfercht mit einem, manchmal zwei Mitfahrern. Heute geht es wahrscheinlich auch mit dem Auto schneller, wenn auch nicht so schnell wie mit dem ICE. Damals wurde die Fahrt durch zwei Grenzübergänge unterbrochen und die hundert Stundenkilometer Geschwindigkeitsbegrenzung waren selbst für die alten Rostkübel langsam.
Die S-Bahn zur Weiterfahrt wartet schon auf Gleis eins. Aber es dauert noch zehn Minuten, bis sie abfährt. Michael vertritt sich noch ein wenig die Beine auf dem Bahnsteig und erinnert sich an die vielen schulfreien Samstagvormittage, die er in Freiburg verbracht hat. In Buchhandlungen, Musikgeschäften und Kaufhäusern stöbern, auf dem Markt exotische Gewürze kaufen, den Straßenmusikern zusehen. Und auf einer Bank am Rande des Kartoffelmarktes sitzen und Chinapfanne essen, ein Gericht aus von Gewürzen gelb gefärbtem Reis, Gemüse und ein paar Schweinefleischstückchen, das an einem Kaufhausimbiss in einem viereckigen Pappbehälter verkauft wurde. Darauf hätte er jetzt Lust. Aber selbst wenn es sie noch gäbe, um diese Uhrzeit würde er keine mehr bekommen. Früher war diese Stadt für ihn das Tor zur Welt oder das Tor zur Zukunft, was für ihn damals wahrscheinlich dasselbe war. Heute ist sie das Tor zu seiner Vergangenheit. Noch zögert er, es zu durchschreiten. Vielleicht fürchtet er sich sogar davor. Furcht – ein Gefühl, das ihm nicht sonderlich vertraut ist. Es gibt nicht viel, was er fürchtet. Aber er wundert sich nicht, dass er jetzt einen Hauch davon spürt. Eigentlich hatte er nicht mehr hierher kommen wollen. Bis heute gab es keinen Grund dafür. Seine Großeltern leben nicht mehr. Jetzt könnte es zwei Gründe geben, einen Bruder und eine Schwester. Vielleicht.
Er könnte noch ein wenig durch die Freiburger Innenstadt schlendern, eine Pizza essen und ein Bier trinken. Er hat es nicht eilig, er wird Gernot heute nicht mehr treffen, Gernot ist bei einem Konzert. Er hat für Michael ein Zimmer in einem Gasthaus gebucht, es reicht, wenn er vor Mitternacht dort ankommt.
Ach, besser, er bringt es schnell hinter sich.
Die S-Bahn fährt pünktlich ab. Eine gute halbe Stunde später betritt Michael den Gasthof. Fast alle Tische und der Tresen sind besetzt, es ist schließlich Freitagabend. Der Wirt zeigt ihm sein Zimmer. Michael wirft seine Reisetasche in die Ecke und legt sich auf das Bett. Durch die Decke dringen Musik und Gelächter. Aber das stört ihn nicht weiter. Er schließt die Augen, spürt, wie müde er ist. Kein Wunder, er hat ja seit über dreißig Stunden nicht mehr geschlafen. Gleichzeitig fühlt er sich aufgekratzt. Er kramt sein Mobiltelefon aus der Jackentasche und wählt Fionas Nummer, sie nimmt nicht ab. Er versucht es bei Klara, doch auch die erreicht er nicht. Zuletzt versucht er es bei Max, seinem hochbegabten Sohn, der mit siebzehn in Oxford einen Studienplatz bekommen hat. Nach zwei Jahren als Weltenbummler arbeitet er jetzt in London als Physiker. Manchmal ist es Michael unheimlich, welche Entwicklung sein Sohn genommen hat. Und sich vorzustellen, welche er hätte nehmen können, wenn sie nicht rechtzeitig bemerkt hätten, woran Max’ Schulprobleme lagen. Max ist zu Hause.
»Hallo Mike, wie geht’s?«
Wann hat Max angefangen, ihn Mike zu nennen? Er weiß es nicht mehr.
Michael erzählt ihm, wo er ist und warum er hier ist.
»Wow, dann habe ich also noch eine Tante und einen Onkel.«
»Vielleicht. Und wie geht’s dir?«
»Gut.«
»Und wie geht es Janet?«
»Auch gut.«
»Irgendwelche Neuigkeiten?«
»Nein.«
Michael atmet auf. Max hat es anscheinend bemerkt.
»Was befürchtest du?«, fragt er.
»Nichts«, antwortet Michael.
»Du befürchtest, dass ich dich bald zum Opa mache, stimmt’s?«
Michael lacht. »Nein, das wäre kein Problem für mich.«
»Klar, nichts ist ein Problem für dich.«
»Stimmt.«
Deswegen ist Klara doch mit ihrer ersten Freundin zu ihm gekommen und nicht zu Fiona. Dabei wäre Fiona die Letzte, die damit ein Problem hätte, sie hat ja selbst schon mit etlichen Frauen geschlafen.
»Du nimmst die Dinge so, wie sie sind«, war Klaras Erklärung.
»Und Fiona nicht?«
»Nein, sie regt sich immer so schnell auf.«
Dass Fiona sich schnell aufregt, ist Michael bisher noch nicht aufgefallen. Aber Mutter-Tochter-Beziehungen sind wahrscheinlich ganz speziell.
»Findest du, Fiona regt sich schnell auf?«, fragt er Max jetzt.
»Nein, wie kommst du darauf?«
»Klara findet das.«
Max lacht. »Vielleicht im Vergleich zu dir. Im Vergleich zu dir regen sich die meisten Menschen viel auf. Du bist jedenfalls der größte Stoiker, den ich kenne.«
»Stoiker?«
»Stoiker, das sind …«
Michael unterbricht ihn. »Mein IQ ist zwar nicht annähernd so hoch wie deiner, aber was ein Stoiker ist, das weiß ich schon. Findest du es schlimm?«
»Dass du ein Stoiker bist? Nein, du bist eben so.«
»Ja, aber war das schlimm für dich?«
»Du warst ein ausreichend guter Vater, wenn du dir darüber Sorgen machst, ich hätte es schlechter treffen können. Du bist es noch. Sonst wäre Klara doch gar nicht zu dir gekommen.«
»Stimmt auch wieder.«
Max lacht. »Apropos Sorgen. Du klingst heute überhaupt nicht wie du selbst. Seit wann machst du dir Sorgen?«
»Mache ich mir Sorgen?«
»Zumindest darüber, ob du ein guter Vater warst und ob Fiona sich schnell aufregt. Und du klingst irgendwie, ich weiß nicht …«
»Hm.« Michael reibt sich das Kinn.
»Plötzlich wieder eine Schwester oder einen Bruder zu haben, bringt wahrscheinlich den größten Stoiker aus dem Gleichgewicht«, sagt Max.
»Vielleicht.«
»Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass alles gut wird.«
»Danke.«
»Schlaf gut, Mike.«
»Du auch, Max.«
Samstag, 17. September 2011
Lisa schläft schlecht. Trotz zweier Grogs und einem Bier. Jedenfalls seit sie den Fernseher ausgeschaltet hat. Die Stimmen im Hintergrund haben sie beruhigt. Jetzt, wo sie weg sind, ist die Angst wieder da. Lisa wälzt sich herum, schießt immer wieder hoch in einem Anflug von Panik. Sie schwitzt, Laken und Nacht-T-Shirt sind feucht. Sie spürt ein Kribbeln in ihren Fingern, in ihrem Nacken. Sie kennt das, sie hat das immer, wenn sie nicht schlafen kann, weil etwas sie plagt. Sie hat Durst. Wenigstens dem kann abgeholfen werden. Sie macht Licht, geht mit nackten Füßen zur Küchennische, nimmt ein Glas aus dem Schrank und füllt es mit Leitungswasser. Sie trinkt es leer, ohne es abzusetzen, und füllt es erneut. Sie trägt das Glas zum Bett, stellt es auf den Nachttisch. Sie legt sich hin, betrachtet die Bettdecke, die sich über ihrem runden Bauch hebt und senkt. Das ist Atem, denkt Lisa, Atem. Wer atmet, lebt. Lebt – noch.
Ihr Atem stockt. Sie ringt nach ihm, hechelt wie eine Schwangere bei der Geburt.
»Ganz ruhig«, flüstert sie, »alles wird gut, alles wird gut, ganz ruhig …« Und dann gibt sie einen Ton von sich, einen tiefen brummenden Ton, der in ihrer Brust vibriert. Es hilft, sie wird ruhiger, die Panik ebbt ab. Doch die Angst bleibt, liegt kalt in ihrem Bauch.
Angst ist ein fürchterliches Monster, wenn man ihr zu viel Raum lässt. Sie muss ihr den Raum nehmen. Diesen Raum. Sie packt es am Kragen, das Angstmonster, schleift es zur Tür, gibt ihm einen Tritt in den Hintern und schließt zweimal hinter ihm ab. Doch es gibt noch nicht auf, es wütet und tobt, rüttelt an der Tür und am Fenster.
»Es ist nur der Wind«, flüstert Lisa, »nur der Wind, nur der Wind, nur der Wind …«
Das Flüstern hilft. Aber nur für einen Augenblick. Denn nun sieht Lisa wieder ihren Bauch, ihren runden Bauch. Sie sieht aus, als wäre sie schwanger, hat ihre Kollegin Ute gesagt. Aber sie ist nicht schwanger. Wovon auch? Von Bettinas Fingern sicher nicht. Außerdem hat das Ganze angefangen, lange bevor sie Bettina zum ersten Mal begegnet ist.
Das Monster ist nicht draußen. Lisa hat allen Grund, Angst zu haben, denn das Monster lebt in ihr drin, in ihrem Bauch. Nein, es lebt nicht nur in ihr, es ist ein Teil von ihr. Es ist aus ihr entstanden. Aus ihren eigenen Körperzellen, die begonnen haben, verrückt zu spielen, die zu Mördern geworden sind, zu Selbstmördern. Wenn sie gerettet werden will, muss sie ein Stück von sich selbst aufgeben. Sie muss es aus sich herausschneiden lassen. Sie muss eine andere werden. Denn solange es noch in ihr drin ist, wird sie es mitnehmen, egal, wohin sie geht. Und am Ende wird es sie töten. Bei dem Gedanken verschlägt es ihr wieder den Atem.
Was zum Henker macht sie hier eigentlich? Sie sollte jetzt ganz woanders sein. Es gibt nur einen Ort, einen Menschen, eine Frau, bei der sie jetzt sein sollte. Eine, an die sie sich auch mitten in der Nacht wenden kann. Keine Geliebte, auch keine Exgeliebte. Eine Verwandte. Aber nicht ihre Mutter. Wenn sie ihre Mutter anruft, muss sie ihre Mutter trösten.
Lisa versucht es zuerst erfolglos auf dem Festnetz. Dann wählt sie die Mobilfunknummer und hat Glück. Sie schafft es nicht zu sprechen, etwas hat sich in ihrer Kehle verhakt.
»Lisa, bist du das?«
Lisa räuspert sich. »Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt.«
Die Frau am anderen Ende der Leitung lacht. »Doch, schon, aber wenn du mitten in der Nacht anrufst, muss es wohl wichtig sein.«
Schweigen.
»Was ist passiert, Lisa?«
»Ich habe Krebs.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























