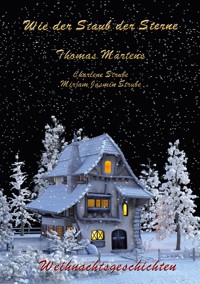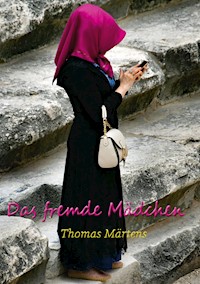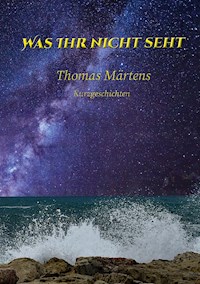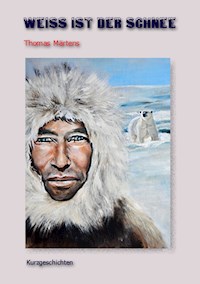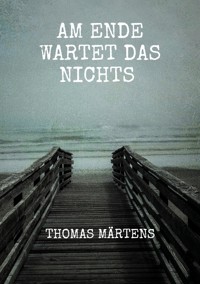
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jean-Baptiste Laroche und Robert Bishop sind zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ein sehr wohlhabender amerikanischer Geschäftsmann aus Marina del Rey (Los Angeles), der in seiner eigenen Werft noble Hochseejachten herstellt, und der andere ein Fleischer, der sein Geld auf dem Großmarkt in Orly, einer Kleinstadt südlich von Paris, verdient. Beide kennen sich nicht, haben niemals in ihrem Leben etwas miteinander zu tun gehabt, leben auf unterschiedlichen Kontinenten weit voneinander entfernt, und doch sind beider Leben unabdingbar miteinander verknüpft, gehören zusammen bis an ihr Ende. Beider Schicksale, ob vorbestimmt oder doch nur zufällig, beginnen ihren Lauf zu nehmen, als sich ihre Blicke erstmalig und nur für den Bruchteil einer Sekunde in einem Szenelokal namens Marlusse et Lapin im Pariser Bezirk Pigalle begegnen. Das war allerdings nur der Auftakt, praktisch der auslösende Moment zu dieser Geschichte, die in diesem Buch zu lesen sein wird. Es darf keinesfalls unerwähnt bleiben, dass beide Serienmörder sind. Jeder von ihnen bringt Menschen um, hat seine ganz eigene Motivation für dieses zwanghafte Handeln und trägt tiefe, ungelöste seelische Probleme in sich. Sowohl Jean-Baptiste Laroche als auch Robert Bishop wissen, dass sie irgendwann von der Polizei erwischt und vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Durch die eingangs erwähnte Begegnung entfesselt sich eine äußerst komplexe Ereigniskette, die den Leser und auch die Leserin zwischen Europa und Amerika hin- und herpendeln lässt, und von der die Protagonisten selbst einfach nichts ahnen konnten, als sich ihre Blicke trafen. Zuletzt betritt Joana, die bildhübsche Tochter von Robert Bishop, die Bühne, um die Geschichte vollkommen unerwartet aus ihren Angeln zu heben und in eine völlig neue, ungeahnte Umlaufbahn zu katapultieren. Diese Geschichte ist ein Stück weit wie das Leben. Sie hat ihre ganz eigene, unaufhaltsame Dynamik, entwickelt geradezu unglaubliche, verwirrende Ereignisse und findet zuletzt ein dramatisches und fesselndes Finale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Viele der Handlungsorte in der nachfolgenden Geschichte sind Fiktion. Auch die Personen wurden frei erfunden. Ähnlichkeiten oder tatsächliche Übereinstimmungen mit lebenden oder bereits verstorbenen Menschen wären rein zufällig und waren zu keiner Zeit beabsichtigt. Sämtliche Handlungsstränge sind nur ausgedacht.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Am Ende wartet das Nichts
Paris - Jean-Baptiste Laroche
Lyon - Mordkommission
Paris
Los Angeles
Los Angeles - Mordkommission
Los Angeles - California State Prison
Los Angeles - Mordkommission
Lyon
Paris
Los Angeles - vier Wochen später
Los Angeles / Mordkommission
Lyon - Kriminalpolizei
Paris
Los Angeles – Marina del Rey
Los Angeles – Policedepartment
Paris
Lyon – Los Angeles
Paris
Los Angeles
Paris
Paris
Los Angeles, Kalifornien
Marina del Rey - Joana
Vorwort
Jean-Baptiste Laroche und Robert Bishop sind zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ein sehr wohlhabender amerikanischer Geschäftsmann aus Marina del Rey (Los Angeles), der in seiner eigenen Werft noble und extrem teure Hochseejachten baut, während der andere ein unbedeutender Fleischer ist, der sein Geld auf dem Großmarkt in Orly, einer Kleinstadt südlich von Paris verdient. Beide kennen sich nicht, haben niemals in ihrem Leben etwas miteinander zu tun gehabt, leben auf unterschiedlichen Kontinenten weit voneinander entfernt, und doch sind beider Leben unabdingbar miteinander verknüpft, gehören zusammen bis an ihr Ende. Ihre Schicksale, ob vorbestimmt oder doch nur zufällig, beginnen ihren Lauf zu nehmen, als sich ihre Blicke erstmalig und nur für den Bruchteil einer Sekunde in einem Szenelokal namens Marlusse et Lapin im Pariser Bezirk Pigalle begegnen. Das war allerdings nur der Auftakt, praktisch der auslösende Moment zu dieser Geschichte, die in diesem Buch zu lesen sein wird. Es darf keinesfalls unerwähnt bleiben, dass beide Serienmörder sind. Jeder von ihnen bringt Menschen um, hat seine ganz eigene Motivation für dieses zwanghafte Handeln und trägt tiefe, ungelöste seelische Probleme in sich. Sowohl Jean-Baptiste Laroche als auch Robert Bishop wissen, dass sie irgendwann ganz sicher von der Polizei erwischt und vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.
Durch die eingangs erwähnte Begegnung entfesselt sich eine äußerst komplexe Ereigniskette, die den Leser und auch die Leserin zwischen Europa und Amerika hin- und herpendeln lässt und von der die Protagonisten selbst einfach nichts ahnen konnten, als sich ihre Blicke trafen.
Zuletzt betritt Joana, die bildhübsche Tochter von Robert Bishop die Bühne, um die Geschichte vollkommen unerwartet aus ihren Angeln zu heben und in eine völlig neue, ungeahnte Umlaufbahn zu katapultieren.
Diese Geschichte ist ein Stück weit wie das Leben. Sie hat ihre ganz eigene, unaufhaltsame Dynamik, entwickelt geradezu unglaublich verwirrende Ereignisse und findet zuletzt ein dramatisches und fesselndes Finale.
Am Ende wartet das Nichts
Geschehen die Dinge, weil es ihre Bestimmung ist, oder unterliegt alles, was ist und was sich ereignet, nur dem Zufall? Jeder kennt die Redewendungen, dass uns alles vorbestimmt ist und dass dieses und jenes Schicksal sei, auf das niemand Einfluss hat. Vielleicht gibt es aber wirklich so etwas wie ein Buch des Lebens, in dem alles steht, was war, was ist und was sein wird, was jedem einzelnen von uns widerfährt, wie wir mit den vielfältigen Ereignissen in unserem Leben umgehen, welche Entscheidungen wir treffen und wo uns unser Leben hinführen wird. Besonders aber, wann, unter welchen Umständen und wo wir sterben müssen. Wenn es aber dieses Buch tatsächlich gibt, wer hat dieses Werk wann und wo geschrieben? Wie lange wird der Autor oder die Autorin dafür gebraucht haben und wie dick sollte dieses Buch wohl sein? Ist es digital, mit Tinte auf Papier oder in einer uns vollkommen unbekannten Form verfasst worden? Wer hat die Urschrift gegengelesen, vielleicht korrigiert oder als inhaltlich richtig anerkannt, wer steuert zuletzt all das, was darin aufgeführt ist, und woher weiß der Autor oder die Autorin, was alles geschehen wird? Bereits aus diesen wenigen Zeilen ergeben sich unendlich viele grundlegende Fragen und die Antworten, so es diese gäbe, würden unseren Verstand ob der Komplexität des Themas über den Rand des Verstehens hinauskatapultieren. Wenn Gott es geschrieben hat, wer ist er? Darf man sich als Mensch auf diesem kleinen und durchaus unscheinbaren Planeten im Vergleich zur Größe anderer Gestirne überhaupt aufschwingen, diese Frage zu stellen? Und wenn ja, ist Gott männlich, weiblich, geschlechtslos oder etwas vollkommen Anderes? Und wo ist dieses Buch jetzt? Handelt es sich überhaupt um ein Buch, so wie wir es kennen? Es muss außerdem entstanden sein, bevor es die Zeit gab. Anders ist es nicht zu erklären. Wo aber war nun die Zeit, bevor alles begonnen hat? War sie schon immer da? Begann sie erst mit dem Leben? Das Weltall ist riesengroß, wie uns allen hinlänglich bekannt ist. Viele Milliarden und Abermilliarden Galaxien, in denen sich - um es mit Dagobert Ducks Worten zu sagen - fantastillionen Planeten um ihren Fixstern drehen. Wenn wir uns einfach mal die Zeit nehmen, in das nächtliche Himmelszelt hoch über uns zu schauen, sehen wir in dunklen und klaren Nächten bestenfalls ein paar tausend Sterne. In kosmischen Dimensionen ist das nicht sonderlich erwähnenswert, aber wir können durchaus erkennen, wie wunderbar das funkelnde Sternenmeer hoch über uns ist. Unser ganzes Dasein, unser Leben und alles, was uns umgibt, ist ein einziges Wunder. Machen wir uns nichts vor. Jeder von uns hat lediglich eine sehr kurze Zeitspanne im großen Bogen der Zeit, um auf der Erde herumlaufen und die uns überall begegnenden Wunder intensiv bestaunen zu können. Unglücklicherweise aber sind wir viel zu häufig so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir das Schöne um uns herum nur zu selten bewusst wahrnehmen. Wir sind immer und überall von erstaunlichen Dingen umgeben. Die Welt, alles, was ist, und nicht zuletzt auch wir selbst sind ein Wunder, denn bereits bei unserer Zeugung hat sich jeder von uns gegen Millionen Konkurrenten durchgesetzt. Wenn wir uns des Abends schlafen legen und jedes Mal über den vergangenen Tag nachdenken würden, könnten uns die vielen kleinen Wunder des Tages durchaus bewusster werden. Vielleicht war da ein Freund oder eine Freundin, den oder die wir unerwartet wiedergesehen haben. Da war das Eichhörnchen, das flink und geschickt durch einen Kirschbaum huschte, oder das kranke Kind, das nach langer Krankheit genesen ist. Es gibt so unfassbar viele wunderbare Momente an jedem Tag. Und sei es nur, dass wir schmerzfrei geradeaus gehen und uns des Lebens freuen können. Um es noch einmal zu wiederholen. Alles ist erstaunlich. So wie das Leben selbst. Und damit wären wir wieder bei den Sternen. Es wäre ganz sicher ein Irrglaube, Leben ausschließlich auf der Erde zu vermuten. Bei der Unmenge von Sternen liegt es auf der Hand, dass intelligentes Leben auch an anderen Orten des Universums existieren muss. Da kann es keinen Zweifel geben. Die Schöpfung versucht auch an den schier seltsamsten und für unser Verständnis unmöglichsten Orten überall im Kosmos, Leben entstehen zu lassen. Das tut sie unaufhörlich auch an den lebensfeindlichsten Orten auf unserer Erde, denn auch die Wüsten leben. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr ergibt sich daraus die Frage nach einer möglichen Begegnung der dritten Art. Das heißt nichts Anderes, als dass uns vielleicht fremde Wesen aus der Untiefe des Alls besuchen. Dann hätten wir den Beweis, dass intelligentes Leben auch anderswo existiert. Aber mal ganz ehrlich. Da hätte man vielleicht ein ungutes Gefühl, denn wenn eine außerirdische Lebensform in der Lage wäre, die gefährliche Reise über riesige kosmische Distanzen einfach so durchzuführen, dann müsste sie einen vollkommen anderen Grund als den eines banalen Höflichkeitsbesuchs haben. Naheliegend, dass die UFO-Typen ihren eigenen Planeten möglicherweise hingerichtet haben und eine neue Heimat suchen. Und diese Wesen, die mit ihren Raumschiffen durch die Lebensfeindlichkeit des Weltalls reisen können, wären uns technisch sicher weit überlegen. Vielleicht aber ist das auch ganz falsch, denn niemand wird es je in Erfahrung bringen, welche Lebensformen es wo gab, gibt und geben wird. Es sei denn, wir könnten ein paar Blicke in das erwähnte Buch des Lebens werfen. Aber das ist offensichtlich nicht Gottes Wille. Er kennt uns Menschen nur zu genau und hat es möglicherweise aus diesem Grund nicht gewollt. Bleiben wir also besser in unserer unscheinbaren Randregion der weiten Milchstraße und spielen vollkommen sinnlos mit den atomaren Kräften des Universums herum. Das können wir ja besonders gut und uns alle selbst hinzurichten schaffen wir irgendwann auch noch. Der Mensch an sich ist doch paradox. Einerseits verfügt er über die unglaubliche Intelligenz, Atombomben überhaupt bauen zu können und gleichzeitig ist er dumm genug, das auch zu tun. Bleibt zu hoffen, dass das Leben an anderen Stellen der uns umgebenden Unendlichkeit andere und bessere, vor allem friedlichere Maßstäbe setzt als wir auf unserer Erde.
Nun aber wieder zurück zum Buch des Lebens. Wenn darin nicht nur die Ereignisse auf unserer Erde, sondern auch die der anderen Welten geschrieben stehen, dann wird es immer unvorstellbarer, dass es so etwas tatsächlich geben könnte. Es existieren Theorien, die besagen, dass es neben unserem Weltall mit seinen unzählbaren Galaxien unendlich viele andere Universen mit gleichem oder völlig anderem Aufbau geben könnte. Das wäre der blanke Wahnsinn. Allein die Vorstellung ist unbegreiflich, zuletzt aber wie so vieles nicht widerleg- oder bestimmbar. Niemand hat in dieser Frage recht und keiner hat unrecht. Klar scheint aber zu sein, dass in der kosmischen Unendlichkeit kein einziges Atom verloren geht. Niemals und bis in alle Ewigkeit. Und auch die Ewigkeit ist einigermaßen undefinierbar. Doch gibt es eine nette kleine Geschichte, die sie uns etwas begreifbarer machen könnte. Darin heißt es:
Am Rand der Welt gibt es ein Gebirge, dessen höchster Berg bis hinauf in die Wolken reicht. Alle eintausend Jahre kommt ein Vogel geflogen, setzt sich hoch oben auf den Gipfel des Berges, wetzt seinen Schnabel einmal links und einmal rechts. Und wenn er auf diese Weise das gesamte Gebirge dem Erdboden gleich gemacht hat, ist genau eine Sekunde der Ewigkeit vorbei.
Es bleibt aber dabei, wie es zuvor erwähnt wurde. Kein Atom des Universums geht jemals verloren. Alles, was ist, ändert im Laufe der Entstehung und des Vergehens lediglich seinen Aggregatzustand. Aber jedes winzige Teilchen allen Seins bleibt in unserem Kosmos erhalten. Und da tauchen schon wieder Fragen auf. Kann sich so ein Atom nicht doch einfach mal aus dem Staub machen, davonstehlen, durch irgendeine Hintertür abhauen, und wäre unser Weltall überhaupt noch funktionsfähig, wenn nur eines dieser kleinen Teilchen tatsächlich verschwinden würde? Vielleicht aber ist alles auch ganz anders und durchaus möglich, dass in unserem Leben alles zufällig passiert. Das würde die Frage nach dem Buch des Lebens ad absurdum führen, aber gleichzeitig unzählige neue Ungereimtheiten aufwerfen. Wir wundern uns oft, warum Dinge nicht geschehen, wenn wir sie gern hätten, aber wie aus dem Nichts in unser Leben platzen, wenn wir nicht an sie denken. Jeder kennt das. Viele haben nach der großen Liebe gesucht, sie nicht gefunden, sind ihr dann aber in einem völlig unerwarteten, vielleicht absurden Moment geradewegs in die Arme gelaufen. Das ist nur eines von unendlich vielen Beispielen. Mag der geneigte Leser und die geneigte Leserin nach Bedarf in ihrem Leben herumstöbern. Jeder wird vielfältige Beispiele entdecken.
Für die zu erzählende Geschichte wäre es interessant, zu erfahren, ob jemand derartig komplexe Ereignisse in grauer Vorzeit tatsächlich geplant hatte. Wenn es so wäre, müsste dieses Wesen ein ziemlich schräger Typ gewesen sein und einen mehr als schlechten Charakter haben, denn was gleich folgen wird, ist wahrlich keine Gutenachtgeschichte. Kommt Gott, der gut ist, dann tatsächlich noch als Autor infrage? Hatte der Teufel, das böse Gegenstück unseres Herrn, seine verkohlten schwarzen Finger im Spiel? Wer kann das schon sagen? Doch genug der Vorrede. Belassen wir es einfach dabei. Ob Bestimmung und Zufall. Die Dinge geschahen so, wie sie nun erzählt werden.
Paris - Jean-Baptiste Laroche
Paris lag schon seit Tagen unter einer dicken Wolkendecke, aus der unaufhörlich ungeahnte Regenmengen auf die französische Hauptstadt niedergingen. Man konnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass irgendein verwirrter Geist aus dem Reich des Allmächtigen geplant hatte, die historische Metropole ertränken zu wollen, denn inzwischen gab es in diesem anhaltenden Dauerregen, der in Bächen aus den Wolken brach, keinen trockenen Ort in der Stadt, soweit er den Unbilden der Natur ungeschützt ausgeliefert war. Bei genauerer Überlegung ergab dieser Gedanke jedoch keinen wirklichen Sinn, denn wem sollte es tatsächlich etwas nutzen, wenn das riesige Häusermeer dieser geschichtsträchtigen Metropole in den himmlischen Fluten unterginge? Es wäre kein wirklich guter Plan, diesen besonderen Ort, der sich seit dem dritten Jahrhundert vor Christus aus der kleinen keltischen Siedlung namens Lutetia zu einer der bedeutendsten Großstädte auf diesem Planeten entwickelt hatte, von der Bildoberfläche verschwinden zu lassen. Doch so weit würde es wohl nicht kommen, denn zuletzt waren es nur ein paar Tage, in denen der Himmel seine Schleusen zugegebenermaßen sehr anhaltend und weit öffnete. Bald schon würde der Himmel wieder blau strahlen und die Sonne die kleine Sintflut vergessen machen.
So weit war es allerdings in diesem Moment noch nicht, als Jean-Baptiste Laroche im Marlusse et Lapin saß, tief sinnierend aus dem Fenster schaute und sich fragte, wie es möglich sein konnte, dass in den Wolken (in diesen Stunden nicht ganz so hoch über uns) eine derartige Wassermenge um die Erde ziehen konnte, während die irdische Schwerkraft ansonsten auch den kleinsten und leichtesten Gegenstand sofort und unwiderstehlich zu Boden zwingt. Selbst eine Erdnuss vermochte es nicht, der Gravitation Paroli zu bieten.
Da muss man wohl schon studiert haben, um diesen Widerspruch zu verstehen, ging es ihm durch den Kopf, als er sein gekühltes Glas Absinth an die Lippen führte und einen kräftigen Schluck des betörenden Getränks durch seinen Hals laufen ließ.
Jean-Baptiste kam praktisch an jedem Abend in dieses skurrile Kleinod in Pigalle, einer anerkannten Institution des Viertels, in dem sich nach Einbruch der Dunkelheit auch heute noch viele Stammgäste einfinden, um den verdienten Feierabend in gemütlicher Runde zu genießen. Die Bar ist sehr charmant im Retrostil mit allerlei seltsamem Mobiliar eingerichtet und bietet den Gästen eine unglaubliche Atmosphäre, aber auch ein sehr großes Angebot unterschiedlichster Getränke. Jean-Baptiste kannte eine Menge der Leute, die hier täglich immer wieder durch die Tür kamen und sich entspannt einen Drink gönnten, war aber mit niemandem wirklich befreundet, denn die freundschaftliche Nähe zu anderen Menschen erschien ihm schon seit seiner Kindheit mehr als suspekt. Vielmehr badete er in der belebten Anonymität, wenn sich das Lokal zu später Stunde richtig gefüllt hatte. Natürlich gab es das ein oder andere Gespräch, jedoch ließ Jean-Baptiste keine Nähe oder Tiefe zu. Er wollte allein sein, schweigen und beobachten. Er war ein Einzelgänger, ein Herumtreiber und Straßenköter. Diese Rolle hatte ihm das Leben auf den Leib geschnitten oder jemand lange vor dem Urknall in sein Buch des Lebens geschrieben. Niemand wird das jemals beantworten können. Er war immer sehr bieder gekleidet, eine mausgraue und unauffällige Erscheinung, die man nur flüchtig wahrnimmt, wenn sie einem begegnet, und sofort wieder vergisst, sobald sie aus dem Blickfeld verschwindet. Diese Unauffälligkeit war allerdings nur sein Äußeres. In seinem Inneren verbarg sich hinter der eher unscheinbaren Fassade etwas ganz Anderes, von dem außer ihm selbst niemand etwas ahnen konnte. Im Marlusse et Lapin fiel er jedenfalls niemandem mehr auf. Hier war er allein, jedoch nicht einsam, und das war wichtig für sein mehr als unruhiges Innenleben. Also hatte er sich an besagtem Abend wie immer an seinen Ecktisch gesetzt und beobachtete die Leute, die kamen und gingen, bevor er zu fortgeschrittener Stunde zuweilen leicht angeschickert durch das nächtliche Paris in seine nahegelegene Wohnung in der Rue de Maubeuge schlenderte und sich auf seinem Heimweg immer wieder über die Schönheit der Stadt freute.
Es war Freitag und Jean-Baptiste hatte den ganzen Tag schwer gearbeitet. Sein Geld verdiente er ziemlich sauer als Fleischer in den Markthallen von Orly. Diesen Beruf hatte er tatsächlich in einem kleinen Fleischereifachhandel in Batignolles am nördlichen Stadtrand gelernt. Sein damaliger Chef war der etwas zu klein geratene, aber kugelrunde Alain Bernard, der den Beruf des Fleischers mit voller Hingabe ausübte. Mit welcher Akribie er seine Würstchen, die Schnitzel und alles andere zubereitete, war sehr erstaunlich. Er zeigte seinem Schützling Jean-Baptiste mit Hingabe all die vielen Geheimnisse, die in der Zunft den Unterschied machten. Wie würzte man die Wurst, in welche Richtung schnitt man ein ordentliches Steak und vieles mehr. Jean-Baptiste mochte diesen kauzigen kleinen Kerl, der ihm immer wieder ein ordentliches Stück Fleisch mitgab, wenn der Feierabend kam.
»Sag Deiner Mutter, sie soll das feine Stück aus der Hüfte des Rindes langsam in Butter braten. Aber nicht zu lang, hörst Du. Sage mir morgen, wie es Euch geschmeckt hat.«
Der Junge erntete viel Lob vom kleinen Monsieur, denn er gab sich alle Mühe, den Ansprüchen dieses großartigen Menschen und Fleischermeisters gerecht zu werden. Seine Fachprüfung machte er nach drei lehrreichen Jahren mit Auszeichnung und bereitete seinem Chef alle Ehre. Jean-Baptiste erinnerte sich noch Jahre später mit warmem Herzen und Wehmut an die Zeit seiner Ausbildung, denn hier lernte er nicht nur den Umgang mit Würsten und Fleisch, sondern auch vieles über Aufrichtigkeit, Fairness, Anstand und wirkliche Freundschaft, was ihm an anderen Stellen wie in der Schule und vor allem zu Hause in der Familie versagt geblieben war. Monsieur Bernard war jedoch seit sehr langer Zeit gesundheitlich angegriffen und musste das Geschäft bald schon aufgeben. Schweren Herzens sagte er seinem Schützling, der eigentlich bei ihm weiterarbeiten wollte, auf Wiedersehen. Seinen Wunsch, dem Jungen die Fleischerei zu übergeben und das traditionelle Geschäft zu erhalten, musste er leider aufgeben. Er brauchte das Geld aus dem Verkauf des bei der Kundschaft beliebten Ladens für seine instabile Gesundheit. Zuletzt aber vermachte Monsieur zum Abschied seinem Schützling ein Fleischermesser, das er sich Jahre zuvor auf einer Reise durch Japan gekauft hatte, und wünschte Jean-Baptiste alles Gute auf seinen Wegen durchs Leben.
»Halt es in Ehren, mein Lieber«, forderte er ihn eindringlich mit mahnenden Worten und ernstem Blick auf.
»Dieses Messer hat keine Geschichte, es ist Geschichte. Eine uralte japanische Schmiedekunst, die es heute so nicht mehr gibt. Es ist etwa zweihundertfünfzig Jahre alt und wurde dafür gemacht, erlegtes oder bei der Jagd verletztes Wild mit dem nötigen Respekt zu töten, zu zerlegen und seinen Besitzer zu ernähren. Das Messer ist zu keinem Zeitpunkt eine Waffe oder ein Werkzeug, und wenn Du es gegen seine uralte Bestimmung verwendest, wird es sich gegen Dich wenden und Dir Schaden zufügen.«
Jean-Baptiste war eher von schlichter Bildung, die auch seiner oft wenig strukturierten Denkweise entsprach, und begeisterte sich nicht für solche philosophischen Redensarten und Sichtweisen. Insgeheim wunderte er sich immer wieder über derart seltsame Wesenszüge von Monsieur Bernard, den er ohnehin als etwas verdreht angesehen hatte. Trotzdem. Er liebte diesen Mann, denn er war immer fair und gut zu ihm gewesen. Das war es, was für Jean-Baptiste wirklich zählte.
Das Messer befand sich in einem reichlich verzierten Ebenholzetui, als er es vorsichtig an sich nahm, ausführlich und intensiv mit staunenden Augen betrachtete und sich herzlich bedankte. Der schmerzliche Abschied von Monsieur Bernard und seinem Fleischergeschäft war für den Jungen ein durchaus dramatisches Erlebnis, das einer Geburt gleichkam, denn hier hatte er sich zu Hause gefühlt, hier war er anerkannt worden, wurde respektiert, hier wollte er sein. Das alles aber war jetzt vorbei. Ein letztes Mal verabschiedete er sich bei seinem Chef, noch einmal öffnete er die Ladentür mit der kleinen Klingel, die sowohl beim Öffnen oder Schließen so lustig bimmelte. All diese schönen Vertrautheiten, die Gerüche, die netten Kunden waren von jetzt auf gleich passé. Als der Junge die Straße hinunterging, drehte er sich noch ein letztes Mal um, seufzte ein trauriges Adieu in sich hinein und kehrte niemals mehr in dieses Teil von Paris zurück.
Nur zwei Jahre später erfuhr Jean-Baptiste vom frühen Tod des freundlichen Monsieur Bernard.
»Dein Lehrherr ist von uns gegangen. Wie man mir sagte, ist er gestern im Krankenhaus eingeschlafen. Die Familie wird sich bei Dir melden und den Termin und Ort der Beisetzung mitteilen. Für die Zeit bist Du natürlich von der Arbeit beurlaubt«, sagte ihm sein neuer Boss.
Jean-Baptiste nahm die Nachricht reg- und verständnislos entgegen. Er hatte es stets vermieden, seine Emotionen vor anderen zu offenbaren. So etwas hatte er nicht gelernt. Also schüttelte er sich kurz, betrachtete die wunderbare Klinge in seiner Hand mit nachdenklichem Blick, um die ihn jeder beneidete, und arbeitete etwas gedankenverloren weiter. Den Rest des Tages schwieg er, sagte kein Wort mehr, ließ wehmütig Bildfragmente aus seiner Lehrzeit durch seine Gedankenwelt segeln und ging zum Feierabend stumm seiner Wege. Erst jetzt brach alles aus ihm heraus und er ließ es entgegen seiner sonst sich selbst unterdrückenden Art zu. Innerlich tobten seine Emotionen, als er mit der Metro Richtung Pigalle unterwegs war. Er verspürte schmerzenden Verlust, denn Monsieur war für ihn ein Mentor, ein Vater, ein Freund, ein Mensch unter Menschen gewesen. Tränen des Schmerzes, der Liebe und der Trauer liefen ihm übers Gesicht. Die ganze Nacht bewegte ihn der Verlust und das Chaos in seiner wunden Seele und ließ ihn nicht schlafen. Tags darauf ging er allerdings wie gewohnt zur Arbeit, hatte Monsieurs Tod in einer stillen Ecke seiner Seele abgespeichert und machte sich konzentriert an sein Tagwerk. So war er nun mal, das war sein unterkühltes Wesen. Was ihn gerade noch quälte, schüttelte er in nächsten Moment einfach so ab.
Der Beisetzung des Leichnams blieb er einfach fern. Das hätte er nicht aushalten können. Allein die bildliche Vorstellung des in die Grube verschwindenden Sarges spülte ihn über den Rand des Erträglichen. Sein Chef hatte mit Jean-Baptiste darüber gesprochen und ihn dazu bewegen wollen, doch noch zum Friedhof zu fahren. Aber genau das war falsch, denn ein weiterer Wesenszug dieses Jungen war, dass er sich nie etwas sagen ließ. Von niemandem und zu keiner Zeit, sodass sein Boss zuletzt mit hängendem Kopf und sich über eine solche emotionale Kälte wundernd seiner Wege ging.
Wie kann man nur so sein! Ohne Mitgefühl, ohne Anstand. Das ist pietätlos, waren seine Gedanken.
Der Mann hatte keine Ahnung von der wunden, verdrehten Psyche seines Mitarbeiters, konnte einfach nicht ahnen, dass dieser all seine emotionalen Erlebnisse, ob Trauer oder Freude, ausschließlich im Stillen und mit sich allein ausmachte.
Wie bereits erzählt tat der Schlachtergeselle den lieben langen Arbeitstag nichts anderes, als Schweine-, Rinder- und Kalbshälften zu zerlegen. Dazu verwendete er in Andenken und aus Respekt vor seinem verstorbenen Lehrherren ausschließlich die Klinge von Monsieur Bernard, und er würde es sein Leben lang so tun, denn dieses Messer bedeutete ihm die Welt, doch das wusste niemand. Nach so vielen Jahren beherrschte er dieses Handwerk wie im Schlaf. Mit gekonnten und sicheren Schnitten zerlegte er die Fleischberge jeweils in nur wenigen Minuten in jene Formen und Mengen, die ihm vorgegeben waren. Er liebte es, sein japanisches Tranchiermesser mit dem kräftigen Griff seiner rechten Hand in die leblosen Körper zu treiben und zu beobachten, wie durch seiner Hände Arbeit die riesigen Fleischmengen zu kleinen Portionen zerlegt wurden, bis zuletzt nur noch die sauberen Knochen vor ihm auf dem Tisch lagen, die er abschließend auf ein Förderband schob, von dem die tierischen Gebeine zur weiteren Verarbeitung in die Nachbarhalle transportiert wurden. Es war eine wirkliche Kunst, diese anstrengende und anspruchsvolle Arbeit so zu erledigen, wie Jean-Baptiste es fertigbrachte. Unter seinen Kollegen fand er im Laufe der Jahre große Anerkennung und es gehörte seit jeher zum guten Ton der schneidenden Zunft, dass sich jeder, der in diesem Betrieb arbeitete, einen ganz eigenen Schnitt aneignete.
In der Hierarchie dieser Gilde galt das sozusagen als ein individuelles Markenzeichen, als eine Art Unterschrift. Außerhalb der Markthallen würde niemand auch nur ansatzweise erahnen, dass jedes Tier mit einem individuellen und besonderen Cut zerlegt worden war. In Kreisen der Schlachter aber kannte jeder die Signatur der anderen und war in der Lage, an einem ausgelösten Steak zweifelsfrei und sofort zu erkennen, von wem es geschnitten worden war.
»Jean-Baptiste, Du brauchst ein ganz besonderes Schnittbild. Niemand ist so versiert wie Du und keiner kommt auch nur ein Stück weit an Dein Können heran. Also. Lass Dir etwas Besonderes einfallen. Du hast Dir diese Anerkennung wirklich verdient«, meinten seine Mitstreiter einhellig und voller Hochachtung.
Das alles lag inzwischen weit zurück und war jetzt ungefähr zwanzig Jahre her. Tatsächlich war es Jean-Baptiste nach vielen Versuchen gelungen, ein ganz eigenes Konterfei zu kreieren. Er holte bei seinen Schnitten längst nicht so weit aus, wie andere Kollegen, sondern drückte die noch immer extrem scharfe Klinge mit seinen kräftigen Händen in das Fleisch und drehte dabei den Handrücken nach außen, sodass am Ende eine leichte Hohlkehle im Schnittbild entstand.
»Das ist Deiner würdig. So schneidet ein wirklicher Künstler«, waren die anerkennenden Worte der Belegschaft, und Jean-Baptiste, der (bis auf die Zeit seiner Lehre) in seinem Leben wenig Anerkennung und Lob erfahren hatte, sonnte sich im warmen Glanz dieser Worte.
Inzwischen musste er sich nicht mehr konzentrieren, um diesen sonderbaren Schnitt durchzuführen. Alles war längst zur Routine geworden, ein Teil von ihm. Einzigartig, individuell, sauber und perfekt.
Doch zurück ins Marlusse et Lapin. Er saß also allein am Fenster des Lokals, schaute noch immer hinaus in die Nacht und stellte fest, dass der Regen langsam nachzulassen schien. Wie auf Kommando füllten sich die Straßen mit Menschen, und gerade in Pigalle sind nach Einbruch der Dunkelheit die Touristenhorden ständig unterwegs, die in diesem noch immer etwas anrüchigen Stadtviertel abendliche Zerstreuung und Unterhaltung suchen. Viele besuchen die Abendshows des Moulin Rouge, andere wieder gehen die Treppen hinauf zum Montparnasse oder verschwinden zum Abendessen in den unzähligen Restaurants dieser Gegend.
Robert Bishop, ein extrem eleganter, gutaussehender, sehr gebildeter und wohlhabender Geschäftsmann aus Los Angeles/ Kalifornien, war mit seiner Familie für eine Woche nach Paris gekommen. Seine Tochter Joana, ein bildhübsches, äußerst liebenswürdiges, blondes, junges Mädchen, hatte die Reise zum mit sehr guter Note bestandenen Abitur bekommen und genoss die Tage mit ihren Eltern in dieser wunderbaren Stadt. Sie wusste, dass sie das nicht mehr ganz so oft haben würde, da sie vermutlich sehr bald schon in New York ein Medizinstudium aufnehmen würde und künftig nicht mehr viel mit ihren Eltern unternehmen könnte. Ihr Daddy liebte sie über alles und erfüllte ihr fast jeden Wunsch, was der Mutter nicht immer gefiel. Doch was sollte sie machen? Die zwei waren ein Herz und eine Seele, sich so ähnlich und unzertrennlich. Robert und Joana wussten beide nicht, wie sie die bevorstehende Studienzeit ohne einander überstehen sollten. Umso bedeutungsvoller waren diese wunderbaren und erlebnisreichen Tage in Paris. Die Familie war bereits den ganzen Tag unterwegs gewesen, hatte den Eiffelturm erklommen, den Arc de Triomphe de l’Etoile besucht und war stundenlang über die Champs-Élysées geschlendert.
Als es Abend geworden war, mussten sie unbedingt den Sonnenuntergang vom Montparnasse aus bestaunen. Eine Pflicht für jeden Parisbesucher. Das durfte man sich keinesfalls entgehen lassen. Unabhängig von der Wetterlage begegnete man dort vielen Menschen, Straßenkünstler, aber auch Taschendiebe gaben und geben sich dort ein tägliches Stelldichein und unterhielten die Touristen gegen ein kleines Geldstück oder beklauten sie. Wie dem auch sei. Die Sonnenuntergänge und die Pariser Skyline von hier aus zu beobachten, war und ist immer wieder ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Irgendwann aber löste sich auch an diesem Tag die Menschenmenge langsam auf und die Bishops schlenderten die Treppen dieses romantischen Ortes hinunter, um zuletzt am Place Pigalle zu landen und die Eingangstür des Marlusse et Lapin zu öffnen.
»Lasst uns noch etwas trinken, bevor wir ins Hotel fahren. Ich habe von diesem Lokal einiges gelesen und denke, wir finden hier einen schönen Tagesabschluss«, sagte Robert mit seinem Einhundert-Dollar Charmbolzenlächeln zu seinen Mädels, die sich auch nicht lange bitten ließen.
»Mir tun die Füße ordentlich weh und ich bin froh, jetzt ein wenig sitzen zu können«, sagte Joana erschöpft.
»Mir geht es keinen Deut besser«, antwortete ihre Mutter und wies auf einen letzten freien Tisch nahe der Bar.
»Den haben sie bestimmt für uns freigehalten«, meinte Joana.
Wie soll man es nun ausdrücken? War es Bestimmung oder Zufall, dass Robert Bishop die Tür hinter sich schloss und, indem er sich umdrehte, einen Blick in genau die Ecke warf, in der Jean-Baptiste saß. Robert folgte einer inneren Eingebung, blieb stehen, die beiden sahen sich reglos an und ließen die Augen aus unerklärlichen Gründen einige wenige Sekunden an dem jeweils anderen geheftet.
»Dad, kommst Du?«
Es waren die Worte seiner Tochter, die ihn aus diesem seltsamen Moment lösten, er sich abdrehte und sich neben seine Frau auf einen Barhocker setzte. Während des Aufenthalts in dem Lokal war Robert sehr abgelenkt und würdigte den Mann keines weiteren Blickes, schaute allerdings beim Verlassen der Bar noch einmal in die jetzt leere Ecke, in der jener Unbekannte gesessen hatte. Später am Abend bis zum Einschlafen konnte er es sich einfach nicht erklären, warum ihm dieser unscheinbar aussehende Franzose nicht aus dem Kopf gehen wollte. Immer wieder tauchte dessen regloses Gesicht vor ihm auf und sah ihn mit leerem Blick an. Als Robert am nächsten Morgen aufwachte, war alles anders. Er hatte kaum noch eine Erinnerung an den Mann in der Bar, dachte lediglich einen kurzen Moment an diese sonderbare Begegnung und löschte sie sogleich ganz aus seinen Gedanken.
So schnell passierte aber erst einmal nichts. Das Buch des Lebens hatte das Kapitel für die zwei Männer erst ein paar Seiten später vorgesehen. Die Begegnung im Marlusse et Lapin war lediglich eine erste Note, sozusagen die Ouvertüre in einem mehr als ereignisreichen Musikstück.
Am Abend zuvor, hatte sich Jean-Baptiste etwa eine Stunde nach der seltsamen Begegnung auf den Heimweg gemacht. Leicht angesäuselt trat er durch die Tür in die Nacht hinaus und sog die Geräusche der belebten Straßen auf, wie ein trockener Schwamm das Wasser. Es herrschten milde Temperaturen in dieser Juninacht und der Regen hatte inzwischen aufgehört, als er sich eine Zigarette ins Gesicht und seine Hände in die Hosentaschen steckte, um gemütlich seines Weges zu gehen. Er überquerte den Boulevard de Clichy, passierte wenig später den Place Pigalle, folgte der Rue Victor Massé der Rue Condorcet, um nach einer knappen halben Stunde in die Rue de Maubeuge abzubiegen. Die reflektierenden Lichter auf den noch immer regennassen Straßen, der Verkehr, die um diese Zeit immer noch vielen Menschen aus allen Herrenländern, die schönen Fassaden der die Straßen säumenden Häuser. Jean-Baptiste liebte diese Stadt und war dankbar, dass sie im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden war. So blieb der Welt das wunderbare Flair und der Zauber von Paris erhalten. Immer wieder träumte er sich durch die Zeiten von Victor Hugo, Émile Zola, Edith Piaf und anderen großen Künstlern, die über die Epochen in der Bohème dieser Metropole zu Hause gewesen waren. Zu gern hätte er eine Zeitmaschine besessen, die ihn zurück in die Tage seiner Idole katapultierte, um zu sehen, wie Paris damals aussah, wie es auf den Straßen roch und wie es sich anhörte, wenn die noch junge Édith Piaf in den sicherlich verschmutzten Straßenzügen sang, um ein kleines Geld zu verdienen. Natürlich gab es Fotos und andere Zeitdokumente, die vom damaligen Leben erzählten, doch Jean-Baptiste meinte zurecht, dass es etwas vollkommen Anderes sein musste, wenigstens ein paar Stunden mit den Künstlern früherer Tage persönlich verbringen zu dürfen.
Bald schon war er zu Hause, erklomm die Stiegen des alten Hauses und erreichte nach vielen Treppen seine kleine Mansardenwohnung hoch unter dem Dach. Zwei kleine Zimmer, die nur spärlich und sehr kostengünstig eingerichtet waren. Er arbeitete hart, verdiente aber kaum genug, um hier leben zu können. Doch irgendwie schaffte er es, die zwei Zimmer, die sein eigener Platz in dieser Welt waren, zu finanzieren. Wenn er hier die Türe hinter sich schloss, war er endlich allein und gänzlich ungestört. Nichts und niemand ging ihm hier auf die Nerven. Häufig öffnete er mitten in der Nacht die Tür zu einer kleinen Dachterrasse, stellte sich auf einen Stuhl und blickte träumend über die Dächer des beleuchteten Häusermeeres der unaufhörlich pulsierenden Stadt. So war es an diesem Abend allerdings nicht. Er war platt wie eine Flunder, müde, total erschöpft. Er legte sich aufs Bett, schloss die Augen und fiel in einen unruhigen Schlaf. Verschiedene Ereignisse des Tages meldeten sich in einem wirren Traum zurück und wollten vom Unterbewusstsein verarbeitet werden. Zuletzt tauchte nur schemenhaft und für den Bruchteil einer Sekunde ein seltsamer, ihm unbekannter Mann auf, der seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Das konnte nur die Begegnung mit Robert Bishop gewesen sein, doch so klar war es Jean Batiste nicht, als er am Morgen erwachte und etwas zerknirscht aus seinen Augen schaute.
Die meisten Träume vergessen wir, wenn wir am Ende einer Nacht die Augen öffnen und zumeist nur zögerlich, dafür auch schon einmal etwas missmutig aus den Federn kriechen, weil wir lieber im Bett bleiben würden. Auch wenn wir meinen, endlos lang geträumt zu haben, dauern die bewegten Traumbilder tatsächlich kaum länger als fünfzehn bis zwanzig Minuten. Doch nicht alle Träume gehen verloren. Erwachen wir beispielsweise unmittelbar nach der REM-Phase, der letzten Phase im Schlafzyklus, wird unser Gehirn wieder aktiver, und so ist es möglich, dass wir einen Traum oder einen Teil davon mit in den Tag nehmen.
So war es auch bei Jean-Baptiste. Immer klarer wurde das Bild von Robert Bishop vor seinem geistigen Auge, als er in der Metro zur Arbeit fuhr und mehrfach über die Begegnung am Abend zuvor nachdachte.
Wer war dieser Mann? Den habe ich noch nie gesehen. Warum aber erschien er mir im Traum und warum geht er mir nicht aus dem Kopf?, fragte er sich immer wieder, bis er zuletzt wie jeden Tag mit seinem Messer vor einer Rinderhälfte stand, sich auf das Zerteilen des Fleischberges konzentrierte und Roberts Gesicht sehr bald schon aus seinen Gedanken verdrängte.
Lyon - Mordkommission
»Was für ein Haufen Dreck. Wer hat dieses arme Ding nur so grausam zugerichtet? Womit hat sie das verdient?«, sagte Commissaire Victor Lacroix.
»Irgend so ein Sadistenschwein«, antwortete Louise Durand mit kurzen Worten und bösem Blick.
»Wenn ich diesen Mistkerl in die Finger bekomme, schneide ich ihm eigenhändig das Gekröse ab«, führte sie weiter aus.
»Und wenn es eine Frau war?«, gab Victor seiner attraktiven Stellvertreterin zu bedenken.
Tatsächlich hätte auch eine Frau den Mord begangen haben können, gestand sie sich gedanklich ein.
Genau diese weitgefächerten Sichtweisen auf die Dinge waren es, die den Chef der Mordkommission ausmachten. Bei seinen Ermittlungen ließ er alles zu, zog auch das Unmöglichste in Betracht und schloss absolut nichts aus. Diese Art zu denken war in der Vergangenheit immer wieder zum Erstaunen seiner Kollegen der Schlüssel zur Aufklärung vieler Verbrechen gewesen. Einen solchen Blick auf das Wesentliche konnte man allerdings nur sehr schwer erlernen. Dem Commissaire lag es jedoch im Blut, die Tatorte, die Spurenlagen aber auch die Ermittlungsergebnisse aus immer wieder neuen, kritischen Blickwinkeln zu betrachten.
»Warum sollte aber eine Frau eine Prostituierte nicht nur ermorden, sondern auch derart übel zurichten?«
»Eifersucht ist seit Urzeiten ein starkes Mordmotiv. Stell Dir vor, ein Mann geht ständig ins Rotlichtmilieu und quält so die Seele seiner eifersüchtigen Frau. Wenn diese nun den Schmerz dauerhaft unterdrückt und die Emotionen sich dann plötzlich entladen, ist alles möglich. Sadismus, Übertötung und vieles mehr.«
»Übertötung?«
»Das Opfer ist bereits tot, der Täter oder die Täterin sticht trotzdem weiter zu. Wieder und immer wieder. Das nennt man Übertötung.«
»Das trifft in diesem Fall aber nicht zu.«
»Nein. Dieses Opfer ist wie die anderen durch einen sehr glatten Schnitt zu Tode gekommen. Die Klinge muss höllisch scharf gewesen sein.«
Tatsächlich hatte die Polizei über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren in größeren Zeitabständen die Tötung von sieben Frauenleichen mit durchtrennter Kehle auf dem Straßenstrich von Lyon bearbeiten müssen. Es handelte sich immer um Prostituierte und es war bislang nicht gelungen, dem Täter auch nur ansatzweise ein Stück weit auf die Pelle zu rücken. Selbstverständlich hatte man sehr unterschiedliche