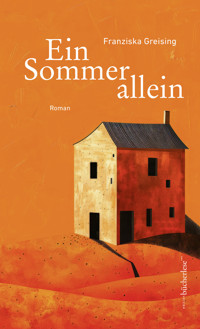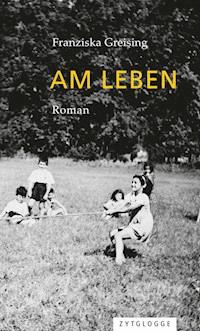
29,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Porträt einer Unbeugsamen •Eindringliches Porträt der Glarnerin Rose (Rösli) Näf, die später als «Gerechte unter den Völkern» geehrt wurde •Unerschrockene Schweizerin, die während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich ein Heim für jüdische Kriegskinder leitete •Auf historischen Tatsachen basierender Roman Im Süden Frankreichs leben 1940 bis 1944 hundert jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich in einem heruntergekommenen Landschloss. Die dreissigjährige Rose aus Glarus, die zuvor bei Albert Schweitzer in Lambarene als Krankenschwester gearbeitet hat, tritt hier ihre neue Stelle an. Sie übernimmt die Leitung des Hauses und bietet den Kindern in der noch unbesetzten Zone Schutz und Geborgenheit. Das Schweizerische Rote Kreuz beschliesst kurz darauf die Zusammenarbeit mit ihr. Nachdem Nazideutschland auch Frankreichs Süden besetzt, nimmt die Bedrohung dramatisch zu. Eines Morgens werden die älteren Jugendlichen in ein Lager verschleppt. Die offizielle Schweiz und das Rote Kreuz kommen nicht zu Hilfe. Franziska Greising erzählt die Geschichte einer loyalen SRKMitarbeiterin, die sich im Laufe der Ereignisse gezwungen sieht, mit den Vorschriften zu brechen, um ihre Schützlinge zu retten. Der Roman erzählt von der Unerschrockenheit der noch viel zu wenig bekannten Glarnerin, die später die Auszeichnung «Gerechte unter den Völkern» verliehen bekam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
FRANZISKA GREISING
AM LEBEN
Franziska Greising
AM LEBEN
Roman
Mit freundlicher Unterstützung von:
© 2016 Zytglogge Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Angela Fessler
Coverfoto: United States Holocaust Memorial Museum,
courtesy of Sebastian Steiger
Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std
ISBN: 978-3-7296-0913-6
eISBN (ePUB): 978-3-7296-2094-0
eISBN (mobi): 978-3-7296-2095-7
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
www.zytglogge.ch
Inhalt
Wie schön heute die Kinder aussehen
Wie Zucker und Salz
Wenn es soweit ist
Chaim
Nachtgespräch
Inge
Hava Narisha
Das Radio
Rose kann Europa nicht retten
Bronia
Das Piano
Als gäbe es nur den Wind
Sechzehn
Weihnachten
2. Teil Macht der Verhältnisse
Überfall
Le Vernet
Macht und Ohnmacht
Spionage
Die Deutschen sind schließlich ein hochkultiviertes Volk
Glarus
Schicksal, du räuberisches
Ich will Feindschaft setzen (1. Buch Moses)
Zäune. Schnee. Silvester
Als redeten sie über eine zugelaufene Katze
Kurzschluss
Nicht ohne Seitenblick auf den braunen Nachbarn
Wie es weitergeht
Sich eine Vorstellung machen – Epilog
Über das Buch
Über die Autorin
Wie schön heute die Kinder aussehen
Juri fiebert, es ist Sommer. Und an der Decke hockt ein winziger Punkt. Oder hat er den im Auge? Nein, dort ist was. Eine kleine Spinne vielleicht. Und wenn sie herunterkommt, auf ihn herunter? Ihm übers Gesicht läuft? In seine Nase spaziert? Sie bewegt sich. Schon wieder. Oder ist da oben kein Punkt, keine Spinne, schwimmt ihm bloß ein Stäubchen im Auge?
Eine Frau tritt ein. Es ist nicht Mama, nein, Mamas Schuhe klingen anders. Und es sind nicht die vertrauten Wände, auch das Bett, in dem er liegt, nicht das seine, nichts ist vertraut hier, und schnell ist sie bei ihm, zwischen den Reihen der Betten ihr Gesicht, um das Gesicht ein Kranz aus Kraushaar, ganz hellem Kraushaar, das Sonnenlicht scheint hindurch. Die Frau deckt Juris Bett auf.
– So, sagt sie, der Wickel wäre fällig, junger Mann. Zieh dich aus, sagt sie, oben, nur oben.
Über ihrem Unterarm hängt eine dicke Wolldecke. Jetzt bemerkt er das Paket, das sie auf einer Hand balanciert wie ein flaches Brot frisch aus dem Ofen, es riecht nach Wiese, nach Sommer. Sie legt das heiße Duftpaket auf seine mageren Rippen.
– Es brennt, ah es brennt.
Sie entfernt es wieder, trägt es im Zimmer herum, schwenkt es ein wenig und legt es von neuem auf.
– Geht’s?, fragt sie, ein bisschen heiß muss es schon sein, sagt sie, weil dadurch der Husten weggeht und du besser atmen kannst. Bald springst du wieder mit den anderen draußen herum.
– Glaubst du, ich darf dann beim Seilziehen dabei sein?
– Aber ja, mein Kleiner, aber ja.
Um die Brust das heiße, feuchte, duftende Tuch. Darum herum die Wolldecke, dann ein Federbett bis unters Kinn gezogen und ein zweites obendrauf. Die Frau schließt das Fenster, Licht scheint von draußen durch ihr Haar, er zieht den mageren Brustkorb ein, der Wickel bewegt sich mit. Duft nach Sommerwiese.
Kein Ton ist mehr zu hören von draußen, auch nicht vom Innern des Schlosses, seinen Kammern und Stuben, seinen hohen Räumen. Es ist ein großes Schloss. Dennoch hat er sich Schlösser bisher anders vorgestellt. Mit Wimpeln, Türmchen, goldenen Treppenläufen, mit Fanfaren am Tor und Stallungen mit weißen Pferden. Es ist kein König da, keine Königin, auch keine Prinzessin oder ein Prinz. Weder liegt er im Himmelbett noch auf sieben Matratzen oder in seidenen Tüchern. Sie bewegt sich. Schon wieder. Verschwindet. Ist wieder da. Oder gibt es da oben keine Spinne, schwimmt ihm bloß ein Stäubchen im Auge?
Er hatte auf Kartoffelsäcken geschlafen, und die Läuse waren auf ihm herumgelaufen, und wie Atmen oder Pinkeln war da von früh bis spät auch das Suchen nach etwas Essbarem gewesen. Er hatte vergessen, dass es auch ein Leben gab ohne diese Pein. Das war, bevor sie Mama geholt hatten, bevor Mama ihm hinter den Stäben zugewinkt hatte, bevor sie etwas rief, was er nicht verstand, bevor sie ihn einer Frau in die Arme gedrückt, trotz seiner Tränen, seiner Halsstarrigkeit einer fremden Frau in die fremden Arme gedrückt hatte, bevor ein Soldat ihr einen Stoß gab, und sie hinfiel.
Juri hatte gewartet, dass sie zurückkommt, sie war nicht gekommen, man hatte ihn in dieses Haus gebracht, dieses Schloss mit den vielen Kindern, die er nicht kannte, wo er Tage und Nächte hindurch weinte und keine Ruhe finden konnte, weil er nicht wusste, was Mama ihm zugerufen hatte, damals, bevor sie sie hinaufstießen in den Zug.
Und wenn die Spinne herunterkommt, wenn sie entlang eines Fadens auf ihn heruntersaust? Er ist eingepackt, und sie läuft ihm übers Gesicht?
Mama wischt mit der Hand die Spinnfäden fort lächelt entfernt sich winkt zwischen den Stäben sagt etwas er versteht nicht sie lächelt wird klein winzig klein winkt Mama hört er sich rufen Mama es rattert rattert er hat Angst runterzufallen aufs Geleise die langen unendlichen Schienen ich will raus ruft er raus.
Eine Hand berührt seine Stirn. Er schlägt die Augen auf und schaut in lauter Bubengesichter. Der eine richtet seinen Blick etwas verstört auf ihn herunter, eigene Alpträume erinnernd, die ihn in Angst versetzt hatten. Andere scheint es zu grausen vor dem tränennassen Gesicht, ohne Erbarmen war ihnen beigebracht worden, dass ein Junge nicht weint, und geglaubt hatten sie’s, jetzt sehen sie einen Jungen vor sich, dem das Weinen hinterrücks gekommen war, im Schlaf. Diese Kinder wandern alle in den Trümmern ihrer Kindheit, wenn sie schlafen, sie wissen, wie Träume einen erschrecken können.
Einer sagt: Der fiebert, Rose soll kommen.
– Hast du Fieber, hast du geträumt?, fragt einer der Großen, und zu den andern sagt er: Es war bloß ein Traum. Doch will er damit die Träume nicht kleinmachen. Denn ein Traum ist keine Krankheit, ist kein Gendarm, will er ihnen klarmachen, und es ist nicht wahr, was die Erwachsenen sagen, dass ein rechter Junge nicht weint. Der Traum will bloß den Schutt des Lebens beiseiteschaffen, damit der nicht die Brücke verschüttet, über die man in die Zukunft kommt. Wenn wir aber weinen und uns herumwerfen im Traum, so bedeutet dies, dass uns manch ein Brocken noch zu schwer ist und wir noch viele Träume träumen müssen. So oder ähnlich hatte einmal jemand zu ihm gesprochen. So oder ähnlich. Jemand. Irgendjemand. Früher. Anderswo.
Also bloß ein Traum, denkt Juri, bloß ein Traum, auch wenn sein ganzer Körper zittert. Er lächelt dem großen Jungen zu, Jacques heißt er und ist sein Freund. Jacques ist schon fast erwachsen, glaubt Juri. Und am Anfang, als Juri jeden Morgen ein nasses Bett gehabt hatte, da durfte er bei Jacques schlafen, im warmen Bett, im Zimmer der großen Buben. Und das Laken war trocken geblieben.
Die Frau tritt wieder ins Zimmer, die Jungen machen sich aus dem Staub.
– Wir nehmen jetzt den Wickel ab, sagt sie und löst die vielen Tücher von den mageren Rippchen.
– Erzähl von Afrika, bettelt er. Wenn sie erzählt, kann er sich mit ihr davonmachen. Das Gefühl, dass ihm was Wichtiges verlorengegangen sei, schwindet beim Zuhören. In Roses Afrika kennt er sich schon halbwegs aus.
– Afrika, beginnt sie, ist voller Geräusche. Besonders nachts hörst du sie, denn am Tag ist viel zu tun, verstehst du. Die Leute reisten weit, manche liefen Tage, um zu uns zu kommen mit ihren Nöten und den kranken Kindern. Und dann hatten sie ihre Kochtöpfe dabei, und es wurde gekocht und geplaudert und gestritten. Auch gesungen, viel gesungen. Wir wohnten und arbeiteten in einem Haus auf Stelzen. Aus dünnen Wänden ohne Treppenhaus, du kamst durch die Tür gleich mitten hinein, man schlief unter weißen Netzen. Um uns herum standen hohe Bäume, von denen ich noch nie gehört hatte. Mangos, Ölpalmen und jene Apfelbäume, die uns hier fremd sind. Ich wollte einen der Äpfel anbeißen, hob ihn auf und biss hinein. Pfui Teufel, sagt sie, und der kleine Juri lacht, als er sieht, wie sie das Gesicht verzieht.
– Erst wenn man die Äpfel kocht, schmecken sie. Und die Vögel saßen dort und riefen den ganzen Tag. So große Vögel wie, ich weiß nicht, wie du etwa. Auch nachts gab es Geräusche, andere als am Tag. Und unten vom Fluss Ogowe hörte ich jede Woche das Dampferchen heranpusten. Und ich hörte die Leute in ihren Ruderbooten, wie sie herüberlärmten, und wie jene, die am Ufer warteten, sie mit Getöse willkommen hießen. Viele der Kranken reisten in schmalen Kanus herbei und brachten ihre Verwandten oder Nachbarn mit. Stets kochte irgendwer für seinen Kranken und die Familie des Kranken, und es duftete den ganzen Tag nach Essen. Sie haben alles dabei, was sie tagtäglich brauchen, ihre Bodenmatten zum Schlafen, ihre Kisten mit den Töpfen zum Kochen und das ganze Drum und Dran. Auch ich war mit dem Dampferchen gekommen. Und die Leute standen alle am Ufer, wie sie es immer tun, wenn angelegt und ausgeladen wird, und empfingen mich staunend, auch ein wenig scheu. Dem Doktor jubelten sie zu, umringten ihn und beschenkten ihn.
– Gab es keine gefährlichen Tiere im Fluss?, fragt er. Krokodile?
– Flusspferde. Riesig, sag ich dir, sie verschlucken ganze Häuser mit einem einzigen Schnappen. Und dabei haben sie oben auf dem Schädel zwei enorme Augen und nur zwei winzige Mäuseöhrchen.
Als sie sieht, wie Juri angstvoll die Augen aufreißt, bricht sie ab.
– Nein, mein Kleiner, neinnein, das war nur Spaß. Aber sie hatte die Verletzungen gesehen, die diese Flussriesen den Menschen beibringen, wenn die Boote zu nahe kamen. Sie hoben die Kanus auf ihre Rücken, ließen sie kentern und griffen die Flüchtenden an. Aber darüber schweigt sie. Es ist keine Geschichte für einen kranken Jungen, dessen eigenes Lebensschiffchen bereits gekippt ist. Oder könnte es ihn stärken, zu erfahren, dass überall auf der Welt Gefahren sind und dass Afrika nicht das Paradies ist? Darüber, beschließt sie, muss ich erst nachdenken.
– Und Krokodile, hast du Krokodile gesehen?, beharrt er.
– Hab ich nicht, nein.
– Und Elefanten, hast du Elefanten gesehen?
– Die rückten abends an, antwortet sie, und saugten Tonnen von Wasser mit ihrem Rüssel ein, sie bogen ihn nach hinten und spritzten sich den Ogowefluss über die Rücken. Die Elefantenbabys trotteten zwischen den vielen Beinen umher. Du weißt ja, wie groß die Tiere sind, oder?
– Ist das nicht gefährlich für die Babys?
– Nie wird eines zerdrückt. Die Kleinen trinken und spritzen, wie sie es den Großen abgeguckt haben, und grummeln fröhlich dabei, sie sind so süß. Aber jetzt schlaf noch ein Stündchen, ja?
– Und was war mit den Moskitos?
– Die Moskitos?
– Ja, und mit den schlimmen Fliegen?
– Erzähl ich dir ein andermal.
– Und hattet ihr Moskitonetze?
– Ja, auch Moskitonetze. Aber, sag, woher weißt du so viel über Afrika?
– Mein Onkel. Er ist Afrikaforscher.
– Dann werden wir uns noch viel über Afrika zu erzählen haben, wir beide. Und jetzt schlaf noch ein bisschen, mein Kleiner, schließt sie, ich muss weiter nach dem Rechten sehen. Werd’ bald gesund. Ich komme wieder.
Die Frau mit der weißen Schürze hält einen Moment inne. Sie schaut aus einem der großen Fenster zum Gemüsegarten mit den Stangenbohnen, dem ausufernden Kürbis, dem Lauch, den Zwiebeln und dem filigranen Kraut der Karotten hinunter, sieht zwischen den Beeten das eine oder andere Kind sich aufrichten und Haar oder Schweiß aus dem Gesicht streichen. In Roses Rücken kreuzen sich die Schürzenbänder, die sie mittels Knopf rutschfest am Taillenband befestigt hat. Die Enden des Taillenbandes bilden eine großzügige und korrekt sitzende Schleife, die sie mit ein paar eingeübten Griffen geschlungen hat. Sie lächelt. Im Mai vor einem Jahr sah sie diese Kinder zum ersten Mal. Kahlgeschoren, von Läusen geplagt, Arme, Münder und Nasen von Hungerekzemen besetzt. Viel zu dicke Bäuche, viel zu magere Gesichter. Sie erinnert sich, wie der Anblick der fauligen Kartoffeln fürs Abendessen ihren Widerwillen erregt hatte, und wendet sich, immer noch lächelnd, vom Fenster ab. Wie schön heute die Kinder aussehen! Gegen den einen ihrer Feinde, den Hunger, hat sie gewonnen.
Beim Verlassen des Raumes fällt ihr Blick wie schon oft auf das geheimnisvolle Röhrchen in der oberen rechten Ecke des Türrahmens. Es hängt dort, seit die Jungs in diesen Schlafsaal eingezogen sind. Letztes Jahr im Juni war es, die Zikaden tobten vor den Fenstern, und Mädchen wie Jungen hatten sich ausgelassen vor Freude über die sauberen Laken und Kopfkissen, die hier auf sie warteten, auf die Betten plumpsen lassen, wieder und wieder. Miguel Palau, ein spanischer Flüchtling aus der Zeit des Bürgerkriegs, hatte die Betten unter Mithilfe der größeren Knaben für alle gezimmert. Sie vermutete einen der üblichen Scherze, als sie eines Abends nach dem Zubettgehen der Jungs das längliche Ding bemerkte. Die einen legten beim Eintreten ihre Fingerspitzen an die Lippen und hernach an das Röhrchen. Rose wollte schon danach greifen, schreckte aber zurück, als sie auf der Oberfläche das seltsame Zeichen sah. Auf die Frage nach dem Sinn dieser kleinen unauffälligen Geste hatte sie ein verlegenes Kichern als Antwort bekommen. Jacques aber erklärte, das sei die Mesusa, ging hin und zog eine kleine Schriftrolle heraus. Sie war mit ein paar Worten in fremder Schrift bekritzelt. Rose bestand darauf, zu wissen, was auf dem Papier stehe. Jacques gab zur Antwort, es sei ein kurzer Text aus der Thora.
– Aha, hatte sie geantwortet, und was bedeutet das Zeichen an dem Röhrchen?
– Allmächtiger besage das Zeichen, wurde sie mehrstimmig und in den verschiedensten Tonlagen von den Betten her belehrt, und schütze den Raum vor schlechten Gedanken und Taten. Den größeren der Jungen würde schon bald die Stimme brechen. Und im Übrigen, hatte Jacques ergänzt, sei in einem traditionellen jüdischen Haushalt an jeder Tür eine Mesusa zu sehen. Für sie alle also ganz normal. Wer sie angebracht hatte, brauchte Rose nicht zu wissen. Hingegen hätte sie gerne gehört, wer sowas herstellt. Da lachten die Kinder, es gefiel ihnen, dass sie allein es waren, die die Antwort kannten. Sonst wusste diese Rose immer in allem Bescheid. Schreibgerät und Tinte dürften kein Metall enthalten, wurde sie aufgeklärt, daher käme nur ein Berufsschreiber in Frage.
– Dann hat jemand von euch die Mesusa mitgebracht? Und bei sich selber schwor sie, dieser Mesusa Sorge zu tragen. Sie sollte diese Kinder beschützen.
Wie Zucker und Salz
Als Rose im Mai vor einem Jahr ihre Stelle bei diesen Kindern antrat, lebten sie in einem Ziegenstall bei Seyre. An den Rand Europas gespült, Strandgut, sich selber überlassen. Sie sei kaum aus der Ruhe zu bringen, hatte sie geglaubt. Das Leben in Afrika hatte ihr zunächst ohne Vorwarnung den Boden entzogen. Sie musste lernen, furchtlos zu verrichten, was sie nicht kannte, und zu gehen, wohin sie nie zuvor einen Fuß gesetzt hätte. Menschen erwarteten sie, die sie nicht verstand, deren Sprache oder Denken sich von nichts ableiten ließen, das ihr vertraut gewesen wäre. Allein das Blut auf dunkler Haut hatte sie immer von neuem erschreckt. Und die hellen samthäutigen Zungen, die sie ihr entgegenstreckten, wenn sie ihre Rachen sehen wollte, hatten sie immer wieder verwundert. Erschöpft war sie letzten Sommer nach fünf Jahren in Urlaub gefahren. Die Regenzeit hatte eingesetzt, der Fluss war bis zum Spital hinauf gestiegen. Für September plante sie ihre Rückkehr. Doch der Krieg schnitt ihr den Rückweg ab. Sie war im Spucknapf dieses Krieges angekommen und begegnete lauter Elend, wohin sie sah. Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kinder hatte eine wie sie gesucht, da war sie gerade auf den Skiern gewesen, der Himmel so blau, die Luft so frisch, das Herz so froh. Sie liebte den Fahrtwind, der ihr um die Ohren pfiff, liebte das Glitzern der Sonne im Schnee, das Knirschen der Bretter bei jedem Schwung und den weiß glitzernden Schweif, der ihr dabei folgte. Der Reisebericht eines ihr Unbekannten, der die französischen Lager besucht hatte, führte ihr vor Augen, was sie eigentlich tat, oder besser: nicht tat. Wie bin ich doch gedankenlos, hatte sie sich gesagt, freue mich am Leben und kümmere mich nicht um das Furchtbare jenseits der Grenze. Es durchfuhr sie, als wäre ein Schneeball gegen ihre Stirn geprallt. Sie musste da hin.
Am Rand einer steinstaubigen Straße, bloß einundzwanzig Kilometer südlich von Toulouse, traf sie sie. Mit Augen, die der Hunger geweitet hatte, von Myriaden von Läusen, Würmern und Pusteln an den abgemagerten Körpern geplagt, in ihren Nasen und Mündern die schorfigen Stellen. An den Beinen die Wunden, Anzeichen von Mangelernährung. Diese Kinder hatten kein Bleiberecht mehr, wohin sie auch kamen. Ihre Eltern Nummern in Internierungslagern, in Gefängnissen, in Ghettos oder auf der Flucht, schon tot oder verscharrt. Hatten nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Kinder mitzunehmen, da die Visa nur für Erwachsene ohne Kinder ausgestellt wurden. Oder bei den Deportationen die Kinder zurückbleiben mussten. Die Eltern hatten geglaubt, sie vor dem Schlimmsten bewahren zu können, indem sie sie rechtzeitig einer wohltätigen Einrichtung in Belgien übergaben, die sich um sie kümmern würde, einer Organisation reicher Damen. Hitler war mittlerweile überall, kaum ein Ort war mehr sicher, kaum ein Versteck, es blieb für viele nur noch die Reise übers Meer. Nach Amerika, nach Palästina, Australien. Es gab Eltern, die ihren Kindern aus Sibirien ein Lebenszeichen schickten.
Es war ein verfrühter Frühlingstag im dritten Kriegsjahr, als der rote Sportwagen Marke Bugatti vor den schäbigen Ziegenstall in Seyre heranfauchte und viel Staub aufwirbelte. Aus allen Himmelsrichtungen rannten die Kinder herbei, fuchtelten mit ihren mageren Armen und hießen das rote Auto misstrauisch willkommen. Sie trugen büschelweise Brennnesseln in den Händen. Maurice Dubois, Leiter der Toulouser Filiale der SAK, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kinder, öffnete die Türe auf der Fahrerseite, sprang heraus und eilte um den Wagen. Doch da war seine Mitfahrerin schon bei der rechten Tür ausgestiegen, und ihr Haarkranz leuchtete wie auf einem Heiligenbild. Aber die Kinder waren jüdisch, kannten keine Heiligenbilder und dachten sowieso manches anders. Sie umtanzten jetzt das glänzende Auto, begrüßten lebhaft den hochgewachsenen Blondschopf in Knickerbockern, den sie schon kannten, begutachteten den Knoten am Hinterkopf der fremden Frau, ihren ratlosen Blick im redlichen Gesicht. Ahnten nicht, wie erschreckt die Frau von dem war, was sie hier sah.
Groß und breitschultrig stand sie an jenem denkwürdigen Tag auf dem steinigen Boden. Ums Weinen war ihr, Weinen aus Wut. Aber das sollte niemand merken. Weder Dubois, ihr Chef, noch diese Kinder. Worauf hatte sie sich eingelassen! Zurück von Afrika, hatte sie gedacht, bringt mich nichts mehr durcheinander. Jene Jahre haben mich völlig umgekrempelt. Mich, alles. Aber das hier …
Es ist Krieg, wie sollte sie es vergessen haben, und sie erlebt ihn nicht zum ersten Mal. Letztes Mal war sie kaum geboren, aber sie hatte auf alten Fotos ihren Großvater in Soldatenuniform gesehen, die Großmutter daneben, versteckt unter einem jener gigantischen Hüte von damals, ganz in Schwarz hatte sie Abschied genommen, aufrecht, eine tapfere Soldatenfrau, die zu wissen glaubte, was sie dem Vaterland schuldet, Stolz. Sie hatte über den Krieg reden gehört, abgerissene Sätze, die sie entsetzten. Im Glarner Tagblatt sah die kleine Rösi Bilder von Krüppeln, Geschützen und Paraden, Häusern in Flammen.
Und nun, dreißig Jahre später, grinste sie wieder das Antlitz des Krieges an, und sie fürchtete, dass dies hier ihr Können, trotz allem guten Willen, übersteigt. Was sie auf der Reise hierher gesehen hatte, war ein Abbild des herrschenden Weltelends. Und hier stand, hier stand sie nun. Vor einem baufälligen Stall ohne Fensterscheiben. Und wusste noch nicht einmal, wie die Kinder in dieser Behausung aus schmutzigrotem Mauerwerk, ohne Ofen und ohne warme Decken die Wintermonate zugebracht hatten, oder wie sie sie alle würde ernähren können. Die Deutschen im Norden Frankreichs fraßen der Bevölkerung im unbesetzten Süden die Kartoffeln, das Mehl, das Fleisch, die Eier weg, hatte Dubois erzählt.
Wieder einsteigen, dachte sie, nur fort hier, fort, mir dies nicht länger ansehen müssen. Die Jungen- und Mädchengesichter so furchtbar mager, manche grau, aus vielen Augen schaute der Ernst Erwachsener, und aus den meisten schoss ihr das Misstrauen von Gehetzten entgegen. Buben wie Mädchen trugen ihr Haar geschoren, mussten demnach von Läusen heimgesucht worden sein. An den steckendünnen Beinen eiterten Wunden, Gfrörni, mutmaßte Rose, hoffend, es möge keine ansteckende Krankheit sein. Und was ihr ganz unfassbar schien: das gute Benehmen dieser Vielzahl von Kindern aller Altersstufen.
Eine Frau und ein sehr junges Mädchen saßen an jenem Frühlingstag 1941 im Innern des Gebäudes vor einem Berg Kartoffeln, trennten aus den Knollen heraus, was noch fürs Abendessen zu gebrauchen war. Die beiden sahen zu, wie die Schweizerin mit ihrem Landsmann draußen auf der Straße auf- und abging.
– Man hat ihnen ein Schloss in Aussicht gestellt, redete Dubois damals auf die Fremde ein, sie blieb ab und zu stehen, den Blick aus ihren hellen Augen prüfend auf ihn gerichtet, doch sie bewohnen immer noch diesen Ziegenstall, er wies zum langgezogenen Gebäude hinüber, in dem die Frauen das Essen rüsteten.
– Ja, sagte die Blonde, während der Wind ihren Mantel öffnete, so dass ihre leichte Pflegerinnentracht zum Vorschein kam, alles, was fliehen muss, will nach Frankreich. Sie schritt von neuem aus, mit festem, entschlossenem Gang, mit schwingenden Armen.
– Es soll inzwischen ein anderes Schloss gefunden worden sein, nicht wahr?, fragte sie.
– Man ist dabei, es herzurichten, sagte Dubois. Die Sechzehn- bis Siebzehnjährigen sind bereits dort und gehen einem Schreiner an die Hand, der Betten für die hundert Kinder, auch Tische und Bänke macht. Bettdecken werden genäht und Wände gestrichen. Im Schlosshof wollen sie eine Zisterne einrichten. Aber bitte, stellen Sie sich bloß keinen Palast vor.
– Das wird die Neue sein, die hier das Zepter übernehmen soll, flüsterte im Küchenwinkel des Ziegenstalls die Ältere der Jungen zu.
– Er sieht einfach hinreißend aus, entgegnete Inge, das junge Mädchen. Sie hatte Kartoffel, Messer und die schmutzigen Hände auf den Tisch sinken lassen und sah unverwandt hinaus.
– Bin gespannt, wie Franks mit dieser Directrice zurechtkommen werden, meinte Flora, die andere.
– Er ist mindestens zwei Meter groß. Und schau, wie aufrecht er geht!
– In der Tat. Sehr aufrecht.
– Und wie elegant er sich kleidet! Wie einer vom Film.
– Ich habe schon lange keinen so gutgekleideten Mann mehr gesehen. Und sie, naja, ein erstaunliches Paar. Er und seine Schweizer Arbeitsgemeinschaft haben uns nun unter die Fittiche genommen. Darum muss jetzt eine der ihren hier zum Rechten sehen.
Sie verstummten. Rose betrat mit Dubois die dürftige Unterkunft. Sie hob den Fuß über die Schwelle, blieb stehen, musste sich erst an das Halbdunkel gewöhnen, ließ nachdenkliche Blicke herumschweifen. Vermochte auf dem Erdboden, dicht den Wänden entlang die mit Stroh bedeckten Bretter zu sehen, die nach und nach aus dem Halbdunkel sichtbar wurden. Vermutlich die Betten, dachte sie erschrocken. Hier ist dem Schmutz nicht Herr zu werden und der Tod nicht weit, stellte sie fest. Dann erblickte sie die Herdstelle. Große Waschkessel standen auf dem Feuer. Kochen sie etwa darin?, fragte sich Rose verzweifelt.
– Ich möchte Ihnen Rose Näf vorstellen, die neue Directrice, die eben zu uns gestoßen ist. Vor dem Krieg arbeitete sie in Lambarene bei Doktor Schweitzer, wandte sich Dubois an die Frauen.
Flora, die Ältere, legte ihr Werkzeug beiseite und versuchte, die Hände am Kleid abzuwischen. Sie stand auf und nickte dem Besuch zu. Ihr anmutiges Lächeln, unverbindlich. Ihr Haar in einer schwungvollen Welle nach hinten gekämmt und am Hinterkopf festgesteckt, wie es die Mode den Frauen noch vor Kriegsausbruch diktiert hatte.
– Flora Schlesinger, sagte Dubois. Sie ist seit Beginn mit ihrem Mann und dem kleinen Pauli dabei. Sie werden die beiden bestimmt noch heute kennenlernen. Bereits im Brüsseler Kinderheim Général-Bernheim betreute Flora die Küche. Dann floh das ganze Heim samt Personal hierher ins unbesetzte Frankreich. Es ging alles sehr überstürzt, habe ich mir sagen lassen. Niemand konnte ahnen, dass der Zug unterwegs mehrmals für viele Stunden gestoppt werden würde, dass Bomben auf ihn fallen würden, ein Wagen ausbrennen und man erst nach einer Woche am Ziel eintreffen würde. Flora hatte jedoch vorgesorgt. Hatte für jedes Kind einen Reiseproviant vorbereitet von dem, was sie noch auftreiben konnte.
– Wie viele Kinder kamen mit Ihnen über die Grenze?, wandte er sich an Flora.
Bei diesen Worten standen Inge wieder das Gewühl und Geschrei auf dem Brüsseler Bahnhof vor Augen, wo sich Hunderte um die letzten Fahrkarten rauften, Püffe austeilten, Frauen mit Kindern einander an den Haaren rissen, ein paar vorandrängende Männer an den Joppen zurückzuzerren versuchten, sie sah die Aufschrift neben der Schiebetür ihres Waggons wieder, Maximum zehn Pferde, das Gedränge im Wageninnern. Die Kinder vom Home Général-Bernheim quetschten sich auf die eine Seite, um nicht mit jenen andern von der Heilsarmee in Berührung zu kommen. Die waren alle noch ziemlich klein, schätzungsweise fünf- bis zehnjährig, und sie rochen. Und bald fiel auf, dass sie sich unter ihren Lumpen überall kratzten. Einige weinten. Die stete Angst vor den Bomben kam ihr wieder in den Sinn, und beim Rütteln, Stocken und erneuten Losfahren des Wagens ihr Wunsch, sie möchten getroffen werden. So hätte alles ein Ende gehabt. Das untröstliche Wimmern eines der Mädchen war wieder da, andere erbrachen sich. Die Leiterin des Home, Elka Frank, hatte damals, als ihr schien, die Flucht mit Flora und den Kindern sei in letzter Minute gelungen, und der Zug Brüssel hinter sich gelassen hatte, die Beherrschung verloren. Ungehalten hatte sie mit Fußtritten nach dem wimmernden Mädchen gezielt, bis sie, Inge, die Frau angeschrien hatte, damit aufzuhören.
– Seit Kriegsausbruch stießen immer mehr zu uns, antwortete Flora Schlesinger auf Dubois’ Frage, bereits kurz vor Abreise kamen noch viele hinzu. Unterwegs schob man weitere Kinder in die Wagen. Just hundert zählte ich, als wir schließlich hier eintrafen. Das war keine gemütliche Ferienreise, Herr Dubois, man hatte längst den Überblick verloren.
Dubois schwatzte munter fort: Flora ist eine Meisterin im Erfinden von Speisen, selbst wenn es schier aussichtslos ist. Sie bäckt Kuchen ohne Eier, und sie schmecken. Sie braut Gemüsesuppe aus Disteln, und es schmeckt. Sie lässt die Kinder Brennnesseln sammeln, und ihr Mann kocht Spinat daraus. Dabei müssen Sie wissen, jeden Krug Wasser muss er aus einem Brunnen pumpen, zwanzig Minuten von hier.
Rose war auf einmal erschöpft, was dachte der Mann sich nur mit seinen grässlichen Geschichten?
– Ihr Mann ist demnach auch hier?, wandte sie sich an Flora.
– Ernst ist mit ein paar Jungs ins Holz gegangen, lächelte diese und wies mit einer Kopfbewegung nach draußen zum Gehölz, das nicht weit entfernt zu sehen war.
Um Dubois’ Lobrede zu einem Ende zu bringen, reichte sie darauf der Neuen entschlossen die Hand. Zwei von der Arbeit rau gewordene Hände glitten ineinander, prüfend gingen die Blicke hin und her. Es standen sich eine Ehefrau und Mutter und eine Psychiatriefachfrau gegenüber. Die eine war staatenlos, hatte ein besetztes Land und die ganze Habe zurücklassen müssen, die andere, nie Ehefrau, nie Mutter geworden, besaß ein noch verschontes Land, in das sie jederzeit zurückkehren konnte. Keine sprach davon, es erzählten allein ihre Blicke und die Art, wie sie einander gegenüberstanden. Von der Sorge Floras um die tägliche Nahrung erzählten sie, vom Schicksal der Menschen, die hier hausten, und von der täglich wiederkehrenden Anstrengung, am Leben zu bleiben. Aber auch von der Entschlossenheit dazu. In Roses Blick lag immer noch der Schrecken über die Zustände in diesem Schuppen, auch die Erschöpfung und die Frage, ob sie der neuen Aufgabe gewachsen sei. In einem Aufruf hatte die Arbeitsgemeinschaft Freiwillige gesucht. Nach einer durchwachten Nacht in den Bergen hatte Rose sich gemeldet.
Welche der beiden Frauen sich der andern unterzuordnen habe, war fraglos geklärt. Und für Dubois gab es Dringenderes zu tun, als Rückschlüsse und Voraussagen zu wagen. Für Inge jedoch, die Rose und Flora still beobachtete, standen sie zueinander wie Zucker und Salz. Die Schlesinger in ihrer leicht übergewichtigen Erscheinung war für viele der Kinder schon in Belgien zu einer Stellvertreterin ihrer verlorenen Mütter geworden. Ihr vertrauten sie, ihr öffneten sie sich. Es gab Dinge, die sie ihr und nur ihr erzählen mochten. Und sie hörte wirklich zu, sie war nicht wie andere Erwachsene, die vorgaben zuzuhören und dann antworteten sie nicht einmal. Flora Schlesinger fragte Tage nach einem Gespräch, ob der erwartete Brief nun gekommen sei, ob der Bruder, der im Lager so schrecklichen Hunger litt, wieder habe von sich hören lassen, ob das beantragte Visum für die Ausreise beim Vater eingetroffen sei. Sie konnte gar nichts anderes tun bei all diesen Nöten als zuhören und wieder zuhören und vielleicht ein Stück von der Schokoladeration abbrechen, sofern Schokolade vorhanden war, und es einem zuschieben.
– Und das ist Inge Joseph aus Darmstadt, unterbrach Dubois Inges Gedanken.
Das Mädchen hatte sich bereits erhoben und reichte Rose schüchtern die Hand. Es fiel ihr auf, wie kräftig die Fremde ihre Hand umfasste, einen Moment nur, doch es genügte, dass eine flüchtige Ahnung sie beschlich.
– Also aus Darmstadt, sagte die künftige Directrice.
– Sie habe Verwandte in Brüssel gehabt, entgegnete Inge. Die hätten sie im Home Général-Bernheim abgegeben.
– Gehabt?
– Bitte?
– Verwandte gehabt?, doppelte Rose nach.
Und dabei fühlte sie nichts als Widerwillen und den Wunsch davonzulaufen. Nur umkehren, rausgehen, weg von dieser elenden Unterkunft, weg von all den hungrigen Blicken. Tut mir leid, ich habe mich in der Adresse geirrt. Wie der dicke Nebel, der zu Hause manchmal über die Bergrücken kriecht, beschlich sie diese Missstimmung, sie fürchtete, jeden Augenblick die Kontrolle über dieses innere Biest zu verlieren. Von den zwei Frauen hier, die den Schmutz nicht zu sehen schienen, konnte der Impuls zu fliehen nicht rühren, auch nicht von Dubois’ Worten, dem Jammer überall, wie den klobigen Holzschuhen an den mageren Füßen der Kinder, den meist zu knappen Kleidern, den verfilzten Haaren, der krätzigen, grauen Haut, die sie aufwiesen, nein, ihnen konnte sie das Aufkommen ihrer inneren Gehässigkeit, die aufsteigende Übelkeit nicht anlasten. Aber woher dann kam sie?
– Sie sind nach Amerika ausgewandert, als die ersten Bomben auf Brüssel fielen, antwortete Inge auf die Frage der Fremden nach ihren Verwandten, und mehr würde sie nicht sagen. Nichts von Vati, der im Darmstädter Gefängnis saß, als Mutti sie nach Brüssel gebracht hatte. Und der zum Skelett abgemagert war, als sie ihn wiedersah. Nichts von Vaters Fabrik, die Konkurs gegangen war, nichts vom einst befreundeten Betriebsleiter, Mitglied bei der NSDAP, der dem Vater erst großzügig Geld geliehen und dann die Fabrik für ein Spottgeld übernommen hatte. Von Mutti, die das Haus an der Alicenstraße verkaufen musste, um dann bei Arierfamilien waschen zu gehen, nein, auch davon kein Wort, dass ihr jeder andere Beruf nicht erlaubt worden war. Immerhin war Mutti einst Stenotypistin gewesen.
Kellergeruch, Rose erkannte es plötzlich. Es war dieser Kellergeruch, der sie so ekelte. Er musste von dem Topf voller Knollen auf dem Tisch herrühren, der neben ihr und den zwei Frauen stand. Ein prüfender Blick bestätigte es ihr. Nun, dafür gab es eine Lösung, und sie bekam sich wieder unter Kontrolle. Rose war keine Person der Nettigkeiten und erklärte, diese Kartoffeln hier sähen nicht unbedingt einladend aus. Aber das würde sich ändern.
– Und wo, fuhr sie fort, wo bleibt euer Gemüse?
Inge gab zu verstehen, es sei noch früh im Jahr, die Bauern hätten noch nichts Grünes.
– Nun, war Roses Antwort, rechtzeitig angefangen, gäbe es bald Erbsen und Bohnen. Mit einem aufmunternden Kopfnicken versprach sie: Wir werden das in Angriff nehmen. Kennt sich jemand von euch mit Gartenbau aus? Sie sprach klar und überlegt, machte Pausen zwischen den Sätzen. Sie wollte, dass sich ihre kurze Rede einprägte. In dem Augenblick betrat ein Junge die Behausung.
– Da bist du ja, Pauli, mein Junge, sagte Flora in ihrem warmen Wienerisch, zog ihn an sich und herzte ihn, der Junge knickste wohlerzogen, seine Mutter zerzauste ihm das Haar. Pauli, unser Sohn, gab sie Rose lächelnd zu verstehen, während er sich in den hinteren Teil des Hauses davonmachte.
Schon kam auch Elka zurück, die mit einer Gruppe von Kindern auf Holzsuche gewesen war. Während sie ihre zusammengehaltene Schürze über dem Tisch ausschüttete, verkündete sie freudig: Ich habe jungen Salat gefunden.
Elka war eine dunkelhaarige junge Frau mit schönen vollen Gesichtszügen, denen man die Entbehrungen kaum ansah. Sie war kräftig gebaut, und auch sie trug ihr Haar modisch nach hinten gesteckt. Es war üppig und vom Durchstreifen des Unterholzes ziemlich zerzaust. Doch es stand ihr.
Nachdem Rose den einstigen Ziegenstall bei Seyre besichtigt und die Leute kennengelernt hatte, mit denen sie zusammenarbeiten würde, brachte Dubois sie ins nahegelegene Vallée de la Lèze. Sie fuhren durch das Felsental von Foix, wo hoch über dem Fluss eine Burg die Schlucht zu beschirmen schien. Die Burg und die Kathedrale vollendeten das Bild eines mittelalterlichen Städtchens. Unterwegs zum Schloss La Hille, das südlich des Tals lag, erzählte er, viele Juden hätten ihre Kinder nicht länger den Demütigungen und der Angst aussetzen wollen. Andere waren in den Besitz eines Visums gekommen und konnten ausreisen. Aber es war ihnen nicht erlaubt, die Kinder mitzunehmen. Niemand hatte mit einem langen Krieg gerechnet. Man wollte, sobald es vorbei wäre, wiederkommen und die Kinder heimholen. Doch als der deutsche Reichspräsident fortfuhr, die Nachbarn zu überfallen, sei die Panik in Belgien unvorstellbar gewesen. Viele hätten sich, wie Inges Onkel und Tante, überstürzt davongemacht. Ein sehr betuchtes Ehepaar seien diese Verwandten gewesen, Elka, die Leiterin, habe das gleich erkannt. Er groß und kräftig, im eleganten Dreiteiler. Sie hübsch geschminkt und aufgedonnert. Dabei hätten sie bis zur Abreise regelmäßig Geld geschickt. Aber wie wir wissen … Er brach ab, es hatte keinen Sinn, weiterzureden, immer wieder von den Tatsachen zu reden. Diese große forsche Blonde auf dem Nebensitz seines Cabriolets würde sich bald selber auskennen, die Ereignisse aber fassbar machen zu wollen, hatte er, Maurice Dubois, längst aufgegeben. Er hatte hier einen Auftrag zu erfüllen, hatte sich dieser Kinder angenommen und war entschlossen, sie durch diese unerfreulichen Zeiten zu bringen.
Sie passierten mehrere Ortschaften, bis jenseits der Landstraße hinter hohen Platanen das Schloss zu sehen war. Ob Dubois wisse, was dieser Name bedeute. Sie selber, scherzte Rose, vergreife sich immer mal wieder in der Sprache und bilde sich ein, es könnte vom englischen the hill herrühren. Aber das sei ja ganz was anderes. Man könne nicht die Sprachen nach Belieben durcheinandermischen. Dubois amüsierte sich, Frankreich habe ja in der Tat mal zu England gehört, entgegnete er. Nicht diese Gegend zwar, aber man könne nie wissen, die Sprache sei eine farbige Angelegenheit.
– Sie leiht sich gerne hier und dort was aus, stimmte Rose zu, also vielleicht doch the hill. Ich werde gleich sehen, was es damit auf sich hat.
Es war seine Frau Ellen gewesen, die das Gebäude eines Tages beim Vorbeifahren entdeckt hatte. Allein Spinnen und Fledermäuse hausten darin. Seit Jahren müsse es schon vor sich hingebröckelt haben, schien es Ellen. Herrn de Dieu, dem Besitzer, gehörten noch weitere Landhäuser, er willigte daher ein, dieses hier günstig an Dubois’ gemeinnützige Organisation zu vermieten. Das schlichte Steingebäude in der Form des Buchstabens L war mit Rissen durchsetzt und erstreckte sich über drei Stockwerke, rechnete man den Dachboden dazu. In den beiden Flügeln befand sich je ein Treppenhaus. Am Westflügel war die kleine Kapelle angebaut, die bald zum Schulzimmer gekürt werden würde. Eine Mauer aus unbehauenen Steinen, die Rose bis zur Brust reichte, zog sich um das Anwesen. Sie war in den Ecken mit vier Türmen ergänzt worden, von denen zwei bereits am Verfallen waren. Der Nordturm prunkte mit einem hohen, spitzen Dach und einem riesigen Eingangstor samt Fallgitter, das von der Familie de Dieu einst aus Liebhaberei angebracht worden war.
– Meinetwegen, hat Monsieur de Dieu gesagt, können Sie das Anwesen haben. Aber Sie werden keinen Tisch, keinen Stuhl, keine Bank und kein Bett vorfinden, erzählte Maurice. Nun ist Alex Frank mit den ältesten Jungen und Mädchen dabei, das Haus instand zu stellen. Ich glaube, es wird ganz wohnlich, sie haben angefangen, einen Brunnen zu graben, und verlegen elektrische Leitungen. Ich habe ihnen zwei spanische Migranten geschickt, von denen ich weiß, dass sie vom Schreinern etwas verstehen.
– Alex. Frank?
– Der bisherige Leiter. Elkas Ehemann. Er diente nach dem Überfall auf Belgien, als die Flucht der hundert Kinder begann, noch in der belgischen Luftwaffe. Er ist etwas über dreißig, wie Elka. Vor dem Krieg studierte er Landwirtschaft und lebte mit seiner Frau in einem Kibbuz. Wochen, nachdem Belgien besetzt und die Armee aufgelöst war, tauchte Alex im Ziegenstall von Seyre auf. Wie die Kinder, die Sie betreuen werden, war bisher die gesamte Leitung des Heims jüdisch.
– Haben sie auch ihre Kinder dabei?
– Sie sind kinderlos.
Als Rose die notdürftig bestückte Schreinerei von La Hille betrat, standen Tische und Stühle herum, die einen zur Hälfte fertiggestellt, die andern schon geschliffen. Zahlreiche Bettgestelle waren im Entstehen. Große Buben sägten und hobelten, hantierten mit Nägeln und Schrauben. Der etwas ältere Brillenträger in der Ecke im Hintergrund, der gerade ein Tischbein oder etwas Ähnliches montierte, musste einer der Flüchtlinge aus dem Spanienkrieg sein. Die Jungs arbeiteten mit Hingabe, einer trug sogar eine Schürze, ein anderer hatte sich einen Bleistift hinters Ohr geklemmt. Hobelspanlocken hingen über einer Werkbank, Sägen und Skizzen an der Wand. Bretter standen oder lagen herum, es roch nach Sägemehl und Bubenschweiß, ohne Unterbruch ging das monotone Hin und Her von Metallzähnen, die sich durch Holz fraßen. Im Innenhof des Hauptgebäudes hatte Alex bereits einen Gemüsegarten angelegt. Rose sah die bestellten Beete mit Verwunderung, das Säen und Pflanzen war doch eigentlich ihre Domäne. In Lambarene war sie für die Kost der Angestellten des Spitals zuständig gewesen und führte die oberste Aufsicht über sämtliche Pflanzungen. Anderseits, warum sollte sie es ihm verübeln, sofort mit dem Anlegen der Beete begonnen zu haben? Es zeugte von Voraussicht. Von ihr, Rose, war wohl zu jenem Zeitpunkt noch keine Rede gewesen. Dennoch, ein kleiner Stachel setzte sich fest. Dieser Alex schien ja ein unerhörtes Talent zu sein. Wozu eigentlich hatte man sie, Rose, als Directrice geholt?
Im Hof wurde geschaufelt und Zement herbeigeführt. Die Jungs bauten an der Zisterne. Im Hausinnern tauchten die Mädchen Pinsel in weiße Tünche und zogen sie über die Wände, andere nähten Leintücher und Kissenbezüge. Sie lachten viel und plauderten laut. Es war ihnen von einer Bäuerin eine Tretnähmaschine geliehen worden. Rose sah, wie viel Spaß sie hatten. Diese richtigen Betten, in denen sie bald liegen, und das Haus, in das sie bald einziehen würden, schufen eine großartige Perspektive.
Zwei Tage später erschien Rose von neuem in der Notunterkunft von Seyre und begann mit der Arbeit. Sie verstaute ihr bisschen Gepäck, nahm mit der Schar der vorläufig Zurückgebliebenen ihr erstes Abendbrot als Direktorin ein, und während sie dabei die einzelnen Kinder beobachtete, die ihr nun anvertraut waren, erinnerte sie sich, wie Maurice Dubois in irgendeinem Zusammenhang von Strandgut gesprochen hatte, das nirgends mehr hingehört. Todmüde und innerlich aufgewühlt legte sie sich kurz darauf schlafen. Das harte Strohlager, die fremden Geräusche im Raum, der unruhige Schlaf vieler Kinder, denen vermutlich Alpträume zusetzten, und die bedenkliche Zukunft ließen sie, trotz Erschöpfung, in jener ersten Nacht immer wieder vor Erregung die Augen aufreißen, wo bin ich? Kein Schlaf bis zum Morgengrauen. Warum, dachte sie, warum habe ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen?
Früh stieg sie am nächsten Morgen aufs Rad und klapperte damit dem nächsten Bahnhof entgegen, losgeradelt und weg, nichts wie weg. Sie kam gegen Mittag mit zwei Schaufeln, einem Spaten und ein paar Samen zurück. Die Radieschen würde man bestimmt schon ernten können, bevor der Umzug ins Schloss beginnen wird. Spinat und Salat, sofern das Wetter mitmachte, ebenso. Mit etwas Glück sogar die Bohnen. Rhabarber war nicht aufzutreiben. Sie rief die zwei großen Mädchen herbei, die mit den Jüngeren in Seyre zurückgeblieben waren und überall Hand anlegten, drückte ihnen die Schaufeln in die Hände und beauftragte sie, ihr beim Graben zu helfen. Sie befahl den Kleinen, die Steine aufzulesen, die beim Graben zum Vorschein kämen, und sie fortwährend zum Rand hinüberzuwerfen.
– Baut damit ein Mäuerchen um unsern Garten, schlug sie vor und zeigte ihnen, wie man sowas macht.
Sie hatte neben dem Haus ein Stück Boden ausgewählt und begann, Gras und Kraut auszureißen. Unnötiges Palavern lag ihr nicht, nein, sie kümmerte sich lieber ums Ausjäten und ums Aufschichten der Steine. Sie schuftete wie ein Ross, spürte den Schweiß zwischen ihren Brüsten rinnen, Erde zwischen den Zehen, das Brüten der Sonne im Rücken, ab und zu den Genuss und die Frische des Regens auf der Haut.
Nach wenigen Tagen ging’s ans Säen, und auch die Umrandung war in die Höhe geschossen. Inge war gerade am Graben eines Erdlochs, als ihr ein Wurm in die Hände geriet.
– Igitt, ein Wurm, schrie sie, andere wollten mit ihrer Schaufel das Tier sofort zerhacken.
– Lasst, eilte Rose herbei, lasst ihn leben. Er ist unser ganz großer Helfer. Er lockert die Erde. Dank ihm wird unser Gemüse kräftiger und größer.
Sie brachte ihren Gärtnern und Gärtnerinnen auch das Kompostieren bei:
– Mit zersetzten Gemüseabfällen, Früchteschalen und organischem Material wird die Erde produktiver, sagte sie. In Afrika lag der Kompost überall nur so herum. Hier müssen wir ziemlich arbeiten, um ihn zu bekommen.
An den Abenden, wenn in Seyre Schaufeln und Hacken ruhten, die Zikaden beim Einnachten verstummt waren, zeigte sich ihre sanfte Seite, sie hob zu erzählen an, und man lauschte ihr bis in die Nacht. Vom Urwald erzählte sie, und niemand hatte sich vorgestellt, wie leicht er einen verhungern lassen kann. Sie dachten an Ananas, Bananen und Datteln, die zu Hause kaum je auf den Tisch gekommen waren. Dachten, die wüchsen den Menschen dort ins Maul.
– Nein, sagte Rose, es gibt einzig Bananen und Maniokwurzeln. Die Bananen sind nur im gekochten Zustand essbar, und sie faulen nach kurzer Zeit. Die Maniokwurzel ist giftig, sie muss vor dem Essen mühselig entgiftet werden. Und das viele Wild, wie soll man es sehen, wie verfolgen, im Busch, der einem keinen halben Meter Sicht und keinen Sonnenstrahl gönnt? Man muss also diese dicken Bäume mit ihren grauenhaften Wurzelarmen, mit denen sie tief in den Boden greifen und sich dort verkeilen, schlagen, um den Wald nutzbar zu machen. Das Fällen eines Baumes kann Tage dauern, so gigantisch sind sie. Aber dann stürzen sie noch nicht, bleiben aufrecht stehen, gehalten von Hunderten von Lianen. Das Schlimmste dabei sind aber die Tse-Tse-Fliegen.
– Die was?, fragten die Kinder.
– Die Tse-Tse-Fliegen. Sie fliegen, sobald die Sonne aufgeht, und verschwinden am Abend wieder. Sehen fast aus wie unsere Fliegen, bloß größer und stechen durch den dicksten Stoff. Sie hassen die Farbe Weiß. Darum tragen die Menschen, die in den Tropen leben und arbeiten, nur weiß. Und darum werden die mit schwarzer Haut von ihnen besonders geplagt. Eine von ihnen, die Glossina palpalis, kann einen mit der Schlafkrankheit anstecken.
– Haben Sie jemanden gekannt, der die Schlafkrankheit hatte? Die Krankheit möchten wir auch haben, immer nur schlafen, nicht arbeiten, nicht zur Schule.
– Wir hatten eine Patientin, antwortete Rose, die war fröhlich und sprach viel. Mitten in einem Satz konnte sie aber in tiefen Schlaf fallen. Schlief tagelang. Ihre Kinder rüttelten an ihr, riefen ihren Namen, warfen Wasser über sie. Sie schlief. War sie wach, schien sie wieder die Alte zu sein. Bloß erinnerte sie sich nicht immer an die Namen ihrer Kinder und sie hatte dieses Fieber, dieses fürchterliche Kopfweh. Mein Kopf, sagte sie dann, mein Kopf. Ich glaube, es sitzt ein Wurm in meinem Kopf. Ich will ihn heraushaben. Eines Tages packte sie ihre ganze Familie ins Kanu und ruderte auf dem Ogowe zu uns ins Spital. Hatte ihren Hausrat und ihre Vorräte dabei und blieb mehrere Wochen, weil sie den Wurm loswerden wollte. Alle fünf Tage gaben ihr der Doktor, manchmal ich, eine Spritze. Einmal sah ich ihren Mann in meiner Pflanzung. Er spazierte gerade mit einer Melone unter seinem Arm davon. Ich sagte zu ihm, er solle sie mir geben, sie gehöre dem Doktor. Er lachte freundlich und ich verstand nicht, was er antwortete. Er ging weiter, es schien, er hatte keine Ahnung, was ich von ihm verlangte. Als ich ihm nachlief und sagte, ich wolle die Melone zurückhaben, schien er immer noch nicht zu verstehen. Unsere Pflanzung haben wir für die Angestellten angelegt, sagte ich und packte die Frucht, sie stürzte zu Boden, platzte und rollte davon.
Rose lässt die Ohrfeige aus, die sie damals dem Mann versetzt hatte. Er war zurückgewichen und hatte dabei die Frucht fallenlassen. Wenn ich das jetzt erzähle, beginnen diese Kinder mich zu fürchten. Und das will ich auf keinen Fall. Der Vorfall ist mir überhaupt zu peinlich, denkt sie. Schweitzer und sie argumentierten lange und heftig. Sowas darf nie wieder vorkommen. Damals war vielleicht die Hitze schuld, fiel ihr ein, und dass sie Afrika noch kein bisschen verstand. Denn groß war auch ihr Befremden gewesen, als immer wieder gesunde Begleiter die kranken Kinder aus den Spitalbetten jagten, um selber drin zu schlafen.
– Was einem gehört, verstanden sie nicht. Was nicht bewacht wird und nicht eingeschlossen ist, das fährt herum, sagten sie. Das darf man mitnehmen. Was im Erdboden steckt, gehört dem Staat, was auf dem Erdboden zu finden ist, gehört allen. Wer keinen Wächter anstellt, muss wissen, dass man sich holt, was man braucht. Doktor Schweitzer waren eines Tages ein Klavierauszug der Meistersinger und die Matthäuspassion von Bach abhandengekommen, direkt vom Bücherbord. Wer seine Sachen unverschlossen aufbewahrt, betrachtet sie nicht als seinen Besitz, sagen die Leute in Afrika. Er hatte in die Partitur von Bach sorgfältig seine eigene, von ihm ausgearbeitete Orgelbegleitung eingetragen. Ich hörte ihn oft spätnachts noch am Klavier.
– Ein Klavier mitten im Urwald, staunten die Kinder.
– Manchmal war’s ein Suchen nach, ich weiß nicht, nach Harmonien vielleicht.
– Was wollte denn der Dieb mit den Noten tun?
– Er wollte sie nicht zu Geld machen, das ist gewiss. Zu lesen verstand er sie auch nicht. Es trieb ihn vielleicht eine bestimmte Vorstellung. Vielleicht war er gebannt von den wunderlichen Zeichen. Dachte womöglich, es seien Zauberzeichen, und die Musik verberge sich darin. Die Frage war dann für ihn, wie er es anstellte, die Musik aus ihnen herauszubekommen.
– Was hatte der Doktor gesagt, als ihm diese Noten gestohlen wurden?
– Für Bach, meinte Schweitzer damals, bedeute dieser Diebstahl im Urwald eine Ehre. So war er, ging großzügig über solche Streiche hinweg, er zürnte den Schwarzen nie. Und jetzt ins Stroh, Kinder, sagte sie plötzlich, amüsiert über die Erinnerung, die sich beim Plaudern eingestellt hatte. Auch über ihr Scheitern damals in Lambarene, wenn sie versuchte, ihre strenge europäische Erziehung anzuwenden.
Wenn es soweit ist
In La Hille ist ein neuer Tag angebrochen. Rose greift routiniert nach einer ihrer kostbaren Haarnadeln und steckt sie als letzte in ihr eigenwilliges Haar. Kostbar nicht, weil sie sie teuer erstanden hätte, kostbar, weil in diesen Zeiten und in solch abgelegener Gegend kaum Ersatz zu finden ist. Zwei Stück davon hat sie in den Monaten, die sie schon im Schloss ist, in diesem weitläufigen Haus oder vielleicht bei der Arbeit im Garten und draußen in den Feldern verloren. Sie steckt sie zwischen die Strähnen, schiebt sie zweimal vor und zurück und stößt sie dann flach unters Haar. Sie nimmt die weiße Schürze vom Haken an der Tür, legt sie über den Bauch, zieht das Taillenband nach hinten und verknüpft es. Über die Treppe eilen ihr Schritte entgegen. Die kleine Sarah Goldstein kommt in kurzbeinigen Sprüngen mit geweiteten Augen atemlos heraufgerannt. Sie nimmt nur jede zweite Stufe, streckt immer wieder den mageren Arm vor, umklammert das Geländer, Rose sieht ihre vor Anstrengung sichtbar werdenden Sehnen.
– Ein Sch… ein Sch…, sagt sie bleich. Erst vor kurzem hat sie wieder zu sprechen angefangen, sie hört, sobald sie ein Wort herauszubringen versucht, immer wieder diesen einen Satz, den sie nicht vergessen kann. Es ist die Stimme eines Mannes, er trägt Uniform, schwarze Vögel kreisen über allem, und die Stimme sagt: Für heute ist genug.
– Ein Sch… ein Sch…, sie verstummt.
Sarah war durch Dutzende Hände gegangen auf ihrer Irrfahrt durch den Krieg. Schließlich gelangte an Rose eine Anfrage, und sie antwortete: Ja, bringt das Kind sogleich her.
Ihre Familie war aus Hamburg nach Polen umgesiedelt worden. Lange zuvor war die Öffentlichkeit ein Ort der Verunglimpfungen und Grobheiten geworden, Einschüchterungen durch immer neue Rassengesetze zur Normalität. Herr Goldstein hatte um Schiffskarten ersucht, hatte Schlange gestanden, um eine Ausreisegenehmigung zu erhalten, hatte Gesuche geschrieben, um gültige Papiere zu beschaffen, von Freunden ein Affidavit für die Auswanderung erbettelt, die Auswanderungssteuer, sämtliche Gebühren und Sonderabgaben für Juden bezahlt, und irgendwann war sein Besitz aufgezehrt. Nachdem auch ihr Hutgeschäft ruiniert und demoliert worden war, warteten die Goldsteins voller Ungeduld auf die Schiffskarten. Das Aufgebot für die Umsiedlung traf aber noch vorher ein.
Sie packten die Koffer wie vorgeschrieben. Bloß einen Handkoffer, etwas Proviant für die fünfköpfige Familie und für jeden durften sie eine Decke mitführen. Frau Goldstein legte noch ihre Gemüseraffel und etwas Besteck zwischen die Wäschestücke, nähte ihre letzten paar Reichsmark, die Eheringe und die goldene Armbanduhr der Großmutter in die Kleidersäume. Dann schlossen sie die Wohnung ab, stiegen mit dem Gepäck durchs Treppenhaus hinunter zur Haustür und machten sich auf den Weg zum Bahnhof. Der Reichsinnenminister hatte kurz davor unmissverständlich dargelegt, dass die abzuschiebenden Juden allesamt volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen anhingen. Die Goldsteins zählten sich aber nicht zu diesen Leuten. Sie konnte der Minister nicht gemeint haben, waren sie überzeugt. Es gab durchaus welche, dachten sie, auf die so etwas zutraf. Aber sie, die Goldsteins, hatten sich loyal verhalten, das konnte jeder sehen. Sie waren Deutsche. Daher hatten sie sich ihre Umsiedlung nie so erbärmlich vorgestellt.
Während die SS für eine reibungslose Deportation der Familie Goldstein sorgte, verfassten andere, vom Finanzbeamten bis zum Vermieter, von der Bank bis zum Kohlehändler, exakte Kostenabrechnungen. Die Bank errechnete zuhanden des Reichsfinanzamtes, ob vom Sparguthaben ihrer ausgereisten Kundschaft noch was übrigblieb, die Wohnungsvermieterin reichte dem Amt die Mietforderungen ein, die ihr nun entgingen, der Kohlehändler ermaß den Brennvorrat der Goldsteins, über den nun neu zu verfügen war. Auch er forderte beim Staat die ausstehenden Zahlungen ein. Antiquare, Händler und Speditionsunternehmen beteiligten sich ohne Verzug an der Inspektion und Räumung der Wohnung. Kunstsachverständige durchsuchten jeden Winkel nach versteckten Gemälden. Die Goldsteins indessen erhielten nach tagelanger Fahrt in Polen eine Wohnung im Ghetto zugeteilt, in der bereits zwei Familien wohnten. Die Schätze, von Frau Goldstein in ihre Kleider genäht, verschleuderten sie auf dem Schwarzmarkt gegen Brot, etwas Gemüse, etwas Kohle, eine Decke, einen Wurstzipfel. Es musste bei Nacht geschehen, in einer dunklen Gasse, einem Hinterhof, es wurde gefeilscht, und kam eine Wache dazu, so schoss sie.
Eines Tages trafen Armeefahrzeuge ein, Uniformierte sprangen herunter und jagten Männer, Frauen, Kinder hinaus auf den Marktplatz. Befahlen allen, sich zu entkleiden, trieben ihre Späße mit den eingeschüchterten Menschen und ließen sie stundenlang warten. Durst. Angst. Und die böse spöttische Sonne. Dann der Marsch. In kleinen Gruppen.
– Los. Vorwärts. Beeilung!
Sarah an Mutters einer Hand, Levi an Mutters zweiter Hand, Aaron ging allein, Vater fehlte. Hatte mit andern Männern vorausgehen müssen, sie trugen Schaufeln hinaus. Neben Mutter ein Polizist, neben Levi ein Polizist. Auch neben Aaron ein Polizist. Alle hatten einen Aufseher neben oder hinter sich. Mutter redete leise.
– Keine Angst, meine Kleinen, keine Angst. Nein, du sollst meine Hand nicht loslassen, Sarah. Nein, wir sollen nicht wegrennen. Bleib bei mir, Aaron, bleib.
Da sagte der Uniformierte, der neben ihnen ging, das Gewehr geschultert, plötzlich: Deutsche?
– Hamburg, sagte die Mutter.
– Aus Hamburg, sagte der Soldat verwundert. Er war nicht mehr der Jüngste, ein Freiwilliger. Sein ganzes Bataillon bestand aus lauter Reservepolizisten. Er kenne Hamburg, sagte er. Er sei als Kind mal dort gewesen und habe die Meerschiffe gesehen. Und die Möwen schrien, sagte er.
– Sie lachen, erinnerte sich Frau Goldstein traurig.
Der Reservist war einer von fünfhundert Männern, eigens für die Entjudung der polnischen Dörfer eingezogen. Früh am Morgen vor ihrem ersten Einsatz erfuhren sie erstmals, was von ihnen erwartet würde. Der Bataillonsarzt erläuterte ihnen, wie man es macht, wo man die Mündung ansetzen muss. Darauf wurde ihnen freigestellt, vorzutreten und zu erklären, man fühle sich diesem Auftrag nicht gewachsen. Ein persönliches Angebot des Kommandanten. Einer trat an diesem ersten Tag vor, am nächsten Tag ein zweiter, im Ganzen wiesen acht den Auftrag zurück. Der Kommandant stellte sie frei. Er selber, Kommandant Trapp, war nicht zum Morden in den Krieg gezogen, er war unter die Waffen gegangen, um zu kämpfen, sein Land sollte wieder zu Würde und Größe gelangen. Was ihm hier in Polen befohlen war, er wollte es nicht, aber als Soldat musste er doch. Weil er den Schwur getan hatte und weil es in den höheren Rängen viele gab, die darüber wachten, dass er tat, was sein Auftrag war, ohne darüber eine Meinung zu haben. All jene Männer seines Bataillons freizustellen, die zur Entjudung Polens nicht Hand bieten wollten, war der einzige Ungehorsam, den er sich erlaubte. Mit Tränen in den Augen, hieß es unter den Männern, habe er diesen Befehl ausgegeben. Zu den Erschießungen ging Trapp nie.
– Gesichter zur Grube, wie befohlen, rief der Soldat, aber Mutter und Kinder krümmten sich mit erschrockenem Schrei weg von der Grube. Ein leichter Stoß mit dem Bajonett, beinah stürzten sie. Man erkennt, wenn der Blick sich zur Grube senkt, keine Bekannten da unten, an die man sich vom Sehen erinnert, keine Nachbarn aus dem Ghetto, man hatte mit ihnen in der Küche um Pfanne und Teller gestritten, sie haben keine Gesichter mehr, liegen so still alle. Um die Leichen sammelten sich Blut und die letzten Ausscheidungen. Kaum gelang es, aufrecht zu stehen, die Beine zitterten fürchterlich, vergeblich versuchte man, sie stillzuhalten. Und am Himmel wuchs jede Minute die schwarze Zahl der Vögel. Ihr Gekrächze vertiefte noch die Übelkeit, die Sarah und ihre Brüder beim Blick nach unten ergriffen hatte. Mutter Goldsteins Blicke wanderten, ob sie ihren Mann irgendwo sähe. Froh war sie, dass er die Familie nicht hier unten würde sehen müssen.
Der Polizist hatte gelernt: Zuerst das Bajonett beim letzten Halswirbel anlegen, dann Schuss, keiner darf daneben gehen. Und doch ging immer mal einer daneben. Oft zogen sie die Köpfe ein, oft begannen sie zu schwanken. Manche weinten, der eine oder andere erwähnte noch einmal seine Orden aus dem Großen Krieg, die er besessen hatte. Die Mehrzahl jedoch war empörend willig. Er würde das nie verstehen. Aber schließlich fielen sie alle, mit weggeschossenen Schädeldecken, Hirnmasse spritzte an die Uniform, Blutspritzer klatschten dem Reservisten ins Gesicht, und die nächste Gruppe wartete schon hinter dem Wäldchen. Der Gestank war unerträglich.
Beim Mädchen aus Hamburg zielte der Reservist ungenau. Man sollte davor mit ihnen nicht sprechen, er wusste es, denn wenn es soweit ist, fasst eine eiskalte Hand nach deinem Herzen, unmöglich dann abzudrücken, aber der Befehl kommt, man presst die Kiefer aufeinander, bis es schmerzt, der Finger zieht, es ist vorbei und da hinten warten die nächsten. Rennt doch weg, zum Teufel, dachte er, lauft! Würde jeden laufenlassen, Donner und Doria, ja, würde ich. Es ist unmöglich zu vergessen, was man mit ihnen geredet hat. Aber ich bin im Krieg, dachte er, Mensch, ich bin Soldat.
Abends auf dem Marktplatz versammelten sich die Reservisten erschöpft, grau, durstig. An Uniform, Gesicht und Stiefeln diese Knochensplitter und blutigen Gewebeteile. Da sahen sie jäh das Mädchen. Verdreckt überall, das Haar verklebt. Ihr Blick zielte an den Reservisten vorbei, ging blitzschnell in die Runde, das Ghetto aber war entvölkert, nur diese Polizisten standen noch da. Sie schwitzten und starrten vor Schmutz. Auf einmal legte sich eine unheimliche Stille über den Platz, als letztes hallte das Wort Wodka noch nach.
Stumm kreisten jetzt über dem Marktplatz die Vögel, sahen die Versammlung da unten und mittendrin das Kind. Einer hatte ihm die Uniformjacke übergeworfen.
– Wer bist du? fragte der Kommandant. Was suchst du hier?
Sarah öffnete den Mund, nichts. Keiner rührte sich. Da, plötzlich ein kurzer trockener Laut. Einer entsicherte die Pistole. Der Kommandant hob die Hand:
– Nicht! Für heute ist genug.
Er nahm Sarah beim Arm und brachte sie weg, gab Befehl, mit dem Ausschenken anzufangen, viel Wodka an seine Reservisten, das Kind hingegen schickte er zurück in den Westen.
– Hat er was gesagt, der Besucher?, möchte Rose von Sarah wissen.
– Er w… er will … S… seh… seh…
– Ich komme.
Sie solle versuchen, den Leutnant hinzuhalten, riet Maurice einmal, als sie unsicher war, wie auf seinen Besuch zu reagieren sei. Sie stopft den kleinen Spiegel zurück in die Tasche zu Kamm, Zahnbürste und Hautcrème, zu den Jodtropfen für Verletzungen, der kleinen blauen Dose mit Vicks gegen Erkältung, und im Seitenfach steckt die Nagelschere. Sie trägt ihre Haube nie, schlüpft daher zum Schluss in die Schuhe, die soliden schwarzen Schuhe, bindet die Schürze wieder los, wirft sie aufs Bett und verlässt ihr Zimmer. Sieht unten im Hof einen Gendarmen stehen.
Nur nicht laufen, sagt sie zu sich selber, lass ihn nicht ahnen, wie erschrocken du bist.
– Sind Sie die Directrice hier?, hört sie ihn fragen, kaum ist sie in den Hof getreten.
– Jawohl. Und Sie, wer sind Sie?
– Leutnant Gabrielle, Polizeioffizier.
– Was verschafft uns die Ehre?
– Sie sind ja ganz außer Atem, Madame.
– Nicht dass ich wüsste, Herr Leutnant. Treten Sie ein.
Der Leutnant tritt ein und folgt Rose in den großen Speisesaal mit den hohen Fenstern und den traditionellen Butzenscheiben, dem dunklen Täfer an den Wänden, dem langen schweren Eichentisch, der merkwürdig verwaist ausschaut, ohne Sessel. Ein beeindruckender Raum, wie es die Besitzer in vergangenen Jahrhunderten mochten. Die Fenster gehen zum Hof und den Gemüsebeeten, in denen zu anderen Zeiten die Rosen und der Lavendel des Landadels in einem andauernden Fest ihre Schönheit gefeiert haben mochten, in der Mauerecke der zerfallene Turm. Beim rußgeschwärzten Kamin bleibt Rose stehen, ihr Blick trifft denjenigen des Leutnants.
– Ein romantischer Ort. Für Kinder ein Paradies, würde ich meinen, bemerkt dieser.
Er hat recht, an den Mauern Kletterrosen, davor der Kräuter- und der Gemüsegarten, Augentrost entlang des Gemäuers und draußen, außerhalb des Tors die Weite, die Ariège, die Stille, die Hügel. Rose weiß, sie muss auf der Hut sein. Mit diesem Mann und insbesondere seinen Auftraggebern darf sie es nicht verderben. Er scheint gesprächsbereit und wünscht, ihr Vertrauen zu gewinnen, sie sieht es mit Erleichterung.
– Was darf ich Ihnen anbieten, Herr Leutnant?
– Danke, Madame, ich bin dienstlich hier. Obwohl, ich gebe es zu, ich wäre lieber ohne Auftrag gekommen, als Freund und Bewunderer. Mein Vater wurde im letzten Krieg schwer verwundet, einer Schweizer Pflegerin im Lazarett hat er das Leben zu verdanken. Davon hat er oft erzählt.
Er dreht das Gesicht wieder dem Fenster zu, betrachtet die fernen schwer zu durchdringenden Wälder, die er so sehr liebt, in denen ihm sein Nachbar die Wildschweinjagd beigebracht hat. Nach einer längeren Pause fügt er an:
– Die Blutmühle von Verdun.
– Oh, sagt Rose.
– Es hätte keinen Krieg mehr geben dürfen, sinniert der Mann.
– Was bringt Sie her?
– Nichts, das Sie ängstigen müsste, Madame, bloß eine Liste sollte ich haben. Namen und Geburtsdatum aller Kinder und Angestellten hier im Schloss. Nichts weiter. Gesetz vom 2. Juni. Alle Juden haben sich registrieren zu lassen.
– Ich kann Ihnen gerne alles sagen, was Sie zu wissen wünschen.
– Eine schriftliche Liste, versteht sich.
– Auf wessen Befehl?
– Französische Militärverwaltung.
– Die Liste, die Sie wünschen, besitze ich nicht. Wir wissen nicht einmal von jedem Kind, wann es geboren wurde und noch weniger wo.
– Fragen Sie nach.
– Viele unserer Kinder sind allein gekommen, manche hören von ihren Eltern seit Monaten nichts mehr.
– Erkundigen Sie sich bei den Behörden der Herkunftsorte.
– Oder sie wurden bei der Ankunft auf französischem Boden voneinander getrennt. Ihre Spuren verloren sich in einem Ihrer Lager, Monsieur. Ihre Herkunftsorte liegen in Trümmern.
– Verschaffen Sie mir die Liste.
– Wozu denn?
– Madame, eine reine Formalität. Es kommen täglich Tausende in unser Land, die nicht erfasst sind, Staatenlose, Ausgebürgerte.
– Es ist nicht ihre Schuld, dass sie hier sind.
– Ich bin nicht gekommen, mit Ihnen zu diskutieren, Madame. Ich habe einen Befehl.
– Ich sagte Ihnen doch, ich verfüge über unvollkommene Angaben. Ich kann Ihnen erzählen, was ich weiß.
– Verschaffen Sie mir die Liste, und ich verschwinde.