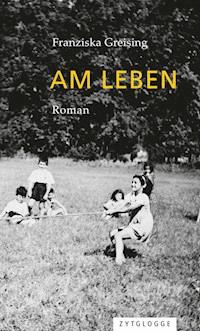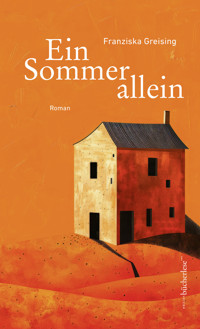
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Sommerabend treffen die Schriftstellerin Mona und der Maler Jonathan zusammen. Beide werden bald über die vermutliche Mitte des Lebens hinaus sein und haben einige Verluste durchlebt. Dennoch verlieben sie sich sofort und heftig. Einfach ist die Verbindung der starken Persönlichkeiten nicht, einfach ist auch das Aufeinandertreffen ihrer unterschiedlichen Künste nicht. Nach etlichen gemeinsamen Jahren und einem Streit, der sich ausgerechnet am neusten Buch von Mona entzündet, fordert Jonathan eine Beziehungspause, die sich über Monate hinzieht. Aber da ist noch mehr, und so entschließt sich die hingehaltene Mona, den Schauplatz der verordneten Beziehungsabstinenz zu verlassen und den Herbst in einem abgelegenen Tessiner Steinhaus zu verbringen. Für sie beginnt eine stille und erlebnisreiche Zeit, eine Zeit der aufmerksamen Beobachtungen, Reflexionen und Erinnerungen. Während langer Tage und Nächte stellt sich Mona der Geschichte ihrer großen Liebe. Und dann erhält sie überraschend Besuch von Jonathan … Mit Ein Sommer allein ist Franziska Greising ein atmosphärisch dichter und stilistisch vollendeter Roman über eine toxische Beziehung und das Ringen um Autonomie gelungen; ein fein gewobener, subtiler Text, dessen Poesie oft lyrische Qualität erreicht und immer wieder mit einer ganz eigenen Sprache für das scheinbar Unaussprechliche überrascht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auch das war schön, wenn nach der Liebe alle Konturen weich und verwischt waren, die Glut aber noch in den Augen brannte.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1.
Beschwingt und voller Vorfreude eilten die Menschen zu den Schiffen, Sonnenbräune auf der Haut und auf den Köpfen zerknautschte Stoffhüte. Mona saß auf einer Bank am Wasser, zwei leere Sommerwochen warteten auf sie. Die Kinder waren in den Ferien. Es stand ihr frei, ans Meer oder in die Berge zu fahren. Zu Hause war niemand, Mona wurde nicht gebraucht.
Diese Leichtigkeit in ihr. Als wäre sie einer der Vögel, die auf dem Wasser schaukelten, tauchten, sich in die Höhe schwangen. Ihre Tage kannten keine Zeit, nur Raum und Ort.
Mona war eine geschiedene Frau. Das war der Unterschied. Noch war sie es nicht gewohnt. Noch fehlte ihr ein Teil. Nicht jener, den sie verlassen hatte. Sie wollte nichts von diesem fehlenden Teil wissen, und doch fehlte ihr ein Teil. Großer Gott, warum fehlt mir etwas, wo ich doch aus tiefstem Herzen allein sein will? Nie mehr Streit, kein tagelanges Schweigen, keine neuen nutzlosen Versöhnungen, keine Schläge und Fußtritte, keine Drohungen mehr. Und nie mehr diese Dumpfheit danach, dieses hündische Warten auf Zärtlichkeit. Viele Monate schon, über ein Jahr war es her, und heute, da die weißen Schiffe zu ihrer Fahrt über den See aufbrachen, drüben am Ballonstand die Kinder herumstanden, und der Sommer diese zwei Wochen lang ihr ganz allein gehörte, war Mona sich selbst endlich ganz nah. Sie brauchte niemanden.
Zwei Wochen würde sie für sich allein sein. In dieser Vorfreude saß sie jetzt auf der Bank, als sie von Weitem Rahel kommen sah.
Rahel war schön und da sie es wusste, war sie schüchtern, schaute niemanden an, denn sie erlebte immer wieder, wie sie alle Blicke auf sich zog. Die Leute starrten sie an, als hätten sie ein Recht dazu. Dachten vielleicht, Schönheit sei öffentliches Eigentum. Sie ging gemessen, die dunklen Stoffbahnen, die von ihren Schultern fielen, umwehten bei jedem Schritt ihren Gang. An der Hand hielt sie ein bildschönes Kind.
Rahel, sagte Mona überrascht, du? Sie kannten einander erst ein paar Wochen. Mona kannte viele Leute erst ein paar Wochen. Ihr neues Leben brachte es mit sich, dass manche aus ihrem Umkreis verschwunden waren, wie Morgennebel, und andere hinzukamen. Mona war mit den Kindern vom Dorf in die Stadt zurückgezogen. Sie hatte eine Wohnung am Stadtrand gesucht, damit den Kindern der Wechsel vom Land in die Stadt nicht zu schwerfiel, der Schulweg nicht zu gefährlich war, die Katze genug Auslauf bekam und der Hund nicht auf dem Straßenpflaster seine Pfoten wund lief. Den Meerschweinchen ging es überall gleich gut oder schlecht, vorausgesetzt, es gab Heu. Und so kam es, dass nicht nur der Zivilstand sich änderte, sondern auch die Umwelt und die Freundschaften.
Beim zweiten Ruf reagierte Rahel. Sieh an, sagte sie, du? Willst du aufs Schiff?
Nein, sagte Mona, und ihr beiden?
Meinen Enkel spazieren führen, sagte sie.
Ein schönes Kind.
Noch wussten sie wenig voneinander. Man hätte Rahel, nach der Art zu schließen, wie sie sich kleidete, für eine Künstlerin halten können. Doch große Talente erkennt man selten an ihrem Äußeren, sie kommen meist unauffällig daher. Und Rahel war in einem sehr hektischen Beruf tätig. Sie und ihr Mann widmeten nur die Freizeit der Kunst, lasen Bücher, besuchten Ausstellungen und verkehrten ausnahmslos mit Architekten, Malerinnen, Literaten.
Als sie erfuhr, dass Mona den Sommer über zu Hause blieb wie sie, verabredeten sie sich, einen gemeinsamen Abend zu verbringen. Weißt du was, sagte Rahel unvermittelt, wir veranstalten ein Fest für Leute, die daheim geblieben sind. Morgen rufe ich dich an.
Gerne, sagte Mona, sehr gerne, ich freue mich darauf.
Siehst du, mahnte ihr Herz, es geht voran. Auch als geschiedene Frau gehörst du noch dazu.
Mona kleidete sich sorgfältig, wie schon lange nicht mehr. Sie fand sich schön, ihr Haar glänzte, und sie war voller Vorfreude auf den Abend. Punkt halb sieben stand das Ehepaar, das Mona abholen sollte, an der Haustür. Sie fuhren den Hügel hinunter dem See zu. In den Gärten richteten sich die Leute auf einen langen Abend ein. Die Sonne stand noch etwa eine Handbreit über den westlichen Hügeln.
Im Garten von Rahel und Robert standen sieben Stühle und ein alter Jugendstiltisch. Auf einem Mäuerchen lagen zusammengetragene Steine von wunderlichen Formen und Zeichnungen. Ein Paar war dabei, Rahel in der Küche mit dem Aperitif zu helfen. Aus einer Karaffe mit silbernem Hals schenkte Robert Sangria in die Gläser. Man sah über den See, der jetzt unten in seinem Becken abendlich glänzte. Später stand Mona unverhofft vor dem letzten der geladenen Gäste. Rahel stellte ihn Mona als Jonathan, den Maler, vor, von dem sie sicher schon gehört habe.
Mona bejahte und fügte an, sie habe unlängst seine Ausstellung gesehen und sich einen Katalog gekauft. Sie hatte ihn sich klein, in sich gekehrt, blond und bärtig vorgestellt. Er war zwar bärtig, aber groß und schön. Er hatte feine Bleistiftzeichnungen von fabelhaften Mensch-Tier-Wesen ausgestellt. Auf den Bögen kurze Notizen. Über ihn und seine Frau hatte Mona oft nachgedacht und sich ausgemalt, wie friedlich ihr Leben verlaufen müsse, erfüllt von immer neuen langen Gesprächen über die Kunst. Mona wusste nicht, aus welchem Grund sie sich den Mann verschroben vorgestellt hatte. Sie vermutete, seine Arbeiten hätten in ihr den Eindruck erregt, sie entsprängen der Gedankenwelt eines schwer zugänglichen Menschen. Doch nun stand ein großer Mann vor ihr, schwarzhaarig, sonnengebräunt und scharf blickend. Sein Händedruck war warm und kräftig, Mona achtete aber nicht weiter darauf. Ihr entging ebenso, dass er sich nach der Begrüßung plötzlich für längere Zeit zurückzog. Sie stieß mit den anderen Gästen auf die Gastgeber und Roberts Sangria an und war restlos glücklich im Gefühl ihrer Freiheit.
Rahel hatte eine reichhaltige Paella zubereitet, der Abend verging mit leichten Gesprächen und Neckereien. Und als der volle Mond über den Bergen aufstieg, wurde dieser zum Mittelpunkt des Gesprächs. Jonathan saß verdeckt von Monas Tischnachbarn, so dass sie ihn während des ganzen Abends kaum sehen konnte. Hingegen wurde sie hellhörig, als er das Thema der Himmelskörper aufnahm und viel darüber zu wissen schien, indes der Mann an Monas Seite immer lauter und ausfälliger wurde.
Jonathan schlug später vor, er würde Mona nach Hause fahren. Sie bedankte sich, sagte, sie fahre mit jenen zurück, die sie abgeholt hatten, und verschwendete keinen Gedanken mehr an den Maler. Am nächsten Tag fand Mona im Briefkasten einen Zettel, den dieser Jonathan eingeworfen haben musste: Er wüsste ihr noch viel von Monden und Sternen zu erzählen.
Jahre später.
Mona lief durch die hereinbrechende Nacht. Als ob er zu ihr gehörte, als ob er sie kennen würde, rannte plötzlich ein großer gelber Hund neben ihr her. Erst war es das Tappen von Pfoten gewesen, man konnte hören, er rannte, er hechelte, dann stellte er sich vor sie hin, es hatte schon zu dämmern begonnen, und beide betrachteten einander prüfend: Was wollte der, wer war der, was fang ich mit dem an? Besonders der Hund sah aus, als überdenke er noch einmal ein ganz bestimmtes Vorhaben. In seinem Blick meinte sie, eine lange Geschichte zu lesen, und als hätte er eine Frage, bewegte er ein paar Mal die Ohren. Nicht rückwärts bewegte er sie, nicht ängstlich war er. Er drückte etwas aus, etwas Verwegenes, schien ihr. Sie wollte den Zug erreichen und eilte weiter, er lief neben ihr her. Schnell hatte sie ihre Zweifel und die kleine Beunruhigung überwunden, und es schien, sie hätten dasselbe Ziel. Die Nacht war im Begriff, sich langsam und so unerbittlich wie stets über die Gegend zu stülpen, eine Schachtel, in die jemand den Tag versorgt. Zwischen Feldern und Abendhimmel ging Mona Richtung Station. Die letzten Häuser lagen hinter ihr. Sie war allein auf der Welt, bewegte sich im Gemälde eines romantischen Malers, dunkle Bäume vor verblasstem Horizont, Gärten, aus denen noch einzelne letzte Blüten im verlöschenden Licht schimmerten, der Feldweg versank weiter unten schon in Unbestimmtheit, der See glitzerte noch schwach, und dort befand sich auch die Station.
Die erste Zeit hatte Jonathan Mona bei der Liebe oft lange Geschichten erzählt. Oder er hatte sie gefragt, wer er sei. Wer bin ich?
Und sie antwortete, du bist mein Mann. Er fragte, wie er heiße. Und sie sagte ihm den Namen. Wenn ihm danach war, fragte er, was sie ihm für einen Preis mache für diese Nacht. Sie erwiderte, dass es darauf ankam, welche Dienste er wünsche. Manchmal band er ihre Handgelenke mit seinem Gürtel ans Stahlrohr am Kopfende und liebte sie so, küsste so ihre Achselhöhlen, fuhr so mit den Lippen über ihren Bauch, ihre Oberschenkel, suchte Kühlung an ihren Brüsten, schaute zu, dass sie spitz wurden, leckte ihr Geschlecht.
Sie waren nie auf einem Standesamt gewesen. Sie hatten keine gemeinsame Wohnung. Sie hatten keine Papiere, die sie banden, nichts hatten sie unterschrieben. Wenn sie sich liebten, flüsterte er ihr jedoch ins Ohr, wir feiern jetzt Hochzeit. Er sagte, du bist nun meine Frau. Sie sagte, und du bist jetzt mein Mann.
Neben einem Acker konnte sie die Umrisse eines Schuppens, in dessen Nähe Bohnenstangen und Beerensträucher erkennen. Auf einmal kam ein Busch in Bewegung, er wuchs sogar ein wenig und teilte sich in zwei Teile. Zwei alte Leute, ein Mann und eine Frau, machten sich noch in ihrem Gemüsegarten zu schaffen. Sie arbeiteten, ohne darauf zu achten, dass die Nacht hereinbrach. Als ob für sie andere Tageszeiten gälten und Eile die ungünstigste Art wäre, das bisschen Leben zu verbringen, das ihnen noch blieb. Mona vermochte ihre Gesichter vor dem Nachthimmel nicht zu erkennen, aber sie fragte über den Zaun hinweg, ob dies der richtige Weg zum Bahnhof sei. Sie sagten, es ist der richtige Weg. Als sie sich nach dem Hund umsah, war er verschwunden. Erst bei der Station, beim Herannahen der S-Bahn, kam er aus der Nacht über die Gleise gerannt. Nachdem sie eingestiegen war, jagte sie ihn zweimal aus dem Zug. Er sprang jedes Mal weiter hinten wieder hinein. Die Wagen fuhren schon, da kam er durch den Gang zwischen den Sitzen. Seither blieb der Hund bei ihr. Sie gab ihm den Namen Quadrupede, Vierfüßiger.
Warum war sie gerade heute, an diesem Abend auf den Gedanken gekommen, dem Mann, den sie liebte, diese Frage zu stellen? Wochenlang hatte sie sie hinausgeschoben. Wollte ihn nicht drängen zu antworten, fürchtete, die Antwort nicht ertragen zu können. Eine Antwort, die alles infrage stellte. Ihre Zukunft, ihr Schreiben, ihre Liebe. Schließlich hatte sie sie dennoch gestellt, so beiläufig wie möglich, als käme sie auf irgendeinen Bericht in der Zeitung zu sprechen. Als käme es nicht drauf an, was er entgegnen würde. Oder ob er überhaupt etwas entgegnete. In Momenten, wo jedermann gerne etwas sagt, hatte er die Gewohnheit zu schweigen. Wo aber die meisten zu schweigen pflegen, redete er, vergaß die Anwesenden, erging sich in weitschweifigen Ausführungen über sein Lieblingsthema, das alle, die ihm nah standen, längst kannten. Nein, uninteressant fand Mona es nie, bloß, dass er dabei alles Übrige vergaß, sogar den Gästen, die gerade gekommen waren, und denen er noch im Stehen seine Denkübungen auseinandersetzte, Stühle anzubieten. Um die Wohnungen, in denen Jonathan und Mona getrennt die Wochentage zubrachten, er allein und ohne Gegenüber aß und schlief, sie mit den Kindern zusammenlebte, beneideten die Freunde sie. Sie würden es ein nächstes Mal genauso machen, sagten alle. Man sollte einander nicht ständig allzu nah sein, fanden sie, jedoch immerhin nicht weiter weg, als dass man schnell rüber in die andere Wohnung, ins andere Bett schlüpfen könnte. Oder bloß auf ein Wort, auf ein Glas, einen Teller Suppe hereinschauen dürfte. Man sollte mitten in der Nacht über die Straße oder um die Ecke laufen und einander umarmen können, wenn einem danach war. Ja, sagten die Freunde und noch deutlicher die Freundinnen, das würde auch uns nicht schaden. Bei Streit sei Distanz hilfreich. Schon auf dem Heimweg verlöre sich der Zorn, und beim Aufschließen der Wohnung, warf Mona ein, in der keiner saß und wartete, falle einem auf, dass man vielleicht doch besser nicht weggelaufen wäre. Ihr mache manchmal das schlechte Gewissen zu schaffen, ein Gefühl, im Unrecht zu sein, als wäre der Streit plötzlich nur eine Lappalie, die Reaktion auf einen anstrengenden Tag, eine viel zu lange Reise. Auf Müdigkeit. Doch komme es auch vor, gab sie außerdem freimütig zu, dass sie erleichtert den Schlüssel ins Türschloss der eigenen Wohnung stecke, glücklich, wieder bei sich zu sein. Ihre Arbeit als Korrespondentin für Sempre forderte unregelmäßige Arbeitszeiten. Vor Redaktionsschluss war, wie bei jeder Monatszeitschrift, der Teufel los. Oft gab es kurzfristige Aufträge, das heißt, nein, fast immer. So setzte sie sich oft, kaum daheim, hinter den Schreibtisch, um die beinah zu Ende gebrachte Geschichte nochmals durchzulesen, zu Ende zu schreiben womöglich. Oder doch noch eine neue zu verfassen.
Hatte sie am Wochenende bei Jonathan den einen oder andern Einfall gehabt, erlebte sie zuhause neue Frische beim ersten Satz, den sie tippte. Nicht, dass Jonathan ihr absichtlich Stoff geliefert hätte, nein, es waren seine Geschichten, die er immer erzählte. Und es waren ihre Gespräche. Die inspirierten sie. Sie wanderten dabei durch Obstlandschaften, in denen lange Stecken rundum die alten Apfelbäume stützten, und an Waldsäumen entlang, wo Pilze sich aus dem Boden arbeiteten. Pirschten mit achtsamen Schritten durch Winterlandschaften. Oder entlang der Sommermatten der Schweinebauern jener Gegend mit ihren traurigen Kettenhunden, Nussbaumalleen, Bäuerinnengärten. Oft sannen sie außerdem gewissen Wörtern nach. Wörter hatten eine Geschichte, ein Herkommen und viele waren von Weitem zugewandert, und die beiden mochten es, sie bis an ihre Wurzeln zu zerlegen. Die lagen meist tief in der Vergangenheit, in Kulturen, wo Jonathan sich ohnehin besser zurechtfand als in der Gegenwart. Um spielen zu können, brachten sie einander gefundene Wörter mit. Und nicht nur beim Wandern, auch bei Tisch beispielsweise spielten sie dieses Spiel, es war eine verschrobene kleine Leidenschaft geworden.
Nicht an jenem Abend. Es war eines der Wochenenden, die sie gemeinsam in Jonathans Stube mit der Sicht zum verwilderten Garten verbrachten. Doch Jonathan war unüblich schweigsam gewesen. Die ganzen letzten Wochen hatte sie gleichsam mit einem Fremden, einem wortkargen, lustlosen Menschen gelebt. Und da wagte sie zu fragen, wie weit er mit Lesen schon gekommen sei. Sie meinte ihr neues Buch.
Jonathan brauste auf. Er habe nichts als Schönschrift in dem Buch gefunden. Nichts als Schönschrift. Da habe er nicht mehr als ein paar Seiten lesen mögen. Diese Worte verletzten sie. Vielmehr noch als befürchtet. Sie vermochte nichts zu entgegnen, spürte nur, es ist das Ende, es muss das Ende sein, ich ertrage das nicht. Sie stürmte aus der Tür und hinaus in die Nacht, weg von Jonathans giftigen Worten. Einzig Feindschaft hörte Mona heraus.
Zuhause entfernte Mona wütend Jonathans Fotografie von der Wand. Sie hatte sie an Ruths achtzehntem Geburtstag aufgenommen. Ruth war ihre ältere Tochter, jene, die den Freund der Mutter wirklich mochte. Jonathan im blauen Hemd, Kaffee einschenkend. Seine Hand, seine schöne Hand, wie sie fand, hielt behutsam den Espressokocher über die Tasse, die Ruth ihm entgegenhielt. Das Foto zeigte sein rechtes Profil, die feine, von Mona geliebte Ironie um den Mundwinkel, die Stirn mit all seinen Geschichten und Gedanken dahinter, das verführerische Ohr. Sein linkes Profil hingegen beunruhigte sie immer von neuem. Ihr schien, es zeige jene andere Seite von ihm, die ihn immer wieder Worte brüllen ließ, die er noch nie infrage gestellt hatte, die aber sein Gesicht zur Fratze verzerrten und sie in die Flucht jagten. Nicht nur furchterregend sah er dann aus, auch noch wie einer, der gerade eine Liebe tötet.
2.
Das Postauto mit Mona und Quadrupede hielt nach steilen Steigungen, mehreren Tunnels und Kurven mitten im Dorf. Mitten im Tal. Mitten am Nachmittag. Unweit eines steinernen Viadukts aus Tausenden roher Steine, von dem im Sommer die Jungen und Mädchen in die Tiefe sprangen. Der Fluss hatte sich hier, bevor er in die Schlucht donnerte, ein breites Bett hergerichtet und große Felsbrocken herbeigeschleppt, auf denen sich die Einheimischen nach ihren Sprüngen sonnten. Eine Anzahl Häuser samt Albergo war in respektvollem Abstand vom Wasser mit seinen Wirbeln und seinem schäumenden Gekräusel versammelt, und auf einem besonders hohen Felsen erhob sich die Kirche. Während der wenigen Sommerwochen, in denen die Wassertemperatur erträglich war, reisten in Scharen Brückenspringer herbei, um von dem berühmten Konstrukt in den Fluss zu springen. Die weniger mutigen turnten über die Granitbuckel, die er hergebracht hatte, und spürten dabei ebenfalls ein Kitzeln im Magen oder leichte Schwäche in den Knien. Es war ein Lachen und Rufen im Tal und in der Luft und vermischte sich mit dem Rauschen des eiligen Wassers. Jahr für Jahr kamen sie und kämpften um die Parkplätze, die am Dorfausgang für sie bereitstanden. Am liebsten kamen sie sonntags. Doch so sehr diese Herbeigereisten sich anstrengten, einige schlotternd, mit blauen Lippen, nie gelangen ihnen Sprünge, wie sie den Jungen gelangen, die in diesem Tal geboren waren. Jeder Stein und jede Untiefe waren ihnen vertraut, sie sprangen, als hätten sie es von den Fischen gelernt, denen sie, zwischen den Felshöckern flink umher tauchend, mit nichts als den Händen nachstellten.
An Tagen wie heute stand das berühmte Bauwerk jedoch unbeachtet, von niemandem fotografiert, keine Menschenseele wanderte an Tagen wie diesen dem Flusslauf entlang, niemand balancierte auf den Gesteinsbrocken oder auf dem Brückenrand. Mona und der Hund entstiegen als einzige dem Postauto. Mona hatte nicht wenig zu schleppen. Sie verließ die Hauptstraße und stieg den Hang hinauf, um die Schlucht zu erreichen, die von Osten her ins Valle mündete. Die Sicht auf die Felswüsten in der Höhe, über denen im Sommer um acht die Sonne erschien, war durch die steile Talwand noch verdeckt. Soweit der Blick reichte, wuchs Baum über Baum in die Höhe, und oben lag wie ein schmutziges Laken der Himmel.
Der Hund umkreiste Mona in weiten unsteten Runden, roch an einzelnen Steinbrocken, lief da- und dorthin, um ein Grasbüschel zu bepinkeln, das ihn schon von Weitem interessiert hatte. Marie, Monas Schwester, hatte ihr den Weg, den sie gehen musste, noch einmal genau beschrieben. Es galt, jene ganz bestimmte Lichtung zu finden, die sich oben, mitten im Kastanienwald auftat. Schmal stieg der Weg hinter der Kirche an, in einem Gemüsegarten leuchteten die Kürbisse. Rohe Stecken und Besenstiele staken im Boden, und fleischige Bohnen rankten sich empor. Am Eingang zum Tal stand ein Vogelbeerbaum und warf seinen löcherigen Schatten über ein Marienstöcklein. Eine verwitterte Gottesmutter war darin abgebildet, jung, aber mit zornigem Gesicht, wie es schien, und auf ihrem Kopf saßen zwei Hörnchen, die letzten Zacken, die ihr von der Krone geblieben waren.
Nach den Wiesen, letzten Steinhäusern und Ziegenställen begann der Kastanienwald. Der Boden war übersät von Kastanien. Alle noch in ihren aufgeplatzten Hüllen.
Glänzende kleine Früchte, zusammengedrängt im weißen Polster, und stets war nur eine Frucht dick geworden. Mona nahm die dicksten aus ihren Kammern und stopfte sie in die Jackentasche. Sie wollte sie später am offenen Feuer braten. Das Gepäck auf dem Rücken wog einige Kilo, der Beutel mit dem Proviant an der Schulter schnitt durch den Jackenstoff in die Haut.
Der Hund wartete hinter jeder übernächsten Kurve und lachte ihr entgegen. Sobald er sah, dass alles seinen Gang nahm und dass sie ihm folgte, rannte er wieder los. Erst hatte er versucht, nach dem Stecken zu schnappen in Monas freier Hand. Nach Stecken zu rennen war sein Lieblingsspiel. Es war aber diesmal ihr Wanderstab, der ihr half, sich und ihre angehängten Lasten über die Gesteinsbrocken und den holprigen Pfad nach oben zu bringen. Und es hatte eine Weile gedauert, bis er gelernt hatte, dass sie diesen Stecken niemals werfen würde. Sie würde überhaupt nichts werfen, um mit ihm zu spielen. Nicht hier, auf diesem schmalen Weg in der steilen Schlucht.
Vor ein paar Jahren war Maries Hündin hier ertrunken. Marie hatte zum Spiel ein Stück Ast den Hang hinuntergeworfen. Sie hatte zu spät bemerkt, dass es aus der Schlucht viel lauter rauschte als üblich. Sie rief, komm zurück! Aber das Tier rannte blindlings abwärts, durch Gestrüpp und altes Laub, sprang über Äste, die der Schnee heruntergerissen hatte, dem Fluss zu. Die Hündin liebte gewagte Sprünge ins Wasser, bei denen sie, noch in der Luft, alle erdenklichen Wurfgeschosse mit den Zähnen packte und triefend, aber glücklich zurückbrachte. Marie hatte das herumliegende Holz unter den vier Pfoten knacken gehört, und jedes Mal, wenn die Hündin in wilder Begeisterung an einem der Sträucher vorbeischoss, das Rascheln der zurückschnellenden Äste. Dann sah und hörte sie nichts mehr. Sie fand das Tier später im Weiher am Fuß des Wasserfalls. Es war auf ein Felsplateau gespült worden, lag nass und flach auf der Seite. Vollkommen reglos.
So hielt Mona jedes Mal, wenn es ihr nötig schien, den Stecken quer vor die Pfoten des Hundes, damit er nicht zu nahe an den Abgrund trat. Von der Einschüchterung erfasst, die ein Stab auf Mensch und Tier seit je ausübt, blieb er jedes Mal folgsam stehen. Eine unbegreifliche Autorität schien dann von dem Stück Ast auszugehen, in das er kurz davor noch voller Übermut gebissen hatte. Sie sagte, braves Tier, Quadrupede.
Der Sommer war wie ein trunkener Gärtner übers Land gegangen und hatte es mit seinen häufigen, sinnlosen Regengüssen beinah ertränkt, bis der Boden das Wasser wieder hervorwürgte und zusammen mit den Bächen, die über die Ufer traten, Dörfer mitriss, Straßen untergrub und zum Einsturz brachte, Felsmassen herunter donnern ließ. Auch hier im Tal lärmte der Fluss unten in der Schlucht durch sein felsiges Bett, die Wasserfälle nahmen mit, was ihnen zu anderen Zeiten unerreichbar war, jetzt aber, sieh an, kamen sie höher, heftiger, lauter.
Die Amseln in den Baumkronen hatten Frau und Hund längst erspäht und warnten die Gegend. Im Unterholz und halb vermoderten Laub raschelte es. Steine kollerten unter Monas Füßen weg und sprangen in die Tiefe. Sie musste sehen, wie sie mit dem Gewicht am Rücken vorankam und hatte genug zu tun mit Atmen, daher ließen sie ihre Gedanken soweit in Ruhe. Nur Schritt vor Schritt und atmen, sagte sie sich. Der Wald begann sich zu lichten, und da befanden sich auch schon die ersten Häuser.
Der Weg stieg nach wie vor an, die Bäume vereinzelten sich, und Mona erkannte die Mäuerchen, die die mageren Alpweiden eingrenzen, lose aufeinander getürmte Granit- und Schieferbrocken mit ausgesparten Schlupflöchern dazwischen, die mittels dicker Äste wiederum geschlossen worden waren. Marie hatte sie erwähnt, als sie ihr den Weg beschrieb. In unregelmäßigen Stufen ging es über grobe Steine, an kleinen oder größeren Gebäuden vorbei, Schöpfe für Schafe und Heu aus Stein oder Holz, deren Fenster mit schweren Holzläden verschlossen waren. Die Türen waren nach uraltem Brauch mit Querbalken und deftigen Nägeln verstärkt, Eisenriegel und ein großes Vorhängeschloss schützten vor Heudieben, aber auch vor zudringlichen Winterstürmen. Sie kamen an einem der Brunnen vorbei, wo einzelne Wandersleute gerne ausruhten, tranken und ihre Handgelenke oder Stirnen kühlten. Ein Steintrog, der einem Sarkophag aus der Antike ähnlich sah. Am halb verfallenen Haus gleich daneben entdeckte sie über dem Türsturz wieder ein Marienbild. Diese Maria trug ein Kind im Arm. Mona brauchte nur noch an ihr vorbeizugehen, und erreichte den Schopf, in dem Schwester und Schwager Brennholz, zwei Regenschirme aus dem Besitz verblichener Generationen, ein paar alte Gartenstühle und zwei Reffe aufbewahrten, hölzerne Gestelle mit Trageriemen. Marie und ihr Mann brachten damit Brennmaterial herbei. Sie war angekommen.
Niemand wusste mit Sicherheit, wie alt das schmale, hohe Haus war. Es überragte die wenigen Steinbauten der Umgebung alle. Neben der Eingangstüre war ein Tisch aus Granit in die Hauswand gemauert worden. Mona lehnte sich dagegen, um sich aus den Trägerschlaufen ihres Rucksacks zu winden. Die Sicht reichte bis zur nächsten Bergflanke, die sich vor den unmittelbar benachbarten Hang schob und zur Schlucht abfiel, auch er war bis oben dicht bewaldet. Sie erkletterte den Hang mit den Blicken, es schien, als klammerten sich die Bäume, so lange es immer ging, fest, manche waren vom Wind verkrüppelt und zu schiefem Wuchs verdammt. Und kaum sprang aus der Schroffheit etwas vor, eine felsige Nase, ein Kinn, ein Horn, fingen auch schon Moos und Gras dort zu gedeihen an. Dabei bildete sich ein grüner Rand um jene Stellen, die senkrecht abfielen und zu steil waren, als dass eine Baumwurzel Halt gefunden hätte. Ganz oben sah sie vor dem leeren Himmel ein paar letzte Baumkronen, entlaubte, vom Wind zerzauste Skelette.
Jetzt ballten sich die Wolken dichter zusammen, ein Glück, dachte sie, sind wir da.
Das Haus bestand aus zwei Stockwerken. Aus rohem Stein erbaut, inwendig nur mit dem Nötigsten ausgestattet, erlaubte sein Grundriss ein Zimmer pro Stockwerk. So waren drei Räume platzsparend aufeinandergetürmt und durch Treppen verbunden, die den Wänden entlang und durch die Böden führten. Die Türen zu den Zimmern lagen nach der obersten Stufe flach am Boden, wer hinaufwollte, musste sie aufstemmen, um einzutreten. Häuser bauen konnten die Vorfahren in diesem Tal bis zum Himmel, Getreide oder Kartoffeln anbauen und das Vieh weiden jedoch nur bis zur nächsten Geröllhalde, zum nächsten Abgrund.
Im Rücken des Hauses und in der Richtung zum Berg standen, abwechselnd mit den Kastanienriesen, Akazien und sogar Buchen. Im zweiten Stock war an der Außenmauer zum Tal hin ein schmaler Balkon zu sehen, auf dem in vergangenen Zeiten Fleisch oder Tabak, hin und wieder ein Fell zum Trocknen gehangen hatten. Vor dem Haus waren einst Erde und Geröll aufgeschüttet, Steinplatten verlegt und dem Hang damit ein Vorplatz abgetrotzt worden. Von einer Pergola pendelte wilder Wein. Es war spät im Jahr und er war schon rot, rot war es auch am Boden vor lauter Laub. Sie schloss auf, schlug die Läden des Fensters im Erdgeschoss zurück, nahm die Stühle vom Holztisch und achtete auf die Petrloleumlampe, die von der Decke hing. Denn diese, hatte Marie gesagt, spende, abgesehen von den Kerzen und der Feuerstelle, das einzige Licht im Haus. Ein offener Kamin gähnte schwarz aus der Wand und war von solcher Größe, dass man einen riesigen Kessel hätte hineinhängen und einen Laib Käse herstellen können. Mona entdeckte an der hinteren Mauer eine Treppe und stieg hinauf, stieß jedoch auf halbem Weg mit dem Kopf gegen ein Hindernis. Sie erinnerte sich, dass sie eine Tür aufstoßen musste, die flach am Boden angebracht war, und mit etwas Kraftaufwand gelangte sie ins obere Zimmer. Angesichts der schmalen, steilen Treppe entschied Quadrupede, lieber unten zu bleiben.