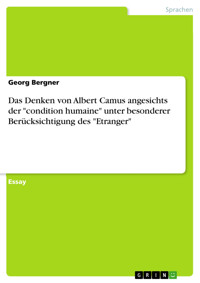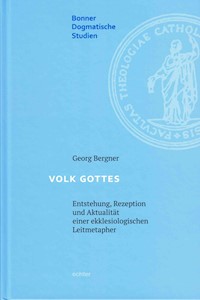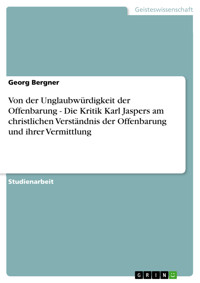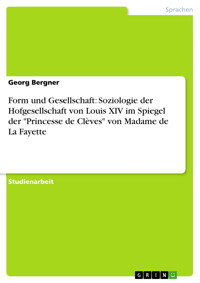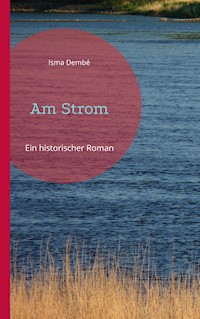
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zurück in das Jahr 2040, in die Zeit vor dem "Digital Crash". Die Zivilisation zeigt bereits erste Auflösungserscheinungen. In einer norddeutschen Kleinstadt geraten Majib und Jerome, ein junges Paar, in das Netz einer Intrige. Es beginnt eine Geschichte über Liebe, Zugehörigkeit, Flucht und den begrenzten Einfluss der Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Vorwort des Herausgebers
„Die Geschichtsschreibung kann man als Kampf gegen die Zeit verstehen. Indem sie die Verstorbenen zurück ins Leben holt, lässt sie die Vergangenheit, die allenfalls noch aus Erzählungen bestand, wieder auferstehen. So begreifen wir, wie wurde, was ist.“
Mit diesen Worten leitete Isma Dembé den berühmten Zeitungsartikel ein, in dem er sich nach dem Erscheinen seines Romans „Am Strom“ gegen seine Kritiker verteidigte. Man hatte ihm eine sentimentale Verklärung der Epoche vor dem großen Digital-Crash von 2069 vorgeworfen und damit die ideologische Rechtfertigung einer Generation, die durch beherztes Eingreifen die sich anbahnende Katastrophe hätte verhindern können.
„Am Strom“ ist in der Tat ein ungewöhnliches Buch. Es war mit Erscheinungsdatum 2099 eines der ersten großen Erzählwerke, das nach der langen Zeit des Wiederaufbaus erschien. Dies geschah in einer geschichtlichen Phase, in welcher den mühsam um das Überleben kämpfenden Menschen der Sinn für die Literatur schon abhandengekommen zu sein schien. Dies merkt man dem Text noch heute an. Dembé, der die „Vor-Crash-Zeit“ schließlich nach Vernichtung der digitalen Datenträger hauptsächlich aus Erzählungen kannte, gibt die Welt von damals nach heutigem Forschungsstand nur unzureichend wieder. Seine Schilderungen der technischen Welt von Telefonen, Internet und automatisierten Transportmitteln sind historisch ungenau. Zu seinen Quellen gehörten neben mündlichen Überlieferungen die Archive seiner Heimatstadt Lomburch, in denen sich unter anderem die letzten gedruckten Ausgaben von Fachmagazinen zu Sport, Mode oder Esskultur befanden. Es ist bis heute ein Problem der historischen Forschung, dass die Alltagskultur um das Jahr 2040, in dem der Roman spielt, wegen der damaligen Vorherrschaft der digitalen Speicher nur lückenhaft dokumentiert ist. Über die Vorgänge im Jahr 1900 oder 1950 wissen wir weit besser Bescheid. Dembé kannte zudem seine Heimatregion gut und hatte etwa seit frühester Kindheit den gewaltigen Bau der Stromburg bewundert, die er zu einem Hauptort seiner Geschichte macht. Die unzureichende Quellenlage wird man dem Autor also nur begrenzt zum Vorwurf machen können. Schließlich ging es ihm, wie er immer wieder betonte, weniger um die exakte Darstellung einer Epoche als vielmehr um das Erzählen einer Geschichte. Aber auch dies wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Dembé orientierte sich in „Am Strom“ an den Begebenheiten aus dem Leben seiner Großeltern mütterlicherseits. Als kleines Kind hatte er diese immer wieder erzählt bekommen. In gewisser Weise setzte er mit dem Roman seiner Familie ein literarisches Denkmal. Aber ließ sich eine solche biografisch angelehnte Geschichte tatsächlich erzählen, ohne die handelnden Personen dabei zu verklären? Der Zeitpunkt, zu dem der Roman erschien, war ungünstig. Man warf der 2040er-Generation vor, für die späteren Katastrophen die Hauptverantwortung zu tragen, ja, die Welt wie sie damals war, in den Ruin getrieben zu haben. Die Wut der Nach-Crash-Generation entlud sich auf einer Gesellschaft, deren Ignoranz man den Untergang der westlichen Zivilisation anlastete. Der Vorwurf einer „Ent-Schuldigung“ der Großeltern-Generation traf Dembé hart. In seinem Verständnis hatte er sich in seinem Roman darum bemüht, die eigenen Vorfahren nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Seine Romanfiguren Majib, Jerome, Enbe oder Yacine sind keine Helden, die sich gegen den Verfall der Zivilisation stemmen. Sie werden als typische Vertreter ihrer Generation geschildert, hineingenommen in die irrlichternde Unentschlossenheit ihrer Zeitgenossen, in den schlingernden ideengeschichtlichen und politischen Kurs der damaligen Epoche. Dass Dembé ihnen in seinen Schilderungen allerdings auch Sympathie, zuweilen sogar emotionale Wärme entgegenbringt, blieb seinen Kritikern ein bleibendes Ärgernis. Durfte man wirklich so über die 2040er schreiben?
Aus heutiger Sicht haben die Diskussionen von damals bereits etwas Patina angesetzt. Das Urteil über Dembés Roman fällt mittlerweile freundlicher aus. Beim Lesen seines „Am Strom“, dem Werk, das wir hier als Jubiläumsedition anlässlich seines 50jährigen Erscheinens erneut vorlegen, treten die ideologischen Grabenkämpfe um das Werk eher in den Hintergrund. Wir nehmen ein Buch zur Hand, das es trotz seines manchmal begrenzten literarischen Werts in die Reihe der Nach-Crash-Klassiker geschafft hat, ein Zeitdokument der langsam wiedererstehenden deutschsprachigen Belletristik. Dembé hat auf seine Weise viele Menschen neu zum Lesen geführt und bedeutende Schriftsteller unserer Tage inspiriert. Dem Autor selbst blieb es verwehrt, diese späte Anerkennung zu erfahren. Er starb bekanntlich bereits 2114. Als Herausgeber darf ich mich bei seiner Familie für die Freigabe der Rechte zur nun vorliegenden Neuauflage bedanken. So wünschen wir dem Roman eine große Leserschaft. Mit den leicht abgewandelten Worten eines von Dembé geschätzten Schriftstellers des 19. Jahrhunderts lässt sich anschließen:
„Wenn diese Geschichte euch nicht gänzlich missfällt, so bleibt dem gewogen, der sie geschrieben, und ein bisschen auch dem, der sie neu eingerichtet hat. Sollten wir jedoch nur Langeweile verbreiten, so glaubt uns, wir haben es nicht mit Absicht getan.“
Hamburg, am 05. Oktober 2149
Alexander Manser, Herausgeber
1
Gänse zogen über das Land. Das sattgoldene Licht der Abendsonne malte ihre Körper in fast unnatürlicher Farbigkeit in den Himmel. Auf dem Wasser des träge dahinfließenden Stroms schillerte und blinkte es edelsteinhaft auf. Das kurze Gleißen des reflektierten Lichtes bewirkte, dass Wertmanns Augenbrauen sich zusammenzogen. Mit fast verschlossenem Blick sah er durch die Wimpern auf den Fluss. Das Licht verzog sich zu langen, nadelähnlichen Strahlen, die sich um ihre Mittelachse bewegten, sobald er den Kopf mal schräg nach rechts, mal nach links wendete. Für kurze Zeit schloss er die Augen ganz und spürte die Wärme der Sonne auf seinen Lidern. Dann öffnete er sie wieder, drehte den Kopf aus dem Licht und blickte stromaufwärts. Wertmann stand auf der Anhöhe des an dieser Stelle steil ansteigenden Ufers. Er sah den reetbewachsenen Flusssaum, das kleine Wäldchen, dahinter die Stadt mit ihrem Kirchturm und dem Schlösschen auf der Anhöhe. Die Stromburg konnte man von hier nicht sehen. Ihre mächtige weiße Fassade, die Kuppel und der nach innen gebogene Turm lagen in der anderen Richtung verborgen hinter einem Wäldchen. Von dort allerdings kamen Geräusche. Einem zunächst entfernten Rascheln und Knacken im Unterholz folgten mehr zu erahnende als zu hörende Schritte und schließlich ein Hecheln. Kurz hinter Wertmann tauchte ein großer schwarzer Hund aus dem Dickicht und blieb auf dem Weg stehen. Für einen kurzen Moment zog er die Lefzen zurück und entblößte sein Gebiss, schob schnell atmend seine Zunge aus dem Maul und sah Wertmann aus knopfgroßen schwarzen Augen an. Ein kurzes, Missfallen ausdrückendes Knurren begleitete Wertmann, als er sich nach links wegdrehte, dem Hund den Rücken zuwandte und die ersten Schritte auf dem Weg weiterging. Nach einigen Metern blickte er zurück und sah das Tier unverändert dort stehen. Ein kurzer Pfiff aus dem Wald ließ es die Ohren aufstellen, ohne jedoch seine Position zu verändern. Weiter hinten am Weg, dort, wo dieser am Steilufer eine Biegung nach innen beschrieb, zeigte sich nun eine große Gestalt. Sie trug eine offensichtlich zu weite Jacke, an deren Ärmelende eine Hundeleine schlenkerte. Die Hände waren nicht zu sehen. Nochmals ertönte ein Pfiff und der Hund kam langsam auf Wertmann zu. Dieser wich zurück, sah, dass er Abstand gewann, drehte sich und beschleunigte seinen Schritt. Nach wenigen Metern standen auf seiner Stirn erste Schweißperlen. Der kleine, übergewichtige Körper folgte der Vorgabe der Beine nur unwillig. Wertmann erreichte eine Treppe. Genaugenommen waren es einzelne Stufen, die in unregelmäßigen Abständen aus dem Boden des Hangs hervorstanden. Er kam leicht ins Trudeln, ergriff mit der Hand ein hölzernes Geländer zu seiner Linken, fing sich und nahm die nächste Stufe: „Nur nicht fallen“. Der Hund folgte ihm in mäßigem Tempo. „He, Sie!“ – die Stimme kam von hinten. Der Mann mit der weiten Jacke war offenbar ebenfalls schneller gegangen. Wertmann erkannte beim Umdrehen sein bärtiges Gesicht. Ein großer Mensch, kurzes Haar, schwere Stiefel. Noch zwei Stufen, dann stand der Fliehende auf einer freien Fläche, Gras unter seinen Füßen, zu seiner Rechten das Reet, dahinter der Fluss. Ein weiteres „He, Sie!“, ein weiterer Pfiff. Der Hund verfiel in Trab, überholte Wertmann und setzte sich vor ihm auf den Boden. Jetzt stand Wertmann. Von hinten kam der Mann die Stufen hinunter, erreichte deren Ende und schritt auf ihn zu. „Haben Sie Angst vor Hunden?“ Ein leichter Wind ließ Wertmann den Schweiß auf seiner Stirn spüren. Der Fremde stand vor ihm, die Beine in den Stiefeln leicht auseinandergestellt. „Sie sind Wertmann, oder?“ Ein kurzes Nicken. „Sie arbeiten in der Stromburg.“ Eine Feststellung, keine Frage. „Sie arbeiten in der Verwaltung. Sie sind Chef der Kundenbetreuung.“ Wieder ein Nicken. Wertmanns Atem ging schnell. Er spürte einen leichten Schwindel. „Bei ihnen arbeitet ein Mann, der Jerome heißt, Jerome Dour.“ „Wer sind Sie?“ „Jerome Dour macht Abrechnungen für Großkunden, oder?“ „Ja.“ Ein Rascheln im Reet. Beide Männer blickten zur Seite. Zwischen den Halmen zeigte sich der grünschillernde Kopf einer Ente. Sie hob den Blick, öffnete den gelben Schnabel, setzte langsam einen Fuß vor den anderen und trat auf die Wiese. Der Hund stieß seine Nase in die Luft, richtete sich auf. Dann stürzte er mit lautem Bellen auf die Ente zu. Ein Pfiff und er blieb mitten im Lauf stehen, den Schwanz in die Höhe gerichtet. Die Ente flog auf und erreichte mit einigen hastigen Flügelschlägen das rettende Wasser des Flusses. Ein weiterer Pfiff. Der Hund kehrte zurück. „Ich komme von Enbe“. Der Mann nahm wieder das Wort. Seine dunklen Augen hatten Wertmann fest im Blick. „Von Enbe?“ „Sie kennen Enbe.“ „Ja, ich kenne Enbe, natürlich.“ „Enbe hat eine Bitte an Sie.“ Wertmann wich dem Blick des Fremden aus, senkte den Kopf und besah seine Fußspitzen. An den Schuhen klebte Lehm. Was wollte Enbe? Er hatte Enbe zuletzt gesehen bei der Betriebsversammlung. Das war vor zwei Wochen gewesen. Enbe saß mit den anderen Vorständen vorne am Tisch. Es ging um Abteilungsstrukturen: neue Zuschnitte, neue Kompetenzen, neue Posten. Enbe selbst hatte nicht gesprochen. Das überließ er anderen. Er brauchte nicht sprechen. Seinem Vater gehörte die Stromburg. Man ging ihm aus dem Weg. „Enbe hat eine Bitte an Sie.“ Der gleiche Satz, wie zur Bestätigung noch einmal gesagt. Wertmann sah auf. „Worum geht es?“ „Ist er gut, der Jerome Dour?“ „Er ist ein zuverlässiger Mitarbeiter.“ „Haben Sie an seiner Arbeit etwas auszusetzen?“ Wertmann überlegte kurz. „Nein, wie gesagt, er ist ein zuverlässiger Mitarbeiter.“ „Werden Sie in Zukunft etwas an seiner Arbeit auszusetzen haben?“ Der Hund spitzte seine Ohren, so als ob auch er an der Antwort Wertmanns interessiert wäre. „Wenn er weiter so arbeitet – ich glaube nicht.“ „Wird er denn weiter so arbeiten, oder könnte es sein, dass er bald eine Aufgabe bekommt, in der er einen Fehler macht, einen großen Fehler?“ Der Fremde ließ seinen Blick nicht von Wertmann. Hinter dem dunklen Bart schienen seine Lippen sich aufeinanderzupressen. Er holte tief Luft, so dass sich die Kontur seines Brustkorbs unter der weiten Jacke zeigte. „Das ist…“ Wertmann stockte kurz. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen, blickte in das Dunkel, öffnete sie wieder, wischte sich die Schweißperlen von der Stirn, ließ seine Schultern ein kleines Stück sinken, sah kurz noch einmal auf seine Schuhspitzen und sagte: „Das ist möglich“. „Ist es wahrscheinlich, dass dies in den nächsten Tagen geschieht?“ „Es ist nicht unwahrscheinlich“. Die Worte kamen Wertmann jetzt wie von selbst. „Enbe hat noch etwas, das er Ihnen sagen möchte“. Der Blick des Fremden hatte sich entspannt. „Er sagt, er mache sich Gedanken um die neuen Abteilungen. Er braucht dafür Menschen mit guten Kompetenzen.“ Wertmann nickte. „Sie meinen, er hat an mich…“. Doch der Fremde hatte sich umgedreht und ging langsam wieder auf die Stufen zu. Ein Pfiff und der Hund erhob sich aus dem Gras und trottete ihm hinterher. Wertmann setzte sich auf eine Bank und sah ihnen nach. Sein Kopf war voller Gedanken. Als er seinen Weg fortsetzte, spürte er beides zugleich: Seine Beine waren schwer wie Blei und leicht, als hätten sie Flügel. Am Ufer hinter der Wiese standen alte Bäume. Zweige von Sträuchern ragten auf den Weg und schlugen dem Gehenden ins Gesicht und an den Körper. Kleine sumpfige Pfützen spiegelten das letzte Tageslicht. In ihm flogen die letzten Gänse und über Wertmann krächzten Krähen in den Bäumen, die dort ihre Nester hatten.
2
Es war kurz vor drei. Aus den Fenstern der Skybar sah man in den schmutzigschwarzen Himmel über der Stadt. Unten die Lichter, gelbliche Punkte über leeren Straßen, ein paar letzte Scheinwerfer an den Containerbrücken. Rote und blaue Stahlschachteln, aufgetürmt zu Wänden und Häusern ohne Eingang. Ein paar große Schiffe, die bereit waren, sie aufzunehmen, Stück für Stück. Die Wände und Häuser bauten sich ab, jeden Tag, und errichteten sich neu: ein steter Wandel und doch stets das gleiche Bild. Die Stahlschachteln gehen und werden zurückgebracht im Kreislauf der Handelsrouten, die sich wie Adern um die Welt legen. Die Stadt ein Herzknoten, der alles pulsieren lässt.
In der Skybar war die Luft vom vielen Atmen dünn geworden. An allen Tischen Gäste, rauchend, lachend, trinkend, plaudernd, geschäftige Mienen bei den einen, Feierlaune bei den anderen, so wie jeden Abend. Der Barmann lehnte auf dem kleinen Vorsprung am Regal, in dem die Flaschen standen. Er unterdrückte ein Gähnen. Majib taten die Füße weh. Ihre Schicht dauerte schon sechs Stunden. Immer wieder hatte sie am Abend das gleiche getan. Sie war vom Tresen an einen Tisch gegangen, hatte eine Bestellung aufgenommen, die Bestellung auf einem kleinen schmutzigweißen Block notiert, hatte dem Barmann den Zettel gereicht, ein Tablett mit bunten Cocktails oder schweren Biergläsern zum Tisch balanciert, die Getränke verteilt, kassiert, war wieder zurück an den Tresen gegangen, hatte einen verlassenen Tisch abgeräumt und gewischt, neue Gäste begrüßt und wieder eine Bestellung aufgenommen. Dazwischen hatte sie mit Laura zweimal eine Zigarette geraucht, dreimal von Gästen Komplimente bekommen, viermal Reklamationen, war heute aber weder beschimpft noch belästigt worden. Es war ein guter Arbeitstag. „Mach mal noch Tisch sechs fertig, dann kannst Du nach Hause gehen. Um die letzten Gäste kümmere ich mich.“ Laura nickte ihr freundlich zu. „Danke“. Majib nahm das Tablett, ging zu Tisch sechs. In den Gläsern schwammen letzte Reste von Eiswürfeln. Ihr Schmelzwasser hatte sich mit der Farbe der Cocktails vermischt. Es war blassrosa und grasgrün, hellgelb und himmelblau. Daneben die Schale eines Orangenstücks, die Blätter einer Erdbeere, eine angebissene Ananasscheibe, ein paar Melonenkerne. Majib stellte alles auf ihr Tablett, sammelte die zerknüllten Servietten ein. Ein letzter Gang zum Tresen, dann holte sie ihren Mantel, ihren Regenschirm und die Handtasche. „Ich geh’, bis morgen!“. „Bis morgen“ – Laura nickte ihr zu, der Barmann nickte ihr zu. Majib stieg in den Fahrstuhl, drückte einen Knopf. Als sich die Türen wieder öffneten, entließ sie das Hotel mit der Skybar auf das nassglänzende schwarze Pflaster. Kaum Verkehr und doch keine Stille. In der Ferne Schiffsmotoren, in der Höhe Möwen, unten ein Glucksen aus den Sielen. Hinter ihr plötzlich Motorengeräusch. Es war ein schwerer Wagen, schwarz, der sich aus dem Grau der Straße heraus gelöst hatte. Er näherte sich Majib langsam von hinten, erreicht sie und drosselt auf Schrittgeschwindigkeit. „Majib!“ Die Stimme aus dem geöffneten Fenster. Sie wusste, wer nach ihr rief. „Heute nicht!“ „Warum nicht?“ „Bin müde.“ „Ich nehm’ dich mit, wenigstens ein Stück.“ „Nicht nötig, ich brauche frische Luft. Bis zur Bahn ist es nicht weit.“ „Wann sehe ich dich wieder?“ „Vielleicht Sonntag, da habe ich früher Schluss.“ „Lass mich nicht so lange warten“ – ein drohender Ton in seiner Stimme? „Dann Freitag, um zehn.“ „Ich bin da.“ Das Fenster schloss sich. Der Wagen beschleunigte. Seine Rücklichter spiegelten sich auf der Straße, hinterließen rote Schlieren auf dem Asphalt. Dann war es wieder still. „Ich hätte nie mit ihm gehen sollen“, dachte sie, „es war falsch“. Seit drei Monaten trafen sie sich. Er war mit Freunden in der Skybar gewesen. Ein Mann mit schwarzen Haaren, die ihm in die Stirn fielen, dunklen Augen, kleiner Nase, breitem Lächeln, Dreitagebart. Er mit weißem Hemd, die ersten drei Knöpfe geöffnet, goldene Uhr am Arm. Er saß in der Mitte und erzählte. Er zahlte die Drinks, viele Drinks. Alles kreiste um ihn. Seine Begleiter lieferten Stichworte, lachten über seine Witze, bestellten das, was er für sich bestellte. Und am Ende des Abends sprach er sie an. Er kam am nächsten Abend wieder, allein, blieb bis zum Schluss, saß an der Bar und sprach mit Majib. Dann nahm er sie mit nach Hause. Sie saßen zwei Stunden zusammen in seinem großen Haus. Er ließ sie von sich erzählen, umarmte sie zum Schluss und brachte sie nach Hause. Seitdem kam der schwere schwarze Wagen häufiger. „Es ist falsch“ – Majib sagte es in die Nacht. Dann schritt sie Treppen zur Bahnstation empor. Im grauschwarzen Himmel zeigten sich die ersten Lücken zwischen den Wolken. Bis zum Tageslicht waren es noch drei Stunden.
3
Jerome war pünktlich. Um acht Uhr schloss er das Büro auf. Kaltes weißes Licht zeigte seinen Schreibtisch, seinen Stuhl, seinen Rechner, seine Regale, seine Kaffeetasse. Er umfasste die beiden Schnüre neben dem Fensterrahmen und zog. Durch die schnelle Bewegung tanzten die Lamellen der Jalousie für einen Moment hin und her. Durch das Fenster ging sein Blick auf die weiträumige Anlage, kleinere und größere Gebäude, Rohrtrassen, Verbindungsgänge, auf der rechten Seite der große Turm der Stromburg, rund, in der Mitte dünner als am oberen Ende. Er sah aus wie ein doppelter Trichter, der aus dem Inneren etwas ansog und nach außen etwas abgab. In der Mitte die dünnste Stelle, so als hätte die Kraft der Maschinen den mächtigen Turm zusammengezogen. Diese Kraft, die ausströmte über Leitungen und Spulen, über Kondensatoren und Drähte und die unbändige elektrische Energie ins Land hinausschickte. Als Jerome seinen Computer hochfuhr, meldete ihm das System die neuen Textnachrichten. Es war das übliche: Informationen zum Arbeitstag, aktuelle Meldungen, Werbung, ein neuer Schichtplan und eine Nachricht von Wertmann. „Herr Dour, bitte kommen Sie heute um 10 kurz bei mir vorbei.“ Jerome überlegte. Was gab es zu besprechen? Das Quartal war noch nicht abgelaufen. Der Zahlungslauf für die Großkunden stand bevor. Es kam vor, dass Wertmann sich zur Kontrolle die Abrechnungen geben ließ und mit den einzelnen Sachbearbeitern sprach, falls er Erläuterungen haben wollte. Manchmal sprach er auch, wenn es andere Dinge gab – Krankheitsvertretungen, Neukunden, aktuelle Anweisungen aus der Zentrale, Schulungen. Es ging um dienstliche Dinge. Wertmann war immer dienstlich. Über Privates sprach er nie. Es war ihm sogar unangenehm, wenn ihm die Mitarbeiter zum Geburtstag gratulierten. „Mein schönstes Geburtstagsgeschenk sind gute Zahlen“, pflegte er zu sagen. Jerome nahm den Ordner mit den letzten Abrechnungen aus dem Regal. Er überflog die Papiere. Alles schien in Ordnung, keine offenen Forderungen, keine beanstandeten Rechnungen, keine Beschwerden. Er las vorsichtshalber auch die elektronischen Nachrichten der letzten Tage. Hatte er etwas übersehen? War noch ein Arbeitsauftrag offen, eine Anfrage nicht bearbeitet. Hatte er jemandem Grund gegeben, sich über ihn zu beschweren? Er fand keine Anzeichen, keinen Anlass, aus dem Wertmann mit ihm sprechen wollte. Um 9.45 Uhr verließ er sein Büro, schloss die Tür ab und ging über den langen Flur. Vorsichtshalber hatte sich Jerome den Ordner mit den aktuellen Vorgängen unter den Arm geklemmt. Er klopfte an die Tür der Abteilungsleitung. Wertmanns Sekretärin begrüßte ihn knapp und wies ihm einen Stuhl zu. „Warten Sie kurz, Herr Wertmann ist noch im Gespräch“. Sie hielt sich bei diesem Satz Daumen und Kleinfinger an den Kopf, so als wollte sie telefonieren. Aus dem Büro klang Wertmanns Stimme. Wertmann sprach leise. Er sprach immer leise. Als er nach fünf Minuten die Tür öffnete, sagte er nur knapp: „Guten Tag, Herr Dour“, reichte der Sekratärin einen Zettel mit einem Arbeitsauftrag und gab Jerome das Zeichen, einzutreten. „Den Ordner brauchen Sie nicht“. Wertmann setzte sich. „Ich möchte etwas anderes mit ihnen besprechen.“ Ein kurzes Hüsteln, ein leicht unsicheres Abschweifen der Augen. „Herr Dour!“ Wertmann legte die Hände auf dem Schreibtisch übereinander. „Ich bin in gewissen Schwierigkeiten. Ihre Kollegin Wasitzki muss kurzfristig in der Lohnbuchhaltung aushelfen. Schwangerschaftsvertretung. Sie hat ja damals dort angefangen, bevor sie zu uns kam. Sie kennt sich also aus. Ich habe der Abteilungsleiterin gesagt, dass Frau Wasitzki hier eigentlich unabkömmlich ist. Sie wissen, die Kollegin betreut hier einige wichtige Kunden.“ „Einige schwierige Kunden“, dachte Jerome. Ekatarina Wasitzki war spezialisiert auf harte Fälle, auf Firmen, bei denen es immer Ärger gab. Sie galt als sehr durchsetzungsstark. Warum wollte Wertmann auf sie verzichten? „Nun ja, Herr Dour, ich konnte zumindest raushandeln, dass Frau Wasitzki ein paar Stunden die Woche noch bei uns arbeitet. Trotzdem muss ich ein wenig umorganisieren. Sie und andere Kollegen müssen leider ein paar Kunden übernehmen. Es tut mir leid, aber ein wenig mehr Arbeit muss ich Ihnen zumuten.“ Wertmann hüstelte wieder und blickte auf seine Hände. „Herr Wertmann, das kann ja immer mal passieren. Sie müssen sich nicht entschuldigen.“ Jerome sah jetzt auch auf Wertmanns Hände. Die rechte Hand drückte die untenliegende linke fest zusammen. „Herr Dour!“ Die Stimme des Vorgesetzten hatte an Festigkeit gewonnen. „Ich übergebe Ihnen die ‚AluTrek‘.“ „Die Aluminiumhütte im Hafen?“ „Ganz genau – ein guter Kunde, Großabnehmer.“ „Ist das Werk nicht schon geschlossen?“ „Noch nicht. Die Schließung ist für nächstes Jahr vorgesehen. Der Fall ist nicht ganz einfach. Die ‚AluTrek‘ steckt in gewissen finanziellen Schwierigkeiten. Soweit ich die Lage überblicke, gibt es noch einige offene Rechnungen. Frau Wasitzki hat da aber schon gut vorgearbeitet.“ „Ich muss mir die Sache anschauen.“ „Ich lasse Ihnen die Akten bringen. Ich bin zuversichtlich, dass sie den Fall kompetent bearbeiten werden.“ Wertmann zog die Mundwinkel leicht nach oben. Es schien eine Art Lächeln zu sein. Oder ein kurzer stechender Schmerz.
4
In Hamburg wohnte das Geld hinter weißen Fassaden unter grünangelaufenen Kupferdächern. Enbe hatte das zu spät gemerkt. Kurz, nachdem er für die Europazentrale der Firma eine Etage in dem neu gebauten Wolkenkratzer an den Elbbrücken angemietet hatte, stellte er fest, dass im gleichen Haus allenfalls zweitrangige Unternehmen ihre Büros untergebracht hatten. Der Elbtower war wenig geschäftsfähig. In der Logik der alten Kaufleute verströmte er einen deutlichen Hauch von Unseriösität. Selbst internationale Großkonzerne hielten ihre Kundengespräche in den altväterlichen Villen und Stadthäusern, umgeben von holzgetäfelten Wänden, Kronleuchtern und maritimen Dekors. Hinter schweren Eichentüren kam man zu Vertragsabschlüssen an langen Tischen zusammen. Man saß auf lederbezogenen Stühlen, vor sich Kaffeetassen aus zartem Porzellan oder schwere Kristallgläser, in denen Wasser und Whiskey gereicht wurden. Enbe war bereits einige Male in diesen Häusern gewesen. Insgeheim hielt er bereits nach einer ähnlichen Immobilie Ausschau. Der Tower war ein Fehler gewesen. In Lagos galt ein Hochhaus mit Blick auf die Lagune als Ausweis von Geld und Bedeutung. Alle wichtigen Firmen waren in solchen Gebäuden zu finden. Die Höhe hielt einem den Stadtmoloch mit seinen 25 Millionen Einwohnern auf Abstand. Wer gesellschaftlich hoch gestiegen war, wohnte oben. Enbes Vater hatte vor gut 40 Jahren sein erstes Büro in Lagos eingerichtet. Er hatte als Geschäftsführer der Filiale eines staatlichen Erdölkonzerns begonnen, nach dem Rückzug einiger westlicher Firmen nach und nach kleinere Unternehmen, schließlich ganze Raffinerien erworben. Vor allem das innerafrikanische Erdölgeschäft boomte damals. Enbes Vater hatte das Geschick und die nötigen Beziehungen, seine Firma mit lukrativen Aufträgen zu versorgen. Er investierte nebenbei in Solaranlagen. Sein neuestes Feld war die Atomkraft. Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht auch vorausschauender Geschäftssinn, dass er seinem Sohn Jonathan zum Studium an eine deutsche technische Universität schickte. Nachdem die deutsche Regierung den Ausstieg aus dem Atomgeschäft beschlossen hatte und die Kraftwerke nach und nach vom Netz gingen, witterte Enbe seine Chance. Der britische „Waterfall“-Konzern zog sich aus dem deutschen Energiesektor zurück und suchte einen Nachfolger, um die Atomanlagen für die restliche Laufzeit von wenigen Jahren noch zu betreiben und dann abzuwickeln. Da sich kein deutsches Unternehmen diese Last aufbinden lassen wollte, schlug „Enbe Energies“ zu. Der Aufschrei in der Wirtschaftswelt war groß: Ein nigerianisches Unternehmen kauft alte deutsche Atomkraftwerke? Es forderte einen langen Atem und die Überwindung vieler bürokratischer Hürden, bis der Verkauf abgeschlossen wurde. Jonathan Enbe bewies das nötige Geschick. Im letzten waren die deutschen Behörden froh, einen Investor gefunden zu haben, der garantierte, seinen Anteil an den Rückbaukosten zu bezahlen. Im Gegenzug gestand man „Enbe Energies“ zu, die Meiler noch bis 2030 betreiben zu dürfen. Die dafür nötige Gesetzesänderung wurde gegen erbitterten Widerstand letztlich umgesetzt. Es gehe, so argumentierte man, schließlich nur um drei Kraftwerke. Für das geringe Entgegenkommen von vier weiteren Jahren Laufzeit entlaste man den Steuerzahler von erheblichen Kosten. Die Wahrheit war, dass man den Meilern bereits eine längere Lebenszeit stillschweigend zugestanden hatte. 2026 wurde der Vertrag besiegelt. Jonathan Enbe leitete im Auftrag seines Vaters die „Enbe Energies Europe“, zunächst mit Sitz in Hannover. Mit dem Kauf der Atomkraftwerke hatte Enbes Vater ursprünglich ein bestimmtes Ziel verfolgt. Es war ihm darum gegangen, technisches Know-How und Fachkräfte für den späteren Bau von Anlagen in Afrika zu gewinnen. Zudem gab es die vage Hoffnung, den technischen Anlagen später in Nigeria zu einem zweiten Einsatz zu verhelfen, ein Wunsch, der sich nach kurzer Zeit und einigen Gesprächen im Wirtschaftsministerium als Illusion herausstellte. Der Einstieg in die deutsche Atomkraft wäre fast zum Fiasko geworden. Doch dann kam 2028. Es begann mit der erneuten Explosion der Strompreise. Der Versuch, die deutsche Volkswirtschaft auf die Versorgung mit regenerativen Energien umzustellen, hatte alle Finanzplanungen gesprengt. Der Strom wurde teurer, die Versorgungssicherheit war mit dem zunehmenden Ausfall der Kohlekraftwerke gefährdet. Auf die Straßenproteste folgten intensive Debatten im Parlament. Die Regierung musste einlenken. 2029 wurde der Vertrag zu „Stream Flow“, der nächsten großen Gaspipeline geschlossen, kurz darauf folgte dann die abermalige Verlängerung der Laufzeiten für die noch bestehenden Atomkraftwerke. Bis 2050 war der Betrieb nun gewährleistet. Wie Enbe aus vertraulichen Gesprächen wusste, gab es hinter den Kulissen allerdings schon Pläne für weitere Verlängerungen sowie den Bau neuer Kraftwerke. „Enbe Energies“ hatte gewonnen. Die Firma galt im Wirtschaftsministerium schon als eine Art Retter der deutschen Energieversorgung. Man stellte bereits weitere Staatsaufträge in Aussicht. 2031 verlegte die europäische Konzerntochter den Firmensitz nach Hamburg. Neun Jahre war das jetzt her. Mit Stolz schaute Enbe auf die Firmengeschichte zurück. Auf seinem Schreibtisch standen in silbernen Rahmen ein Bild des Vaters, ein Bild der Firmenzentrale in Lagos, ein Bild von Enbe mit dem deutschen Wirtschaftsminister und ein Bild der Stromburg, dem größten der deutschen Kraftwerke. „Etwas fehlt.“ Dieser Gedanke kam Enbe in den letzten Monaten immer wieder. Er meldete sich in den stillen Momenten des Tages, beim Blick auf den Fluss und auf die Wolken. Es war so etwas wie ein Ostinato, ein gleichbleibender Akkord unter den Betriebsamkeiten des Alltags. Mit Blick auf das Wasser und die auf ihm treibenden Wellen brach dieser Akkord wieder hervor. „Wohin treibt es mich?“ „Wohin geht mein Leben?“ Wo war der Rahmen mit dem Hochzeitsbild, mit dem Bild der glücklichen Familie eines mächtigen Mannes, der sich in diesem Moment im Sessel zurücklehnte und die Augen schloss?
5
Die Akten trafen nach der Mittagspause ein. Der blonde junge Mann mit der blassen Gesichtsfarbe, der letzten Monat seine Ausbildung in der Abteilung begonnen hatte, klopfte zaghaft an die Tür des Büros. „Entschuldigung, ich soll das hier vorbeibringen“. Auf ein kurzes Zeichen Jeromes hin schob der Blondschopf einen Aktenwagen durch die Türöffnung. Jerome staunte nicht schlecht. Auf dem Wagen türmte sich ein Berg mit Ordnern, welche die Aufschrift „AluTrek“ auf ihrem Rücken trugen. „Das ist noch nicht alles. Ich komme gleich nochmal wieder“. „Hören Sie mal“, Jerome rief den jungen Mann zurück, „ich brauche nicht die ganzen Altbestände zu diesem Fall. Mir reicht eine Übersicht über die letzten fünf Jahre“. „Das sind die letzten fünf Jahre“. Der Auszubildende zog schon leicht entschuldigend die Schulterm nach oben. „Das heißt, eben noch nicht ganz, der Jahrgang 2037 fehlt noch. Den bringe ich gleich vorbei.“ Er entfernte sich rasch und zog die Tür leise hinter sich ins Schloss. Jerome brauchte eine Minute, um mit Blick auf den Aktenwagen die erste Verblüffung zu überwinden. Das viele Papier hatte ihn überfallen wie ein Feind aus dem Hinterhalt. Von seiner Masse durfte man sich nicht überwältigen lassen. Nach dem ersten Innehalten ging Jerome auf den Wagen zu und begann, die Akten mit dem aktuellen Datum zu suchen. Dazu nahm er Ordner um Ordner vom Wagen, sah kurz auf die Beschriftung, warf einen Blick auf die ersten Seiten und begann, für jedes Halbjahr einen Stapel zu bilden. Das zwölfte Aktenpaket, das auf diese Weise zugeordnet wurde, trug die Aufschrift „Juni 2040“. Allerdings entdeckte Jerome etwa zehn Ordner später einen weiteren Aufkleber, der das Datum „August 2040“ trug. Dafür, dass sich hier der gesammelte Schriftverkehr von nur zwei Monaten fand, war der abgeheftete Papierstapel bereits auf eine erstaunliche Höhe angewachsen. Schon bei einem ersten Durchblättern erkannte Jerome das Problem. Neben den ausgedruckten Rechnungen fanden sich Mahnschreiben für ausgebliebene Zahlungen, Zwischenstände zu Gerichtsverfahren, die nachrichtlich in Kopie durch die Rechtabteilung verschickt worden waren, außerdem zahlreiche Gesprächsvermerke, Auszüge aus Briefwechseln, Protokolle von Beratungen zwischen den Abteilungen der Stromburg. Frau Wasitzki hatte als zuständige Sachbearbeiterin versucht, alle relevanten Schriftstücke zu erfassen. Allerdings ließ die Handakte eine gewisse Ordnung vermissen. Jerome ahnte, was passiert war. Die Sachbearbeiterin war von der schieren Menge der Papiere erschlagen worden. Sie hatte nicht mehr die Zeit, vielleicht auch nicht mehr die Lust, für eine ordnungsgerechte Aktenführung zu sorgen. Auf einem Notizblock vermerkte Jerome nach dem ersten Einblick: „1. Mit Frau Wasitzki eine geordnete Übergabe der Akten durchführen (Übergabeprotokoll), 2. Mit Wertmann über Zeitkontingente sprechen (Entlastung an anderer Stelle), 3. Platz für die Akten schaffen (den blassen Azubi fragen!), 4. Die AluTrek über Wechsel in der Zuständigkeit informieren, 5. Nicht ärgern.“ Jerome ging auf den Flur, ließ sich an der Kaffeemaschine seinen Becher auffüllen, trank einen Schluck und machte sich auf den Weg in den zweiten Stock. Hier musste das Büro von Frau Wasitzki sein. Als er den Namen auf den Schildern im Flur nicht finden konnte, klopfte er wahllos an einer Tür. Eine mittelalte rothaarige Frau öffnete ihm. Als sie ihn ansah, lächelte sie. „Herr Dour, was verschafft mir die Ehre ihres Besuchs? Ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen. Sie hatten mir doch letzte Woche in der Kantine versprochen, dass wir uns mal zum Kaffee treffen.“ Jerome erinnerte sich nur noch bruchstückhaft an die Begegnung in der Kantine. Offenbar hatte sie bei der Kollegin einen tieferen Eindruck hinterlassen als bei ihm. „Ja…“ er suchte kurz nach den passenden Worten „…ich habe Sie nicht vergessen. Wir können uns gerne die nächsten Tage treffen. Ich habe nur im Moment gerade ein anderes Anliegen. Sie können mir sicher helfen. Ich suche Frau Wasitzki. Sie hat doch ihr Büro hier bei Ihnen auf der Etage.“ Die Kollegin versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Im Bruchteil einer Sekunde gewann sie wieder die Kontrolle über ihre Mundwinkel. Sie lächelte erneut. „Herr Dour, kein Problem. Ich hätte Ihnen ohnehin sagen müssen, dass es in dieser Woche mit dem Kaffee nicht klappt. Wir haben gerade viel zu tun. Sie sicher auch, oder?“ „Ja, deswegen suche ich ja Frau Wasitzki. Ich musste einen Kunden von ihr übernehmen.“ „Doch nicht etwa die ‚AluTrek‘?“ Diese Frage wurde von einem Stirnrunzeln begleitet. „Doch, genau die. Deshalb würde ich mit Frau Wasitzki gerne eine Übergabe machen.“ „Kommen Sie doch kurz rein“. Die Frau zog Jerome sanft am Ärmel und schloss die Bürotür hinter ihnen. „Herr Dour, ich will Ihnen was sagen: Lassen Sie die Finger von der ‚AluTrek‘. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Frau Wasitzki hat die Sache ganz gut im Griff gehabt. Aber auch sie ist regelmäßig an dem Kunden verzweifelt. Ich habe mit ihr häufiger gesprochen. Der ständige Druck in diesem Fall hat ihr zugesetzt.“ „Ist sie deshalb in die Lohnbuchhaltung versetzt worden?“ „Davon weiß ich nichts. Ich habe nur gehört, dass Frau Wasitzki für längere Zeit krankgeschrieben ist. Ihr Büro ist seit heute leer.“ „Ich danke Ihnen sehr“. Jerome nahm die Klinke in die Hand und wandte sich zum Gehen. „Wegen des Kaffees melde ich mich.“ Auf der Treppe kam er ins Grübeln. Wie hieß die rothaarige Kollegin? Frau Möller? Oder Frau Meiser oder Maier oder Mieske oder so ähnlich…
6
Majib ließ die Wohnungstür ins Schloss fallen. Leichtfüßig nahm sie die Stufen im grauen Treppenhaus, setzte die Füße in ihren bequemen Schuhen federnd von Tritt zu Tritt. Sie war spät aufgestanden. Nach den Nachtschichten schlief sie meist bis zum frühen Vormittag. So war es auch heute gewesen. Schon im Aufwachen horchte sie kurz in die Wohnung hinein. Manchmal hörte sie die Stimme der Mutter leise vor sich hinsummen. Die Stimme war nicht da. Offenbar war auch sie bereits ausgeflogen. Yacine, Majibs Mutter, summte wohl schon auf dem Weg zum Supermarkt, wo sie an der Kasse arbeitete. Vielleicht würde Majib nachher kurz vorbeischauen. Majib kochte sich einen Kaffee, setzte sich vor den Fernseher, stöberte währenddessen in ihrem Telefon nach einigen Einkauftipps. Dann rief sie Laura an und erfuhr, dass die gestrige Spätschicht ohne größere Probleme zu Ende gegangen war. Lediglich für den letzten Gast habe man noch ein Taxi rufen müssen, nachdem er bereits durch mehrere Drinks im Sprechen beeinträchtigt, trotzdem wortreich beklagte, seinen Autoschlüssel verloren zu haben. „Was machst du heute noch, Majib?“ „Ich weiß noch nicht. Ich gehe gleich eine Runde durch die Stadt, dann hole ich Jerome vom Bus ab und dann mal schauen.“ Ein flüchtiger Blick auf die Uhr verriet Majib, dass der Nachmittag bereits weiter fortgeschritten war, als sie gedacht hatte. „Gut, dass wir gerade drüber sprechen.“ Majib lachte: „Ich muss langsam wirklich los. Sehen wir uns morgen?“ Laura legte am anderen Ende eine kurze Pause ein: „Ich schaue gerade auf den Plan. Warte. Heute habe ich nochmal Spätschicht, morgen ist Freitag. Da bin ich früh dran und du wieder spät. Also wahrscheinlich sehen wir uns nicht.“ „Nicht morgen, aber spätestens Sonntag.“ „Sonntag sicher.“ „Bis dann.“ Als Majib vor die Tür trat empfing sie wärmender Sonnenschein. Es war ein spätsommerlicher Tag. Federnden Schritts durchquerte sie die Straßen, die sich in rechten Winkeln zwischen den Wohnblocks kreuzten. Nach einigen Minuten bog sie in die Fußgängerzone ein. Hier verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und bummelte an den Schaufenstern vorbei. Bis vor wenigen Jahren hatten sich an dieser Stelle Geschäfte befunden. Durch die rasant zunehmenden Bestellungen und Lieferdienste war der altertümliche Warenverkauf mit Schauräumen und Ladentresen mit der Zeit überflüssig geworden. Die Stadtverwaltung versuchte, ein wenig Nostalgie zu wahren, indem sie auf großformatigen Tafeln alte Fotografien vor den Häusern aufgestellt hatte. Hier sah man Ansichten der Fußgängerzone aus dem vergangenen Jahrhundert. Verschiedene Läden trugen altertümliche Schriftzüge, auf denen „Quelle“ zu lesen war oder „Elektro Meyer“ oder „Petras Boutique“. Die nostalgischen Erinnerungen passten sich gut in das Stadtbild ein, das sich mittlerweile wegen seiner schönen Atmosphäre zum Anziehungspunkt für Besucher aus dem Umland entwickelt hatte. Nachdem die 1980er Jahre über lange Zeit als Inbegriff des langweiligen und uninspirierten Bauens gegolten hatten, lobte man nun die verborgene Schönheit des neuen „Sachlichen Stils des Endes des 20. Jahrhunderts“ in den höchsten Tönen. Mehrere Ausstellungen hatten die Stadt als Mustersiedlung dieser Epoche bekanntgemacht und die Aufmerksamkeit architekturbegeisterter Touristen auf sie gezogen. Besonders die Bauart der Häuser war für derzeitige Verhältnisse außergewöhnlich. Man fand dort erstaunlich niedrige, teilweise sogar eingeschossige Gebäude, viele von ihnen aus Ziegeln gemauert, einem Baustoff, der so unendlich teuer geworden war. Neidvoll blickte so mancher Besucher auf die kleinen romantischen Balkone über den Geschäftsräumen mit ihren geometrisch geformten mintgrünen oder roten Eisengeländern. Ziegeldächer und Regenrinnen aus Kupfer rundeten den harmonischen Eindruck ab. Auch die Straße aus echten Pflastersteinen, die ein Schwarz-Weiß-Muster zeichneten, erregte Aufmerksamkeit. An einer Stelle traten kleine Wasserfontänen aus der Straße. Dieser fröhliche Ort vor einem vergleichsweise imposanten Gebäude mit Glasfassade lud zur Rast ein. Majib setzte sich für einen Augenblick auf die neben dem Brunnen stehende Bank, schloss die Augen und hörte dem Wassersprudeln zu. Die Fußgängerzone war zu dieser Nachmittagsstunde belebt. Die zahlreich gewordenen Kaffee-Shops und Eisdielen erfreuten sich eines regen Andrangs. An anderen Stellen waren Renovierunmgsarbeiten zu beobachten. Ehemalige Ladenräume wurden jetzt häufig zu Wohnungen umgebaut. Die großen Räume und ihre Schaufenster boten Investoren Freiraum zur Gestaltung und wohlhabenden Bürgern die Möglichkeit zu luxuriöser Repräsentation. Im Stillen hatte sich Majib bereits ihr Traumhaus ausgesucht, einen kleinen Bungalow in einer Seitenstraße, der noch vor 10 Jahren eines der letzten Schreibwarengeschäfte beheimatet hatte. Sie erinnerte sich an die Regale voller bunter Hefte, Papiere, Stifte und Malutensilien. Damals hatte eine ältere Frau den Laden betrieben, die sich lange mit den Kunden unterhielt und Empfehlungen gab. Merkwürdig, dass sich jemand zu dieser Zeit noch die Mühe machte, Dinge in so kleinen Mengen zu verkaufen, einen Klebestift oder eine Packung buntes Papier oder eine Packung Tintenpatronen. Die Dame fand erwartungsgemäß für ein solches Geschäft keinen Nachfolger und schloss den Laden. Seitdem stand der Geschäftsraum ungenutzt leer. Die jetzigen Besitzer schienen sich nicht um die Immobilie zu kümmern. In Majib regte sich seit geraumer Zeit die kleine Hoffnung, in die Räume vielleicht selbst einmal einziehen zu können. Mit Jerome zusammen würde sie das Wohnen mit etwas Anstrengung schon finanzieren können. Er hatte ihr immer wieder Hoffnung auf ein besseres Einkommen und eine Beförderung gemacht. Die Stromburg bot ihm einen sicheren Arbeitsplatz und die Möglichkeit, im Unternehmen aufzusteigen.
In dieser Weise in Gedanken vertieft, bog Majib um die nächste Ecke und gelangte zur Hauptstraße. An der Bushaltestelle blieb sie stehen. Es war wie fast an jedem Tag. Jerome hatte ihr immer wieder gesagt, dass sie ihn nicht vom Bus abholen müsse, aber sie tat es. Majib liebte den Blick die Straße hinab, den Augenblick, an dem ein Bus um die Ecke bog und sie von Weitem bereits zu erkennen versuchte, ob es Jeromes Bus war. Sie kannte die kleine Enttäuschung, den winzigen Moment der Vergeblichkeit, wenn sie auf dem Fahrzeug die falsche Liniennummer identifizierte. In ihr regte sich dann ein leiser Schmerz, der zugleich die Erwartung steigerte. Im nächsten Bus würde er kommen, ganz sicher. Und er würde aussteigen in seiner etwas zerstreuten Art, würde sie erst auf den zweiten Blick sehen, kurz lächeln und „Hallo Majib“ sagen. Dann würde er sie kurz in den Arm nehmen und für einen Augenblick nicht wissen, was er sagen sollte. Dieses Zögern war der stumme Ausdruck seiner Freude, sie zu sehen. So war es jeden Tag. Majib stand und wartete, die Straße fest im Blick. Nur noch kurze Zeit. Dann bog der Bus um die Ecke.
7
Lassen wir Majib für einen Moment an ihrer Bushaltestelle zurück und Jerome auf seinem Heimweg und Enbe in seinem Büro. Was ist an diesem Nachmittag das Kleine ihrer Geschichte im Verhältnis zu der Schwere des Ereignisses, das an diesem Tag, dem 6. September 2040 seinen Lauf nehmen sollte? Während hier, im norddeutschen Tiefland noch sanft die Sonne schien und den Menschen einen letzten Sommergruß sendete, floss der Strom aufwärts und trug das Sonnenlicht auf den Wellen weiter ins graue Meer. Dort im auffrischenden Wind, türmte sich das Wasser ungleich höher. Auf den Spitzen der auf- und niedergehenden Hügel formte sich die flüssige Landschaft in ewiger Variation. Es ist gleichzeitig das Wechselnde und Beständige, das sich in der Bewegung der Meere spiegelt. Viele Seemeilen von der Mündung des Stroms entfernt, vor der französischen Küste durchschnitt ein Koloss aus Stahl das wogende Element, ein Schiff von gewaltiger Größe. Es brach die Hügel aus Wasser an seinem Rumpf und glitt über die Täler. Dem stampfenden Rhythmus seiner Motoren folgend strebte es seinem Ziel auf dem grauen Nichts entgegen. Doch was, wenn es das Ziel verlieren würde? Als die Besatzung der „MS Zita“ an diesem Nachmittag auf die ersten Abweichungen ihrer Route aufmerksam wurde, war es schon fast zu spät. Die sonst untrügliche Navigation durch das Satellitensystem setzte mit einem Mal aus. Der unsichtbare Wellenstrom der Daten aus dem All versiegte. Die „MS Zita“, beladen mit einigen hundert Containern voller Waren aus aller Welt geriet vom Kurs ab. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Schiffsoffiziere den Fehler entdeckten. Die Navigation schien wie festgefroren. Man hielt die Motoren an. Doch bis sich der Stahlriese aus der Bewegung bringen ließ, vergingen wertvolle Minuten. Meter um Meter arbeitete sich das Schiff vor, fand allerdings, zum Glück ohne auf ein Hindernis zu stoßen, irgendwann im Spiel der Wellen zu einer relativen Ruhe. Das Schiff trieb nun vor sich hin, ein Zustand, der in der rastlosen Tätigkeit der Maschinen auf See nicht vorgesehen war. Der Kapitän alarmierte über Funk die Küstenwache. Es habe, so sagte er, einen Fehler im Navigationssystem gegeben. Man sei derzeit ohne Satellitensignal und versuche, das Problem zu beheben. Der derzeitige Standort solle an umliegende Schiffe weitergegeben werden, um sie auf das Hindernis aufmerksam zu machen. Wenig später meldete sich die Küstenwache zurück. Man habe weitere Meldungen aus dem gleichen Seegebiet erhalten. Mehrere Schiffe befänden sich in einer ähnlichen Situation wie die „MS Zita“. Offenbar sei nicht das Navigationsgerät, sondern das Satellitensignal ausgefallen. Die Besatzung solle vorsichtshalber mit halber Kraft die Fahrt fortsetzen und sich an die Seekarten halten. Falls Bedarf bestehe, sei man bereit, einen Lotsen zur Verfügung zu stellen. Das Eintreffen könne allerdings dauern. Im Falle der Weiterfahrt möge man gegebenenfalls andere Schiffe in der Nähe kontaktieren, um die Information weiterzugeben. Man sei sich nicht sicher, ob der Satellitenausfall auch Auswirkungen auf die Überwachungssysteme der Behörden habe. Die „MS Zita“ setzte sich daraufhin langsam wieder in Bewegung. Für die nächsten zwei Stunden steuerte sie mit halber Kraft weiter auf ihren Zielhafen zu. Dann meldete sich das Satellitensignal zurück. Eine kleine Störung, nichts weiter. Die Verzögerungen im Schiffsverkehr dieses Tages bedeutete für die Hafenarbeiter zwischen Le Havre und Rotterdam eine unfreiwillige Spätschicht. Den Nachrichten des Tages war das Ereignis keine Meldung wert. Noch nicht.
8
„Du bist angespannt.“ Majib sah vom Sofa aus Jerome hinüber. In ihren Worten lag eine Mischung aus Sorge und Gereiztheit. „Warte ganz kurz.“ Jerome überflog noch einmal die Nachrichten auf seinem Computer. Entgegen seiner Gewohnheit hatte er seinen Dienstlabtop mit nach Hause genommen und ging die Posteingänge des Tages durch. Seit ihn der Aktenberg der „AluTrek“ erreicht hatte, war er im Büro zu nichts anderem gekommen. Er hatte versucht, die Angelegenheit zu ordnen, die offenen Forderungen aufzulisten und den Stand der Mahn- und Gerichtsverfahren systematisch zu erfassen. Mühsam versuchte er, einzelne Schriftwechsel den jeweiligen Vorgängen zuzuordnen. Ein Hauptstreitpunkt der letzten Monate war eine Abschlagszahlung aus dem Jahr 2038 gewesen, deren Richtigkeit von der „AluTrek“ angefochten wurde. Die endgültige Klärung war beiderseits an Anwälte delegiert worden, in der Hoffnung, auf außergerichtlichem Wege eine Einigung zu finden. Eine Nachfrage in der Rechtsabteilung der Stromburg hatte ergeben, dass das Verfahren ruhe, da der beauftragte Rechtsanwalt über mehrere Wochen nichts unternommen habe. Darauf wollte man ihm das Mandat entziehen, ein Vorgang, gegen den der Rechtsanwalt nun selbst gerichtlich vorgehe. Die „AluTrek“ ihrerseits habe auf der Klärung bestanden und halte die fällige Zahlung zurück. Man sicherte Jerome zu, sich von Seiten der Rechtsabteilung nun noch einmal mit dem Fall zu befassen, den man bedauerlicherweise etwas aus dem Blick verloren habe. In einem anderen Streitfall beschuldigte die „AluTrek“ seinen Energieversorger, selbst mutwillig die Lieferung des Stroms gedrosselt zu haben. Über drei Wochen im Januar dieses Jahres sei es daher zu Produktionsausfällen gekommen, für die man nunmehr die Stromburg verantwortlich mache. Die Behauptung war eine glatte Lüge. Nach Datenlage war es nie zu einer Einschränkung der Strommenge gekommen. Wie aus einem internen Gesprächsvermerk hervorging, vermutete man in der Zentrale des Energiekonzerns, dass die „AluTrek“ das Unternehmen für selbstverschuldete Produktionsausfälle in Mithaftung nehmen wolle. Bei der prekären finanziellen Lage des Aluminiumwerkes war dies eine naheliegende Schlussfolgerung, allein, sie ließ sich nicht beweisen. Der Versuch, über einen Mittelsmann beim Metall-Interessenverband informelle Erkundigungen einzuziehen, war kläglich gescheitert. Kurz danach traf eine Anzeige wegen Betriebsspionage in der Rechtsabteilung ein. Diese wurde gegen Zahlung einer Geldbuße abgewendet. Man vereinbarte Stillschweigen und übergab die Klärung des Sachverhalts wieder der zuständigen Sachbearbeiterin Frau Wasitzki. Damit war nun Jerome in ihrer Nachfolge mit dem Vorgang beschäftigt. Was sich vor ihm auftat, war ein Wust gegenseitiger Beschuldigungen und Forderungen. Der Fall „AluTrek“ würde Jeromes Zeit auf Wochen hin binden. „Majib, es tut mir leid.“ Jerome klappte den Computer zu. „Ich musste schnell noch ein paar Mails bearbeiten. Ich bin gerade furchtbar unter Druck.“ Majib sagte nichts. Stattdessen nahm sie seine Hand. Sie legte ihre Finger unter seine Handfläche und begann, mit dem Daumen sanft über seinen Handrücken zu streichen. Der Daumen wanderte über die Knöchel und ertastete wie von plötzlicher Neugier gepackt zuerst den kleinen Finger, dann den Ringfinger, verweilte dort einen Augenblick und wechselte zum Mittelfinger, dann zum Zeigefinger. Dort angekommen fuhr er langsam der Handkontur folgend auf den Jeromes Daumen zu. Majibs Finger glitten von der Handfläche auf den Handrücken und legten sich sanft zwischen Jeromes Finger, legten seine Hand sanft in die ihre und schlossen sie nunmehr zu einer doppelten Hand zusammen. Jerome atmete auf. Er fühlte sich sicher.
9
Nach der Arbeit ging Yacine in das Café Africaine. Es lag nur ein paar Schritte vom Supermarkt entfernt. Nach acht Stunden, die Yacine damit verbracht hatte, Lebensmittel in Pappkartons zu verpacken, boten die Feierabendstunden im Café eine willkommene Abwechslung. Angefangen hatte sie damals als Kassiererin. Das war, bevor sich der Supermarkt immer mehr zu einem Umschlagplatz für die diversen Bringdienste verwandelt hatte. Seit einigen Jahren kamen kaum noch Kunden, sondern Boten mit bunten logobewehrten Jacken und Mützen, die ihre ebenso bunten Fahrräder, E-Roller und Kleinwagen auf dem mittlerweile für sie reservierten Parkplatz abstellten, um in bunten Kisten und Taschen die bestellten Waren am Supermarkt abzuholen. Aus den Kassiererinnen waren „Delivery Hub“-Servicekräfte, kurz „DeliHubbies“ geworden. Sie arbeiteten die elektronischen Bestellungen ab, digitale Einkaufszettel, die ihnen über die Bringdienste zugespielt wurden. Yacine hatte den Vorteil, noch über einen alten Vertrag zu verfügen, der ihr zugestand, auch weiter in den Regelzeiten der Kassiererin zu arbeiten. So konnte sie die Nachtschichten umgehen, die für das 24-Stunden-Geschäft unumgänglich waren. Wie ihr die jungen Kollegen berichteten, bestand letzteres im Wesentlichen aus Standardzusammenstellungen von Bier, Chips, Wodka, Tiefkühlpizza und Sushi, um die lückenlose Versorgung nächtlicher Computerspielsessions und studentischer Partys sicherzustellen. Die Tagschichten kümmerten sich eher um die Dinge des täglichen Bedarfs und waren somit abwechslungsreicher. Dennoch war das lange Stehen an den Packstationen anstrengend.
Das Café Africaine bot nach der Schicht neben einem warmen Tee und einem Abendessen auch genügend bequeme Polstersessel, in denen Yacine ihrem strapazierten Rücken gerne eine kleine Auszeit gab. Als Gastraum diente eine ehemalige Änderungsschneiderei. Als diese vor etwa 10 Jahren aufgegeben wurde, hatte Yacines Freundin Mae die Idee mit dem Café gehabt. „Wir brauchen einen Ort für ein wenig Kulturpflege“, hatte sie damals gesagt. „Wir alle sind jetzt schon so lange in Deutschland, dass wir unsere Heimat noch ganz vergessen.“ Mae stammte wie Yacine aus dem Senegal und war wie diese als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Über Beziehungen war es ihr gelungen, für kleines Geld allerhand heimatlich-afrikanisches Interieur zusammenzutragen, bunte Lampen, Holzschnitzereien, vor allem aber farbige Stoffe, mit denen Wände und Tische bedeckt wurden. „Leider alles in China produziert…“, stellte Mae bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit einem resignierenden Kopfschütteln fest, „…aber immerhin im Senegal gekauft“. Um ihrem Anspruch gerecht zu werden, die heimische Kultur im norddeutschen Gewerbegebiet sichtbar und erlebbar zu machen, ließ sich Mae nicht davon abbringen, im Café großgemusterte afrikanische Kleider zu tragen. Sie stammten zum Teil aus dem Erbe ihrer Mutter, wie sie den Gästen ebenfalls gerne erklärte. Heute empfing sie Yacine in einer Kombination aus einem eng geschnittenen gelb-grün gestreiften Rock und einer schimmernde Bluse mit silbernen Hyänen auf schwarzem Grund. „Yacine, mein Schatz, gut, dass du kommst.“ Mae begrüßte sie eigentlich immer so. Als Yacine sie irgendwann gefragt hatte, warum es gut sei, dass sie komme, hatte Mae nur lakonisch geantwortet, dass es immer gut sei, wenn sie komme. „Ich mache dir schonmal einen Tee. Magst du auch was essen? Ich habe heute Ceebu Jen gemacht.“ Ceebu Jen gehörte zu Maes beliebtesten Gerichten. Reis mit Fisch. Yacine war zurückhaltend. Fisch war teuer. Mae kaufte je nach Angebotslage und verarbeitete dann auch schon einmal Heringsfilets in ihren traditionellen westafrikanischen Speisen. „Danke“ Yacine bemühte sich um eine diplomatische Antwort. „Ich hätte heute eher Lust auf etwas Süßes. Wenn du Kuchen hast, nehme ich gerne ein Stück. Ich setze mich zu Rosy.“ Sie steuerte geradewegs auf die Sitzecke mit den blauen Polsterstühlen zu, an der sie bereits beim Eintreten Rosys zierliche Gestalt entdeckt hatte. Rosy war mit ihren fast 70 Jahren mittlerweile das, was man früher eine elegante Dame genannt hätte. Eigentlich hieß sie gar nicht Rosy, sondern hatte vor einigen Jahrzehnten ihren afrikanische Namen gegen dieses europäisch-amerikanische Pseudonym eingetauscht. „Das konnten sich Gäste besser merken“, sagte sie gerne zur Erklärung. Rosy stammte aus Liberia und war, damals gerade volljährig, als Flüchtling nach Italien gekommen. Dort hatte sie einige Monate illegal gelebt – eine Zeit, von der sie nicht sprach. Über Umwege und Beziehungen war sie schließlich nach Deutschland gekommen und erhielt die Gelegenheit, zunächst ein Praktikum, später eine Ausbildung in einem Hotel zu beginnen. Im Laufe der Zeit erarbeitete sie sich Stufe um Stufe ihren beruflichen Aufstieg. Die letzten Jahre vor ihrer Pensionierung war sie Empfangschefin im Hotel „Schifferklavier“ unten am Stadthafen gewesen. Nun zählte sie zu den Stammgästen des Café Africaine und zu Yacines besten Freundinnen. „Wie war dein Tag?“ Yacine zog mit leicht schmerzerfülltem Gesicht die Schultern nach hinten, um den schmerzenden Rücken zu entlasten. „Eigentlich wie immer. Es passiert ja nichts Besonderes.“ „Das sagst du so. In meiner Zeit im Hotel haben ich das auch immer gedacht und später verwundert festgestellt, welche interessanten Geschichten sich offenbar im Verborgenen in den Zimmern abgespielt haben. Hotelgäste…“ bei diesem nunmehr nur halb geflüsterten Wort beugte sich Rosy leicht nach vorne, „…Hotelgäste glauben, sie seien unbeobachtet. Aber das stimmt nicht. Das Personal sieht alles.“ „Unsere Waren im Supermarkt sind da weniger aktiv. Dafür wissen sie, dass wir sie immer im Blick haben.“ Rosy