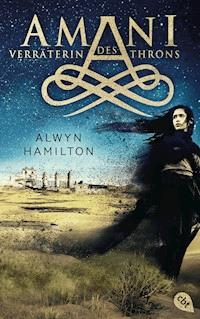
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die AMANI-Reihe
- Sprache: Deutsch
Es geht um alles: Macht. Liebe. Verrat.
Seit fast einem Jahr kämpft Amani für den Rebellenprinzen, als sie aufs Schlimmste verraten und an den Sultan ausgeliefert wird – ihren Todfeind. Ihrer Djinni-Kräfte beraubt und getrennt von ihrer großen Liebe heißt es für das Wüstenmädchen überleben um jeden Preis. Denn der Sultanspalast ist eine wahre Schlangengrube, in dem Intrigen und mysteriöse Todesfälle an der Tagesordnung sind. Amani riskiert ihr Leben, indem sie als Spionin den Rebellen Botschaften zukommen lässt. Doch je mehr Zeit sie in Gesellschaft des berüchtigten Sultans verbringt, desto öfter kommen Amani Zweifel: Steht sie wirklich auf der richtigen Seite?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alwyn Hamilton
Aus dem Englischenvon Ursula Höfker
Für Rachel Rose Smith,die mir immer den Rücken freihält
Charaktere
Die Rebellion
Amani Scharfschützin, Demdji, gebrandmarkt durch blaue Augen, kann den Wüstensand manipulieren, auch unter dem Spitznamen »Blauäugiger Bandit« bekannt.
Prinz Ahmed Al-Oman Bin Izman Der Rebellenprinz, Anführer der Rebellion.
Jin Prinz von Miraji, Bruder von Ahmed. Sein voller Name lautet Ajinahd Al-Oman Bin Izman.
Shazad Al-Hamad Tochter eines mirajinischen Generals, gehört zu den ursprünglichen Mitgliedern der Rebellion, bestens ausgebildete Kämpferin, Strategin.
Delila Demdji, gebrandmarkt durch lila Haare, kann aus Licht in der Luft Illusionen erzeugen. Leibliche Schwester von Ahmed, Schwester von Jin durch Adoption.
Hala Demdji, gebrandmarkt durch goldfarbene Haut, kann in den Köpfen anderer Menschen Halluzinationen erzeugen. Schwester von Imin.
Imin Demdji, gebrandmarkt durch goldene Augen, kann jede beliebige menschliche Gestalt annehmen. Schwester von Hala.
Izz und Maz Zwillinge und Demdji, beide gebrandmarkt durch blaue Haut und blaues Haar, können jede beliebige Tiergestalt annehmen.
Bahi (verstorben) Jugendfreund von Shazad, in Ungnade gefallener Heiliger Mann, wurde von Noorsham getötet.
Izman
Sultan Oman Herrscher über Miraji, Vater von Ahmed und Jin.
Prinz Kadir Ältester Sohn des Sultans, Sultim, d.h. Thronerbe.
Prinz Naguib (verstorben) Einer der Söhne des Sultans, Armeekommandant, wurde von den Rebellen in der Schlacht um Fahali getötet.
Lien (verstorben) Xichainerin, Frau des Sultans. Jins leibliche Mutter, nach Adoption auch Ahmeds und Delilas Mutter. Starb an einer Krankheit.
Nadira (verstorben) Ahmeds und Delilas leibliche Mutter. Wurde vom Sultan getötet, weil sie das Kind eines Djinni gebar.
Die Letzte Provinz
Tamid Amanis bester Freund, Heiliger Vater in Ausbildung, hinkt aufgrund einer angeborenen Missbildung. Vermutlich tot.
Farrah Amanis Tante, die älteste Schwester ihrer Mutter.
Asid Farrahs Mann, Pferdehändler in Dustwalk.
Sayyida Amanis Tante, im Alter zwischen Amanis Mutter und Farrah, verließ Dustwalk vor Amanis Geburt, um ihr Glück in Izman zu finden.
Zahia (verstorben) Amanis Mutter, wurde für den Mord an ihrem Ehemann erhängt.
Hiza (verstorben) Ehemann von Amanis Mutter, nicht der leibliche Vater von Amani. Wurde von seiner Frau ermordet.
Shira Amanis Cousine, Farrahs einzige Tochter. Aufenthaltsort unbekannt.
Fazim Shiras Geliebter.
Noorsham Demdji, gebrandmarkt durch blaue Augen, kann Djinni-Feuer erzeugen, das eine ganze Stadt dem Erdboden gleichmachen kann. Geboren in der Minenstadt Sazi. Aufenthaltsort unbekannt.
Mythen und Legenden
Erstwesen Von Gott erschaffene unsterbliche Wesen wie Djinn, Buraqi und Vögel Roch.
Die Weltenzerstörerin Ein Wesen aus dem Mittelpunkt der Erde, das an die Erdoberfläche kam, um Tod und Dunkelheit zu bringen. Von der Menschheit besiegt.
Ghule Die Diener der Weltenzerstörerin. Zu den Ghulen zählen Nachtmahre, Gestaltwechsler und andere.
Der Erste Held Der erste, als Kämpfer gegen die Weltenzerstörerin von den Djinn erschaffene Sterbliche. Er wurde aus Sand, Luft und Wasser gemacht und mit Djinni-Feuer zum Leben erweckt. Auch als Erster Sterblicher bekannt.
Prinzessin Hawa Legendäre Prinzessin, die die Sonne an den Himmel sang.
Der Held Attallah Geliebter von Prinzessin Hawa.
Der fremde Prinz
Im Wüstenkönigreich von Miraji lebte einmal ein junger Prinz, der den Thron seines Vaters besteigen wollte. Er hatte keinen Anspruch darauf, doch er hielt seinen Vater für einen schwachen Herrscher und glaubte, er selbst sei stärker. Und so machte er sich den Thron gewaltsam zu eigen. In einer einzigen Nacht voller Blutvergießen fielen der Sultan und die Brüder des Prinzen durch das Schwert des jungen Prinzen und die fremde Armee, die er anführte. Beim Morgengrauen war er kein Prinz mehr. Er war der Sultan.
Der junge Sultan war dafür bekannt, Frauen auf dieselbe Art in seinen Harem zu holen, wie er sich den Thron genommen hatte: mit Gewalt.
Im ersten Jahr seiner Herrschaft gebaren zwei dieser Frauen fast zur selben Zeit Söhne. Eine der jungen Frauen war in der Wüste geboren und ihr Sohn gehörte zur Wüste. Die zweite Frau war auf der anderen Seite des Wassers geboren, in einem Land namens Xicha. Sie wuchs an Deck eines Schiffes auf. Ihr Sohn gehörte nicht zur Wüste dazu.
Dennoch wuchsen die Söhne wie Brüder auf. Ihre Mütter schützten sie vor den Dingen, vor denen die Palastmauern keinen Schutz boten. Und eine ganze Zeit lang war alles gut im Harem des Sultans.
Bis die erste Frau wieder niederkam, doch dieses Mal mit einem Kind, das nicht vom Sultan war. Es war die Tochter eines Djinni mit einer unnatürlichen Haarfarbe und unnatürlichem Feuer im Blut. In seinem Zorn bestrafte der Sultan seine Frau für das Verbrechen, ihn betrogen zu haben. Sie starb unter seinen Schlägen.
Der Sultan war so außer sich vor Zorn, dass er nicht auf die zweite Frau achtete. Sie floh mit den beiden Söhnen und der Tochter des Djinni übers Meer ins Königreich Xicha, aus dem der Sultan sie entführt hatte. Dort konnte ihr Sohn, der Fremde Prinz, so tun, als gehörte er dazu. Der Wüstenprinz konnte das nicht. Er war so fremd in diesem Land, wie sein Bruder es im Land seines Vaters gewesen war. Doch keiner der Prinzen sollte lange bleiben. Bald verließen die beiden Xicha und fuhren zur See.
Und auf Schiffen, die nach überall fuhren und von nirgendwo kamen, war eine Zeit lang alles gut für die Brüder. Sie segelten von einem fremden Hafen zum nächsten und gehörten an jedem Ort gleichermaßen dazu. Bis eines Tages über dem Bug des Schiffes Miraji wieder auftauchte.
Der Wüstenprinz sah sein Land und erinnerte sich, wohin er in Wirklichkeit gehörte. An dem vertrauten Strand verließ er das Schiff und seinen Bruder. Der Wüstenprinz bat seinen Bruder zwar, ihn zu begleiten, doch der Fremde Prinz lehnte ab. Das Land seines Vaters wirkte auf ihn leer und karg, und er verstand nicht, weshalb es seinen Bruder so dahin zog. Und ihre Wege trennten sich. Der Fremde Prinz blieb noch eine Weile auf See. Insgeheim zürnte er seinem Bruder, weil dieser die Wüste dem Meer vorgezogen hatte.
Schließlich kam der Tag, an dem der Fremde Prinz die Trennung von seinem Bruder nicht länger aushielt. Als er in die Wüste von Miraji zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser dort eine Rebellion entfacht hatte. Der Wüstenprinz redete von großen Dingen, von großen Ideen, von Gleichheit und Wohlstand. Er war umgeben von neuen Brüdern und Schwestern, die genau wie er die Wüste liebten. Man nannte ihn jetzt den Rebellenprinzen. Dennoch hieß er den Mann, der schon sein ganzes Leben sein Bruder war, mit offenen Armen willkommen.
Und eine Zeit lang war alles gut unter den Rebellen.
Bis ein Mädchen kam. Ein Mädchen, das sie den Blauäugigen Banditen nannten, das im Sand gemacht und von der Wüste geschliffen worden war und mit ihrem ganzen Feuer brannte. Und zum ersten Mal verstand der Fremde Prinz, was sein Bruder an dieser Wüste so liebte.
Der Fremde Prinz und der Blauäugige Bandit durchquerten gemeinsam die Wüste, bis sie schließlich zur Stadt Fahali kamen, in der die fremdländischen Verbündeten des Sultans sich niedergelassen hatten und wo eine große Schlacht entbrannte.
In dieser Schlacht von Fahali errangen die Rebellen ihren ersten großen Sieg. Sie verteidigten die Wüste gegen den Sultan, der sie lebendig verbrannt hätte. Sie befreiten den Demdji, den der Sultan sonst gegen seinen Willen zu einer Waffe gemacht hätte. Sie töteten den Sohn des Sultans, der Blut so lange vergossen hätte, bis er von seinem Vater Lob geerntet hätte. Sie zerschlugen das Bündnis des Sultans mit den Fremden, die die Wüste jahrzehntelang bestraft hatten. Und die Rebellen erklärten einen Teil der Wüste zu ihrem Eigentum.
Die Berichte über die Schlacht von Fahali breiteten sich rasch aus. Und mit ihnen die Nachricht, dass es sich lohnen könnte, die Wüste zurückzuerobern. Denn die Wüste von Miraji war der einzige Ort, an dem alte Magie und neue Maschinen zusammen existieren konnten. Das einzige Land, das Gewehre schnell genug ausspucken konnte, um ausreichend Männer für den großen Krieg zwischen den Nationen des Nordens bewaffnen zu können.
Herrscher von fremden Küsten wandten die Blicke gen Miraji, und es waren hungrige Blicke. Rasch tauchten weitere fremde Armeen in der Wüste auf. Sie kamen von allen Seiten und versuchten, neue Bündnisse zu schließen oder gleich Anspruch auf das Land zu erheben. Eine Zeit lang bissen sich Feinde von außerhalb an den Grenzen des Sultanats fest und hielten seine Armee auf Trab. Derweil eroberten die Rebellen im Innern eine Stadt nach der anderen. Sie schlugen sie dem Sultan aus der Hand und brachten die Menschen auf ihre Seite.
Und eine Zeit lang war alles gut für die Rebellen, für den Blauäugigen Banditen und den Fremden Prinzen.
Bis das Pendel nach und nach gegen seinen Bruder, den Rebellenprinzen, ausschlug. Zwei Dutzend Rebellen tappten in der Wüste in eine Falle. Sie wurden umzingelt und überwältigt. Eine Stadt erhob sich gegen den Sultan. Die Leute riefen den Namen des Rebellenprinzen in die Nacht, doch die ihn gerufen hatten, erlebten das Morgengrauen nicht. Und der Blauäugige Bandit wurde während einer Schlacht in den Bergen von einer Kugel getroffen und schwer verwundet. Sein Leben hing an einem seidenen Faden. Und zum ersten Mal, seit sich die Wege des Blauäugigen Banditen und des Fremden Prinzen gekreuzt hatten, trennten sie sich dort wieder.
Während der Blauäugige Bandit um sein Leben kämpfte, wurde der Fremde Prinz an die Ostgrenze der Wüste geschickt, wo eine Armee aus Xicha ihr Lager aufgeschlagen hatte. Der Fremde Prinz stahl eine Uniform und marschierte ins Lager der Xicha, als gehörte er dazu. Es war nicht schwer, da er hier nicht fremd aussah. Im Kampf gegen die Truppen des Sultans stand er an ihrer Seite und spionierte sie insgeheim für den Rebellenprinzen aus.
Und eine Zeit lang ging alles gut für den Spion in der fremden Armee.
Bis ein Sendschreiben aus dem feindlichen Lager eintraf. Der Überbringer trug das Gold und das Weiß des Sultans und schwenkte eine Friedensflagge.
Der Fremde Prinz wäre bereit gewesen zu töten, um zu erfahren, was in diesem Schreiben für ihn und seine eigenen Leute stand, doch das war nicht nötig. Es war bekannt, dass er die Sprache der Wüste sprach. Er wurde ins Zelt des xichainischen Generals gerufen, um für den Gesandten des Sultans und die Xichainer zu übersetzen. Dabei wusste keine Seite, dass er der Feind beider war. Beim Übersetzen erfuhr er, dass der Sultan einen Waffenstillstand wollte. In dem Schreiben stand, er wolle kein weiteres Blutvergießen mehr und sei bereit für Verhandlungen. Der Fremde Prinz erfuhr, dass der Herrscher von Miraji alle fremden Herrscher zu sich rief, um über eine neue Allianz zu reden. Der Sultan forderte jeden König und jede Königin, jeden Kaiser oder Prinz, die Anspruch auf seine Wüste erhoben, auf, in seinen Palast zu kommen und ihre Forderungen vorzubringen.
Das Sendschreiben erreichte den xichainischen Kaiser am nächsten Morgen, und die Waffen schwiegen. Der Waffenstillstand hatte begonnen. Als Nächstes kamen Verhandlungen. Dann ein Friedensvertrag zwischen dem Sultan und den Eindringlingen. Und sobald keine Notwendigkeit zur Sicherung seiner Küsten mehr bestand, würde der Wüstenherrscher sich wieder den inneren Angelegenheiten zuwenden.
Der Fremde Prinz erkannte, dass es Zeit war, zu seinem Bruder zurückzukehren. Die Rebellion stand kurz davor, sich zu einem Krieg auszuweiten.
Ich hatte dieses Hemd immer gemocht. Schade, dass es jetzt voller Blut war.
Immerhin war das meiste nicht von mir. Das Hemd gehörte übrigens auch nicht mir – ich hatte es mir von Shazad ausgeliehen und nie zurückgegeben. Jetzt wollte sie es wahrscheinlich auch nicht mehr.
»Halt!«
Mit einem Ruck brachte man mich zum Stehen. Meine Hände waren gefesselt, und der Strick scheuerte schmerzhaft über die wunde Haut an meinen Handgelenken. Ich zischte einen Fluch, als ich den Kopf hob, endlich von meinen staubigen Stiefeln aufschaute und der gleißenden Wüstensonne in die Augen blickte.
Im letzten Licht warfen die Stadtmauern von Saramotai einen mächtig langen Schatten.
Diese Stadtmauern waren legendär. Sie hatten in einer der größten Schlachten des Ersten Krieges standgehalten, in der Schlacht zwischen dem Helden Attallah und der Weltenzerstörerin. Sie waren so alt, dass sie aussahen, als seien sie aus den Knochen der Wüste selbst erbaut. Doch die Worte, die man in weißer Farbe über das Stadttor geschmiert hatte … sie waren neu.
Willkommen in der freien Stadt.
Ich sah, dass die Farbe an manchen Stellen in die Ritzen zwischen den alten Steinen gelaufen war, bevor sie in der Hitze getrocknet war.
Ich hätte die eine oder andere Bemerkung darüber machen können, wie es sich anfühlte, wie eine auf den Bratenspieß gebundene Ziege in eine sogenannte freie Stadt geschleift zu werden, doch selbst ich wusste, dass es im Moment besser war, die Klappe zu halten.
»Erklärt euch, oder ich schieße!«, rief jemand von der Stadtmauer herunter. Die Worte beeindruckten entschieden mehr als die Stimme. Der Sprecher war wohl noch im Stimmbruch. Ich blinzelte durch meine Sheema zu dem Jungen hinauf, der von der Zinne mit einem Gewehr auf mich zielte. Er war schlaksig und konnte kaum älter sein als dreizehn. Und er sah aus, als könnte er das Gewehr nicht richtig halten, selbst wenn sein Leben davon abhinge. Was wahrscheinlich der Fall war. Wir waren schließlich in Miraji.
»Wir sind’s, Ikar, du Idiot«, bellte der Mann, der mich festhielt, neben meinem Ohr. Ich zuckte zusammen. So zu schreien, schien wirklich nicht nötig zu sein. »Mach sofort das Tor auf, sonst werde ich dafür sorgen, dass dein Vater dir wenigstens ein bisschen Verstand in deinen Kopf prügelt, und wenn er stärker draufhauen muss als auf seine Hufeisen. So wahr mir Gott helfe.«
»Hossam?« Ikar senkte das Gewehr nicht sofort. Er war schrecklich nervös, was mit einem Finger am Abzug nicht unbedingt gut war. »Wen hast du dabei?« Er wies mit dem Gewehr in meine Richtung. Instinktiv drehte ich mich zur Seite, als der Lauf wild herumschwang. Der Junge sah zwar aus, als könnte er kein Scheunentor treffen, selbst wenn er es wollte, doch ich konnte nicht ausschließen, dass er mich durch puren Zufall traf. Dann war es besser, der Schuss ging in die Schulter und nicht in die Brust.
»Das« – ein stolzer Unterton stahl sich in Hossams Stimme, als er mein Gesicht nach oben und in die Sonne riss, als sei ich ein erlegtes Tier – »ist der Blauäugige Bandit.«
Der Name schlug härter ein als früher. Auf der Mauer herrschte erst mal Schweigen. Ikar starrte mich von oben herab an. Selbst aus der Entfernung sah ich, wie sein Unterkiefer herunterklappte, sein Mund einen Augenblick offen stand und sich dann wieder schloss.
»Öffnet das Tor!«, quiekte Ikar endlich und kraxelte von der Mauer herunter. »Öffnet das Tor!«
Die riesigen eisernen Torflügel schwangen quälend langsam auf. Sie stemmten sich gegen den Sand, der sich im Lauf des Tages angehäuft hatte. Hossam und seine Männer schoben mich eilig vorwärts, als die alten Angeln ächzten.
Die Torflügel öffneten sich nicht ganz, nur so weit, dass ein Mann nach dem anderen durchgehen konnte. Auch nach Tausenden von Jahren sah das Tor noch so widerstandsfähig aus wie seit Anbeginn der Menschheit. Die Torflügel waren aus massivem Eisen und so dick, wie ein Männerarm lang war. Bewegt wurden sie über ein System aus Gewichten und Rädern, das noch keine andere Stadt nachbauen konnte. Bisher war es nicht gelungen, dieses Tor niederzureißen, und jeder wusste, dass man die Stadtmauern von Saramotai nicht überwinden konnte.
Anscheinend gelangte man dieser Tage nur als Gefangener mit einer Hand um den Hals in die Stadt. Da hatte ich ja mal wieder Glück gehabt.
Die Stadt Saramotai lag im Westen der Mittleren Berge, was bedeutete, dass sie uns gehörte. Zumindest sollte sie uns gehören. Nach der Schlacht von Fahali hatte Ahmed dieses Gebiet zu seinem erklärt. Die meisten Städte hatten ihm ziemlich schnell die Treue geschworen, als die gallanischen Besatzer, die so lange die Herrschaft über diese Hälfte der Wüste ausgeübt hatten, von den Straßen verschwanden. Oder wir hatten ihre Loyalität, die vorher dem Sultan galt, ohne größere Probleme eingefordert.
Saramotai war eine andere Geschichte.
Willkommen in der freien Stadt.
Saramotai hatte seine eigenen Gesetze aufgestellt und die Rebellion noch einen Schritt weiter getragen.
Ahmed redete eine Menge über Gleichheit und Reichtum für die Armen. Die Menschen in Saramotai hatten beschlossen, dass es nur eine Möglichkeit gab, Gleichheit herzustellen, und zwar indem sie diejenigen ausschalteten, die sie regierten. Und dass die einzige Möglichkeit, reich zu werden, darin bestand, ihnen ihren Reichtum wegzunehmen. So hatten sie sich unter dem Vorwand, Ahmeds Herrschaft anzuerkennen, gegen die Reichen gewandt.
Doch Ahmed kannte sich mit der Übernahme von Macht aus. Wir wussten nicht allzu viel über Malik Al-Kizzam, den Mann, der Saramotai jetzt regierte. Nur dass er ein Untertan des Emirs war, dass dieser jetzt tot war und Malik im Palast wohnte.
Also schickten wir ein paar Leute los, um mehr in Erfahrung zu bringen und etwas dagegen zu unternehmen, falls uns nicht gefiel, was wir erfuhren.
Sie kamen nicht zurück.
Das war ein Problem. Ein weiteres Problem war, danach noch in die Stadt zu gelangen.
Und so war ich jetzt hier gelandet, die Hände hinter meinem Rücken so fest zusammengebunden, dass ich bald kein Gefühl mehr darin hatte, und mit einer frischen Wunde am Schlüsselbein von einem Messer, das meinen Hals nur knapp verfehlt hatte. Komisch, dass Erfolg zu haben sich ganz genauso anfühlte, wie gefangen genommen zu werden.
Hossam schob mich vor sich her durch den schmalen Spalt zwischen den Torflügeln. Ich stolperte und fiel mit dem Gesicht voraus in den Sand, dabei knallte mein Ellenbogen schmerzhaft gegen das Eisentor.
Verflucht, das tat mehr weh, als ich gedacht hatte.
Mir entfuhr ein Schmerzenslaut, als ich mich herumrollte. Da, wo sich unter dem Strick Schweiß gesammelt hatte, blieb Sand an meinen Händen kleben. Dann packte Hossam mich und riss mich wieder auf die Füße. Rasch schob er mich vollends durch das Tor, das sich sofort wieder hinter uns schloss. Es war fast, als hätten sie vor etwas Angst.
Ein paar Schaulustige hatten sich bereits hinter dem Tor versammelt. Die Hälfte trug Gewehre, und etliche waren auf mich gerichtet.
Dann eilte mein Ruf mir tatsächlich voraus.
»Hossam.« Jemand schob sich nach vorn. Der Mann war älter als meine Bewacher. Mit ernstem Blick erfasste er meinen erbärmlichen Zustand. Er sah mich ruhiger an als die anderen, ließ sich nicht durch Übereifer blenden wie sie. »Was ist geschehen?«
»Wir haben sie in den Bergen geschnappt«, brüstete sich Hossam. »Sie wollte uns in einen Hinterhalt locken, als wir von unserem Tauschgeschäft mit den Gewehren zurückkamen.«
Zwei Männer, die mit uns gekommen waren, stellten stolz schwere Taschen voller Waffen ab, wie zum Beweis, dass ich nichts hatte ausrichten können. Die Waffen stammten nicht aus Miraji, sondern aus Amonpour. Blöde Dinger, allein schon vom Aussehen. Verziert und mit Schnitzereien versehen, von Hand gefertigt und nicht von Maschinen und doppelt so teuer, als sie wert waren, nur weil jemand sich die Mühe gemacht und sie verschönert hatte. Es spielte keine Rolle, wie schön eine Waffe war, nach einem Treffer war man genauso mausetot. Das hatte ich von Shazad gelernt.
»Nur sie?«, fragte der Mann mit den ernsten Augen. »Ganz allein?«
Sein Blick wanderte zu mir, als könnte er der Wahrheit allein dadurch, dass er mich anschaute, auf den Grund kommen. Ob ein siebzehnjähriges Mädchen wirklich glaubte, sie könnte es mit nichts weiter als einer Handvoll Kugeln mit einem halben Dutzend erwachsener Männer aufnehmen und auch noch als Siegerin aus der Sache hervorgehen? Ob der berühmte Blauäugige Bandit wirklich so blöd sein konnte?
»Verwegen« gefiel mir besser.
Doch ich hielt den Mund. Je mehr ich redete, desto wahrscheinlicher war, dass ich etwas sagte, das nach hinten losgehen konnte. Sag nichts, mach ein missmutiges Gesicht und sieh zu, dass du nicht umgebracht wirst. Wenn alles andere fehlschlägt, halte dich wenigstens an das Letzte.
»Bist du tatsächlich der Blauäugige Bandit?«, sprudelte es aus Ikar heraus, worauf alle sich ihm zuwandten. Er war von seinem Wachposten heruntergekommen, um mich wie die anderen anzuglotzen. Gespannt beugte er sich über dem Lauf seines Gewehrs vor. Falls es jetzt losging, würde es ihm beide Hände und einen Teil seines Gesichts wegpusten. »Stimmt es, was man über dich erzählt?«
Sag nichts, mach ein missmutiges Gesicht und sieh zu, dass du nicht umgebracht wirst.
»Kommt wahrscheinlich darauf an, was man so sagt.« Verdammt. Der Vorsatz hielt nicht lang. »Und du solltest dein Gewehr nicht so halten.«
Ikar veränderte geistesabwesend seinen Griff, wobei er mich nicht aus den Augen ließ. »Es heißt, du könntest einem Mann im Stockdunkeln auf fünfzig Fuß Entfernung ein Auge ausschießen. Dass du in Iliaz durch einen Kugelhagel marschiert und mit den geheimen Kriegsplänen des Sultans zurückgekommen bist.«
In meiner Erinnerung war es in Iliaz ein wenig anders gelaufen. So hatte ich am Ende zum Beispiel eine Kugel in mir stecken.
»Dass du bei ihrem Besuch in Izman eine der Frauen von Emir Jalaz verführt hast.«
Also, das war mir neu. In der Geschichte, die ich gehört hatte, hatte ich den Emir selbst verführt. Aber vielleicht mochte die Frau des Emirs ja auch Frauen. Oder vielleicht war die Geschichte beim Erzählen verdreht worden, denn in letzter Zeit erschien der Blauäugige Bandit in der Hälfte der Darstellungen als Mann. Ich band meine Brüste nicht mehr ab, um mich als Junge ausgeben zu können, doch anscheinend bräuchte ich ein paar Rundungen mehr, um gewisse Leute davon zu überzeugen, dass ich ein Mädchen war.
»Du hast in Fahali hundert Galla-Soldaten getötet«, fuhr er unbeeindruckt von meinem Schweigen fort. In seinem Eifer verhaspelte er sich fast. »Und ich habe gehört, dass du auf dem Rücken eines riesigen blauen Vogels Roch aus Malal geflohen bist und das Gebetshaus hinter dir geflutet hast.«
»Du solltest nicht alles glauben, was du hörst«, warf ich ein, als Ikar endlich innehielt, um nach Luft zu schnappen. Vor Aufregung waren seine Augen so groß wie zwei Louzi-Münzen.
Enttäuscht ließ er die Schultern hängen. Er war eben noch ein Kind und glaubte all die Geschichten so bereitwillig, wie ich es in seinem Alter getan hatte. Obwohl er jünger aussah, als ich in meiner Erinnerung jemals gewesen war. Er sollte nicht hier sein, kein Gewehr tragen. Aber das machte die Wüste nun mal mit uns. Sie machte uns zu Träumern mit Waffen. Ich fuhr mir mit der Zunge über die Zähne. »Das mit dem Gebetshaus in Malal war ein Unfall – größtenteils.«
Ein Flüstern ging durch die Menge. Ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass es mir keinen kleinen Schauer über den Rücken jagte. Zu lügen war eine Sünde.
Es war fast ein halbes Jahr her, seit ich mit Ahmed, Jin, Shazad, Hala und den Zwillingen Izz und Maz in Fahali zwei Armeen und Noorsham gegenübergestanden hatte, einem Demdji, aus dem der Sultan eine Waffe gemacht hatte. Einem Demdji, der zufällig auch mein Bruder war.
Wir gegen eine enorme Übermacht und einen Demdji mit verheerenden Kräften. Doch wir hatten überlebt. Und die Geschichte von der Schlacht um Fahali machte die Runde – in der Wüste sogar noch schneller als damals die Geschichte von den Sultimsprüfungen. Ich hatte sie ein Dutzend Mal von Leuten gehört, die nicht wussten, dass Rebellen zuhörten. Unsere Heldentaten wurden mit jedem Erzähler größer und weniger plausibel, doch die Geschichte endete immer auf dieselbe Art. Man hatte das Gefühl, dass der Erzähler zwar fertig war, die Geschichte aber nicht. So oder so, die Wüste war nach der Schlacht von Fahali nicht mehr dieselbe.
Die Legende vom Blauäugigen Banditen war mit der Geschichte um Fahali gewachsen, bis etwas daraus geworden war, das ich nicht mehr in allen Teilen wiedererkannte. So war der Blauäugige Bandit jetzt kein Rebell mehr, sondern ein Dieb. Man erzählte sich auch, ich würde mit den Leuten herumhuren, um an Informationen für meinen Prinzen zu gelangen. Dass ich meinen eigenen Bruder auf dem Schlachtfeld getötet hätte. Diesen Teil hasste ich am meisten. Vielleicht, weil es einen Moment gegeben hatte, mit dem Finger am Abzug, in dem es fast wahr geworden wäre. Doch ich hatte ihn entkommen lassen. Was fast genauso schlimm war. Er war irgendwo da draußen mit diesen ganzen Kräften, die er besaß. Und im Gegensatz zu mir hatte er keine anderen Demdji, die ihm helfen konnten.
Manchmal sagte ich spät in der Nacht, nachdem die anderen im Lager sich schlafen gelegt hatten, laut vor mich hin, dass er noch am Leben war. Nur um zu wissen, ob es stimmte oder nicht. Bis jetzt konnte ich es ohne zu zögern aussprechen. Doch ich hatte Angst, dass der Tag kommen würde, an dem ich es nicht mehr konnte. Das würde bedeuten, dass es eine Lüge war und mein Bruder gestorben war, allein und voller Angst irgendwo in dieser vom Krieg zerrissenen Wüste.
»Wenn sie so gefährlich ist, wie sie sagen, sollten wir sie töten«, rief jemand aus der Menge. Es war ein Mann mit einer leuchtend gelben Militärschärpe über der Brust, die aussah, als sei sie aus Fetzen zusammengestückelt worden. Mir fiel auf, dass einige der Männer eine solche Schärpe trugen. Es musste sich um die frisch ernannten Wachen von Saramotai handeln, da die früheren ja getötet worden waren. Er hielt ein Gewehr in den Händen und zielte auf meinen Bauch. Bauchwunden waren ganz schlecht. Sie brachten einen langsam um.
»Aber wenn sie der Blauäugige Bandit ist, gehört sie doch zum Rebellenprinzen«, meldete sich ein anderer. »Heißt das dann nicht, dass sie auf unserer Seite ist?«
Das war jetzt die Eine-Million-Fouza-Frage.
»Komisch, wie ihr Leute behandelt, die auf eurer Seite stehen.« Ich bewegte demonstrativ meine gefesselten Hände. Ein Murmeln ging durch die Menge. Das war gut, bedeutete es doch, dass sie sich nicht so einig waren, wie es von außerhalb ihrer undurchdringlichen Mauer erschien. »Wie wäre es also, wenn ihr mich losbindet, damit wir reden können, wo wir doch alle Freunde sind.«
»Netter Versuch, Bandit.« Hossam verstärkte seinen Griff. »Wir geben dir keine Chance, ein Gewehr in die Hände zu kriegen. Ich habe Geschichten gehört, wie du ein Dutzend Männer mit einer einzigen Kugel getötet hast.«
Ich war mir ziemlich sicher, dass das unmöglich war. Außerdem brauchte ich kein Gewehr, um ein Dutzend Männer zur Strecke zu bringen.
Es war fast schon komisch. Sie hatten mich mit Stricken gefesselt, nicht mit Eisen. Sobald meine Haut mit Eisen in Berührung kam, war ich ein Mensch genau wie sie. War dies nicht der Fall, konnte ich die Wüste gegen sie aufbringen. Was bedeutete, dass ich gefesselt mehr Schaden anrichten konnte als mit einem Gewehr in den Händen. Aber Schaden war im Plan nicht vorgesehen.
»Ohnehin sollte Malik entscheiden, was wir mit dem Banditen machen.« Der Mann mit den ernsten Augen rieb sich nervös mit der Hand übers Kinn, als er von ihrem selbst ernannten Anführer sprach.
»Ich habe auch einen Namen«, sagte ich.
»Malik ist noch nicht zurück«, blaffte der Mann, der sein Gewehr auf mich gerichtet hatte. Er schien einer von der nervösen Sorte zu sein. »Sie könnte alles Mögliche anstellen, bevor er zurück ist.«
»Er ist Amani. Mein Name, meine ich.« Niemand hörte mir zu. »Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert.« Diese Debatte konnte noch eine Weile so weitergehen. War ein Komitee an der Macht, ging es nie schnell. Meist funktionierte es überhaupt nicht.
»Dann sperrt sie ein, bis Malik zurückkommt«, rief jemand von weit hinten in der Menge.
»Er hat recht«, rief eine Stimme von der anderen Seite. Wieder ein Gesicht, das ich nicht sehen konnte. »Werft sie ins Gefängnis, wo sie keine Scherereien machen kann.«
Der Vorschlag schien allgemeine Zustimmung zu finden. Schließlich nickte der Mann mit den traurigen Augen zackig.
Die Menge teilte sich hastig, als Hossam mich durchzog. Nur dass sie nicht besonders weit zurücktraten. Jeder wollte einen Blick auf den Blauäugigen Banditen erhaschen. Sie glotzten und rangelten um einen guten Platz, als ich an ihnen vorbeigezogen wurde.
Ich wusste genau, was sie sahen. Ein Mädchen, das jünger war als einige ihrer Töchter, das eine aufgeplatzte Lippe hatte und dem das dunkle Haar von Blut und Schweiß am Kopf klebte. Legenden erfüllten nie die Erwartungen, wenn man sie aus der Nähe sah. Ich war da keine Ausnahme. Das Einzige, was mich von jedem anderen mageren, dunkelhaarigen Wüstenmädchen unterschied, waren meine Augen. Sie loderten in einem intensiveren Blau als der Himmel zur Mittagszeit. Wie der heißeste Teil einer Flamme.
»Bist du eine von ihnen?«
Die schrille Stimme, die den Lärm der Menge übertönte, hatte ich bisher noch nicht gehört. Eine Frau mit einer gelben Sheema drängelte sich nach vorn. Das Tuch war mit Blumen bestickt, die fast so blau waren wie meine Augen. In ihrer Miene lag eine verzweifelte Dringlichkeit, die mich nervös werden ließ. Auch in der Art, wie sie »ihnen« gesagt hatte. Als meinte sie Demdji.
Selbst Leute, die um Demdji wussten, erkannten mich gewöhnlich nicht als solchen. Wir Kinder eines Djinni und einer sterblichen Frau sahen menschlicher aus, als die meisten Leute annahmen. Ich hatte mir schließlich selbst fast siebzehn Jahre lang etwas vorgemacht. Im Grunde sah ich nicht unnatürlich aus, nur etwas fremd.
Meine Augen verrieten mich, aber nur wenn man wusste, wonach man schauen musste. Und wie es aussah, wusste diese Frau es.
»Hossam.« Die Frau bemühte sich, mit uns Schritt zu halten, als Hossam mich durch die Straßen schleifte. »Wenn sie eine von ihnen ist, ist sie genauso viel wert wie meine Ranaa. Wir könnten sie eintauschen. Wir könnten …«
Doch Hossam stieß sie zur Seite, und die Menge schluckte sie, während er mich weiter in die Stadt zog.
Die Straßen von Saramotai waren so schmal, wie sie alt waren, sodass die Menge nach und nach kleiner wurde und sich schließlich auflöste. Mauern rückten in den länger werdenden Schatten dicht an uns heran, an manchen Stellen so dicht, dass meine Schultern sie auf beiden Seiten berührten. Wir gingen zwischen zwei bunt gestrichenen Häusern mit eingedrückten Türen durch. An den Wänden waren Schießpulverspuren. Ich sah verbarrikadierte Eingänge und Fenster. Je weiter wir kamen, desto sichtbarer wurden die Spuren des Krieges. Eine Stadt, in der die Kämpfe von innerhalb der Mauern ausgegangen waren und nicht von außerhalb. Vermutlich nannte man das eine Rebellion.
Der Gestank von verwesendem Fleisch erreichte mich, noch bevor ich die Leichen sah.
Wir gingen unter einem schmalen Bogen durch, über den ein Teppich gehängt worden war, damit er in der Sonne trocknete. Die Fransen strichen über meinen Nacken, als ich gebückt darunter durchging. Als ich wieder aufschaute, sah ich zwei Dutzend am Nacken aufgeknüpfte Leichen. Man hatte sie wie Laternen an der mächtigen Stadtmauer aufgehängt.
Laternen, denen Geier die Augen ausgepickt hatten.
Schwer zu sagen, ob sie alt oder jung, hübsch oder vernarbt waren. Doch sie mussten alle reich gewesen sein. Die Vögel hatten sich noch nicht über die in leuchtenden Farben bestickten Hemden oder die feinen Musselinärmel ihrer Khalate hergemacht. Der Gestank brachte mich fast zum Würgen. Der Tod und die Wüstenhitze fackelten nicht lang mit einem Körper.
Hinter mir ging die Sonne unter. Bei Sonnenaufgang würden sie hell leuchten.
Ein neues Morgenrot. Eine neue Wüste.
Das Gefängnis stank fast noch schlimmer als die Leichen.
Hossam schob mich die Treppe hinunter, die zu den unterirdisch gelegenen Zellen führte. Ich hatte Zeit, zu beiden Seiten des schmalen Gangs einen Blick auf die mit Eisenstäben vergitterten Zellen zu werfen, bevor Hossam mich in eine hineinstieß. Ich landete mit der Schulter hart auf dem Boden. Verdammt, die wurde bestimmt wieder grün und blau.
Ich versuchte, nicht aufzustehen, sondern blieb mit dem Kopf auf dem kühlen Steinboden liegen, während Hossam die Zellentür hinter mir abschloss. Das Klirren von Eisen auf Eisen ging mir durch und durch. Ich rührte mich auch dann nicht, als die Schritte auf der Treppe verhallten, sondern wartete drei Atemzüge lang, bevor ich mich mit meinen gefesselten Händen und meinen Ellenbogen abstützte und mühsam aufstand.
Unter der Zellendecke war ein kleines Fenster, das gerade genug Licht gab, damit ich nicht im Dunkeln herumsuchen musste. Durch die Eisenstäbe konnte ich in die gegenüberliegende Zelle schauen. Ein Mädchen, nicht älter als zehn, hockte zusammengekauert in einer Ecke und beobachtete mich mit großen Augen. Sie zitterte in ihrem schmutzigen hellgrünen Khalat.
Ich lehnte mein Gesicht an die Stäbe der Zelle. Das kalte Eisen drang tief in meinen Demdji-Anteil ein.
»Imin?«, rief ich den Gang hinunter. »Mahdi?«
Mit angehaltenem Atem lauschte ich in die Stille. Dann tauchte ganz am anderen Ende des Gangs ein Teil eines Gesichts auf und presste sich an die Gitterstäbe. Finger krallten sich verzweifelt um das Eisen.
»Amani?« Die Stimme war rau vor Durst, doch ein aufreizend näselnder, herrischer Ton war immer noch unüberhörbar. Ich hatte mich während der letzten Monate daran gewöhnen müssen, seit Mahdi und ein paar andere aus dem intellektuellen Kreis in Izman sich aus der Stadt auf den Weg in unser Lager gemacht hatten. »Bist du das? Was machst du hier?«
»Ja, ich bin’s.« Ich ließ erleichtert die Schultern sinken. Sie lebten noch. Ich war nicht zu spät gekommen. »Ich bin hier, um euch rauszuholen.«
»Dumm nur, dass sie dich auch geschnappt haben, was?«
Ich biss mir auf die Zunge. Es war typisch Mahdi, dass er selbst aus einer Gefängniszelle heraus noch unverschämt zu mir war. Ich hielt nicht viel von ihm oder einem der anderen schmächtigen Stadtjungen, die so spät zum Kern der Rebellion gestoßen waren. Nachdem wir bereits so viel Blut vergossen hatten, um die halbe Wüste in Besitz nehmen zu können. Aber es waren die jungen Männer, die Ahmed geholfen hatten, als er zum ersten Mal nach Izman kam. Die, mit denen er philosophische Dispute geführt und die ersten Funken der Rebellion entfacht hatte. Außerdem hätten wir bald kaum noch Verbündete, wenn ich alle, die mir unsympathisch waren, sterben ließ.
»Na ja …«, begann ich mit zuckersüßer Stimme, »wie sonst hätte ich durchs Tor kommen sollen, nachdem ihr eure Mission so grandios vermasselt habt, dass sie die ganze Stadt abgeriegelt haben?«
Das missmutige Schweigen vom anderen Ende des Gefängnisses entschädigte mich. Von der falschen Seite einer Zellentür aus würde es selbst Mahdi schwerfallen abzustreiten, dass er gescheitert war. Aber triumphieren konnte ich später immer noch. Da das letzte Tageslicht immer weniger wurde, musste ich mich erst mal beeilen. Ich trat von den Eisenstäben zurück und rieb mir die Finger, damit sie wieder richtig durchblutet wurden.
Der Sand, der zwischen ihnen kleben geblieben war, als ich am Tor so getan hatte, als würde ich stolpern, geriet in erwartungsvolle Bewegung. Er war auch in den Falten meiner Kleider, in meinem Haar und klebte fast überall an meiner verschwitzten Haut. Das war das Schöne an der Wüste. Sie durchdrang alles, bis hinein in deine Seele.
Das hatte Jin einmal zu mir gesagt.
Ich schob diese Erinnerung beiseite, als ich die Augen schloss, tief Luft holte und den Sand von meiner Haut abzog. Jedes Körnchen, jedes Partikel reagierte auf meinen Ruf und löste sich von mir, bis sie vorsichtig abwartend in der Luft hingen. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich umgeben von einem Sandschleier, der im letzten Licht der Spätnachmittagssonne golden glänzte.
Das kleine Mädchen im grünen Khalat in der Zelle gegenüber richtete sich etwas auf und beugte sich ins Licht, um besser sehen zu können.
Ich zog die Luft ein, und der Sand formierte sich und nahm die Form einer Peitsche an. Ich bewegte meine gefesselten Hände, soweit es ging, vom Körper weg und dirigierte damit den Sand. Von den anderen Demdji schien keiner zu verstehen, weshalb ich mich bewegen musste, um meine Kräfte zu nutzen. Hala meinte, ich sähe dann immer aus wie der letzte Scharlatan auf dem Markt in Izman. Aber ihre Kräfte steckten seit ihrer Geburt in ihren Fingerspitzen. Wo ich herkam, musste eine Waffe mit der Hand geführt werden.
Der Sand fuhr wie eine Klinge zwischen meine Handgelenke und zerschnitt den Strick. Meine Arme waren frei.
Jetzt konnte ich echten Schaden anrichten.
Ich packte den Sand und beschrieb mit dem Arm einen weiten Bogen, als führte ich ein Schwert. Der Sand ging mit und traf das Schloss der Zellentür mit der ganzen Wucht eines in einem Schlag konzentrierten Wüstensturms.
Das Schloss zersprang mit einem befriedigenden Knacken. Ich war frei. Einfach so.
Das Mädchen in Grün beobachtete mich mit großen Augen, als ich, ohne das Eisen zu berühren, die Zellentür aufstieß. Gleichzeitig sammelte ich den Sand wieder in meiner Faust.
»So.« Ich schlenderte den Gang hinunter und entfernte dabei die Seilreste, die noch an meinen Handgelenken hingen. Das Seil an meiner rechten Hand ließ sich leicht lösen. Darunter war eine rote Schwiele. Ich fummelte noch am Knoten an meiner linken Hand herum, als ich vor Mahdis Zelle stehen blieb. »Wie laufen die diplomatischen Verhandlungen so für euch?« Das letzte Stück Seil glitt zu Boden.
Mahdi schaute griesgrämig drein. »Bist du gekommen, um dich über uns lustig zu machen oder um uns zu befreien?«
»Ich sehe keinen Grund, weshalb ich nicht beides könnte.« Ich stützte meine Ellenbogen auf eine Querstrebe in der Zellentür und legte mein Kinn auf meine Faust. »Erzähl mir noch einmal, wie du Shazad gesagt hast, wir bräuchten nicht mitzukommen, da man Frauen bei politischen Verhandlungen einfach nicht ernst nehmen könne.«
»Ich glaube, was er wirklich gesagt hat«, meldete sich eine Stimme aus dem hinteren Teil der Zelle, »war, dass ihr ›unnötige Ablenkung‹ wärt, du und Shazad.«
Imin kam zur Tür, damit ich ihn richtig sehen konnte. Sein Gesicht war mir fremd, doch die spöttischen gelben Augen hätte ich überall wiedererkannt. Sie gehörten unserem Gestaltwechsler-Demdji. Als ich Imin beim Verlassen des Lagers das letzte Mal gesehen hatte, war sie eine zierliche Frau in übergroßen Männerkleidern – um dem Pferd nicht zu viel Gewicht aufzubürden. In dieser Gestalt hatte ich sie schon etliche Male gesehen, obwohl es nur eine von unendlich vielen war, die Imin annehmen konnte: Junge, Mädchen, Mann oder Frau. Inzwischen hatte ich mich an Imins ständig wechselndes Gesicht gewöhnt. Sie konnte als kleines Mädchen mit großen Augen daherkommen, das auf dem Pferd, das sie ritt, zwergenhaft erschien, oder als Kämpfer, der seinen Gegner mit einer Hand hochheben konnte. Dann wieder war sie ein dürrer Gelehrter in einer Gefängniszelle in Saramotai, zornig, aber harmlos. Doch ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, diese irritierend gelben Augen blieben immer dieselben.
»Stimmt.« Ich wandte mich wieder Mahdi zu. »Vielleicht hatte ich es vergessen, weil ich so überrascht war, dass sie dir nicht auf der Stelle sämtliche Zähne ausgeschlagen hat.«
»Bist du fertig?« Mahdi sah aus, als hätte er in eine eingelegte Zitrone gebissen. »Oder willst du noch mehr Zeit vergeuden, die wir sonst zur Flucht nutzen könnten?«
»Jaja, schon gut.«
Ich trat zurück und streckte eine Hand aus. Der Sand reagierte und sammelte sich in meiner Faust. Ich zog die Hand zurück, spürte, wie sich die Kraft in meinem Brustkorb verdichtete. Ich wartete einen Moment, bevor ich den Sand nach unten schleuderte. Das Schloss explodierte.
»Na, endlich.«
Mahdi klang genervt, als sei ich eine Dienstmagd, die sich gerade unangemessen viel Zeit gelassen hatte, um ihm sein Essen zu bringen. Er versuchte, sich an mir vorbeizuschieben, doch ich streckte meinen Arm aus und stoppte ihn.
»Was …«, begann er.
Seine Empörung wuchs. Ich legte ihm die Hand auf den Mund, damit er still war, und lauschte. Ich sah die Veränderung in seiner Miene in dem Moment, in dem auch er es hörte. Schritte auf der Treppe. Die Wachen waren auf uns aufmerksam geworden.
»Musstest du so laut sein?«, flüsterte er, als ich meine Hand wegnahm.
»Gut möglich, dass ich mir das nächste Mal nicht mehr die Mühe mache, dich zu retten.«
Ich stieß ihn zurück in die Zelle. Meine Gedanken überschlugen sich. Wie konnte ich uns lebend hier herausbringen? Imin ging an Mahdi vorbei und trat auf den Gang. Ihn hielt ich nicht auf. Ich hätte es auch nicht gekonnt, selbst wenn ich gewollt hätte. Im Gehen wechselte er bereits seine Gestalt. Aus dem Körper des harmlosen Gelehrten wurde der eines Mannes, der zwei Köpfe größer war als ich und doppelt so breit. In dieser Gestalt wollte ich Imin ganz bestimmt nicht auf einem dunklen Gang begegnen. Er ließ die Schultern rollen. In dem jetzt zu engen Hemd fühlt er sich unbehaglich. An der Schulter platzte eine Naht auf.
Inzwischen war es fast ganz dunkel geworden. Die Zellen lagen im Dämmerlicht. Ich sah auf der Treppe eine Lampe hin und her schwingen. Gut, das kam uns gelegen. Ich presste mich am Fuß der Treppe an die Wand, wo ich von oben nicht gesehen werden konnte. Imin folgte meinem Beispiel an der gegenüberliegenden Wand.
Wir warteten. Die Schritte auf der Treppe wurden lauter. Ich zählte mindestens vier Paar Stiefel. Vielleicht waren es auch fünf. Sie waren in der Überzahl und bewaffnet, aber sie mussten im Gänsemarsch gehen, was bedeutete, dass die Zahl keine Rolle spielte. Lampenlicht huschte über die Wände, als sie herunterkamen. Ich hatte das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und wie sagte Shazad immer? Wenn du gegen jemand doppelt so Großes kämpfst, muss der erste Schlag sitzen. Ein Schlag, der in diesem Fall völlig unerwartet kam. Umso besser, wenn man so zuschlagen konnte, dass es keinen weiteren brauchte.
Das kleine Mädchen in Grün mir gegenüber war dicht an die Gitterstäbe getreten und beobachtete uns fasziniert. Ich legte einen Finger auf die Lippen und hoffte, dass sie verstand, was ich damit meinte. Das Mädchen nickte. Gut. Sie war jung, aber sie war ein Wüstenkind. Sie wusste, wie man überlebt.
Ich griff in dem Moment an, in dem der Kopf des ersten Wächters in mein Blickfeld kam.
Explodierender Sand traf ihn mit voller Wucht an der Schläfe. Er taumelte gegen die Stäbe der Zellentür des kleinen Mädchens. Sie wich schwankend zurück, als sein Schädel gegen das Eisen krachte. Imin packte den Soldaten dahinter, hob ihn hoch und schleuderte ihn gegen die Wand. Sein erschrockenes Gesicht war das Letzte, was ich sah, bevor seine Lampe auf dem Boden zerschellte und erlosch. Ich war so gut wie blind.
Ein Schuss fiel, und ein ganzer Chor Schreie ertönte, sowohl in den Zellen als auch davor. Dazwischen betete eine Stimme laut. Ich wisperte einen Fluch, als ich mich wieder an die Wand presste. Hier war es weniger wahrscheinlich, dass mich eine verirrte Kugel traf. Ich musste nachdenken. Sie waren so blind wie wir. Aber sie waren bewaffnet, und ich musste davon ausgehen, dass es ihnen genauso wenig ausmachen würde wie mir, einen Gefangenen mit einer verirrten Kugel zu töten. Wieder ein Schuss, und dieses Mal folgte ein Schrei, der mehr nach Schmerz klang als nach Angst. Ich bemühte mich trotz der wachsenden Panik klar zu denken, während ich die Geräusche einzuordnen versuchte. Es war lange her, seit ich allein einen Kampf ausgefochten hatte. Shazad wüsste einen Weg aus diesem Schlamassel. Ich konnte mich in der Dunkelheit zwar gegen meine Feinde wehren, doch genauso gut konnte es sein, dass ich das kleine Mädchen oder Imin erwischte. Ich brauchte Licht.
Dringend.
Und dann ging, wie in Erhörung eines Gebets, im Gefängnis die Sonne auf.
Vor meinen Augen explodierten Sterne. Ich war weiter blind, doch jetzt lag es an dem plötzlichen grellen Licht. Ich blinzelte heftig und versuchte, durch die Sonnenflecken hindurch etwas zu erkennen.
Es dauerte gefährlich lang, bis ich wieder etwas sehen konnte. Mein panischer Herzschlag erinnerte mich daran, dass ich hilflos und blind und von bewaffneten Feinden umringt war. Stückchen für Stückchen tauchte meine Umgebung vor mir auf. Zwei Wächter auf dem Boden. Reglos. Drei weitere, die sich die Augen rieben, die Gewehre locker in der Hand. Imin, an die Wand gepresst und aus der Schulter blutend. Und in ihrer Zelle das kleine Mädchen in Grün mit einer winzigen Sonne, nicht größer als eine Faust, in den zu einer Schale geformten Händen. Ihr Gesicht glühte in dem grellen Licht, das von unten seltsame Schatten warf, die sie viel älter erscheinen ließen. Und jetzt sah ich auch, dass diese großen Augen, mit denen sie mich beobachtet hatte, eine so unnatürliche Farbe hatten wie meine oder die von Imin, nämlich die von erlöschender Glut.
Sie war ein Demdji.
Um meine neue Demdji-Verbündete konnte ich mir auch später noch Gedanken machen. Im Augenblick musste ich das Geschenk, das sie uns gab, nutzen. Die Wächter richteten bereits ihre Gewehre auf mich – eine Sandgarbe schlug sie ihnen aus den Händen. Ein Wächter taumelte rückwärts in Imin hinein. Imin packte ihn, drehte einmal kurz, und ich hörte ein Genick brechen.
Ein anderer Wächter sprang mich mit gezogenem Messer an. Ich teilte den Sand, schlug mit der einen Hälfte seine Hand weg, bevor er mir zu nah kommen konnte, und formte mit der anderen eine gebogene Klinge. Ich zog sie ihm über den Hals und es floss Blut. Imin schnappte sich ein heruntergefallenes Gewehr. Selbst wenn er kein so guter Schütze war wie ich, war es in einem so engen Raum schwer, nicht zu treffen. Ich duckte mich, als er schoss. Aus den Zellen kamen wieder Schreie, doch das Echo der Schüsse übertönte sie.
Und dann Stille. Ich richtete mich auf. Es war vorbei. Imin und ich lebten noch. Die Wächter nicht.
Mahdi trat aus der Zelle. Sein Mund verzog sich missbilligend, als er sich das Gemetzel anschaute. Das war typisch für diese Intellektuellen. Sie wollten die Welt verbessern und schienen zu glauben, dass das ohne Blutvergießen möglich sei. Ich ignorierte ihn und wandte mich stattdessen der Zelle mit dem kleinen Demdji-Mädchen zu. Sie hielt immer noch die winzige Sonne in den Händen und schaute mich mit diesen traurigen roten Augen an, die verstörend glänzten.
Ich zerschmetterte das Schloss mit einem Sandstrahl. »Du bist …«, begann ich, als ich die Zellentür aufzog, doch die Kleine war bereits auf den Beinen, lief an mir vorbei und zum anderen Ende des Gefängnisses.
»Samira!«, rief sie und trat dicht an eines der Gitter, ohne es zu berühren. Sie war klug genug, sich von Eisen fernzuhalten. Klüger als ich in ihrem Alter. Ich lehnte mich an die Mauer. Jetzt, da der Kampf vorbei war, spürte ich, wie erschöpft ich war.
»Ranaa!« Eine junge Frau kam in ihrer Zelle nach vorn und kniete sich auf den Boden, damit sie mit dem Demdji auf Augenhöhe war. Sie war sicher einmal sehr schön gewesen, bevor das Gefängnis seine Spuren an ihr hinterließ. Jetzt wirkte sie nur noch müde. Dunkle, tief eingesunkene Augen in einem abgehärmten Gesicht. Ich nahm sie rasch in Augenschein, suchte nach einem Demdji-Zeichen an ihr, doch sie sah einfach nur menschlich aus. Wahrscheinlich war sie so alt wie ich, jedenfalls nicht alt genug, um die Mutter des Mädchens zu sein. Eine Schwester vielleicht? Sie griff zwischen den Gitterstäben hindurch und legte dem Mädchen eine Hand auf die Wange. »Ist alles in Ordnung?«
Der kleine Demdji Ranaa wandte sich an mich, die Lippen ärgerlich zusammengepresst. »Lass sie raus.«
Es war ein Befehl, keine Bitte. Und er kam von jemandem, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen.
»Hat dir noch niemand beigebracht, bitte zu sagen, Kleine?« Es rutschte mir einfach so heraus, obwohl das wirklich nicht der Ort war, um jemandem Manieren beizubringen. Und wahrscheinlich war ich auch nicht die geeignete Person dafür.
Ranaa fixierte mich. Das funktionierte wahrscheinlich bei den meisten. Ich war an Demdji gewöhnt, doch selbst ich fand diese roten Augen verstörend. Ich erinnerte mich an Geschichten, die man sich über den Eroberer Adil erzählte. Er soll so schlimm gewesen sein, dass seine Augen rot glühten. Mit diesen Augen war Ranaa es gewohnt zu bekommen, was sie wollte. Doch ich hatte nicht allzu viel Übung darin zu tun, was man mir sagte. Ich ließ den Sand um meine Finger wirbeln und wartete.
»Lass sie raus, bitte«, versuchte sie es, doch dann stampfte sie mit dem bloßen Fuß auf. »Sofort.«
Seufzend stieß ich mich von der Wand ab. Ich hatte es zumindest versucht. »Zurück!« Auch ich konnte Befehle erteilen.
Das Schloss war kaum zerschlagen, als Ranaa sich nach vorn fallen ließ und ihre dünnen Ärmchen um den Hals des älteren Mädchens schlang. In einer Hand hielt sie immer noch vorsichtig den Lichtball, während sie sich mit der anderen an den schmutzigen Khalat klammerte. Im Licht der winzigen Sonne konnte ich in die Zelle hineinsehen. In dem engen Raum waren so viele Gefangene untergebracht, dass nicht genügend Platz war, um sich hinzulegen. Ein Dutzend Frauen drängten sich dicht aneinander. Sie kamen auf die Füße, stürzten erleichtert aus der Zelle und versuchten, die Freiheit in großen Zügen einzusaugen. Ich überließ es Imin und Mahdi, irgendwie Ordnung in den Haufen zu bekommen.
Es waren alles Mädchen oder Frauen. Dass es in den anderen Zellen nicht anders aussah, merkte ich, als ich mich umschaute und in die Gesichter voller Angst und Zweifel blickte, die sich im Dämmerlicht an die Gitter pressten. Sie trauten uns nicht ganz, hofften aber zaghaft auf Rettung. Mahdi und Imin hatten bei einem der toten Wächter einen Schlüsselbund gefunden und befreiten jetzt rasch die restlichen Gefangenen. Was vermutlich einfacher war, als jedes Schloss explodieren zu lassen. Aus einer Zelle nach der anderen kamen Gefangene. Manche umarmten einander, andere wankten einfach nur heraus. Sie sahen aus wie verschreckte Tiere.
»Wo sind die Männer?«, fragte ich Samira, als sie sich aus Ranaas Umklammerung löste. Ich glaubte, die Antwort bereits zu wissen.
»Sie waren gefährlicher«, antwortete Samira. »Zumindest sagte Malik das, als er …« Sie unterbrach sich und schloss die Augen, als könnte sie dadurch das Bild verdrängen, wie sie durch die Hand des Mannes starben, der in ihrer Stadt die Macht an sich gerissen hatte. »Und sie waren weniger wert.«
Es dauerte einen Moment, bis ich den vielsagenden Blick verstand, den sie mir über Ranaas Kopf hinweg zuwarf. Dann kapierte ich. Die Frauen, die da aus den Zellen taumelten, waren jung. In letzter Zeit hatte es eine Menge Gerüchte gegeben über Sklavenhändler, die sich den Krieg zunutze machten. Sie entführten Mädchen aus unserer Hälfte der Wüste und verkauften sie an Soldaten, die weit weg von ihren Frauen stationiert waren, oder an reiche Männer in Izman. Und dann war da auch noch der Wert eines Demdji …
»Ranaa.« Ich durchforstete mein Gedächtnis. Den Namen hatte ich heute schon einmal gehört. Genau, von der Frau mit der mit blauen Blumen bestickten Sheema. Die wissen wollte, ob ich ein Demdji war. Jetzt verstand ich, weshalb sie mich erkannt hatte. »Deine Mutter macht sich Sorgen um dich.«
Das kleine Mädchen musterte mich verächtlich. »Warum hat sie mich dann nicht hier rausgeholt?«
»Ranaa«, zischte Samira vorwurfsvoll.
Ich war wohl nicht die Einzige, die versuchte, dem kleinen Demdji Manieren beizubringen. Samira hatte sich an der Zellentür abgestützt. Ich reichte ihr die Hand und zog sie aus ihrer knienden Haltung auf die Beine. Ranaa klammerte sich immer noch an den Saum ihres schmutzigen Khalats und machte es für Samira doppelt schwer, sich in ihrem geschwächten Zustand vorwärts zu bewegen.
»Verzeih ihr«, bat Samira mich. Ihr geschliffener Akzent erinnerte mich an Shazad, obgleich ihr Ton sehr viel freundlicher war. Und mit einem vielsagenden Blick auf das Mädchen fügte sie hinzu: »Sie hat nicht oft Gelegenheit, mit Fremden zu reden.«
»Deine Schwester?«, fragte ich.
»Gewissermaßen.« Samira legte dem Mädchen eine Hand auf den Kopf. »Mein Vater ist …« Sie stockte. »War der Emir von Saramotai. Er lebt nicht mehr.«
Ihre Stimme war ausdruckslos und sachlich und verriet nichts von ihrem Schmerz. Ich wusste, was es bedeutete, ein Elternteil sterben zu sehen.
»Ihre Mutter war eine Dienstmagd im Haushalt meines Vaters. Als Ranaa geboren wurde und … anders aussah, flehte ihre Mutter meinen Vater an, sie vor den Galla zu verstecken.«
Samira suchte in meinem Gesicht. Für gewöhnlich ging ich trotz meiner blauen Augen als menschlich durch. Doch einige Leute kannten sich mehr als nur oberflächlich mit Demdji aus und erkannten mich, so wie Jin.
»Ich nehme an, du verstehst, weshalb.«
Ich hatte Glück gehabt. Ich hatte die Galla sechzehn Jahre lang überlebt, ohne als das, was ich war, erkannt zu werden, da ich als menschlich durchgehen konnte. Ranaa würde das nie können. Und für die Galla war alles, was nicht menschlich war, ein Monster. Für sie bestand kein Unterschied zwischen einem Demdji, einem Gestaltwechsler oder einem Nachtmahr. Ranaa mit ihren roten Augen wäre tot, sobald sie sie zu Gesicht bekämen.
Samira fuhr mit den Fingern zärtlich durch das Haar des Mädchens, eine beruhigende Geste, die von zu vielen Nächten sprach, in denen sie ein verängstigtes kleines Mädchen zum Schlafen gebracht hatte. »Wir nahmen sie zu uns und versteckten sie. Nachdem sie … damit anfing« – Samiras Finger tanzten über das Licht in Ranaas Händen –, »war mein Vater der Überzeugung, sie sei die von den Toten auferstandene Prinzessin Hawa.«
Die Geschichte von Prinzessin Hawa gehörte, als ich kleiner war, zu meinen Lieblingsgeschichten. Sie handelte von den ersten Tagen der Menschheit, als die Weltenzerstörerin noch auf der Erde wandelte. Hawa war die Tochter des ersten Sultans von Izman. Prinzessin Hawas Stimme war so wunderschön, dass jeder, der sie hörte, auf die Knie fiel. Ihr Gesang führte einen Gestaltwechsler zu ihr, verkleidet als einer ihrer Diener. Er stahl ihr die Augen aus dem Kopf. Prinzessin Hawa schrie, und der Held Attallah kam und rettete sie, bevor der Gestaltwechsler ihr auch die Zunge nehmen konnte. Mit einem Trick konnte er dem Ghul ihre Augen wieder abluchsen. Und als Hawas Augenlicht wiederhergestellt war und sie Attallah zum ersten Mal sah, stockte ihr Herz. Was sie empfand, war so neu und ungewohnt, dass sie glaubte, sterben zu müssen. Hawa schickte Attallah weg, da es so schmerzhaft für sie war, ihn anzuschauen. Doch nachdem er gegangen war, tat ihr Herz nur noch mehr weh. Sie waren die ersten Sterblichen, die sich ineinander verliebten, hieß es in der Geschichte.
Eines Tages erreichte Hawa in Izman die Nachricht, dass eine bedeutende Stadt auf der anderen Seite der Wüste von Ghulen belagert wurde und dass Attallah dort kämpfte. In der Stadt versuchte man jeden Tag, neue Verteidigungsanlagen zu bauen, doch jede Nacht kamen die Ghule und rissen sie nieder, sodass die Bewohner im Morgengrauen, wenn die Ghule sich zurückzogen, von Neuem beginnen mussten. Als Hawa hörte, dass Attallah mit ziemlicher Sicherheit verloren war, ging sie hinaus in die Wüste hinter Izman und weinte so bittere Tränen, dass ein Buraqi, eines der unsterblichen, aus Sand und Wind geschaffenen Pferde, sich ihrer erbarmte und ihr zu Hilfe kam. Sie ritt auf dem Buraqi über den Sand und sang so hell und klar, dass die Sonne am Himmel erschien, als sie an Attallahs Seite eilte. Sie erreichte Saramotai und hielt die Sonne am Himmel und die Ghule auf Abstand, und das hundert Tage lang, lange genug, dass die Leute von Saramotai ihre dicken, unüberwindlichen Mauern bauen konnten. Sie arbeiteten Tag und Nacht, bis sie in ihrer Stadt sicher waren. Als das Werk schließlich vollendet war, ließ Hawa die Sonne los, und geschützt hinter den Mauern dieser großartigen Stadt heiratete sie ihren geliebten Attallah.
Hawa hielt jede Nacht auf der Stadtmauer Wache, wenn Attallah wieder hinausritt in den Kampf und im Morgengrauen zu ihr zurückkehrte. Weitere hundert Nächte ritt Attallah vor die Tore, um die Stadt zu verteidigen. Keiner konnte ihm im Kampf etwas anhaben. Keine Ghulsklaue konnte ihm auch nur einen Kratzer zufügen. Sie wachte jede Nacht, bis in der hundertersten Nacht seit Beginn ihrer Wache ein verirrter Pfeil den Mauerkranz erreichte und Prinzessin Hawa tötete.
Als Attallah sie von der Mauer stürzen sah, hörte sein Herz vor Schmerz auf zu schlagen. Der Schutz, der ihn hundert Nächte lang so zuverlässig umgeben hatte, fiel von ihm ab, die Ghule überwältigten ihn und rissen ihm das Herz aus der Brust. Doch in dem Moment, in dem beide starben, leuchtete die Sonnen ein letztes Mal mitten in der Nacht. In der Sonne konnten die Ghule nicht mehr kämpfen. Sie verbrannten, und mit Hawas und Attallahs letztem Atemzug war die Stadt gerettet. Die Bewohner der Stadt nannten sie ihr zu Ehren Saramotai, was in der Ersten Sprache »der Tod der Prinzessin« bedeutet.
Ob es für einen Djinni wohl die Vorstellung von einem Scherz war, seiner in der Stadt Hawas geborenen Tochter dieselbe Gabe zu verleihen, die diese hatte?
Aber Hawa war rein menschlich. Zumindest sagte das die Geschichte. Früher hatte ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Die Leute in den alten Geschichten hatten manchmal einfach Kräfte, von denen keiner wusste, woher sie kamen. Aber vielleicht war Hawa ja auch eine von uns, und im Lauf der Jahrhunderte, während der die Geschichte immer wieder erzählt wurde, war die Tatsache, dass Hawa ein Demdji und keine echte Prinzessin war, einfach untergegangen. Schließlich hatte das wiederholte Erzählen der Geschichte der Sultimsprüfungen aus der sanften, hübschen Delila eine hässliche, gehörnte Bestie gemacht. Und einige Geschichten über den Blauäugigen Banditen ließen die Kleinigkeit, dass ich ein Mädchen war, unerwähnt.
»Nach Fahali dachten wir, sie hätte nichts mehr zu befürchten.« Samira zog Ranaa näher zu sich. »Aber selbst wenn sie sie nicht mehr töten wollten, hätten gewisse Leute sie gern für andere Dinge.«
Es war ein bescheuerter Aberglaube, dass ein Stück von einem Demdji sämtliche Krankheiten heilen konnte. Hala, unser goldhäutiger Demdji und Imins Schwester, wurde jeden Tag daran erinnert. Man hatte ihr zwei Finger abgeschnitten und sie verkauft. Wahrscheinlich, um die Magenschmerzen irgendeines reichen Mannes zu heilen.
»Es geht das Gerücht, dass selbst der Sultan hinter einem Demdji her ist.«
»Das wissen wir«, unterbrach ich sie schärfer als beabsichtigt.
Ich hatte mir darum, dass der Sultan Noorsham aufspüren könnte, mehr Sorgen gemacht als um alles andere, nachdem wir von diesem Gerücht hörten. Die Chancen, dass ein zweiter Demdji mit derselben zerstörerischen Kraft wie mein Bruder da draußen herumlief, waren meiner Ansicht nach verschwindend gering. Selbst ich konnte keine Stadt so auslöschen, wie Noorsham es getan hatte. Dennoch hatten wir während der letzten Monate darauf geachtet, dass nicht bekannt wurde, dass der Blauäugige Bandit und der Demdji, der Wüstenstürme herbeirief, ein und derselbe waren. Nicht dass es eine Rolle spielte. Ich würde nie zulassen, dass der Sultan mich lebendig ergriff. Doch jetzt war da noch die winzige Sonne in Ranaas Händen zu bedenken. Umschlossen von ihren Handflächen sah sie ziemlich harmlos aus. Hundertfach vergrößert war sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so harmlos. Die Chancen des Sultans standen jetzt besser.
»Eure Rebellion hat ihn bis jetzt nicht auf diese Seite der Wüste kommen lassen. Wie lange könnt ihr ihn wohl noch fernhalten, was meinst du?«
So lange wie nötig. Ich wollte verdammt sein, wenn ich zuließ, dass der Sultan irgendeinem anderen Demdji antat, was er Noorsham angetan hatte. Ranaa mochte ein weltfremdes Gör sein, der es in den Kopf gestiegen war, dass man ihr zeitlebens erzählt hatte, sie sei die Reinkarnation einer legendären Prinzessin. Aber sie war ein Demdji. Und wir kümmerten uns um unseresgleichen.
»Ich kann sie in Sicherheit bringen.« Hier konnte ich sie nicht lassen. Nicht, so lange die Chance bestand, dass sie entdeckt wurde und ich sie als Nächstes über den Lauf eines Gewehrs hinweg anschaute. »Außerhalb der Stadt.«
»Ich will nirgendwo hingehen mit dir«, wehrte Ranaa ab.
Wir ignorierten sie.
»Prinz Ahmed möchte dieses Land zu einem sicheren Ort für Demdji machen, und ich weiß, wo man sie schützen kann, bis es so weit ist.«
Samira zögerte einen Moment. »Kann ich mitkommen?«
Erleichtert entspannte ich mich etwas. »Kommt darauf an. Kannst du gehen?«
Imin stützte Samira, als sie zur Treppe humpelte. Ranaa klammerte sich immer noch an sie. Ich wollte mich gerade abwenden, als Ranaas Licht die hintere Wand streifte. Die Zelle war nicht ganz leer. Eine Frau in einem hellgelben Khalat lag immer noch reglos in einer Ecke.
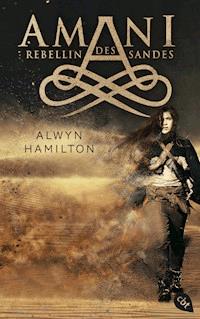
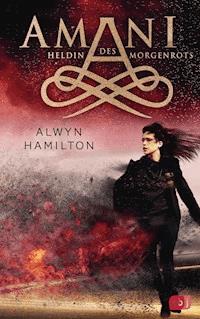














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












