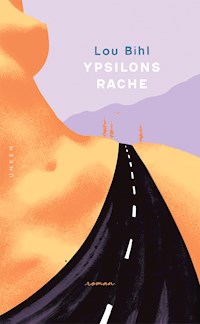Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unken Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
AMAZONAH ist eine Vorschau auf die künftige Entwicklung aktueller Probleme: Heißes Wetter, soziale Kälte, politische Skrupellosigkeit und eine neue Pandemie. Doch es zeigt auch die Macht der Liebe in Zeiten der Krise - und was Frauen zu deren Bewältigung befähigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lou Bihl
Amazonah beschreibt ausschließlich Erfundenes.
Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Begebenheiten sind zufällig.
Erste Auflage 2022
© Unken Verlag GmbH, Karlsruhe
Umschlag und Illustrationen: Daniel Horowitz, Paris
Lektorat: Dr.Felicitas Igel
Korrektorat: Eva Wagner
Satz: Buch&media GmbH, München
Gesetzt aus der Neuton und Segoe
Druck und Verarbeitung: CPI books GmbH, Leck
Print-ISBN 978-3-949286-07-0
E-Book-ISBN 978-3-949286-08-7
Geschichte – das ist etwas, was alle gemeinsam machen, um danach sofort zu erklären, es dürfe sich nicht wiederholen.
Peter Hohl
1. August
Kaum blieb ihr Zeit, den Moment zu genießen, als sie den Winzling in Händen hielt. Die Leica schlitterte über die Fliesen, der Körper des Ministers klatschte dumpf auf den Boden. Rasch reichte Anna der Hebamme das Neugeborene und ließ den internistischen Notdienst aus dem Klinikum rufen. Neben dem Bewusstlosen kniend fühlte Anna dessen Puls auf der linken Halsseite: flach und zu schnell. Ihr blutiger Handschuh hinterließ rote Spuren auf blasser Haut. Sekunden später war die Assistenzärztin zur Stelle. Claire, erst kürzlich aus der Inneren Medizin ins Kinderwunsch- und Geburtshilfe-Zentrum KiZ gewechselt, bewies Notfallfitness. Routiniert schloss sie das tragbare EKG an und fand problemlos eine Vene. Ein wenig zitterte sie, die Kanüle bohrte sich schmerzhaft in die schlaffe Haut des Ministers, was ihn aus seiner Ohnmacht holte. Er schlug die Augen auf und funkelte die über ihn Gebeugte an: »Was soll der Quatsch?«
Claire drückte ihn sanft auf das untergeschobene Kissen. »Bitte bleiben Sie liegen, Sie hatten einen Schwächeanfall.«
Anna streifte frische Handschuhe über. Draußen lauerte die Presse, schon sah sie die Schlagzeile vor sich: Bundesgesundheits- und Sozialminister Arian Preuss (PEL) stirbt bei Geburt seines Kindes an Herzschlag – Chefärztin des KiZ steht hilflos daneben, Ehefrau Mechthild muss ohnmächtig zusehen.
Sie atmete auf, als der Boden vibrierte; knatternd näherte sich der Hubschrauber – ein Geräusch, das selten geworden war, seit Wasserstoff-Helis fast lautlos flogen. Der Landeplatz auf dem Dach, großzügig finanziert durch die Preuss-Stiftung, war zwei Wochen zuvor in Betrieb genommen und dieses Event prompt zu einem Werbespot für Preuss verarbeitet worden: Nie rettet man mehr Leben als im Mutterleib – für die Zukunft unseres Landes!
In Begleitung zweier Rettungsassistenten stürmte der Chefkardiologe des Klinikums in den Kreißsaal, er hatte darauf bestanden, den Einsatz persönlich zu leiten. »Ganz ruhig, Arian, das kriegen wir ruckzuck in den Griff«, versprach Struck dem Parteifreund; die Assistenzärztin schob er rüde beiseite. Nach einem Blick auf das EKG bekräftigte er die Beruhigung mit einem reichlichen Schuss Benzodiazepin[Medizinische Fachausdrücke werden im Glossar erläutert], dann spritzte er Aspirin und einen Betablocker. Zum Schluss klebte er eine sterile Kompresse auf die mäßig blutende Platzwunde über der rechten Augenbraue. »Kein Grund zu Sorge, mein Lieber, aber dein Herz muss ich mir anschauen, wir nehmen dich kurz mit.«
Mühelos hievten die hünenhaften Rettungsassistenten den Minister auf die Trage. Preuss winkte seiner Frau zu und brabbelte benzobenebelt: »Alles wird gut, Mausi!«
Struck trat zu Mechthild Petri. Gönnerhaft nickte er Anna zu, die tröstend auf ihre Patientin einsprach. »Na, wie ist es, Frau Kollega, haben wir bei der jungen Mutter alles im Griff?«
Anna richtete sich auf, schob die Brille ein Stück Richtung Nasenspitze und schaute über das Gestell. Der kompakte Kardiologe überragte sie mit knappen eins achtzig nur um Zentimeter und wich vor dem Blick auf ungewohnter Augenhöhe einen Schritt zurück. »Danke der Nachfrage, Herr Kollege, wir haben den Erfolg unserer Intervention bereits in trockenen Tüchern.«
Kichernd streckte die Hebamme dem Verdutzten das Neugeborene entgegen, das in flauschigem Frottee strampelte. Struck schaltete sein Lächeln von säuerlich auf väterlich, tapste einmal mit dem Zeigefinger auf das Köpfchen und murmelte »ganz süß!«. Dann wandte er sich Mechthild Petri zu und tätschelte ihr die schweißnasse Wange. »Glückwunsch zum Stammhalter, gnädige Frau«, dröhnte er, worauf die Angesprochene unwillig schnaubte. »Erstens ist es ein Mädchen, und zweitens sorgen Sie bitte dafür, dass sie keine Halbwaise wird.«
»Klar doch, das kriegen wir hin, Frau Minister.« Der Kardiologe knickte den Oberkörper in eine kleine Verbeugung. »Schließlich braucht unser Land Ihren Gatten!« Damit enteilte er Richtung Heliport.
Nach Verklingen der Rotorengeräusche legte sich stilles Aufatmen über den Kreißsaal; in ruhiger Routine wurde der Rest absolviert, die Entbundene versorgt, das Baby gescreent. Als die Hebamme der Patientin endlich ihr Kind in die Arme legte, ging ein Leuchten über deren Gesicht und verlieh ihren anstrengungsverquollenen Zügen einen Moment lang die maßstabslose Schönheit aller frischgebackenen Mütter.
¤
In der Umkleide klopfte Anna der Assistentin auf die Schulter. »Super, wie Sie den Minister versorgt haben, damit haben Sie die Probezeit bereits mit Bravour bestanden.« Ihr Augenzwinkern sagte, was beide wussten: Seit selbst Assistenzärzte mit Headhuntern gesucht wurden, war die Probezeit zum formalen Relikt ferner Jahrzehnte geworden. Claire bedankte sich grinsend. »Ich habe gelernt, dass man es ernst nehmen soll, wenn ein Mann über fünfzig umkippt. Warum müssen solche Oldies noch Kinder kriegen? Und warum müssen die armen Embryonen nach ihrer Befruchtung im Reagenzglas dann noch jahrelang in der Tiefkühltruhe freezen?«
Zwei Jahre älter als Petri, ließ Anna die »Oldies« unkommentiert. »Die ›armen Embryonen‹ sind Achtzeller und keine leidensfähigen Wesen«, entgegnete sie knapp. Dann erst begriff sie und erschrak. »Verdammt, woher wissen Sie das überhaupt?«
Claire erwiderte unbefangen: »Beim Personalgespräch vor vier Wochen rief die Petri an, und ich sollte das Büro verlassen. Sie haben so laut gesprochen, dass ich im Vorzimmer das meiste verstanden habe, obwohl ich nicht lauschen wollte.«
Anna wurde blass. »Was haben Sie gehört?«
»Na ja, Sie meinten, Frau Petri könne doch dankbar sein, dass sie in ihrem Alter überhaupt schwanger wurde. Und ob sie als siebenundvierzigjährige Erstgebärende wirklich das Risiko einer normalen Geburt eingehen wolle, statt mit dem geplanten Kaiserschnitt zu entbinden.«
Anna ließ sich auf die harte Holzbank fallen. Nur zu gut erinnerte sie sich an das Mitarbeitergespräch mit Claire – unterbrochen von der Kleinen Nachtmusik, der Erkennungsmelodie des »Preussofons«. Das Seniorenhandy war ein Geschenk von Frau Petri gewesen, hatte keine Internetfunktion und riesige Ziffern für Menschen über achtzig, die keine Smartphones bedienen konnten. Es war nicht zu hacken und abhörsicher. An jenem Abend hatte die werdende Mutter aus ihrem Kosmetikstudio angerufen, und die Meditationsmusik im Hintergrund war so durchdringend gewesen, dass sie brüllen musste. Zuerst fragte Petri, ob die Schwangerschaft ein Hinderungsgrund für ihre Botox-Applikation sei. Ganz nebenbei teilte sie Anna ihre Entscheidung gegen den empfohlenen Kaiserschnitt mit, da sie sich eine natürliche Geburt durchaus zutraue. Ihr Pränatal-Coach habe sie dazu ermutigt, und Ari, ihr Mann, wollte die Geburt so gern filmen.
Anna stand auf. »Ich weiß, dass Sie die ärztliche Schweigepflicht ernst nehmen. Dieser Fall ist besonders delikat. Herr Minister Preuss befindet sich im Landtagswahlkampf, seine politischen Gegner und die Presse stürzen sich gierig auf alles, was seinen Ruf schädigen und ihm die Landesvaterschaft vermasseln könnte.«
»Schon klar«, gab Claire unbewegt zurück. Anna legte nach. »Wo Sie politisch stehen, geht mich nichts an. Aber jede Indiskretion, die nach außen dringt, fällt auf die Klinik zurück und würde alles gefährden, was wir uns mühevoll aufgebaut haben.«
Mit einem Ruck zog Claire den Reißverschluss ihrer Jeans hoch. »No worries, Chefin. Von mir erfährt niemand, dass das First Child ein aufgetautes Retortenbaby ist.«
¤
Das Telefon zerschrillte abrupt die Stille im Büro. Der persönliche Referent des Ministers verlangte umgehend zu erfahren, was mit seinem Boss los sei. Anna bat um Geduld und versprach einen Rückruf. In der Kardiologie gab es nichts Neues, die Koronarangiografie war noch im Gang und bislang keine Diagnose zu stellen. Draußen wartete die Presse, kein Kommentar war keine Lösung, ein Vertrösten befeuerte Spekulationen, Davonschleichen wäre unwürdig. Also Geduld. Donnerndes Klopfen unterbrach ihr Grübeln. Ehe sie antworten konnte, platzte der Referent ins Büro, ein vierschrötiger Bulle, in seinem Schlepptau ein gestikulierender Security-Mitarbeiter des Hauses, der sich erregt entschuldigte, er habe keine Chance gehabt, diesen Herrn abzuwimmeln.
»Beckstein«, bellte der Bulle. »Warum fertigen Sie mich am Telefon ab wie einen Hilfspfleger?«
Anna lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Dr. Martini, sehr angenehm, bitte nehmen Sie Platz.« Sie schwieg einen Moment und verschränkte die Arme. »Übrigens behandle ich meine Mitarbeiter in der Pflege stets mit Respekt.«
»Schon gut«, brummte Beckstein, als hätte er etwas zu verzeihen, und ließ sich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch fallen. Anna legte die manikürten Hände auf die mattschwarze Schreibtischunterlage und musterte ihr Gegenüber schweigend.
Unter ihrem Blick zerbröselte die aggressive Präsenz des Referenten, Beckstein rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Sorry, Frau Chefarzt, dass ich hier unangemeldet hereinschneie.« Er senkte den Kopf. »Ich bin in Sorge um meinen Chef, weil ich nichts gehört habe, und mir sitzt die Presse im Nacken und.«
»Ich verstehe«, unterbrach Anna, »aber die Presse wird warten müssen.« Knapp erläuterte sie die Sachlage. »Wir können nur hoffen, dass es kein Herzinfarkt ist«, schloss sie.
Beckstein wurde blass und sackte in sich zusammen. »Oh Gott, Frau Doktor, was soll ich jetzt bloß tun?«
Der klägliche Ton erweichte ihre Frostigkeit, trotz der Vermutung, dass Becksteins Sorge eher der eigenen Karriere als der Gesundheit seines Chefs galt. Sie bot an, sich gemeinsam den Journalisten zu stellen. Beckstein straffte die Schultern und knipste sein Presselächeln an. »Sehr freundlich. Nur bitte, Frau Doktor, sagen Sie auf gar keinen Fall, dass der Minister mit dem Hubschrauber ausgeflogen wurde. Das sieht so nach Notfall aus.« Anna nickte.
¤
Gerne überließ sie es dem Referenten, die sehr geehrten Damen und Herren der Presse im Namen des Herrn Ministers zu begrüßen. Die Zwischenfragen nach dem Verbleib des frischgebackenen Vaters wehrte Beckstein mit einem beschwichtigenden Spreizen seiner fleischigen Hände ab und übergab den Stab an Frau Dr. Martini, eine renommierte Expertin der Gynäkologie und Geburtshilfe.
Anna bedankte sich artig und spulte mit routinierter Empathie ihren Text ab: »Ich darf Ihnen die überaus freudige Mitteilung machen, dass wir Frau Petri von einer gesunden Tochter entbinden konnten. Das Baby wiegt dreitausendzweihundert Gramm bei einer Körperlänge von neunundvierzig Zentimeter, also alles im Normbereich. Die Geburt war komplikationslos, aber sehr anstrengend für Mutter und Kind. Beide sind wohlauf, bedürfen jedoch vorerst der absoluten Ruhe.«
Murrendes Stimmengewirr. »Wo bleibt der Minister? Schließlich hat er die Pressekonferenz angesetzt.«
»Silentium bitte!«, sagte Anna. Die leise Schärfe ihrer Stimme sorgte für Stille. »In meiner langjährigen Tätigkeit als Geburtshelferin habe ich es immer begrüßt, wenn der werdende Vater seiner Frau im Kreißsaal beisteht.« Sie legte eine Pause von zwei Sekunden ein. »Das Glück, ein Neugeborenes im Arm zu halten, ist ein existenzielles Erlebnis für jeden Menschen – und wenn es gemeinsam durchlebt wird, auch eine richtungsweisende Erfahrung für Paare. Allerdings unterschätzen die Herren der Schöpfung mitunter, welch schmerzhaften Prozess ihre Frau oder Partnerin bei der Geburt durchschreiten muss. Auch und gerade toughe Typen kippen dabei einfach um. Wie heute der Herr Minister.«
Als Gelächter und Stimmengewirr verstummt waren, fuhr sie fort: »Es besteht kein Grund zur Sorge, Herr Preuss ist nur kurz ohnmächtig geworden und war sofort wieder ansprechbar. Allerdings hat er sich eine kleine Platzwunde über der rechten Augenbraue zugezogen, und ich habe eine routinemäßige neurologische Abklärung empfohlen. Deshalb steht der junge Vater Ihnen heute leider nicht mehr zur Verfügung.«
Nach einigen Momenten unwilligen Raunens kam die befürchtete Frage ausgerechnet von dem schmierigen Reporter des Society-Kaleidoskops. »Warum ist vor einer Stunde ein Helikopter auf dem Dach Ihrer Klinik gelandet?«
»Wir sind als überregionale Geburtshelfer sehr froh, seit Neuestem über einen Hubschrauberlandeplatz zu verfügen, so können bei Notfällen und dringlichen Risikogeburten die Patientinnen eingeflogen werden.«
»Prinzipiell können Sie aber auch Notfälle ausfliegen?«, rief der Reporter vom Abendblatt dazwischen.
Sie schaute über ihre Brille. »Selbstverständlich! Allerdings sind wir ein hoch spezialisiertes Zentrum – gerade für Risikoschwangerschaften und -geburten. Somit können wir geburtshilfliche Notfälle sehr gut selbst versorgen.«
Eine dünne Journalistin mit grauem Zopf, zuständig für die Klatschspalte im Kurier, hakte nach, was für eine Notfallpatientin denn am Nachmittag eingeflogen worden sei.
»Ach, wissen Sie«, Anna schob ihre Brille hoch und machte eine kurze Pause, »wenn Sie selbst in jüngeren Jahren bei uns Patientin gewesen wären, hätten Sie sich doch bestimmt gewünscht, dass wir unsere ärztliche Schweigepflicht ernst nehmen?«
Mit einer schroffen Handbewegung beendete Anna das schadenfrohe Lachen zweier männlicher Kollegen. »Natürlich schützen wir die Identität unserer Patientinnen, aber ich darf Ihnen versichern, dass alle drei Mütter, die heute entbunden haben, ebenso wohlauf sind wie deren vier Neugeborene.«
Damit waren die unliebsamen Fragen beendet. Anna sah auf die Uhr und nickte Beckstein zu. Der nahm das Signal umgehend auf, bedankte sich bei den Damen und Herren für das zahlreiche Erscheinen und versprach eine sofortige Pressemeldung, sobald die junge Familie für einen Fototermin bereit sei.
»Noch eine letzte Frage«, rief jemand aus dem Hintergrund. Die meisten Journalisten kannte Anna aus früheren Konferenzen, diesen Reporter bemerkte sie erstmalig. Hagerer Typ, Mitte dreißig, dunkelhaarig, mit ausgeprägtem Kinn, imposanter Hakennase und einer wulstigen Narbe auf der Stirn. Er stellte sich nicht einmal vor. Anna bat, er möge sich freundlicherweise kurz fassen, sie müsse zu ihren Patientinnen.
»Frau Dr. Martini, haben Sie persönlich heute Frau Petri persönlich entbunden?«
Anna verzog keine Miene. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage verstehe; vielleicht sollten Sie solche Wortdoppelungen aber in Ihrem geschriebenen Text vermeiden«, gab sie zurück. »Und ja, bei der Frau des Ministers habe ich selbstverständlich die Entbindung persönlich durchgeführt. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte.«
Der Kerl runzelte seine buschigen Augenbrauen und gab nicht auf. »Allerletzte Frage zum Thema persönlich: Was sagen Sie zu dem Gerücht, Frau Petri hätte eine Leihmutter angeheuert und der Öffentlichkeit die Schwangerschaft nur vorgespielt?«
Anna blähte die Nasenlöcher. »Junger Mann, Sie sind wohl noch neu im Geschäft, sonst wäre Ihnen bekannt, dass Schwangerschaften immer bis ins Detail dokumentiert werden – auch die von Frau Petri. Übrigens: Ein Charakteristikum von Fake News ist, dass sie falsch sind. Vielleicht sollten Sie künftig die Quellen solcher Gerüchte etwas kritischer prüfen. Schönen Abend noch.«
Die Lacher waren auf ihrer Seite. Als sie sich zum Ausgang des Konferenzsaals wandte, sah sie aus dem Augenwinkel den bohrenden Blick des Journalisten, der zu ihr trat. »Bitte noch eine Sekunde, Frau Doktor.«
Der Referent stellte sich in Drohpositur neben sie. »Sie haben doch gehört, dass das für heute alles war«, schnauzte er den vorwitzigen Schreiberling an. »Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Pressestelle!«
¤
Dankbar, dem Autopiloten den Weg durch den abendlichen Verkehr nach Hause zu überlassen, drückte Anna die Home-Taste und lehnte sich zurück ins weinrote Mikrofaserpolster ihres E-Autos mit selbstverdunkelndem Plexiglasdach. Die Schnellstraße war gesperrt, das Navi wählte den Weg durch die Kasernenstadt, eine No-go-Area, die sie sonst strikt mied.
Das Auto schlich durch die Straßenschluchten zwischen schmutzig grauen Betonklötzen, deren erdrückende Höhe alles Licht zu schlucken schien. Auf der Straße tummelten sich Menschenmassen, die sich nicht um den Verkehr scherten. Eine Gruppe von sieben Jugendlichen randalierte in Gang-Uniform: armeegrüne Jeans im Camouflage-Look mit Arsch-Dekolleté, senfgelbe Muscle-Shirts und magentafarbene Baseballkappen. Grölend bewarfen sie sich mit zerknautschten Bierdosen. Einige starrten ihren Flitzer böse an, einer zeigte den Stinkefinger, seine Dose verfehlte die Frontscheibe knapp. Mit zitternden Händen suchte Anna vergeblich die Security-Taste auf dem Display. Dann fiel ihr der Sprachbefehl ein: Protection Now. Der akustisch aktivierte Notmechanismus setzte alle Griffe und hervorstehenden Teile der Karosserie unter Strom, um Angreifer abzuwehren – falls sie nicht zu zahlreich waren. Außerdem heulte die Hupe fünfmal gellend, und das Auto beschleunigte ruckartig, ein Hund konnte gerade noch zur Seite springen. Die Jugendlichen blieben zurück, brüllten Unverständliches und trollten sich.
Anna atmete auf und schloss die Augen. Nach zehn Minuten bot die häusliche Tiefgarage Geborgenheit in Beton. Mit dem Lift schwebte sie in den dreizehnten Stock, ihre schweißnassen Hände hinterließen klebrige Fingerabdrücke auf dem Code-Display.
Die Wohnungstür glitt zur Seite, Robby begrüßte Anna mit fröhlicher Chorknabenstimme. »Guten Abend, Süße, wie war dein Tag?« Seit die Katze tot war, lieferte die Zuwendung des Kuschelroboters ihr ein Surrogat für das Gefühl, dass sich jemand freute, wenn sie abends nach Hause kam.
»Möchtest du einen Drink?«, schnarrte Robby fürsorglich, wobei sich sein Scharniergelenk unter dem Kinn um fünfzehn Grad neigte und eine putzige Kopfschieflage entstehen ließ. Unvermittelt musste Anna niesen, der taiwanesische Putzmann hatte wieder die ätzende Reinigungsflüssigkeit benutzt. Ihr »Hatschi« überforderte Robbys Spracherkennung; er funkte das Kommando Caipi an den Drinkomaten, dessen Eiscrasher umgehend zu häckseln begann. Dann zischten die Düsen und gaben einprogrammierte Mengen von Limettensaft, braunem Zucker und Cachaça zum Eis. Dankend nahm Anna den unbestellten, doch hochwillkommenen Caipirinha entgegen und kraulte den Acrylfaserflausch auf Robbys Kopf, der die Streichelhaptik eines Kleinkinderschopfes imitierte.
Sie sah aus dem Panoramafenster hinunter auf die Stadt, die im letzten Tageslicht versank, und dachte an den frischgebackenen Vater, der in der dritten Medizin des Klinikums nach dem Herzkatheter die Beruhigungsmittel ausschlief, nach hoffentlich unauffälligem Befund. Der Cachaça flutete an und spülte das Adrenalin aus ihrem System. Schlagartig sackte die innere Drehzahl ab. Endlich geschafft: die Petri-Schwangerschaft, an deren Details von der Planung bis zur Entbindung sie sich teils messerscharf, teils nur verschwommen erinnerte. Doch ihr Gedächtnis lagerte im Gästeklo. Dort ließ sie per Knopfdruck den Spiegel zur Seite gleiten, öffnete den Tresor und griff nach dem Tagebuch.
1.2. Unfassbar! Ich hatte gleich ein komisches Gefühl bei der handgeschriebenen Einladung des Staatssekretärs zu einem Imbiss in familiärer Atmosphäre. Das war wörtlich gemeint, es ging um Familienplanung!! Dem Powerpaar fehlt die Power, auf übliche Weise ein Kind zu zeugen – oder vielleicht ist dem früheren Schürzenhelden nur der Bock auf Sex mit Mausi vergangen? Ich habe versucht, ihnen den Kollegen S.F. in Berlin schmackhaft zu machen, schließlich ist Karlsruhe nur ihr Zweitwohnsitz. Aber erfolglos. Klar, als milliardenschwerer Sprössling des Preuss-Imperiums fliegt man im eigenen Wasserstoff-Minijet klimaneutral in einer knappen Stunde vomBERzum Baden Airpark.
Beim Dessert verpflichteten sie mich zur »uneingeschränkten Diskretion«. Das Schärfste kam dann beim Digestif: Petri fragte ganz unbefangen, ob ich – da ich schon im Hause sei – nicht gleich eine Spermaprobe mitnehmen wolle, die schon, in einer Spritze aufgezogen, im Kühlschrank lagere. Ari scharrte mit den Füßen und starrte zu Boden. Unfassbar, wie der Macho, den die Öffentlichkeit kennt (»Ich nenne alle Frauen Mausi, dann gibt es keine Verwechslungen«), zu Hause seiner Lebensgefährtin die Hosen überlässt. Nicht umsonst wird sieMP, die Maschinenpistole genannt.
Das Telefon klingelte, Anna klappte das Tagebuch zu. Der Kardiologe wollte sie über den Zustand des Ministers updaten. »Gut, dass Sie mich gleich gerufen haben«, sagte er. »Minister Preuss hatte einen Herzinfarkt. Die Engstelle in der Koronararterie wurde aufgedehnt und wird nun mit einer Spiralprothese offen gehalten. Er ist stabil und wird in Kürze wieder fast der Alte sein.«
»Gott sei Dank«, sagte Anna und wünschte dem Kollegen noch einen schönen Abend. Danach war ein zweiter Caipirinha fällig. Zurück auf der Couch öffnete sie erneut das Tagebuch.
2.3. Es hat tatsächlich im zweiten Anlauf geklappt!! Fünf achtzellige Embryonen, trotz miserabler Spermienqualität. Für Preuss war es die ultimative narzisstische Kränkung, dass seine Spermiendichte nicht einmal die Hälfte des unteren Normwertes erreichte. Bei meinen Worten »Ohne unsere Hilfe schaffen es Ihre Samenzellen nicht« zuckte sein rechtes Unterlid. Bei Mausi ahnte ich stille Genugtuung über die eindeutige personelle Zuordnung des reproduktiven Misserfolges.
Jetzt ruhen die vitrifizierten* Embryonen friedlich im Trockeneis, denn die beiden (er 47, sie immerhin 43Jahre) wünschten nicht etwa einen sofortigen Embryotransfer, sondern eine Kryokonservierung!!* Momentan wäre eine Schwangerschaft der Karriereplanung wohl abträglich. Vielleicht verpasstMPja die Implantation über der Karriere, bis es dann wirklich zu spät ist.
Doch Anna hatte vergeblich gehofft. Vier Jahre später standen Preuss und Petri auf der Matte. Ihr vorsichtiger Hinweis auf das Alter seiner Zukünftigen wurde vom Verlobten charmant abgebügelt: Biologisch sei Mausi höchstens Mitte dreißig. Petri war eine schwierige Schwangere und bestätigte das Klischee, der Albtraum jedes Arztes seien Ärzte als Patienten. Als studierte Medizinerin, die nie praktisch in ihrem Beruf gearbeitet, sondern sich direkt nach der Approbation auf Medizinmanagement spezialisiert hatte, meinte MP, in allen medizinischen Belangen mitreden zu können. Nachdem das erste kritische Trimenon problemlos überstanden war, engagierte sie umgehend einen Coach, der auf Pränatal-Training von späten Erstgebärenden spezialisiert war und dreimal pro Woche aus Basel anreiste. Als der Babybauch sichtbar wurde, gab es eine pompöse Hochzeit. Die massive Präsenz der großzügig eingeladenen Presse sorgte für einen werbewirksamen Auftakt des Wahlkampfes.
Anna legte das Tagebuch zurück in den Safe. Obwohl ihr Kalorienkontingent mit den Drinks bereits erreicht war, taute sie eine Diät-Lasagne auf, schaffte aber nur die Hälfte der Gumminudeln mit ihrer Pseudofleischfüllung. Müde schminkte sie sich ab und wünschte Robby eine gute Nacht. Bevor sie in einen unruhigen Schlaf fiel, galt ihr letzter Gedanke dem Baby, das schon pränatal Wahlkampfhelfer sein musste und am Tag der Geburt fast Halbwaise geworden wäre.
¤
Mehr hatte er nicht herausholen können aus dieser bescheuerten Pressekonferenz, auf die alle stundenlang gewartet hatten. Nicht einmal nach der Veranstaltung hatte er es geschafft, an die Chefärztin heranzukommen, um ihr wegen der Leihmuttergerüchte auf den Zahn zu fühlen. »Bornierte Schnepfe«, murmelte Ben und spuckte seinen Kaugummi auf den Boden. Noch immer hatte er den sarkastischen Ton der Doktorin im Ohr, penetrant wie einen Tinnitus. »Junger Mann« hatte sie ihn genannt, was er überwiegend unverschämt – ansatzweise aber auch antörnend fand. Scharfes Weib, kein Zweifel. Wenn man auf ältere Frauen stand. Diesen Print hatte ihm sein erster Sex verpasst, mit dem Au-pair-Mädchen im Haus des besten Schulfreundes.
Ben zog den Kopf ein, um durch die Tür seines 23,5-Quadratmeter-Hauses zu passen. Er pellte sich aus dem verschwitzten Shirt. Im Kühlschrank lag noch ein kleines Bier, das er in drei Zügen hinunterstürzte. Ein weiteres wäre schön gewesen, aber er kaufte nie auf Vorrat. Minimalismus forderte Verzicht auf den Erwerb von Überflüssigem, dazu gehörte auch Alkohol. Früher leidenschaftlicher Weintrinker, beschränkte Ben sich nun auf ein Pils pro Tag, nur am Wochenende gönnte er sich ein zweites.
Auf der Mini-Holzterrasse tippte er die Headline: Tougher Typ macht im Kreißsaal schlapp. Dann folgten einige Sätze zur Geburt des Preuss-Kindes, bei der der einundfünfzigjährige Vater ohnmächtig geworden, aber nach Angaben der Klinikleitung nun wieder wohlauf war. Den Text sandte er an die Redaktion von VIGILANZVISION, des Online-Magazins, das ihn als Freelancer vorzugsweise zu Events von minderer Relevanz schickte, wenn gerade kein Festangestellter verfügbar war.
Das Wummern des Messingtürklopfers vom Flohmarkt riss ihn aus seinen Gedanken. Kilian, sein pensionierter Nachbar, mit dem er sich auch den kleinen Gemüsegarten teilte. Manchmal brachte er eine Flasche Wein mit, bei Hitze auch gekühlten Sprudel, für Ben eine willkommene Abwechslung zum stillen Kanisterwasser.
»Wenn ich störe, bin ich sofort wieder weg.« Das sagte er immer.
»Quatsch, komm rein«, antwortete Ben, ebenfalls wie fast immer, diesmal umso lieber, als Kilian neben dem norwegischen Riesling noch zwei Hamburger aus der Jutetasche zog – ein kulinarischer Sündenfall, den der Neunzig-Prozent-Vegetarier sich gelegentlich gönnte. Ben ließ sich willig verführen. Sie trugen Gläser, Holzbretter und zwei Blatt Küchenkrepp als Servietten zum Klapptisch auf die Terrasse.
»Wie war dein Tag?«, fragte Kilian.
»Beschissen, deshalb heute keine Politik!«
Kilian nickte und öffnete den Riesling. »Ist das First Baby gelandet? Hast du deine Fragen zur Mutterschaft untergebracht?«
»Schön wär’s«, seufzte Ben und berichtete von der Pressekonferenz, vom Schwächeanfall des Ministers nach der Geburt und erwähnte in einem Halbsatz auch den Heli: »Aber den Einsatz konnte die scharfe Chefärztin hinreichend erklären.«
Kilian tupfte sich das Ketchup aus dem Fusselbart und grinste. »Scharfe Chefärztin? Zeig mal!«
Ben rief das mitgeschnittene Video auf. Kilian schnalzte mit der Zunge. »Trotz der Falten gut erhalten – und du stehst ja auf die Alten.«
»Typisch Deutschpauker! Die ist locker zwanzig Jahre jünger als du!«
Sie prosteten sich zu, während das Video weiterlief. Als es um den Heli ging, bat Kilian, die Aufzeichnung zurückzuspulen, und zwirbelte seinen grauen Pferdeschwanz. »Ist dir aufgefallen, dass die Chefärztin die Frage deines Kollegen nicht beantwortet? Wäre doch denkbar, dass den Minister vor lauter Geburtsstress der Schlag getroffen hat und er deshalb ausgeflogen wurde?«
»Optimist!«, gab Ben zurück. »Preuss ist einundfünfzig und spielt regelmäßig Tennis. Bei Geburten kippen auch jüngere Väter um. Außerdem interessiert mich das Gerücht um die Leihmutterschaft viel mehr.«
»Aber die ist heutzutage legal«, meinte Kilian, »schließlich braucht man mehr Rentenzahler.«
Ben widersprach. Der Nachweis einer Leihmutterschaft könne dem Wahlkämpfer sehr wohl das Genick brechen. »Nicht weil es illegal ist, sondern weil er und seine Frau so ein Babybauch-Brimborium veranstaltet haben. Da menschelt sich der Noch-Minister über den Kindesvater zum Landesvater. Den Job will er dringend haben, denn der Kanzler kann ihn nicht leiden, und mehr als das langweilige Amt als Gesundheitsminister ist nicht drin. Wenn herauskäme, dass der schwangere Bauch der Gattin nur Schaumgummi und die Gebärmutter gemietet war – das würde die Öffentlichkeit nicht verzeihen.«
Wie täglich um diese Zeit dröhnte im Nachbarhäuschen der Fernseher. Erna und Otto Schmidt, beide Rentner, waren hörgemindert. Vor den Abendnachrichten lief ein Wahlwerbespot mit dem panflötendominierten Musikeinspieler der Partei der Echten Liberalen.
»Scheiß-Echte«, sagte Ben. »Selbst wenn der Preuss tot umfiele, wären die in der Landtagswahl kaum zu schlagen. Ihr Grünen habt Anhänger verloren, die Christen sind abgeschlafft, und die Sozis hatten im Ländle noch nie viel zu sagen. Immerhin haben die Echten den Rechten so viele Wähler abgeworben, dass die auch nix mehr hinkriegen.«
»So viel zum Thema keine Politik«, gab Kilian zurück. »Du sagst es: Alles wird immer trostloser.« Er pulte die sauren Gurken von seinem Hamburger. »Das waren noch Zeiten, als Baden-Württemberg unangefochten grün war, bevor ihr Minimalisten die Schnapsidee hattet, eine Partei zu gründen.«
»Quatsch«, konterte Ben. »Es gibt viel mehr Rechte, die bei den Echten eine politische Heimat finden, als Grüne, die den Mut zum Minimalismus haben. Nicht wir sind schuld, dass ihr schwächelt. Die Menschen glauben euch nicht mehr, dass man den Klimawandel noch aufhalten kann.«
»Du Defätist! Unaufhaltsam ist der nur, wenn Politiker sich weiter von Lobbyisten kaufen lassen. Oder wenn Lobbyisten oder Finanzhaie Politiker werden, wie der Preuss. Und ihr tragt an diesem Desaster Mitschuld, weil ihr mit uns dasselbe macht wie die Echten mit den Rechten – ihr spannt uns Wähler aus. Menschen, die auf Sinnsuche sind und denen ihr einredet, Verzicht wäre Weltrettung.« Er riss ein Stück Küchenrolle ab und wickelte die Gurkenscheiben sorgsam ein. »Den menschlichen Basisbedürfnissen nach Wohlstand und Genuss die Berechtigung abzusprechen, ist für eine Bewegung vielleicht akzeptabel, aber noch längst kein Parteiprogramm.«
Ben wickelte die Gurkenscheiben aus der Küchenrolle und schob sie sich in den Mund. »Würden euch die Wähler wegrennen, wenn euer Programm sexy wäre? Vielleicht haben die Leute es satt, die Welt von Wohlstandsbürgern erklärt zu kriegen, die Wasser predigen und Wein saufen? Wir tun wenigstens, was wir propagieren: Wir schränken uns ein. Ihr dagegen fordert von den Bürgern Verzicht auf Luxus, und dann haust ihr in wohngesunden Ökovillen und lasst eure vegane Pizza mit der Drohne einfliegen.«
Kilian stand abrupt auf und schnappte sich die halb leere Weinflasche. »Dann ist es wohl auch verwerflich, wenn ein Grüner seinen teuren Biowein mit einem konsequenten Asketen teilt und damit dessen Ernährungsbudget schont. Schönen Abend noch.«
Mit diesem nicht retournierbaren Konter trottete Kilian zu seinem Tiny House. Ben schaute ihm nach und rief ihm ein »Sorry« hinterher, er möge doch bitte zurückkommen. Aber Kilian drehte sich nicht um.
Was für ein Scheißtag!
¤¤¤
2. August
Beim Aufwachen dröhnte Kilians Kopf vom allein geleerten Riesling. Im Spiegel starrte ihm eine rotäugige Visage entgegen, mit Tränensäcken, die sich wangenwärts ausbreiteten und in deren Falten man Kresse säen konnte.
Er trug ein Schälchen Sojamilch vor die Tür und stolperte fast über die Katze, die keinem gehörte. Sie strich ihm hektisch um die Beine, ignorierte das Schälchen und sprang mit einem Satz durch die offene Haustür nach drinnen. Im Wohnzimmer kletterte sie blitzschnell die Leiter hoch und verschwand unter seinem Bett, ihrem Lieblingsplatz. Er brauchte zehn Minuten, um die Problemkatze zu verscheuchen.
Nach dem Duschen stieg Kilian auf die Waage: 69,4Kilogramm – alles unter siebzig war gut! Bei einer Körpergröße von eins vierundsiebzig war sein BMI unter dreiundzwanzig und lag damit nicht viel höher als in der Jugend, damals allerdings ohne störendes Bäuchlein. Dann maß er den Blutdruck: 150/90 – gar nicht gut! Kilian nahm die Statistiken zur erhöhten Inzidenz von Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko ab 120/70 ernst, besonders, seit die Krankenkassen ihre Leistungen für über Siebzigjährige deutlich einschränken durften. Seine familiäre Fettstoffwechselstörung machte ihn zum Risikopatienten, und bis zum runden Geburtstag war nicht mehr viel Zeit. So verordnete er sich zusätzlich zum fettsenkenden Statin und der teuren DHEA* Anti-Aging-Kapsel ausnahmsweise eine ganze statt der halben Blutdruckpille, dazu zwei Aspirin gegen den Kater. Kopfwehbedingt musste er die Kniebeugen nach der fünfzehnten abbrechen. Sonst war er da eisern, denn das Tiny House war nicht barrierefrei und die Leiter zum Bett ziemlich steil. Immer öfter fragte er sich, ob die Investition all seines postehelichen Restkapitals ins Tiny House in Anbetracht seines Alters ein Fehler gewesen war – von den zunehmenden Unwetterkatastrophen ganz abgesehen.
Mit der Exfrau war Kilian nicht gelungen, was er seinen Schülern beigebracht hatte: Jeder Streit sei durch ein Gespräch beizulegen. Vor allem mit Menschen, die man mochte. Ben war einer der wenigen, die ihm derzeit am Herzen lagen – umso mehr, als ihm nach der Scheidung neben der Gattin auch der größte Teil seines sozialen Umfeldes abhandengekommen war. Bei Licht betrachtet erschien ihm sein Ärger vom Vorabend kaum nachvollziehbar. Er trug mit Ben oft politische Kontroversen aus, meist harmlos, als frotzelndes Ritual. Eigentlich waren sie sich grundsätzlich einig in ihrer Weltanschauung und den wesentlichen politischen Zielen, was Kilian in diesen Zeiten keinesfalls selbstverständlich fand. Uneinig waren sie sich über carpe diem. Während Kilian das Leben zu kurz fand, um sich wesentliche Genüsse zu versagen, so sie der Umwelt nicht schadeten, meinte Ben, Verzicht sei unverzichtbar, um die Welt zukunftsfähig für alle Menschen zu machen. Dagegen erzählte Kilians fast gleichaltriger Sohn seinem Dad bei jeder ihrer seltenen Zusammenkünfte, dass Deutschland sich als Nation wieder auf sich selbst besinnen müsse, statt sich um Sozialschmarotzer und als Flüchtlinge getarnte Terroristen aus aller Welt zu kümmern. Da fühlte er sich dem jungen Nachbarn oft näher als seinem »Selbstgemachten«.
Also Friede durch Frühstück! Nach Bens prompter Zusage nahm Kilian zwei Dinkelbrötchen und ein halbes Roggenbaguette aus dem kleinen Tiefkühlschrank. Nachdem er das Brot gewärmt und zwei Henne-Hahn-Eier gekocht hatte, klappte er den Esstisch aus der Wand, deckte ihn mit dem guten Geschirr und dekorierte die Aufschnittplatte mit Cherrytomaten aus dem eigenen Beet. Zur Deko kam noch ein blühender Kaktus in die Mitte. Die Außentemperatur lag schon bei über dreißig Grad, doch hatte sein Tiny House dem seines Nachbarn eine Solar-Klimaanlage voraus. Zwar bezeichnete Ben die als dekadente Energieverschwendung für Weicheier, allerdings genoss er bei seinen Besuchen die relative Kühle von maximal achtundzwanzig Grad, genau wie den fair getradeten, frisch gemahlenen Kaffee aus einer Hightech-Maschine.
Kilian schaltete sein Pad ein. Auf dem Display erschien ein Foto des Ministers, der strahlte wie ein Kind nach ergiebiger Bescherung. In spektakulärem Kontrast dazu stand sein grotesker Kopfverband, blutig durchgesuppt. Darunter die Schlagzeile: Wenn starke Männer schwach werden. Wie heroisch der Minister seiner Frau durch alle Strapazen der Geburt beigestanden habe. Und wie menschlich es den als durchsetzungsstark bekannten Politiker mache, sich von Vaterfreude überwältigen zu lassen. Auf die Frage, wie der Minister die Geburt seines Babys erlebt habe, antwortete Preuss wörtlich: »Als mir meine neugeborene Tochter ihre winzigen Fäustchen entgegenstreckte, war mein erster Gedanke: Die wichtigste Vaterschaft meines Lebens wurde mir soeben geschenkt. Natürlich werde ich weiter mit all meinen Kräften darum kämpfen, als nächster Landesvater dem Volk zu dienen – aber ich werde es mit einer neuen Gelassenheit tun.«
¤
Kurz vor dem Orgasmus holte die Schiffssirene seines Handys Ben aus dem Schlaf. Gerade hatte ihn die scharfe Chefärztin mit ihrer hauchzarten Spitzenunterwäsche auf einen Gebärstuhl gefesselt; ihr dichtes Schamhaar kringelte sich zu einer lackschwarzen Lockenpracht, wie man sie seit Jahrzehnten bei keiner Frau mehr zu sehen kriegte, und sie roch wunderbar ungewaschen, wie ein mittelalter Chèvre. So dicht beugte sie sich über ihn, dass er die langen Wimpern ihrer Katzenaugen einzeln wahrnahm, dabei leckte sie sich die knallroten Lippen. Er wollte sich nicht bewegen, um die Dessous nicht zu zerreißen. Bis die Textnachricht von Kilian mit der Frühstückseinladung ihn brutal aus seiner Wonne riss. Kurz wandelte sich sein Groll vom Vorabend in Wut am Morgen. Seinen Schwanz ereilte prompt die Schwerkraft, gleich einem beleidigten Shrimp zog er sich zurück ins Glattrasierte, als wollte er seinem Herrchen bedeuten, Kilian könne doch nix dafür. Herrchen gab sich einsichtig.
Bei den Minimalisten war Grünen-Bashing Sport – ähnlich wie vor vielen Jahren die Frauenwitze, die auch niemand lustig fand. Dennoch eine Gemeinheit, ausgerechnet Kilian Doppelmoral an den Kopf zu knallen, obwohl der selbst nicht viel besaß und das Wenige immer bereitwillig teilte. Also sagte er zu.
Als er Kilian schmächtig und verknittert in der Tür stehen sah, hätte er seinen Nachbarn am liebsten umarmt. Stattdessen schlugen sie sich auf die Schulter.
»Willkommen in meiner wohngesunden Ökovilla.«
Ben senkte den Kopf. »Sorry, ich war gestern ein Arsch.«
Kilian hob die Hände. »Schon gut, mein Junge. Auch von mir war es unangemessen, einfach abzuhauen.«
Ben griff herzhaft zu, eine Weile kauten sie schweigend. Dann zeigte ihm Kilian den Preuss-Artikel. Ben verzog das Gesicht und legte sein Brötchen weg. »Machtgieriger Zyniker zielt auf Wählers Tränendrüsen«, brummte er.
»Mein Lieber, du bist unaufmerksam«, tadelte Kilian. »Deine scharfe Chefärztin sprach im gestrigen Video von einer kleinen Platzwunde über dem rechten Auge. Und wo bitte liegt dieser fette Blutfleck auf seinem Kopfverband – der nebenbei bemerkt für eine kleine Platzwunde ziemlich groß ist?«
»Links«, murmelte Ben und stellte ruckartig die Kaffeetasse ab.
Kilians Augen funkelten. »Eben, Mann! Falsche Seite!«
¤
Robby weckte Anna zur programmierten Zeit. »Hallo, Süße, pflück dir den Tag!«
»Noch zehn Minuten«, murmelte sie und kuschelte sich zurück. Beim nächsten Mal war er strenger. »Raus jetzt, mein Faultier! Zeit, den Tag zu beginnen.«
Anna quälte sich aus dem Bett, klappte per Knopfdruck das versenkte Laufband auf. Sie prügelte den inneren Schweinehund, bis er den Weg freimachte, und absolvierte ihre täglichen zwölf Kilometer.
Beim Müsli störte Mozart – das Preussofon. Mit Mühe verbarg Anna den Unmut. Doch der Anrufer war nicht Preuss, sondern Struck, der sich für die frühe Störung entschuldigte. Er rufe im Auftrag des Herrn Ministers an.
»Verehrte Frau Kollegin, ich brauche Ihre Unterstützung«, schleimte er. »Ich bitte Sie inständig, zu vergessen, was ich Ihnen gestern gesagt habe.«
»Ich höre«, antwortete Anna; er seufzte.
»Mein Freund, der Herr Minister, war äußerst ungehalten, dass ich Ihnen gestern seine Diagnose kommuniziert habe. Er meint, ein Herzinfarkt würde ihm im Wahlkampf schaden, weil er als Zeichen einer grundsätzlichen gesundheitlichen Schwäche ausgelegt werden könnte. Und Schwäche ist schlecht, Unfall ist bloß Pech. Kurz: Herr Preuss hat mich beauftragt, Ihnen auszurichten, dass er Sie um absolutes Stillschweigen bittet. Er hat sich beim Umkippen eine Platzwunde mit Gehirnerschütterung geholt – und mehr war nicht.«
Anna war im Bilde. Ob der Kollege wirklich glaube, das sickere in Zeiten der Totalvernetzung und Überwachung nicht durch?
Auch darauf hatte er die Antwort. »Mein Team habe ich im Griff. Alles loyale, eingeschworene Mitarbeiter. Und in Ihrer Klinik wissen die ja nur, dass er umgekippt ist.«
Anna nickte und dachte an Claire, die das EKG gesehen hatte.
Die Pressemitteilung des Gesundheits- und Sozialministeriums müsste schon herausgegangen sein, fuhr Struck fort und bat Anna, die Meldung sorgfältig zu lesen, um sich bei Nachfragen unbedingt an diesem Text zu orientieren.
Anna klickte sich in ihr Pad und las:
Minister Arian Preuss (51) wich seiner Frau Mechthild Petri (47) während der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter nicht von der Seite. Von freudigen Emotionen überwältigt, erlitt er einen kurzen Schwächeanfall mit Bewusstlosigkeit. Dabei prallte Preuss mit dem Kopf unglücklich auf die Steinfliesen und erlitt eine heftig blutende Platzwunde und eine Gehirnerschütterung. Nach Angaben der Ärzte ist diese keinesfalls bedrohlich, zur vollständigen Genesung seien jedoch mindestens zwei Wochen absoluter Ruhe erforderlich. Um ihn vom Wahlkampfstress abzuschirmen, rieten die Mediziner zu einer Reha in einer Privatklinik. Dort werden sich Frau und Tochter mit ihm erholen.
Struck wartete in der Leitung, bis sie den Text gelesen hatte.
»Wir haben den Minister in den frühen Morgenstunden in die MESANCOSA-Klinik verlegt. Da gibt es eine kleine Intensivstation, und mein Neffe wird freigestellt, um ihn dort zu betreuen. Er ist Facharzt für Kardiologie, und ich bin im Standby.«
»Geht doch nix über Familie«, sagte Anna.
»Und über Freunde«, ergänzte Struck. »Frau Kollegin, Sie haben etwas gut bei mir.«
¤
Als sie in die VIP-Suite trat, stolperte Anna fast über den Kerl mit der Kamera. Frau Petri hielt ihre Tochter im Arm und kuschelte sich, perfekt geschminkt und lipglossig lächelnd, an die breite Schulter eines Mannes, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Neue Kinder braucht das Land trug. Im rechten Winkel des »L« war ein winziger Kaffeefleck. Unfassbar, dass man den Herzinfarktpatienten für ein Fotoshooting hierhertransportiert hatte! Beim zweiten Hinsehen schien der Typ auf dem Bett allerdings deutlich jünger, doch die Preuss’sche Familienähnlichkeit war unverkennbar.
MP setzte sich aufrecht, der Kuschelpartner sprang auf und stellte sich als Schwager vor, der mal kurz gratulieren und seinem Bruder gleich ein Familienfoto mitbringen wollte. Anna reichte ihm die Hand. »Schön, dass die Familie so zusammenhält!«
Nach ein paar weiteren Klicks packte der Fotograf die Kamera ein, und beide Männer empfahlen sich. Als die Tür sich hinter ihnen schloss, erlosch MPs strahlendes Lächeln wie eine Wunderkerze im Regen, in Sekundenschnelle wurde die glückliche Mutter zur Mater Dolorosa. Das Baby legte sie im Körbchen ab. »Ich weiß, dass Sie es wissen. Struck, diese Labertasche. So ein Desaster, dieser Infarkt – und ausgerechnet jetzt.«
Anna schaltete in den Alles-wird-gut-Modus. »Das mit Ihrem Mann tut mir leid, aber er ist in den besten Händen. Dafür haben Sie sich fantastisch erholt, und Ihre süße Tochter ist auch topfit.«
Die Patientin reagierte nicht auf den Trost. »Mein Mann hatte schon länger Herzstechen; der Idiot sagte immer ›bloß keinen Arzt im Wahlkampf‹.«
Anna nahm das kleine Mädchen hoch und streichelte den flaumigen Punkerschopf. Als sie das Baby frontal zur Mutter drehte, schmatzte es einmal Richtung Mama, aber die schaute kaum hin. Anna fuhr mit dem Zeigefinger über den speckigen Nacken des Neugeborenen, legte es behutsam zurück ins Körbchen und wandte sich der Patientin zu. »Ich verstehe Ihre Sorge um den Gatten; Männer sind mitunter unvernünftig. Aber dass Ihr Mann Ihnen bei der Geburt beistehen wollte, kann man ihm ja nicht übel nehmen …«
»Natürlich nicht. Aber ich würde es durchaus übel nehmen, wenn der blöde Herzinfarkt uns die Wahl vergeigt.«
¤
Bei der weiteren Visite schienen alle Mütter glücklich, auch die Babys waren gesund. Das Zimmer ihrer neunzehnjährigen Patientin Vida da Silva aus Rio de Janeiro besuchte Anna zuletzt. Gerne nahm sie sich Zeit für den Schwatz in spanisch-portugiesisch-englischem Kauderwelsch, bei dem immer viel gelacht wurde. Sie hatte Vida nach einer Risikoschwangerschaft bei Eklampsie* vor zwei Tagen von ihrem ersten Kind entbunden, und selbst bei der stundenlangen, schmerzhaften Geburt hatte die junge Frau mit ihrem heiteren Temperament im Kreißsaal für gute Laune gesorgt.
Anna fand Vida in Tränen. Schluchzend berichtete sie, ihr kürzlich eingestelltes Kindermädchen, das in der kommenden Woche die Arbeit hätte antreten sollen, sei ganz plötzlich »doida« geworden; Vida tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. Die Nanny hatte Fieber und ein paar Tage später war sie »morta« – wohl an einer ansteckenden Krankheit gestorben, denn auch drei ihrer fünf jüngeren Geschwister waren infiziert und in kritischem Zustand. Vidas Mann hatte berichtet, die Seuche habe in kurzer Zeit elf Menschen aus Rio dahingerafft, die meisten in Rocinha, der größten Favela der Stadt.
Auf Annas Frage, ob sie Angst vor Ansteckung oder um ihr Baby habe, antwortete Vida, das sei nicht das Problem. Ihr Ehemann habe versichert, die Infektion sei ausschließlich eine Krankheit der Slumbewohner, die ihr Trinkwasser nicht abkochten.
Was dann außer der Trauer ihr Problem sei, fragte Anna.
Vida wusste nicht, wie sie allein mit dem Baby zurechtkommen sollte, ihr Mann war dauernd beruflich unterwegs. Anna versuchte zu trösten, es ließe sich doch sicher Ersatz finden?
»But not so simpática«, heulte Vida, so nette Nannys gebe es selten, sie wünsche sich ein bisschen Gesellschaft, und ihr Mann sei doch schon so alt.
Anna sah sie fragend an. Vor Kurzem war Vidas Gatte »forty anos« geworden.
¤
Zurück in ihrem Büro streckte sich Anna für ein paar Minuten im stufenlos verstellbaren Lümmelsessel aus. Eine Viertelstunde Zeit bis zur Sprechstunde. Auf dem Intelligopad fand sie das Familienfoto im Netz. Der Minister strahlend unter blutigem Kopfverband, und die Gattin mit anbetendem Augenaufschlag und verklärtem Lächeln an seine Schulter geschmiegt. Das Baby mit dem dunklen Schopf kuschelte sich an die Mutterbrust. Wie ein Krippenbild von Murillo, Maria nur nicht ganz so jung und etwas weniger unschuldig. Fehlte noch Richard Claydermans Kitsch-Klavier. Der Minister wirkte schlank, er trug das T-Shirt mit der Aufschrift Neue Kinder braucht das Land. Anna griff zur Lupe: Im rechten Winkel des »L« sah sie den winzigen Kaffeefleck. Sie speicherte das Foto in ihrem verschlüsselten Privatarchiv auf einer separaten Festplatte, die sie nach Dienstschluss zu Hause im Safe lagern würde. Sicherheitshalber.
¤¤¤
3. August
Als Teilzeitler kriegte Ben oft die Krüppelschicht. So nannten die Taxler die Krankentransporte mit alten Hybridautos – für die meisten Kollegen eine Strafe, ohne Autopilot, kaum Hightech und vor allem: weniger Trinkgeld. Nachdem die Krankenkassen die Fahrtkosten zum Arzt oder in die Klinik nur noch bei Schwangeren ersetzten, boten Taxiunternehmen den Alten und chronisch Kranken gegen Attest reduzierte Preise. Schließlich machte auch Kleinvieh Mist, und immerhin waren die Transporte steuerbegünstigt; außerdem konnten so die Autos weiterlaufen, in die sonst kein Fahrgast mehr stieg. Ben fuhr die Patienten gern, er mochte die alten Kisten, bei denen man noch mitdenken musste.
Manche Patienten mochte er auch. Herr Karliczek gehörte nicht dazu. Er war hundertdreißig Kilo schwer, rauchte Kette und litt unter allen denkbaren Zivilisationskrankheiten. Immer wenn er zum Hausarzt musste, schimpfte er über diesen kaltherzigen Quacksalber, dem nichts Besseres einfiel, als ihm die letzten Freuden des Lebens zu vermiesen. »Überhaupt, was für eine Frechheit, dass Hausärzte sich so nennen dürfen, obwohl sie seit Jahren keine Hausbesuche mehr machen!« Er motzte nonstop, bis Ben ihm einen seiner Vollkornkekse anbot. Solange Herr Karliczek kaute, war Ruhe.
Bevor Ben den nächsten Patienten abholte, deckte er die Rückbank mit Folie ab; Herr Maier, der an Lungenkrebs mit Hirnmetastasen litt, vergaß manchmal seine Pampers und nicht selten auch seinen Betrahlungstermin. Oft musste Ben mehrfach läuten, doch an diesem Nachmittag saß Herr Maier schon vor dem Haus auf dem dreckigen Bordstein und spielte Mundharmonika.
Anfangs hatte Ben geglaubt, Taxifahren sei ein kontemplativer Job, keiner, der den wesentlichen Projekten die Energie abzog: das Eigentliche zu finden, sich vom Überflüssigen zu befreien. Und sein Buch zu schreiben. Von wegen! Nach der Schicht war Ben meist abgegessen und ausgelutscht, oft auch genervt, weil er sich vom Herrenmenschentum mancher Fahrgäste noch immer ärgern ließ, umso mehr, als er selbst sich nur mit Anstrengung aus dem Überlegenheitsdenken des Elternhauses befreit hatte.
Dreimal pro Woche sechs Stunden – zusammen mit dem unregelmäßigen Einkommen als freier Journalist reichte es gerade zum Leben. Für einen Minimalisten. Gelegentlich kamen Einsätze in dem Abschleppdienst hinzu, den der Chef nebenher betrieb.
Mitunter tröstete ihn, dass sein Job sich demnächst durch die Zulassung selbstfahrender Taxis erledigen würde. Bis dahin musste er es schaffen, von der Schriftstellerei zu leben. Schreiben als Berufung, die zum Brotberuf würde; das war der Plan. Und dass der Weg steinig würde, hatte er vorher gewusst. Hold on tight to your dreams war das Lebensmotto seiner verstorbenen Lieblingstante Gerda gewesen. Nur manchmal schien ihm das Wegschaffen der Steine zu viel Kraft zu kosten, um das Ziel zu erreichen, bevor er für alles zu alt war.
Kitty war sein letzter Fahrgast des Tages – und ein Lichtblick, der seine Laune hob. Nicest nerd of the universe nannte er Frau von Kittwitz, die Sympathie beruhte auf Gegenseitigkeit: Bei der zweiten Fahrt hatte sie angekündigt, ab sofort sei sie »taximonogam« und würde nur noch mit ihm fahren. Nach einer Schulterverletzung musste Kitty zweimal pro Woche zur Physiotherapie. Mit siebzig Jahren hatte sie eine Audrey-Hepburn-Figur, und ihre großen Augen strahlten in jugendlichem Optimismus. Immer war sie akkurat geschminkt und adrett gekleidet. Bis zu ihrer Pensionierung im Vorjahr Systemanalytikerin für eine IT-Security-Firma, besserte Kitty nun ihre Rente als freie EDV-Beraterin auf. Im Darknet war sie zu Hause wie in ihrer Wohnstube und erledigte gelegentlich Recherchen für Ben, für die es spezieller Kenntnisse und Connections bedurfte. Als Zugabe zum Trinkgeld.
An seinem Leben nahm Kitty gerne, aber unaufdringlich Anteil. Beim letzten Beziehungskummer mit Svenja war ihr Trost therapeutisch gewesen. Ben hatte Svenja im Netz als Literaturbloggerin schätzen gelernt, und der digitale Austausch wurde bald auf die Matratze erweitert. Dort bereitete ihm ihre scharfe Zunge ebenfalls Wonne; alles schien bestens und in beidseitig akzeptierter Ausgewogenheit von Nähe und Distanz. Bis zu dem Tag, als er ihr das erste Kapitel seines Buches über Minimalismus zur Beurteilung anvertraute. Ihr herzloser Spott war so vernichtend, dass die Matratze umgehend zum Sperrgebiet wurde. Kitty hatte sein zerschmettertes Schreiber-Ego aufgerichtet, indem sie sagte: »Literaturkritiker kritisieren, was manche von ihnen selbst gerne wären, nämlich Schriftsteller. Und merken Sie sich eins, mein Lieber: Wenn man sich schon spitzzüngige Menschen ins Bett holt, sollte man Ihnen dort Sprechverbot erteilen.«
Kitty saß mit ihrem Pad in der Wartezone der Physio-Praxis. »Ich habe Ihren Beitrag über das Ministerbaby gelesen, diesmal haben Sie sich aber nicht besonders ins Zeug gelegt?«
Ben erzählte von der frustrierende Pressekonferenz und wie Frau Dr. Martini ihn abgebügelt hatte. Kitty lachte. »Die kenne ich, sie hat Haare auf den Zähnen, ist aber sympathisch.« Als das Kinderwunsch-Zentrum vor Jahren in Betrieb gegangen war, hatte Kitty dessen IT-Security implementiert.
Das Telefon plingte, Ben drückte auf Annahme. Kilian. Die Tomaten waren überreif gewesen, er hatte sie ernten müssen. »Kommst du zum Essen? Es gibt Nudeln mit Sugo, mein Spezialrezept.«
Nudeln mit Sugo und Gebabbel – gegen Pellkartoffeln mit Quark und Ruhe. Eins zu null für Ruhe. Ben war reif fürs Trappistenkloster und wollte noch eine Runde schreiben. Aber Kilian ließ nicht locker. »Einen guten Primitivo hab ich auch.«
Halbe Flasche Rotwein mit Gebabbel – gegen ein einziges Bier mit Ruhe. Unentschieden.
»Und zum Minister ist mir noch was aufgefallen. Da gab es ein Bild von der jungen Familie, das ist nicht ganz koscher, wenn du mich fragst. Um eine Fotomanipulation nachzuweisen, bräuchte man allerdings einen Fotoforensiker.«
Ohne nachzudenken, antwortete Ben, er würde mal seinen Fahrgast fragen, eine IT-Spezialistin. Schon zwitscherte Kitty dazwischen. »Hier spricht die Gästin. Katharina von Kittwitz. Ehemals Informatikerin, genauer gesagt IT-Security.«
Kilian schnaufte hörbar und legte maximalen Schmelz in seine Stimme: »Sehr angenehm, gnädige Frau, Kilian Georg Pichler, ehemals Germanistik und Biologie. Wenn das nicht Schicksal ist. Kennen Sie sich mit Fotoforensik aus?«
Ben verdrehte die Augen, das letzte Jahrtausend ließ grüßen, und der alte Misanthrop machte auf charmant. Aber Kitty nickte eifrig. »Na ja, ich habe da so ein Programm.«
Kilians Begeisterung waberte durch den Lautsprecher. »Darf ich Sie auch zum Essen einladen, es ist genug Sugo da. Ben soll Sie einfach mitbringen.«
»Das ist hier ein Taxi und kein Datingportal«, protestierte Ben – wohl wissend, dass er längst verloren hatte.
¤
Schon von Weitem schallte ihm das Lachen der Blind Dater entgegen. Trotz anhaltender dreißig Grad plus saßen sie auf Kilians winziger Terrasse. Klimaanlage wäre Ben lieber gewesen, nachdem er erst Kitty bei Kilian abgesetzt, dann den Hyundai in der Zentrale abgegeben und sich schließlich mit dem Fahrrad nach Hause gequält hatte.
Die beiden begrüßten ihn eher beiläufig, niemand würdigte seinen schweißtreibenden Umweg, und der Primitivo war schon halb leer. Kitty und Kilian wirkten bestens gelaunt und waren bereits per Du. Oldies beim Teenietreff statt Trappistenkloster!
»Darf man überhaupt Wein trinken, wenn man Schmerzmittel nimmt?«, fragte Ben.
»Spielverderberfrage!«, rügte Kilian. »Wenn die Gelenke nicht funktionieren, muss man erst recht die Leber trainieren.«
»Ist er nicht ein fabelhafter Dichter?«, kicherte Kitty.
Ben goss sich Rotwein ein und füllte das Glas bis zu einem unziemlichen Pegel.
Zwei Tablets lagen einträchtig nebeneinander auf dem Tisch. Kitty griff nach ihrem magentafarbenen und zeigte Ben einen Beitrag auf Twitter: Autor: KalauerKilian
Die Frau hat gelitten, das Baby ist da.
Und wer kippt prompt um? Der stolze Papa.
Ari ist hart auf den Kopf gefallen,
nun kann er nur noch grinsen und lallen.
Schon immer intelligenzgemindert,
ist er jetzt endgültig geistig behindert?
Kitty strahlte Kilian bewundernd an. Ben trank einen großen Schluck. Die psychotrope Wirkung des Primitivo setzte prompt ein, die zarte Schärfe des fruchtigen Sugo vertrieb seinen Missmut vollends. Selbst als das Gespräch irgendwann wieder beim Minister und dem Familienfoto landete, störte ihn das nicht.
»Das Foto könnte eine Fälschung sein«, erklärte Kilian und zog das Bild auf seinem Tablet groß. »Verdacht auf Photoshop-Montage. Für mein Gefühl zu viel Body für zu wenig Kopf, und der Hals ist zu kurz. Kitty, kannst du meinen Verdacht fotoforensisch bestätigen?«
»Nicht unschwierig«, meinte sie, versprach aber, zu Hause ihr Analyseprogramm über das Bild laufen zu lassen.
Als die Flasche leer war, verschwand Kilian im Castle. Kurz darauf kam er mit einem Joint zurück. Kurz angeraucht reichte er ihn an Kitty weiter. »Reines Biogras, kein genverändertes Hollandgewächs«, betonte er, und Kitty bekam leuchtende Augen: »Wie wundervoll, ein richtiger Old-School-Joint!«
Schweigend nahmen sie die ersten Züge. Kitty inhalierte genießerisch. »Schön mit euch beiden, so gut ging es mir lange nicht. Wunderbares Essen, herrlicher Wein, Biogras … dazu noch zwei Männer!«
Sie hob ihr Glas und bot Ben das Du an.
»Endlich«, sagte Ben und küsste sie zart auf die linke Wange.
Kitty umarmte ihn. »Ich bewundere dich, mein Lieber! Viele Menschen haben eine Lebenseinstellung, und wenige leben sie wirklich. Du bist der einzige praktizierende Minimalist, den ich kenne. Warum wirst du nicht politisch aktiv?«
»Weil ich weder Talent zum Lügen noch das dicke Fell habe, auf dem andere rumtrampeln können, ohne dass es wehtut.«
»Da hat er leider recht«, stimmte Kilian zu. »Mit Ehrlichkeit wird man nicht gewählt, mit Ehrlichkeit erreicht man allenfalls ein paar Idealisten, die Mehrzahl der Dummen will so belogen werden, dass sie nur sehen müssen, was sie sehen wollen.«
Schon waren sie wieder bei der Politik; Kitty und Kilian einig in allem, was wichtig war, wie Werbende, die einander mit Seelenverwandtschaft beeindrucken wollen – aber doch genügend Dissens wahren, um das Florettflirten spannend zu halten.
Ben rauchte und staunte.
Nach zwanzig Minuten ausschließlichen Zweiergespräches mit dem gemeinsamen Resümee »Der Preuss ist die Pest in Tüten« erinnerte man sich schließlich an die Präsenz eines Dritten. Kitty wandte sich an Ben. »Mein Lieber, du bist doch investigativer Journalist und Schriftsteller, mach dich doch an die Chefärztin heran und krieg heraus, wie das mit dem kollabierten Minister und der Schwangerschaft seiner Frau war. Ich kenne Mechthild Petri flüchtig aus einem Frauenclub, sie ist hochintelligent, ideenreich und pragmatisch. Sicher wäre sie eine hervorragende Politikerin, wenn sie nicht im Schatten dieses superreichen Egomanen stünde. Aber sie ist auch brandehrgeizig, und ich traue ihr jeden Betrug zu, wenn’s um den Wahlkampf des Gatten geht.«
Ben war skeptisch. Die Martini hatte ihn schon bei der PK abgebügelt.
»Schleich dich auf Umwegen an«, riet Kitty. »Behaupte, du planst ein Feature über Reproduktionsmedizin.«
»Wie das denn?«, fragte Ben.
Kitty legte die Fingerspitzen aneinander und brauchte zwanzig Sekunden. »Wie wäre es damit: Die sozialen Auswirkungen der innovativen Verfahren und neuen Rechtsverordnungen in der Fertilitätsmedizin auf die moderne Gesellschaft.«
»Moment«, sagte Ben und kritzelte Kittys Textvorschlag auf die Recyclingpapierserviette. Aus Erfahrung wusste er, wie der Biohanf seines Nachbarn die Merkfähigkeit zerbröselte.
Nach zwei weiteren Zügen hatte Ben eine Idee.
¤¤¤
4. August
Absagen war ihr erster Impuls gewesen, als die Eltern Anna zum Familienfest geladen hatten. Doch wieder hatte sie es nicht übers Herz gebracht.
Der TGV war verspätet, zumindest funktionierte bei den Franzosen die Klimaanlage, und der Schnellzug schaffte Karlsruhe–Stuttgart in sechsunddreißig Minuten. Versteppte Landschaften und abgestorbene Bäume flitzten hinter trüben Scheiben vorbei, die Augen suchten vergeblich nach Grün. Bei Mühlacker bremste der Zug auf Schleichtempo, die Personenschadenstrecke hatte schon mehreren Lokführern posttraumatische Belastungsstörungen beschert. Eine Mauer schirmte ebenerdig das Migrantenlager ab, nur von der erhöhten Bahntrasse war die Containersiedlung einsehbar. Die vormals kreischenden Pastellfarben waren verblasst und schmutzigem Grau gewichen, das die Trostlosigkeit der dicht gereihten Ansammlung kleiner Leichtbauwürfel betonte, in denen Horden von Menschen auf engstem Raum hausten. Mülltonnen quollen über, struppige Katzen wurden von mageren Hunden gejagt. Aus der Ferne ahnte man die Teilnahmslosigkeit der graugesichtigen Gestalten, die rauchend in Grüppchen auf dem staubigen Boden vor ihren Würfeln hockten und kaum aufsahen, als ein Polizeiauto langsam durch die zentrale Gasse fuhr.
Per App bestellte Anna den Perso-Guard, der sie durch den Bahnhof von Stuttgart 21 eskortierte und zum Kauf der Schoko-Maultäschle in den Souvenirshop begleitete. Auf den letzten Metern über den Bahnhofsvorplatz bis zum Taxistand hatte er die Hand am Schlagstock, dort tummelten sich Abgestürzte und Junkies, laufend kam es zu Überfällen. Die prekäre Lage hatte sich verschärft, seit Stuttgart wegen des unerträglichen Smogs den Status der Landeshauptstadt an Karlsruhe verloren hatte und die Polizei Personal reduzieren musste. Der Perso-Guard hielt Anna die Taxitür auf, gab ihr eine Visitenkarte für künftige Gelegenheiten und wünschte einen schönen Abend.
¤
Winzig stand das graue Achtzigerjahrehäuschen ihrer Eltern zwischen der sechsstöckigen Jahrtausendwende-Mietskaserne und dem Glaspalast einer Versicherung. Als der Fahrer sie vor dem Gartentor absetzte, schallte ihr kastagnettenklappernder Flamenco entgegen, die Gipsy Kings. Vater nannte das »Zigeunermusik«, aber an diesem Abend hatte Mutter sich offensichtlich durchgesetzt, das deutsche Liedgut würde später zum Einsatz kommen. Einmal mehr war Anna die Letzte und wappnete sich gegen Vaters Missbilligung. Tante Berta öffnete die Tür und sah sie mit strafendem Blick an, der sie ihrem Bruder noch ähnlicher machte. »Deine Eltern warten schon sehnsüchtig auf dich.«
Bei zweiunddreißig Grad stand die Luft stickig im Häusle, Alkoholdunst mischte sich mit Schweißgeruch, trotz reichlich Raumspray und Duftwasser. Nur vereinzelt nutzten Gäste, meist Raucher, den kleinen Garten, der mistralartige Wind war kaum angenehmer als der Wohnzimmermief. Vater hob langsam den linken Arm und sah drei Sekunden lang auf die Uhr, ehe er Anna auf die Stirn küsste. Sein zunehmender Bauch sorgte für ausreichend Abstand. Anna senkte den Kopf. »Sorry, dass ich zu spät bin, Papa, du weißt ja, das Baby der Frau Minister, und dann hatte ich noch einen Notkaiserschnitt.«
»Selbstverständlich, das kennt man ja«, antwortete er. »Und jetzt geh deiner Mutter gratulieren.«
»Zu dir?«, fragte Anna. Vater sah knapp an ihr vorbei. »Und begrüße deinen Mann, der war übrigens pünktlich.«
»Wie bitte?«, zischte Anna, insistierte aber nicht, denn ihre Mutter stöckelte in roten Schuhen mit hohen Absätzen auf sie zu. Immer war Mama stolz auf ihre schlanke Figur gewesen, mittlerweile sah sie knochig aus, ihre Haare waren noch lackschwärzer als früher, mit den Jahren nahm der Kontrast zum mittlerweile schlohweißen Haaransatz zu.
»Qué tal, mi corazón«, begrüßte sie ihre Tochter; ihr Lachen klang rauchig-sangriaschwanger, morgen würde sie wieder katerkrank sein. Ihr Bronzeteint war gerötet, und die dunklen Augen strahlten wie früher, als sie zu den Gipsy Kings oder später zu Juanes getanzt hatte, wenn sie sich allein glaubte. Anna schaute in das scharf geschnittene Gesicht ihrer Mutter, in der Jugend eine mediterrane Schönheit, nun furchig verhärmt; stets aufs Neue fürchtete Anna diesen Blick in den Spiegel von übermorgen.
»Herzlichen Glückwunsch zur goldenen Hochzeit, Mama.« Anna umarmte sie und zog den Gutschein aus der Tasche. Zehn Tage Hurtigruten, mit dem Postschiff von Bergen nach Kirkenes, einer der wenigen Reiseträume, die ihre Eltern teilten. Mama küsste sie auf beide Wangen. »Muchísimas gracias, Cariño«, sagte sie und gab den Umschlag zurück, ohne ihn zu öffnen. »Leg ihn auf den Gabentisch zu den anderen Geschenken.«
Dann schwebte sie weiter, drehte sich aber noch einmal zu ihrer Tochter um.
»Es ist dir doch recht, dass ich Joschi eingeladen habe? Ist schließlich ein Familienfest, und da gehört dein Mann ja dazu.«
»Ex-Mann!«, korrigierte Anna reflexartig.
»Schlimm genug«, konterte die Mutter. »Wo er damals so treu zu dir gehalten hat.«
Irgendwann würde sie ihren Eltern erzählen, dass es zwei »damals« gab, von denen sie nur eines kannten. Aber nicht heute. »Du hättest mich vorher fragen können.«
Ihre Mutter schüttelte unmerklich den Kopf. »Ist zwar dein Ex-Mann, Chiquita. Aber meine goldene Hochzeit!«
Anna stopfte den Gutschein in die Tasche zurück und ließ sie zuschnappen. »Ich bin eben nicht so leidensfähig wie du – schon gar nicht fünfzig Jahre lang.«
Sie sah ihre Mutter zusammenzucken und wartete auf den Konter. Doch dann kam nur: »Nimm dir Sangria.«