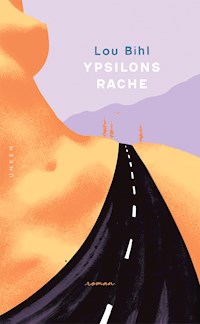Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unken Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Roman handelt vom Sterben und feiert das Leben. Er erzählt von Freundschaft bis zum letzten Atemzug – und über die Macht der Liebe und Erotik angesichts des Todes. Als Marlene mit Anfang fünfzig unheilbar an Krebs erkrankt, ist sie fest entschlossen, die verbleibende Zeit mit dem Mann ihres Lebens intensiv zu genießen. Doch dafür braucht sie die Option, selbstbestimmt zu sterben, falls ihr Leiden unerträglich wird. Mit diesem Anliegen stürzt sie Helena, ihre langjährige beste Freundin und behandelnde Ärztin, in innere Konflikte. Gemeinsam und mitunter kontrovers setzen sie sich mit den ethischen, rechtlichen und menschlichen Aspekten von assistiertem Suizid und Sterbefasten auseinander. Für die Ärztin und Palliativmedizinerin Helena werden selbstbestimmtes Sterben und assistierter Suizid unverhofft zum persönlichen Thema, als ihre beste Freundin Marlene auch ihre Patientin wird. Sie leidet unter einer besonders bösartigen Form von Brustkrebs, kurz nach der Erstbehandlung lassen Metastasen die Hoffnung auf Heilung schwinden. Die lebenslustige Marlene ist entschlossen, ihr Dasein und die Liebe noch einmal bis zur Neige auszukosten. Doch sie bittet Helena, ihr als letzten Freundschaftsdienst einen assistierten Suizid zu Hause zu ermöglichen, falls der Krebs ihre Lebensqualität in unerträglichem Maße mindern sollte. Sie hatte dies schmerzlich bei ihrer Zwillingsschwester erlebt, die wegen einer unheilbaren Nervenerkrankung Sterbehilfe in der Schweiz suchte, da eine Suizid-Assistenz in Deutschland nach § 217 StGB strafbar ist. Diese Rechtslage stellt auch Helena vor ein Dilemma. Doch dann setzt das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen außer Kraft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Nichts macht so heiß auf das Leben wie der Tod.“
Als Marlene mit Anfang fünfzig unheilbar an Krebs erkrankt, ist sie fest entschlossen, die verbleibende Zeit mit dem Mann ihres Lebens intensiv zu genießen. Doch dafür braucht sie die Option, selbstbestimmt zu sterben, falls ihr Leiden unerträglich wird. Mit diesem Anliegen stürzt sie Helena, ihre langjährige beste Freundin und behandelnde Ärztin, in innere Konflikte. Gemeinsam ringen sie um die ethischen, rechtlichen und menschlichen Probleme der Suizidassistenz.
Der Roman handelt vom Sterben und feiert das Leben. Er erzählt von Freundschaft bis zum letzten Atemzug – und über die Macht der Liebe und Erotik angesichts des Todes.
Für die Ärztin und Palliativmedizinerin Helena werden selbstbestimmtes Sterben und assistierter Suizid unverhofft zum persönlichen Thema, als ihre beste Freundin Marlene auch ihre Patientin wird. Sie leidet unter einer besonders bösartigen Form von Brustkrebs, kurz nach der Erstbehandlung lassen Metastasen die Hoffnung auf Heilung schwinden.
Die lebenslustige Marlene ist entschlossen, ihr Dasein und die Liebe noch einmal bis zur Neige auszukosten. Doch sie bittet Helena, ihr als letzten Freundschaftsdienst einen assistierten Suizid zu Hause zu ermöglichen, falls der Krebs ihre Lebensqualität in unerträglichem Maße mindern sollte. Sie hatte dies schmerzlich bei ihrer Zwillingsschwester erlebt, die wegen einer unheilbaren Nervenerkrankung Sterbehilfe in der Schweiz suchte, da eine Suizid-Assistenz in Deutschland nach §217 StGB strafbar ist. Diese Rechtslage stellt auch Helena vor ein Dilemma. Doch dann setzt das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen außer Kraft.
Lou Bihl wurde 1951 in Freiburg geboren.
Sie ist Ärztin und Verfasserin zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Buchbeiträge. Die langjährige Betreuung von Krebspatienten verschaffte ihr Einsicht in unterschiedliche Fachbereiche der Medizin, vor allem aber in die Komplexität der menschlichen Psyche.
Seit dem Rückzug ins Privatleben widmet sie sich dem literarischen Schreiben. Nicht tot zu sein, ist noch kein Leben ist ihr vierter Roman nach Ypsilons Rache, Amazonah, Putin im Wartezimmer und dem Kurzgeschichtenband Ohne Befund.
www.unken-verlag.de
Umschlag: Daniel Horowitz
Foto: Pavel Komyakov
Lou Bihl
Nicht tot zu sein, ist noch kein Leben
Roman
U N K E N
In Nicht tot zu sein, ist noch kein Leben sind sämtliche Ereignisse und handelnden Personen frei erfunden. Die medizinischen und juristischen Aspekte sind faktentreu recherchiert und lassen sich anhand des Quellenverzeichnisses nachvollziehen.
Impressum
Erste Auflage 2025
Umschlag und Illustration: Daniel Horowitz
Lektorat: Dr.Felicitas Igel
Korrektorat: Viola Diehl
Satz: fotosatz griesheim GmbH
Gesetzt aus PT Serif
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
Print-ISBN 978-3-949286-13-1
E-Book-ISBN 978-3-949286-14-8
»Wie bei einem Theaterstück kommt es im Leben nicht darauf an, wie lange es dauert, sondern wie gut es gespielt wird.«
Inhalt
November 2024
1988 – 1994
1996 – 2005
2009 – 2017
2018 – 2020
2020 – 2021
2022 – 2023
November 2024
Nachwort und Dank
Glossar
Quellen
Medizin
Literatur allgemein
Assistierter Suizid und Rechtsprechung
November 2024
Die Gestalt des Mannes, der mir auf dem Markt die letzte Pomelo wegschnappt, wirkt vage bekannt. Wie eine Melodie, die in der Tiefe des Bewusstseins eine Schwingung erzeugt, obwohl mir der Titel entfallen ist. Mein Puls stockt, als mich der Hund mit dem verknautschten Kopf und den Glupschaugen in freundlicher Wiedererkennung anbellt – Bushido, der Boston Terrier. Sein Herrchen dreht sich um und blinzelt in die Novembersonne.
Julian! Komplize und einziger Zeuge meiner Leiche im Keller, die sich, tief vergraben, selbst konserviert.
Anderthalb Jahre seit ich ihn zuletzt sah, am 14.Mai 2023 – für mein viszerales Selbst gerade erst gestern. Seit damals ist er nicht jünger geworden, wirkt aber vitaler, sein Gesicht zwar scharf geschnitten, aber nicht mehr verhärmt. Die sportliche Hagerkeit eines trainierten Läufers zeigt um die Körpermitte etwas kompaktere Konturen, seine Mähne ist grau geworden, doch sonst sieht man ihm seine fünfzig kaum an.
Als auch er mich erkennt, strafft sich Julians Gestalt und ein schalkhaftes Grinsen wischt ihm Jahrzehnte aus dem Gesicht. Bei seinem freundlich taxierenden Blick fühle ich mich wieder wie ein Insekt unter dem Mikroskop. Bei ihm keine Spur der aufgewühlten Verlegenheit, die ich selbst zu überspielen versuche.
»Dass ich das noch erleben darf!«, sagt er mit der Rapperstimme, die, wie auch die Bomberjacke, nicht zur elaborierten Sprache passt. Meine ausgestreckte Hand ignoriert er und umarmt mich ohne Zögern, kurz, aber kraftvoll. Er riecht nach frischen Algen und Leder. Leider löst er sich nach fünf Sekunden, hält mich auf Armeslänge und legt den Kopf schief. »Schöne Helena, die Prämenopause steht dir super.«
Kompliment oder Unverschämtheit? Julian kennt mein Baujahr, ich bin drei Monate älter als seine frühere Frau. Bevor mein verlangsamtes Hirn eine Replik findet, fragt er, seit wann ich in diesem Stadtteil den Markt besuche, wo er selbst regelmäßig einkaufe, mich aber hier noch nie gesehen habe – leider.
Froh über die Chance, in unverfänglicher Konversation die Fassung wiederzufinden, plappere ich los: »Refresherkurs Palliativtherapie. Ich nutze die Mittagspause, um über den Markt zu schlendern; in meinem Vorort gönne ich mir das selten, da laufen mir immer Patienten über den Weg. Ganz kurz, Frau Doktor – und zack bin ich in eine Konsultation verwickelt.«
Julian nickt grinsend. »Darf auch ich Frau Doktor ganz kurz konsultieren?«, fragt er. »Natürlich als Privatpatient und nicht auf dem Markt, meine Stammkneipe ist gleich um die Ecke?«
Reflexhaft wehre ich ab. »Sorry, ich habe nur noch zehn Minuten, bis mein Kurs weitergeht.«
In Julians Achselzucken liegt Resignation, noch einen Korb wird er sich nicht holen. »Schade«, meint er, »es gäbe so viel, das ich dir sagen möchte, seit damals. Aber dein Leb wohl ließ mir keine Chance.«
Ich bereue meinen Fluchtinstinkt und fasse mir ein Herz. »Mein Kurs geht bis 18Uhr. Danach hätte ich ein bisschen Zeit; den Gesellschaftsabend wollte ich sowieso schwänzen.«
»Prima, dann hol ich dich ab.« Dieses Lächeln! Die Fältchen kräuseln sich tiefer um Julians heterochrome* Augen – die linke Iris gletschergrün, rechts bernsteinfarben mit dunkelbraunen Einsprengseln.
Wir plaudern noch ein paar Takte Belangloses, von dem ich nichts erinnere, seine Fragen habe ich wohl mechanisch beantwortet. Dann mache ich mich auf den Weg, finde es korrekt, aber bedauerlich, dass er mich nicht nochmals zum Abschied umarmt und nur lässig die Hand hebt. »See you.«
Die Zeit bis sechs Uhr abends erscheint mir sehr lang.
◊
Ich verlaufe mich auf dem Rückweg zum Messezentrum, komme an einer Boutique vorbei und kaufe spontan ein sündhaft teures Shirt aus Kaschmirseide, türkisfarben, in Wasserfalloptik.
Im Seminar rauscht der Vortrag über neue Schmerzmittel-Stufenpläne an mir vorbei, ebenso die Bedeutung der Supervision für palliativ tätige Ärzte. Einzig das Thema Rechtsprechung beim ärztlich assistierten Suizid vermag mich zu fesseln.
Stolz betont der Referent, vor seinem Jurastudium Krankenpfleger gewesen zu sein. Er erläutert die Rechtslage in den europäischen Nachbarländern und das Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020, nach dem der assistierte Suizid für Ärzte unter Auflagen wieder straffrei wurde.
Das kenne ich bereits, hatte es oft genug diskutiert. Die Aufmerksamkeit driftet ab, vaporisiert von der Begegnung auf dem Markt: Julian, Lenes Mann, der sie liebevoll und selbstlos durch Krankheit und Sterben begleitete. Der mich noch immer verwirrt. Meine hirnlose Plapperei, meine Abwehr, das willenlose Einknicken. Mein Weglaufen damals – ohne Chance zur Freundschaft.
Die Aufmerksamkeit kehrt zurück, als der Jurist von einem Prozess berichtet, der im Frühjahr durch alle Medien gegangen war. »Zwar ist der Vorfall nicht repräsentativ, doch er zeigt exemplarisch, dass durch die Legalisierung der Suizidassistenz eine Grauzone entstanden ist, die zu fatalem Missbrauch verleiten kann.«
Ein 72-jähriger Hausarzt im Ruhestand hatte assistierte Sterbehilfe bei einer 37-Jährigen geleistet, die, mutmaßlich im Rahmen einer bipolaren Störung*, unter wiederkehrenden depressiven, mitunter auch suizidalen Episoden litt. Nur neun Tage nach dem ersten Gespräch verabreichte er der Patientin oral das kardiotoxische* Malariamedikament Chloroquin* in Kombination mit dem Beruhigungsmittel Diazepam*. Durch Erbrechen scheiterte der Versuch.
Die Patientin wurde daraufhin stationär in der Psychiatrie behandelt. In der Folge schwankte sie mehrfach kurzfristig zwischen dem Wunsch zu sterben und dem Vorsatz, ihr Leben wieder aktiv zu gestalten – wie selbst noch am Tag ihres Todes. Diese Ambivalenz kommunizierte sie telefonisch auch regelmäßig dem Angeklagten. Am Ende des stationären Aufenthaltes hatte sie sich endgültig entschieden: Sie wollte sterben und verabredete mit dem Angeklagten einen zweiten Anlauf, nun mit intravenöser Gabe des Barbiturats* Thiopental*. Die Patientin äußerte massive Ängste vor einem erneuten Scheitern des Suizidversuchs und drängte den Arzt, ihr bei Bedarf eine weitere Dosis nachzuspritzen. Vor Gericht räumte der Arzt eine entsprechende Zusage ein, gegeben jedoch nur, um die Patientin zu beruhigen.
In einem Hotelzimmer legte ihr der Angeklagte einen venösen Zugang für Thiopental als Infusion. Das Rädchen zum Öffnen des Infusionsschlauches betätigte die junge Frau selbst und starb kurz danach.
Zu seiner Motivation gab der Angeklagte vor Gericht an, es sei für ihn ein Gebot der Humanität und christlichen Nächstenliebe, Menschen, für die das Leben nur noch Leid und Qual bedeute, durch einen friedlichen Tod zu erlösen.
Im April 2024 verurteilte das Landgericht Berlin den Angeklagten zu drei Jahren Haft wegen Totschlags. In der Urteilsbegründung wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass die Fähigkeit der Patientin, realitätsgerecht zu entscheiden, aufgrund der akuten Depression beeinträchtigt und ihre Entscheidung angesichts der kurzfristigen Schwankungen nicht von der erforderlichen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen war. Außerdem hatte der Angeklagte dadurch auf die Entscheidung Einfluss genommen, dass er ihr – auch wenn er das tatsächlich nie vorgehabt haben mochte – versprach, erforderlichenfalls »nachzuhelfen«.
Der Referent schloss seine Präsentation mit der Bemerkung: »Das BVerfG-Urteil von 2020 hat Straffreiheit für Ärzte geschaffen, die – unter Einhaltung bestimmter Vorgaben – Patienten den Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben erfüllen. Doch wie ich eingangs erwähnte, entstand hier auch ein Graubereich, in dem Machtmissbrauch nicht nur Patienten das Leben kosten, sondern auch die ärztliche Assistenz beim Suizid in Verruf bringen kann.«
Mit einer Ausnahme befürworten alle das Urteil.
Ich habe Lenes Stimme noch im Ohr, auch sie hat damals ähnlich argumentiert. Damals, als sie mich um Suizidassistenz bat und in innere Konflikte stürzte. Lene, der ich helfen wollte, wo ich konnte, es so aber nicht zu können glaubte.
Kaum zu fassen, dass Lene nicht mehr in meinem Leben ist – schon so lange, obwohl es mir so vorkommt, als wäre sie gestern noch da gewesen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich das leise Lächeln in ihrem wächsernen Gesicht beim Transit vom Leben zum Tod. Und dann ihr lebenssprühendes Lachen in der Zeit als Studienanfängerin. Daran halte ich mich fest.
◊
1988 – 1994
Nach ergebnisloser Besichtigung von gefühlt fünfzig Wohnklos machte die Zusage des Studentenheims mich froh. Das Zimmer war klein, aber mein. Es hatte zwar keine eigene Kochgelegenheit, dafür war der Mietpreis moderat. Und nirgends lernte man leichter Menschen kennen – wichtig für mich als Studienanfängerin in der Phase des Flüggewerdens, des Abschieds von der heimischen Geborgenheit.
Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich meine Zimmernachbarin in der Stockwerksküche traf, wo sie die versiffte Kochplatte schrubbte. »Ich bin Marlene Dietrich«, stellte sie sich vor, »aber alle nennen mich Lene.«
Mir blieb der Mund offen, dann erwiderte ich prustend: »Mich auch fast, mein Taufname ist Helena, und mich nennen sie Lena.«
Wir wollten nicht nur beide Spaghetti kochen, sondern stammten auch aus derselben Stadt und waren fast gleichaltrig. Die Kochzutaten warfen wir zusammen, das Resultat war eine deutliche Optimierung des Sugo durch Lenes Spezialkräutermischung und mein griechisches Olivenöl. Dazu leerten wir eine Flasche Rotkäppchensekt, allerdings ungekühlt, was wir mit reichlich Eiswürfeln kompensierten.
Lene studierte bereits im zweiten Semester, kannte sich also schon aus – sowohl im Wohnheim als auch in der Stadt. Sie bot an, mir alles zu zeigen und mich auf Partys mitzunehmen. Lene war es gewohnt, von Männern umschwirrt zu werden wie von Motten im Licht, und ich schwebte gerne mit. Wo immer sie auftauchte, hatte sie einen Auftritt. Zwar kam ich mir fast unscheinbar neben ihr vor, genoss es jedoch sehr, dass wir als Duo durch den äußerlichen Kontrast Aufmerksamkeit erregten: Lene, blond, mit sportlicher Jane-Fonda-Figur – ich selbst dunkelhaarig und von eher kurviger Gestalt. Zu meiner heimlichen Freude behauptete Lene, sie sei neidisch auf mein Brust-Arsch-Volumen. Wie gerne hätte ich mit ihrer kalorienresistenten Schlankheit getauscht!
In Sachen Selbstbewusstsein war ich hoffnungslos im Hintertreffen – auch durch mein Hasenscharten-Trauma. Trotz früher operativer Erstkorrektur hatte ich mir über die gesamte Kindheit und Pubertät immer wieder gemeine Kommentare über meine Lippenspalte anhören müssen, von denen Fugenfresse noch freundlich war. Erst mit siebzehn Jahren durfte ich im zweiten Anlauf ein Wunder der plastischen Chirurgie erleben: Der HNO-Chefarzt eines spezialisierten Zentrums machte sowohl die Spalte als auch die Vernarbung fast unsichtbar. Dennoch spürte ich bei Aufregung noch ein Bitzeln in der Oberlippe und war überzeugt, meine ehemalige Entstellung trete in diesen Momenten wieder aufdringlich zu Tage. Lene brachte mein Herz zum Schmelzen, als sie meinte, wenn man genau hinschaue, betone die minimale Narbe sogar die Sexiness meines herzförmigen Mundes.
Man nannte uns das doppelte Lenchen, und wir ließen es krachen, soweit mein Gewissen das erlaubte. Ich nahm das Medizinstudium ernst; Ärztin zu werden, war mein Traum. Auch wusste ich, dass die Finanzierung meinen Eltern nicht leichtfiel. Als städtische Verwaltungsangestellte mit anderthalb Stellen im einfachen Dienst lag ihr Einkommen nur knapp über der BAföG-Grenze. So fühlte ich mich verpflichtet, zu liefern und die Approbation schnellstmöglich zu erlangen. Der Einfluss meiner neuen Freundin war diesbezüglich eher kontraproduktiv, da Lene die Studienzeit als letzte Gelegenheit sah, sich im Intervall zwischen den Zwängen von Schule und Beruf auszutoben. Sie war für Journalistik und Pharmazie immatrikuliert, Letzteres eher pro forma, als Zugeständnis an ihre Eltern, die eine große Apotheke betrieben und hofften, ihre Tochter würde das lukrative Geschäft irgendwann übernehmen. Lene schwebte eher eine Karriere als Investigativ- oder Kulturjournalistin vor, sie hatte aber nicht den Mut, ihren Oldies den Herzenswunsch endgültig abzuschlagen. Zu deren tiefem Kummer kam Antonia, Lenes Zwillingsschwester, als Nachfolgerin nicht infrage, da sie trotz hoher Intelligenz wegen eines schweren ADHS* nur mit Ach und Krach das Abitur geschafft hatte.
Im ersten Studienjahr waren unsere Tage vom Studienplan getaktet, den ich penibel, Lene eher locker einhielt. In der freien Zeit waren wir unzertrennlich und hatten ähnliche Interessen. Wir teilten fast alles, auch die meisten unserer kleinen Geheimnisse. Im Gegensatz zu mir hatte Lene ein Faible für Astrologie und war überzeugt, unsere Freundschaft sei unter anderem deshalb so harmonisch, weil sie als Zwilling und ich als Fisch – gerade durch unsere Verschiedenheit – die perfekt komplementären Charaktereigenschaften in die Beziehung einbrachten.
Beide hatten wir eine beste Freundin gesucht und nun gefunden. Beide mochten wir Spaß mit Männern, aber noch keine feste Beziehung. Ich hielt mich eher an Kommilitonen, Lene hatte ein Faible für etwas ältere Typen und schleppte gelegentlich einen Dozenten ab. Wir hielten uns strikt an Safer Sex, Ende der Achtzigerjahre war AIDS als Bedrohung allgegenwärtig und die HIV-Infektion noch ein mittelfristiges Todesurteil. Gemeinsam machten wir erste Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen, doch die Grenze zu harten Drogen überschritten wir nie, und intravenösen Gebrauch lehnten wir strikt ab.
Unsere Innigkeit erlitt den ersten Knacks, als Ingo auftauchte – ein Informatikstudent, kein Nerd, Surfer-Body und Besitzer einer Chevrolet Corvette, die er Gerüchten zufolge als Model für Herrenunterwäsche finanzierte. Ingo galt als notorisch beziehungsunfähiger Womanizer, verstand es aber, jeder Neueroberung die Illusion zu vermitteln, sie habe die Chance, ihn erstmals zu domestizieren. So auch mir, und ich träumte vom Neid meiner verlassenen Vorgängerinnen.
»Arschloch, aber sexy«, kommentierte Lene knapp. Ihre Einschätzung traf mich im Innersten, obwohl ich felsenfest überzeugt war, sie müsse sich ausnahmsweise irren. So behielt ich meine Verknalltheit für mich und antwortete nur lässig: »Bei mir benimmt er sich bis jetzt tadellos.«
Lachend bot mir Lene an, seine Treue zu testen.
Lachend nahm ich die Wette an.
Wenig später war Ingo ohne Ankündigung aus meinem Leben verschwunden, damals nannte man das noch nicht Ghosting. Kurz danach erzählte mir Lene unbefangen, sie habe Sex mit Ingo gehabt, der im Bett nicht schlecht, aber ein typischer Nachtischmann sei. »War kurz mal ganz süß, macht aber schnell satt.«
»Fand ich auch«, log ich und mein Bauch fühlte sich an, als würde mir ein Knäuel rostigen Stacheldrahtes ins Zwerchfell gerammt. Ohne es zu wollen, war Lene gelungen, wovon ich heimlich geträumt hatte: Ingos Promiskuität in eifersüchtige Anhänglichkeit zu verwandeln.
Doch für Lene war Ingos Metamorphose zum Spießer langweilig. Zeitnah servierte sie ihn ab.
Objektiv betrachtet gab es für mich nichts zu verzeihen, subjektiv verzieh ich nichts. Unsere Bindung bröselte konfliktfrei, doch kontinuierlich. Dass wir nie darüber sprachen, verstärkte die Distanz und machte es zunehmend unmöglich, die Spirale zu durchbrechen.
Drei Monate später klopfte Lene mit einer Flasche Sekt an meine Tür, um mir verlegen mitzuteilen, dass sie demnächst in ein komfortableres WG-Zimmer umziehen werde. Ich bekundete artig mein Bedauern, was nicht mal gelogen war.
Durch den gemeinsamen Bekanntenkreis trafen wir uns nach Lenes Umzug recht oft, verabredeten uns gelegentlich auch zu zweit, was mit der Zeit jedoch seltener wurde. Ich schrieb in mein Tagebuch: Ich mag sie noch immer, aber ich liebe sie nicht mehr.
Im dritten Studienjahr wurde es Lene in unserer Stadt zu langweilig, sie wechselte nach Berlin. Dort traf ich sie nur noch einmal anlässlich ihrer Examensfeier. Wenig später zog sie nach San Francisco, wo sie aufgrund der besonderen Qualifikation durch ihr Doppelstudium in Journalistik und Pharmazie einen lukrativen Job als Pressesprecherin einer Pharmafirma für Gentechnik ergattert hatte.
◊
1996 – 2005
Wir schrieben uns zu Weihnachten und Geburtstagen. Kaum konnte ich es glauben, als ich nur zwei Jahre später eine Karte mit protzigem Goldrand und geprägten rosa Orchideen bekam.
5/18/1996
You are invited to the wedding of
Dr.Jeremy D. Campbell & Marlene Dietrich
Auf der Büttenpapier-Einlage stand:
San Francisco, 2.4.1996
Liebe Lena,
Du musst BITTE zu meiner Hochzeit kommen! Ich weiß, es ist ein bisschen kurzfristig, aber Jeremy wollte unbedingt im Frühling auf Martha’s Vineyard heiraten und es war der einzig freie Termin. Mein Zukünftiger ist der tollste Mann der Welt, leitender Manager der Firma und endlich mal ein Erwachsener! Sieht aus wie eine Mischung aus Brad Pitt und Pierce Brosnan, aber viel jünger als seine 38Jahre. Er ist superschlau (Harvard!!), wahnsinnig witzig und total romantisch. Ich weiß, ich habe immer gesagt, ich heirate nie oder frühestens mit 30, aber so einen kriege ich nie wieder. Die gesamte weibliche Belegschaft beneidet mich glühend um den begehrtesten Junggesellen der Firma. Und vielleicht werde ich später PR-Chefin des Konzerns, dann kann ich mit ihm die ganze Welt bereisen.
Ich umarme Dich, hoffentlich bis bald
Deine glückliche Lene
Ich sagte ab. Mit Bedauern. Wegen des straffen Dienstplans als junge Assistenzärztin und der Kurzfristigkeit ihrer Einladung. Mein Budget erwähnte ich nicht, und schon gar nicht mein Befremden. Energisch verdrängte ich eine kurze Anwandlung von Neid.
Lene schickte Hochzeitsfotos, wir schrieben uns weiter zu den üblichen Anlässen. Anfangs schwärmte sie vom gemeinsamen Glück, dann wurden die Infos spärlicher, was mir zwar auffiel, doch da mein eigenes Berufsleben ereignisreich war, dachte ich nicht weiter darüber nach.
Der Kontakt wurde wieder etwas enger, als wir begannen, uns per Mail auszutauschen. Lene war immer eine Briefschreiberin gewesen, was man auch ihren Mails anmerkte.
◊
Marriage ist Mist
23.
12.
1998, 01:34
Von: [email protected]
My Dear, here comes my poem:
Merry Christmas und Happy New Year –
ich hoffe, es geht dir besser als mir!
Sei froh, dass du Single bist! Ich fürchte, auch ich werde das bald wieder sein. Jeremy, mein Göttergatte (this is exactly how he views himself!), war ein Traummann bis zur Eheschließung. Es war hinreißend, wie er um mich warb, seine Komplimente waren charmant, ich sei nicht nur schön, sondern überaus begabt – und hätte eine steile Karriere vor mir. Er versprach, mich zusätzlich zu pushen.
Obwohl ich darauf bestanden hatte, meinen Nachnamen zu behalten, wurde ich für ihn nach der Hochzeit zu Mrs.Jeremy Campbell. Die er zunächst noch auf Händen trug. Ich glaube, dass er mich sogar liebte, aber er ist eifersüchtig und besitzergreifend – was, wie du weißt, für mich das Gegenteil von Liebe ist. Er mag es schon nicht, wenn ich beruflich ohne ihn unterwegs bin, privat aber noch weniger. Gesellschaftliche Verpflichtungen betrachtet er als Gattinnenpflicht und erwartet selbstverständlich, dass ich bei Einladungen für Geschäftsfreunde nicht nur alles organisiere, sondern auch als dekoratives Eheweibchen repräsentiere und bitte nicht zu viel widerspreche. Da ich heftig in ihn verknallt war, habe ich zunächst alles klaglos mitgemacht, gestehe auch, dass ich den glamourösen äußeren Rahmen (7-Zimmer-Villa mit Pool, Haushälterin etc.) durchaus genoss.
Du findest das blöd, aber eigentlich hätte ich es wissen müssen: Jeremy ist Skorpion – und der harmoniert nun mal nicht mit Zwillingen.
Die Probleme ließen sich nicht mehr verdrängen, als J. nach einem halben Jahr von mir verlangte, meine Hormonspirale zur Verhütung entfernen zu lassen. Leider hatte er mir vor der Hochzeit sein dringendes Bedürfnis verschwiegen, möglichst umgehend die kostbaren Campbell-Gene an mindestens drei (!) Sprösslinge weiterzugeben. Schließlich war er bei der Hochzeit schon 38Jahre alt. Wir hatten zwar über Kinder gesprochen, ich war auch nicht prinzipiell abgeneigt, wollte aber erst später welche. Mit 26Jahren fühlte ich mich noch nicht bereit für die Mutterschaft, außerdem liebte ich meinen Job und hatte durchaus Erfolg. Also versuchte ich, einen Deal mit J. zu machen: Mit 29Jahren würde ich die Spirale ziehen lassen. Er handelte mich runter auf 28Jahre. Pünktlich zu meinem Geburtstag bestand er darauf, hatte sogar bereits einen Termin bei einer befreundeten Gynäkologin für mich vereinbart. Ich hatte es versprochen und Versprechen bricht man nicht (!). Um Zeit zu gewinnen, habe ich den Termin wahrgenommen. Da ich schon ahnte, dass er nicht der Mann ist, mit dem ich Kinder will, besorgte ich mir heimlich bei einem anderen Frauenarzt ein Rezept für die Pille.
Idiotischerweise hat Jeremy die Tabletten gefunden, zu Hause hatte ich sie gut versteckt, aber auf einem Weekend-Trip einfach ins Kosmetik-Necessaire gestopft.
Nun fährt er über Weihnachten ohne mich zu seinen Eltern, um sich über alles klar zu werden. Ich habe den ganzen Rummel um das Fest der Liebe ja schon immer gehasst. Aber ganz allein in einer 7-Zimmer-Villa? Und natürlich hat das Personal Urlaub. Na ja, besser als allein in einer Wellblechhütte im Slum …
I’ll keep you posted.
Luv, Lene
Ich war fassungslos. Ausgerechnet Lene, die immer alle Kerle im Griff hatte. Ich wünschte ihr alles Gute und empfahl ihr dringend, den narzisstischen Yuppie in die Wüste zu schicken. Heimlich hoffte ich, sie würde dann vielleicht zurückkehren.
◊
Single again
10.
05.
1999, 01:34
Von: [email protected]
My Dear, du siehst schon am Betreff, was passiert ist. Erstens: Ich wurde letzte Woche geschieden. Zweitens: Ich fürchte, ich bin erwachsen geworden.
Nachdem Jeremy über Weihnachten vom Familienclan darin bestärkt worden war, meine Gebärunwilligkeit sei einer Gattin unwürdig, hatte er es unheimlich eilig, sich scheiden zu lassen. In Kalifornien geht das schnell, wenn man weniger als fünf Jahre verheiratet ist und keine Kinder hat.
In der Firma verbreitete sich die Nachricht von unserer Trennung wie ein Lauffeuer. Jetzt bedenkt mich die weibliche Belegschaft nicht mehr mit Neid, sondern mit hämischem Mitleid, verbrämt als Empathie. Auch von Karriere ist keine Rede mehr, zumindest nicht in dieser Firma, aber ich habe mich schon bei der Konkurrenz beworben und bin in vielversprechenden Verhandlungen. Ich glaube, auf Dauer hält mich in San Francisco nichts, meine Freunde waren überwiegend seine Freunde, und wie das so ist, bin ich seit der Trennung ziemlich allein.
Immerhin ist J. nicht geizig, er hat eine hübsche kleine Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung in Fisherman’s Wharf, dort lässt er mich erst einmal mietfrei wohnen, das könnte ich mir sonst nie leisten.
Lena, ich vermisse dich und wünsche mir so sehr, mit dir zu reden – so wie früher. Ich will dich nicht anjammern, aber vielleicht ein bisschen brainstormen, wie es weitergeht für mich. Du bist ja schon auf einem klar vorgezeichneten Weg, darum beneide ich dich manchmal!
Hier mein Vorschlag: Lass uns zusammen San Francisco auf den Kopf stellen, solange ich noch hier bin. Wir können das Meer genießen, frischen Hummer essen, durch Haight-Ashbury schlendern, auf den Spuren von Armistead Maupins Stadtgeschichten wandeln. Außerdem können wir mit meinem Mustang Cabrio Ausflüge machen, es gibt hier so viel Schönes zu sehen …
Ich würde dich zu diesem Trip gerne einladen, über unsere Marketingabteilung kriege ich verbilligte Flugtickets.
Pleeease!
Luv, deine Lene
Ich hatte Lust und auch Glück: Gerne tauschte eine Kollegin ihren Urlaub, da ihr der Reisepartner abhandengekommen war. Voller Vorfreude kaufte ich die Stadtgeschichten von Armistead Maupin und den Baedeker Kalifornien. Meine Begeisterung erfuhr einen kleinen Dämpfer, als Lene mir schrieb, mein Aufenthalt werde sich in den ersten drei Tagen mit einem Besuch ihrer Schwester überschneiden.
◊
Auf dem Airport in San Francisco kamen Lene und Antonia Hand in Hand auf mich zu. Antonia wirkte attraktiver als damals in der Studienzeit. Rein äußerlich waren die zweieiigen Zwillinge so verschieden, wie Geschwister nur sein können: Marlene, die personifizierte Weiblichkeit, lange blonde Locken, Toni, eher androgyn mit kurzen dunklen Haaren, einem scharf geschnittenen Gesicht und blitzenden Augen. Auch vom Temperament her waren sie grundverschieden: Marlene ehrgeizig und zielstrebig, Antonia genialisch unstet, immer voller Pläne und Projekte, die sie selten zu Ende brachte – unter anderem ihrem ADHS geschuldet. Lene mochte Männer, Toni liebte Frauen.
Bei aller Unterschiedlichkeit hielten die beiden zusammen wie Pech und Schwefel, wann immer es darauf ankam. Minuten früher geboren, fühlte sich Lene als ältere Schwester, die ihre Kleine beschützen musste, was Toni nicht immer schätzte, sondern oft als Einmischung empfand und sie dann als Manipulene beschimpfte. Letztlich rauften sie sich aber doch meist zusammen, häufig half Lene ihrer Schwester aus der Patsche, wenn die mal wieder in eine Katastrophe geschlittert war. Kürzlich hatte Toni sich überreden lassen, als Teilhaberin in die Flora’s Flower-Boutique ihrer aktuellen Lebensabschnittsgefährtin einzusteigen.
Nach wenigen Monaten ging der Laden pleite, was auch dem Lebensabschnitt ein Ende bereitete und Tonis Finanzen in den tiefroten Bereich brachte.
Nach der floralen Trennung war Toni zu ihrer Schwester nach San Francisco geflüchtet.
Lene umarmte mich stürmisch, es war, als hätten wir uns gestern erst gesehen, die Jahre dazwischen schienen wie weggefegt. Toni überraschte mich mit einem Kuss auf den Mund.
◊
San Francisco verzauberte mich mit seiner Buntheit und dem kosmopolitischen Groove. Noch spürte man das Flair der Hippie-Ära und der Queer-Community, allerdings auch den Umbruch auf dem Weg ins neue Millennium. Sowohl Hightech-Entwicklungen als auch Internet boomten, Start-ups schossen aus dem Boden. Die Nähe zum Silicon Valley ließ die Mietpreise explodieren, viele Geschäfte, Clubs und Bars mussten deshalb schließen. Die Gentrifizierung vertrieb Einheimische aus der Stadt.
Toni, immer rastlos und auf der Suche nach Abenteuern, schleppte uns durch die LGBTQ-Bars und -Clubs, sie hatte vorab recherchiert und kannte sich besser aus als ihre einheimische Schwester. Toni war eine leidenschaftliche Tänzerin, kreiste geschmeidig mit den Hüften, mitunter an der Grenze zum Obszönen; sie liebte es zu provozieren. Gerne mit Frauen zu tanzen und mich dabei mit dem eigenen Körper in Einklang zu fühlen, war ein neues Erlebnis. Ein Höhepunkt unserer Streifzüge war der Finocchio’s Club, erst später wurde uns das Privileg bewusst, diese legendäre Location noch live erlebt zu haben, bevor der Club Ende des Jahres geschlossen wurde. Wir machten uns einen Spaß daraus, bei den attraktivsten der vielen hübschen Kerle mit sportgestählten Bodys zu wetten, ob sie schwul oder verführbar seien. Je nach Einschätzung der sexuellen Präferenz testeten die Schwestern im Wechsel, ich war Schiedsrichterin und hielt mich eher zurück. Wer die Wette verlor, musste den nächsten Drink spendieren. Toni lag überwiegend richtig. Auch mit mir flirtete sie, aber ohne ernsthafte Absichten. Sie wusste, dass ich hetero war, fragte aber doch, ob ich nicht Lust auf eine alternative Erfahrung hätte.
»Nicht wirklich«, war meine Antwort, was sie lächelnd bedauerte – ich eigentlich auch.