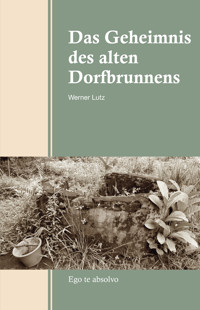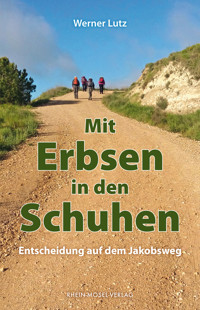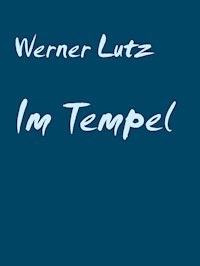Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georg muss, wie seine fünf Geschwister, in der elterlichen Bäckerei mithelfen und erlebt in der Familie eine heile und behütete Welt. Diese zerbricht, als er zusammen mit seinen Freunden, zu denen das Ferienkind Regina und der behinderte Arthur gehören, in einem Ameisenhaufen eine Leiche entdeckt. Ehe die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen kann, wird nachts der Ameisenhaufen in Brand gesetzt. Das ganze Dorf erschrickt, denn alle ahnen, dass der Mörder unter ihnen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2016 E-Book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-839-5Ausstattung: Marina FollmannLektorat: Gabriele Korn-SteinmetzTitelfoto: Felix Kremer (Die Faider Jugend beim Errichten des Martinsfeuers)
Werner Lutz
Ameisen brennen nicht
Schicksalhafter Eifelsommer
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
***
Für
meine Frau Irmgard,
für meine Kinder
Daniela, Andreas und Christoph mit Katrina
sowie für meine Enkelkinder
Johanna, Philine und Konstantin
Damit Ihr wisst, wie es war und nichts verloren geht.
***
In diesem Roman habe ich Selbsterlebtes und Geschichten, die mir erzählt worden sind, miteinander zu einer zusammenhängenden Handlung verwoben.
Die Geschichte spielt in meinem Geburts- und Heimatort Faid, das als erstes Eifeldorf auf der Strecke zwischen Cochem und Ulmen liegt.
Die handelnden Personen, denen Merkwürdiges in den unterschiedlichsten Eifeldörfern widerfahren ist, habe ich in mein Heimatdorf versetzt und lasse sie unter geändertem Namen zusammen mit mir, meiner Familie und meinen Freunden jenen Sommer durchleben, in dem meine Kindheit endete.
Ich erfuhr damals, dass es außerhalb der behüteten Atmosphäre in meinem Elternhaus mit sechs Kindern eine brutale, selbstsüchtige und rücksichtslose Welt gab.
War das Leben auch durch viele Pflichten und Aufgaben in der elterlichen Bäckerei bestimmt, weil jeder mithelfen musste, so empfanden wir sechs Geschwister aber das Miteinander innerhalb der Familie als einen Hort und ein Gehöschnis[1], in dem Vertrauen, Liebe, Rücksichtsnahme und gegenseitige Hilfe uns stark machten.
Vater und Mutter lebten es uns vor.
In jenem Sommer zerbrach die Idylle eines verschlafenen Eifeldorfes. Die Menschen, die zwischen Kirche, Schule und bäuerlicher Dorf- und Familienstruktur lebten, wurden plötzlich mit unfassbarer Gewalt konfrontiert.
Das ganze Dorf erschrak.
Aber in dieser Welt traf ich auch auf Menschen, wunderbare, starke und mutige Menschen, die alles zum Guten lenkten. Sie wurden mir zum Vorbild, weil sie großherzig und gütig waren.
Ihnen danke ich für diesen wunderbaren Sommer.
I
Lag es an Vaters Weigerung, sich einen Anzug nähen zu lassen, oder daran, dass Regina plötzlich in unserem Dorf auftauchte, oder war es einfach nur dieser Sommer mit seinem frühen Licht und den heißen, schlaflosen Nächten, der die Geschehnisse entfesselte, die unseren Ort wochenlang in Atem hielten?
Ich rätsele heute noch.
Als die Geschichte begann, saß ich gerade wieder einmal auf dem Salzsack in der Backstube. Vater hatte vor zwei Wochen eine neue Erziehungsmethode eingeführt, von der ich besonders betroffen war. Hatte man irgendetwas »angestellt«, gab es keine Ohrfeige wie in der Schule, man wurde auch nicht damit bestraft, früher als die anderen ins Bett zu gehen. Nein, seit vierzehn Tagen musste man für eine bestimmte Zeit auf dem Salzsack in der Backstube sitzen.
»Dann kannst du über deine Schandtaten bestens nachdenken«, hieß es übereinstimmend von Vater und Mutter. »Und außerdem können wir uns dabei noch nett unterhalten.« Nachzudenken hatte ich heute über mein Zuspätkommen fürs Autoladen. Ich sollte gestern, am letzten Schultag vor den großen Ferien, um vier Uhr zu Hause sein, um das Auto für die Brottour in den Nachbarort Büchel zu laden und hatte das vergessen. Abends gegen sechs Uhr, als ich vom Spielen mit meinen Freunden nach Hause kam, fiel es mir wieder ein. Vater war natürlich sauer.
Kurz und gut: Eine Stunde Salzsack.
Ich saß also auf meinem aus dichter Jute gewebten Salzsack neben der Tür zum Brotraum in der Backstube und wartete sehnsüchtig darauf, dass die eine Stunde vorbei sei, als Mutter die Tür hereinkam und sagte:
»Johann, im Dorf ist ein Tuchhändler unterwegs, der hätte gute Stoffe, sagte gerade Irmgard Steffes im Laden. Sie haben gestern Stoff gekauft, ihr Mann braucht unbedingt einen neuen Anzug. Und du brauchst auch einen neuen. Bei deinem alten ist die Hose am Hintern fast durchgescheuert.«
»Auf meinen Hintern schaut doch kein Mensch, außerdem ist die Anzugjacke so lang, dass er verdeckt wird. Der Anzug macht es noch ein paar Jahre.«
»Ja, aber denk daran, nächstes Jahr haben die beiden Jungs Kommunion, und dann musst du nicht mit dem ollen Ding da rumlaufen.«
Mit den beiden Jungs waren meine jüngeren Brüder Robert und Klaus gemeint, die zwar altersmäßig ein Jahr auseinander waren, aber gemeinsam zur Kommunion gehen sollten.
»Nun gut, wenn der Händler kommt, kannst du mich ja rufen«, sagte Vater nach einigem Zögern und griff mit beiden Händen in den Teigkessel der Knetmaschine, um weitere Brotteigstücke abzuwiegen und in zwei Reihen auf die Mulde zu legen. Mutter wollte noch etwas sagen, aber da klingelte schon die Ladentür und sie verschwand, Vater kritisch anblickend, in den Flur. An Vaters Stimmlage war genau zu erkennen, ob er im Moment nichts mit der besprochenen Sache zu tun haben wollte oder ob es ihn ernsthaft interessierte. Und jetzt schien wohl der erstere Fall vorzuliegen. Ich merkte das daran, dass er etwas wie: »Lass den mal kommen«, vor sich hingrummelte, als die Tür ins Schloss gefallen war. Er würde Gründe finden, die Anschaffung eines neuen Anzugs um ein oder zwei Jahre zu verschieben, da war ich mir sicher. Ich hörte ihn leise lachen.
Das war für mich der richtige Moment, zu fragen: »Vater, wie lange noch? Noch zehn Minuten?«
Erst jetzt schien er mich wieder wahrzunehmen, drehte sich um, schaute auf die Uhr und meinte: »Noch vierzehn Minuten, und die wollen wir auch einhalten, nun nerve nicht!«
Diese Schlussbemerkung war ein Warnsignal, das mir ganz klar zu verstehen gab: Nicht mehr fragen, sonst gibt es Verlängerung.
Letzte Woche erst hatte mir meine Fragerei ganze acht Minuten Verlängerung eingebracht.
Vater war beim Absitzen meiner Salzsackstrafe in Bezug auf die Zeit unerbittlich, er ließ sich auch nicht durch angebliches Bauchweh oder durch vorgetäuschte Kopfschmerzen austricksen. Erst recht nicht durch Quengeln. Quengeln war total kontraproduktiv. Das kostete.
Vater war nicht immer so pingelig mit seinen Zeitangaben, er konnte großzügig, ja generös sein. Manchmal hätte man den Eindruck haben können, er habe überhaupt kein Zeitgefühl.
Kam es nämlich vor, dass morgens im Laden Kundschaft auf frische Brötchen wartete, und Mutter in der Backstube nachfragte, wie lange es noch dauere, war Vaters Antwort immer: »Noch knapp fünf Minuten.« Er behauptete dies einfach, obwohl jeder in der Backstube wusste, es dauert bestimmt noch zehn Minuten, denn oft waren die Brötchen noch im Gärraum und noch gar nicht im Ofen.
»Was ist das, ein Tuchhändler?«, fragte ich, um die letzten Minuten meiner Arrestzeit auf dem Salzsack zu verkürzen.
Vater, der mit dem Rücken zu mir an der fensterseitigen Backmulde stand, hatte sich zwei Teigstücke genommen, rund gewirkt und in längliche Backformen aus Blech gelegt. Das ergab das gute Kastenbrot.
»Das ist einer von den Reisenden, die mit Stoffballen von Haus zu Haus gehen und den Leuten Stoffe verkaufen. Der ›Scherepitter‹ macht daraus für die Leute Anzüge, Hosen, Röcke oder Kleider.«
Scherepitter war der Schneider Peter Lambrich, der das halbe Dorf benähte und auch Kundschaft in den Nachbardörfern hatte. Ich hatte einmal zugesehen, wie er Vater mit einem gelben Maßband vermessen, in einen kleinen Kalender der Raiffeisenkasse die Maße eingetragen hatte und zwei Wochen später mit einer halbfertigen Jacke, bei der noch die Nähte zu sehen waren, auftauchte. Mit einem Kreidestück hatte er hier und dort ein paar Linien gezogen und Kreuze gemacht sowie mit verschiedenen Nadeln den Stoff an bestimmten Stellen gerafft oder glatt gespannt.
»An den Linien wird jetzt noch nachgenäht und dann hat dein Vadder eine tolle Jacke«, hatte mir damals Scherepitter erklärt. Auch diese Jacke hatte Vater eigentlich nicht haben wollen, aber Mutter hatte darauf bestanden.
»Dem Scherepitter sein Irma kauft immer bei uns Brot«, hatte Mutter damals argumentiert.
Den Genitiv zu gebrauchen, war bei uns im Dorf, oder besser gesagt, in der ganzen Vordereifel, unbekannt. Nur Vater benutzte ihn, er war kein Eifeler. Er kam vom Bodensee.
»Manchmal muss sie sogar anschreiben lassen. Bei denen kommt kaum Geld rein, dabei haben die drei Kinder. Da würde so eine neue Jacke denen schon helfen. Du sähst vernünftig aus und wir hätten ein gutes Gefühl.«
Darauf legte Mutter immer großen Wert. Ihr gutes Gefühl hielt bei dieser Jacke ziemlich lange, ja sogar verdächtig lange an, denn ich bekam einmal morgens mit, als ich in der Backstube half, wie Vater fragte, ob er jetzt die neue Jacke endlich abgebacken habe.
»Mach du deine Backstube und ich mach meinen Laden«, hatte Mutter spitz geantwortet, wobei ihr Gesicht richtig fleckig geworden war. Dann hatte sie die Schürze abgebunden und war aus der Backstube verschwunden.
An diesem Tag kam sie nicht mehr in die Backstube und beim Mittagessen herrschte bedrückendes Schweigen am Tisch. Wir Kinder spürten die Spannung und atmeten erst auf, als Vater Mutter beiläufig fragte: »Hast du mal einen Moment Zeit?«
Zusammen mit ihr verschwand er in der Backstube. Wir hörten zwei, drei Minuten lang laute Stimmen. Dann kam Mutter frohgelaunt in die Küche zurück, und Irma durfte noch drei Wochen auf die neue Jacke einkaufen, wie Mutter mir viel später erzählte. Nur keine Zuckerwecken, darauf hatte Vater bestanden. »Aber die hab ich Irma sowieso erst dienstags oder mittwochs geschenkt, die waren vom Samstag übrig geblieben.«
Der Salzsack drückte, und ich rutschte hin und her.
»Woher kommen denn die Tuchhändler?«, wollte ich von Vater wissen und schielte dabei auf die Wanduhr. Noch drei Minuten! Die Wanduhr war unsere alte Küchenuhr. Sie hing deshalb in der Backstube, weil dem Glasdeckel die linke untere Hälfte fehlte. Dieser Glasdeckel war Opfer eines Ballspiels meiner Schwester und mir in der Küche geworden. Die verbotene sportliche Betätigung hatte mir – und nur mir – eine halbe Stunde Salzsack gebracht. Meine Schwester ging wieder einmal straflos aus. Es hieß zwar, sie müsse eine Woche spülen. Aber das tat sie ja sowieso jeden Tag.
Hurra! Die Arrestzeit war um.
Ich stand neben Vater an der Mulde, um seine Antwort, die mich eigentlich gar nicht interessierte, noch abzuwarten. Er schaute zuerst auf die Uhr, meinte, ich sei aber pünktlich und sagte: »Das sind meistens Leute aus der Gladbacher Gegend oder auch welche aus Italien. Die fahren durch die Dörfer und bieten ihre Waren an, so wie ich mein Brot. Kein leichter Job.«
Ich weiß nicht, woher Vater dieses neue Wort hatte. Und dann auch noch ein englisches. Manchmal versetzte er uns alle in Staunen, wenn er, der normalerweise Wert auf den Gebrauch von deutschen Wörtern legte, treffend und sicher einen neuen Begriff einsetzte. Und uns diesen auch noch wortreich erklärte.
An den Beginn seiner Landbäckerei konnte ich mich schwach erinnern, als Vater auf dem Fahrrad mit seinem Bergrucksack, bestückt mit ein paar Broten, durch die Nachbardörfer fuhr und oft missgelaunt nach Hause kam, weil im Rucksack noch das ein oder andere Brot war, und in dem auf dem Gepäckträger aufgeschnallten Korb ein paar verlorene Brötchen kullerten. Mutter war in dieser Zeit oft am Weinen, und es gab zwischen den beiden manchmal heftige Dispute.
»Über Land seine Waren zu verkaufen, ist ein hartes Brot«, fuhr Vater fort und drückte mit der flachen Hand weiter die abgewogenen Teigstücke in die blechernen Backformen für das Kastenbrot, das neben Nudeln seine Spezialität war. Die Nudeln, die er anfangs in seinem Rucksack verkaufte, hatten ihm die Bezeichnung »Nuddelebäcker« eingebracht.
»Wenn der Stoff nicht in Ordnung ist, dann sind die Tuchhändler über alle Berge und du hast einen schlechten Anzug«, gab ich zu bedenken und war schon Richtung Backstubentür gelaufen, um einem möglichen Arbeitsauftrag, wie noch kurz die Backstube kehren, zu entgehen.
»Dann dürften sie sich nie mehr in der Gegend blicken lassen.« Die Stimme hebend fuhr er fort: »Hast du keine Zeit mehr? Wenn du mich was fragst, will ich dir auch ordentlich antworten. Oder hast du es so eilig?«
Ich blieb an der geöffneten Tür stehen.
»Ihr Ruf wäre ruiniert, und das nicht nur hier, sondern in der ganzen Gegend. Die Ware muss in Ordnung sein. Und als Käufer muss man gut aufpassen. So, jetzt kannst du.«
Schon war ich draußen.
Mit einem Sprung nahm ich die drei Stufen der Außentreppe und lief den ausgefahrenen Ackerweg Richtung »Schindgraben«. Dort hatte ich mich mit meinen Freunden für diesen Nachmittag verabredet. Unser Treffpunkt lag etwa 300 Meter von unserem Haus entfernt in einer großen Haselnusshecke mit einem hohen Steinhaufen davor. Es waren Steine, die die Bauern, oder besser gesagt, ihre Kinder, von den Äckern aufgehoben und dort am Heckenrand abgekippt hatten. Es waren Feuersteine, wie wir sie nannten – eigentlich Quarzsteine – und Bretz. Bretz ist ein lehmiger, grau bis tiefbrauner Schieferstein, der auf allen Feldern rund um meinen Heimatort zu finden ist. Manche Felder sind von diesen Bretzsteinen so dicht übersät, dass eigentlich weder Getreide noch Kartoffeln auf diesen Äckern etwas werden können. Aber es wächst immer etwas auf diesen mühsam gepflügten Steinäckern, wenn auch spärlich.
Unser Treffpunkt war der Steinhaufen neben der Haselnusshecke. Dort vorbei führte der Weg nach »Felchelen«. Das war unser Spielparadies.
Felchelen war die Flurbezeichnung für eine weitläufige Senke, an deren hinteren Ende ein kleiner Bach in einem Heckengestrüpp entsprang. Er floss etwa 500 Meter durch Streuobstwiesen und versickerte dann in einem sumpfigen Gelände am Waldrand.
Um dorthin zu gelangen, musste man am Steinhaufen vorbei, ehe sich der Weg gabelte. Der obere Weg stieg leicht eine sanfte Kuppe bis zu einem mächtigen Eichenbaum empor, der auf einer heideähnlichen, kargen Brachfläche jedes Jahr Unmengen von Eicheln über den Boden – Bretzboden – streute. Von dort aus übersah man die ganze Senke mit ihren Feldern, Wiesen und Brachflächen bis zum Waldrand.
Der untere Weg führte, begrenzt von einer etwa 200 Meter langen hohen Hecke, ins Tal hinab.
Die Felder am Rande der Senke waren die schlechtesten Ertragsflächen im Dorf. Manches Bauernkind hatte hier schon Hunderte von Steinen gesammelt und auf Haufen geworfen.
Unser Steinhaufen war der größte.
Für uns waren solche Steinhaufen an den Heckenrändern interessant, lieferten sie uns doch bestes Wurfmaterial, wenn wir Weitwurf übten. Sie waren aber auch oft Ursache für Ärger, denn wenn uns ein Bauer sah, wie wir Steine zurück auf ein Feld warfen, gab es Geschrei und Drohgebärden mit der Peitsche. Wir lachten darüber, denn die Felder konnten nie steinfrei werden, dazu hätte man den Boden austauschen müssen, außerdem ließen wir uns nicht von Drohgebärden mit einer geschwungenen Peitsche beeindrucken. Dafür konnten wir zu schnell laufen.
Als ich an diesem Tag an unserem Steinhaufen ankam, war keiner meiner Freunde da. Auch unter den Hecken, wo wir unser Häuschen gebaut hatten, war kein Mensch zu sehen.
Halt! Stimmt nicht ganz.
Da war ein Mädchen, vielleicht elf oder zwölf Jahre alt, so wie ich.
Schwarze Haare. Bubikopf, flache Schuhe und Söckchen. Die auch noch gelb.
Wo kommt die denn her?, dachte ich, als sie unvermittelt sagte: »Die anderen sind weg und außerdem blöd.« Damit meinte sie meine drei Freunde, Herbert, Manfred und Franzpeter.
»Am blödesten ist der Dicke, der mit der Brille.«
Keine schlechte Menschenkenntnis, registrierte ich, denn Franzpeter konnte manchmal furchtbar nerven, während ich mir den Bubikopf mit seinen gelben Söckchen genauer ansah.
Wenn mich am Abend jemand gefragt hätte, was sie denn sonst noch trug, ich hätte es nicht sagen können. Ein rotes, blaues oder grünes Kleid? Eine Schürze? Pullover oder Bluse? Oder gar eine Hose? – Nein, das mit Sicherheit nicht, so was Sündiges wäre mir aufgefallen. Bei uns im Dorf trug kein Mädchen eine Hose!
Ich bemerkte ihre großen braunen Augen. Sie sah mich an, als ob sie mich schon ewig kenne, mit mir Steine aufs Feld geworfen oder heimlich geraucht hätte.
»Du sollst nachkommen. Sie sind zum Weiher Frösche aufblasen, die Sadisten.«
Ihr Ton klang abfällig, dabei schürzte sie ihre Lippen, als wolle sie sagen: Diese Ekel!
Ich kannte das Wort »Sadisten« nicht, ahnte aber, dass es irgendwie eine Beschreibung für die Sauereien mit den Fröschen war.
Hätte ein Junge aus unserem Dorf das gesagt, wäre es in Ordnung gewesen. Aber jetzt informierte mich ein Mädchen – dabei noch ein wildfremdes – ich solle zum Fröscheaufblasen kommen. Das Dickste jedoch war, dass sie meine Freunde als Sadisten beleidigte, was auch immer das sein mochte.
Dabei ahnte sie nicht, dass meine Freunde mit dem Fröscheaufblasen nur angeben und ihr zeigen wollten, was für tolle Kerle sie seien. Nach den peinlichen Erfahrungen des letzten Jahres hätten wir nie gewagt, Frösche auch nur anzusehen.
Fröscheaufblasen hätte in der Schule vom Lehrer und auch vom Pastor Prügel, Nachsitzen und einen ganzen Winter Kohleschleppen aus dem Schulkeller bedeutet. Und für mich? Gar nicht auszudenken. Es hätte mir tage-, nein, wochenlanges, was sage ich, monatelanges Salzsacksitzen eingebracht. Ich sah mich schon in der Backstube verkümmern, meine Beinmuskulatur schwinden, weil ich mich nicht bewegen durfte. Oh Gott, einen ganzen Monat keine Sonne!
Hoffentlich hält die die Klappe und sieht das nicht als bare Münze an. Nachher glaubt man ihr das noch im Dorf, und dann ist der Ärger doppelt groß.
Es war ein ungeschriebenes Gesetz – jedenfalls bis letztes Jahr im Mai – niemandem von diesem verbotenen Spiel zu erzählen, welches uns die Großen, das heißt, die, die schon öffentlich rauchen durften, gezeigt hatten.
Eigentlich war es Blödsinn, denn jeder Erwachsene im Dorf wusste um diese perversen Spiele im Frühjahr.
Es war letztes Jahr beim Maibaumstellen gewesen. Es war ekelig und gleichzeitig faszinierend, den Großen zuzuschauen. Willem – eigentlich hieß er Wilhelm – der in der Schule noch nie den Mund aufgemacht hatte und nicht die Zähne auseinander bekam, war an diesem Tag der Chef gewesen. Ich hatte eigentlich nie verstanden, warum gerade er, der im Dorf nicht als der Hellste galt, bei dieser Aktion der Wortführer war.
Paul, mein Cousin, hatte das väterliche Pferd bekommen, um den von den Waldarbeitern gefällten Fichtenbaum aus dem Waldstück »Birken« zu ziehen. Mit vereinten Kräften war das untere Ende des Baumes auf einen Nachläufer gehievt worden. Das war nichts anderes als die Achse eines Ackerwagens mit Rädern. Vorne an einer Deichsel war das Pferd angeschirrt. Auf der Achse lag das untere Ende des geschälten Baumes, während der Stamm mit dem Wipfel über den Boden schleifte. Eigentlich hätte ich, weil ich zum ersten Mal dabei war, auf dem Stamm reiten dürfen, während das Pferd die Last zog. Aber nachdem letztes Jahr Franz von der Achse gekippt, mit dem Fuß unter den Stamm geraten und mit einem Beinbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden war, konnte mich nichts dazu bringen, auf die Achse zu klettern, obwohl sie mir alles Mögliche hinterherriefen: Schlappschwanz, Krücke und Hosenscheißer.
Nein, dann lieber eine Woche Salzsack.
Meine Freunde und ich liefen neben dem Stamm her. Gerne wären wir einmal von der rechten auf die linke Seite mit einer Flanke gesprungen, aber das hatte Paul, der das Pferd am Kopf führte, streng verboten. Er würde den Betreffenden mit der Peitsche kriegen. So war er.
Wir kamen den Waldweg entlang, als wir auf die freie Flur gelangten, und da stand Willem mit vier anderen Großen am Wegrand. Er hielt einen handgroßen, grünen ballartigen Gegenstand in der Hand. Pickelig.
Es war ein überdimensionaler Frosch mit aufgeblähtem Bauch, hervorquellenden Augen und mit einem breit zur Seite gezogenen Maul.
Meine Freunde und ich hatten zwar schon gerüchteweise davon gehört, dass beim Maibaumstellen Frösche aufgeblasen würden. Aber wir hatten das noch nicht gesehen.
Nun hatte sich das Gerücht in brutale Realität verwandelt.
Und dann flog auch schon der Frosch, von Willem blöd grinsend in unsere Richtung geworfen, auf uns zu. Das erbarmungswürdige Tier eierte durch die Luft, schlug auf der Mitte des Stammes auf und zerplatzte. »Poff« machte es. Und die gemarterte Kreatur kippte schleimend und zerfetzt von dem Stamm. Das, was von dem Frosch übrig geblieben war, zuckte noch einige Zeit auf dem Boden.
Niemand brauchte mir in diesem Augenblick zu erklären, warum Lehrer, Pastor und Eltern solch eine Aktion bestraften, obwohl alle davon wussten. Nur zugeben würde dies keiner.
Wer nichts davon wissen konnte, war Vater. Denn der war ja vom Bodensee. Und einen Zugereisten weihte man nicht unbedingt in solche Dorfinterna ein.
Mir schossen Tränen in die Augen. Ich hörte das laute, dämliche Lachen von Willem und das Gejohle der anderen.
»Los, kommt her, jetzt seid ihr dran«, rief Willem und kam mit einem Eimer auf uns zu. Darin kauerte ein Frosch. »Hier steck ihm den Strohhalm in den Arsch und dann blase ihn auf«, sagte dieses Pickelgesicht Willem zu mir und hielt mir den Frosch vor das Gesicht.
Ich wandte mich angeekelt und voller Schrecken ab. Während ich mich umdrehte, hörte ich, wie auch meine drei Freunde sich vehement wehrten, das arme Geschöpf mit dem Strohhalm aufzuspießen.
»Dann seid ihr draußen, ihr Hosenscheißer! Aus! Ende! Haut ab zu eurer Mutti. Los lauft!«, hörte ich Willems wütende Stimme.
»Spiel dich mal nicht so auf«, vernahm ich meinen Cousin Paul. »Es reicht doch, wenn sie den Frosch aufblasen. Steck du ihm einfach nur den Strohhalm rein und lass sie dann blasen.«
»Halt du dich da raus, das ist unsere Sache«, plärrte Willem und erhielt Unterstützung von den anderen, die bis jetzt nur grinsend dabei gestanden hatten.
»Gut, dann spann ich jetzt mein Pferd aus. Und ihr könnt den Stamm schleppen, ihr Großmäuler.«
Paul löste die Ketten des Geschirrs, die klirrend zu Boden fielen.
Es gab einen heftigen Disput. Das wäre das erste Mal, dass sich jemand, und jetzt direkt vier Anfänger weigern würden. Das sei die Memmentour! So was könne man nicht zulassen.
Aber Paul blieb hart: Entweder Memmentour, oder der Stamm bleibt liegen.
Der Stamm blieb natürlich nicht liegen, sie reichten uns den aufgespießten Frosch und jeder musste blasen. Ich war der Letzte, der den schreckstarren Frosch in die Hand bekam.
Ich schloss die Augen, während ich die glitschige Kreatur mit beiden Händen festhielt und verzweifelt in den Strohhalm blies.
Was bist du nur für ein Feigling, ging es mir durch den Kopf. Du bist genauso bestialisch wie die grinsenden Säcke da vorne. Wo ist denn dein Mut, nein zu sagen? Ich stellte mir Mutters erschrockenes Gesicht vor, wenn sie erfahren würde, was ich gemacht habe.
»He, ist gut, hör auf, sonst platzt der dir noch vor der Fresse«, hörte ich Pickelwillem rufen.
»Und jetzt wirf!«
Ich warf nicht, nein, ich ließ den Frosch einfach fallen, der wie ein schlapper Ball über den Weg kullerte.
»Du Scheißkerl«, schrie Willem, rempelte mich zur Seite, trat mit seinen Gummistiefeln auf den Frosch und zermatschte ihn mit mehreren stampfenden Schritten.
Die Peitsche knallte.
Dann begann ich zu rennen und rannte, bis ich in unserem Häuschen beim Steinhaufen war. Zitternd saß ich später bei meinen Kaninchen, nahm meinen Lieblingshasen Hans auf den Arm und streichelte ihn. Ich glaube, noch nie haben meine Kaninchen mehr und besseres Futter bekommen als an diesem Tag.
Danach schlief ich zwei Nächte nicht. Immer wieder sah ich das breite Maul und die vorquellenden Augen des aufgeblasenen Frosches vor mir und hörte, wie sein Leben zappelnd zerfetzte. In der dritten Nacht klopfte ich an die Tür des Elternschlafzimmers. Sofort erstarb Vaters Schnarchen. Ich setzte mich auf Mutters Bettkante und erzählte weinend die ganze Geschichte.
»Johann, das musst du stoppen«, sagte Mutter.
»Kann ich bei euch im Bett schlafen?«, fragte ich.
Sie nickte und schlug die Bettdecke zurück, als Vater barsch dazwischenfuhr: »Der Frosch konnte in seiner Todesangst auch nirgends unterkriechen. Geh mal schön zurück in dein Bett.«
Mutter brachte nur ein: »Aber Johann …«, heraus, da hatte Vater schon die Schlafzimmertür geöffnet und mich auf den Flur geschoben.
Doch an Schlafen war in dieser Nacht nicht zu denken.
Am nächsten Morgen stellte Vater am Frühstückstisch klar, als wir beide alleine waren: »Mit ein bisschen Courage hättest du die Kreatur retten können.«
Beschämt senkte ich den Kopf.
Danach gab es einen Riesenwirbel. Es stellte sich heraus, dass, nachdem ich angeekelt und vom höhnischen Lachen der anderen verfolgt, geflüchtet war, noch zwei Frösche ihr Leben elendiglich gelassen hatten. Am Maibaumplatz, als mein Cousin Paul mit dem Pferd abgezogen war.
Dass Vater mit Lehrer Gail gesprochen hatte, erfuhr ich erst später. Die ganze Wahrheit kam ans Licht, nachdem Gail mehrere Ohrfeigen verteilt und Ohren verdreht hatte. Auch ich hatte zwei Ohrfeigen nachmittags auf dem Schulhof gefangen, obwohl Gail gar nicht mehr mein Lehrer war, denn ich ging bereits zum Gymnasium nach Cochem. Erstmals war bei dieser Befragung auch seine neueste Spezialität zum Einsatz gekommen: Er zwickte die Schüler unterhalb des Kinns kurz über dem Adamsapfel in den Hals. Das war regelrechte Folter, und auf diese Weise erfuhr er alles.
Die Eltern wurden informiert und das bis dahin still geschwiegene und unter der Hand geduldete Fröscheaufblasen, das Generationen von Jungen als eine Art Initialritus absolviert hatten, wurde verboten. In der Sonntagspredigt wetterte Pastor Graf, dass Jugendliche die Würde der Kreatur missachten würden. Der Bürgermeister, von allen »Scheffe Wern« genannt, machte bei der »Jemaan« am Sonntag nach der Messe bekannt, dass Frösche aufblasen verboten sei und in Zukunft angezeigt würde. Namen wurden bei dieser Gemeindemitteilung am Backhaus nicht genannt, aber jeder kannte die Betroffenen und auch den, der sie verpetzt hatte.
Hier erkannte ich zum ersten Mal, dass in meinem Dorf viele Dinge stillschweigend geduldet wurden. Wenn sie allerdings öffentlich angesprochen wurden, zerriss sich jeder darüber den Mund.
Hatten die Großen mehr Ohrfeigen als ich bekommen, und war ihre Haut so fest unterm Kinn von Gails kräftiger Hand gequetscht worden, dass sie noch ein, zwei Tage danach im Halsbereich blaue Flecken hatten, so hatte ich am ganzen Körper blaue Flecken. Und das über eine Woche lang.
Sie erwischten mich nämlich am Friedhof.
Ich hatte gerade die Blumen auf Opas Grab gegossen, die Gießkanne abgestellt, als mich ein Tannenzapfen am Kopf traf. Ehe ich mich versah, waren sie über mir.
Ich erhielt Faustschläge ins Gesicht, in den Bauch, in den Rücken. Tritte in den Hintern und Ohrfeigen mit dem Handrücken durch den Kartoffelsack, den sie mir über den Kopf gestülpt hatten, so dass ich mit meinen Armen eingeklemmt war.
Ich sah nichts und ich hörte nichts, denn es fiel kein Wort. Dann schubste mich einer in den Straßengraben neben der Friedhofsmauer. Ich fiel in brackiges, stinkendes Wasser und hörte sich schnell entfernende Schritte.
»Bin gestolpert und in den Graben gefallen«, sagte ich daheim zu Mutter, »dabei habe ich mich am Kopf gestoßen, daher kommt das Blut.«
Vater glaubte mir nicht. So hartnäckig er auch fragte, ich blieb bei meiner Version.
Aber er ahnte, dass meine Blessuren mit der Fröscheaktion in Verbindung standen.
»Ist vielleicht besser so«, meinte er zum Schluss. »Wenn man etwas ändern will, muss man oft im Leben Schläge einstecken. Und wenn man keinen Mut hat, sogar zwei Mal. Merk dir das!«
Ich empfand keine Rachegefühle, denn die Abreibung, die ich am Friedhof bekommen hatte, läuterte irgendwie mein Gewissen.
Nur Frösche konnte ich die nächste Zeit weder sehen noch quaken hören.
Ach, das hätte ich fast vergessen, Paul hatte damals Willem, als er den Frosch in den Matsch getreten hatte, eine mit der Peitsche gegeben.
Prima!
All das ging mir durch den Kopf, als dieses Mädchen mir wie nebenbei sagte, was meine drei Freunde gerade tun würden. Dabei zeichnete sie seelenruhig mit ihrem Stock in der Hand Striche in die Matschpfütze neben dem Steinhaufen. Strich neben Strich.
Ich ließ Gelbsöckchen stehen und lief los in Richtung Weiher. Da kamen die drei mir auch schon entgegen. Sie lachten. Freute es sie etwa, einen Frosch aufgeblasen zu haben? Das konnte doch nicht wahr sein! Oder was war der Grund ihrer Freude?
Es sei das blöde Gesicht von dem Mädchen am Steinhaufen gewesen. Der hätten sie mit ihrer Bemerkung einen schönen Schrecken versetzt.
»Wo ist die eigentlich?«, fragte Herbert und schaute unter den herabhängenden Ästen der Haselnusshecke hindurch. Aber Bubikopf war verschwunden.
»Was trägt der denn bei euch ins Haus?«, rief Manfred und zeigte auf unser Haus, das von der Hecke aus gut zu sehen war. Als ich mich umdrehte, sah ich einen Mann, der etwas großes Längliches auf seiner Schulter die Ladentreppe hoch trug. Es war der angekündigte Tuchhändler, der Stoffballen für Vaters neuen Anzug brachte.
»Bis morgen!«
Ich lief los. Nur allzu gern wollte ich dabei sein, wenn Vater und Mutter den Stoff für den Anzug aussuchten.
Ich war noch nicht an unserem Gartenzaun, als ich sie – ich erkannte sofort ihre Stimme – rufen hörte: »Ich heiße übrigens Regina, und du?«
Ich war perplex und sah mich suchend um. Wo war sie denn?
Sie stand doch tatsächlich mitten in den mannshohen Brennnesseln. Und das mit ihren nackten Beinen und den gelben Söckchen. Wollte die sich wichtig tun? Wollte sie mir zeigen, wie zäh sie war? Die Brennnesseln waren da, wo sie stand, niedergetreten und die Spitzen geköpft. Aha, dachte ich, sie hat mit ihrem Stock das Zeug platt gemacht.
»Wie heißt du denn?«, hörte ich nochmals ihre Frage, weil ich sie nur stumm ansah und dabei feststellte, dass sie braune Augen und lange Wimpern hatte.
Eigentlich konnte ich auf diese Entfernung die Farbe ihrer Augen gar nicht erkennen. Ich rief: »Georg«, zwar etwas zögerlich. Aber verdammt noch mal! Es war passiert.
Wer gibt denn schon seinen Namen einer Fremden preis, und dann noch einer in gelben Ringelsöckchen und … mit einem …
Mir fiel nicht mehr ein, wie man ihre Frisur nannte! Gerne hätte ich ihr irgendeine Bemerkung an den Kopf geworfen, als sie auch schon rief: »Ich weiß es von deinen Freunden, aber ich wollte es von dir hören.«
Wie gesagt, ich war zu perplex oder …?
»Du blöde Kuh!«, rief ich zurück und lief auf unsere Ladentür zu, hinter der der Tuchhändler mit seinen Ballen auf der Schulter verschwunden war.
Wirklich ein blödes Weibsstück!
Gelbe Söckchen, Schuhe, die wie Schlappen aussehen, Bubikopf – jetzt hatte ich den Begriff wieder – und sie sprach auch noch Hochdeutsch!
Ich kam in die Küche.
Klaus, Robert, Helga und Maria saßen am Küchentisch auf ihren angestammten Plätzen, als hätte man sie hierher bestellt. Keiner trat dem anderen unter dem Tisch ans Bein oder schubste ihn, weil er mit seinen Ellenbogen zu viel Platz beanspruchte. Auch mein jüngster Bruder Marcus saß in seinem Hochstuhl, konzentriert in die Runde blickend. Vater saß am Kopfende, neben ihm stand Mutter in ihrer Kittelschürze. Vater hatte seine Backschürze abgelegt und schaute interessiert – oder eher kritisch beobachtend – auf den schwarzhaarigen Mann, der seine Stoffe auf dem Tisch ausrollte. Auf dem hatte Mutter die Bügeldecke ausgebreitet. Wahrscheinlich war sie besorgt, dass irgendein übersehener Fettfleck auf dem Tisch die Tuchware verunreinigen könnte.
»Wir haben hier einen Stoff, der zur Zeit sehr gerne getragen wird, weil er in seinem Muster dezent und dabei gleichzeitig vornehm, ja fast aristokratisch wirkt«, begann der Tuchhändler, der selbst einen dunklen, gestreiften Anzug trug. Ich verstand zwar nicht, was aristokratisch bedeutet, sah aber am Gesicht meines Vaters, dass ihm dieses Attribut wohl nicht so sehr zusagte, denn er zog bei diesem Wort die Augenbrauen hoch.
Der Tuchhändler war ein feiner Mann, einer, wie Vater in seinem besten Sonntagsstaat niemals aussehen würde. Ein weißes Hemd mit silbergrauer Krawatte verlieh ihm Seriosität und einen Hauch Vornehmheit. Mit seinen gepflegten Händen, und seinen kurz geschnittenen Fingernägeln strich er über den Stoff, hob ihn mit zwei Fingern hoch und ließ ihn wieder fallen.
Das einzige, was störte, war ein Fingerling am Mittelfinger der linken Hand. Er war aus braunem Glattleder und mit einem schmalen Band am Handgelenk verknotet. In krassem Gegensatz dazu glänzte am kleinen Finger der gleichen Hand ein goldener Knopfring. Breit, mit einem runden, roten Stein in der Mitte. Vater trug noch nicht einmal seinen Ehering. Zu gefährlich in der Backstube! Er wäre nicht der Erste, dessen Ringfinger durch irgendeine Maschine abgerissen worden wäre, antwortete er stets, wenn er danach gefragt wurde.
Erneut nahm der Tuchhändler den Stoff auf, verkrumpelte ihn in seiner Faust und fuhr fort: »Selbst langes Sitzen, ständige Beanspruchung in den Ellenbogen und im Kniebereich lassen keine Falten zurück. Ich simuliere dies« – wieder ein Wort, das ich nicht verstand – »durch festes Drücken und intensives Knautschen des Stoffes. Fühlen Sie selbst!« Er nahm Vaters schwielige Hand. »Knautschen Sie, drücken Sie, als wäre es Brotteig.«
Vaters Gesichtsausdruck war äußerst kritisch.
»Nehmen Sie ihn zwischen zwei Finger und reiben Sie. Nicht so zögerlich! Spüren Sie, wie elastisch sich der Stoff dem Druck anpasst? Und, und? Was sage ich: Keine Falten, keine Knitter. Da gibt es keine Reizwirkung auf der Haut. Wir verarbeiten nur hautsympathische Fasern.«
Er wandte sich an Mutter, der er jetzt den Stoff hinhielt. »Gnädige Frau!«
Über Mutters Gesicht glitt die Andeutung eines Lächelns. Vater verzog keine Miene.
»Fassen Sie den Stoff ruhig einmal an. Sie haben ihn nachher zu bügeln. Ich sage den Leuten immer, ein Anzug ist für den Mann und für die Frau. Sie haben sechs Kinder. Jetzt stellen Sie sich doch einmal vor, Sie bügeln die Anzughose ihres Mannes und die wird und wird nicht glatt. Sie ärgern sich doch kaputt. Sehen Sie, unser Stoff ist familien- und hausfrauenfreundlich. Er knittert nicht, und wenn, dann einmal bügeln und fertig. Sie wollen doch als Mutter mehr Zeit für Ihre Kinder aufbringen als für das Hosenbügeln, oder?«
Selbst Marcus in seinem Hochstuhl schien dieses Argument überzeugt zu haben, denn er machte im selben Moment ein Bäuerchen. Wir lachten alle. Nur Vater nicht.
Mutter hatte sich, bevor sie den Stoff selbst prüfte, die Hände an ihrer Schürze nochmals abgewischt. Dann rieb sie das Tuch, zerknautschte es und kratzte mit dem Daumennagel gegen die Maserung. Nichts veränderte sich.
»Die Ware ist ordentlich«, sagte sie zu Vater gewandt. »Ich denke, das ist ein guter Stoff.«
Um Mutters Urteil noch zu bestärken, schob der Verkäufer seinen Anzugärmel nach vorne und zeigte auf die Stelle, an der der Daumenrücken gewöhnlich scheuert.
»Das ist der kritische Punkt, hier zeigt sich Qualität.«
Er erzählte, dass er seinen Anzug nun schon zwei Jahre bei Kundenbesuchen trage, nicht die geringste Spur von Verschleiß sei zu sehen. Der heutige Stoff sei allerdings noch strapazierfähiger.
Mutter sah Vater mit äußerst wohlwollender Miene an.
Ich bemerkte im Gesicht des Tuchhändlers ein verstecktes Aufleuchten. Er wähnte den Geschäftsabschluss bereits in greifbarer Nähe, als Vater sich nach der Schmutzempfindlichkeit erkundigte.
»Keine Frage«, konterte der Händler siegessicher, »dieser Stoff ist so dicht gewebt, dass er kaum Staub aufnimmt. Das kann ich Ihnen gern demonstrieren.«
Ich wurde in die Backstube geschickt, um etwas Roggenmehl zu holen, das er auf den Stoff stäubte. Mit drei, vier Bürstenstrichen war das Mehl aus dem Anzugtuch ausgebürstet. Diesmal nickte auch Vater anerkennend.
Der Händler hatte mit seiner linken Hand, deren Mittelfinger den ledernen Fingerling trug, wedelnd den letzten Rest Mehl beseitigt. Ich überlegte, ob er den Finger vielleicht verletzt hatte.
»Schauen Sie sich doch nur dieses Design an. Es ist äußerst modern, dabei vornehm in seiner dezenten Zurückhaltung«, fuhr er lobpreisend fort.
Ich schaute Vater an, merkte, dass er das Wort »Design« noch nie gehört hatte und wusste sofort, dass er am Abend in unserem dreibändigen Lexikon dessen Bedeutung nachschlagen würde. Ich jedoch wollte sie gleich wissen und glaubte außerdem, mit einer geistreichen Frage mein Interesse zu zeigen. »Was ist Design?«, fragte ich.
»Gut, mein Junge«, antwortete der Tuchhändler und drehte dabei seinen protzigen Knopfring am kleinen Finger.
»Die Jugend ist aufgeweckter als wir, sie traut sich zu fragen. Nur durch Fragen wird man klüger, sage ich zu meinen Jungs auch immer«, demonstrierte er den verständigen Vater.
Während er wortreich den Begriff »Design« erklärte, bekam ich unter dem Tisch einen kräftigen Fußtritt gegen mein Schienbein. Ich zuckte zusammen und wollte gerade losplärren, als ich in Klaus’ gelangweiltes Gesicht sah. War er es? Robert schaute Vater an, Maria putzte Marcus’ Nase und Helga saß direkt neben mir und konnte unmöglich um die Ecke getreten haben. Außerdem trug sie Pantoffeln, wie ich beim vorsichtigen Schielen unter den Tisch erkannte. Aber dabei sah ich auch Klaus’ Nagelschuhe. Beim Hochblicken bemerkte ich, dass er mich richtig frech musterte.
Er war’s, dachte ich, so wie der guckt. Außerdem saß er mir genau gegenüber. Ich schaute ihm in die Augen und bildete auf dem Tisch eine Faust, doch er verzog keine Miene. Warte bis nachher, schwor ich mir im Stillen.
Er konnte nicht vertragen, dass ich mich wichtig tat. Das mochte keiner in unserer Familie. Und ich muss ehrlich sein, ich wollte mich in dem Moment hervortun, wollte in der Schar meiner Geschwister auffallen. Dann kam das Regulativ in Form eines Trittes. Was ich dennoch als ungerecht empfand.
Warte nur, bis gleich! Dann regeln wir das!
Wegen des Tritts hatte ich die letzten Verkaufsofferten und Qualitätsbeschreibungen nicht gehört. Jetzt sah ich, wie der Tuchhändler in seine Jackentasche griff und daraus ein Feuerzeug und ein Benzinfläschchen von Esso zog. Ehe ich verstand, was er damit machte, hatte er schon Benzin über den Stoff gekippt und angezündet.
Wir beobachteten mit offenem Mund, wie eine orangeblaue Flamme über dem Tuch aufflackerte, jederzeit fürchtend, der Stoff würde in Flammen aufgehen.
»Sehen Sie, das ist Qualität«, unterbrach der Verkäufer mit einem triumphalen Lächeln das kleine Feuerspektakel. »Der Stoff ist so hochwertig, das er sogar Feuerattacken schadlos übersteht.« Er zeigte den Stoff, der ohne irgendeine Brandspur war, reihum. Wir alle hatten mit »Oh« und »Ach« die Vorführung und das Ergebnis kommentiert. Etwas zu laut Klaus, glaubte ich zu bemerken.
Während der Verkäufer noch seinen Triumph genoss und einen Preis nannte, sah ich, dass Vaters Miene sich veränderte. Seine Stirn hatte sich gekräuselt und seine typischen Ärgerfalten zogen sich von den Mundwinkeln abwärts. Ich kannte das, hatte ich dies doch oft genug vor einem Ausbruch erlebt.
Was hatte ihn derart verärgert? Ich schaute über den Tisch, sah den schmunzelnden Tuchhändler und Mutters erstauntes Gesicht, die immer noch von der Feuerdemonstration beeindruckt war.
Sie war die Erste, die sich äußerte und meinte: »Das hab ich ja noch nie gesehen, das ist wirklich eine sehr gute Qualität. Nein, dass der Stoff dem Feuer widersteht! Johann, da kaufen wir etwas Gutes. Welches Muster willst du denn haben? Für welches Design entscheidest du dich?« Dabei zeigte sie auf die drei halb ausgerollten Stoffballen auf dem Tisch.
Ich bemerkte, wie sich der Tuchhändler heimlich die Hände rieb.
Aber Vater antwortete zuerst gar nichts, prüfte mit den Fingern nochmal die verschiedenen Stoffe und antwortete: »Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich brauch noch etwas Bedenkzeit.«
Mutter wollte sofort etwas erwidern, doch als sie in Vaters Gesicht sah, schloss sie den schon halb geöffneten Mund. Ihre Augen und die quer über ihre Stirn verlaufende Falte drückten Missmut und Ärger aus, und ich dachte schon, sie fällt Vater ins Wort, als sie sagte: »Schauen Sie morgen noch mal vorbei, bis dahin hat mein Mann sich entschieden.«
Schnell waren die drei Ballen zusammengerollt. Der Händler zeigte seine Enttäuschung nicht. Sicher hoffte er darauf, dass er morgen das Geschäft abschließen könne. Mit einer heftigen Bewegung warf er die Stoffe über seine Schulter. Dabei löste sich die Schlaufe des ledernen Fingerlings. Der rutschte vom Mittelfinger und zeigte einen gespaltenen Nagel und eine gezackte rote, wulstige Narbe, die über das vordere Fingerglied lief. Hastig versteckte der Tuchhändler die Hand wie ein mit Makel behaftetes Objekt unter einem Stück Tuch, das von einem der Ballen herabhing. Freundlich, jetzt Marcus auf dem Arm haltend, begleitete Mutter ihn zur Tür.
Dann kam sie zurück, stellte sich vor Vater und begann leise, fast flüsternd: »Sag mal, was soll das denn? Willst du denn, dass …« Sie schnappte nach Luft und suchte nach Worten. Ich ahnte, was in ihr vorging. Sie fühlte sich durch Vaters Verhalten brüskiert und irgendwie als Dummchen vorgeführt.
Sie sprach nicht mehr weiter, denn sie bemerkte, dass wir Kinder alle auf beide Eltern sahen. Erlebten wir jetzt den ersten vor uns ausgetragenen Krach? Würden sie sich anschreien, oder weinte Mutter vielleicht laut?
Dass die beiden sich schon mal zankten und es manchmal hinter geschlossener Backstuben- oder Schlafzimmertür heftige Dispute gab, das wussten wir. Aber vor unseren Augen? Noch nie!
Wir Kinder wussten, dass diese Momente, in denen Vater und Mutter unterschiedlicher Meinung waren, oft mit Vaters barschem Befehl endeten: »Macht, dass ihr raus kommt! Und guckt nicht so dumm!« Dann machten wir uns schnell aus dem Staub, um nicht noch eine zusätzliche Arbeit aufgedrückt zu bekommen, wie Holz holen, Straße kehren oder am Gartenzaun Brennnesseln ausreißen. Vaters Phantasie war in solchen Situationen grenzenlos.
Und heute? Nichts dergleichen.
Mutter war sauer, sie blitzte Vater an. Aber der war die Ruhe selbst. »Ich muss euch was erklären.«
»Du musst gar nichts erklären«, platzte es aus Mutter heraus, »wie steh ich denn jetzt da? Ich hab den Mann doch ins Haus bestellt!«
»Aber du konntest nicht wissen, dass er die Leute mit Taschenspielertricks blufft. Er spielt uns den seriösen Reisenden vor und ist in Wirklichkeit ein bauernschlauer Fuchs. Darauf fallen vielleicht andere rein. Ich nicht! Was er uns vorhin mit seinem Feuer vorgeführt hat, mache ich mit jedem Stoff. Der Stoff kann gar nicht brennen, es brennt nämlich nur das Benzingas. Und ehe das verbrannt ist, bläst unser sauberer Händler das Feuer aus. Ich zeig es euch.«
»Ich denke, wir essen zuerst«, sagte Mutter scharf und gab mir Marcus auf den Arm. «Komm Maria, hilf den Tisch decken.«
Das Abendessen war bei uns etwas Besonderes. Wir Jungs saßen auf der Längsseite der Eckbank, wobei Robert in der Mitte sitzen musste, um Klaus und mich zu trennen, denn wir traktierten uns oft mit Tritten unter dem Tisch. Auf dem kurzen Bankteil am Kopfende saß Maria. Uns gegenüber Mutter mit Helga und Marcus im Hochstuhl. Am freien Kopfende war Vaters Platz.
Vor und nach dem Essen beteten wir. Abends gab es Brot mit Hausmacher Wurst, Schinken oder Käse und Tee. Fürchterlichen Hagebuttentee, den Vater wegen seines Magenleidens trinken sollte. Waren irgendwelche Pausenbrote von uns Kindern übrig geblieben, wurden diese mit Senf, einem Stückchen Gurke oder einem Zwiebelring verfeinert, in Stücke geschnitten und auf einen Teller mitten auf den Tisch gestellt. Es war das »Hasenbrot«. Und das musste gegessen werden, ehe man sich ein Brot schmieren durfte. Aber der Teller mit dem »Hasenbrot« war schnell geleert, denn ein vertrocknetes Pausenbrot schmeckte mit der abendlichen Garnitur einfach himmlisch.
Beim Essen ging es stets lebhaft zu. Es wurde über die Erlebnisse und Geschehnisse des Tages gesprochen. Was war in der Schule vorgefallen? Hatten alle die Hausaufgaben gemacht? Was habt ihr heute erlebt? Was erwartet uns morgen? Sind die Arbeiten getan wie Brikett hochtragen, Brotpfannen fetten und Backbleche putzen? Übrigens alles Aufgaben, die wir Kinder nach einem bestimmten Rhythmus zu erledigen hatten. Bei mir war der Arbeitsrhythmus unproblematisch. Da ich der älteste Junge war, musste ich jeden Tag mehr oder weniger bestimmte Dinge verrichten. Entweder machte ich die Arbeiten selbst oder ich »betreute« meine jüngeren Geschwister bei leichteren Aufgaben.
Das führte manchmal zu Diskussionen, denn ich muss gestehen, dass ich ihnen manchmal etwas übertrug, was eigentlich mir zugedacht war. Vater und Mutter regelten das abends beim Essen gütlich. So gütlich, dass ich auch schon mal eine Salzsacksitzung erhielt.
Ich hütete mich zu widersprechen, denn Vater wusste genau, was Sache war. Danach war Ruhe und Schweigen am Tisch.
Genauso war es heute.
Mutter tat so, als sei Vater gar nicht da und beschäftigte sich intensiv mit Helgas Butterbrot, das sie in kleine und kleinste Stückchen schnitt, obwohl Helga ein Butterbrot schon alleine in die Hand nehmen konnte.
Vater konzentrierte sich auf das Brotemachen für Marcus.
Maria hatte zu Beginn des Essens noch etwas erzählen wollen, bemerkte aber bald die knisternde Spannung zwischen Vater und Mutter.
Mutter war sichtlich beleidigt. Wie stand sie denn jetzt vor dem Tuchhändler da, den sie eigens ins Haus bestellt hatte, weil sie ihrem Mann was Gutes tun wollte. Und der? Was machte der?
Vater wiederum schien Mutter nicht zu verstehen. Hatte er doch bei diesem Pferdetäuscher, wie er sich ausdrückte, gerade noch rechtzeitig die Bremse gezogen. Aß Vater abends drei oder gar vier Scheiben Brot, so schob er heute schon nach dem zweiten Stück den Teller zur Seite. Auch ich hatte keinen Hunger mehr. Robert stopfte neben mir schnell die letzte Brotecke in den Mund. Alle schienen plötzlich satt zu sein. Marcus schaute den Tisch auf und ab und schob dann das Holzbrettchen zur Seite.
Alle satt!
Vater war mittlerweile an den Küchenschrank getreten und hatte aus dem oberen linken Fach das Reinigungsbenzin genommen. Es war ein blechernes Benzinfläschchen der Marke Esso, genau wie das des Händlers. Aus dem Schrankschubfach holte er nach einigem Suchen ein weißes Taschentuch hervor, ein Paar Socken und eine frische Bäckerschürze.
Schnell waren unsere Vesperbrettchen, Tassen und Teller abgeräumt.
Er schaute sich um, fand die unbenutzte Griesbreischüssel von Marcus und stellte sie vor sich auf die freie Tischfläche.
Mutter beobachtete mit undurchdringlicher Miene das geschäftige Treiben von der Spüle aus. Einen leichten Ausdruck des Staunens glaubte ich um ihren Mund zu erkennen.
Ob die folgenden Vorführungen den Grundstein für mein Interesse an Chemie und Physik legten, kann ich nicht mehr beurteilen. Aber mit Sicherheit wurde an diesem Abend bei uns allen die Neugierde an den Naturwissenschaften und besonders am Experimentieren geweckt.
Ich sollte zunächst das weiße Taschentuch über die Griesbreischüssel spannen.
»Kopf weg«, sagte Vater, träufelte ein paar Tropfen Benzin auf die Tuchfläche, riss ein Streichholz an und hielt es zwei, drei Zentimeter über das mit Benzin benetzte Taschentuch. Schon loderte eine blaufarbene Flamme hoch.
»Keine Angst«, sagte Vater ruhig, als ich mit dem Gesicht zurückzuckte und wir alle mit aufmerksamen Blicken sein weiteres Tun verfolgten. »Das war’s schon.« Er legte seine flache Hand auf das brennende Taschentuch. Die Flamme erlosch schlagartig.
Triumphierend zeigte er auf die Brandstelle. Tatsächlich, kein Brandfleck hatte das weiße Taschentuch beschädigt. Nur ein schwacher Feuchtigkeitsfleck in der Mitte wurde immer kleiner und verschwand schließlich.
»Das ist das nicht verbrannte Benzin, es verdunstet jetzt«, klärte Vater uns auf.
Das Experiment mit der Schürze zeigte das gleiche Ergebnis. Allerdings musste Vater hierbei mit kräftigem Blasen die Benzinflamme löschen.
»Bei den Socken kann es sein, dass die abstehenden Wollfasern verschmoren«, meinte er und erklärte uns die Faserunterschiede zwischen Baumwolle, Leinen, Seide und Schafwolle.
Wirklich, die Brennprobe mit der Wollsocke roch nach verschmortem Horn. Man konnte deutlich auf der Oberfläche der Wolle winzige dunkle Kügelchen sehen.
»Siehst du, Gertraud«, wandte sich Vater an Mutter, die, wie wir, staunend dessen Vorführung verfolgt hatte. Mutter hieß eigentlich Gertrud, aber Vater sagte immer dann Gertraud zu ihr, wenn er gut gelaunt war und zeigen wollte, dass er Mutter mochte.
»Gibst du mir deinen Schal?«, fragte er augenzwinkernd.
Doch Mutter wollte ihren Schal nicht für einen weiteren Test hergeben. »Ich glaub’s dir auch so«, meinte sie.
»Seht ihr, was ich euch gezeigt habe, wusste dieser Vertreter genau. Nicht der Stoff, sondern nur das Benzingas brennt. Man muss nur früh genug die Flamme löschen, ehe sie den Stoff erreicht. Die Brennprobe sagt also gar nichts über die Qualität des Tuches aus.«
Während er die Benzinflasche in den Schrank zurückstellte, sagte er zu Mutter: »Wir kaufen meinen Anzug lieber beim Süß aus Müden, da weiß man, was man hat.«
Die Firma Süß in Müden, einem kleinen Moselort, verkaufte Stoffe und Bekleidung in der ganzen Gegend.
»Außerdem bleibt das Geld dann auch in der Region.«
Ein Satz, den Vater oft gebrauchte und der sich bei uns Kindern fest einprägte.
»Aber dann kaufen wir in Müden nur den Stoff. Den Anzug kann jedenfalls der Scherenpitter nähen. Seine Frau lässt schon seit drei Wochen anschreiben. Johann, die brauchen das Geld.«
»In Ordnung.« Vater nickte.
Es war trotz der knisternden Spannung zwischen Vater und Mutter noch ein schöner Abend geworden, und als ich im Bett lag, fiel mir ein, dass ich Klaus noch eine Abreibung geben wollte. Aber morgen war ja auch noch ein Tag.
Diese Regina ging mir nicht aus dem Kopf. Woher war die so plötzlich aufgetaucht?
Eifeler Dialekt sprach sie jedenfalls nicht! Wie war die eigentlich angezogen gewesen?
Gelbe Söckchen. Flache Schuhe. Wie Schläppchen. So lief sonst kein Mädchen bei uns herum. Morgen würde ich mich nach ihr erkundigen.
II
Schon am nächsten Tag sah ich sie wieder. Sie stand an den Brennnesseln in der Nähe des Straßengrabens, durch den nicht nur das Oberflächenwasser der Fahrbahn lief, sondern auch Küchenabwässer und Fäkalien aus übervollen Güllegruben. Der Graben roch immer, und an heißen Tagen stank er. So wie heute.
Regina schaute unentwegt zu Herbert, Manfred und mir herüber. Wir drei spielten auf einem an diesem Morgen von Schäfers Jäb abgekippten Sandhaufen, den Vater bestellt hatte. Im Brotlager sollte eine Mauer eingezogen werden.
Nicht dass wir wie Kindergartenkinder – diesen Begriff kannte damals keiner, denn in unserem Dorf gab es noch keinen Kindergarten – im Sand mit Eimer und Schaufel spielten.
Nein, wir bauten eine Burganlage, die den ganzen kegelförmigen Sandhaufen umfasste, mit umlaufendem Wehrgraben, Vormauern, Toren, Ecktürmen und Bergfried.
Eigentlich war es mir zu dumm, als Zwölfjähriger mit meinen gut ein Jahr jüngeren Freunden im Sand zu spielen. Aber was gab es sonst an diesem Tag zu tun?
Brennnesseln köpfen? – Hatten wir vorgestern schon.
Steine werfen? – Bitte nicht heute.
Indianer spielen? – Ja, vielleicht, aber richtige Lust? Nein.
Auf der Ley rumhängen? – Da war bestimmt niemand bei der Hitze.
Dann doch lieber eine mittelalterliche Burg im feinen gelben Rheinsand bauen.
»Was will die denn?«, fragte Herbert, während er aus feuchtem Sand einen Eckturm formte und zu Regina hinüberschaute.
»Die ließ sich gestern schon an unserem Steinhaufen nicht vertreiben«, ergänzte Manfred. »Und wie vornehm die spricht. Die soll ja abhauen!« Dabei schaute er zum Straßengraben, hatte aber nicht den Mut, seinen Satz laut zu sagen.
»Die heißt Regina und ist bei ihrer Oma im Scholtese Haus zu Besuch«, wusste Herbert.
Im Scholtese Haus, einem kleinen Haus ohne Scheune und Stallungen, lebte ein älteres Ehepaar. Brasch hießen sie. Sie wohnten erst seit Januar in dem Häuschen, das etwa 100 Meter von uns entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite lag. Der alte Brasch ging am Stock und seine Frau war groß und grauhaarig und schaute immer ernst drein. Man sah sie selten im Dorf. Es waren Flüchtlinge. Vier Flüchtlingsfamilien lebten in unserem Ort. Deren Kinder erkannte man an den Stricksachen, die sie trugen.
Aber Braschs Enkelkind war anscheinend anders!
Regina, das registrierte ich erstaunt und bewundernd zugleich, trug heute rote Söckchen und ein blau geblümtes Kleid mit kurzen Ärmeln. Es sah gut aus. Aber seit wann interessierte mich, wie ein Mädchen angezogen war? Sie trug keine Schürze, wie meine Schwester und die anderen Mädchen im Dorf. Außerdem meinte ich, das Kleid sei ein bisschen kürzer als sonst üblich.
Herbert stand auf und lief mit geballter Faust in Richtung Wassergraben, blieb nach ein paar Metern stehen und rief laut: »Hau ab!«
Regina schien diese verbale Attacke nicht zu beeindrucken, sie rührte sich nicht vom Fleck. Mir kam es vor, als höre sie gar nicht hin, denn sie zog, wie schon die ganze Zeit, ungerührt weiter Striche mit ihrem Stock in den Schotter des Weges.
Mit keiner Miene reagierte sie auf Herberts Zuruf. Sie sah vielmehr unentwegt zu uns herüber, und ich bildete mir ein, sie schaue nur mich an. Ich konnte mir ihre braunen Augen vorstellen, obwohl sie etwa zwanzig Meter von uns entfernt stand. Das machte mich langsam nervös.
»Lass sie doch mitspielen«, sagte ich zu Herbert, der noch immer auf halbem Weg zwischen Sandhaufen und Regina stand, »vielleicht kennt sie auch das Buch von Richard Löwenherz und weiß, wie man eine Burg baut.«
Herbert besaß dieses Buch mit Bildern, auf denen anschaulich Burgen und mittelalterliche Befestigungsanlagen dargestellt waren.
Als Manfred diesen Vorschlag gut fand, und ich Herbert zusicherte, er solle der Baumeister sein, stellte er sich vor uns und betonte: »Aber zu sagen hat die nichts!«
»Und wenn sie nervt«, ich hob den Finger, »jagen wir sie wieder zu ihrer Oma.«
Herbert nickte.
»Komm, kannst mitspielen«, rief ich, als auch schon ihr Stock in die Brennnesseln flog.
Sie rauschte heran, hockte sich mit ihrem Blumenkleid sofort in den gelben Sand und meinte lachend: »Ihr baut aber eine schöne Burg.«
Sie half sofort Manfred beim Anlegen eines Wassergrabens rund um den Sandhügel. Mit ihren feinen Händen, deren Fingernägel nicht abgebrochen und ohne Trauerränder waren, begann sie Mauern und Türme zu formen. Wortlos. Aber konzentriert und sich sofort zurückziehend, wenn sie in den Wirkbereich von einem von uns kam. Sie wollte auf keinen Fall auffallen, kam es mir vor.
Sie lief mit einem blechernen Marmeladeneimer zum Wasserhahn an unserer Garage, in der das Brotauto stand, holte Wasser und befeuchtete den Sand. Wir sprachen nicht viel. Eigentlich sprachen wir gar nicht, sondern beobachteten sie aus den Augenwinkeln und sahen verdutzt, wie sie auf dem Sandhaufen herumkletterte und Türme, Palisaden, Mauern und Gräben entstehen ließ. Mit ihrer Hand grub sie einen Tunnel und fragte nach, wo denn Pallas und Rittersaal seien, ob sie die Kemenate und den Zwinger an die Nordseite bauen dürfe, und ob wir schon an die Burgkapelle gedacht hätten.
Hatte natürlich keiner. Wie auch? Wir hatten zwar die Bilder in Herberts Buch gesehen, aber außer Bergfried, Burgtor und Rittersaal kannten wir nichts. Aber natürlich taten wir so. Besonders Herbert. Ihm gehörte ja das Buch.
Wollte er vor zehn Minuten Regina noch wegjagen, so fachsimpelte er jetzt mit ihr. Regina nickte nur, sagte ja und gut, so als habe sie mitbekommen, dass Herbert der Baumeister war, und sie nichts zu melden hätte.
»Es ist schade«, meinte sie, als wir eine Pause einlegten und unsere Burglandschaft betrachteten, »dass nachher, wenn der Sand trocken ist, alles zerbröselt und zerfällt. Dann sieht die Burg aus wie nach einem feindlichen Angriff.«
Sie kratzte sich am Kopf. »Man müsste den Sand verkleben. Ich glaub, ich hab eine Idee.«
Schon lief sie über die Straße zum Haus ihrer Oma. Ich sah nur auf- und abwippende rote Söckchen.
Während wir drei warteten und die letzten Außenmauern der Sandburg mit unseren Händen glätteten, meinte Manfred, der nie der Gesprächigste war: »Also verkehrt ist sie jedenfalls nicht. Ich meine, für ein Mädchen.«
Aber Herbert maulte nur: »Mal abwarten, wenn sie uns nervt, ist sie weg. Wo bleibt die denn so lange?«
Mehrmals hatte ich in den letzten Minuten in Richtung Scholtese Haus geguckt. Schließlich kam sie angelaufen. Das Kleid flatterte um ihre Beine. Mit einem Satz sprang sie über den Straßengraben und dann stand sie atemlos neben uns.
»Das habe ich Oma stibitzt«, lachte sie und zeigte uns ein faustgroßes rundes Glasgefäß, das oben einen Metalldeckel mit halbkugelförmigen Aufsatz trug, aus dem auf der einen Seite ein dünnes Röhrchen mit einer Düse ragte, und auf der anderen Seite ein kleiner Schlauch mit einem apfelgroßen Gummiball baumelte.
Wir schauten ungläubig auf dieses Gerät. So etwas hatten wir Jungs noch nie gesehen.
»Riecht mal hier vorn«, sagte Regina und hielt jedem das Ende des dünnen Röhrchens an die Nase. Es roch leicht nach Rosen.
»Parfüm«, sagte Manfred mit Kennermiene, »so riecht manchmal meine Mutter. Aber nur sonntags.«
Ich kannte einen solchen Duft nicht.
Mit Mutter verbinde ich vieles. Aber Parfüm? Die einzigen Gerüche, die ich mir eingeprägt habe, waren Nivea Creme, Kernseife und Persil. Montags, wenn Mutter aus der Waschküche im Keller kam, roch sie nach Persil. Genau wie unsere Kleider, denn Mutter wusch nur mit diesem Waschmittel, und bei hartnäckigem Schmutz benutzte sie Kernseife.
»Wer mit Persil wäscht«, sagte Vater, »braucht keine Wässerchen in den Kleidern.«
Mutter lächelte dabei jedes Mal etwas verlegen. Ob Vater zu knauserig war, oder Mutter kein Parfüm wollte, erfuhr ich nie. Viele Jahre später, als Mutter um die sechzig war, stand plötzlich ein Parfümfläschchen im Bad.
»Das ist ein Parfümzerstäuber«, klärte uns Regina auf und lachte, als wir drei uns verdutzt und fragend ansahen.
»Soll jetzt unsere Burg etwa nach deiner Oma und Manfreds Mutter riechen?«, fragte ich einigermaßen verärgert. Für solch einen Mist hatte ich mich nicht bei meinen Freunden für sie stark gemacht. Manfred stieß mich in die Seite und raunte: »Die spinnt ja.«
»Da drin habe ich Zuckerwasser«, erklärte Regina, »damit bespritzen wir die Türme und Mauern der Burg.«
»Oh, wird ja richtig toll. Eine süße Burg!«, lästerte Herbert.
Aber Regina ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und erklärte uns dreien, dass das aufgesprühte Zuckerwasser die Sandkörner verklebe und so die Konstruktion stabilisiere.
Herbert, der im Begreifen von physikalischen Dingen schneller war als Manfred und ich, nickte begeistert und meinte: »Raffiniert!«
Das Zuckerwasser reichte nicht aus. Ich klaute in der Backstube aus dem Zuckersack – auf dem durfte ich nie sitzen, denn der stand im Nebenraum der Backstube – eine Tasse mit Zucker. Den lösten wir in einer Flasche mit Wasser auf und sprühten und sprühten. Mit Löffeln und Küchenmessern konnten wir jetzt einzelne Zinnen auf den Mauern herausarbeiten, Fensternischen auskratzen und Torbögen konstruieren. Wir leckten an unseren klebrigen, sandigen Fingern und lachten und lachten. Der Sand knirschte zwischen unseren Zähnen. Wir lachten noch am nächsten Tag.
Bis zum Abend stand unsere Burg unversehrt auf dem Sandkegel. Dann begann es leicht zu regnen.
III