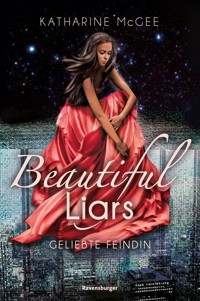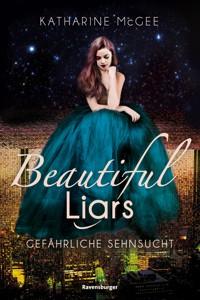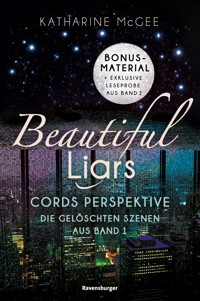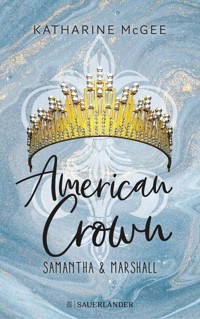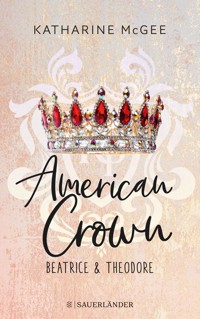
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: American Crown
- Sprache: Deutsch
»Von heute an bist du zwei Menschen auf einmal: das Mädchen Beatrice und Beatrice, die Erbin der Krone. Und wenn sie sich uneins sind und verschiedene Dinge wollen, dann muss die Krone gewinnen. Immer.« Prinzessin Beatrice ist Thronerbin der Vereinigten Staaten von Amerika, und gewohnt, immer im Rampenlicht zu stehen. Doch als sie vor die Frage gestellt wird, wen sie heiraten möchte, fühlt sie sich wie in zwei Teile gespalten: Da ist ihr öffentliches Ich, das auf Veranstaltungen erscheint, und das alle Pflichten der Kronprinzessin perfekt erfüllt. Inklusive der standesgemäßen Heirat. Und dann gibt es da die gestohlenen Momente mit ihrer wahren, heimlichen Liebe. »Originell, frisch und köstlich romantisch. ›Royal Secrets‹ ist ein absoluter Genuss!" – Sarah J. Maas, Autorin von »Throne of Glass« und »Das Reich der Sieben Höfe«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Katharine McGee
American Crown – Beatrice & Theodore
Band 1
Biografie
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »American Royals« bei Random House Children‘s Books, a division of of Penguin Random House LLC, New York
Text copyright © 2019 by Katharine McGee and Alloy Entertainment
Covergestaltung und -abbildung: Carolin Liepins
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0494-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1 Beatrice
2 Nina
3 Daphne
4 Samantha
5 Beatrice
6 Daphne
7 Nina
8 Beatrice
9 Samantha
10 Daphne
11 Nina
12 Beatrice
13 Samantha
14 Nina
15 Daphne
16 Beatrice
17 Samantha
18 Daphne
19 Beatrice
20 Nina
21 Beatrice
22 Samantha
23 Nina
24 Samantha
25 Beatrice
26 Nina
27 Daphne
28 Beatrice
29 Samantha
30 Daphne
31 Nina
32 Samantha
33 Daphne
34 Nina
35 Beatrice
36 Nina
37 Samantha
38 Daphne
39 Beatrice
40 Daphne
41 Nina
42 Samantha
43 Daphne
44 Beatrice
Danksagung
Die Geschichte geht weiter! [...]
Für Alex
Prolog
Du kennst die Geschichte von der amerikanischen Revolution und vom Beginn der amerikanischen Monarchie.
Du kennst sie aus den Büchern, die du als Kind gelesen hast. Oder von den Schultheateraufführungen, bei denen du so gern King George I. oder Queen Martha gespielt hättest, stattdessen dann aber ein Kirschbaum warst. Du kennst sie aus Liedern und Spielfilmen, aus Geschichtsbüchern und von deinem Hauptstadtbesuch inklusive Schlossbesichtigung.
Inzwischen hast du die Geschichte so oft gehört, dass du sie in- und auswendig kennst: wie Colonel Lewis Nicola nach der Schlacht von York vor General George Washington auf die Knie fiel und ihn im Namen der gesamten Nation anflehte, Amerikas erster König zu werden.
Der General sagte natürlich ja.
Historiker debattieren gern darüber, wie die Welt wohl heute aussähe, wenn es damals anders gekommen wäre. Was, wenn General Washington abgelehnt hätte, König zu sein, und stattdessen darum gebeten hätte, als gewählter Volksvertreter eingesetzt zu werden? Als Premierminister – oder vielleicht hätte man dem Amt sogar einen ganz neuen Namen gegeben, Präsident zum Beispiel. Möglicherweise hätten dann andere Nationen – Frankreich, Russland, Preußen, Österreich-Ungarn, China und Griechenland – Amerikas Beispiel folgend ebenfalls ihre Monarchien abgeschafft und ein neues Zeitalter der Demokratie eingeläutet.
Aber das ist nie passiert, wie wir alle wissen. Und du bist nicht hier, um eine Lügengeschichte zu hören. Du bist hier, um zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Wie Amerika heute, zweihundertfünfzig Jahre später, aussieht, während die Nachfahren Georges I. noch immer auf dem Thron sitzen.
Es ist eine Geschichte von rauschenden Bällen und abgelegenen Hinterzimmern. Von Geheimnissen und Skandalen, von Liebe und gebrochenen Herzen. Es ist die Geschichte der berühmtesten Familie der Welt, die ihre Dramen auf der größten Bühne von allen präsentiert.
Dies ist die Geschichte der amerikanischen Königsfamilie.
1Beatrice
Beatrice konnte ihre Ahnenlinie bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgen.
Also genau genommen nur den Zweig von Queen Martha, doch die meisten Leute ließen das lieber unerwähnt. King George I. war im Grunde nichts anderes gewesen als ein ehrgeiziger Pflanzer aus Virginia, der es verstanden hatte, sich gut zu verheiraten und noch besser zu kämpfen. Er hatte sogar so gut gekämpft, dass Amerika mit seiner Hilfe die Unabhängigkeit errang und er zum Dank dafür vom Volk mit der Krone belohnt wurde.
Aber wenigstens durch Martha konnte Beatrice ihre Abstammung mehr als vierzig Generationen zurückverfolgen. Unter ihren Ahnen gab es Könige und Königinnen, Erzherzöge, Gelehrte, Soldaten und sogar einen kanonisierten Heiligen. Der Blick in die Vergangenheit kann uns sehr viel lehren, pflegte ihr Vater immer zu sagen. Vergiss niemals, wo du herkommst.
Es war nahezu unmöglich, seine Vorfahren zu vergessen, wenn man ihre Namen mit sich herumtrug, so wie Beatrice es tat: Beatrice Georgina Fredericka Louise aus dem Hause Washington, Königliche Hoheit von Amerika.
Beatrice’ Vater, King George IV., warf ihr einen Blick zu. Reflexartig setzte sie sich aufrechter hin, während der Zeremonienmeister noch einmal zusammenfasste, was für den morgigen Ball der Königin alles geplant war. Ihre gefalteten Hände ruhten in ihrem Schoß, sie trug einen sittsamen Bleistiftrock, und ihre Füße waren auf Knöchelhöhe gekreuzt. Ihr Benimmlehrer hatte ihr eingetrichtert – indem er bei jedem noch so kleinen Ausrutscher ein Lineal auf ihr Handgelenk schnalzen ließ –, dass eine Dame niemals die Beine übereinanderschlug.
Und Beatrice musste sich besonders streng an die Regeln halten, denn sie war nicht nur eine Prinzessin, sondern auch die erste Frau in der Geschichte des Landes, die eines Tages Amerikas Thron besteigen würde. Die erste Frau, die eigenständige Königin werden würde; nicht bloß die Gemahlin des Königs, sondern eine souveräne Regentin mit Herrschaftsgewalt.
Hätte sie zwanzig Jahre früher das Licht der Welt erblickt, wäre sie zugunsten ihres Bruders Jeff in der Thronfolge übersprungen worden. Aber ihr Großvater hatte dieses jahrhundertealte Gesetz in einem legendären Akt abgeschafft und verfügt, dass in allen nachfolgenden Generationen der Thronanspruch auf das erstgeborene Kind übergehen solle, nicht auf den erstgeborenen Sohn.
Beatrice ließ den Blick über den Konferenztisch vor sich gleiten. Er war übersät mit Papieren und Kaffeebechern, deren Inhalt schon vor geraumer Zeit kalt geworden war. Heute fand die letzte Kabinettssitzung des Jahres statt, und das bedeutete ellenlange Abschlussberichte und endlose Tabellenblätter.
Die Kabinettssitzung wurde wie immer im Sternensaal abgehalten, so benannt wegen der in Gold gemalten Sterne, die an den blau gestrichenen Wänden prangten, und dem berühmten sternförmigen Fenster im Giebel. Das Licht der Wintersonne fiel in den Raum und tüpfelte helle Flecken auf den Tisch. Nur dass Beatrice die warmen Strahlen nicht würde genießen können. Ihr blieb nur selten Zeit, sich draußen an der frischen Luft aufzuhalten, außer an den Tagen, an denen sie noch vor Sonnenaufgang aufstand, um ihrem Vater bei seiner Joggingrunde Gesellschaft zu leisten, flankiert von seinen Leibwächtern.
Einen Augenblick lang überlegte sie entgegen ihrer Gewohnheit, was ihre Geschwister wohl gerade taten, ob sie inzwischen von ihrer turbulenten Reise durch Südostasien zurückgekehrt waren. Samantha und Jeff – Zwillinge und drei Jahre jünger als Beatrice – waren ein gefährliches Gespann. Sie strotzten vor Energie und spontanen Einfällen, steckten voller haarsträubender Ideen und hatten, im Gegensatz zu den meisten anderen Teenagern, alle Möglichkeiten und Mittel, diese auch in die Tat umzusetzen, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. Mittlerweile war es sechs Monate her, dass die Zwillinge die Highschool abgeschlossen hatten, und offensichtlich wussten alle beide nichts mit sich anzufangen – außer die Tatsache zu feiern, dass sie endlich achtzehn waren und legal Alkohol trinken durften.
Niemand erwartete je irgendetwas von den Zwillingen. Sämtliche Erwartungen – die ihrer Familie und letztlich die der ganzen Welt – ruhten auf Beatrice wie ein greller weißer Scheinwerfer.
Endlich schloss der Zeremonienmeister seinen Bericht ab. Der König nickte wohlwollend und stand auf. »Vielen Dank, Jacob. Wenn es sonst keine weiteren Punkte gibt, ist die Sitzung damit für heute beendet.«
Alle Versammelten erhoben sich und schoben sich unter allgemeinem Geplauder über den morgigen Ball oder bevorstehende Urlaube langsam aus dem Raum. Ihre politischen Differenzen hatten sie vorübergehend beigelegt, doch Beatrice wusste, dass im neuen Jahr die alte Rivalität zwischen Republikanern und Föderalisten wieder aufflammen würde.
Connor, ihr persönlicher Leibwächter, stand neben dem Beschützer ihres Vaters draußen auf dem Flur und hob den Blick. Beide Männer gehörten zur Revere-Garde, dem Elitecorps, dessen Angehörige ihr Leben in den Dienst der Krone gestellt hatten.
»Beatrice, könntest du bitte noch einen Moment dableiben?«, fragte ihr Vater.
Beatrice hielt auf der Schwelle inne. »Natürlich.«
Der König setzte sich wieder hin, und Beatrice tat es ihm gleich. »Danke für deine Hilfe bei den Nominierungen«, sagte er. Beide blickten auf das Blatt Papier vor ihm auf dem Tisch, das eine alphabetisch geordnete Namensliste enthielt.
Beatrice lächelte. »Es freut mich, dass du meinen Vorschlägen zugestimmt hast.«
Morgen würde die alljährliche Weihnachtsfeier stattfinden, der sogenannte Ball der Königin. Der Name rührte daher, dass Queen Martha ihren Gatten George I. beim allerersten Weihnachtsball dazu gebracht hatte, Dutzende von Amerikanern, die auf der Seite der Revolution gekämpft hatten, in den Adelsstand zu erheben. Seither war dieser Akt Tradition. Jedes Jahr erteilte der König auf dem Ball einigen amerikanischen Bürgern für ihre Verdienste um das Land den Ritterschlag und machte sie damit zu Lords und Ladys. Und zum ersten Mal hatte er Beatrice die Kandidaten vorschlagen lassen, denen diese Ehre zuteilwerden sollte.
Noch bevor sie fragen konnte, was er von ihr wollte, klopfte es an der Tür. Der König ließ ein erleichtertes Seufzen vernehmen, als Beatrice’ Mutter ins Zimmer schwebte.
Queen Adelaide war sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits adeliger Abstammung. Vor ihrer Heirat mit dem König war sie die angehende Erbin des Herzogtums Canaveral und des Herzogtums Savannah gewesen. Die Doppel-Duchess, so hatten die Leute sie genannt.
Adelaide war in Atlanta aufgewachsen und hatte ihren ätherischen Südcharme nie verloren. Auch jetzt war jede ihrer Gesten von Anmut begleitet: die leichte Neigung ihres Kopfes, während sie ihre Tochter anlächelte, die Drehung ihres Handgelenks, als sie sich auf dem Walnussstuhl rechts neben Beatrice niederließ. Bernsteinfarbene Strähnen schimmerten in ihrem dichten dunkelbraunen Haar, das sie jeden Morgen mit Hilfe aufheizbarer Lockenwickler in Form brachte und mit einem Haarband zurückhielt.
So wie ihre Eltern hier saßen – einer rechts, der andere links von ihr, fast wie eine Eskorte –, hatte Beatrice das ungute Gefühl, dass sie in der Falle hockte.
»Hallo, Mom«, sagte sie mit leiser Verwunderung. Die Königin beteiligte sich sonst nie an den politischen Gesprächen zwischen ihr und ihrem Vater.
»Beatrice, deine Mutter und ich wollten uns mit dir über deine Zukunft unterhalten«, setzte der König an.
Die Prinzessin blinzelte irritiert. Sie dachte pausenlos an die Zukunft.
»Auf einer eher persönlichen Ebene«, erläuterte ihre Mutter. »Wir haben uns gefragt … ob es irgendjemand … Besonderen in deinem Leben gibt?«
Beatrice war perplex. Sie hatte damit gerechnet, dass diese Unterhaltung früher oder später auf sie zukommen würde, und versucht, sich mental darauf vorzubereiten. Sie hatte nur nicht angenommen, dass es so bald passieren würde.
»Nein, gibt es nicht«, versicherte sie ihnen. Ihre Eltern nickten zerstreut; sie wussten beide ganz genau, dass sie keinen Freund hatte. Das ganze Land wusste es.
Der König räusperte sich. »Deine Mutter und ich haben gehofft, dass du langsam damit anfängst, nach einem Partner Ausschau zu halten. Nach dem Mann, mit dem du dein Leben verbringen willst.«
Seine Worte schienen zigfach verstärkt durch den Sternensaal zu hallen.
Beatrice hatte noch keinerlei nennenswerte Erfahrungen in puncto Liebe und Romantik – obwohl es durchaus schon entsprechende Bemühungen verschiedener ausländischer Prinzen ihres Alters gegeben hatte. Der Einzige, der es zu einem zweiten Date mit ihr gebracht hatte, war Nikolaos von Griechenland gewesen. Seine Eltern hatten ihn zu einem Auslandssemester in Harvard gedrängt, darauf hoffend, dass er und die Prinzessin sich Hals über Kopf ineinander verlieben würden. Beatrice hatte sich mit ihm verabredet, um ihre Familien zufriedenzustellen, aber mehr hatte sich nicht daraus entwickelt. Dabei gehörte Nikolaos als jüngerer Spross einer Königsfamilie zu den wenigen Männern, die für eine Verabredung mit Beatrice überhaupt in Frage kamen. Die Auswahl der potentiellen Ehemänner einer zukünftigen Monarchin beschränkte sich schließlich auf Aristokraten und Edelmänner.
Beatrice wusste, dass sie keine Beziehung mit dem Falschen eingehen durfte – dass sie nicht mal den Falschen küssen durfte, so wie es im College anscheinend allgemein üblich war. Denn niemand wollte seine zukünftige Monarchin zerrupft und mit schamgebeugtem Haupt von einer wilden Collegeparty nach Hause wanken sehen.
Nein, es war einfach viel sicherer, wenn die Thronerbin keine sexuelle Vergangenheit hatte, die von der Boulevardpresse zerpflückt werden konnte: keine Altlasten in Form von Verflossenen, keine Exfreunde, die ihre Memoiren veröffentlichten und darin sämtliche intimen Geheimnisse ausbreiteten. In Beatrice’ Beziehungen durfte es keine Hochs und Tiefs geben. Sobald sie offiziell einen Freund hätte, wäre die Sache klar: Sie müssten glücklich, einander treu ergeben und vor allem dauerhaft zusammen sein.
Da ließ Beatrice lieber komplett die Finger von Dates.
Jahrelang hatte die Presse ihr applaudiert, weil sie so sorgsam auf ihren Ruf bedacht war. Doch seit ihrem einundzwanzigsten Geburtstag hatte sich der Ton, den die Medien bei der Diskussion ihres Liebeslebens anschlugen, merklich verändert. Anstatt sie pflichtbewusst und tugendhaft zu nennen, bezeichneten die Journalisten sie nun als einsam und bemitleidenswert – oder, noch schlimmer, als verklemmt. Wenn sie nie einen Freund hätte, so klagten sie, wie sollte sie dann je heiraten und sich der wichtigsten aller Aufgaben widmen, den nächsten Thronerben zu produzieren?
»Findet ihr nicht, dass ich noch ein bisschen zu jung bin, um mir darüber Gedanken zu machen?«, fragte Beatrice und war erleichtert, wie ruhig und gelassen ihre Stimme klang. Aber sie hatte ja auch lange genug geübt, ihre wahren Gefühle vor der Öffentlichkeit zu verbergen.
»Ich war so alt wie du, als ich deinen Vater geheiratet habe. Und im Jahr darauf war ich mit dir schwanger«, erinnerte die Königin sie. Ein geradezu erschreckender Gedanke!
»Das war vor zwanzig Jahren!«, protestierte Beatrice. »Keiner erwartet, dass ich … Ich meine … Heute liegen die Dinge anders.«
»Wir sagen ja auch nicht, dass du morgen zum Altar rennen sollst. Alles, worum wir dich bitten, ist, dass du anfängst, darüber nachzudenken. Die Entscheidung wird nicht leicht werden, und wir wollen dir helfen.«
»Helfen?«
»Es gibt da eine Reihe von jungen Männern, die du ruhig mal näher kennenlernen solltest. Wir haben sie alle zum Ball morgen Abend eingeladen.« Die Königin öffnete den Clipverschluss ihrer großen Saffianledertasche und holte einen Ordner heraus, dessen Inhalt durch bunte Reiter unterteilt war. Sie gab ihn ihrer Tochter.
Auf jedem Reiter stand ein Name. Lord José Ramirez, zukünftiger Duke von Texas. Lord Marshall Davis, zukünftiger Duke von Orange. Lord Theodore Eaton, zukünftiger Duke von Boston.
»Ihr wollt mich verkuppeln?«
»Wir zeigen dir lediglich verschiedene Optionen. Machen dich mit ein paar jungen Männern bekannt, die möglicherweise passend sein könnten.«
Wie betäubt blätterte Beatrice durch die Seiten. Sie waren gespickt mit Informationen: Stammbaum, Fotos, Kopien der Highschoolzeugnisse, sogar Größe und Gewicht der jungen Männer waren vermerkt.
»Habt ihr alle diese Sachen vom Geheimdienst bekommen?«
»Wie? Nein!« Der König guckte schockiert angesichts der Andeutung, dass er seine Privilegien missbraucht haben könnte. »Die jungen Männer und ihre Familien haben uns diese Informationen freiwillig ausgehändigt. Sie wissen genau, worauf sie sich einlassen.«
»Dann hast du also schon mit ihnen gesprochen«, stellte Beatrice mit ausdrucksloser Stimme fest. »Und ihr wollt, dass ich morgen auf dem Ball mit diesen … potentiellen Ehemännern Bewerbungsgespräche führe?«
»Bewerbungsgespräche klingt schrecklich unpersönlich«, sagte die Königin. »Wir wollen lediglich, dass du dich mal mit ihnen unterhältst. Wer weiß? Vielleicht ist ja einer unter ihnen, der dich überrascht.«
»Na ja, Bewerbungsgespräche trifft es eigentlich schon ganz gut«, räumte der König ein. »Beatrice, wenn du dich für einen jungen Mann entscheidest, wird er nicht nur dein Ehemann. Er wird auch Amerikas erster Prinzgemahl. Und mit der regierenden Königin verheiratet zu sein ist ein Vollzeitjob.«
»Ein Vollzeitjob, der keinen Feierabend kennt«, fügte die Königin hinzu.
Durch das Fenster drang von unten aus dem Marmorhof Gelächter und Geschnatter zu Beatrice herauf sowie eine einzelne Stimme, die tapfer versuchte, den Krach zu übertönen. Vermutlich eine Highschoolklasse bei einem Rundgang durchs Schloss, einen Tag vor Ferienbeginn. Mit dem Daumen fächerte Beatrice die Seiten im Ordner durch. Es war gerade mal ein Dutzend junger Männer.
»Der Ordner ist ganz schön dünn«, sagte sie leise.
Ihr war schon immer klar gewesen, dass sie in einem winzigen Teich fischen würde, dass ihre Liebesoptionen sehr begrenzt wären. Heutzutage war es nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor hundert Jahren, als die Verheiratung des Königs vor allem eine politische Entscheidung und keine Herzensangelegenheit gewesen war. Wenigstens müsste sie nicht heiraten, um ein politisches Bündnis zu besiegeln.
Aber trotzdem schien es reichlich optimistisch zu hoffen, dass sie sich in jemanden aus dieser kurzen Liste verlieben würde.
»Dein Vater und ich haben sehr gründlich recherchiert. Wir sind sämtliche Söhne und Enkelsöhne aller Adelshäuser durchgegangen, bevor wir diese Liste erstellt haben«, erklärte ihre Mutter ruhig.
Der König nickte. »Es sind ein paar gute Optionen darunter, Beatrice. Die jungen Männer in diesem Ordner sind alle sehr klug, umsichtig und stammen aus guten Familien. Sie gehören zu der Art Männer, die dich unterstützen und ihr eigenes Ego zurückschrauben würden.«
Aus guten Familien. Beatrice wusste genau, was das bedeutete. Es waren die Söhne und Enkel von hochrangigen amerikanischen Adligen, denn die ausländischen Prinzen, die vom Alter her in Frage kamen – Nikolaos oder Charles von Schleswig-Holstein oder Großherzog Pieter –, waren bereits alle bei ihr durchgefallen.
Beatrice blickte zwischen ihren Eltern hin und her. »Und was, wenn mein zukünftiger Ehemann nicht auf dieser Liste steht? Was wenn ich keinen von denen heiraten will?«
»Du hast sie doch noch nicht mal kennengelernt«, unterbrach ihr Vater sie. »Außerdem wurde die Ehe zwischen deiner Mutter und mir auch arrangiert, und sieh nur, was daraus geworden ist.« Der König und die Königin sahen sich mit einem zärtlichen Lächeln an.
Beatrice nickte ein wenig zuversichtlicher. Sie wusste, dass ihr Vater ihre Mutter auf die gleiche Weise ausgesucht hatte, aus einer vorab ausgewählten Liste. Vor dem Tag ihrer Hochzeit hatten sie sich höchstens ein Dutzend Mal gesehen. Und ihre arrangierte Verbindung war dann zu einer echten Liebesehe herangereift.
Sie erwog die Möglichkeit, dass ihre Eltern recht hatten, dass sie sich tatsächlich in einen der jungen Männer aus diesem schrecklich dünnen Ordner verlieben könnte.
Nein, das war eher unwahrscheinlich.
Sie hatte die Adelsabkömmlinge zwar noch nicht persönlich kennengelernt, doch sie ahnte bereits, worauf sie sich gefasst machen konnte: auf die gleiche Sorte junger, verwöhnter, selbstverliebter Männer, die schon seit Jahren um sie herumschwirrte. Die Sorte Männer, die sie an der Uni tunlichst abgewiesen hatte, wann immer sie sie zu einer Abschlussfeier oder einem Verbindungsabend einladen wollten. Die Sorte Männer, die in ihr keinen Menschen sahen, sondern nur eine Krone.
Und manchmal, dachte Beatrice insgeheim, sahen ihre Eltern sie genauso.
Der König stützte sich mit flachen Händen auf dem Konferenztisch auf. An seinen gebräunten Fingern funkelten zwei Ringe: der schlichte goldene Ehering und daneben der schwere Ring mit dem Großen Siegel von Amerika. Sinnbildhaft für seine zwei Ehen, die mit ihrer Mutter und die mit seinem Land.
»Wir haben immer gehofft, dass du mal jemanden findest, den du liebst und der darüber hinaus den Anforderungen eines Lebens im Schatten der Krone gewachsen ist«, sagte er. »Jemand, der zu dir und zu Amerika passt.«
Beatrice hörte den unausgesprochenen Subtext heraus: Wenn sie niemanden fände, der beide Kriterien erfüllte, müsste Amerika an erster Stelle kommen. Es war wichtiger, dass sie jemanden heiratete, der diesen Job meistern könnte, als ihrem Herzen zu folgen.
Offen gestanden hatte Beatrice schon vor langer Zeit aufgehört, ihr Herz zu befragen. Ihr Leben gehörte ihr nicht, ihre Entscheidungen waren nie ganz und gar ihre eigenen – das wusste sie schon seit ihrer Kindheit.
Ihr Großvater, King Edward III., hatte es ihr damals auf seinem Sterbebett gesagt. Die Erinnerung daran war in ihr Gedächtnis eingebrannt: der sterile Krankenhausgeruch, das gelbe Neonlicht, die entschiedene Art, wie ihr Großvater alle anderen aus dem Raum geschickt hatte.
»Ich muss Beatrice ein paar Dinge sagen«, hatte er erklärt, mit diesem furchterregenden Grollen in der Stimme, das nur ihr vorbehalten war.
Der sterbende König hatte Beatrice’ kleine Hände in seine eigenen gebrechlichen genommen. »Vor langer Zeit gab es Monarchien, damit das Volk dem Monarchen dienen konnte. Jetzt muss die Monarchie dem Volk dienen. Denke immer daran, dass es eine Ehre und ein Privileg ist, eine Washington zu sein, und widme dein Leben dieser Nation.«
Beatrice hatte feierlich genickt. Sie wusste, dass es ihre Pflicht war, dem Volk oberste Priorität einzuräumen; seit ihrer Geburt war ihr das von allen Seiten wieder und wieder gesagt worden. Die Worte »Im Dienste Gottes und des Landes« hatten buchstäblich an den Wänden ihres Kinderzimmers geprangt.
»Von heute an bist du zwei Menschen auf einmal: das Mädchen Beatrice und Beatrice, die Erbin der Krone. Und wenn sie sich uneins sind und verschiedene Dinge wollen«, hatte ihr Großvater streng gesagt, »dann muss die Krone gewinnen. Immer. Schwöre es mir.« Seine Finger hatten sich mit erstaunlicher Kraft um die ihren geschlossen.
»Ich schwöre es«, hatte Beatrice geflüstert. Soweit sie sich erinnerte, war es keine bewusste Entscheidung gewesen, diese Worte zu sagen; wie von einer höheren Macht, vielleicht dem Geist Amerikas selbst, waren sie ihrer Brust entrissen worden.
Und gemäß diesem heiligen Schwur lebte Beatrice. Sie hatte immer gewusst, dass diese Entscheidung irgendwann auf sie zukäme. Aber dass nun alles so plötzlich ging und ihre Eltern erwarteten, dass sie sich bereits morgen Abend daranmachte, einen Ehemann auszusuchen – noch dazu von solch einer bescheiden kurzen Liste –, ließ ihr den Atem stocken.
»Du weißt, dass dieses Leben kein Zuckerschlecken ist«, sagte der König sanft. »Dass es von außen betrachtet ganz anders aussieht als von innen. Beatrice, es ist absolut unabdingbar, dass du den richtigen Partner dafür findest. Jemanden, der dir in schwierigen Situationen zur Seite steht und deine Erfolge mit dir teilt. Deine Mutter und ich sind ein Team. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft.«
Beatrice schluckte gegen den Kloß in ihrer Kehle an. Also gut, wenn sie zum Wohl des Landes heiraten musste, konnte sie die Männer von der Auswahlliste ihrer Eltern ja wenigstens mal anschauen.
»Wollen wir die Kandidaten zusammen durchgehen, bevor ich sie morgen kennenlerne?«, sagte sie schließlich und schlug die erste Seite des Ordners auf.
2Nina
Nina Gonzalez polterte die rückwärtige Treppe des Vorlesungssaals hinauf und steuerte ihren Stammplatz auf der Empore an. Unter ihr erstreckten sich Hunderte roter Auditoriumsstühle, die fest mit einem Holzpult verbunden waren. Fast alle Plätze waren besetzt. Einführung in die Weltgeschichte war ein Pflichtkurs für alle Studienanfänger des King’s Colleges. So hatte es King Edward I. bei der Gründung der Universität im Jahr 1828 per Dekret verfügt.
Sie krempelte die Ärmel ihres Flanellhemds hoch, und an einem ihrer Handgelenke blitzte eine Tätowierung auf, eckige Linien auf ihrer bronzefarbenen Haut. Es war das chinesische Schriftzeichen für Freundschaft. Auf Samanthas Beharren hin hatten sie sich das Tattoo gemeinsam stechen lassen, als Erinnerung an ihren achtzehnten Geburtstag. Natürlich durfte man an Samantha keine Tattoos sehen, deshalb saß ihres an einer versteckteren Stelle.
»Du kommst doch heute Abend?« Ninas Freundin Rachel Greenbaum lehnte sich vom Nachbarstuhl zu ihr herüber.
»Heute Abend?« Nina schob sich eine Strähne ihres dunklen Haars hinters Ohr. Ein süßer Typ am Ende der Reihe sah in ihre Richtung, aber sie ignorierte ihn. Er ähnelte zu sehr dem Jungen, über den sie hinwegzukommen versuchte.
»Wir treffen uns alle im Gemeinschaftsraum, um uns die Live-Übertragung des Balls der Königin anzusehen. Ich habe Kirschtörtchen gebacken, nach dem offiziellen Rezept aus dem Washington-Kochbuch. Ich habe sie sogar mit Kirschen aus dem Palastshop garniert, damit sie möglichst authentisch sind«, erklärte Rachel eifrig.
»Hm, klingt köstlich.« Diese Kirschtörtchen waren weltberühmt, schon seit Generationen wurden sie bei jeder Gartenparty und zu jedem Empfang im Palast serviert. Was Rachel wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass die Washingtons diese Törtchen insgeheim verabscheuten?
Ehrlich, es wäre weitaus authentischer gewesen, wenn sie scharfes Grillfleisch gemacht hätte. Oder Frühstückstacos. Beides aß die königliche Familie nämlich mit erschreckender Regelmäßigkeit.
»Also kommst du jetzt, oder was?«, drängelte Rachel.
Nina gab sich alle Mühe, bedauernd zu schauen. »Ich kann nicht. Ich habe heute Spätschicht.« Sie arbeitete in der Universitätsbibliothek, wo sie Bücher in Regale einsortierte; der Job war Bestandteil ihres Studium-Plus-Programms, das die Kosten ihres Stipendiums trug. Aber selbst wenn sie nichts zu tun gehabt hätte, Nina hegte nicht den leisesten Wunsch, sich die Berichterstattung vom Ball der Königin anzusehen. Sie hatte mehrere Jahre in Folge selbst an diesem Ball teilgenommen, und jedes Mal war es mehr oder weniger das Gleiche.
»Ich wusste gar nicht, dass die Bibliothek freitagabends geöffnet ist.«
»Vielleicht magst du mir ja Gesellschaft leisten? Ein paar Jungs aus dem Abschlussjahrgang müssen noch für ihre Prüfung büffeln; du könntest dir also einen Älteren angeln«, frotzelte Nina.
»Niemand außer dir träumt von einer romantischen Begegnung in der Bibliothek.« Rachel schüttelte den Kopf und seufzte wehmütig. »Ich überlege schon die ganze Zeit, was Prinzessin Beatrice heute Abend wohl tragen wird. Erinnerst du dich noch an ihr Kleid von letztem Jahr? Das mit dem transparenten Spitzeneinsatz am Ausschnitt? Das war so elegant.«
Nina hatte keine Lust, über die Königsfamilie zu reden, schon gar nicht mit Rachel, die von dem Thema förmlich besessen war. Sie hatte Nina mal erzählt, dass sie als Kind ihren Goldfisch Jefferson genannt hatte – und zwar alle zehn Exemplare in Folge. Doch eine tiefverwurzelte Loyalität Samantha gegenüber ließ Nina trotzdem antworten. »Und was ist mit ihrer Schwester? Sie sieht auch immer bildschön aus.«
Rachel gab ein vagen, missbilligenden Laut von sich und ignorierte die Frage. Es war eine nur allzu typische Reaktion. Die Nation vergötterte Beatrice, ihre zukünftige Königin – zumindest die meisten Leute taten dies, abgesehen von ein paar sexistischen, reaktionären Grüppchen, die immer noch gegen den Thronfolgeakt protestierten. Diese Leute hassten Beatrice, einfach weil sie die Unverfrorenheit besaß, eine Frau zu sein, die den Thron erben würde, der immer Männern vorbehalten gewesen war. Sie bildeten zwar eine Minderheit, aber sie waren lautstark und präsent, trollten sich hartnäckig durch die Kommentarspalten von Online-Artikeln über Beatrice und buhten sie bei öffentlichen Auftritten aus.
Während also das Gros der Nation Beatrice liebte, geriet es bei ihrem Bruder Jefferson förmlich in ekstatische Verzückung; es war wie ein kollektives Seufzen, das durch das ganze Land zu gehen schien. Er war der einzige männliche Nachkomme, und offenbar war die Welt bereit, ihm alles zu verzeihen. Ganz im Gegensatz zu Nina.
Und was Samantha anging … bestenfalls fanden die Leute sie unterhaltsam. Und schlimmstenfalls, was eher die Regel war, missbilligten sie sie zutiefst. Sie kannten Sam einfach nicht. Nicht so, wie Nina sie kannte.
Professor Urquhart erklomm mit donnernden Schritten das Podium und rettete sie vor einer Antwort. Hektische Aktivität erfasste den Saal, als siebenhundert Studenten ihre gemurmelten Gespräche abbrachen und die Laptops vor sich zurechtrückten. Nina, die vermutlich der letzte Mensch war, der sich noch handschriftliche Notizen in einem Spiralblock machte, setzte die Spitze ihres Bleistifts auf eine leere Seite und hob erwartungsvoll den Blick. Staubkörnchen schwebten in den Lichtstrahlen, die durch die Fenster fielen.
»Wie wir im Laufe des Semesters ja bereits gehört haben, waren politische Bündnisse zur Zeit der Jahrhundertwende typischerweise bilateral und leicht zerbrechlich – weshalb man auch so viele mittels Heirat besiegelte«, begann Professor Urquhart. »All dies wandelte sich mit der League of Kings: ein Abkommen zwischen verschiedenen Nationen, zum Schutz der kollektiven Sicherheit und des allgemeinen Friedens. Die League wurde 1895 in Paris gegründet, unter dem Vorsitz von …«
Louis, soufflierte Nina innerlich. Das war der unkomplizierteste Aspekt der französischen Geschichte: Ihre Könige hießen allesamt Louis bis zum aktuellen König, Louis XXIII. Im Ernst, die Franzosen waren, was Louis anging, sogar noch schlimmer als die Washingtons mit George.
Sie notierte sich die Worte ihres Professors auf ihrem Block. Wenn sie doch nur aufhören könnte, an die Washingtons zu denken! Das College sollte schließlich ein Neustart sein, eine Chance, um endlich herauszufinden, wer sie wirklich war, befreit vom Einfluss der königlichen Familie.
Von klein auf war Nina die beste Freundin von Prinzessin Samantha gewesen. Sie hatten sich vor zwölf Jahren kennengelernt, als Ninas Mutter Isabella zu einem Vorstellungsgespräch ins Schloss gebeten worden war. Der vorherige König – Edward III., Samanthas Großvater – war vor kurzem gestorben. Und der neue König brauchte einen Kämmerer. Isabella war damals Angestellte bei der Handelskammer und erstaunlicherweise hatte ihr Chef sie Seiner Majestät empfohlen. Um Jobs im Palast bewarb man sich nicht. Der Palast erstellte eine Liste mit potentiellen Anwärtern, und wenn man Glück hatte, nahmen sie Kontakt mit einem auf.
Am Tag des Vorstellungsgesprächs war Ninas Mom Julie nicht in der Stadt gewesen, und der Babysitter hatte in allerletzter Minute abgesagt, so dass Ninas Mama Isabella nichts anderes übriggeblieben war, als Nina mitzunehmen. »Du bleibst jetzt schön brav hier«, hatte sie in mahnendem Ton gesagt und sie auf eine Bank in einem Flur im Erdgeschoss gesetzt.
Nina hatte es gewundert, dass das Vorstellungsgespräch ihrer Mama wirklich im Palast selbst stattfand, aber wie sie bald erfahren sollte, war der Washington-Palast nicht nur der Wohnsitz der Königsfamilie, sondern bildete auch das administrative Zentrum der Krone. Im überwiegenden Teil der sechshundert Schlossräume waren Büros und öffentliche Anlaufstellen untergebracht. Die Privatwohnungen lagen im zweiten Stock.
Die siebenjährige Nina zog die Füße unter ihren Körper und schlug lautlos das mitgebrachte Buch auf.
»Was liest du da?«
Ein Gesicht, eingerahmt von dichtem kastanienbraunem Haar, spähte um die Ecke. Nina erkannte Prinzessin Samantha sofort – obwohl sie mit den Zebraleggins unter ihrem Paillettenkleid nicht gerade sehr prinzessinnenhaft aussah. Ihre Fingernägel waren in Regenbogenfarben lackiert, jeder Finger in einem anderen Ton.
»Ähm …« Nina verbarg das Cover in ihrem Schoß. Das Buch handelte von einer Prinzessin, einer fiktiven allerdings, trotzdem fühlte es sich irgendwie komisch an, das einer echten Prinzessin gegenüber zuzugeben.
»Mein kleiner Bruder und ich lesen gerade eine Drachengeschichte«, erklärte Samantha und neigte den Kopf zur Seite. »Hast du ihn gesehen? Ich kann ihn nicht finden.«
Nina schüttelte den Kopf. »Ich dachte, ihr seid Zwillinge«, konnte sie sich nicht verkneifen.
»Ja schon, aber ich bin vier Minuten älter, also ist er mein kleiner Bruder«, entgegnete Samantha mit unschlagbarer Logik. »Willst du mir helfen, ihn zu suchen?«
Samantha war das reinste Energiebündel. Sie hüpfte die langen Flure hinunter, riss eine Tür nach der nächsten auf und spähte auf der Suche nach ihrem Bruder hinter alle Möbel. Die ganze Zeit plapperte sie ohne Unterlass und zeigte Nina all ihre persönlichen Palasthighlights.
»Da drinnen spukt der Geist von Queen Thérèse. Ich weiß, dass sie es ist, denn der Geist spricht Französisch«, erklärte sie mit unheilvoller Stimme und wies auf den verrammelten Salon im Erdgeschoss. »Früher bin ich immer auf Rollerskates durch die Gänge gedüst, aber dann hat mich mein Papa erwischt, und er hat’s mir verboten. Beatrice hat’s auch gemacht, aber bei ihr ist es immer egal.« Samantha klang nicht verbittert, nur nachdenklich. »Sie wird eines Tages Königin.«
»Und was wirst du mal?«, fragte Nina neugierig.
Samantha grinste. »Alles andere.«
Sie führte Nina von einem unglaublichen Ort zum nächsten, zeigte ihr Kammern, in denen sich bis unter die Decke glattgebügelte Servietten stapelten, und Küchenräume so groß wie Tanzsäle, mit einem Koch, der ihnen zuckerverzierte Kekse aus einer blauen Dose gab. Die Prinzessin biss sofort ein Stück ab, aber Nina steckte ihren in die Tasche. Er sah zu hübsch aus, um ihn zu essen.
Wieder an der Bank im Flur angelangt, sah Nina voller Staunen, wie ihre Mama zusammen mit dem König den Gang hinunterkam und sich ganz locker mit ihm unterhielt. Dann blickten beide zu ihr, und Nina erstarrte instinktiv.
Der König lächelte, ein liebenswertes, jungenhaftes Lächeln, das seine Augen funkeln ließ. »Wen haben wir denn da?«
Nina war noch nie einem echten König begegnet, doch einer inneren Eingebung folgend – oder vielleicht waren auch die vielen Märchenfilme daran schuld –, versank sie in einem tiefen Knicks.
»Das ist meine Tochter Nina«, murmelte Isabella.
Samantha trottete zu ihrem Vater hinüber und zog ihn an der Hand. »Dad, kann Nina mal zu uns zum Spielen kommen?«, bettelte sie.
Der König richtete seine freundlichen Augen auf Ninas Mama. »Samantha hat recht. Ich hoffe, Sie holen Nina nachmittags hierher. Unsere Arbeitstage werden schließlich nicht gerade kurz sein.«
Isabella blinzelte. »Eure Majestät?«
»Offensichtlich verstehen sich die Mädchen prächtig, und Ihre Frau muss ja auch sehr viel arbeiten. Warum also sollte Nina zu Hause bei einem Babysitter bleiben, wenn sie genauso gut hier sein kann?«
Nina war zu jung, um Isabellas Zögern zu verstehen. »Bitte, Mama?«, quietschte sie, von vibrierendem Eifer erfüllt, und Isabella gab unter tiefem Seufzen nach.
So wurde Nina von einem Tag auf den anderen zum festen Bestandteil im Leben der Zwillinge.
Auf Anhieb wurden sie ein Dreiergespann: der Prinz, die Prinzessin und die Tochter der Kämmerin. Damals hatten Nina die Unterschiede zwischen ihrem und Samanthas Leben nicht groß gekümmert. Denn obwohl Jeff und Samantha Zwillinge und dazu noch königlich waren, gaben sie Nina nie das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wenn überhaupt, waren sie alle gleichermaßen ausgeschlossen von der glamourösen und unerreichbaren Welt der Erwachsenen.
Immer waren Sam und Jeff diejenigen, die neue Pläne ausheckten, während Nina vergeblich versuchte, sie davon abzubringen. Sie büxten dem Kindermädchen aus und machten sich auf die Suche nach Abenteuern, planschten heimlich im beheizten Innenpool oder durchforsteten das ganze Gebäude nach Panikräumen und Bunkern, die angeblich im Palast versteckt waren. Einmal überredete Samantha sie dazu, unter dem Tischtuch versteckt eine private Unterredung zwischen dem König und dem österreichischen Botschafter zu belauschen. Bereits nach zwei Minuten wurden sie erwischt, weil Jeff am Zipfel der Tischdecke zog und so den Wasserkrug umriss. Aber da hatte Samantha schon längst Honig in den Schuh des Botschafters gegossen. »Wenn du keinen Honig in deinen Schuhen haben willst, zieh sie nicht unter dem Tisch aus«, sagte sie später mit übermütig blitzenden Augen.
Die Tatsache, dass Samanthas und Ninas Freundschaft all die Jahre überlebt hatte, war ein Beweis für die Entschlossenheit der Prinzessin. Sie ließ nicht zu, dass sie auseinanderdrifteten, nicht, als sie auf verschiedene Schulen gingen, und auch nicht, als Ninas Mutter zur Schatzministerin berufen wurde und das Amt der Kämmerin niederlegte. Beharrlich lud Samantha Nina weiter zu Pyjamapartys oder zu Urlauben in eines der zahlreichen Ferienhäuser der Washingtons ein und nahm sie als ihre offizielle Begleitung zu Veranstaltungen mit.
Ninas Eltern beobachteten die Freundschaft zwischen ihrer Tochter und der Prinzessin mit gemischten Gefühlen.
Isabella und Julie hatten sich vor vielen Jahren an der Uni kennengelernt. Inzwischen zählten sie zu einem der Washingtoner Powerpaare: Isabella war Schatzministerin, Julie Gründerin eines erfolgreichen E-Commerce-Unternehmens. Sie stritten nicht oft, aber Ninas Verbindung zur Washingtoner Königsfamilie war etwas, über das sie sich nie einig wurden.
»Wir können Nina nicht mitreisen lassen«, hatte Isabella protestiert, als Samantha Nina ins königliche Strandhaus einlud. »Ich möchte einfach nicht, dass sie so viel Zeit mit ihnen verbringt, vor allem nicht, wenn wir nicht dabei sind.«
Nina spitzte die Ohren, als ihre Stimmen über die alten Heizungsrohre in die anderen Räume des Hauses übertragen wurden. Sie saß in ihrem Zimmer im dritten Stock, direkt unter dem Dach. Sie wollte nicht lauschen … andererseits hatte sie ihren Eltern auch nie gesagt, wie gut sie zu hören waren, wenn sie im Zimmer unter ihr miteinander sprachen.
»Warum nicht?«, erwiderte Julie, ihre Stimme merkwürdig verzerrt.
»Weil ich mir Sorgen um sie mache! Diese Welt, in der die Washingtons leben, mitsamt ihren Privatjets und Banketten und der Hofetikette – das ist nicht die Realität. Und egal wie oft sie von ihnen eingeladen wird oder wie sehr Prinzessin Samantha sie mag, Nina wird nie eine von ihnen sein.« Ninas Mama seufzte. »Ich will nicht, dass sie sich vorkommt wie die verarmte Verwandte aus einem Jane-Austen-Roman.«
Nina lehnte sich näher an die Wand, um die Antwort zu verstehen
»Die Prinzessin ist ihr immer eine gute Freundin gewesen«, protestierte Mom. »Und du solltest etwas mehr Vertrauen in unsere Erziehung haben. Im Gegenteil, ich glaube, dass Nina einen positiven Einfluss auf Samantha hat, weil sie durch sie erfährt, wie das Leben außerhalb der Palastmauern aussieht. Die Prinzessin braucht eine normale Freundin.«
Schließlich einigten Ninas Eltern sich darauf, dass sie mitfahren durfte, unter der Bedingung, dass man Nina von der Öffentlichkeit fernhielt und sie niemals im Zusammenhang mit der Presseberichterstattung über die Königsfamilie genannt oder fotografiert würde. Der Palast stimmte bereitwillig zu. Dort war man ebenso wenig erpicht darauf, dass Prinzessin Samantha in den Fokus der Medien rückte.
Im Laufe der Jahre hatte Nina sich an die verrückten Einfälle und die ansteckende Aufgekratztheit ihrer Freundin gewöhnt. Komm, wir führen Albert aus!, schrieb Sam ihr aufs Handy, womit sie den zitronengelben Jeep meinte, den ihre Eltern ihr nach einigem Bitten und Betteln zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatten. Nun hatte sie das Auto, war aber schon mehrmals beim Rückwärtseinparken durch die Fahrprüfung gerasselt und besaß immer noch keinen Führerschein. Was bedeutete, dass letztlich Nina den quietschgelben Jeep durch die Straßen steuerte, während Samantha mit gekreuzten Beinen auf dem Beifahrersitz saß und sie anbettelte, durchs McDonald’s-Drive-in zu fahren. Nach einer Weile störte Nina nicht mal mehr der grimmige Leibwächter, der sie vom Rücksitz aus anstarrte.
Sam machte es Nina leicht, die unzähligen Unterschiede zwischen ihnen zu vergessen. Und Nina liebte Sam, bedingungslos und ohne jede Einschränkung, so wie ihre Schwester, wenn sie eine gehabt hätte. Nur dass ihre Schwester eben die Prinzessin von Amerika war.
Aber in den letzten sechs Monaten hatte sich ihre Beziehung beinah unmerklich verändert. Nina hatte Sam nie erzählt, was am Abend der Abschlussfeier passiert war – und je länger sie es geheim hielt, desto größer schien die Distanz zwischen ihnen zu werden. Dann brachen Sam und Jeff zu ihrer großen Abenteuerreise auf, und Nina begann ihr Collegestudium, und vielleicht war das so auch am besten. Es war Ninas Chance, ein normales Leben zu führen, eines ohne Privatjets, Bankette und Hofetikette, all die Dinge, derentwegen Isabella sich solche Sorgen gemacht hatte. Sie konnte wieder ganz sie selbst sein.
Nina hatte niemandem am King’s College erzählt, dass Samantha ihre beste Freundin war. Sie würden sie vermutlich sowieso für eine Lügnerin halten – oder wenn sie ihr doch glaubten, nur versuchen, sie ihrer Verbindungen wegen auszunutzen. Nina wusste nicht, was davon schlimmer wäre.
Professor Urquhart schaltete sein Mikrophon aus, das Signal für das Ende der Vorlesung. Alle erhoben sich unter Füßescharren und Laptopgeklapper, und gedämpftes Gemurmel erfüllte den Raum. Nina kritzelte noch ein paar letzte Notizen auf ihren Block und warf ihn in ihre Tasche. Dann folgte sie Rachel die Treppen hinunter und trat hinaus in den Innenhof.
Weitere Mädchen aus ihrem Wohnheim gesellten sich hinzu, alle waren schon ganz aufgekratzt wegen des gemeinsamen Fernsehabends anlässlich des Balls der Königin. Sie gingen los Richtung Studentenzentrum, wo sie normalerweise zusammen zu Mittag aßen, aber Nina verlangsamte ihre Schritte und ließ sich unauffällig zurückfallen.
Eine Bewegung am Straßenrand hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Dort kroch mit leise brummendem Motor eine schwarze Limousine entlang. Hinter dem Autofenster klebte ein weißes Blatt Papier mit Ninas handgeschriebenem Namen darauf.
Dieses Gekrakel würde sie überall wiedererkennen.
»Nina? Kommst du?«, rief Rachel ihr zu.
»Tut mir leid, ich habe noch einen Termin bei der Studienberatung«, flunkerte Nina. Sie wartete noch ein paar Sekunden, dann rannte sie über den Rasen zur Limousine.
Auf dem Rücksitz saß Prinzessin Samantha, sie trug eine Jogginghose aus Nickistoff und ein weißes T-Shirt, durch das ihr rosafarbener BH hindurchschimmerte. Eilig stieg Nina in den Wagen und zog die Tür zu, bevor sie jemand sah.
»Nina! Ich habe dich vermisst!« Sam warf ihrer Freundin gewohnt überschwänglich die Arme um den Hals.
»Ich habe dich auch vermisst«, murmelte Nina in Samanthas Schulter. Eine Million Fragen brannten ihr auf der Zunge.
Schließlich löste Samantha sich von ihr und lehnte sich vor zum Chauffeur. »Drehen Sie einfach ein paar Runden um den Campus«, sagte sie zu ihm. Typisch Sam, sie wollte einfach immer in Bewegung bleiben, auch ohne konkretes Ziel.
»Sam, was machst du denn hier? Solltest du dich jetzt nicht für den Ball heute Abend fertig machen?«
Sam senkte verschwörerisch die Stimme. »Ich entführe dich und schleppe dich mit zum Ball – als meine offizielle Begleitung!«
Nina schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich muss heute Abend arbeiten.«
»Aber deine Eltern werden auch da sein. Sie würden sich bestimmt total freuen, dich zu sehen.« Sam atmete tief durch. »Bitte, Nina? Ich könnte wirklich etwas Beistand gebrauchen.«
»Bist du nicht gerade erst zu Hause angekommen?« Worüber konnten ihre Eltern jetzt schon sauer sein?
»Am letzten Morgen in Thailand sind Jeff und ich unseren Leibwächtern entwischt«, gestand Sam und sah dabei aus dem Fenster. Sie fuhren langsam die College Street hinauf, und vor ihnen erhob sich das gotische Backsteingebäude der Dandrige Bibliothek.
»Ihr seid euren Leibwächtern entwischt? Wie?«
»Wir sind weggelaufen«, erwiderte Samantha, wobei sie sich ein Lächeln nicht verkneifen konnte. »Wortwörtlich. Jeff und ich haben uns einfach umgedreht und sind voll in den Gegenverkehr reingerannt, mitten zwischen den Autos hindurch, bis uns jemand aufgegabelt und zur nächsten Mietwagenstation gefahren hat. Wir sind mit dem Quad durch den Dschungel gerast. Das war so krass!«
»Klingt ziemlich gefährlich«, entgegnete Nina, und Sam lachte.
»Du hörst dich exakt wie meine Eltern an! Und genau deshalb brauche ich dich. Ich habe gehofft, wenn du mich heute Abend begleitest …«
»Könnte ich dich im Zaum halten?« Als ob sie die Prinzessin je kontrollieren könnte. Wenn Samantha sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte keine Macht der Welt sie wieder davon abbringen.
»Du bist nun mal das brave Mädchen!«
»Nur im Vergleich zu dir«, konterte Nina. »Und das heißt ja nun wirklich nicht viel.«
»Du solltest mir dankbar sein, dass ich die Messlatte so tief lege«, frotzelte Sam. »Ach, komm schon. Wir seilen uns gleich nach dem Empfang ab, mopsen uns eine Schüssel frischen Kuchenteig aus der Küche und glotzen bis in die Puppen dämliche Reality-Shows. Unsere letzte Pyjamaparty ist schon eine Ewigkeit her. Bitte!«, sagte sie wieder. »Ich habe dich wirklich vermisst.«
Ein so inständiges Flehen der besten Freundin ließ sich nur schwer ignorieren. »Na ja, ich schätze … ich könnte Jodi dazu kriegen, die Schicht mit mir zu tauschen«, sagte Nina nach einem beinah unmerklichen Zögern.
»Danke!«, quietschte Sam aufgeregt. »Apropos, ich habe dir etwas aus Bangkok mitgebracht.« Sie wühlte in ihrer Tasche und förderte schließlich eine Tüte Crispy M&Ms zutage. Auf der knallblauen Verpackung prangten die hübschen Kringel und Schnörkel der Thai-Schrift.
»Du hast dran gedacht.« M&Ms waren Ninas Lieblingssüßigkeit. Sam brachte von ihren Auslandsreisen immer eine Tüte nach Hause mit – sie hatte mal irgendwo gelesen, dass sich die Rezeptur von Land zu Land unterschied, und beschlossen, dass Nina und sie alle durchkosten würden.
»Und? Wie sind sie?«, fragte Sam, als Nina sich eines der Schokobonbons in den Mund gesteckt hatte.
»Köstlich.« Es schmeckte etwas muffig, was in Anbetracht der Tatsache, dass es zusammengequetscht im Seitenfach von Sams Tasche Tausende Meilen weit gereist war, nicht weiter verwunderlich war.
Sie fuhren um eine Kurve, und der Palast kam in Sicht – viel schneller, als es Nina lieb war, aber King’s College lag nun mal nur ein paar Meilen entfernt. Hohe, elegante Virginia-Kiefern standen zu beiden Seiten der Straße Spalier, dahinter ragten Verwaltungsgebäude auf, und es wimmelte nur so von Menschen. Das königliche Schloss hob sich strahlend weiß gegen den emailleblauen Himmel ab. Es spiegelte sich tanzend im Wasser des Potomac wider, so dass es aussah, als wären es zwei Paläste – ein solider und ein wässriger, wie aus einem Traum.
Touristen umklammerten die Stäbe des eisernen Eingangstors, hinter dem Angehörige der königlichen Wachgarde strammstanden und salutierten. In der Mitte der kreisförmigen Auffahrt flatterte die royale Standarte, die Fahne, die signalisierte, dass sich der Monarch im Schloss aufhielt.
Nina holte Luft und wappnete sich innerlich. Sie hatte nicht in den Palast zurückkehren wollen, nicht riskieren wollen, ihnzu sehen. Sie hasste ihn noch immer wegen dem, was in der Nacht der Abschlussfeier passiert war.
Doch noch mehr hasste Nina diesen kleinen Teil ihrer selbst, der sich insgeheim danach sehnte, ihn zu sehen, sogar nach allem, was er getan hatte.
3Daphne
Daphne Deighton drehte den Schlüssel in der Eingangstür ihres Hauses um und hielt kurz inne. Aus reiner Gewohnheit warf sie einen Blick zurück über ihre Schulter und lächelte, obwohl schon seit Monaten keine Paparazzi mehr ihren Vorgarten umlagerten, wie sie es getan hatten, als sie noch mit Jefferson zusammen gewesen war.
Gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, konnte sie eine Ecke des Washington-Palastes sehen. Der Nabel der Welt – oder zumindest ihrer Welt.
Von ihrem Standort aus betrachtet sah er wunderschön aus, die Nachmittagssonne übergoss den weißen Sandstein und die hohen Bogenfenster mit ihrem goldenen Licht. Aber Daphne wusste, dass die Prunkfassade täuschte. Errichtet an der Stelle, wo ursprünglich Mount Vernon gestanden hatte, die Residenz von King George I., war das Schloss von den verschiedenen Monarchen immer und immer wieder umgebaut und erweitert worden, in dem Bemühen, ihm so den jeweils eigenen Stempel aufzudrücken. Mittlerweile war es ein labyrinthisches Gewirr aus verschachtelten Korridoren, Treppengängen und Fluren, das ständig von Menschen überlaufen war.
Daphne lebte mit ihren Eltern am Rand von Herald Oaks, einem Viertel mit herrschaftlichen Häusern östlich des Palastes. Im Gegensatz zu den Anwesen ihrer Nachbarn, die in den vergangenen zweieinhalb Jahrhunderten von Generation zu Generation weitervererbt worden waren, war das Haus der Deightons recht neu. Genau wie ihr Adelsgeschlecht.
Aber wenigstens hatte ihre Familie einen Adelstitel, Gott sei Dank, auch wenn er für Daphnes Geschmack in der aristokratischen Hierarchie etwas zu weit unten angesiedelt war. Ihr Vater Peter war der Baronet Margrave, ein Titel, der Daphnes Großvater einst von King Edward III. verliehen worden war, zum Dank für einen persönlichen diplomatischen Dienst im Zusammenhang mit der Kaiserin Anna von Russland. Keiner in der Familie hatte je erfahren, um welche Art von Dienstleistung es sich dabei genau gehandelt hatte. Aber natürlich hatte Daphne sich ihren Reim darauf gemacht.
Sie zog die Haustür hinter sich zu und ließ die große Ledertasche voller Bücher von ihrer Schulter zu Boden gleiten. Die Stimme ihrer Mutter drang aus dem Esszimmer zu ihr herüber. »Daphne? Kannst du mal herkommen?«
»Ja, sicher.« Daphne bemühte sich, die Gereiztheit in ihrer Stimme zu kaschieren.
Sie hatte damit gerechnet, dass ihre Eltern heute einen Familienrat einberufen würden, genau wie all die Male zuvor: als Jefferson zum ersten Mal mit Daphne ausgegangen war, als er sie eingeladen hatte, zusammen mit seiner Familie in Urlaub zu fahren, und auch an jenem unvorstellbaren Tag, als er mit ihr Schluss gemacht hatte. Jeder Meilenstein ihrer Beziehung mit dem Prinzen hatte eines dieser Gespräche zur Folge gehabt. So funktionierte ihre Familie nun mal.
Obwohl ihre Eltern nicht viel beigetragen hatten. Daphne hatte alles, was sie bei Jefferson erreicht hatte, ganz allein geschafft.
Sie glitt auf den Stuhl gegenüber von ihren Eltern, nahm mit nonchalanter Geste den Eisteekrug und schenkte sich ein Glas voll. Sie wusste bereits, was ihre Mutter als Nächstes sagen würde.
»Er ist gestern Abend zurückgekommen.«
Ihre Mutter musste nicht näher erklären, wer er war. Prinz Jefferson George Alexander Augustus, Jüngster der drei royalen Washington-Geschwister und der einzige männliche Nachkomme.
»Ich weiß.« Als hätte Daphne nicht ein Dutzend Alerts eingerichtet, die sich meldeten, sobald sein Name irgendwo im Internet auftauchte; als wäre sie nicht pausenlos in den sozialen Netzwerken unterwegs, auf der Suche nach dem kleinsten Informationsfitzel über seinen aktuellen Beziehungsstatus. Sie kannte den Prinzen besser als irgendwer sonst, vermutlich sogar besser als seine eigene Mutter.
»Du warst nicht da, um sein Flugzeug in Empfang zu nehmen.«
»Zusammen mit all den kreischenden Fan-Girls? Nein danke. Ich sehe Jefferson heute Abend auf dem Ball.« Daphne weigerte sich beharrlich, den Prinzen Jeff zu nennen, wie alle anderen es taten. Es klang so ganz und gar nicht royal.
»Es ist jetzt sechs Monate her«, sagte ihr Vater. »Bist du dir sicher, dass du bereit bist?«
»Denke schon«, erwiderte Daphne knapp. Natürlich war sie bereit.
Ihre Mutter beeilte sich einzulenken. »Wir wollen dir doch nur helfen, Daphne. Heute ist ein sehr wichtiger Abend. Nach all den Bemühungen …«
Ein Psychologe hätte wohl vermutet, dass Daphne ihren Ehrgeiz von ihren Eltern geerbt hatte, doch, um genau zu sein, war es eher so, dass die elterlichen Ambitionen sich in ihr vergrößerten und konzentrierten wie bei einer Glaslinse, die gestreute Lichtstrahlen bündelt.
Rebecca Deightons sozialer Aufstieg hatte lange vor Daphnes Geburt begonnen. Becky, wie sie sich damals noch nannte, hatte mit neunzehn ihre heimatliche Kleinstadt in Nevada verlassen, ausgerüstet mit nichts weiter als einem umwerfend guten Aussehen und einem rasiermesserscharfen Verstand. Innerhalb weniger Wochen unterschrieb sie einen Vertrag mit einer der führenden Modelagenturen, bald schon prangte ihr Gesicht auf Zeitschriftencovern und Werbeplakaten, Unterwäscheanzeigen und Autoreklamen. Ganz Amerika war hin und weg.
Schließlich erfand Becky sich neu, sie wurde zu Rebecca und machte es sich zum Ziel, einen Adelstitel zu erlangen. Als sie dann Daphnes Vater kennenlernte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Lady Margrave wurde.
Und wenn alles nach Plan lief und Daphne Jefferson heiratete, würden ihre Eltern gewiss in den Hochadel aufsteigen. Vielleicht würden sie Earl und Countess werden … oder möglicherweise sogar Marquess und Marchioness.
»Wir wollen nur das Beste für dich«, fügte Rebecca hinzu, während sie ihre Tochter ansah.
Du meinst wohl das Beste für dich, war Daphne versucht zu antworten.
»Ich komme schon zurecht«, sagte sie stattdessen.
Daphne hatte immer gewusst, dass sie mal den Prinzen heiraten würde. Ja, gewusst – das traf den Nagel auf den Kopf. Nicht gehofft oder davon geträumt oder sich dazu bestimmt gefühlt. Denn in diesen Worten schwang eine gewisse Unsicherheit mit, eine leise Skepsis.
Als sie jünger war, hatte Daphne immer mitleidig auf die Mädchen in ihrer Schule geschaut, die von der königlichen Familie wie besessen waren, die jedes Outfit der Prinzessinnen kopierten und ihre Schließfächer mit Bildern von Prinz Jefferson vollpflasterten. Was sollte es bringen, das Poster des Prinzen anzuschmachten und dabei so zu tun, als wäre er ihr fester Freund? So tun als ob war ein Spiel für kleine Kinder und Narren, und Daphne war weder das eine noch das andere.
Doch dann, in der achten Klasse, unternahm Daphne eine Schulexkursion ins Schloss, und plötzlich verstand sie, warum ihre Eltern sich derart verbissen an ihren aristokratischen Status klammerten. Dieser Status war ihr Tor zu dieser Welt.
Während sie den Palast in all seiner unerreichbaren Pracht bestaunte, während sie ihre Mitschülerinnen leise wispern hörte, wie wundervoll es sein müsse, eine Prinzessin zu sein, kam ihr eine überraschende Erkenntnis: Sie hatten recht. Es war wundervoll, eine Prinzessin zu sein. Weshalb Daphne im Gegensatz zu all den anderen auch eine werden würde.
Nach dem Klassenausflug hatte Daphne also beschlossen, dass der Prinz und sie ein Paar würden, und ihre selbstgesteckten Ziele erreichte sie immer. So auch diesmal. Sie bewarb sich an der privaten Mädchenschule St. Ursula, an der seit Menschengedenken sämtliche Töchter der Königsfamilie ausgebildet wurden. Auch Jeffersons Schwestern gingen dorthin. Und dass Jeffersons Schule, die Forsythe Academy für Jungen, gleich nebenan war, schadete der Sache auch nicht.
Und tatsächlich, am Ende des Jahres – sie war in der Neunten und Jefferson in der Zehnten – bat der Prinz sie um ein Date.
Es war nicht immer leicht, mit jemandem zurechtzukommen, der so sprunghaft und übermütig war wie Jefferson. Aber Daphne verkörperte alles, was eine Prinzessin ausmachte: Sie war reizend und kultiviert und – natürlich – bildschön. Sie bezauberte das amerikanische Volk und die Presse. Sie errang sogar die Anerkennung der Königinmutter, und Jeffersons Großmutter war berüchtigt dafür, dass man ihr nichts recht machen konnte.
Bis zu jenem Abend von Jeffersons Highschoolabschlussfeier, an dem alles so furchtbar aus dem Lot geriet. Als Himari sich verletzte und Daphne losging, um nach Jefferson zu suchen – und ihn im Bett mit einem anderen Mädchen fand.
Es war zweifellos der Prinz, sein im Licht schimmerndes, unverwechselbares dunkelbraunes Haar. Daphne rang nach Atem. Schwarze Punkte tanzten vor ihren Augen. Und das nach allem, was geschehen war, nach all den Mühen, die sie auf sich genommen hatte …
Sie floh aus dem Zimmer, bevor einer der beiden sie sehen konnte.
Jefferson rief am nächsten Morgen an. Kurz befiel Daphne Panik, dass er irgendwie über alles Bescheid wusste – wusste, was für eine undenkbare, schreckliche Sache sie getan hatte. Doch stattdessen stammelte er eine Trennungsrede hervor, die genauso gut aus der Feder seines PR-Beraters hätte stammen können. Immer wieder sagte er, wie jung sie beide noch seien, dass Daphne noch die Schule besuche und er keine Ahnung habe, was er im nächsten Jahr überhaupt machen wolle. Dass es besser für sie beide sei, sich zu trennen, er jedoch die Hoffnung hege, dass sie Freunde bleiben könnten. Daphnes Stimme war geradezu gespenstisch ruhig gewesen, als sie ihm sagte, dass sie ihn sehr gut verstehen würde.
Sobald Jefferson aufgelegt hatte, rief Daphne Natasha von der Daily News an und brachte selbst die Trennungsneuigkeit in Umlauf. Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass die erste Version einer Geschichte immer am wichtigsten war, weil sie den Ton für alle folgenden angab. Also sorgte sie dafür, dass Natasha von einer einvernehmlichen Trennung berichtete: Daphne und Jefferson hatten gemeinsam entschieden, dass es so am besten sei.
Zumindest im Moment, wie der Artikel subtil andeutete.
In den sechs Monaten seit der Trennung war Jefferson pausenlos unterwegs gewesen, erst auf einer offiziellen Repräsentationstour, dann auf Abenteuerreise zusammen mit seiner Zwillingsschwester. Daphne hatte also ausreichend Zeit gehabt, um über ihre Beziehung nachzudenken – darüber, was sie beide getan hatten und welchen Preis sie dafür hatte zahlen müssen.
Trotz allem, was passiert war, und trotz allem, was sie inzwischen wusste, wollte sie immer noch eine Prinzessin sein. Und sie hatte vor, Jefferson zurückzugewinnen.
»Wir versuchen nur, auf dich achtzugeben«, erklärte ihre Mutter mit todernster Stimme, als würde sie über eine lebensbedrohliche Diagnose sprechen. »Gerade jetzt …«
Daphne wusste genau, was ihre Mutter meinte. Jetzt, da Jefferson und sie sich getrennt hatten und das Feld wieder frei war, rannten ihm die Mädchen scharenweise hinterher. Prinzenjägerinnen wurden sie von der Presse genannt. Daphne bezeichnete sie insgeheim als Jeffschlampen. Egal welche Stadt, sie sahen immer gleich aus: Aufgebrezelt mit knappen Röcken und wolkenkratzerhohen Stilettos lungerten sie in Bars oder Hotellobbys herum, darauf hoffend, einen kurzen Blick auf ihn zu erhaschen. Und Jefferson – zerstreut wie eh und je – flatterte vergnügt von einem Ort zum nächsten wie ein Schmetterling, während diese Mädchen ihn mit einsatzbereiten Netzen verfolgten.
Die Prinzenjägerinnen waren für sie keine echte Konkurrenz, keine von ihnen spielte in ihrer Liga. Und dennoch – jedes Mal wenn sie ein Foto von Jefferson sah, umlagert von einer Schar dieser Mädchen, machte sie sich unwillkürlich Sorgen. Es waren einfach so viele.
Ganz zu schweigen von dem Mädchen in Jeffersons Bett, wer auch immer sie war. Ein masochistischer Teil von ihr wollte es unbedingt wissen. Nach jener Nacht hatte Daphne damit gerechnet, dass das Mädchen mit einer schmutzigen Enthüllungsgeschichte an die Öffentlichkeit gehen würde, aber das war nie passiert.
Daphne hob den Kopf und warf einen Blick in den Spiegel über der Anrichte, um sich selbst zu beschwichtigen.
Ohne Zweifel, sie war unglaublich schön – auf diese atemberaubende, selten zu findende Art, die sämtliche Erfolge zu rechtfertigen schien und die meisten Fehler verzeihen ließ. Sie hatte Rebeccas lebhafte Züge geerbt, ihren Alabasterteint und vor allem ihre Augen, diese grün schillernden Seen mit einem Hauch Gold darin, die aussahen, als bärgen sie viele Geheimnisse. Aber ihr Haar hatte sie von Peter. Es war ein wahres Feuerwerk von Rottönen, mit allen möglichen Schattierungen von Kupfer über Zimt bis Kastanie, das ihr in üppigen Wellen fast bis auf die Taille fiel.
Sie lächelte leise, wie immer ermutigt vom Anblick ihres Spiegelbildes.
»Daphne.« Die Stimme ihres Vaters durchschnitt ihre Gedanken. »Egal was auch passiert, du sollst wissen, wir stehen auf deiner Seite. Immer.«
Egal was auch passiert. Daphne warf ihm einen Blick zu. Wusste er, was sie in jener Nacht getan hatte?
»Ich komme schon zurecht«, sagte sie noch einmal und ließ es dabei bewenden.
Sie wusste genau, was man von ihr erwartete. Wenn ein Plan nicht funktionierte, hatte sie einen neuen zu schmieden; wenn sie stolperte und hinfiel, hatte sie nach vorne zu fallen. Für sie durfte es immer nur vorwärts und nach oben gehen.
Ihre Eltern hatten keine Ahnung, wozu Daphne fähig war – keine Ahnung, was sie bereits alles getan hatte, um diese Krone zu erlangen.
4Samantha
An diesem Abend hielt Samantha auf eine unscheinbare Tür zu, die wie ein verspäteter Einfall des Architekten leicht versteckt am Ende des Flurs im Erdgeschoss lag. Sie mochte nicht beeindruckend aussehen, aber das hier war die sogenannte Seufzertür, der königliche Privatzugang zum Ballsaal. Der Name rührte daher, dass Generationen von Prinzessinnen, als sie noch zu jung waren, um am Ball teilzunehmen, heimlich hier gestanden und beim Anblick der tanzenden Paare sehnsuchtsvoll geseufzt hatten.
»Deine Eltern werden dir die Hölle heißmachen«, sagte Nina, die neben ihr ging.
»Vielleicht.« Obwohl Sam bezweifelte, dass ihre Eltern überhaupt Notiz davon genommen hatten, dass sie zu spät dran war. Sie nahmen nie Notiz von irgendetwas, das sie tat, es sei denn, Sam zwang sie dazu, indem sie massiv über die Stränge schlug.
Sams Leibwächter trottete neben ihnen her, den Mund zu einer schmalen Linie zusammengekniffen. Caleb war noch immer sauer auf Sam, weil sie in Thailand abgehauen war. Na ja, sie hatte ja nicht in den Gegenverkehr rennen wollen. Caleb hatte ihr schlichtweg keine Wahl gelassen. Keine ihrer anderen Methoden – überreden, anbetteln, schmollen – hatte bei ihm funktioniert, nicht mal ihr Notfall-Ausredentrick mit Periodenbeschwerden. Der Leibwächter hatte ihr einfach nur wortlos zwei krampflösende Tabletten und eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt.
»Der Spatz ist im Anflug«, raunte Caleb in sein Funkgerät. Sam schluckte die aufwallende Verärgerung hinunter, die ihr Deckname auslöste. Alle Mitglieder der königlichen Familie hatten ein Vogel-Alias: Der König war der Adler, die Königin der Schwan, Beatrice der Falke und Jeff die Blaumeise. Erst vor wenigen Jahren hatte Sam erfahren, warum die Sicherheitskräfte das zweite Kind immer Spatz nannten.
Es reimte sich auf Ersatz. Sam war das Reservekind, die Absicherung für den Fall der Fälle: ein leibhaftiges, atmendes Notaggregat.
Der Herold, der an der Seufzertür postiert war, wagte es nicht, Sams Verspätung zu kommentieren. Er wartete geduldig, während sie Lipgloss aus ihrer Clutch hervorkramte und sich die Lippen auffrischte. Die Farbnuance war speziell für sie kreiert worden, und die Kosmetikfirma hatte ihr einen millionenschweren Lizenzdeal angeboten. Sie wollten den Lipgloss Amerikanische Rose nennen und Sams Gesicht auf die Verpackungen drucken, aber sie hatte abgelehnt. Ihr gefiel die Vorstellung, dass die Lipglossfarbe nur ihr ganz allein gehörte.
Als sie fertig war, nickte sie dem Herold zu, der daraufhin mit einem Schritt in den Ballsaal eintrat und seinen gewaltigen goldenen Zeremonienstab auf den Boden stieß. Der dumpfe Knall prallte auf die Partygeräusche: das Gläserklirren und Füßescharren und das leise Gesumm aus Klatsch und Tratsch.
»Ihre Königliche Hoheit Samantha Martha Georgina Amphyllis aus dem Hause Washington!«
Samantha warf Nina einen allerletzten Blick zu, dann betrat sie den Ballsaal.
Hunderte von Augenpaaren schossen in gieriger Erwartung in ihre Richtung. Hatte sie während ihrer Zeit im Ausland zugenommen? Wie viel hatte ihr Kleid gekostet? Reagierte sie neidisch auf ihre ältere Schwester? Sam versuchte, keine Miene zu verziehen. Sie hatte völlig vergessen, dass der Jahresball ein riesiges Event war, mit allem, was Rang und Namen hatte – Adlige, Politiker, ja sogar der Verdienstadel war samt Ehepartnern geladen.
Kellner, befrackt und mit weißen Handschuhen, trugen Tabletts voller Champagnergläser durch die Menge, und im Hintergrund spielte ein Streichquartett dezente Jazzmusik. Der Saal versank in üppigem Tannengrün, geschmückt mit leuchtenden Christsternblüten und großen roten Samtschleifen. In einer Ecke stand der gewaltige Palastweihnachtsbaum, seine Äste beladen mit altmodischem Baumschmuck aus Popcorngirlanden und kandierten Kirschen, so wie es bei den Washingtons seit Jahrhunderten Tradition war.
Sam entdeckte Jeff draußen auf der Terrasse. Die großen Doppelflügeltüren standen weit offen, und die Ballbesucher strömten hinaus unter das Säulendach, um sich dort unter den Heizstrahlern zusammenzuscharen. Auch ein paar ihrer gemeinsamen Freunde waren darunter. Jeffs Blick traf den ihren, und in seinen Augen blitzte eine unmissverständliche Warnung auf. Im selben Moment legte sich eine Hand schraubstockgleich um Sams Unterarm.
»Samantha. Wir müssen reden.« Queen Adelaide strahlte kühle Eleganz aus. Sie trug ein trägerloses schwarzes Kleid, und ihr glänzendes Haar wurde von zwei Diamantspangen zurückgehalten – jenen berühmten Spangen, die King George II. beim Kartenspiel gegen König Louis XVI