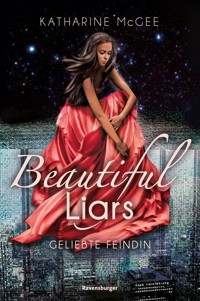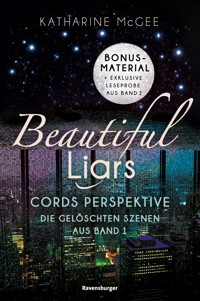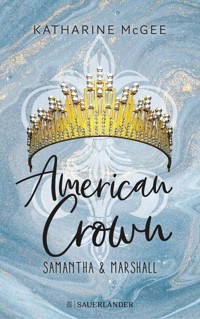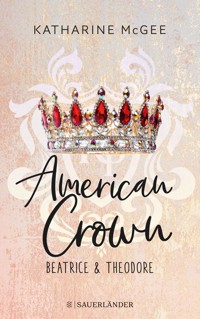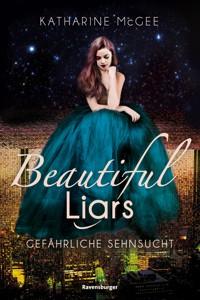
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Beautiful Liars
- Sprache: Deutsch
New York, 2118: Im höchsten Wolkenkratzer der Welt wird für vier Jugendliche nichts mehr so sein wie vor der schlimmsten Nacht ihres Lebens. Denn einer von ihnen hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und die anderen haben die Tat verheimlicht. Sie ahnen nicht, dass jemand weiß, was sie auf dem Dach des Towers getan haben. Und dieser Jemand wird sie nicht so einfach davonkommen lassen ... Um ihr dunkles Geheimnis zu verbergen, müssen sie den schönen Schein um jeden Preis wahren. Doch das ist alles andere als einfach. Denn einer von ihnen kämpft mit gefährlichen Gefühlen für ein gefährliches Mädchen. Eine von ihnen muss zu dem Jungen zurückkehren, dessen Herz sie in tausend kleine Teile zerbrochen hat. Eine von ihnen gerät in einen gefährlichen Strudel aus Hass und Schuld. Und eine von ihnen muss ihre große Liebe verleugnen, um ihre Familie nicht zu zerstören. Noch herzzerreißender, noch gefährlicher - Band 2 der "Beautiful Liars"-Trilogie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2018Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2018 Ravensburger Verlag GmbHCopyright © 2017 by Alloy Entertainment and Katharine McGeePublished by arrangement with Rights People, LondonDie englischsprachige Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Dazzling Heights« bei HarperCollins Children’s Books.
Produced by Alloy Entertainment, LLCÜbersetzung: Franziska Jaekel
Redaktion: Svenja Wulff
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
Verwendete Fotos von © Spa Chan/Shutterstock, © conrado/Shutterstock, © Matipon/ Shutterstock, © Nagy Mariann/Shutterstock, © Jesus Cervantes/Shutterstock
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-47862-0www.ravensburger.de
Für meine Eltern
Prolog
Es sollte einige Stunden dauern, bis man die Leiche des Mädchens fand.
Es war spät, so spät, dass man es schon wieder früh nennen konnte – diese unwirkliche, verzauberte Dämmerungsstunde zwischen dem Ende einer Party und dem Erwachen eines neuen Tages. Die Stunde, in der die Realität sich trübt und an den Rändern verschwimmt, sodass fast alles möglich zu sein scheint.
Das Mädchen trieb mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Über ihr ragte eine Stadt in den Himmel, gesprenkelt mit glühwürmchengleichen Lichtern, jeder nadelstichkleine Punkt eine Person, ein zerbrechliches Fleckchen Leben. Der Mond starrte teilnahmslos hinab wie das Auge einer antiken Gottheit.
Etwas trügerisch Friedliches lag über der Szenerie. Das Wasser umhüllte das Mädchen wie ein glattes dunkles Laken, sodass es aussah, als würde sie bloß ruhen. Ihr Haar umrahmte ihr Gesicht wie eine zarte Wolke. Der Stoff ihres Kleides schmiegte sich an ihre Beine, als wollte er sie vor der kühlen Morgenluft schützen. Aber das Mädchen würde nie mehr frieren.
Ihr Arm war ausgestreckt, als würde sie jemanden erreichen wollen, den sie liebte, oder auch eine unausgesprochene Gefahr abwehren oder vielleicht etwas bedauern, das sie getan hatte. Das Mädchen hatte in seinem viel zu kurzen Leben bestimmt genug Fehler gemacht. Aber sie hätte nicht ahnen können, dass diese Fehler sie heute Nacht auf diese Weise einholen würden.
Denn niemand, der auf eine Party geht, rechnet damit zu sterben.
Mariel
Zwei Monate vorher
Mariel Valconsuelo saß im Schneidersitz auf ihrer gesteppten Tagesdecke in ihrem beengten Zimmer in der einhundertdritten Etage des Towers. Sie war von unzähligen Menschen umgeben, von denen sie nur ein paar Meter und ein oder zwei Stahlwände trennten: ihre Mutter in der Küche, ein paar Kinder, die den Flur hinunterrannten, ihre Nachbarn nebenan, die sich wieder einmal mit gesenkten, erhitzten Stimmen stritten. Doch Mariel hätte in diesem Moment auch ganz allein in Manhattan sein können, so wenig Aufmerksamkeit hatte sie für ihre Umgebung übrig.
Sie beugte sich vor und drückte ihren alten Plüschhasen fest an die Brust. Das trübe Licht eines schlecht übertragenen Holo-Videos flackerte über ihr Gesicht, beleuchtete ihre leicht schräg stehende Nase und das markante Kinn. In ihren dunklen Augen standen Tränen.
Vor ihr flackerte das Bild eines Mädchens mit rotgoldenem Haar und einem durchdringenden Blick aus goldgesprenkelten Augen. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen, als würde sie eine Million Geheimnisse kennen, die niemand jemals erraten könnte. Was wahrscheinlich sogar stimmte. Am Rand des Holo-Videos stand in winzigen weißen Buchstaben: International Times Sterbeanzeigen.
»Heute betrauern wir den Verlust von Eris Dodd-Radson«, begann der Begleitkommentar der Sterbeanzeige – gesprochen von Eris’ Lieblingsschauspielerin. Mariel fragte sich, welche absurd hohe Summe Mr Radson dafür wohl ausgegeben hatte. Die Stimme der Schauspielerin klang für diesen Anlass viel zu munter, sie hätte genauso gut über ihr Yoga-Workout plaudern können. »Eris wurde uns durch einen tragischen Unfall genommen. Sie war erst achtzehn Jahre alt.«
Tragischer Unfall. Mehr habt ihr nicht zu sagen, wenn eine junge Frau unter ungeklärten Umständen vom Dach fällt?, dachte Mariel.
Eris’ Eltern wollten den Leuten damit wahrscheinlich nur verdeutlichen, dass Eris nicht gesprungen war. Als könnte irgendjemand, der sie gekannt hatte, das für möglich halten.
Mariel hatte sich diesen Nachruf schon unzählige Male angesehen, seit das Video letzten Monat veröffentlicht worden war. Inzwischen kannte sie jedes Wort auswendig. Oh, wie sie dieses Video hasste! Es war zu glatt, zu sorgfältig produziert, und Mariel wusste, dass es nicht die wahre Eris zeigte. Aber sie hatte sonst kaum etwas, das sie an Eris erinnerte. Also drückte Mariel ihr abgenutztes altes Kuscheltier an die Brust und quälte sich mit dem Video über ihre Freundin, die viel zu jung gestorben war.
Das Holo-Video schaltete jetzt zu Aufnahmen um, die Eris im Laufe ihres Lebens zeigten: wie sie als Kleinkind in einem magnalektrischen Tutu herumtanzte, das in grellen Neonfarben leuchtete; wie sie als kleines Mädchen mit knallgelben Skiern einen Abhang hinunterjagte; wie sie als Teenager mit ihren Eltern an einem märchenhaften, sonnenüberfluteten Strand Urlaub machte.
Mariel hatte nie so ein Tutu besessen. Im Schnee war sie nur gewesen, wenn sie sich in die Randgebiete von New York oder auf eine der öffentlichen Terrassen in den unteren Etagen nach draußen gewagt hatte. Ihre Welt war ganz anders als die von Eris, aber als sie ein Paar gewesen waren, hatte das überhaupt keine Rolle gespielt.
»Eris hinterlässt ihre geliebten Eltern, Caroline Dodd und Everett Radson, sowie ihre Tante Layne Arnold, ihren Onkel Ted Arnold, ihre Cousins Matt und Sasha Arnold und ihre Großmutter väterlicherseits, Peggy Radson.«
Kein Wort über ihre Freundin Mariel Valconsuelo. Dabei war Mariel die Einzige in diesem ganzen traurigen Haufen – mit Ausnahme von Eris’ Mom –, die Eris wirklich geliebt hatte.
»Die Trauerfeier findet am Dienstag, den ersten November, in der St. Martin’s Kirche in der neunhundertsiebenundvierzigsten Etage statt«, fuhr die Schauspielerin fort, wobei sie sich um einen etwas sachlicheren Tonfall bemühte.
Mariel hatte an der Trauerfeier teilgenommen. Sie hatte mit einem Rosenkranz in der Hand ganz hinten in der Kirche gestanden und sich zusammengerissen, um beim Anblick des Sarges neben dem Altar nicht in Tränen auszubrechen. Es war alles so unwiederbringlich endgültig gewesen.
Im Video erschien eine offenherzige Aufnahme von Eris auf einer Bank in der Schule. Sie hatte die Beine unter ihrem Schuluniformrock perfekt übereinandergeschlagen und neigte lachend den Kopf nach hinten. »Spenden im Gedenken an Eris können an den neu eingerichteten Stipendium-Fonds der Berkeley Academy entrichtet werden, dem Eris-Dodd-Radson-Gedächtnispreis für benachteiligte Schüler mit besonderen Lebensumständen.«
Besondere Lebensumstände. Ob eine Liebesbeziehung zu der verstorbenen Namensgeberin des Preises auch dazu zählt?, fragte sich Mariel. Gott, sie hätte fast Lust, sich für das Stipendium zu bewerben, nur um zu beweisen, wie verkorkst diese Leute hinter all dem Glanz aus Geld und Privilegien waren. Eris hätte dieses Stipendium bestimmt lachhaft gefunden, wenn man bedachte, dass sie überhaupt keine Lust auf die Schule gehabt hatte. Eine Modenschau für Ballkleider wäre viel eher ihr Stil gewesen. Eris hatte nichts mehr geliebt, als Spaß zu haben und glitzernde Kleider zu tragen, vielleicht noch die passenden Schuhe dazu.
Mariel streckte eine Hand aus, als wollte sie das Holo-Video berühren. Die letzten Sekunden des Nachrufs bestanden aus weiterem Filmmaterial von Eris – wie sie mit ihren Freundinnen lachte, dieser Blonden, die Avery hieß, und ein paar anderen Mädchen, an deren Namen sich Mariel nicht erinnern konnte. Sie liebte diesen Abschnitt des Videos, weil Eris so glücklich aussah, hasste ihn gleichzeitig aber auch, weil sie nicht Teil davon war.
Das Logo der Produktionsfirma lief kurz über die letzte Aufnahme, dann wurde das Video ausgeblendet.
Das war’s, die offizielle Geschichte von Eris’ Leben, abgestempelt mit einem verdammten Gütesiegel der International Times. Nur Mariel kam darin nirgends vor. Sie war stillschweigend aus der Geschichte gelöscht worden, als hätte Eris sie nie gekannt. Bei diesem Gedanken lief eine stille Träne über Mariels Wange.
Sie hatte entsetzliche Angst davor, das einzige Mädchen zu vergessen, das sie je geliebt hatte. Schon jetzt wachte sie manchmal mitten in der Nacht mit dem panischen Gefühl auf, dass sie nicht länger vor Augen hatte, wie sich Eris’ Mundwinkel zu einem Lächeln gehoben hatten oder wie sie eifrig mit den Fingern geschnipst hatte, wenn ihr eine neue Idee gekommen war. Nur deshalb schaute sich Mariel dieses Video immer wieder an. Sie durfte ihre letzte Verbindung zu Eris nicht verlieren. Sie lehnte sich in ihr Kissen zurück und begann ein Gebet zu sprechen.
Normalerweise beruhigte sie das Beten, tröstete ihre aufgewühlten Gefühle. Doch heute war sie zu zerstreut. Ihre Gedanken sprangen in die verschiedensten Richtungen, rastlos und schnell wie die Hover-Taxis auf dem Expressway. Sie bekam nicht einen davon zu fassen.
Vielleicht sollte sie stattdessen in der Bibel lesen. Sie griff nach ihrem Tablet und öffnete den Text, tippte auf den blauen Kreis, mit dem sich ein zufälliger Vers öffnen ließ – und blinzelte erschrocken, als sie sah, an welcher Stelle sie gelandet war: das fünfte Buch Mose.
Du sollst kein Mitleid zeigen: sondern du sollst geben Auge um Auge, Zahn um Zahn, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde … denn das ist die Rache des Herrn …
Mariel beugte sich vor, ihre Hände umklammerten fest den Rand ihres Tablets.
Eris’ Tod war kein Unfall unter Alkoholeinfluss gewesen. Davon war Mariel instinktiv überzeugt. Eris hatte an jenem Abend nicht ein Glas angerührt – und sie hatte Mariel erzählt, dass sie noch etwas erledigen müsse, »um einem Freund zu helfen«. Dann war sie aus unerfindlichen Gründen auf das Dach von Avery Fullers Apartment gestiegen.
Mariel hatte sie nie wiedergesehen.
Was war in dieser kalten, windigen und so unfassbaren Höhe tatsächlich geschehen? Mariel hatte von angeblichen Augenzeugen gehört, die die offizielle Geschichte bestätigten – dass Eris betrunken gewesen, ausgerutscht und in den Tod gestürzt war. Aber wer waren diese Augenzeugen? Bestimmt gehörte Avery dazu, aber wie viele Personen waren noch dabei gewesen?
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Worte hallten wie ein Echo in ihrem Kopf wider.
Sturz um Sturz, fügte eine innere Stimme hinzu.
Leda
»Wie hättest du den Raum denn heute gern, Leda?«
Leda Cole verdrehte erst gar nicht die Augen. Sie saß einfach stocksteif auf der graubraunen Psychologencouch, auf der sie sich nie hinlegte, egal wie oft Dr. Vanderstein ihr das schon vorgeschlagen hatte. Er irrte sich gewaltig, wenn er glaubte, dass eine liegende Position sie ermutigen würde, sich ihm zu öffnen.
»Das passt schon so.« Leda machte eine kurze Handbewegung, um das Hologramm-Fenster vor ihr zu schließen, das Dutzende Gestaltungsmöglichkeiten für die Farbmodifikationswände anzeigte – einen englischen Rosengarten, einen heißen Wüstenabschnitt der Sahara, eine gemütliche Bibliothek. Also behielt der Raum seine nichtssagende Grundausstattung – beigefarbene Wände und ein kotzfarbener Teppichboden. Sie wusste, dass das vermutlich ein Test war, bei dem sie jedes Mal versagte, aber sie empfand eine krankhafte Freude, den Arzt dazu zu zwingen, eine Stunde in dieser deprimierenden Umgebung mit ihr zu verbringen. Wenn sie diese Sitzungen schon über sich ergehen lassen musste, sollte er eben auch ein bisschen leiden.
Wie üblich kommentierte er ihre Entscheidung nicht. »Wie fühlst du dich?«, fragte er stattdessen.
Sie wollen wissen, wie ich mich fühle?, dachte Leda wutentbrannt. Wo sollte sie da anfangen? Zunächst einmal war sie von ihrer besten Freundin und dem einzigen Jungen hintergangen worden, für den sie je wirklich etwas empfunden und mit dem sie ihre Unschuld verloren hatte. Jetzt waren die beiden zusammen, obwohl sie Adoptivgeschwister waren. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hatte sie ihren Dad beim Fremdgehen mit einer ihrer Klassenkameradinnen erwischt – Leda konnte sich nicht dazu durchringen, Eris als Freundin zu bezeichnen. Oh, und dann war Eris gestorben, weil Leda sie aus Versehen vom Dach des Towers gestoßen hatte.
»Ich fühle mich gut«, sagte sie knapp.
Sie wusste, dass »gut« nicht ausreichte und sie etwas mitteilsamer werden musste, wenn sie ohne große Schwierigkeiten aus dieser Sitzung rauskommen wollte. Leda war schließlich in einer Entzugsklinik gewesen, sie kannte die Abläufe. Sie atmete tief durch und startete einen zweiten Versuch. »Ich meine, ich erhole mich langsam, in Anbetracht der Umstände. Es ist nicht leicht, aber ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich von meinen Freunden bekomme.« Nicht dass sich Leda tatsächlich um irgendjemanden aus ihrem Freundeskreis scherte. Sie hatte auf die harte Tour gelernt, dass sie keinem von ihnen trauen konnte.
»Hast du mit Avery darüber gesprochen, was passiert ist? Ich weiß, dass sie dabei war, als Eris gestürzt –«
»Ja, Avery und ich haben darüber geredet«, unterbrach Leda ihn schnell. Und wie wir das getan haben, fügte sie in Gedanken hinzu. Avery Fuller, ihre sogenannte beste Freundin, hatte sich als die Schlimmste von allen entpuppt. Leda konnte es nicht ertragen, wenn jemand laut aussprach, was Eris passiert war.
»Und das hat geholfen?«
»Ja, hat es.« Leda wartete darauf, dass Dr. Vanderstein eine weitere Frage stellte, aber er runzelte nur die Stirn und richtete den Blick ins Leere, während er sich in irgendeine Projektion vertiefte, die nur er sehen konnte. Leda wurde plötzlich übel. Was, wenn der Arzt einen Lügendetektor benutzte? Nur weil es keine sichtbaren Anzeichen dafür gab, bedeutete das nicht, dass der Raum nicht trotzdem mit unzähligen Vitalscannern ausgestattet war. Selbst in diesem Moment könnte er ihre Herzfrequenz oder ihren Blutdruck messen, die höchstwahrscheinlich gerade wie verrückt in die Höhe schossen.
Der Psychiater seufzte. »Leda, seit deine Freundin gestorben ist, besuchst du mich regelmäßig, aber wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis du dich besser fühlst?«
»Ich fühle mich doch besser!«, protestierte Leda. »Dank Ihnen!« Sie warf Dr. Vanderstein ein schwaches Lächeln zu, aber er nahm es ihr nicht ab.
»Wie ich sehe, nimmst du deine Medikamente nicht«, wechselte er das Thema.
Leda biss sich auf die Lippe. Sie hatte in den letzten Monaten gar nichts genommen, keine einzige Xenperheidren oder sonst irgendwelche Psychopharmaka, die die Stimmung verbesserten, nicht mal eine Schlaftablette. Sie vertraute sich nicht, was synthetische Mittel anging, nach dem, was auf dem Dach passiert war. Eris mochte eine geldgierige, familienzerstörende Schlampe gewesen sein, aber Leda hatte nie gewollt –
Nein, stoppte sie sich und ballte die Hände zu Fäusten. Ich habe sie nicht umgebracht. Es war ein Unfall. Es war nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Sie wiederholte den Satz wie die Yoga-Mantras, die sie in Silver Cove gelernt hatte.
Wenn sie die Worte oft genug wiederholte, würden sie vielleicht wahr werden.
»Ich versuche, es ohne Medikamente zu schaffen. Wegen meiner Vorgeschichte und so.« Leda hasste es, ihre Entziehungskur zur Sprache zu bringen, aber sie fühlte sich in die Ecke gedrängt und wusste nicht, was sie sonst sagen sollte.
Vanderstein nickte mit einer Art Respekt. »Ich verstehe. Aber es ist ein wichtiges Jahr für dich. Das College liegt in greifbarer Nähe und ich möchte nicht, dass diese … Situation sich ungünstig auf deine akademische Laufbahn auswirkt.«
Es ist mehr als eine Situation, dachte Leda bitter.
»Laut der Aufzeichnungen deines Raumcomputers schläfst du nicht besonders gut. Ich mache mir zunehmend Sorgen«, fügte der Arzt hinzu.
»Seit wann haben Sie Zugriff auf meinen Raumcomputer?«, rief Leda aufgebracht und vergaß für einen Moment ihren ruhigen, gefassten Ton.
Wenigstens besaß der Arzt den Anstand, verlegen zu wirken. »Nur auf die Daten zu deinen Schlafgewohnheiten«, sagte er schnell. »Deine Eltern haben das genehmigt. Ich dachte, sie hätten mit dir darüber gesprochen …«
Leda nickte nur kurz. Das würde sie später mit ihren Eltern klären. Nur weil sie noch minderjährig war, bedeutete das noch lange nicht, dass die beiden einfach in ihre Privatsphäre eingreifen durften. »Mir geht es wirklich gut«, versicherte sie dem Arzt noch einmal.
Vanderstein schwieg wieder. Leda wartete und überlegte. Was konnte er sonst noch tun? Ihre Toilette autorisieren, ihren Urin zu kontrollieren, wie es in der Entzugsklinik üblich war? Tja, das konnte er gerne machen. Er würde nicht das Geringste finden.
Der Arzt drückte auf einen Spender an der Wand, der zwei kleine Pillen ausspuckte. Sie hatten ein fröhliches Pink – wie die Farbe von Kinderspielzeug oder wie Ledas Lieblingskirscheis. »Das sind rezeptfreie Schlaftabletten mit der geringsten Dosierung. Vielleicht probierst du die heute Abend mal, wenn du wieder nicht einschlafen kannst?« Er runzelte die Stirn, während er die dunklen Ringe unter ihren Augen musterte, die scharfen Konturen ihres Gesichts, das noch schmaler wirkte als sonst.
Natürlich hatte er recht. Leda schlief wirklich nicht gut. Ehrlich gesagt hatte sie Angst davor einzuschlafen. Sie versuchte absichtlich so lange wie möglich wach zu bleiben, denn sie wusste, welche schrecklichen Albträume sie erwarteten. Wenn sie irgendwann doch eindöste, wachte sie kurz darauf in kalten Schweiß gebadet wieder auf, gepeinigt von den Erinnerungen an diese Nacht, die sie vor allen anderen verheimlichte.
»Sicher.« Sie nahm die Pillen und steckte sie in ihre Tasche.
»Ich wäre auch sehr froh, wenn du eine unserer anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen würdest – unsere Lichterkennungstherapie oder vielleicht die Trauma-Rückführungstherapie.«
»Ich bezweifle stark, dass es hilfreich wäre, das Trauma noch einmal zu durchleben, wenn man bedenkt, was hinter meinem Trauma steckt«, konterte Leda. Sie hatte nie an diese Theorie geglaubt. Warum sollte es dabei helfen, über ein Trauma hinwegzukommen, wenn man die schmerzhaften Momente in einer virtuellen Realität noch einmal durchleben musste? Außerdem wollte sie im Moment nicht unbedingt irgendwelchen Maschinen erlauben, sich in ihr Gehirn einzuschleichen, für den Fall, dass sie die Gedanken lesen konnten, die tief darin vergraben lagen.
»Was ist mit deinem Traumweber?«, beharrte der Arzt. »Wir könnten ein paar auslösende Erinnerungen an diese Nacht hochladen und abwarten, wie dein Unterbewusstsein darauf reagiert. Du weißt, dass Träume aus den Tiefen deines Gehirns kommen und dir helfen, zu begreifen, was du erlebt hast, ob es nun glückliche oder schmerzvolle Erfahrungen waren …«
Er sagte noch etwas anderes, nannte Träume die »sicheren Orte« des Gehirns, aber Leda hörte nicht mehr zu. In ihren Gedanken war eine Erinnerung an Eris aus der neunten Klasse aufgetaucht, wie sie damit prahlte, dass sie die Kindersicherung an ihrem Traumweber geknackt und nun Zugriff auf die ganze Auswahl an Träumen mit »Erwachseneninhalt« hätte. »Es gibt sogar eine Promi-Einstellung«, hatte Eris mit einem überheblichen Grinsen ihrem andächtigen Publikum erklärt. Leda fiel wieder ein, wie minderwertig sie sich gefühlt hatte, als Eris davon erzählte, wie sie in heiße Träume mit irgendwelchen Holo-Stars eintauchte, während sie selbst sich noch nicht einmal Sex vorstellen konnte.
Abrupt stand sie auf. »Wir müssen diese Sitzung früher beenden. Mir ist gerade etwas eingefallen, um das ich mich noch kümmern muss. Bis zum nächsten Mal.«
Als sie kurz darauf durch die mattierte Flexiglastür der Lyons Klinik trat, die sich auf der East Side der achthundertdreiunddreißigsten Etage befand, plärrten die Mikroantennen in ihren Ohren mit einem unverschämt lauten Klingelton los. Ihre Mom. Leda schüttelte den Kopf und lehnte den Anruf ab. Ilara wollte bestimmt wissen, wie die Sitzung gelaufen war, und kontrollieren, ob sie schon auf dem Heimweg zum Abendessen war. Aber Leda hatte im Moment nicht den Nerv für diese gezwungen fröhliche Normalität. Sie brauchte einen Moment für sich, um ihre Gedanken und ihre Schuldgefühle zum Schweigen zu bringen, die in einem wilden Tumult durch ihren Kopf jagten.
Sie betrat den C-Lift und stieg ein paar Haltestellen weiter oben wieder aus. Kurz darauf stand sie vor einem gigantischen Torbogen, der Stein für Stein von einer alten englischen Universität hierher transportiert worden war. BERKELYACADEMY stand in riesigen Blockbuchstaben darauf.
Leda atmete erleichtert auf, als sie durch den Torbogen trat und ihre Kontaktlinsen sich automatisch abschalteten. Vor Eris’ Tod hätte sie nie gedacht, dass sie einmal dankbar für das Tech-Netz an ihrer Schule sein würde.
Ihre Schritte hallten in den leeren Gängen wider. Es war ein wenig unheimlich, so spät am Abend hier zu sein, denn alles war in trübe, blaugraue Schatten gehüllt. Leda beschleunigte ihre Schritte. Sie lief am Seerosenteich und an den Sportanlagen vorbei bis zu einer blauen Tür am Ende des Schulgeländes. Normalerweise war dieser Raum schon seit Stunden abgeschlossen, aber Leda hatte eine Zugangsberechtigung für die gesamte Schule, weil sie im Schülerrat war. Sie trat näher, damit das Sicherheitssystem ihre Netzhaut scannen konnte, und die Tür schwang gehorsam auf.
Seit ihrem Astronomie-Kurs im Frühjahr war sie nicht mehr in der Sternwarte gewesen. Aber alles sah immer noch genauso aus, wie sie es in Erinnerung hatte: ein gewaltiger, kreisförmiger Raum, gesäumt von Teleskopen, hochauflösenden Bildschirmen und unzähligen Datenprozessoren, deren Funktionsweise Leda nie begriffen hatte. Über ihr erhob sich eine geodätische Kuppel und in der Mitte des Fußbodens befand sich das Glanzstück: ein glitzernder Flecken Nacht.
Die Sternwarte war einer der wenigen Orte des Towers, die sich über den Rand der Etagen darunter hinaus erstreckten. Leda hatte nie verstanden, woher die Schule die bauliche Genehmigung bekommen hatte, aber sie war froh darüber, denn nur deshalb gab es das Oval Eye: ein gewölbtes Oval aus dreifach verstärktem Flexiglas im Boden, etwa drei Meter lang und zwei Meter breit – ein flüchtiger Eindruck der unglaublichen Höhe, in der sie sich so nah an der Spitze des Towers befanden.
Leda näherte sich dem Oval Eye. Es war dunkel dort unten, nichts als Schatten waren zu erkennen. Ein paar verstreute Lichter funkelten herein, wahrscheinlich aus den öffentlichen Parks in der fünfzigsten Etage.
Wieso nicht?, dachte sie euphorisch und trat auf das Flexiglas.
Das war definitiv verboten, aber Leda wusste, dass die Konstruktion sie halten würde. Sie sah nach unten. Zwischen ihren Ballerinas war nichts als Leere, der unglaubliche, endlose Raum zwischen ihr und der leuchtenden Dunkelheit in der Tiefe.
Das hat Eris gesehen, als ich sie gestoßen habe, dachte Leda voller Selbstverachtung.
Sie sank auf den Boden, völlig gleichgültig der Tatsache gegenüber, dass nur ein paar Lagen geschmolzenes Karbonit sie davor bewahrten, zwei Meilen tief hinabzustürzen. Sie zog die Knie an die Brust, senkte den Kopf und schloss die Augen.
Ein Lichtstrahl durchschnitt den Raum. Ledas Kopf schoss panisch in die Höhe. Niemand sonst hatte Zugang zur Sternwarte, nur die restlichen Schülervertreter und die Astronomielehrer. Wie sollte sie erklären, was sie hier machte?
»Leda?«
Ihr rutschte das Herz in die Hose, als sie die Stimme erkannte. »Was machst du denn hier, Avery?«
»Wahrscheinlich dasselbe wie du.«
Leda fühlte sich ertappt. Sie war seit jener Nacht nicht mehr mit Avery allein gewesen – seit sie Avery damit konfrontiert hatte, dass sie von ihrer Beziehung zu Atlas wusste, seit Avery sie aufs Dach geführt hatte und dann alles so gewaltsam außer Kontrolle geraten war. Leda suchte verzweifelt nach Worten, aber ihr Verstand war wie eingefroren. Was sollte sie auch sagen angesichts all der Geheimnisse, die sie und Avery miteinander verbanden, die sie gemeinsam hüteten?
Leda war schockiert, als sie einen Moment später Schritte näher kommen hörte. Avery kam zu ihr herüber und setzte sich an das gegenüberliegende Ende des Oval Eye.
»Wie bist du hier reingekommen?« Leda konnte sich die Frage einfach nicht verkneifen. Ob Avery noch Kontakt zu Watt hatte, dem Hacker aus den unteren Etagen, der Leda dabei geholfen hatte, Averys Geheimnis aufzudecken? Leda hatte auch mit ihm seit jener Nacht nicht mehr gesprochen. Aber mit seinem geheimen Quantencomputer konnte Watt im Prinzip alles hacken.
Avery zuckte mit den Schultern. »Ich habe den Direktor gefragt, ob ich Zugang zur Sternwarte haben darf. Es hilft mir, hier zu sein.«
Natürlich, dachte Leda bitter, sie hätte sich denken können, dass es so einfach war. Für die perfekte Avery Fuller war nichts verboten.
»Ich vermisse sie auch, weißt du«, sagte Avery leise.
Leda blickte in die stille Weite der Nacht hinab, um sich davon abzulenken, was sie in Averys Augen sah.
»Was ist an diesem Abend passiert, Leda?«, flüsterte Avery. »Was hattest du genommen?«
Leda dachte an die verschiedenen Pillen, die sie an dem Tag eingeworfen hatte, während sie immer tiefer in einen brodelnden, wütenden Strudel aus bitterem Selbstmitleid hineingezogen worden war. »Es war ein harter Tag für mich. Ich hatte die Wahrheit über eine Menge Leute herausgefunden – Menschen, denen ich vertraut habe. Menschen, die mich benutzt haben«, sagte sie schließlich. Als sie sah, wie Avery bei diesen Worten zusammenzuckte, empfand sie eine perverse Freude.
»Es tut mir leid«, erwiderte Avery. »Aber bitte, Leda, rede mit mir.«
Leda hätte Avery so gern alles erzählt – wie sie herausgefunden hatte, dass ihr Vater, dieses miese Schwein, eine heimliche Affäre mit Eris hatte; wie schlecht sie sich gefühlt hatte, als ihr klar geworden war, dass Atlas verdammt noch mal nur mit ihr geschlafen hatte, um Avery zu vergessen, und wie sie Watt unter Drogen gesetzt hatte, um diese Wahrheit aufzudecken.
Aber wenn man die Wahrheit erst einmal kannte, war es unmöglich, sie wieder zu vergessen. Egal wie viele Pillen Leda auch nahm, die Wahrheit war immer noch da, lauerte wie ein ungebetener Gast in jeder Ecke ihres Verstandes. Es gab nicht genug Tabletten auf der Welt, um sie wieder loszuwerden. Leda hatte Avery damit konfrontiert, hatte sie auf dem Dach angeschrien, ohne sich richtig bewusst zu sein, was sie da eigentlich sagte, denn in der sauerstoffarmen Luft hatte sie sich noch desorientierter und benommener gefühlt. Dann war Eris plötzlich aufgetaucht und hatte sich bei Leda entschuldigt. Als könnte eine verdammte Entschuldigung den Schaden wiedergutmachen, den sie in Ledas Familie angerichtet hatte. Warum war Eris immer weiter auf sie zugekommen, obwohl Leda sie aufgefordert hatte, stehen zu bleiben? Es war nicht Ledas Schuld, dass sie sich Eris vom Hals halten musste und sie deshalb weggestoßen hatte.
Sie hatte nur zu fest geschubst.
Wie gern würde sie ihrer besten Freundin das alles gestehen und sich dann einfach fallen lassen und wie ein Kind weinen.
Aber ihr dickköpfiger, unnachgiebiger Stolz erstickte die Worte in ihrer Kehle. Sie verengte die Augen und hob trotzig den Kopf. »Du würdest es sowieso nicht verstehen«, sagte sie müde. Was spielte es auch für eine Rolle? Eris war tot.
»Dann hilf mir, es zu verstehen. Es muss zwischen uns nicht so sein, Leda – dass wir uns auf diese Art drohen. Warum erzählst du nicht einfach allen, dass es ein Unfall war? Ich weiß, dass du ihr nie etwas antun wolltest.«
Genau diese Gedanken waren Leda schon oft durch den Kopf gegangen, doch sie jetzt aus Averys Mund zu hören, weckte eine kalte Panik, die sich wie eine Faust um Leda schloss.
Avery kapierte es einfach nicht. Für sie war immer alles so einfach. Aber Leda wusste, was ihr blühte, wenn sie mit der Wahrheit herausrückte. Es würde wahrscheinlich zu einer Untersuchung des Falls und zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Dass Leda zuerst gelogen hatte, würde alles nur noch schlimmer machen – und es käme ans Licht, dass Eris mit Ledas Dad geschlafen hatte. Ledas Familie, vor allem ihre Mom, würde durch die Hölle gehen. Und Leda war nicht dumm. Genau diese Geschichte würde wie ein verdammt triftiges Motiv aussehen, Eris in den Tod zu stoßen.
Woher nahm Avery überhaupt das Recht, hier hereinzuschneien und ihr wie eine Art Göttin die Absolution erteilen zu wollen?
»Wage es ja nicht, irgendjemandem davon zu erzählen. Wenn du das tust, wirst du es bereuen, das schwöre ich.« Eiskalt zerschnitt die wütende Drohung die Stille. Leda kam es in der Sternwarte plötzlich ein paar Grad kälter vor.
Sie stand auf und wollte nur noch hier weg. Als sie vom Oval Eye auf den Teppich trat, merkte sie, wie etwas aus ihrer Tasche fiel. Die beiden leuchtend pinken Schlaftabletten.
»Gut zu sehen, dass sich nichts geändert hat.« Averys Stimme klang völlig leer.
Leda machte sich gar nicht erst die Mühe, ihr zu erklären, wie falsch sie lag. Avery würde die Welt immer so sehen, wie sie wollte.
An der Tür blieb Leda stehen und sah sich noch einmal um. Avery kniete jetzt in der Mitte des Oval Eyes, die Hände auf das Flexiglas gedrückt, den Blick in die Tiefe gerichtet. Die Geste wirkte makaber und sinnlos, als hätte sie sich zum Gebet hingekniet, um Eris wieder zum Leben zu erwecken.
Erst einen Moment später merkte Leda, dass Avery weinte. Sie war wahrscheinlich das einzige Mädchen auf der Welt, das noch schöner aussah, wenn es weinte. Ihre Augen leuchteten in einem noch helleren Blau, die Tränen auf ihren Wangen betonten ihre erstaunlich perfekten Gesichtszüge. Und in diesem Augenblick fielen Leda all die Gründe wieder ein, aus denen sie Avery hasste.
Sie wandte sich ab und ließ ihre ehemals beste Freundin auf diesem winzigen Stück Himmel mit ihren Tränen allein.
Calliope
Das Mädchen betrachtete sein Spiegelbild in den hohen Smart-Spiegeln, die die Wände der Hotellobby säumten, und verzog die rot geschminkten Lippen zu einem zufriedenen Lächeln. Sie trug einen kurzen, marineblauen Jumpsuit, der mindestens seit drei Jahren aus der Mode war, aber das war volle Absicht. Sie genoss es, wie die anderen Frauen im Hotel neidisch ihre langen, gebräunten Beine beäugten. Das Mädchen warf die Haare zurück. Das warme Gold ihrer Ohrringe betonte ihre karamellfarbenen Strähnchen und sie klimperte mit ihren falschen Wimpern – nicht die implantierten, sondern echte organische, die nach einer schmerzhaften genetischen Repair-Prozedur in der Schweiz aus ihren eigenen Augenlidern gewachsen waren.
Mit all diesen Attributen sah sie glamourös und sexy aus, ohne dass es aufgesetzt wirkte. Ganz Calliope Brown, dachte das Mädchen mit einem angenehmen Schauer.
»Ich heiße diesmal Elise. Und du?«, fragte ihre Mom, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Sie hatte dunkelblondes Haar und eine künstlich glatte, cremefarbene Haut, die sie zeitlos jung erscheinen ließ. Niemand, der die beiden zusammen sah, war sich ganz sicher, ob sie die Mutter oder die etwas erfahrenere ältere Schwester war.
»Ich dachte an Calliope.« Das Mädchen zuckte dabei mit den Schultern, als wollte sie in ein altes, bequemes Sweatshirt schlüpfen. Calliope Brown war schon immer eins ihrer Lieblingspseudonyme gewesen. Und der Name fühlte sich irgendwie passend an für New York.
Ihre Mom nickte. »Ich mag diesen Namen auch, obwohl man ihn sich kaum merken kann. Aber er klingt nach … einer Draufgängerin.«
»Du könntest mich auch Callie nennen«, bot Calliope an. Ihre Mom nickte gedankenverloren, dabei würde sie Calliope sowieso nur mit irgendwelchen Kosenamen anreden. Sie hatte einmal das falsche Pseudonym benutzt und damit alles ruiniert. Jetzt hatte sie panische Angst davor, denselben Fehler noch einmal zu machen.
Calliope sah sich in dem teuren Hotel um. Sie betrachtete die vornehmen Sofas, die passend zum Farbton des Himmels mit golden und blau leuchtenden Streifen durchzogen waren; die in Grüppchen zusammenstehenden Geschäftsleute, die ihren Kontaktlinsen Sprachbefehle zumurmelten; das verräterische Schimmern der versteckten Sicherheitskamera in der Ecke, die alles beobachtete. Calliope unterdrückte den Impuls, der Kamera zuzuzwinkern.
Plötzlich stieß sie mit der Schuhspitze irgendwo an und fiel hin. Sie landete auf ihrem Hüftknochen, fing sich gerade noch mit den Armen ab und spürte, wie ihre Handflächen zu brennen begannen.
»O mein Gott!« Elise ging neben ihrer Tochter in die Knie.
Calliope stöhnte schmerzhaft auf, was nicht schwierig war, denn der Sturz hatte tatsächlich wehgetan. In ihrem Kopf pochte es wütend. Hoffentlich waren die Absätze ihrer Stilettos nicht völlig zerschrammt.
Ihre Mom schüttelte sie und Calliope jammerte noch lauter, Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Ist alles in Ordnung mit ihr?« Es war die Stimme eines Jungen. Calliope hob leicht den Kopf, um ihm durch halb geschlossene Lider einen verstohlenen Blick zuzuwerfen. Mit seinem glatt rasierten Gesicht und dem leuchtend blauen Holo-Namensschild an der Brust musste er ein Rezeptionsmitarbeiter sein. Calliope war schon in genügend Fünfsternehotels gewesen, um zu wissen, dass die wirklich wichtigen Leute ihre Namen nicht auf Schildern zur Schau trugen.
Ihre Schmerzen ließen langsam nach, aber Calliope konnte trotzdem nicht widerstehen, noch etwas mehr zu stöhnen und ein Knie an die Brust zu ziehen, nur um ihre Beine besser zur Geltung zu bringen. Zufrieden sah sie, wie eine Mischung aus Bewunderung und Bestürzung – beinahe Panik – über das Gesicht des Jungen huschte.
»Natürlich ist nichts in Ordnung! Wo ist der Manager?«, brauste Elise auf.
Calliope schwieg. Sie überließ das Reden lieber ihrer Mom, wenn es erst mal darum ging, das Netz auszuwerfen. Außerdem sollte sie ja sowieso die Verletzte spielen.
»Es tut mir l-leid, ich rufe ihn sofort …«, stammelte der Junge. Als kleine Zugabe wimmerte Calliope noch ein wenig, obwohl das gar nicht nötig war. Sie spürte, wie sich alle Aufmerksamkeit in der Lobby auf sie zu richten begann, eine Zuschauermenge bildete sich. Die Nervosität hing an dem Rezeptionsjungen wie ein billiges Parfum.
»Ich bin Oscar, der Manager. Was ist hier passiert?« Ein übergewichtiger Mann in einem schlichten dunklen Anzug kam herangetrottet. Calliope bemerkte erfreut, dass er teure Schuhe trug.
»Was hier passiert ist? Meine Tochter ist in Ihrer Lobby gestürzt. Wegen dieses verschütteten Getränks!« Elise deutete auf eine Pfütze am Boden, in der sogar noch eine verloren wirkenden Zitronenscheibe lag. »Sparen Sie etwa beim Reinigungsservice?«
»Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung! Ich kann Ihnen versichern, dass so etwas hier noch nie vorgekommen ist, Mrs …?«
»Ms Brown«, näselte Elise. »Meine Tochter und ich hatten eigentlich vor, eine Woche hier zu verbringen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir das noch möchten.« Sie beugte sich ein wenig tiefer. »Kannst du aufstehen, Liebling?«
Das war Calliopes Stichwort. »Es tut so weh.« Sie rang nach Luft und schüttelte dann den Kopf. Eine einzelne Träne lief an ihrer Wange hinab und ruinierte ihr ansonsten perfekt geschminktes Gesicht. Sie hörte, wie ein mitfühlendes Raunen durch die Zuschauermenge ging.
»Ich werde mich sofort um alles kümmern«, bot Oscar beschwörend an, während er vor Unbehagen knallrot anlief. »Ich bestehe sogar darauf. Und Ihr Zimmer ist für Sie natürlich kostenlos.«
Fünfzehn Minuten später hatten es sich Calliope und ihre Mutter in einer Suite bequem gemacht, die sich in einer der Ecken des Towers befand. Calliope lag im Bett – ihr Knöchel wurde von einem kleinen Dreieck aus Kissen gestützt – und stellte sich schlafend, als der Hotelpage ihr Gepäck abstellte. Auch nachdem sie die Tür hinter ihm zugehen hörte, hielt sie die Augen geschlossen und wartete, bis sich die Schritte ihrer Mutter ihrem Schlafzimmer näherten.
»Die Luft ist rein, Süße«, rief Elise.
Mit einer ruckartigen Bewegung stand Calliope auf, sodass die Kissen auf den Boden purzelten. »Echt jetzt, Mom? Du lässt mich ohne Vorwarnung stolpern?«
»Tut mir leid, aber du weißt doch selbst, wie schlecht du bei einem vorgetäuschten Sturz bist. Dein Selbsterhaltungstrieb ist einfach zu stark ausgeprägt«, erwiderte Elise vom Wandschrank aus. Sie sortierte bereits ihre enorme Auswahl an Kleidern, die in farbkodierten Transporttaschen steckten. »Wie kann ich es wiedergutmachen?«
»Ein Stück Käsekuchen wäre kein schlechter Anfang.« Calliope griff an ihrer Mom vorbei nach dem weichen weißen Bademantel, der an der Tür hing und an der Brusttasche mit einem blauen N und einer winzigen Wolke bestickt war. Sie schlüpfte hinein und die Gürtelenden schlossen sich sofort von selbst.
»Wie wäre es mit Käsekuchen und Wein?« Elise rief mit ein paar raschen Handbewegungen das Holo-Zimmerservice-Menü auf und tippte auf verschiedene Bilder, um Lachs, Käsekuchen und eine Flasche Sancerrezu bestellen. Nur wenige Sekunden später erschien der Wein in ihrem Zimmer, geliefert von dem hoteleigenen temperaturgesteuerten Luftrohrsystem.
»Ich hab dich lieb, Süße. Entschuldige noch mal, dass du meinetwegen auf die Nase gefallen bist.«
»Ja, ich weiß. Das ist der Preis für unser Geschäft«, lenkte Calliope mit einem Schulterzucken ein.
Ihre Mom füllte zwei Gläser und stieß mit Calliope an. »Auf einen Neuanfang!«
»Auf einen Neuanfang!«, wiederholte Calliope lächelnd, während ihr ein aufgeregter Schauer über den Rücken lief. Diese Worte benutzten sie und ihre Mom jedes Mal, wenn sie an einem neuen Ort angekommen waren. Und es gab nichts, was Calliope mehr liebte, als irgendwo neu anzufangen.
Sie ging durch das Wohnzimmer auf die gewölbte Flexiglasscheibe zu, mit der die Ecke des Gebäudes verkleidet war. Von hier aus hatte man einen atemberaubenden Blick über Brooklyn und das dunkle Band des East River. Ein paar Schatten, wahrscheinlich Boote, tanzten auf der Wasseroberfläche. Die Abenddämmerung senkte sich über die Stadt und ließ alle Linien weicher erscheinen. Verstreute Lichtflecken blinkten in der Ferne wie vergessene Sterne.
»Das ist also New York«, sinnierte Calliope laut. Nachdem sie jahrelang mit ihrer Mom durch die Welt gereist war, in so vielen Luxushotels an ähnlichen Fenstern gestanden und über so viele Städte geblickt hatte – Tokios neonfarbenes Raster, Rios fröhliches und pulsierendes Wirrwarr, Mumbais kuppelförmige Wolkenkratzer, die wie Knochen im Mondlicht schimmerten –, waren sie nun endlich in New York.
New York, die erste Stadt mit einem genialen Supertower, die ursprüngliche Stadt in den Wolken. Calliope spürte schon jetzt eine zärtliche Verbundenheit.
»Eine traumhafte Aussicht«, sagte Elise, die neben ihre Tochter getreten war. »Erinnert mich fast an den Blick von der London Bridge.«
Calliope hörte auf, sich die Augen zu reiben, die nach der letzten Netzhauttransplantation immer noch ein wenig juckten, und sah ihre Mom verwundert an. Bisher hatten sie kaum über ihr altes Leben gesprochen. Doch Elise ging auch nicht weiter auf das Thema ein. Sie nippte an ihrem Wein, ihr Blick war starr auf den Horizont gerichtet.
Wie wunderschön Elise war, dachte Calliope. Inzwischen hatte ihre Schönheit aber auch etwas Steifes und ein wenig Plastikartiges – das Ergebnis unzähliger Operationen, mit denen sie ihr Äußeres verändert hatte und jedes Mal unerkannt geblieben war, wenn sie sich wieder einen neuen Ort ausgesucht hatten. »Ich tue das für uns«, sagte sie oft zu Calliope. »Für dich, damit du das nicht tun musst. Zumindest jetzt noch nicht.« Calliope durfte in ihren Betrügereien immer nur eine Nebenrolle spielen.
Seit sie London vor sieben Jahren verlassen hatten, waren Calliope und ihre Mutter ständig von einem Ort zum nächsten gezogen. Sie blieben nie irgendwo lange genug, um geschnappt zu werden. Und in jeder Stadt gingen sie nach demselben Muster vor: Sie schummelten sich in das teuerste Hotel in der nobelsten Gegend und kundschafteten ein paar Tage die Lage aus. Dann wählte Elise ihr Ziel aus – eine Person mit zu viel Geld, als gut für sie wäre, und dumm genug, jede Geschichte zu glauben, die Elise ihm oder ihr auftischte. Wenn die Zielperson merkte, was wirklich vor sich ging, waren Elise und Calliope längst verschwunden.
Calliope wusste, dass einige Leute sie und ihre Mom als Hochstapler, Trickbetrüger oder Schwindler bezeichnen würden. Sie selbst betrachtete sich und ihre Mom jedoch lieber als besonders clevere und charmante Frauen, die genau wussten, wie man überall punkten konnte. Reiche Leute bekamen ständig alles umsonst. Warum sollten sie nicht auch davon profitieren?
»Bevor ich es vergesse, das ist für dich. Ich habe gerade den Namen Calliope Ellerson Brown hochgeladen. Den hast du dir doch gewünscht, oder?« Ihre Mom reichte ihr einen glänzenden neuen Handgelenkcomputer.
Hier ruht Gemma Newberry, geliebte Diebin, dachte Calliope begeistert und begrub damit in stillem Gedenken ihr jüngstes Pseudonym. Sie war genauso schamlos wie wunderschön.
Calliope hatte die schrecklich makabre Angewohnheit, sich jedes Mal eine Grabinschrift auszudenken, wenn sie wieder eine Identität ablegte. Ihrer Mom hatte sie noch nie davon erzählt. Sie hatte das Gefühl, Elise würde das nicht besonders lustig finden.
Sie tippte auf den neuen Handgelenkcomputer, öffnete ihre Kontakte – eine wie immer noch leere Liste – und stellte überrascht fest, dass auch keine Schule aufgeführt war. »Du willst diesmal nicht, dass ich zur Schule gehe?«
Elise zuckte mit den Schultern. »Du bist achtzehn. Möchtest du denn noch zur Schule gehen?«
Calliope zögerte. Sie war auf unzähligen Schulen gewesen und hatte immer die Rolle gespielt, die das jeweilige Drehbuch ihrer Mutter von ihr verlangte – eine lange verloren geglaubte Erbin, ein Opfer irgendeiner Verschwörung oder einfach nur Elises Tochter, wenn Elise eine brauchte, um auf ihr nächstes Opfer attraktiver zu wirken. Sie hatte ein nobles englisches Internat besucht, eine französische Klosterschule und eine tadellose staatliche Schule in Singapur. Und jedes Mal hatte sie vor purer Langeweile die Augen verdreht.
Deshalb hatte Calliope ein paar Betrügereien auch schon auf eigene Faust abgezogen. Es waren keine großen Dinger, wie Elise sie drehte, wo es um hohe Geldsummen und Wertgegenstände ging, aber wenn Calliope die Gelegenheit bekam, machte sie sich nebenbei einen Spaß daraus. Elise hatte nichts dagegen, solange Calliopes Projekte sie nicht daran hinderten, ihrer Mom jederzeit auszuhelfen. »Es ist gut, wenn du ein paar Erfahrungen sammelst«, sagte Elise immer und erlaubte Calliope, alles zu behalten, was sie sich selbst erschwindelte – was vor allem ihrem Kleiderschrank zugutekam.
Normalerweise versuchte Calliope, das Interesse eines reichen Teenagers zu gewinnen und ihn dann dazu zu bringen, ihr eine Kette oder eine neue Handtasche oder wenigstens ein Paar Designer-Wildlederstiefel zu kaufen. Ein paarmal hatte sie es sogar geschafft, sich nicht nur Geschenke an Land zu ziehen, sondern Bargeldbeträge zu kassieren. Sie musste nur so tun, als stecke sie in ernsten Schwierigkeiten, oder die Geheimnisse der Leute herausfinden, um sie zu erpressen. Calliope hatte im Laufe der Jahre gelernt, dass die Reichen eine Menge Dinge taten, die sie vor anderen lieber geheim hielten.
Sie überlegte, ob sie wieder zur Highschool gehen und ihre übliche Masche abziehen sollte, doch sie verwarf den Gedanken rasch. Diesmal wollte sie etwas Größeres planen.
Oh, es gab so viele Möglichkeiten, sich ein Opfer zu angeln – ein »zufälliger« Zusammenstoß, ein mehrdeutiges Lächeln, ein heißer Flirt, eine Konfrontation, ein Unfall – und Calliope war Expertin auf jedem Gebiet. Sie hatte bis jetzt jeden Trickbetrug erfolgreich abgeschlossen.
Mit einer Ausnahme: Travis. Die einzige Zielperson, die Calliope verlassen hatte anstatt andersherum. Calliope hatte den Grund nie herausgefunden, und das ärgerte sie immer noch, zumindest ein bisschen.
Aber das war nur ein Fehltritt bei einer Person gewesen und hier gab es Millionen. Calliope dachte unwillkürlich an die Menschenmassen, die sie vorhin gesehen hatte. Sie waren aus den Fahrstühlen geströmt, nach Hause oder zur Arbeit oder zur Schule geeilt. Jeder von ihnen war mit seinen eigenen kleinen Sorgen beschäftigt, klammerte sich an seine eigenen unerreichbaren Träume.
Niemand wusste, dass Calliope überhaupt existierte, und selbst wenn es jemand wüsste, wäre es ihm gleichgültig. Und genau das machte das Spiel so spannend: Calliope würde dafür sorgen, dass sie einem dieser Menschen nicht mehr gleichgültig war, dass sie ihm etwas bedeutete, und zwar sehr viel bedeutete. Bei diesem Gedanken überkam sie eine herrlich rücksichtslose Vorfreude.
Sie konnte es kaum erwarten, sich ihr nächstes Opfer auszusuchen.
Avery
Avery Fuller legte die Arme noch fester um sich. Der Wind zerrte an ihrem Haar, zerzauste es zu einem unbändigen, blonden Wirrwarr, peitschte den Stoff ihres Kleides wie eine Fahne um sie. Ein paar Regentropfen begannen zu fallen, stachen sie, stachen in ihre nackte Haut.
Aber Avery war nicht bereit, das Dach zu verlassen. Das war ihr geheimer Ort, an den sie sich zurückzog, wenn sie die grellen Lichter und Geräusche der Stadt dort unten nicht mehr ertragen konnte.
Sie betrachtete den violett dämmernden Horizont und das tiefe und unergründliche Schwarz des Himmels über ihr. Hier oben – fern von allem und allein – fühlte sie sich wohl, hier waren all ihre Geheimnisse sicher. Nichts ist sicher, meldete sich ein quälendes Gefühl, als sie Schritte hörte. Nervös drehte Avery sich um – und begann zu lächeln, als sie sah, dass es Atlas war.
Aber die Falltür flog erneut auf und plötzlich stand Leda da, ihr Gesicht war vor Wut verzerrt. Sie wirkte hager und angespannt und gefährlich, ihre Haut war wie ein Panzer.
»Was willst du, Leda?«, fragte Avery misstrauisch, obwohl sie gar nicht fragen musste. Sie wusste, was Leda wollte. Sie wollte Atlas und Avery auseinanderbringen. Aber Atlas war das Einzige, was Avery niemals aufgeben würde. Sie schob sich ein Stück vor ihn, als wollte sie ihn beschützen.
Leda bemerkte die Bewegung. »Wie kannst du es wagen?«, schrie sie und streckte den Arm aus, um Avery wegzustoßen.
Avery drehte sich der Magen um, sie ruderte verzweifelt mit den Armen, um irgendwo Halt zu finden, aber alles war plötzlich zu weit entfernt, selbst Atlas. Die Welt verwandelte sich in einen Strudel aus Farben, Geräuschen und Schreien, der Boden raste immer schneller auf sie zu.
Abrupt setzte Avery sich auf, kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Sie brauchte einen Moment, um im Dämmerlicht Atlas’ Zimmereinrichtung zu erkennen.
»Aves?«, murmelte Atlas. »Alles okay?«
Sie zog die Knie an die Brust und versuchte, ihren unregelmäßigen Herzschlag zu beruhigen. »War nur ein Albtraum«, sagte sie.
Atlas zog sie zu sich und legte die Arme von hinten um sie, bis sie sich in seiner warmen Umarmung sicher und geborgen fühlte. »Willst du darüber reden?«
Avery wollte darüber reden, aber sie konnte es nicht. Also drehte sie sich nur um und brachte ihn mit einem Kuss zum Schweigen.
Seit Eris gestorben war, schlich sie sich jede Nacht in Atlas’ Zimmer. Sie wusste, dass sie mit dem Feuer spielte, doch mit dem Jungen zusammen zu sein, den sie liebte – mit ihm zu reden, ihn zu küssen, seine Gegenwart zu spüren –, war das Einzige, was Avery davon abhielt, völlig durchzudrehen.
Aber sogar mit Atlas an ihrer Seite war sie nicht ganz sicher vor sich selbst. Sie hasste das Netz aus Lügen und Geheimnissen, in das sie sich verstrickt hatte, denn es trieb einen unsichtbaren Keil zwischen sie und Atlas. Und er hatte nicht die geringste Ahnung.
Er wusste nichts von Averys und Ledas heiklem Drahtseilakt. Ein Geheimnis für ein Geheimnis, dachte Avery bitter. Sie hatte mitangesehen, wie Leda Eris in jener Nacht vom Dach gestoßen hatte. Aber Leda wusste über Avery und Atlas Bescheid. Und nur wegen Ledas Drohung, ihre geheime Beziehung zu Atlas in die Welt hinauszuposaunen, wenn sie nicht den Mund hielt, war Avery nun gezwungen, auch die Wahrheit über Eris’ Tod geheim zu halten.
Sie konnte sich nicht dazu durchringen, Atlas von all dem zu erzählen. Es würde ihn nur verletzen, und wenn sie ehrlich war, wollte sie gar nicht, dass er erfuhr, was tatsächlich auf dem Dach geschehen war. Wenn er wüsste, was sie getan hatte, würde er sie bestimmt nicht mehr so ansehen – mit dieser bedingungslosen Liebe und Hingabe.
Sie vergrub die Finger in den Locken an Atlas’ Nacken und wünschte, sie könnte die Zeit anhalten, um in diesem Moment zu verschwinden und für immer darin zu leben.
Als Atlas sich von ihr löste, spürte sie, dass er lächelte, auch wenn sie es nicht sehen konnte. »Keine schlimmen Träume mehr. Nicht, wenn ich hier bin. Ich halte sie von dir fern, versprochen.«
»Ich habe geträumt, dich zu verlieren«, platzte es aus ihr heraus. Ein ängstlicher Unterton lag in ihrer Stimme. Allen Widrigkeiten zum Trotz waren sie endlich zusammen, und es war ihre größte Angst, von Atlas getrennt zu werden.
»Avery …« Er legte einen Finger unter ihr Kinn und hob sanft ihren Kopf, bis sie ihm in die Augen sehen musste. »Ich liebe dich. Du wirst mich nie verlieren.«
»Ich weiß«, erwiderte sie, denn er meinte es auch so. Aber es gab so viele Hindernisse auf ihrem Weg, so viele Kräfte, gegen die sie ankämpfen mussten, dass sich alles manchmal unüberwindbar anfühlte.
Sie kuschelte sich auf den weichen, warmen Platz neben ihm, aber innerlich war sie immer noch aufgewühlt. Sie fühlte sich wie in einem Teufelskreis, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnte.
»Hast du dir jemals gewünscht, eine andere Familie hätte dich adoptiert?«, flüsterte sie und sprach damit einen Gedanken aus, der ihr schon unzählige Male durch den Kopf gegangen war. Wäre er bei einer anderen Familie gelandet und sie stattdessen mit einem anderen Adoptivbruder aufgewachsen, wäre Atlas für sie nicht verboten. Sie hätte ihn in der Schule kennengelernt oder auf einer Party, ihn mit nach Hause bringen und ihren Eltern vorstellen können.
Alles wäre so viel leichter.
»Natürlich nicht«, sagte Atlas. Sein vehementer Tonfall erschreckte sie. »Aves, wenn ich von einer anderen Familie adoptiert worden wäre, hätte ich dich vielleicht nie getroffen.«
»Vielleicht …« Sie verstummte, aber sie war sich sicher, dass sie und Atlas füreinander bestimmt waren. Das Universum hätte einen Weg gefunden, sie zusammenzubringen. Es hätte dafür gesorgt, dass ihre gegenseitige Anziehungskraft sie zusammenführte, auf die eine oder andere Weise.
»Okay, vielleicht doch«, lenkte Atlas ein. »Aber dieses Risiko wäre ich nicht eingegangen. Du bist für mich das Wichtigste auf der Welt. Der Tag, an dem deine Eltern mich zu sich genommen haben – an dem ich dich zum ersten Mal gesehen habe –, war der zweitschönste Tag in meinem Leben.«
»Ach ja? Und welcher war der schönste?«, fragte sie lächelnd.
Sie ging davon aus, dass es der Tag war, an dem sie sich ihre Liebe gestanden hatten. Aber Atlas überraschte sie.
»Heute«, sagte er schlicht. »Und danach wird morgen der schönste Tag sein. Denn jeder Tag mit dir ist noch schöner als der Tag davor.« Er beugte sich über sie, um sie zu küssen, als es an der Tür klopfte.
»Atlas?«
Für einen schrecklichen Augenblick erstarrte jede Zelle in Averys Körper. Als sie zu Atlas aufblickte, spiegelte sich ihr eigenes Entsetzen in seinem Gesicht.
Seine Tür war verschlossen, aber wie überall im Apartment konnten sich Mr und Mrs Fuller auch hier über die Einstellung des Raumcomputers hinwegsetzen.
»Sekunde noch, Dad«, rief Atlas übertrieben laut.
Avery stolperte aus dem Bett. Sie war nur mit ihren elfenbeinfarbenen Satinshorts und einem BH bekleidet und taumelte atemlos auf Atlas’ Wandschrank zu. Mit ihren nackten Füßen wäre sie fast über einen Schuh gestolpert.
Sie hatte gerade die Tür hinter sich zugezogen, als Pierson Fuller das Zimmer seines Adoptivsohns betrat. Das Licht an der Decke schaltete sich ein.
»Ist hier alles okay?«
Hörte sie einen argwöhnischen Unterton in seiner Stimme oder bildete sie sich das nur ein?
»Was gibt’s, Dad?«
Typisch Atlas, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Aber es war ein gutes Ablenkungsmanöver.
»Ich hatte gerade eine Rückmeldung von Jean-Pierre LaClos aus dem Pariser Büro«, sagte Averys Dad langsam. »Sieht so aus, als würden die Franzosen unser Bauvorhaben neben ihrem antiken Schandfleck doch noch genehmigen.« Seine Umrisse waren durch die Lamellen in der Schranktür gut erkennbar. Avery rührte sich nicht. Sie stand mit vor der Brust verschränkten Armen an einen grauen Wollmantel gepresst da. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie fürchtete, ihr Dad könnte es hören.
Atlas’ Wandschrank war viel kleiner als ihrer. Sie konnte sich nirgendwo verstecken, falls Pierson auf die Idee kam, die Schranktür zu öffnen. Es gab auch keine plausible Erklärung dafür, was sie in BH und Pyjamashorts in Atlas’ Zimmer zu suchen hatte – bis auf den wahren Grund natürlich.
Ihr pinkfarbenes Shirt lag noch im Zimmer auf dem Boden wie ein leuchtendes Hinweisschild.
»Okay«, erwiderte Atlas und Avery hörte die unausgesprochene Frage. Warum kam ihr Dad mitten in der Nacht vorbei, um Atlas etwas mitzuteilen, das nicht besonders dringend klang?
Nach einem viel zu langen Schweigen räusperte sich Pierson. »Du wirst morgen früh am Projektmeeting teilnehmen. Wir müssen eine komplette Analyse des Straßennetzes und der Wasserwege aufstellen, damit wir mit den Vorbereitungen beginnen können.«
»Ich werde da sein«, sagte Atlas knapp. Er stand direkt auf dem Shirt und versuchte es diskret mit einem Fuß zu verdecken. Avery betete, dass ihr Dad die Bewegung nicht bemerkt hatte.
»Klingt gut.«
Einen Moment später hörte Avery, wie die Tür zum Zimmer ihres Bruders ins Schloss fiel. Sie lehnte sich an die Rückwand des Schranks und sank kraftlos nach unten, bis sie auf dem Boden saß. Es kam ihr vor, als würden winzige Nadeln überall auf ihrer Haut kribbeln wie bei ihrem Vitamin-Check beim Arzt, nur dass sie diesmal voller Adrenalin war. Sie fühlte sich aufgewühlt und leichtsinnig und merkwürdig berauscht, als wäre sie in Treibsand gelandet und irgendwie unverletzt wieder herausgekommen.
Atlas riss die Schranktür auf. »Alles okay, Aves?«
Das Licht im Schrank war angegangen, als er die Türen geöffnet hatte, aber für einen unglaublich kurzen Moment hatte Avery noch in der Dunkelheit gehockt, während Atlas von hinten angestrahlt wurde. Das Licht umströmte ihn, vergoldete seine Umrisse, sodass er fast übernatürlich wirkte. Und plötzlich kam es ihr so vor, als könnte er unmöglich echt sein, und hier und bei ihr.
In Wahrheit war es auch unmöglich. Ihre ganze Beziehung hatte sich als unmöglich erwiesen, auch wenn sie sich noch so sehr wünschten, dass es funktionierte.
»Ja, alles okay.« Sie stand auf und ließ die Hände über seine Arme wandern, bis sie auf seinen Schultern lagen, doch er trat reflexartig einen Schritt zurück und bückte sich nach ihrem Shirt, das immer noch auf dem Boden lag.
»Das war verdammt knapp, Aves.« Atlas hielt ihr mit besorgter Miene das Shirt hin.
»Er hat mich doch nicht gesehen«, hielt Avery dagegen, aber sie wusste, dass es nicht darum ging. Keiner von ihnen erwähnte, was ihr Dad vielleicht vorher schon entdeckt hatte: Averys Zimmer auf der anderen Seite des Apartments, ihr makellos weißes Bett zerwühlt, aber eindeutig leer.
»Wir müssen vorsichtiger sein.« Atlas klang resigniert.
Avery zog sich das Shirt über den Kopf und blickte zu ihm auf. Ihre Brust schnürte sich bei dem Gedanken zusammen, was er nicht aussprach. »Kein gemeinsames Übernachten mehr, oder?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte. Das durften sie nicht riskieren, nicht mehr.
»Nein. Aves, du musst gehen.«
»Das werde ich. Gleich morgen«, versprach sie und zog seinen Kopf zu sich. Avery war sich mehr als jemals zuvor bewusst, wie gefährlich das Ganze war, aber das machte jeden Moment mit Atlas nur noch unendlich kostbarer. Sie kannte die Risiken. Sie wusste, dass sie sich auf einem schmalen Grat befanden und jeden Moment zu fallen drohten.
Wenn das ihre letzte gemeinsame Nacht war, sollte sie auch etwas bedeuten.
Sie wünschte, sie könnte ihm alles erzählen, doch stattdessen küsste sie ihn. Und mit diesem Kuss schenkte sie ihm all die stummen Entschuldigungen, die Geständnisse, das Versprechen, ihn für immer zu lieben. Wenn sie es ihm schon nicht mit Worten sagen konnte, musste sie ihm ihre Gefühle wenigsten auf diesem Weg mitteilen.
Sie umklammerte Atlas’ Schultern, zog ihn mit sich, und er folgte ihr in den Wandschrank, während das Deckenlicht ausging.
Watt
Watzahn Bakradi lehnte sich auf dem harten Hörsaalstuhl zurück und studierte das Schachbrett. Bewege Turm drei Felder nach links. Entsprechend veränderte sich die Anordnung auf dem Schachbrett, das gespenstisch weiß und schwarz auf seine hochauflösenden Kontaktlinsen projiziert wurde, die er ständig trug.
Das war kein kluger Zug, flüsterte Nadia, der Quantencomputer, der in Watts Gehirn eingebettet war. Ihr Springer schob sich augenblicklich nach vorn, um seinen König zu schlagen.
Watt unterdrückte ein Aufstöhnen und fing ein paar fragende Blicke von Freunden und Klassenkameraden auf, die um ihn herumsaßen. Schnell riss er sich wieder zusammen und richtete den Blick nach vorn, wo ein Mann in einem purpurroten Blazer auf einem Podium stand und über die geisteswissenschaftlichen Fächer sprach, die an der Stringer West University angeboten wurden. Watt blendete seine Worte aus, wie er es schon bei all den anderen Rednern während dieser obligatorischen Veranstaltung für die elften Klassen getan hatte. Watt hatte nicht die Absicht, nach der Highschool Geschichts- oder Englischkurse zu belegen.
Du hast durchschnittlich elf Minuten früher gegen mich verloren als sonst. Ein eindeutiges Zeichen, dass du abgelenkt bist, stellte Nadia fest.
Was du nicht sagst, dachte Watt gereizt. Er hatte schließlich einen guten Grund, abgelenkt zu sein. Er hatte einen scheinbar einfachen Hacker-Job für eine Highlier namens Leda angenommen und sich dann in ihre beste Freundin Avery verliebt. Bis er herausgefunden hatte, dass Avery in Wirklichkeit Atlas liebte, genau die Person, die er für Leda ausspionieren sollte. Dann hatte er dieses Geheimnis ungewollt an Leda verraten, die bösartig und drogenabhängig und auf Rache aus war. Ein unschuldiges Mädchen war deshalb gestorben. Watt hatte nur dagestanden und es geschehen lassen. Und Leda kam ungestraft davon – denn sie wusste über Nadia Bescheid.
Watt hatte keine Ahnung, wie sie das angestellt hatte, aber irgendwie war Leda hinter sein gefährlichstes Geheimnis gekommen. Sie könnte Watt jederzeit für den Besitz eines illegalen Quants anzeigen. Nadia wäre dann natürlich für immer zerstört. Und Watt würde lebenslang im Gefängnis sitzen. Wenn er Glück hatte.
Watt!, zischte Nadia und jagte einen leichten Stromschlag durch seinen Körper. Der Mann von der Stringer war vom Podium heruntergetreten, auf dem jetzt eine Frau mit schulterlangen, kastanienbraunen Haaren und ernster Miene stand. Vivian Marsh, die Verwaltungschefin des MIT.
»Ein paar wenige von euch werden sich für das Massachusetts Institut für Technologie bewerben. Und noch weniger von euch haben die Noten, um auch aufgenommen zu werden«, sagte sie ohne Umschweife. »Aber diejenigen, auf die das zutrifft, werden feststellen, dass unser Programm auf drei Grundsätzen beruht: Forschen, Erfahren, Entwickeln.«
Watt hörte, wie leise auf den Tablets getippt wurde. Er sah sich um. Einige Schüler aus den Mathe-Leistungskursen schrieben eifrig mit, klammerten sich an jedes von Vivians Worten. Seine Freundin Cynthia – ein hübsches Mädchen mit japanischen Wurzeln, die mit Watt schon in den Kindergarten gegangen war – saß mit leuchtenden Augen an der Kante ihres Stuhls. Watt hatte nicht mal gewusst, dass sie sich für das MIT interessierte. Würde er mit ihr um die begrenzten Plätze konkurrieren müssen?
Watt hatte sich noch nicht mal überlegt, was er tun würde, wenn er nicht am MIT aufgenommen wurde. Schon seit Jahren träumte er davon, an dem extrem umkämpften Studienprogramm für Mikrosystemtechnik teilnehmen zu können. Das Forscherteam dieser speziellen Richtung hatte den Millichip entwickelt und die Verschränkungssoftware und die Raumtemperatur-Supermagneten, die die Quantendekohärenz verhindern.
Watt war immer davon überzeugt gewesen, dass er einen Platz bekommen würde. Verdammt, er hatte schon mit vierzehn einen eigenen Quantencomputer gebaut. Wie könnten sie ihn nicht nehmen?
Nur leider konnte er in seiner Bewerbung nicht über Nadia schreiben. Und wenn er sich unter den anderen Schülern so umsah, war er gezwungen, sich mit der sehr realen Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass er am Ende vielleicht doch nicht genommen wurde.
Soll ich eine Frage stellen?, fragte er Nadia unruhig. Er musste irgendetwas tun, damit Vivian Notiz von ihm nahm.
Das ist keine Frage-und-Antwort-Veranstaltung, Watt, bemerkte Nadia.
In diesem Moment trat plötzlich die Vertreterin der Stanford University auf das Podium und räusperte sich.
Ohne nachzudenken, sprang Watt auf, und fluchte, als er von der Stufe seiner Sitzreihe stolperte. Echt jetzt?, formte Cynthia mit den Lippen, als er über ihren Platz hinwegkletterte, aber das war Watt egal. Er musste mit Vivian Marsh reden, Stanford war im besten Fall eine Notlösung.
Er stürmte durch die Doppeltüren ganz hinten im Hörsaal, ignorierte die vorwurfsvollen Blicke, die ihm hinterhergeworfen wurden, und rannte um die Ecke auf den Ausgang der Schule zu.
»Ms Marsh! Warten Sie!«
Sie blieb mit erhobener Augenbraue stehen, eine Hand schon an der Tür. Na ja, zumindest würde er ihr im Gedächtnis bleiben.
»Ich muss zugeben, es kommt eher selten vor, dass ich aus einem Schulhörsaal verfolgt werde. Ich bin keine Prominente, wissen Sie.«
Watt hatte das Gefühl, einen Anflug von ironischer Belustigung in ihrem Tonfall zu hören, aber sicher war er nicht.
»Seit ich denken kann, träume ich schon davon, ans MIT zu gehen. Und ich wollte nur … ich wollte unbedingt mit Ihnen reden.«
Dein Name!, erinnerte Nadia ihn.
»Watzahn Bakradi«, sagte er schnell und hielt seine Hand hin. Nach einem kurzen Zögern schüttelte Vivian sie.
»Watzhan Bakradi«, wiederholte sie. Ihr Blick war nach innen gerichtet, also stellte sie mithilfe ihrer Kontaktlinsen Nachforschungen über ihn an. Sie blinzelte und richtete den Blick wieder auf ihn. »Wie ich sehe, haben Sie mit einem Stipendium an unserem Sommerprogramm für junge Ingenieure teilgenommen. Aber Sie wurden nicht noch einmal eingeladen.«
Watt zuckte zusammen. Er wusste genau, warum er nicht noch einmal gefragt worden war – weil eine seiner Professorinnen ihn mit dem illegalen Quantencomputer erwischt hatte. Sie hatte zwar versprochen, nicht die Polizei zu alarmieren, aber dieser Fehler hing ihm immer noch nach.
Nadia hatte Vivians Lebenslauf in seinen Kontaktlinsen aufgerufen, doch das half ihm auch nicht weiter. Watt erfuhr daraus nur, dass sie in Ohio aufgewachsen war und zuerst Psychologie studiert hatte.
Aber ihm war bewusst, dass er ihr antworten musste. »Dieses Programm lief vor vier Jahren. Ich habe seitdem eine Menge dazugelernt und ich würde mich freuen, wenn ich die Möglichkeit bekäme, Ihnen das zu beweisen.«
Vivian neigte den Kopf und nahm einen Anruf an. »Ich spreche gerade mit einem Schüler«, sagte sie zu dem Anrufer, wahrscheinlich ein Assistent oder so. »Ich weiß, ich weiß. Es dauert nur noch einen Moment.« Als sie eine Haarsträhne hinter das Ohr schob, entdeckte Watt einen teuren Handgelenkcomputer aus Platin. Plötzlich fragte er sich, was sie tatsächlich davon hielt, so weit unten in der zweihundertvierzigsten Etage vor Schülern zu sprechen, auch wenn es eine angesehene Schule war. Kein Wunder, dass sie es eilig hatte, hier wieder wegzukommen.
»Mr Bakradi, warum ist das MIT Ihre erste Wahl?«
Nadia hatte die Richtlinien und Leitbilder des MIT aufgerufen, aber Watt wollte keine vorgefertigte Antwort geben, nur um auf der sicheren Seite zu sein. »Mikrosystemtechnik. Ich möchte mit Quants arbeiten«, sagte er mutig.
»Wirklich?« Sie sah ihn von oben bis unten an und Watt hätte schwören können, dass ihr Interesse geweckt war. »Sie wissen, dass es für dieses Programm Tausende Bewerbungen gibt, aber jedes Jahr nur zwei Studenten genommen werden?«
»Ja, ich weiß. Es ist trotzdem meine erste Wahl.«
Es ist meine einzige Wahl, dachte Watt und warf ihr sein bestechendstes Lächeln zu, das er sonst immer zum Flirten mit hübschen Mädchen benutzte, wenn er mit Derrick unterwegs war. Er spürte, wie sie sich erweichen ließ.
»Haben Sie jemals einen Quant gesehen? Wissen Sie, wie unglaublich leistungsstark diese Computer sind?«
Hier wäre eine Lüge optimal, riet Nadia ihm, aber Watt wusste, wie er der Frage ausweichen konnte.
»Ich weiß, dass es nur noch wenige gibt«, sagte er. Die NASA