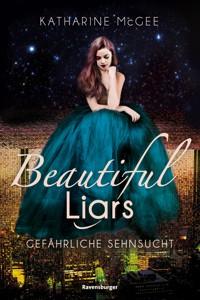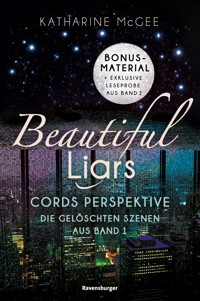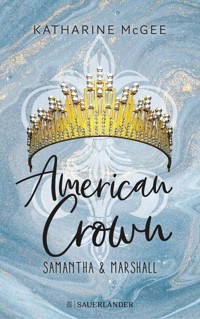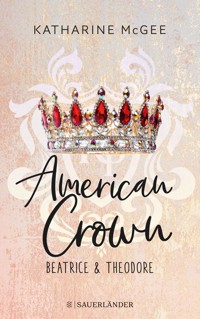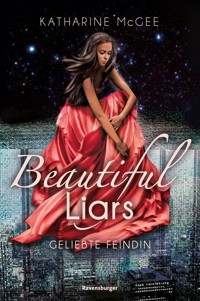
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Beautiful Liars
- Sprache: Deutsch
New York, 2119. Auch ein Jahr nach den tragischen Ereignissen im Tower kehrt im höchsten Wolkenkratzer der Welt kein Frieden ein. Die Polizei nimmt überraschend die Ermittlungen in einem mysteriösen Todesfall wieder auf, und die Mitwisser drohen aufzufliegen. Um einer Strafe zu entgehen, spinnen sie ihr Netz aus Lügen weiter, und am Ende steht wieder jemand auf dem Dach des Towers, bereit, alles hinter sich zu lassen … Band 3 der gefährlichen "Beautiful Liars"-Trilogie! Band 1: Verbotene Gefühle Band 2: Gefährliche Sehnsucht Band 3: Geliebte Feindin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2019Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2019 Ravensburger Verlag GmbHCopyright © 2018 by Alloy Entertainment and Katharine McGeePublished by arrangement with Rights People, LondonDie englischsprachige Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Towering Sky« bei HarperCollins Children’s Books.
Produced by Alloy Entertainment, LLCRedaktion: Regine TeufelUmschlaggestaltung: Carolin LiepinsVerwendete Fotos von © Matipon / Shutterstock, © conrado / Shutterstock, © Josef Mohyla / Shutterstock, © taramara78 / Shutterstock und © Irina Alexandrovna / ShutterstockAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-47905-4www.ravensburger.de
Für Deedo und in liebevoller Erinnerung an Snake
Prolog
Dezember 2119
Der erste Schnee des Jahres hatte in New York immer etwas Überirdisches. Er vergoldete die Schönheitsfehler der Stadt, ihre Ecken und Kanten, verwandelte Manhattan in einen stolzen, glitzernden Ort. Magie erfüllte die Luft.
Am Morgen des ersten Schnees blieben selbst die gleichgültigsten New Yorker auf den Straßen stehen und blickten in den Himmel hinauf, tief ergriffen von einem stillen Gefühl der Ehrfurcht. Als würden sie in jedem heißen Sommer vergessen, dass so etwas möglich war, und könnten es erst wieder glauben, wenn die ersten Flocken ihre Gesichter küssten.
Es schien fast so, als könnte der Schnee die Stadt reinwaschen und damit all die abscheulichen Geheimnisse enthüllen, die unter ihrer Oberfläche verborgen lagen.
Doch einige Geheimnisse wären lieber im Verborgenen geblieben.
An einem dieser kalten, in verzauberte Stille gehüllten Morgen stand ein Mädchen auf dem Dach des gigantischen Manhattan-Wolkenkratzers. Sie trat näher an den Rand, der Wind peitschte ihr Haar. Schneeflocken tanzten wie zersplitterte Kristalle um sie herum. Ihre Haut leuchtete wie ein überbelichtetes Hologramm im Licht der Morgendämmerung. Hätte irgendjemand sie hier oben gesehen, hätte sie auf den Betrachter aufgewühlt und unfassbar schön gewirkt. Und voller Angst.
Sie war seit über einem Jahr nicht mehr auf dem Dach gewesen, aber alles war unverändert. Es war mit Solarplatten bedeckt, die darauf warteten, das Sonnenlicht aufzunehmen und in nutzbare Energie umzuwandeln. Eine riesige Turmspitze aus Stahl ragte in den Himmel. Und unter ihren Füßen summte eine ganze Stadt – ein eintausend Etagen hoher Turm, in dem es von Millionen Menschen wimmelte.
Einige von ihnen hatte sie geliebt, andere verabscheute sie. Viele hatte sie überhaupt nicht gekannt. Und dennoch hatte jeder sie auf seine Weise verraten, jeder Einzelne von ihnen. Sie hatten ihr das Leben unerträglich gemacht. Denn sie nahmen ihr den einzigen Menschen, den sie jemals geliebt hatte.
Das Mädchen wusste, dass sie schon zu lange hier oben war. Sie spürte die vertraute wacklige Benommenheit, während sich ihre Körperfunktionen verlangsamten, darum kämpften, sich an den niedrigen Sauerstoffgehalt anzupassen und ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Sie rollte die Zehen ein. Sie waren taub. Die Luft im Tower war mit zusätzlichem Sauerstoff und Vitaminen angereichert, aber hier auf dem Dach war sie zu dünn zum Atmen.
Das Mädchen hoffte, sie würden ihr vergeben, was sie im Begriff war zu tun. Aber sie hatte keine Wahl. Entweder das oder sie würde weiterhin ein verkümmertes, elendes, halbherziges Leben führen, der einzigen Person beraubt, die es lebenswert gemacht hatte. Schuldgefühle kamen in ihr hoch, aber das tief empfundene Gefühl der Erleichterung, dass es wenigstens – endlich – bald vorüber wäre, war stärker.
Das Mädchen wischte sich über die Augen, als hätte der Wind ihr die Tränen hineingetrieben.
»Es tut mir leid«, sagte sie, obwohl niemand in der Nähe war, der es hören konnte. Zu wem sprach sie? Vielleicht zu der Stadt unter ihr oder der ganzen Welt oder ihrem eigenen stillen Gewissen.
Aber was spielte das auch für eine Rolle? New York würde mit ihr oder ohne sie weiterbestehen, so wie immer, genauso laut und energiegeladen und dröhnend und hell. New York scherte sich nicht darum, dass dies die letzten Worte von Avery Fuller waren.
Avery
Drei Monate vorher
Avery trommelte unruhig mit den Fingern auf die Armlehne am Sitz des Familienhelikopters. Sie spürte den Blick ihres Freundes auf sich und sah hoch. »Warum schaust du mich so an?«, fragte sie neckend.
»Wie denn? Als würde ich dich küssen wollen?« Max antwortete auf seine eigene Frage, indem er sich hinüberbeugte und ihr einen Kuss auf die Lippen drückte. »Es ist dir vielleicht nicht klar, Avery, aber ich möchte dich immer küssen.«
»Bitte machen Sie sich für die Ankunft in New York bereit«, unterbrach sie die Stimme des Autopiloten aus unsichtbaren Lautsprechern. Avery hätte diese Information gar nicht nötig gehabt, denn sie hatte den ganzen Flug aufmerksam mitverfolgt.
»Alles okay?« Max sah sie mitfühlend an.
Avery rutschte auf ihrem Sitz herum und suchte krampfhaft nach einer Erklärung. Sie wollte auf keinen Fall, dass Max dachte, sie sei seinetwegen so angespannt. »Es ist nur … es ist so viel passiert, während ich weg war.«
Es war eine lange Zeit gewesen. Sieben Monate, so lange hatte sie New York in ihren achtzehn Jahren noch nie verlassen.
»Mich eingeschlossen.« Max grinste verschwörerisch.
»Ganz besonders, was dich betrifft.« Avery erwiderte sein Lächeln.
Der Tower kam rasch näher, bis er den Blick aus den Flexiglasfenstern völlig beherrschte. Avery hatte ihn schon oft aus dieser Perspektive gesehen – in all den Jahren, die sie mit ihrer Familie verreist oder Eris und deren Eltern begleitet hatte –, aber ihr war bisher noch nie aufgefallen, wie sehr der Tower einem gewaltigen Grabstein aus Chrom ähnelte. Wie Eris’ Grabstein.
Avery schob den Gedanken beiseite. Stattdessen konzentrierte sie sich auf das herbstliche Sonnenlicht, das über den Fluss tanzte und die goldene Fackel der Freiheitsstatue zum Leuchten brachte. Einst hatte sie so groß gewirkt, nun war sie absurd zwergenhaft zusammengeschrumpft – durch ihren riesigen Nachbarn, den eintausend Etagen hohen Megatower, emporgewachsen aus der Betonfläche Manhattans. Der Tower, den das Unternehmen ihres Vaters mitgebaut hatte und in dem die Fullers die oberste Etage bewohnten, das höchste Penthouse der Welt.
Avery ließ ihren Blick zu den Booten und Fahrzeugen wandern, die weit unten umhersurrten, während die Monorailbahnen so fein wie die Fäden eines Spinnennetzes in der Luft schwebten.
Sie hatte New York im Februar verlassen, kurz nach der Eröffnung des neuen senkrechten Wohnkomplexes ihres Vaters in Dubai. An diesem Abend hatten sie und Atlas entschieden, dass sie nicht zusammen sein konnten, egal wie groß ihre Liebe füreinander war. Denn auch wenn sie nicht blutsverwandt waren, blieb Atlas ihr Adoptivbruder.
Avery hatte zu diesem Zeitpunkt geglaubt, ihre ganze Welt wäre zerbrochen, vielleicht auch sie selbst – in so viele winzig kleine Scherben, dass sie zu der Figur aus einem Kinderreim geworden war, die nie wieder zusammengesetzt werden konnte. Sie war sich sicher gewesen, dass sie an dem schrecklichen Schmerz zugrunde gehen würde.
Wie dumm sie gewesen war, zu glauben, dass ein gebrochenes Herz sie umbringen würde, aber genau so hatte sie sich gefühlt.
Doch Herzen waren komische, sture, flexible kleine Organe. Avery starb nicht, und ihr wurde klar, dass sie gehen musste – weg aus New York, das voller schmerzhafter Erinnerungen und vertrauter Gesichter war. Genau wie Atlas es getan hatte.
Sie hatte sich bereits für das Oxford-Sommerprogramm beworben, also rief sie einfach bei der Zulassungsstelle an und fragte, ob sie schon früher wechseln könne, rechtzeitig zum Frühjahrssemester. Dann traf sie sich mit dem Dekan der Berkeley Academy, um ihn zu bitten, die Oxford-Collegekurse in der Highschool anzuerkennen. Natürlich waren alle Beteiligten einverstanden. Als könnte irgendjemand Pierson Fullers Tochter etwas abschlagen.
Der einzige Widerstand kam überraschenderweise von Pierson Fuller selbst.
»Was soll das, Avery?«, wollte er wissen, als sie ihm die entsprechenden Papiere zum Unterschreiben vorlegte.
»Ich muss gehen. Irgendwohin weit weg, wo ich frei von Erinnerungen bin.«
Der Blick ihres Vaters verfinsterte sich. »Ich weiß, dass du sie vermisst, aber das kommt mir doch etwas übertrieben vor.«
Na klar. Er vermutete, dass ihr Vorhaben etwas mit Eris’ Tod zu tun hatte. Und das stimmte auch zum Teil – aber Avery trauerte auch um Atlas.
»Ich brauche einfach etwas Zeit außerhalb der Berkeley. Auf den Gängen starren mich alle an, tuscheln über mich«, beharrte sie und sagte damit die Wahrheit. »Ich will einfach nur weg. An einen Ort, an dem mich niemand kennt und wo ich niemanden kenne.«
»Die Leute kennen dich auf der ganzen Welt, Avery. Und wer dich noch nicht kennt, wird es bald tun«, erwiderte ihr Vater sanft. »Was ich damit sagen will … ich kandidiere dieses Jahr für das Amt des Bürgermeisters von New York.«
Avery starrte ihn für einen Moment an. Sie war sprachlos. Obwohl sie eigentlich nicht hätte überrascht sein sollen. Ihr Vater war nie mit dem zufrieden, was er hatte. Jetzt, da er der reichste Mann der Stadt war, wollte er natürlich auch der einflussreichste sein.
»Zu den Wahlen im Herbst bist du zurück«, sagte Pierson. Und es war keine Frage.
»Also kann ich gehen?« Avery wurde von einer heftigen, fast Übelkeit erregenden Erleichterung ergriffen.
Ihr Vater seufzte und begann, die Papiere zu unterschreiben. »Eines Tages wirst du begreifen, dass es nicht viel bringt, vor Dingen davonzulaufen, denen du dich irgendwann ja doch stellen musst, Avery.«
In der darauffolgenden Woche bahnte sich Avery mit einer drängelnden Schar Umzugs-Bots einen Weg durch die schmalen Straßen Oxfords. Die Studentenwohnheime waren mitten im Semester voll belegt, aber Avery hatte eine anonyme Anzeige in den College-Foren gepostet und ein Zimmer in einem Cottage außerhalb des Campus’ mit einem entzückenden verwilderten Hintergarten gefunden. Sie hatte sogar eine Zimmernachbarin, eine Literaturstudentin namens Neha. Und, wie sich herausstellte, ein Nachbarhaus voller männlicher Bewohner.
Avery lebte sich problemlos in Oxford ein. Es gefiel ihr, wie unmodern hier alles war. Ihre Professoren schrieben mit witzigen weißen Stiften an grüne Tafeln. Die Leute sahen sie tatsächlich an, wenn sie mit ihr sprachen, und ließen die Augen nicht andauernd zur Seite wandern, um ihre Feeds zu checken. Die meisten hier besaßen nicht einmal die computergesteuerten Kontaktlinsen, mit denen Avery aufgewachsen war. Die Verbindung in Oxford war so schwach, dass schließlich auch Avery ihre Kontaktlinsen herausnahm und wie ein vormoderner Mensch nur mithilfe eines Tablets kommunizierte. Ihr Blick fühlte sich dadurch angenehm natürlich und frei an.
Eines Abends, als Avery gerade an einem Aufsatz für ihren ostasiatischen Kunstkurs arbeitete, wurde sie durch Stimmen von nebenan abgelenkt. Ihre Nachbarn feierten eine Party.
In New York hätte sie einfach ihren Geräuschdämpfer eingeschaltet – ein Gerät, das alle ankommenden Schallwellen blockierte und damit selbst an den lautesten Orten für ein kleines Fleckchen Stille sorgte. Obwohl sie das in New York eigentlich nicht nötig hatte, weil es dort gar keine direkten Nachbarn gab, nur den Himmel, der sich um alle Seiten des Fuller-Apartments erstreckte.
Sie drückte die Hände auf die Ohren und versuchte sich zu konzentrieren, aber der dröhnende Lärm und das Gelächter wurden nur noch lauter. Schließlich stand sie auf und marschierte zum Fenster, ohne sich daran zu stören, dass sie Sportleggings trug und ihr honigfarbenes Haar mit einer Haarklammer in Schildkrötenform hochgesteckt war, die Eris ihr vor Jahren geschenkt hatte.
Da sah sie Max.
Er stand in der Mitte einer Gruppe im Hintergarten und erzählte lebhaft irgendetwas. Er hatte wirre dunkle Haare und trug ein blaues Sweatshirt zu blauer Jeans, eine Kombination, für die ihn die Mädels bei Avery zu Hause gnadenlos ausgelacht hätten. Avery betrachtete das jedoch als Zeichen seiner natürlichen Ungeduld, als wäre er zu sehr mit wichtigeren Gedanken beschäftigt.
Plötzlich kam Avery sich ziemlich lächerlich vor. Was hatte sie vorgehabt, als sie zum Fenster gestapft war? Wollte sie ihre Nachbarn anschreien, weil sie Spaß hatten? Sie trat einen Schritt zurück, als der Junge, der so eifrig erzählte, plötzlich aufsah – und ihr direkt in die Augen blickte. Er lächelte seltsam wissend. Dann glitt sein Blick an ihr vorbei, und er redete einfach weiter, ohne den Faden verloren zu haben.
Avery war überrascht, wie sehr sein Verhalten sie irritierte. Sie war es nicht gewohnt, ignoriert zu werden.
»Natürlich würde ich für das Referendum stimmen, wenn ich eine Stimme hätte«, sagte der Junge gerade. Er hatte einen deutschen Akzent, und sein Tonfall hob und senkte sich in einem wilden Spektrum aus Emotionen. »London muss sich nach oben erweitern. Eine Stadt ist etwas Lebendiges. Wenn sie nicht wächst, verkümmert sie und stirbt.«
Avery begriff, dass er von dem Gesetzentwurf ihres Vaters sprach. Nach seiner jahrelangen Lobbyarbeit im Britischen Parlament hatte Pierson Fuller endlich ein landesweites Referendum durchgesetzt, mit dem abgestimmt werden sollte, ob Großbritannien seine Hauptstadt abreißen und als Supertower wieder aufbauen sollte. Viele Städte der Welt hatten das schon hinter sich – Rio, Hongkong, Peking, Dubai und allen voran natürlich New York vor inzwischen zwanzig Jahren. Aber einige der älteren europäischen Städte sträubten sich noch dagegen.
»Ich würde mit Nein stimmen«, rief Avery dazwischen. Es war nicht gerade die populäre Meinung unter den jungen Menschen, und ihr Dad wäre entsetzt gewesen, aber sie verspürte den seltsamen Wunsch, die Aufmerksamkeit des Jungen auf sich zu ziehen. Abgesehen davon war das tatsächlich ihre Meinung.
Er machte eine halbe ironische Verbeugung in ihre Richtung und forderte sie damit auf, weiterzureden.
»London würde sich einfach nicht mehr wie London anfühlen«, fuhr Avery fort. London wäre eine weitere glatt gebügelte vollautomatisierte Stadt, ein weiteres senkrechtes Meer der Anonymität.
Die Augenwinkel des Jungen kräuselten sich leicht, wenn er lächelte. »Hast du den Entwurf gesehen? Ein Bataillon aus Architekten und Designern sorgt dafür, dass Londons Ausstrahlung erhalten bleibt. Die Stadt wird sogar noch eindrucksvoller sein als vorher.«
»Aber dieses Vorhaben kann nie wirklich umgesetzt werden. Wenn man in einem Tower ist, gibt es kaum noch ein Gefühl der Verbundenheit, der Spontaneität. Es gibt weniger …«, sie streckte ein wenig hilflos die Arme aus, »… von dem hier.«
»Uneingeladen in eine Party zu platzen? Irgendwie glaube ich, dass Leute aus Wolkenkratzern das ganz gut können.«
Avery wusste, dass sie vor Verlegenheit rot werden sollte, doch stattdessen lachte sie los.
»Maximilian von Strauss. Du kannst mich Max nennen«, sagte der Junge. Er hatte gerade sein erstes Jahr in Oxford abgeschlossen, wie er erklärte. Er studierte Wirtschaft und Philosophie, wollte promovieren und Professor werden oder Autor obskurer Wirtschaftsbücher.
Max hatte etwas ausgesprochen Altmodisches an sich, als wäre er durch ein Portal aus einem anderen Jahrhundert getreten und hier gelandet. Vielleicht lag das an seiner Ernsthaftigkeit. In New York schienen alle ihre Überlegenheit daran zu messen, wie herablassend und zynisch sie waren. Max hatte offenbar keine Angst, für Dinge einzustehen, öffentlich und ohne Ironie.
Schon nach wenigen Tagen verbrachten er und Avery den größten Teil ihrer Freizeit zusammen. Sie lernten in der Hauptbibliothek an einem Tisch, umgeben von zerfledderten alten Romanen. Sie saßen vor dem einheimischen Pub und lauschten der Musik der Amateur-Studentenbands oder dem sanften Zirpen der Grillen in warmen Sommernächten. Aber die Grenze der Freundschaft übertraten sie nicht ein einziges Mal.
Anfangs betrachtete Avery es als Experiment. Max war wie ein heilender Verband aus der Zeit, als die Leute noch keine Medi-Sticks besaßen. Er half ihr zu vergessen, wie verletzt sie immer noch war, weil sie Atlas verloren hatte.
Doch an irgendeinem Punkt hörte es auf, sich wie ein Trostpflaster anzufühlen. Ihre Beziehung begann echt zu werden.
Eines Abends gingen sie am Fluss entlang nach Hause, ein Schattenpaar im Dämmerlicht vor einem Wandteppich aus Bäumen. Der Wind frischte auf und kräuselte die Wasseroberfläche. In der Ferne glänzten die Kalksteinbögen der Universität blassblau im Mondlicht. Zaghaft griff Avery nach Max’ Hand. Sie spürte, wie er überrascht ein wenig zusammenzuckte.
»Ich dachte, du hast zu Hause einen Freund«, bemerkte er, als würde er auf eine Frage von ihr antworten, die sie vielleicht sogar gestellt hatte.
»Nein«, sagte Avery leise. »Ich wollte nur … über etwas hinwegkommen, das ich verloren habe.«
Seine dunklen Augen suchten ihren Blick und fingen dabei das leuchtende Mondlicht ein. »Bist du jetzt darüber hinweg?«
»Bald.«
Jetzt, im Helikopter ihres Vaters, in den riesigen bequemen Sesseln, rutschte sie näher an Max heran. Der marineblaue Polsterstoff hatte ein goldfarbenes Muster, das sich bei näherer Betrachtung als eine Reihe ineinander verschlungener kursiver Fs herausstellte. Selbst auf dem Teppich zu ihren Füßen prangte das Familienmonogramm.
Avery fragte sich nicht zum ersten Mal, was Max von all dem hielt. Wie würde er auf die Begegnung mit ihren Eltern reagieren? Sie hatte seine Familie diesen Sommer bereits an einem Wochenende in Würzburg kennengelernt. Max’ Mutter war Professorin für Linguistik, und sein Vater schrieb Romane, herrlich schreckliche Mysterygeschichten, in denen die Figuren mindestens dreimal pro Buch umgebracht wurden. Keiner der beiden sprach besonders gut Englisch. Sie hatten Avery einfach überschwänglich umarmt und ihre Kontaktlinsen für witzige automatische Übersetzungen verwendet, die ihre Nutzer trotz jahrelanger Upgrades immer noch wie betrunkene Kleinkinder reden ließen.
»Das liegt daran, dass Sprachen so viele Töne haben«, versuchte Max’ Mom zu erklären. Was wahrscheinlich bedeuten sollte, dass Sprachen viele Bedeutungsebenen hatten, wie Avery vermutete.
Aber sie hatten sich ebensogut mit Gesten und Lachen verständigt.
Avery wusste, dass es mit ihren Eltern ganz anders ablaufen würde. Sie liebte ihre Eltern, aber zwischen ihnen und ihr herrschte schon immer eine sorgfältig gehütete Distanz. Als sie noch jünger war und ihre Freundinnen manchmal mit ihren Müttern sah, hatte Avery immer einen Stich der Eifersucht verspürt. Auf Eris und ihre Mom, wie sie Arm in Arm durch Bergdorf tollten, verschwörerisch die Köpfe zusammensteckten, kicherten und dabei eher wie Freundinnen als wie Mutter und Tochter wirkten. Selbst auf Leda und ihre Mom, die sich höllisch streiten konnten, sich hinterher jedoch umarmten und immer wieder Frieden schlossen.
Die Fullers zeigten ihre Zuneigung nicht auf diese Weise. Selbst als Avery noch ein Kleinkind gewesen war, hatten sie nie mit ihr gekuschelt oder sich an ihr Bett gesetzt, wenn sie krank war. Dafür gab es in ihren Augen ausreichend medizinische Hilfe. Aber nur, weil sie ihre Gefühle nicht unbedingt körperlich zum Ausdruck brachten, bedeutete das nicht, dass sie Avery weniger lieb hatten. Dennoch – manchmal fragte sie sich, wie es wäre, Eltern zu haben, mit denen sie herumalbern konnte, Eltern, die sie nicht nur respektieren müsste.
Averys Eltern wussten, dass sie mit jemandem zusammen war, und sie hatten deutlich gemacht, dass sie es nicht erwarten konnten, ihren Freund kennenzulernen. Trotzdem wurde Avery das ungute Gefühl nicht los, dass sie schon nach dem ersten Blick auf Max und all seine chaotische deutsche Pracht ihn am liebsten in die Wüste schicken würden. Seit ihr Dad als Bürgermeister von New York kandidierte, schien er noch besessener von ihrem Familienimage zu sein. Was auch immer das bedeutete.
»Worüber denkst du nach? Machst du dir Sorgen, dass deine Freunde mich nicht mögen könnten?«, fragte Max und kam der Wahrheit damit erstaunlich nah.
»Natürlich werden sie dich mögen«, sagte Avery nachdrücklich, obwohl sie im Moment nicht wusste, was sie von ihren Freunden erwarten konnte, ganz besonders nicht von ihrer besten Freundin Leda Cole. Als Avery im Frühling gegangen war, war Leda in keiner guten Verfassung gewesen.
»Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist«, fügte sie hinzu. Max würde nur ein paar Tage in New York bleiben, bevor er zurückmusste, weil sein zweites Collegejahr in Oxford begann. Es bedeutete ihr viel, dass er für sie den Ozean überquerte, um ihre Heimatstadt zu sehen und die Menschen kennenzulernen, die ihr wichtig waren.
»Als würde ich mir die Chance entgehen lassen, Zeit mit dir zu verbringen.« Max strich sanft mit dem Daumen über Averys Fingerknöchel. Ein schmales Armband – eine Erinnerung an einen Freund aus Kindertagen, der jung gestorben war – rutschte an seinem Handgelenk hinunter. Avery drückte seine Hand.
Sie neigten sich ein paar Grad zur Seite und tauchten in den Luftstrom ein, der den Tower umgab. Selbst ihr Helikopter, der auf allen Seiten mit Gewichten beschwert war, um vor Turbulenzen geschützt zu sein, musste gegen den starken Wind ankämpfen. Avery verspannte sich, denn schon lag die Öffnung der Landeplattform wie ein klaffendes Maul vor ihnen – in perfektem Neunziggradwinkel in die Towerwand geschnitten, kahl und glatt und glänzend, als würde alles hinausschreien wollen, wie neu es war. Ganz anders als Oxford, wo schräge, unebene Dächer in den Himmel ragten.
Der Helikopter schlingerte auf die Plattform zu und peitschte die Haare der Wartenden auf. Avery blinzelte überrascht. Was wollten all diese Leute hier? Sie rempelten sich gegenseitig an, während sie kleine Bildaufnahmegeräte umklammerten, deren Linsen in der Mitte wie Zyklopenaugen leuchteten. Das waren wahrscheinlich Video-Blogger oder i-Net-Reporter.
»Sieht so aus, als freut sich New York, dass du zurück bist«, stellte Max trocken fest.
Avery lächelte beklommen. »Tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung.« Sie war an vereinzelte Fashion-Blogger gewöhnt, die Schnappschüsse von ihren Outfits machten, aber nicht an so etwas.
Dann entdeckte sie ihre Eltern, und plötzlich wusste sie genau, wer dahintersteckte. Ihr Dad hatte beschlossen, aus ihrer Rückkehr ein PR-Event zu machen.
Die Tür des Helikopters ging auf, und die Ausstiegsstufen entfalteten sich wie ein Akkordeon. Avery wechselte noch einen letzten Blick mit Max, dann stieg sie aus.
Elizabeth Fuller kam nach vorn geeilt. Sie trug ein maßgeschneidertes Kleid und Pumps. »Willkommen zu Hause, Schatz! Wir haben dich vermisst.«
Avery vergaß den Ärger darüber, dass ihr Wiedersehen auf diese Weise ablaufen musste – in der Hitze und im Lärm einer Landeplattform voller Schaulustiger. Sie vergaß alles bis auf die Tatsache, dass sie nach so vielen Monaten der Trennung ihre Mom wiedersah.
»Ich habe dich auch vermisst!«, rief sie und umarmte ihre Mom fest.
»Avery!« Ihr Vater wandte sich von Max ab, dem er gerade die Hand geschüttelt hatte. »Ich freue mich so, dass du zurück bist!«
Er umarmte Avery ebenfalls, und sie schloss die Augen, um die Umarmung zu genießen – bis ihr Dad sie geschickt herumdrehte, damit sie besser im Blickwinkel der Kameras stand. Strahlend vor Stolz trat er zurück. In seinem makellosen weißen Hemd wirkte er aalglatt und selbstzufrieden. Avery versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Ihr Dad machte aus ihrer Heimkehr eine Show, und die Medien sprangen auch noch darauf an.
»Ich danke Ihnen allen!«, rief er mit seiner dröhnenden, charmanten Stimme, was natürlich alle filmten. Wofür er ihnen dankte, war Avery nicht ganz klar, aber den nickenden Köpfen der Reporter zufolge schien das auch keine Rolle zu spielen. »Wir freuen uns wahnsinnig, dass unsere Tochter Avery rechtzeitig zur Wahl von ihrem Auslandssemester zurückgekehrt ist. Avery beantwortet natürlich gern ein paar Fragen«, fügte ihr Dad hinzu, wobei er sie sanft nach vorn schob.
Das wollte sie eigentlich nicht, aber sie hatte keine Wahl.
»Avery! Was trägt man zurzeit in England?«, rief eine Fashion-Bloggerin, die Avery flüchtig kannte.
»Ähm …« Obwohl sie schon oft erklärt hatte, dass sie kein Modefreak war, schien ihr niemand zu glauben. Avery warf Max einen flehenden Blick zu – nicht, dass er eine große Hilfe gewesen wäre –, und ihr Blick blieb am Ausschnitt seines Flanellhemds hängen. Die meisten Knöpfe bis zum Kragen waren dunkelbraun, nur einer in einem weichen Beige war deutlich heller. Er musste diesen Knopf verloren und durch einen neuen ersetzt haben, ohne darauf zu achten, dass der nicht zu den anderen passte.
»Knöpfe, die sich beißen«, hörte sie sich plötzlich sagen. »Also Knöpfe, die mit Absicht nicht zueinander passen.«
Max fing ihren Blick auf und hob amüsiert eine Augenbraue. Sie musste wegschauen, um nicht loszulachen.
»Und wer ist das? Dein neuer fester Freund?«, fragte ein anderer Blogger. Sofort richtete sich die Menge hungrig auf Max. Er zuckte freundlich mit den Schultern.
Auch Averys Eltern sahen Max an, und Avery bemerkte, wie sich ihre Mienen verfinsterten. »Ja, das ist mein Freund Max«, erklärte sie.
Nach diesen Worten gab es einen kleinen Tumult, aber bevor Avery noch etwas hinzufügen konnte, legte Pierson schützend einen Arm um sie. »Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir sind sehr froh, Avery wieder bei uns in New York zu haben«, wiederholte er. »Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden, wir brauchen etwas Zeit für uns allein. Als Familie.«
»›Knöpfe, die sich beißen‹?« Max ging neben Avery. »Woher hast du nur diese Idee?«
»Du solltest mir dankbar sein. Ich habe dich gerade zum stylischsten Typen New Yorks gemacht«, stichelte Avery und griff nach seiner Hand.
»Genau! Wie soll ich diesem Druck standhalten?«
Während sie auf das bereitstehende Hover-Taxi zugingen, wanderten Averys Gedanken zurück zu den letzten Worten ihres Dads.
Zeit für uns allein. Als Familie. Nur dass ihre Familie im Moment nicht vollständig war, weil eine wichtige Person fehlte.
Avery wusste, dass sie nicht an ihn denken sollte, aber sie fragte sich trotzdem insgeheim, was Atlas am anderen Ende der Welt wohl machte.
Leda
»Ist das nicht schön?«, versuchte es Leda Coles Mom mit kategorisch fröhlichem Tonfall.
Leda sah sich flüchtig und desinteressiert um. Sie und Ilara standen hüfthoch in warmem Wasser, umgeben von den zerklüfteten Felsen der Blauen Lagune. Die Decke der achthundertvierunddreißigsten Etage erhob sich in einem heiteren Azurblau über ihnen, was überhaupt nicht zu Ledas Stimmung passte.
»Sicher«, murmelte sie und ignorierte den schmerzvollen Ausdruck, der über das Gesicht ihrer Mom huschte. Sie hatte heute gar nicht aus dem Haus gewollt. Sie wäre viel lieber in ihrem Zimmer geblieben, allein mit ihrer einsamen Traurigkeit.
Leda wusste, dass ihre Mom nur helfen wollte. Sie fragte sich, ob Dr. Vanderstein ihr diesen erzwungenen Ausflug vorgeschlagen hatte, der Psychiater, der sie beide behandelte. Warum versuchen Sie es nicht mit etwas »Mädelszeit«?, hörte Leda ihn sagen, während er Anführungszeichen in die Luft malte. Ilara hätte diese Idee dankbar angenommen. Sie würde alles tun, um ihre Tochter aus dieser bleischweren dunklen Gemütsverfassung zu holen.
Vor einem Jahr hätte das auch funktioniert. Ilara hatte kaum Zeit für ihre Tochter gehabt. Leda wäre schon dankbar gewesen, wenn sie einfach nur miteinander hätten abhängen können. Und die Leda von früher war immer gern vor allen andern in ein schickes neues Spa oder Restaurant gegangen.
Die Blaue Lagune hatte erst vor ein paar Tagen eröffnet. Nach dem unerwarteten Erdbeben im letzten Jahr, bei dem fast ganz Island im Meer untergegangen war, hatte ein Bauunternehmen die überschwemmte Lagune als Schnäppchen von der überforderten isländischen Regierung abgekauft. Es hatte Monate gedauert, jedes einzelne Stück Vulkangestein auszugraben, das Ganze nach New York zu verschiffen und hier Stück für Stück wiederaufzubauen.
Typisch New Yorker. Immer darauf aus, die Welt zu sich zu holen, als könnten sie es nicht ertragen, ihre kleine Insel zu verlassen. Was auch immer ihr habt, schienen sie dem Rest der Welt sagen zu wollen, wir können es hier auch aufbauen – nur besser.
Leda hatte dieses coole Selbstbewusstsein auch mal besessen. Sie hatte über jeden Bescheid gewusst, Gerüchte verbreitet oder Gefälligkeiten ausgetauscht, hatte immer versucht, das Universum nach ihrem Willen zu beugen. Aber das war Vergangenheit.
Unbeteiligt ließ sie eine Hand durch das Wasser gleiten und fragte sich, ob es mit lichtbündelnden Partikeln durchsetzt war, um diese unglaublich blaue Farbe zu erzeugen. Anders als die ursprüngliche Lagune wurde diese hier nicht von einer heißen Quelle gespeist. Es war einfach heißes Leitungswasser, angereichert mit Multivitaminen und einem Hauch Aloe, was wahrscheinlich viel besser duftete als dieses alte, faulig riechende Schwefelzeug.
Leda hatte außerdem ein Gerücht gehört, dass der Manager der Lagunenanlage illegal Relaxans in die Luft pumpte. Keine bedenkliche Menge, nur gerade so viel, dass es 0,02 Prozent der Luftzusammensetzung ausmachte. Nun, im Moment konnte sie ein wenig Entspannung gut gebrauchen.
»Ich habe gesehen, dass Avery zurück ist«, wagte sich Ilara vor. Allein der Name stach wie ein Splitter in Ledas Schutzhülle aus Taubheit.
Es war leicht gewesen, nicht an Avery zu denken, während sie in England war. Avery hatte sich noch nie gern auf die Vid-Chat-Funktion verlassen. Solange Leda auf ihre Nachrichten antwortete, konnte Avery sich einreden, dass alles in Ordnung war. Aber was, wenn ein Wiedersehen mit ihr all die Erinnerungen wieder hochkommen ließ? Die Erinnerungen, an die Leda nicht mehr denken wollte, die sie tief in ihrem Inneren, in pechschwarzer Finsternis, vergraben hatte?
Nein, sagte sie sich, Avery wollte bestimmt genauso wenig über die Vergangenheit nachdenken wie sie. Avery war jetzt mit Max zusammen.
»Sie hat einen neuen Freund, richtig?« Ilara zupfte am Träger ihres schwarzen Badeanzugs herum. »Weißt du irgendwas über ihn?«
»Wenig. Sein Name ist Max.«
Ihre Mom nickte. Sie wussten beide, dass die alte Leda bei so einer Frage förmlich übergesprudelt wäre, die verschiedensten Vermutungen und Spekulationen über Max abgegeben hätte und ob er gut genug für ihre beste Freundin war oder nicht.
»Was ist mit dir, Leda? Ich habe dich schon eine Weile nicht mehr von Jungs reden hören«, fuhr ihre Mom fort, obwohl sie genau wusste, dass Leda den ganzen Sommer allein verbracht hatte.
»Weil es darüber auch nichts zu reden gibt.« Leda kniff die Lippen zusammen und ließ sich ein wenig tiefer ins Wasser gleiten.
Ilara zögerte, aber dann entschloss sie sich, das Thema doch noch nicht fallen zu lassen. »Ich weiß, dass du noch nicht über Watt hinweg bist, aber vielleicht ist es an der Zeit –«
»Ernsthaft, Mom?«, brauste Leda auf.
»Du hattest so ein hartes Jahr, Leda. Ich möchte nur, dass du glücklich bist. Und Watt …« Sie hielt inne. »Du hast mir nie richtig erzählt, was zwischen euch vorgefallen ist.«
»Ich will nicht darüber reden.«
Bevor ihre Mom weiter nachhaken konnte, hielt Leda die Luft an und tauchte in der Lagune unter, ohne sich davon stören zu lassen, dass die dämlichen Vitamine ihre Haare ganz spröde machen würden. Das Wasser fühlte sich warm und angenehm still an, es erstickte jedes Geräusch. Sie wünschte, sie könnte für immer untergetaucht bleiben, tief am Grund der Lagune, wo es kein Versagen und keinen Schmerz gab, keine Fehler und keine Missverständnisse, keine falschen Entscheidungen. Wasch mich und ich werde rein sein, erinnerte sie sich an einen Spruch aus der Sonntagsschule, nur dass Leda sich nie würde reinwaschen können, auch nicht, wenn sie für immer unter Wasser blieb. Nicht nach dem, was sie getan hatte.
Zunächst einmal war da die Sache mit Avery und Atlas. Es war schwer zu glauben, aber Leda hatte Atlas mal gemocht – dummerweise sogar geglaubt, sie würde ihn lieben –, bis sie herausgefunden hatte, dass er und Avery heimlich zusammen waren. Leda erschrak, als sie sich daran erinnerte, wie sie Avery damit auf dem Dach konfrontiert hatte, genau an dem Abend, als alles so schrecklich aus dem Ruder lief.
Ihre Freundin Eris hatte versucht, Leda zu beschwichtigen, obwohl Leda sie angeschrien hatte, zurückzubleiben. Als Eris näher kam, hatte Leda sie weggeschubst – und damit ungewollt vom Rand des Towers gestoßen.
Danach war es keine Überraschung gewesen, dass Avery New York verlassen wollte. Dabei wusste Avery nicht mal über die ganze Geschichte Bescheid. Nur Leda kannte den dunkelsten und verhängnisvollsten Teil der Wahrheit: Eris war Ledas Halbschwester gewesen.
Das hatte Leda im letzten Winter von Eris’ Exfreundin erfahren. Mariel Valconsuelo. Mariel hatte ihr auf der Eröffnungsparty des neuen Dubai-Towers davon erzählt – nachdem sie Leda unter Drogen gesetzt und während steigender Flut ganz nah am Wasser zum Sterben zurückgelassen hatte.
Mariels Worte hatten mit unerträglicher Endgültigkeit in Leda nachgehallt. Sie ergaben so viel mehr Sinn als das, was sie sich zusammengereimt hatte – dass Eris eine heimliche Affäre mit Ledas Vater hatte. Stattdessen hatten Eris und Leda denselben Dad. Und was noch schlimmer war: Eris kannte die Wahrheit, bevor sie starb. Das wurde Leda jetzt bewusst. Und das hatte Eris ihr an diesem Abend auf dem Dach auch sagen wollen, doch Leda hatte es auf dramatische Weise missverstanden.
Die Gewissheit, dass sie ihre eigene Schwester umgebracht hatte, fraß Leda von innen auf. Sie wollte mit den Fäusten um sich schlagen und schreien, bis der Himmel aufriss. Sie konnte nicht mehr schlafen, wurde verfolgt von traurigen Bildern von Eris auf dem Dach, die sie unheilvoll aus ihren bernsteingefleckten Augen ansah.
Es gab nur einen Weg, diesen Schmerz ein wenig zu lindern. Leda hatte zwar geschworen, ihn nie wieder zu betreten, aber sie konnte nicht anders. Mit zitternder Stimme hatte sie ihren Dealer angerufen.
Sie nahm immer mehr Pillen, mischte und kombinierte sie mit einer schockierenden Leichtsinnigkeit. Es war ihr egal, was sie einwarf, Hauptsache, es betäubte sie. Und dann – während es ihr insgeheim wahrscheinlich bewusst war – schluckte Leda eines Tages zu viele Pillen.
Sie war einen ganzen Tag verschwunden. Als ihre Mom sie am nächsten Morgen fand, lag sie zusammengerollt auf ihrem Bett und hatte immer noch Jeans und Schuhe an. Irgendwann musste sie auch Nasenbluten bekommen haben. Das Blut war in ihre Bluse gelaufen und in klebrigen Flecken auf ihrer Brust angetrocknet. Ihre Stirn war kalt und feucht vor Schweiß.
»Wo bist du gewesen?«, rief ihre Mom erschrocken.
»Ich weiß es nicht«, gestand Leda. Dort, wo ihr Herz sein sollte, war nur ein Flattern. Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, wie sie sich mit ihrem alten Dealer Ross zugedröhnt hatte. Für alles andere, was in den folgenden vierundzwanzig Stunden passiert war, konnte sie keine Rechenschaft ablegen. Sie wusste nicht einmal, wie sie es geschafft hatte, sich nach Hause zu schleppen.
Ihre Eltern schickten sie zur Entziehungskur, voller Angst, dass Leda sich hatte umbringen wollen. Vielleicht war das auf irgendeiner unterbewussten Ebene auch ihr Ziel gewesen. Vielleicht hatte sie nur beenden wollen, was Mariel begonnen hatte.
Und dann erfuhr Leda zu ihrer großen Überraschung, dass Mariel ebenfalls tot war.
Als Folge der schrecklichen Konfrontation in Dubai hatte Leda eine i-Net-Warnung eingerichtet, die jedes Mal anschlug, wenn Mariels Name erwähnt wurde. Leda hätte jedoch nie erwartet, den Namen in einer Traueranzeige zu finden. Aber in der Entzugsklinik wartete eines Tages ein Nachruf in ihrer Inbox: Mariel Arellano Valconsuelo, siebzehn Jahre alt, ist nun bei unserem Herrn. Sie hinterlässt ihre Eltern, Eduardo und Marina Valconsuelo, und ihren Bruder, Marcos …
Ist nun bei unserem Herrn. Das war noch vager formuliert als das Übliche ist von uns gegangen oder ist unerwartet verstorben. Leda hatte keine Ahnung, was Mariel passiert war, ob sie einen Unfall gehabt hatte oder an einer schlimmen Krankheit gestorben war. Vielleicht hatte sie auch Drogen genommen – aus Trauer über Eris’ Verlust. oder weil sie bedauerte, was sie Leda in Dubai angetan hatte.
Mit der Nachricht von Mariels Tod stieg eine erschreckende neue Angst in Leda auf. Es fühlte sich wie eine Art Omen an, ein schlimmes Vorzeichen auf die Dinge, die noch kommen würden.
»Ich muss gesund werden«, verkündete sie ihrer Ärztin an diesem Nachmittag.
Dr. Reasoner lächelte. »Natürlich, Leda. Das wünschen wir uns alle für dich.«
»Nein, Sie verstehen das nicht«, beharrte Leda aufgebracht. »Ich bin gefangen in diesem grausamen Kreislauf aus Schmerz, aus dem ich endlich ausbrechen will. Aber ich weiß nicht, wie!«
»Das Leben ist hart, und Drogen scheinen es leichter zu machen. Sie isolieren dich vom echten Leben, halten dich davon ab, zu tiefe Gefühle zu entwickeln«, sagte Dr. Reasoner sanft.
Leda hielt den Atem an und wünschte, sie könnte erklären, dass sie ein viel größeres Problem hatte als nur die Drogen. Es war dieser gähnende Strudel aus Finsternis in ihrem Inneren, der sie und alle Menschen um sie herum unaufhaltsam in die Tiefe zog.
»Leda«, fuhr die Ärztin fort, »du musst die emotionalen Strukturen durchbrechen, die dich in die Sucht getrieben haben, und dann ganz neu anfangen. Deshalb habe ich deinen Eltern empfohlen, dich in ein Internat zu schicken, wenn du den Entzug hier hinter dir hast. Du brauchst einen Neuanfang.«
»Ich gehe in kein Internat!« Leda konnte den Gedanken nicht ertragen, von ihren Freunden getrennt zu werden – oder von ihrer Familie, wie zerrüttet und zerbrechlich die Verhältnisse auch waren.
»Du kannst diesen Kreislauf nur mit einer Generalüberholung durchbrechen.«
Dr. Reasoner erklärte ihr, dass sie die vergifteten Teile ihres Lebens abtrennen müsste wie ein Chirurg mit einem Skalpell. Mit dem, was ihr dann noch blieb, müsste sie die nächsten Schritte wagen. Sie sollte alles herausschneiden, was die Sucht erneut auslösen könnte, und ihr Leben wieder aufbauen.
»Was ist mit meinem Freund?«, hatte Leda gewispert.
Dr. Reasoner seufzte. Sie hatte Watt kennengelernt, als er sie im Herbst zu Ledas Nachkontrolle begleitet hatte. »Ich glaube, Watt ist der schlimmste Auslöser von allen.«
Selbst mitten im blinden Nebel ihrer Schmerzen erkannte Leda, dass die Ärztin recht hatte. Watt kannte sie – kannte sie richtig, jedes letzte Bruchstück ihrer Hinterhältigkeit, ihre Unsicherheiten und Ängste, all die schrecklichen Dinge, die sie getan hatte. Watt war zu sehr in ihr altes Leben verstrickt. Und Leda musste sich auf ein neues Leben konzentrieren.
Nachdem sie aus der Entzugsklinik zurückgekehrt war, hatte sie sich endgültig von Watt getrennt.
Leda wurde aus den Gedanken gerissen, als eine rot leuchtende Mitteilung am Rand ihres Blickfeldes aufblinkte.
»Oh, Zeit für unsere Massage!«, rief Ilara und sah ihre Tochter hoffnungsvoll an.
Leda rang sich ein Lächeln ab, obwohl Massagen ihr inzwischen egal waren. Massagen gehörten zur alten Leda.
Sie watete hinter ihrer Mom durch das Wasser, vorbei an der Schlammpackung-Station und der Eisbar bis zu einem abgetrennten Bereich, der für private Spa-Behandlungen reserviert war. Sie traten durch eine unsichtbare Schallwand, die das Gelächter und die Stimmen aus der Lagune sofort ausblendete. Stattdessen waren sie nun von sanfter Harfenmusik aus Lautsprechern umgeben.
Zwei schwebende Matten waren für sie vorbereitet worden, jede mit einem elfenbeinfarbenen Band am Boden des Pools verankert. Leda legte die Hände auf ihre Matte und erstarrte. Plötzlich sah sie nur noch Eris’ weißen Schal, der vor ihrem rotgoldenen Haar flatterte, während sie in die Dunkelheit stürzte. Den Schal, den Leda so drastisch fehlinterpretiert hatte, weil er ein Geschenk von Ledas Dad gewesen war.
»Leda? Ist alles okay?«, fragte ihre Mom mit vor Sorge gerunzelter Stirn.
»Natürlich«, sagte Leda steif und hievte sich auf die Matte, die sich sofort aufzuheizen begann. Die Sensoren spürten ihre Verspannungen auf und passten die Behandlung an.
Leda zwang sich, die Augen zu schließen und abzuschalten. Alles würde gut werden, jetzt da die dunkle Seite des letzten Jahres hinter ihr lag. Sie würde nicht zulassen, dass die Fehler ihrer Vergangenheit sie nach unten zogen.
Sie ließ ihre Hände durch das künstlich blaue Wasser der Lagune gleiten und blendete ihre Gedanken aus, doch ihre Finger schlossen sich immer wieder automatisch zur Faust.
Es wird mir gut gehen, redete sie sich ein. Solange sie sich von allem fernhielt, mögliche Auslöser für ihre frühere Sucht nicht an sich heranließ, war sie sicher vor der Welt.
Und die Welt war sicher vor ihr.
Calliope
Calliope Brown stützte sich mit den Handflächen auf dem gusseisernen Geländer ab und blickte auf die Straße, die siebzig Etagen unter ihr lag.
»Oh, Nadav!«, rief ihre Mom Elise hinter ihr. »Du hattest ja so recht. Das ist absolut perfekt für den Hochzeitsempfang.«
Sie standen auf der Außenterrasse des Naturkundemuseums – eine tatsächlich offene Terrasse, deren Türen direkt in die honiggoldene Septemberluft hinausführten. Der Himmel strahlte wie auf Hochglanz poliert. Das war eine der letzten Etagen, wo man noch richtig nach draußen treten konnte. Weiter oben waren die Terrassen keine echten Terrassen mehr, sondern mit Polyethylen verglaste Räume mit einem schönen Blick.
Calliopes zukünftige Stiefschwester, Nadavs Tochter Livya, die in der Nähe der Türen stand, stieß ein zustimmendes »Wow!« aus. Calliope drehte sich gar nicht erst um. Sie hatte die Nase voll von Livya, gab aber ihr Bestes, sich das nicht anmerken zu lassen.
Sie und Livya würden nie Freundinnen werden. Livya war unausstehlich folgsam. Sie war eins dieser Mädchen, die immer noch schriftliche Danksagungen verschickten und ein schrilles falsches Lachen von sich gaben, wenn einer ihrer Lehrer einen lahmen Witz erzählte. Aber noch schlimmer war, dass sie etwas unausweichlich Hinterhältiges und Gerissenes an sich hatte. Würde man sich hinter einer verschlossenen Tür Geheimnisse zuflüstern, wäre Livya diejenige, die begierig ihr Ohr ans Schlüsselloch drückte. Das Gefühl hatte Calliope jedenfalls.
Sie hörte Nadav undeutlich etwas sagen, wahrscheinlich ein weiteres »Ich liebe dich!« zu Elise. Armer Nadav. Er hatte wirklich keine Ahnung gehabt, worauf er sich einließ, als er Calliopes Mom auf der Dubai-Eröffnungsfeier der Fullers einen Antrag gemacht hatte. Er konnte ja nicht wissen, dass Elise eine professionelle Hochzeitsschwindlerin war und dass es mit ihm die vierzehnte Verlobung war, die sie in den letzten paar Jahren eingegangen war.
Als Calliope noch ein Kind war und in London lebte, hatte ihre Mutter als persönliche Assistentin für eine kalte, wohlhabende Frau namens Mrs Houghton gearbeitet, die behauptete, aristokratische Wurzeln zu haben. Ob das nun stimmte oder nicht, es gab Mrs Houghton nicht das Recht, Calliopes Mom so zu malträtieren. Schließlich brachte sie das Fass zum Überlaufen, und Calliope und Elise verließen London. Calliope war erst elf Jahre alt.
Sie begannen ein glamouröses Nomadenleben zu führen, jetteten um die Welt, nutzten ihren Verstand und ihre Schönheit, um reiche Leute von ihrem überschüssigen Vermögen zu befreien, wie Elise es immer nannte. Eine ihrer vielen Strategien, um das zu erreichen, waren die Verlobungen. Elise brachte eine Zielperson dazu, sich in sie zu verlieben, ging die Verlobung ein, nahm den Ring und verschwand, bevor die Hochzeit stattfinden konnte. Aber das war längst nicht alles. Im Laufe der Jahre hatten Elise und ihre Tochter unzählige Geschichten erfunden, von längst verloren geglaubten Verwandten bis hin zu Anlagebetrug. Geschichten voller Tränen und Hingabe – was die Leute immer dazu brachte, ihre Bitbank-Konten für sie zu öffnen. Und nachdem sie eine bestimmte Summe erbeutet hatten, verschwanden Calliope und Elise von der Bildfläche.
Es war nicht ganz einfach, immer wieder auf diese Weise unterzutauchen, nicht in diesen Tagen und zu dieser Zeit. Aber sie waren unglaublich gut darin. Calliope war nur ein Mal entlarvt worden, und sie wusste immer noch nicht, wie das hatte passieren können.
Es war an dem Abend auf der Party in Dubai, kurz nachdem Nadav und Elise sich verlobt hatten – und nachdem Elise sich zu Calliope gedreht und ihr angeboten hatte, in New York zu bleiben, die Hochzeit tatsächlich durchzuziehen und hier zu leben, statt sich mit dem ersten Zug auf und davon zu machen. Calliopes Puls pochte vor Begeisterung bei dieser Aussicht. Sie hatte neuerdings das seltsame Verlangen, sesshaft zu werden, ein echtes Leben zu führen, und New York schien dafür der perfekte Ort zu sein.
Doch dann hatte Avery Fuller sie mit den Tatsachen konfrontiert.
»Ich kenne die Wahrheit über dich und deine Mutter. Also werdet ihr beide New York sofort verlassen«, hatte sie eiskalt und distanziert gedroht. Calliope wusste, dass sie einen Rückzieher machen musste. Sie hatte keine Wahl – bis sie ein paar Stunden später beobachtete, wie Avery und Atlas sich küssten, und ihr klar wurde, dass sie damit etwas ebenso Tückisches gegen Avery in der Hand hielt wie Avery gegen sie.
Zurück in New York, war sie diejenige, die Avery mit Tatsachen konfrontierte. »Ich gehe nirgendwohin«, erklärte sie. »Und wenn du irgendjemandem verrätst, was du über mich weißt, werde ich allen erzählen, was ich über dich weiß. Du kannst mich untergehen lassen, aber glaube mir, dann gehst du mit mir unter.«
Avery hatte sie nur mit müden Augen angestarrt, als würde sie Calliope gar nicht wahrnehmen, als wäre sie ein substanzloser Geist.
Damals war Calliope nicht klar gewesen, wozu sie sich verpflichtete, wenn sie in New York blieb und diesen Betrug weiterspielte. Sie hätte den Schilderungen ihrer Mom mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Elise legte ihnen immer eine Hintergrundgeschichte zurecht, die zu der Zielperson passte – und für Nadav, den sensiblen Mann der leisen Töne, den stillen Kybernetik-Ingenieur, war Elise aufs Ganze gegangen. Sie hatte sich und Calliope als liebenswerte, ernsthafte und mit Herzblut engagierte Wohltäterinnen präsentiert, die jahrelang durch die Welt gereist waren, um ehrenamtlich zu arbeiten.
Calliope blieb also in New York und hatte zum ersten Mal seit Jahren ein stabiles, »normales« Leben. Doch dafür bezahlte sie einen hohen Preis: Sie konnte nicht sie selbst sein.
Aber war überhaupt irgendjemand wirklich er selbst in New York? War das nicht die Stadt voller Menschen aus dem Nirgendwo, die sich mit ihrer Ankunft neu erfanden? Calliope blickte auf die Zwillingsflüsse hinab, die um Manhattan flossen wie der kalte Fluss Lethe – als wäre die gesamte Vergangenheit in dem Moment bedeutungslos, wenn man ihn überquerte, weil man als neuer Mensch wiedergeboren wurde.
Das liebte sie so an New York. Dieses Gefühl der absoluten Lebendigkeit, das Rauschen und Fließen einer schonungslosen, unbändigen Energie. Dass die New Yorker glaubten, das Zentrum der Welt zu sein – und Gott helfe dem, der irgendwo anders war.
Sie warf einen resignierten Blick auf ihr Kostüm – sie weigerte sich, es als Outfit zu bezeichnen, weil sie sich so etwas nie selbst ausgesucht hätte –, ein maßgeschneidertes knielanges Kleid und Pumps mit niedrigem Absatz. Ihr volles braunes Haar war im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, sodass die schlichten Aquamarin-Ohrringe zu sehen waren. Das Ganze wirkte damenhaft und elegant – und entsetzlich langweilig.
Zuerst hatte sie versucht, auf Nadavs Toleranzgrenze zu pfeifen. Er war schließlich mit ihrer Mom verlobt und nicht mit ihr. Was interessierte es ihn, wenn sie enge Kleider trug und bis spätabends wegblieb? Er hatte sie auf der Unterwasser-Gala und auf der Dubai-Party gesehen. Er wusste bestimmt, dass sie nicht so sittsam war wie ihre Mutter – oder besser gesagt, wie ihre Mutter vorgab zu sein.
Doch Nadav hatte schnell klargemacht, was er von Calliope erwartete: dass sie dieselben Regeln befolgte wie Livya. Er war direkt und kompromisslos. Er schien die ganze Welt als Computerproblem zu betrachten. Für ihn gab es nur schwarz oder weiß. Ganz anders als für Calliope und ihre Mom, die jede mögliche Grauzone nutzten.
Monatelang hatte sich Calliope kopfüber in diese Rolle gestürzt. Sie hatte den Blick gesenkt gehalten, für die Schule gelernt, sich an die Ausgangssperre gehalten. Aber das ging jetzt schon eine Ewigkeit so, viel länger als jede andere Betrugsmasche, und Calliope begann sich unter den Einschränkungen wund zu reiben. Sie hatte das Gefühl, sich in dieser nie endenden Darbietung selbst zu verlieren – sogar darin zu ertrinken.
Sie lehnte sich mit den Ellbogen auf das Geländer. Der Wind spielte mit ihren Haaren, zupfte am Stoff ihres Kleides. Der Hauch eines Zweifels, den sie nicht verdrängen konnte, machte sich in ihren Gedanken breit. War es das wirklich wert, nur um in New York zu bleiben?
In der Ferne senkte sich langsam die Sonne, ein wild lodernder goldener Lichtschein über Jerseys drachenrückenförmiger Skyline. Doch die Stadt zeigte keinerlei Anzeichen, zur Ruhe zu kommen. Autos fuhren in geordneten Bahnen über den West Side Highway. Staubpartikel tanzten in der untergehenden Sonne über dem Hudson und verliehen ihm einen feinen warmen Bronzeschimmer. Weiter unten am Fluss war ein altes Schiff in eine Bar umfunktioniert worden, wo New Yorker stur ihr Bier umklammert hielten, während die Wellen gegen die Bordwand schwappten. Plötzlich sehnte sich Calliope danach, bei ihnen dort unten zu sein, in das Gelächter und das Schaukeln des Schiffs einzustimmen, anstatt hier oben wie eine stille, atmende Statue festzusitzen.
»Ich habe mir gedacht, dass die Gäste hier draußen Cocktails einnehmen könnten, während wir unseren Fototermin haben«, sagte Nadav. Seine Mundwinkel verzogen sich fast, aber nicht ganz, zu einem Lächeln.
Elise klatschte wie ein kleines Mädchen in die Hände. »Das klingt wundervoll!«, rief sie. »Natürlich ginge das nur, wenn es kein Regentag wird, aber –«
»Ich habe bereits eine Wetteranfrage an das Metropolitan Wetteramt gestellt«, unterbrach Nadav sie eifrig. »Es sollte ein perfekter Abend werden, genau wie heute.« Er warf die Arme in die Luft, als wollte er den Sonnenuntergang als Geschenk präsentieren, was wahrscheinlich auch seine Absicht war, wie Calliope vermutete.
Sie hätte wissen müssen, dass man an seinem Hochzeitstag für gutes Wetter sorgen konnte, dachte sie ironisch. Letztendlich konnte man in New York alles kaufen.
Elise hob protestierend die Hand. »Das hättest du nicht tun müssen! Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel das gekostet hat. Du musst das absagen und das Geld stattdessen spenden …«
»Auf gar keinen Fall«, widersprach Nadav. Er beugte sich vor und küsste Calliopes Mom. »Dieses eine Mal dreht sich alles nur um dich.«
Calliope konnte sich gerade noch verkneifen, die Augen zu verdrehen. Als würde sich nicht immer alles um Elise drehen und um das, was sie wollte. Nadav hatte keine Ahnung, dass er auf den einfachsten Manipulationstrick der Welt hereingefallen war: umgekehrte Psychologie. Je mehr man bestimmte Menschen darum bat, kein Geld für einen auszugeben, desto entschlossener wurden sie, genau das zu tun.
Der Eventplaner des Museums erschien auf der Terrasse und informierte sie, dass die Verkostung der Appetithäppchen vorbereitet sei. Als sie sich im Gänsemarsch auf den Weg nach drinnen machten, warf Calliope einen letzten Blick über die Schulter auf den unendlich weiten Himmel. Dann drehte sie sich um und trat mit einem pflichtbewussten, mechanischen Schritt durch die Tür.
Watt
Es war Freitagabend und Watzahn Bakradi tat dasselbe, was er jeden Freitag machte. Er war in einer Bar.
Die heutige Bar seiner Wahl hieß Helipad. Die MidTower-Kundschaft hielt das wahrscheinlich für einen urkomischen, ironischen Hipsternamen, aber Watt hatte eine andere Theorie: Die Bar hieß Helipad, weil niemand Bock gehabt hatte, sich etwas Kreativeres auszudenken.
Obwohl Watt zugeben musste, dass die Location ziemlich cool war. Tagsüber war es eine echte, funktionsfähige Helikopterlandeplattform – es gab sogar Bremsspuren auf dem grauen Fußbodenbelag aus Karbongemisch, die erst wenige Stunden alt waren –, bis sie sich jeden Abend nach der letzten Hubschrauberlandung in eine illegale Bar verwandelte.
Die Decke erhob sich über den Gästen wie ein riesiger Brustkorb aus Stahl. Hinter einem Klapptisch mixten Barkeeper Drinks, die sie aus Kühlboxen nahmen. Niemand wagte es, einen Botkeeper mitzubringen, weil ein Bot alle Sicherheitsverstöße sofort melden würde. Dutzende junge Leute in bauchfreien Tops oder T-Shirts mit flimmernden Aufdrucken drängten sich in der Mitte der Plattform. Die Stimmung war aufgeheizt, die Luft vibrierte förmlich vor Spannung und Anziehungskraft und dem tiefen Dröhnen aus den Lautsprechern. Aber am bemerkenswertesten waren die Doppeltüren der Landeplattform. Sie standen weit und scharfkantig offen, als hätte ein Hai in die Außenwand des Towers gebissen. Die kühle Nachtluft peitschte um das Gebäude. Watt konnte sie über die Musik hinweg hören, ein seltsam geisterhaftes Heulen.
Die Partygänger sahen die ganze Zeit in diese Richtung, magisch angezogen vom Anblick des samtigen Nachthimmels, aber niemand wagte sich zu nah an die Türen heran. Es gab eine unausgesprochene Regel, auf dieser Seite der roten Sicherheitslinie zu bleiben, etwa zwanzig Meter von der klaffenden Öffnung des Hangars entfernt.
Trat man etwas näher, konnten die Leute denken, man wollte springen.
Watt hatte gehört, dass hier manchmal auch nachts unvorhergesehen Helikopter landeten, bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Wenn das passierte, konnte die ganze Bar innerhalb von vier Minuten geräumt werden. Die Leute, die hierherkamen, störte diese Ungewissheit nicht. Das machte den Reiz ja gerade aus, den Nervenkitzel, mit der Gefahr zu flirten.
Watt verlagerte sein Gewicht. Er hielt eine gekühlte Flasche Bier in der Hand. Es war nicht seine erste an diesem Abend.
Seit er wieder angenfangen hatte, abends wegzugehen – gleich nachdem Leda mit ihm Schluss gemacht hatte –, lungerte er in den Ecken jeder beliebigen Bar herum und versuchte seinen Schmerz zu verstecken, wodurch es nur noch mehr wehtat. Inzwischen war die Wunde so weit vernarbt, dass er sich unter die Leute mischen konnte. Dadurch fühlte er sich wenigstens nicht mehr ganz so einsam.
Dein Blutalkoholspiegel ist höher als die erlaubte Promillegrenze, teilte ihm Nadia mit, der Quantencomputer in Watts Gehirn. Sie projizierte die Worte auf seine Kontaktlinsen wie eine eingehende Nachricht. So kommunizierte sie immer mit ihm, wenn er sich in der Öffentlichkeit aufhielt.
Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß, gab Watt etwas gereizt in Gedanken zurück.
Ich mache mir nur Sorgen, wenn du alleine trinkst.
Ich trinke nicht alleine, betonte Watt freudlos. Ganz viele Leute sind mit mir hier.
Nadia lachte nicht über diesen Witz.
Watts Blick heftete sich auf ein hübsches Mädchen mit langen Beinen und olivfarbener Haut. Er warf seine leere Bierflasche in die Recyclingklappe und ging zu ihr hinüber.
»Möchtest du tanzen?«, fragte er. Nadia sagte kein Wort. Komm schon, Nadia. Bitte.
Das Mädchen zog die Unterlippe zwischen die Zähne und sah sich um. »Es tanzt aber sonst niemand …«
»Deshalb sollten wir den Anfang machen«, konterte Watt, als die Musik abrupt zu einem schrillen Popsong umschaltete.
Die Zurückhaltung des Mädchens schmolz augenblicklich dahin und sie lachte. »Das ist sogar mein Lieblingssong!«, rief sie und nahm Watts Hand.
»Wirklich?«, fragte Watt, als wüsste er das nicht längst. Nur seinetwegen – na ja, wegen Nadia – wurde dieser Song gespielt. Nadia hatte die Feeds des Mädchens gehackt, ihre Lieblingsmusik herausgefunden und sich dann in die Anlage der Bar gehackt, um sie abzuspielen, und das alles in weniger als einer Sekunde.
Danke, Nadia.
Bist du sicher, dass du mir danken willst? Dieser Song ist Müll, gab Nadia so heftig zurück, dass Watt sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte.
Nadia war Watts Geheimwaffe. Jeder konnte das i-Net mithilfe der computergesteuerten Kontaktlinsen durchsuchen, aber selbst die neusten Modelle funktionierten nur mit Sprachsteuerung – man musste den Befehl also laut geben, genau wie bei einer Flickernachricht. Nur Watt konnte das i-Net heimlich und wortlos durchsuchen, denn nur Watt besaß einen Computer, der in sein Gehirn eingebettet war.
Immer wenn Watt ein Mädchen kennenlernte, scannte Nadia augenblicklich die Feeds. So konnte sie ihm Tipps geben, was er sagen sollte, um die Auserwählte für sich zu gewinnen. War das Mädchen zum Beispiel eine tätowierte Grafikerin, konnte Watt so tun, als würde er auf alte 2-D-Zeichnungen und billigen Whiskey stehen.
War sie eine Austauschstudentin, konnte sich Watt weltgewandt und gebildet präsentieren.
Vielleicht setzte sie sich auch leidenschaftlich für Politik ein, dann konnte er behaupten, er würde ihr Anliegen unterstützen, egal was es war. Das Drehbuch änderte sich jedes Mal, aber mit Nadias Hilfe war es nie schwer, ihm zu folgen.
All diese Mädchen suchten letztendlich nach jemandem, der ihnen ähnlich war, der ihre Ansichten teilte, ihnen sagte, was sie hören wollten, sie nicht bedrängte oder ihnen widersprach. Leda war die Einzige unter all den Mädchen, die er jemals kennengelernt hatte, der es lieber war, wenn man ihr die Stirn bot.
Er verdrängte den Gedanken an Leda und konzentrierte sich wieder auf das Mädchen mit den strahlenden Augen.
»Ich bin Jaya.« Sie trat näher und legte die Arme um Watts Schultern.
»Watt.«
Nadia lieferte ihm ein paar Themen, um ein Gespräch zu beginnen, Fragen zu Jayas Interessen oder ihrer Familie, aber Watt war nicht in der Stimmung für Smalltalk.
»Ich muss bald los«, hörte er sich sagen.
Wow, ein richtiger Schnellschuss heute Abend, stellte Nadia trocken fest, doch Watt hatte keine Lust, darauf zu reagieren.
Jaya wirkte leicht überrascht, aber Watt redete einfach weiter. »Ich habe einen Welpen aus dem Tierheim in Pflege«, sagte er, »und ich muss nach ihm sehen. Ich habe zwar einen dieser Haustier-Bots, aber ich fühle mich immer komisch dabei, wenn ich den Kleinen mit dem Ding allein lassen muss. Er ist noch so jung, weißt du?«
Jayas Gesichtszüge wurden sofort wieder weicher. Es war ihr Traum, einmal Tierärztin zu werden. »Natürlich verstehe ich das. Was für ein Welpe ist es denn?«
»Wir denken, es ist ein Border Terrier, aber wir sind nicht ganz sicher. Er wurde verlassen im Central Park gefunden.« Aus irgendeinem Grund schmeckte die Lüge ranzig.
»Oh! Ich habe auch einen geretteten Border Terrier! Sein Name ist Frederick«, rief Jaya. »Man hat ihn unter der alten Queensboro Bridge gefunden.«
»Was für ein Zufall«, sagte Watt nüchtern.
Jaya schien seine fehlende Überraschung nicht zu bemerken. Durch ihre dichten, flatternden Wimpern blickte sie zu ihm auf. »Möchtest du, dass ich mitkomme und dir helfe? Ich kenne mich gut mit geretteten Tieren aus«, bot sie an.
Genau das hatte Watt erreichen wollen, aber jetzt, da Jaya diesen Vorschlag machte, hatte er das Interesse verloren. Er hatte das Gefühl, dass nichts und niemand ihn jemals wieder überraschen könnte.
»Ich denke, ich komme schon klar«, erwiderte er. »Aber trotzdem danke.«
Jaya zuckte sichtlich zurück. »Okay, na dann«, sagte sie kühl und stolzierte davon.
Watt fuhr sich müde mit der Hand über das Gesicht. Was stimmte nicht mit ihm? Derrick würde ihm was erzählen, wenn er wüsste, dass Watt hübsche Mädchen zurückwies, die von sich aus mit zu ihm gehen wollten. Nur dass er keins dieser Mädchen wollte, weil keine von ihnen die Erinnerung an die Eine auslöschen könnte, die er verloren hatte. Die Einzige, die ihm wirklich etwas bedeutet hatte.
Anstatt sich auf den Weg zum Ausgang zu machen, ging Watt in die entgegensetzte Richtung. Seine Zehen berührten die aufgemalte Sicherheitslinie. Hoch über ihm funkelten die Sterne am Himmel. Wenn man sich überlegte, dass ihr Licht mit einer Geschwindigkeit von dreihundert Millionen Metern pro Sekunde auf ihn herabraste … Aber was war mit der Dunkelheit? Wie schnell bewegte sie sich auf ihn zu, wenn ein Stern verglühte und sein Licht für immer erlosch?
Egal wie schnell das Licht auch war, dachte Watt, die Dunkelheit schien immer zuerst anzukommen.
Unweigerlich wanderten seine Gedanken zu Leda zurück. Aber diesmal wehrte er sich nicht dagegen.
Es war seine Schuld. Er hätte Leda in diesen ersten Wochen nach Dubai genauer im Auge behalten sollen. Nach allem, was passiert war, hatte sie darauf bestanden, etwas Zeit für sich zu haben. Watt hatte versucht, ihren Wunsch zu respektieren – bis er erfahren musste, dass sie eine Überdosis genommen hatte und erneut in der Entzugsklinik gelandet war.
Als sie nach ein paar Wochen wieder nach Hause kam, schien sie nicht besonders erpicht zu sein, ihn wiederzusehen.
»Hey, Watt«, sagte sie kühl an der Haustür. Sie trug einen ausgeleierten dunklen Pulli zu einer schwarzen, billig wirkenden Shorts und stand barfuß auf dem Hartholzboden vor ihrem Eingang. »Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Wir müssen reden.«
Diese drei Worte erfüllten Watt mit einer unguten Vorahnung. »Ich … ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht«, stammelte er und trat einen Schritt vor. »In der Entzugsklinik wollten sie mich nicht mit dir reden lassen. Ich dachte, du wärst …«
Leda schnitt ihm abrupt das Wort ab. »Watt, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich kann nicht mit dir zusammen sein, nicht nach allem, was ich getan habe.«
Watts Herz pochte. »Das spielt für mich keine Rolle«, versicherte er. »Ich weiß, was du getan hast, aber es ist mir egal, weil ich –«
»Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst!«, schrie Leda ihn an. »Watt, Eris und ich hatten denselben Vater. Ich habe meine Halbschwester umgebracht!«
Ihre Worte hallten in der Luft wider. Watts Kehle schnürte sich zu. Alles, was er Leda sagen wollte, schien nun bedeutungslos.
»Ich brauche einen Neuanfang, okay?« Ihre Stimme bebte und sie zwang sich, ihm nicht in die Augen zu sehen. »Es wird mir nie besser gehen, solange du in meiner Nähe bist. Du bist einer der Auslöser – der schlimmste Auslöser – für mein Verhalten. Und wenn ich mit dir zusammenbleibe, werde ich wieder in meine alten Verhaltensmuster zurückfallen. Das kann ich nicht riskieren.«
»Das ist nicht wahr! Du und ich, wir haben uns gegenseitig zu besseren Menschen gemacht«, versuchte er zu protestieren.
Leda schüttelte den Kopf. »Bitte«, flehte sie. »Ich möchte einfach in die Zukunft schauen. Wenn dir wirklich etwas an mir liegt, lässt du mich gehen, zu meinem eigenen Besten.«
Mit einem endgültigen Klicken schloss sie die Tür hinter sich.
»Hey, zurück da!«, brüllte jemand. Benommen nahm Watt wahr, dass er die Sicherheitslinie übertreten hatte und auf den gähnenden Schlund der Landeplattform zugegangen war.
»Sorry«, murmelte er und wich ein paar Schritte zurück. Er versuchte gar nicht erst, sein Verhalten zu erklären. Was genau sollte er den Leuten auch sagen? Dass es etwas Beruhigendes hatte, über den Rand zu blicken? Dass es ihn daran erinnerte, wie klein und unbedeutend er inmitten dieser gewaltigen Stadt war? Wie wenig sein Schmerz im Vergleich zum großen Ganzen zählte?
Schließlich drehte er sich um und verließ die Bar, genau wie er sich vor all diesen Monaten gezwungen hatte, Leda zu verlassen.
Rylin
Rylin Myers saß im Schneidersitz auf dem Boden, alte Vid-Speichergeräte lagen verstreut um sie herum. Einige hatten die Form von glänzenden kreisförmigen Scheiben, andere waren kastenförmig und quadratisch. Rylins feine halbkoreanischen Gesichtszüge verzogen sich zu einem Stirnrunzeln, während sie jedes Hardwareteil der Reihe nach genauer betrachtete – wobei sie bei jedem innehielt, als wollte sie den jeweiligen Wert abwägen –, bevor sie den Kopf schüttelte und zum nächsten überging. Sie war so in ihre Aufgabe vertieft, dass sie die näherkommenden Schritte gar nicht mitbekam.
»Ich habe nicht erwartet, dass du an deinem letzten Tag noch so hart arbeitest«, sagte Raquel, Rylins Chefin.
»Ich wollte die letzte Sammlung noch sortieren, bevor ich gehe. Wir sind schon fast bei 2030«, erwiderte Rylin eifrig.
Zu ihrer Überraschung kam Raquel herüber und kniete sich neben sie. Der tätowierte Blitz auf ihrem Unterarm – der in einem Sechzigsekundentakt eingestellt war – blitzte auf, wurde wieder dunkel und verschwand dann wie Rauch.
»Was hältst du davon?«, grübelte Raquel laut und griff nach einer Disc, auf der eine animierte Schneeflocke und zwei Mädchen mit geflochtenen Zöpfen abgebildet waren.
»Das mag ich«, sagte Rylin schnell und schnappte sich die Disc, bevor Raquel sie aussortieren konnte. Sie legte sie auf den Stapel mit der Kennzeichnung SICHERN: MÖGLICHEADAPTATION.
Ein Lächeln umspielte Raquels Mundwinkel. »Ich werde dich vermissen, Rylin. Ich bin froh, dass du dich für den Job beworben hast.«
»Ich auch.«