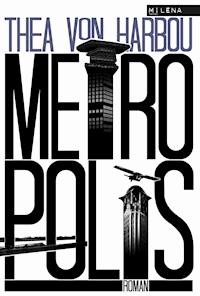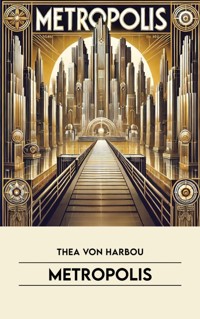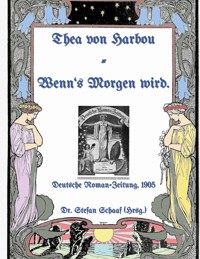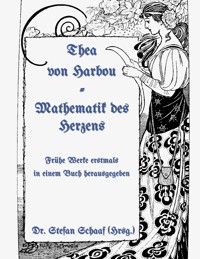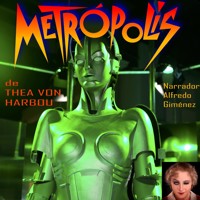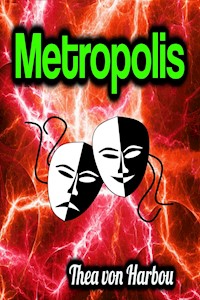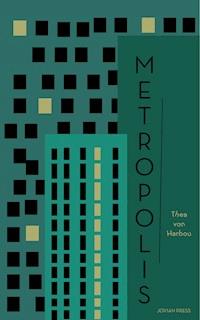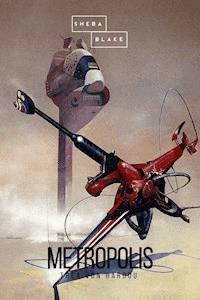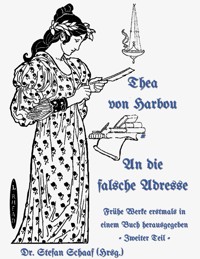
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Denken Sie doch, zwei starke, derbe, widerborstige Wildlinge in Hut zu haben, die man pflegen und ziehen und veredeln darf, bis es zwei gesunde, verheißungsvolle Bäumchen sind, die köstliche Frucht tragen sollen - ist das nicht wundervoll?" (Thea von Harbou, In einem Zuge, 1909) Thea von Harbou ist u.a. bekannt als Autorin von Metropolis, Drehbuchautorin von "M - Eine Stadt sucht ihren Mörder" und ihrer Ehe mit dem Regisseur Fritz Lang aber auch als Kriegsbuchautorin. Jedoch kennt kaum einer ihre verschollenen, frühen Werke. Nachdem es mir gelungen ist, diese aus den tiefen der vielen Tages-, Wochen- oder Monatszeitschriften zu bergen, war es immer mein Wunsch, sie als Herausgeber wieder allen einfach zugänglich zu machen. Im zweiten Teil geht es um kleine Episoden zum Schmunzeln, Weihnachtsgeschichten, aber auch um eine atemberaubende Autofahrt sowie um Erzählungen, die zu Kriegszeiten bzw. in der Kolonialzeit handeln. Aber es findet sich auch ein bisher noch unbekannter kurzer Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Herausgeber
Dr. Stefan Schaaf, Diplom-Physiker, ist promovierter, theoretischer Festkörperphysiker. Er ist als Unternehmensberater für Qualitäts- und Compliance Management in der Pharma- und Life Science Industrie tätig. Als Liebhaber klassischer Literatur, v. a. von Werken von Alexandre Dumas und Charles Dickens, wurde er über Metropolis zum Anhänger der Literatur Thea von Harbous.
1. Auflage, Februar 2025.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ist der König tot?
Junggesellen-Leiden
An die falsche Adresse
„Wir haben seinen Stern gesehen . . .“
Eine kleine Überraschung
Die Glocke
Vertauschte Rollen
Eine Minute vor Mitternacht
Der Weihnachtsteufel
Ich glaube!
Mater Dolorora
Die tote Maschine
Advent
Die Pfingstferien
Die Weihnachten des gottseligen Michel
Ein Liebesabenteuer in Fes
Schatten der Vergangenheit
Es ist ein Ros' entsprungen
Ich hatt' einen Kameraden
Das Licht im Nebel
Die Deutsche Fahne
Denken Sie doch, zwei starke, derbe, widerborstige
Wildlinge in Hut zu haben, die man pflegen und ziehen und veredeln darf, bis es zwei gesunde, verheißungsvolle
Bäumchen sind, die köstliche Frucht tragen sollen
— ist das nicht wundervoll?
(Thea von Harbou, In einem Zuge, 1909)
Vorwort
Mit Mathematik des Herzens habe ich eine erste Sammlung unter dem Thema „Die Frau und die Liebe“ zusammengestellt. Jedoch gibt es noch einige weitere Werke von Thea von Harbou, die nun über 70 Jahre nach ihrem Tod wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Aber neben diesen sehr emotionalen Erzählungen, gibt es noch den Teil, der seinerzeit oft unter dem Titel Humoreske, also einer kurzen, heiteren, lustigen oder komischen Erzählung, erschienen ist. Chronologisch sind die Erzählungen nach ihrem Entstehungsjahr zwischen 1905 und 1913 zu finden.
Ausnahmen sind drei Erzählungen (Die Weihnachten des gottseligen Michel, Ein Liebesabenteuer in Fes, und Schatten der Vergangenheit), die sich erst 1922 bzw. 1935 und sogar erst 1951 nachweisen lassen. Ihre Anzahl ist deutlich geringer als in Mathematik des Herzens, aber sie mischen sich zeitlich zwischen die anderen Erzählungen und zeigen ihre Sprachgewandtheit bei kleinen Geschichten zum Schmunzeln, über Hoffnungen und deren Erfüllung bis hin zu dramatischen Erlebnissen — wie in Die tote Maschine.
Eine kleine Besonderheit bildet auch Schatten der Vergangenheit, da es sich um einen Roman handelt. 1951 als kleiner Fortsetzungsroman in einer Revue erschienen, stellt er einen meiner neuesten Funde ihres literarischen Werkes dar. Auch wenn der Untertitel des Buches „Frühe Werke“ lautet, habe ich diese drei neueren Erzählungen hier mit aufgenommen, da sich ab den 1920er Jahren nicht mehr sehr viele Erzählungen in Zeitschriften finden.
Doch noch ein Wort zu den letzten 4 Erzählungen in diesem Buch:
Die Erzählungen sind einmal 1909 und die anderen 1915/16 veröffentlicht worden. Dabei war Südwest-Afrika 1884 bis 1915 Kolonie des Deutschen Reichs.
Thea von Harbou verbindet sicherlich hier ihre persönliche Reise nach Ostafrika, die sie tief beeindruckt hat und nach der sie angeblich ihren Eltern gesagt hat, dass sie als Krankenschwester dorthin zurückkehren will. Daher sind die Erzählungen in dieser Aufbruchstimmung der Kolonialisierung zu sehen. So hält sie 1907 einen Vortrag mit dem Titel „Was kann die deutsche Frau den deutschen Kolonien sein?“.Ihr Enthusiasmus bleibt über die Jahre erhalten. Im Rahmen des 25. Jubiläums der Abteilung Aachen der Deutschen Kolonialgesellschaft hält sie 1913 den Festspruch „Kolonie! O Zauberwort“.
So verbindet sich der Aufbruch in die Kolonien mit dem Auftrag der Frau, die ihren Anteil leisten will für das Vaterland. Heute würde man dies sicherlich als sehr „blauäugig“ sehen. Wenn man diese Erzählungen liest, dann sollte man daher immer daran denken, dass dies auch ein Stück Zeitgeschichte darstellt.
Ist der König tot?
Musikalische Novelle
Tobias Lautenkamp stand vor seinem alten, geliebten Spinett und schlug mit muskulösen Fingern die wunderbarsten Akkorde an. Die Saiten surrten und summten, als ob ein Schwarm Wespen aufgeschreckt würde — sie waren an eine solche Behandlung nicht gewöhnt. Und von der alten Tapete an der Wand blickte Vater Bach vorwurfsvoll auf seinen treuen Apostel herab, auf die lärmenden Hände und das rote, schwarz bedruckte Papier, das auf dem Instrument lag. Einen solchen Hexensabbat, wie ihn Tobias Lautenkamp heute vorstellte, hatte man in diesem musikalischen Heiligtum noch nie gehört.
Die Jalousien an den beiden Fenstern waren noch nicht zurückgeschlagen; nur einer war halb offen, und durch dieses Guckloch lugte die Morgensonne. Tobias Lautenkamp, der sich sonst über das kleinste Staubkorn ärgern würde, bemerkte die Staubwolke nicht, die im Gold der Sonne vibrierte.
Zu dieser ungewöhnlichen Störung des Hausfriedens trug nichts als das rote Papier bei, das so ruhig auf dem zornigen alten Spinett lag. Darin hieß es in klaren, fettgedruckten Buchstaben:
Samstag, 13. Februar
Konzert des Lautenkamp-Orchesters, unter der persönlichen Leitung des Kapellmeisters Lukas Lautenkamp.
„Es ist nicht zu glauben!“ rief der alte Herr und schlug mit der flachen Hand auf den unverschämten roten Zettel. „Es ist unglaublich! Ist die Welt nicht groß genug für ihn? Nein! Er muß mich noch hindern, alter Mann! Er wagt es, mich noch einmal anzusehen — Herr Kapellmeister! Mit seinem erbärmlichen Spiel! Ein tolles Programm, muss ich sagen! Und du (das war Vater Bach) kannst sie bei all deiner himmlischen Herrlichkeit nicht verhindern, dass sie dir ins Gesicht spotten? Selbst wenn du den ganzen jungen Menschen in deinen Palmengarten rufst, so laufen sie doch wieder hinaus, in die schreckliche Wildnis, weil sie sich einbilden, dort nochmehr zu finden. Selbst wenn du dich im Grab umdrehst, gibt die Menschheit keinen Deut dafür!“
Er war ein wunderbarer Kerl, der alte Tobias Lautenkamp, und das stille Heidestädtchen Lubing mit seinen hohen Giebelhäusern, dem schlafenden Brunnen auf dem Marktplatz und den wenigen altmodischen Einwohnern, die so schläfrig waren wie die Stadt, paßte vorzüglich zu dem alten Herrn. Er lebte seit undenklichen Zeiten in dem Häuschen neben der Kirche, in das nur wenig Leben einzog, als die süße, sanfte Elske, das einzige Kind des Vaters, einzog.
Das dauerte fünf ruhige, glückselige Jahre. Sie gebar ihrem Mann ein Mädchen; sie nannten sie Cecilia.
Als aber drei Jahre später ein munterer, schwarzäugiger Knabe das Licht der Welt erblickte, schlossen sich die sanften Augen der blonden Mutter für immer, und Tobias fand sich allein mit den kleinen Geschöpfen wieder, selbst hilfloser als ein Kind.
Der resolute Wirt von der „Goldenen Gans“ stand ihm schließlich mit Rat und Tat zur Seite. Tobias schloß die Tür seines Heiligtums fest hinter sich, nickte seinem guten alten Freunde über das Klavier hinweg mit einem glücklichen Lächeln zu und vertiefte sich mit ganzer Aufmerksamkeit in die Partituren auf dem Schreibtisch.
Durch die stillen Räume hallten die majestätischen Akkorde eines Chorals von Johan Sebastian oder das homerische Lachen des Paradieses Mozarts, des Lieblings der Götter, oder Papa Haydn nickte und lächelte von den rostigen Saiten. Da vergaß Tobias Lautenkamp die ganze Welt und wurde sehr zornig, wenn eine weinende Kinderstimme die hohe Klage eines Kirchenliedes störte.
Mit vierzig Jahren wurde Vater Tobias schon „der alte Lautenkamp“ genannt, und niemand konnte sich daran erinnern, dass er jemals jung gewesen war. Seine Eltern hatten auf dem Kirchhofe gegenüber seiner Hütte geschlafen, seit er sechs Jahre alt war, und für ihn, der immer unter Fremden war, nie erlebt hatte, was es heißt, ein Kind zu sein, waren die sonnigen Augen seiner Kinder wie unlösbare Rätsel.
Cäcilie war ein vernünftiges Kind, und schon mit vierzehn Jahren war sie eine gute Hausfrau für ihren Vater. Sie war sehr aufmerksam und lernte bald, den Haushalt zu führen, aber der helle Glanz ihrer Augen wurde schwächer undschwächer. Nur um den weichen, jugendlichen Mund war ein Hauch stiller Sehnsucht; aber der alte Lautenkamp merkte das nicht.
Er hatte genug mit seinem Jungen zu tun, über den er sich Tag für Tag halb zu Tode ärgerte. Kein Graben war ihm zu breit, keine Mauer zu hoch. Und das Feuer in Lukas' tiefen, dunklen Augen funkelte immer triumphierender, als hätte er die Maisonne, die am Tage seiner Geburt lachte, in seinem warmen, jungen Herzen aufgefangen. Er vermied sorgfältig Vaters Studierzimmer; eines Tages aber wurde er am Kragen gepackt und hineingestopft; er war gerade vom Drachensteigen gekommen, müde und warm. So erhielt er seinen ersten Klavierunterricht.
Er benahm sich sehr lehrreich; nur zeigte er eine Vorliebe für furiose Tempi. Der alte Lautenkamp schlug mit beiden Händen auf das Maß und stieß endlich den Knaben von seinem Stuhl herunter, um ihm den Ernst der Sache zu erklären. Lange Zeit spielte der alte Herr, in sich versunken, alle seine Lieblingsstücke. Er war erstaunt und freute sich so leise, dass der Junge hinter ihm zuhörte.
Mit einem kräftigen Ton schloß er und drehte sich um, und Lukas lag auf dem Boden, so groß er war, und schlief den Schlaf der Gerechten, ein Lächeln auf seinem schelmischen Gesicht. Lautenkamp erhob in stummer Verzweiflung die Augen über das Porträt — aber Vater Bach war klüger als sein eifriger Freund; er freute sich über den Halsstarrigen.
Und Schwester Cecilia?
Es war sie, des Vaters Trost und des Bruders Idol.
Sie heilte nicht nur schweigend alle Löcher und Haken, sondern hatte auch ein offenes Ohr für die wütenden Worte des Jungen, als sein Vater ihn einmal in die Hand genommen hatte. Sie hatte so gute, kühle Hände, so unendlich wohltuend für heiße, pochende Schläfen. Niemand ahnte, was das einsame Mädchen durchmachte; niemand wußte, was sie litt, als an einem lauen Frühlingsabend ihr bleichgesichtiger Bruder in ihr Kämmerlein trat. Verwirrte, aufgeregte Worte drangen an ihr Ohr, und sie blickte mit trockenen Augen auf den lockigen Kopf hinab, der sich in den Falten ihres Kleides verbarg.
„Gott helfe dir, Liebling!“ flüsterte sie.
Unten knallte eine Tür ins Schloss, und sie wusste, dass Lukas das Elternhaus verlassen hatte und nie wieder zurückkehren würde. Gegen die kleinen Fensterscheiben schlugen die Regentropfen wie große, warme Tränen.
Die Jahre vergingen, eintönig und langweilig. Die Stadt hatte sich nicht merklich verändert. Manches Haus war so schwach geworden, daß es nur aus alter Gewohnheit stehen blieb, oder weil es nicht wußte, ob es nach rechts oder links umfallen würde.
Aber heute! Was für ein Leben und was für eine Bewegung auf der Straße. Was für ein Gelaufe, Treppen rauf, Treppen runter hinter den hohen Fassaden. Ganz Lubing roch nach Seife und Bügeleisen. Im „Saal“ der „Goldenen Gans“ standen alle Fenster offen, und die Vorhänge flatterten im sanften Nachmittagswind. Es wurde geschrubbt und gespült, so dass sie in den Pfützen vor dem Haus hätten segeln können.
Cecilia war ausgegangen, um Besorgungen zu machen. Sie ging die Straße hinunter mit dem Gefühl, als ob die Leute sie ansähen. „Seine Schwester!“
Unangenehm fand sie das aber keineswegs. Im Gegenteil! Ihr noch jugendliches, weiches Gesicht war heute stolz auf seinen Ausdruck; sie nickte den großen roten Zetteln an den Straßenecken zu wie gute alte Bekannte. Es sang in ihr, fremd und doch vertraut — kein Ton aus den Partituren ihres Vaters; eine Melodie, die seit jenem Tag geschlummert hatte, einem Vorfrühlingstag wie heute, an dem Lukas von ihr Abschied genommen hatte.
Der alte Lautenkamp hatte gemurrt und leicht genickt, als sie ihm mit zitternder Hand die beiden Karten zeigte, auf denen dieselben Worte standen wie auf dem roten Zettel. Die glühenden Wangen seiner Tochter trieben ihn aus dem Haus in die Kirche. Er stieg die knarrende Treppe zu seiner geliebten Orgel hinauf und begann zu spielen, ein anschwellendes Trio, wehmütig und ein wenig bitter.
Und er beklagte sich bei den Geistern der alten Meister über seine Not über die junge Generation mit ihrer „modernen“ Musik, die sie ihren himmlischen Liedern vorzog. Er zermalmte diese Jungen unter seinen Flüchen und Akkorden. Er wollte ihre erbärmliche Musik in den Sumpf der Sünde zurücktreiben, wo sie hingehörte.
Eine Pause.
„Da saß der unverschämte Kerl — Gott, daß ich das erleben mußte! — Beethoven und Richard Wagner auf einem Programm. Verzeih ihm, großer Ludwig!“
Und die Prometheus-Musik erwachte in der Orgel. Er lacht über das Leben. Spott, Verachtung und ein Meer von Bitterkeit brachen aus der Seele des tauben Maestros hervor.
„Kümmere dich nicht darum, alter Beethoven. Du stirbst, und die Menschen leben . . .“
Der König ist tot — es lebe der König!
Und was für ein König! Ein König im Bettlergewand. Und das schreibt ein Charfreitagszauber. Schöner Charme! Schöne Welt!
Tobias Lautenkamp fährt sich mit den Fingern durch das dünne graue Haar.
„Warte, ich werde dir beibringen, was Karfreitagsmusik ist!“
Und er stimmt ein Lied von Bach an. Er spielt, bis Licht in das murmelnde Herz kommt. Er hat das Gefühl eines Siegers — er wird diese unsinnige Musik wieder aus seinem Kopf vertreiben; schließlich müssen er und seine geliebten Freunde triumphieren — auch wenn die Welt voller böser Geister wäre!
Die Welt war jedoch nicht voller Dämonen; sie war voll geheimnisvoller, erwachender Schönheit an dem lauen Frühlingstag. Noch keine Blüte, kein grünes Blatt, noch von Schnee und Eis befreit, die Erde voll Saft und Kraft, und in den Zweigen ein Pressen von Knospen. Kein triumphierendes Blau am Himmel; aber hie und da schimmerte ein Stück Königsmantel unter den Wolkenschleiern.
Die Flurfenster in der „Goldenen Gans“ waren geschlossen und hinter den weißen Vorhängen „spukte es“.
Es gab Schritte, es gab Schlurfen und Ruckeln, Überlegen und Zanken, dort wurden Instrumente gestimmt und schwierige Passagen noch einmal geprobt.
Unglücklicherweise kam in diesem Augenblick Tobias Lautenkamp vorbei, und ein grimmiger Blick ging zu den Fenstern hinauf.
„Natürlich hat er in seinem Herumtreiberleben1 kein Herz für seine Familie!“
Der Mann, den er meinte, gehörte jedoch nicht zu seinen Kollegen; er war auf den Kirchhof gegangen, um das Grab seiner Mutter zu besuchen. Und als er zurückkam, stand Cäcilie in der Tür des väterlichen Hauses. Sie sah sehr blaß aus; denn plötzlich fühlte sie, daß zwischen dem berühmten Künstler und ihr, die nie aus der Stadt gewesen war, eine tiefe Kluft bestand. Und Lukas meinte, sie habe um seinetwillen viel gelitten; so wagte es keiner von ihnen, auch nur das erste Wort zu sagen.
Cäcilie ging ins Haus zurück — mit einem flehenden Blick.
„Vater ist nicht hier“, flüsterte sie.
Er folgte ihr in ihr kleines Zimmer — alles war wie vor Jahren, einfach und gemütlich.
Er hatte in den Salons der großen Welt gestanden, und vornehme Damen hatten ihm geschmeichelt, aber nie hatte sein Herz geschlagen wie in dem stillen Zimmer seiner Schwester, aus dem er einst wie ein Verbrecher entflohen war.
Cecilia fühlte, wie seine Rührung und die Liebe, die sie jahrelang gehegt und unterdrückt hatte, alle trennenden Mauern niederrissen. Sie zog ihn in ihre Arme, küßte ihn und streichelte mit ihren kühlen Händen seine glühende Stirn.
„Liebling! Oh Gott, wie danke ich dir, dass ich ihn wieder habe!“
Er sah sie mit tiefer Liebe an.
„Wie gut du bist, Cäcilie, mich so zu empfangen. Ich habe dir so viel zu verdanken, und — ach, Schwester, was für eine Angst habe ich in diesem Augenblick gehabt!“
„Schande über dich“, sagte sie und lachte unter Tränen.
„Und Vater?“ fragte er zögernd.
Sie senkte den Kopf und antwortete niedergeschlagen:
„Heute nicht. Überzeuge ihn von dem, was du kannst, und komm dann. Ich schicke nach dir, wenn er . . . wenn er will. Aber nicht jetzt.“
Lukas Lautenkamp lachte traurig. Und es stand ihm noch ins Gesicht geschrieben, als er die Treppe zum Saal hinaufstieg, wo seine Musiker auf ihn warteten. Es musste noch geprobt werden.
„Der Kapellmeister ist heute nicht pünktlich“, wurde laut bemerkt.
„Ich bitte um Verzeihung“, sagte er und ging zum Dirigentenpult.
Die erste Geige verzog das Gesicht und sah seinen Freund erstaunt an.
„Hat Papa mitgespielt?“ fragte er; denn sie wußten alle, was der kleine Lubing für den jungen Dirigenten war.
Er schüttelte den Kopf und klopfte auf seinen Stock.
„Beethoven!“ sagte er kurz und wandte sich der Egmont-Partitur zu. Einen Augenblick ließ er den Taktstock sinken und wandte sich dem Orchester zu.
„Jungs“, begann er mit dem alten Jubel in der Stimme, „heute kommt es darauf an. Wenn Sie den alten Herrn Tobias Lautenkamp dazu bringen können, unsere Kunst zu erkennen — dann können Sie mich fragen, was Sie wollen!“
„Das nehmen wir an!“ rief die erste Geige. Und das Orchester applaudierte. Eine Flöte intonierte das Kampfmotiv der Meistersinger als Schlachtruf.
Fast hätte sie es wiederholt, als Lukas Lautenkamp kurz vor Konzertbeginn durch die kleine Tür des Orchesters in einer der ersten Reihen den weißen Kopf seines Vaters entdeckte. Der alte Herr sah aus, als ob er mit seinen dunklen Augen die gut gekleideten Leute ermordete, die sich um ihn drängten, als sie alle kamen, um diesen weltlichen Unsinn zu hören. Bisher war ihnen der alte Musikalist die Inkarnation allen musikalischen Verständnisses gewesen; jetzt wurde er kaum noch gegrüßt. Die jungen, fröhlichen Gesichter der Musiker waren für die Lubinger viel interessanter.
Der alte Mann saß da und blickte nach vorn und nickte stumm.
Der König ist tot; es lebe der König!
Aber nicht zu sterben und trotzdem tot zu sein, war viel schwerer zu ertragen.
Die schlanke, junge Gestalt trat mutig und selbstsicher auf, schritt hastig durch die Reihen der Musiker auf die kleine Bühne und verbeugte sich vor dem Saal.
Man applaudierte ihm, und er dankte mit einem Lächeln, nicht mit einem geschminkten, geschmeichelten Lächeln, sondern mit dem eines glücklichen, kämpferischen Künstlers. Die dunklen Augen glänzten. Es herrschte feierliches Schweigen. Gewiss, Lukas Lautenkamp brauchte keine Familie, das merkte der Alte; er gewann das Herz und die Seele seiner Musiker, die sich um ihn scharten.
Es war ein wenig bitter, aber Tobias vergaß es bald, denn aus der Menge ertönte eine Melodie, die er kannte: Fanfaren des Meeresgottes — eine seltsame Welle — Oberons Heer.
Tobias schürzte die Lippen. Ja, ja, ja, das war alles schön und gut — hm! — In der Tat. Das hatte er von dem Jungen nicht gedacht. Was für ein schöner Organist wäre daraus erwachsen; schade, schade für den Jungen!
Und wegen dieser Mutwilligkeit hatte er diese glänzende Zukunft aufgegeben. Was für ein Abschaum wurde da gespielt? . . . Chopin natürlich! Der alte Lautenkamp war wütend auf den Polen.
Es klang alles sehr schön und nett; wie Feentanz und Feenlied und das Lied der Nixen, — aber das war nicht möglich! Das war eine Entweihung der Kunst.
Hm! Es war nicht schlecht, aber das bedeutete nicht, dass die Lubinger wie verrückt in die Hände klatschen mussten. Zorn entzündete sich in dem alten Manne, der sein Herz am liebsten in einem tüchtigen Schimpfen ausgelassen hätte. Aber heute hatte er kein Kommando; der junge König war eingezogen.
Tobias saß steif da, aufrecht wie eine Kerze, und — überlegte: Seltsame Welten eröffneten sich ihm, aber auch dort schien die Sonne, und die Bäume trugen goldene Früchte, und niemand konnte gehindert werden, einzutreten. Über jedem Tor stand: Hier wohnt die Musik — und hinter jedem Tor war etwas anderes.
Tobias Lautenkamp dachte an Tausende von Menschen, die in die Berge reisten und ihre steile, schroffe Größe bewunderten. Zehn Pferde hatten ihn nicht hierher gebracht; aber er konnte deshalb die Berge selbst nicht vom Antlitz der Erde verbannen. Sie standen da und hoben ihre Wipfel zum Himmel empor und kümmerten sich nicht darum — ja, du alter Schurke, bekenne es! — ob es hier im Norden an der Heide eine Stadt mit einem solchen Bewohner gebe.
Obwohl er in seiner Heidestadt nicht viel von fremden Ländern hörte, waren sie da und wuchsen auf, und die jungen Leute wuchsen mit ihnen auf.
Lukas Lautenkamp sah seinen Vater an; ihre Blicke trafen sich — nur eine Sekunde, aber das reichte. Der alte Herr vollendete seinen Gedanken.
Die Kunst war eine Welt für sich wie die alte Mutter Erde und hatte ebenso viele verschiedene Länder. Die wachsende Menschheit beherrschte die alten Länder und suchte nach neuen. Die kleinen Staaten wurden von den großen unterdrückt; aber die wahrhaft Großen blieben, trotz des Wandels der Zeiten.
Und nun wusste Tobias plötzlich, warum Vater Bach immer so fröhlich lächelte, wenn sein Freund die neue Zeit beklagte.
„Mein lieber Lautenkamp“ bedeutete dieses Lächeln; „Du bist ein richtiger alter Dummkopf. Glaubst du, ich bin so schwach, dass ich deine Verteidigung brauche? Ist das, was ich geschaffen habe, so bedürftig?“
Der alte Herr seufzte tief. Er warf dem jungen Dirigenten einen traurigen Blick zu. Er blickte geradeaus, und es war offensichtlich, dass er Note für Note die Sprache der Instrumente kannte. Und mit dem Klang der Orgel schwoll das alte, stolze Lied an: Ein feste Burg ist unser Gott!
Lautenkamp lehnte sich zurück und sah seinen Jungen vergnügt an. Jetzt wußte er, warum er ihn an sich binden wollte. Er hatte ihn um die größere Fähigkeit, um das mächtigere Wissen in der Seele des jungen Mannes beneidet. Und er schämte sich aufrichtig dafür. Jahre des Grolls und des Zorns opferte er diesem Geständnis.
Du wirst alt, Tobias, dachte er, und die Jugend hat ihre Rechte. Bedenke das. Es ist ein ewiges Wachsen und Abnehmen in der Welt, und das nennt man Leben. Öffne die Tür für den sonnigen Jüngling; er küsst dein Herz herzlich. Sie, alter Richard Wagner, haben Vater Bach nicht nachgeahmt. Das war gut; denn du hast es nicht gebraucht. Du hast dein eigenes Lied sehr gut gesungen . . .
„Es wird anders sein, Kind“, brummte er zu seiner Tochter, als sie mit glühenden Wangen neben ihm nach Hause schritt. Du warst einer dieser kleinen Vögel, die man gefangen hat. Das wird jetzt anders sein. Und wenn der Junge nicht stur ist, sag es ihm . . .
„Vater!“ rief Cäcilie schluchzend vor Freude, „Vater, ich habe mit ihm gesprochen — er sehnt sich so sehr nach dir!“
„Gut, gut!“ Tobias grunzte, unnötig mächtig. „Sag ihm, daß er kommen soll!“
1 Formulierung an heutigen Sprachgebrauch angepasst (Anmerkung des Herausgebers)
Junggesellen-Leiden
Humoreske
„Paß auf, Moppel, uns gehts schlecht“ verkündete Theobald Schmiedlein seinem trauernden Liebling, der von der gemütlichen Sofaecke her sanft grunzend ins Dasein stierte.
Theobald Schmiedlein befand sich tatsächlich in jämmerlicher Verfassung. Vorgestern hatte man die alte Bärbel, die Schutzgöttin seiner Kindheit, den Hort seiner Flegeljahre, die Bewunderung seiner werdenden Männlichkeit begraben, aber niemand ahnte, — auch er selbst noch nicht — was ihm dies bissige kleine Frauenzimmer gewesen. Sie hatte ihn über alle Bäume verwöhnt! Kein Wunder, daß Theobald Schmiedlein sich nie nach einer anderen Häuslichkeit sehnte, denn ästhetische Ansprüche stellte er nicht — und Theobald war und blieb Junggeselle aus Grundsatz und Ueberzeugung.
Nun war die alte Bärbel tot und ihr armer Herr mußte sich seufzend nach einer anderen Bärbel umsehen. Düsterer Ahnungen voll mietete er auf eine Annonce hin ein appetitliches, hübsch gekleidetes Mamsellchen, das aus dunklen Spatzenaugen zutraulich in die Welt guckte. Am Montag um neun wollte sie eintreten und um elf wartete Theobald Schmiedlein immer noch, was ihm, den an strenge Pünktlichkeit Gewöhnten, zu jener pessimistischen Weltanschauung verhalf, deren Zeuge Moppel war.
Endlich, — es ging stark aufs Mittagessen zu und dem Wartenden revoltierte der Magen, kam auf der Straße ein von zwei Dienstmännern gezogenes Ungetüm angewankt, das aus Koffern, Körben und Schachteln gleich dem Götterwagen zu Dschaggernaut zum Riesending aufgebaut war. Theobald fühlte, daß ihm der Angstschweiß ausbrach, als er ging, die Haustür zu öffnen, und hinter dem Koffergefährt eine Droschke entdeckte, aus deren Innern ein hochmodern frisiertes Köpfchen strahlend vor Freundlichkeit grüßte.
„Es ist etwas spät geworden“, flötete das Mamsellchen, mit Anerkennung der Tatsachen. „Aber ich habe mich abgehetzt, so sehr ich konnte, obgleich mir das der Doktor verboten hat. Sie sind mir hoffentlich nicht böse?“
Theobald vollzog sein gutmütiges Vollmondgesicht zu einem Grinsen, das einen Herero schamrot gemacht hätte, und sah zu, wie die Kofferpyramide im Vorsaal aufgestapelt wurde. Das erschwerte zwar die Passage besonders für Theobald Schmiedleins Taillenmaß ungemein, aber es ging, und das Mamsellchen verschwand in seiner Kremenate, es dem guten Theobald überlassend, die männlichen Grazien abzulohnen.
Theobald Schmiedlein gehorchte, auch als sie später im weißen Tändelschürzchen bat, sie in die Wirtschaft einzuführen. Zum Glück fand sich das Mamsellchen flinker zurecht als er und der Hausherr machte Miene, seinen knurrenden Magen mit einem improvisierten Schläfchen zu betäuben.
„Aber ich sehe gar nicht das Küchenmädchen“, sagte das Mamsellchen mit holdem Lächeln.
„Küchenmädchen?“ wiederholte Theobald geistesabwesend, die Hand auf der Klinke.
„Nun ja“, — das Lächeln versüßte sich — „sprachen Sie nicht neulich davon?“
„Nein!“ erklärte Theobald selbstsicher. „Aber wenn es sein muß, so suchen Sie sich eins.“ Sprachs und verschwand in seinem Zimmer, um Moppel im Aerger vom Sofa herunterzuwerfen, was dieser mit einem giftigen Blick quittierte.
„Vor drei Uhr kann ich mit dem Essen nicht fertig werden“, meldete das Mamsellchen an der Tür.
Theobald grunzte etwas aus den Kissen heraus, was man mit etwas Phantasie und Optimismus für aufmunternde Zustimmung nehmen konnte. Dann wollte heilige Ruhe in sein Gemüt einziehen.
Er zog aber ein ziemlich grätiges Gesicht, als er, zum Essen gerufen, zwei Gedecke auf dem Tische fand.
„Sie werden doch nicht verlangen, daß ich wie ein Dienstbote in der Küche esse?“ meinte das Mamsellchen gekränkt durch seinen mißtrauischen Blick. Theobald, der in rohem Barbarismus das allerdings gewünscht hatte, winkte ab, doch seine gute Laune kehrte selbst beim Anblick und Genuß des tadellosen Males nicht wieder. Er haßte es auf den Tod, sich die Bissen in den Magen zählen zu lassen, und zwischendrein womöglich noch eine Unterhaltung zu leiten. Alle diesbezüglichen Versuche wies er denn auch mit beharrlicher Grobheit ab, so daß Mamsellchen endlich wütend seinen Teller von sich schob und den Mund wie eine eigensinnige Auster zuklappte.
Gefühllos nahms der Hausherr hin und zog sich gleich einer nudelsatten Riesenschlange auf sein Ruheplätzchen zurück. Was aber aus seiner Seele aufstieg, als draußen drei Türen nacheinander schmetternd ins Schloß flogen und dann ein Krach erscholl, als ginge eine ganze Porzellanausstattung in Scherben, — das will ich lieber nicht wiederholen. Ein Gebet war's nicht.
Um sechs Uhr wanderte Mamsellchen aus, um sich eine Küchenfee zu holen, und in dieser Zeit war's, als hätten sich sämtliche Handel- und Gewerbetreibenden zu einem Rendezvous bei Theobald Schmiedlein verschworen. Beim zehnten Klingelzug holte sich der wutschnaubende Hausherr einen Stuhl in den Vorsaal und hütete seine Tür wie Cerberus der Zweite. Als um acht noch kein Mamsellchen wiederkam, suchte er sich ein dürftiges Abendbrot in der Speisekammer und trug sich die Lampe ins Wohnzimmer. Elektrisches Licht mochte er nicht. Mamsellchen aber hatte vergessen, Oel aufzugießen, und so sagte die Lampe nach einer halben Stunde „Gute Nacht!“
Als Theobald nach einer durchschnarchten halben Stunde mit prasseldürrem Hals erwachte, vermißte er das frische Glas Wasser, das ihm die gute Bärbel allabendlich hingestellt. Vom Durst getrieben, stand er auf und tappte sich im Dunkeln nach der Küche, wo er zum Glück ein Glas auf dem Tisch fand. Das frisch gefüllte Glas in beiden Händen, trat er den Rückzug an und prallte mit seinem Bäuchlein ebenso wuchtig als erschütternd an die Kofferpyramide, deren Spitze — eine Hutschachtel — ins Fallen geriet und ihm das Glas aus der Hand schlug, nachdem sie auf Theobalds Kopf und Schulter aufgeplumst war.
Pflichtschuldigst ging das Glas in Scherben, — — es gab einen Mordsspektakel! Im Gange hinten öffnet sich eine Tür, ein breiter Lichtschein fiel heraus, dann gab's einen Quietscher, einen Krach, und Theobald stand wieder in sanftem Dunkel, dessen Effekt durch auf Reisen gehende Pantoffeln und eine kleine Kneipkur lieblich erhöht wurde.
Am nächsten Morgen nieste Theobald Schmiedlein. Düster sah er den kommenden Tagen entgegen und hatte für alle Annäherungsversuche Mamsellchens nur eisiges Stillschweigen. Das neue Hilfswesen im Hause trug Amors Pfeil im Herzen, stellte in begreiflicher Entzücktheit sämtliche Teller in Luft und brachte dem Hausherrn zerlassene Butter zum Rasieren. Als aber Mamsellchen in wilder Erbitterung einmal das Essen anbrannte und dann nicht garkochen ließ, da wurde Theobald Schmiedlein falsch und setzte Mamsellchen und Küchenmaid an die Luft.
„Nun nehme ich mir eine ganz Alte“, beschloß der gute Theobald und führte sein Vorhaben aus. Guste Uebermeyer war ein knochiges, langes Jungfräulein, das ganz gut unter den blauen Jungen des alten Fritz hätte dienen können. Etwas befremdend wirkte nur, daß sie den Anzugstag vom Freitag auf den Samstag verschob, weil der erste, wie sie sagte, Unglück brächte.
Theobald ergab sich und hatte am Samstag die Genugtuung, daß Guste nur mit einem Handköfferchen antrat und in grober, blauer Schürze wacker zugriff. Ein sanfter Duft durchzog bald das Haus und Theobald steckte erwartungsvoll seine Nase in die Luft. Pünktlich war der Tisch gedeckt und Guste trug ihre Schätze ins Zimmer — da, ein Schrei und ein dumpfer Krach, und der schönste Spinat, denn es je gegeben, zierte den persischen Teppich zu des Hausherrn Füßen. Guste aber kreischte in den höchsten Regionen: „Herrcheses, herrcheses, Herr Schmiedlein. Se müssen sterb'n. Se ham ne Spinne überm Koppe!“
Theobald sah empor. Da hing tatsächlich eines jener unschuldigen Geschöpfe und sah den perplexten Hausherrn ahnungslos über das Unheil, daß es angerichtet, in die Teller.
„Aber, Guste“, sagte Theobald betrübt. „Nun haben Sie den Spinat hingeworfen! Was hat Ihnen die Spinne getan?“
„Das ist 'ne Todesanzeige!“ verkündigte der ehemalige Flügelmann von der Garde.
„Quatsch!“ meinte Theobald, mehr überzeugt als höflich. „So nehmen Sie doch das Vieh weg!“
„Behüte, bewahre! Das machen Sie nur selber!“ kreischte Guste von neuem, und der Hausherr stieg über seinen schönen Spinat hinweg, um einen Besen zu holen, und schüttelte das Unglückstier „in die Sonne“, wie Guste befohlen hatte, aus. Guste aber verschwor sich hoch und teuer, mit diesem Besen nicht wieder kehren zu wollen.
Sehr nachdenklich kehrte Theobald Schmiedlein zu seinem Mittagsmahl zurück und seufzte. Nun war es am Tage! Guste Uebermeyer war abergläubisch — aber wie! Einmal am Tage mindestens rief ihr Zetergeschrei ihn in die Küche, um irgend eine entsetzliche Botschaft in Empfang zu nehmen. Theobald Schmiedlein kam zu keiner ruhigen Stunde mehr, aus den harmlosesten Dingen glotzten ihn Gespenster an. Als aber Guste Uebermeyer ihm aus dem Kaffeesatz gar eine Frau prophezeite, da gab's einen plötzlichen Schluß. Theobald Schmiedlein dankte Gusten für alle Bemühungen und schloß seine Gemächer ab, gab dem Nachbar das Moppelchen zur Bewahrung und ging auf Reisen — in die Berge.
Nun ging ein herrliches Leben los. Das Hotel, das Theobald Schmiedlein gewählt hatte, zeichnete sich durch Schönheit der Lage, Einfachheit und Güte aus, besaß einen hübschen Garten und einen breiten, überdachten Balkon, den Theobald Schmiedlein besonders anschwärmte.
Am vierten Tage aber bekam er an der Tafel ein neues Gegenüber und zwar ein doppeltes, eine Mutter mit ihrer Tochter Mariechen, die zur Zeit des siebziger Krieges lange Zöpfe und kurze Kleidchen getragen und die Eigenschaft besaß, bei Nennung ihres Namens die Augen niederzuschlagen und wie eine Pfingstrose zu erröten, was Theobald, nebenbei bemerkt, ziemlich albern fand.
Schon beim ersten Mittagsmahl begegnete er den huldvoll lächelnden Blicken der Mutter und eine düstere Ahnung wachte in ihm auf: das Gesicht hatte er schon des öfteren gesehen, aber wo? Mutter Behmke half ihm freundlichst ein: „Nichtwahr, Sie sind Herr Schmiedlein aus Oberrotha?“ Theobald verwünschte die jämmerliche Kleinheit des Erdkreises, aber er mußte seine Personalien feststellen.
„Ach Gott, wie ich mich freue!“ bekannte Mutter Behmke strahlend. „Wir sind doch zehn Jahre von Oberrotha fortgewesen, aber ich habe Sie gleich erkannt! Sie sind noch ganz der stattliche Herr wie früher! Nicht wahr, Mariechen?“
„Aber ich bitte Sie!“ verwahrte sich Theobald mit vollem Munde, doch Mariechen sagte: „Ja, Mama“, und wurde sehr rot.
„Nein, nun müssen Sie uns so viel als möglich erzählen“, fuhr Mutter Behmke fort, und alle wutschnaubenden Blicke Theobald Schmiedleins flossen an ihr ab, wie ein Stückchen Butter von einer heißen Kartoffel. „Also, wie geht's denn Lobitzers? Die wollten sich doch scheiden lassen? Nicht wahr, Mariechen?“
„Ja, Mama“, sagte Mariechen errötend und schlug die Augen nieder.
„Nein, so ein Skandal, wie das damals war!“ entsetzte sich Mutter Behmke. „Was? Sie haben sich wieder vertragen? Nein, was Sie sagen! Wo doch die Frau — na, ich will nichts gesagt haben, aber wir wissen, was wir wissen, nicht wahr, Mariechen?“
„Ja, Mama“, sagte Mariechen und wurde röter als die Korallenbrosche, die sie trug.
„So was! Mit einem fremden Mann davonlaufen! Das könnte meinem Mariechen nicht passieren!“ trompetete Mutter Behmke, daß sämtliche Gäste aufmerksam wurden. Und nun legte sie mit der Tugendliste Mariechens los, das war eine Litanei, so lang wie die dritte Epistel St. Johannes.
„Ach Gott, ach Gott!“ stöhnte der arme Theobald aus der Tiefe seines weiberfeindlichen Herzens. „Dabei kann man ja verrückt werden! Wenn das so weitergeht, dann hat dies Fleckchen Erde für uns zwei, das heißt drei, nicht Raum!“
Es schien in der Tat so, denn wo Theobald auch weilen mochte, — im Saal, im Garten, auf dem Altan, — wie ein Schatten in rosa Mull tauchte Mariechen Behmke hinter ihm auf, ein weltverlorenes Warten in den wasserhellen Augen. Bei Tisch aber hielt ihm Mutter Behmke allerlei nützliche Vorträge über das Thema: es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Es war zum aus der Haut fahren!
Kurz, Theobald brütete über einen Ausweg — und siehe da, er kam auf einen herrlichen Gedanken! Er suchte eine Fremdenpension auf, in der fast nur Ausländer wohnten, und machte sich zur Bedingung, daß er bei der Tafel einen Eckplatz und einen Nachbar bekäme, der kein Wort Deutsch verstünde. Die Sache machte sich famos und Theobald strahlte.
Der Nachbar war eine „Sie“, und zwar eine himmellange, dünne Amerikanerin, die mit dreister Freundlichkeit den Neuling unter die Lorgnette nahm. Er mußte ihrer Kritik standhalten, denn schon bei der Suppe wandte sie sich mit holdem Lächeln an ihn — doch sie litt kläglich Schiffbruch! Mit trostlosen Gebärden setzte Theobald ihr auseinander, daß eine Unterhaltung zwischen ihnen ins Bereich der Unmöglichkeit gehöre. Die lange Miß aber machte die etwas schläfrigen Augen noch weiter auf und sagte: „Aooh!“
Dabei bliebs fürs erste. Theobald glaubte, den Stein der Weisen in der Tasche zu haben und freute sich wie ein Schneekönig der endlich gewonnenen Ruhe und Ungestörtheit. Das einzige, was seinen Horizont trübte, war das Lächeln der langen Miß, das von Tag zu Tag rätselhafter und unwiderstehlicher wurde.
Er dachte aber doch, der Schlag sollte ihn treffen, als sie sich eines Tages mit dem Semmelkörbchen zu ihm wandte und strahlend vor Heiterkeit fragte: „Wuollen Sie Brot?“
Armer Theobald! Er schnappte umsonst nach Luft, sie schob es auf seine Bewunderung.
„Oh ja!“ fuhr sie freundlich fort, „ich habe lernen Ihre Sprake, um mir zu unterhalten mit Ihnen! Ich denke, wir werden uns sehr gut unterhalten!“
Seit dem Tage gleicht Theobald Schmiedlein dem ewigen Juden, aber er hatte die Sache schon recht gründlich satt. Ich fürchte, Mamsell Gustes Kaffesatz wird doch noch recht behalten!
An die falsche Adresse
Novellette
„Nein, Himmelkreuzbombenelement!“ schrie Hans Heinrich Vogel, der Aeltere, und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch, daß die Tinte aus dem frischgefüllten Fäßchen schwappte und draußen im Kontor zwölf Köpfe von den Pulten in die Höhe fuhren.
„Jetzt gibt's was!“ grinste der naseweise Jüngste mit der grausigen Freude des Nichtkombattanten; aber er sah sich betrogen. Hans Heinrich, der Jüngere, war viel zu sehr im Innern erbittert, um seine Empörung fortissimo zu offenbaren.
„Vater“, sagte er unterdrückt und bog das metallene Falzbein zum Hufeisen, „wie kannst Du einem ganz ungerechtfertigten Vorurteil, einer Laune, mein Lebensglück — “
„Ach!“ machte Papa Vogel mit unendlicher Geringschätzung. „Dein Lebensglück! Das sagt ihr jungen Grashupfer immer und meint dabei, die Weltgeschichte mache einen Satz wegen euch. Fällt ihr gar nicht ein! Lebensglück! — Eben um Deines Glückes willen verweigere ich Dir ein für alle mal meine Einwilligung zu dieser Heirat. Lehre Du mich die Amerikaner kennen! Geschäftsleute — Hut herunter, mein Junge! Aber heiraten, — nein!“
„Als ob ich einen alten, kontrapunktisch organisierten Yankee heiraten wollte!“ rief Hans Heinrich nicht ohne Berechtigung. „Mary kümmert sich den Kuckuck um die Geschäfte! Bei Baurat Spenser, wo ich sie kennen lernte, war sie der Sonnenschein und gute Hausgeist.“
„Du, — das sind die schlimmsten, welche die Hausgeister vor der Hochzeit spielen!“ bemerkte Papa Vogel ungerührt. „In so einem Küchenschürzchen aus Illusionstüll werden die meisten Männer gefangen. Gott bewahre! Die Chamäleonsnatur kommt erst nachher. Ich will keine von diesen amerikanischen Froschprinzeßchen in meiner Familie. Ich will ein liebes, inniges, gemütvolles Mädel zur Schwiegertochter, das mir meine alten Tage erwärmt und verschönt und mich nicht mit hundert Neuerungen aus meinen behaglichen Gewohnheiten aufjagt. Danach richte Dich! Schlag Dir Deine goldhaarige Mary aus dem Kopf und suche eine Marie in größerer Nähe. Ich will nicht, daß Du mit offenen Augen in Dein Verderben rennst — und dann, wenn Dich der Aerger und das Herzeleid umgebracht haben, als nachtwandelnder Geist an meinem Bett stehst und mich fragst: Warum hast Du mir nicht beizeiten einen Eimer kalten Wassers über den rauchenden Gehirnskasten gegossen, bevor ich mich von dieser amerikanischen Circe verwandeln ließ?“
„Das wäre noch lange nicht so schlimm“, — entgegnete Hans Heinrich junior, „als wenn ich zum Beispiel Mariechen Löblichs Wolle wickeln müßte, die seit ihrer Konfirmation 480 Paar Strümpfe für ostasiatische Waisenkinder gestrickt hat, oder wenn ich Henriettchen Ueberhau heimführte, die das Sprechen für eine Sünde zu halten scheint, oder Friederike Donner, die altindische Werke im Urtext liest und so lang ist, daß ich erst auf eine Fußbank klettern müßte, um ihr einen Kuß zu geben. Ich danke! Meine Frau müßte mir handlicher sein, ungefähr wie — Mary Briton, und wenn ich diese nicht bekomme, dann siehe Du zu, woher Du eine Schwiegertochter bekommst!“
Wupp! flog die Tür ins Schloß und Papa Vogel stand ärgerlich die Hände auf den Rücken gelegt, und guckte nach der Richtung, in der sein Einziger verschwunden war.
„Dummer Junge!“ grollte der alte Herr. „Immer loht bei dem gleich das Feuer aus den Augen, als ob er nicht an mir das Urbild der Sanftmut und milden Ueberredung hätte! Schockschwerebrett noch einmal! Mariechen Löblich ist doch die einzig richtige Frau für ihn, die ist geduldig und macht keine Szenen. Na, er kommt schon noch zu Verstand.“