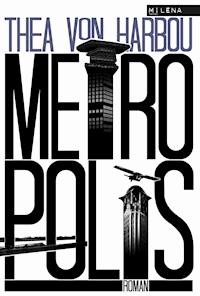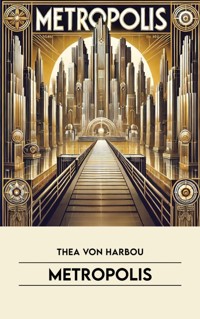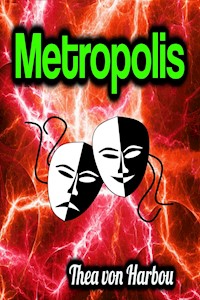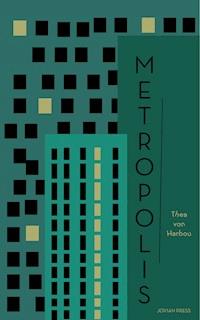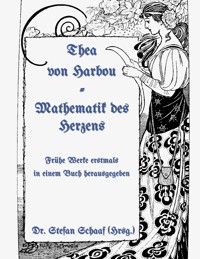
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thea von Harbou ist u.a. bekannt als Autorin von Metropolis, Drehbuchautorin von "M - Eine Stadt sucht ihren Mörder" und ihrer Ehe mit dem Regisseur Fritz Lang aber auch als Kriegsbuchautorin bekannt. Aber kaum einer kennt ihr verschollenes, frühes Werk. Nachdem es mir gelungen ist, dieses aus den tiefen der vielen Tages-, Wochen- oder Monatszeitschriften zu bergen, war es immer mein Wunsch, dieses als Herausgeber wieder allen einfach zugänglich zu machen. 70 Jahre nach ihrem Tod und fast 120 Jahre, seit die ersten Erzählungen erschienen, führt dieses Buch durch ihre Sicht der Frau über Liebe, Treue, Heldentum in viele Kulturen und Gesellschaften. Der Weg geht über zufällige Begegnungen, trotzige Abweisungen, Herausforderungen, aber immer . . . zum Herz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Herausgeber
Dr. Stefan Schaaf, Diplom-Physiker, ist promovierter, theoretischer Festkörperphysiker. Er ist als Unternehmensberater für Qualitäts- und Compliance Management in der Pharma- und Life Science Industrie tätig. Als Liebhaber klassischer Literatur, v. a. von Werken von Alexandre Dumas und Charles Dickens, wurde er über Metropolis zum Anhänger der Literatur Thea von Harbous.
1. Auflage, Januar 2025.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Auf Ehrenwort!
Puck
Signe
John Hunters Brautfahrt
Kamerad
Das Mammutchen
Die Liebesfibel
Aschenbrödel
Ein Wettrennen
Violet Stenhals Verlobung
Dem "Weihnachtsbazillus" verfallen
Jahreswende
Mein Bursche Fridolin
Der Föhn
Karfreitagszauber
Pfingsten im Schnee
Gewonnen!
Zwei Tischgespräche
Ueber der Erde
Krieg im Frieden
Der Stubenkrieg
In einem Zuge
Eine reiche Erbin
Prometheus
Das Kreuz auf dem Meere
Bräutliche Pfingsten
P.p.c
Die Sphinx
Auf eigenen Füßen
Eine Frauenfrage
Die Geschichte einer Kirschblüte
Ein Kuß
Hand in Hand
Mathematik des Herzens
Ya kuonana
Eine Begegnung
Die Ungekrönten
Zwei Leben
Das Licht aus der Türe
Das Wiegenlied
Veronika
Der Buddha mit der Lotosblüte
Einige Briefe
Michael Rosenrot
Da war das Leben sie suchen gegangen,
nun stand es wartend an der Tür
und ließ sich nicht fortreißen ohne Kampf.
(Thea von Harbou, Karfreitagszauber, 1909)
Vorwort
Selbst über 70 Jahre nach ihrem Tod ist Thea von Harbou noch immer durch ihre Werke bekannt, wenn auch oft nur der Name ihres Mannes Fritz Lang mit ihnen verbunden wird. Sie schrieb die Bücher und später auch die Drehbücher wie Metropolis, Die Nibelungen, Das indische Grabmal und Der Dieb von Bagdad. Mit 16 schrieb sie bereits ihren ersten Roman und in Folge viele Kurzgeschichten, Skizzen genannt. Die meisten dieser Skizzen erschienen nur in Zeitschriften und gerieten dadurch in Vergessenheit. Dank der Digitalisierung der Zeitungsarchive sind diese nun aber wieder leichter zugänglich geworden.
Fasziniert durch Metropolis und weitere ihrer Bücher habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so viele ihrer Erzählungen als möglich aufzufinden und so konnte ich in meinem 2020 bei BoD erschienenen Buch „Thea von Harbou – Skizzenbuch - Frühe Werke und Quellen“ zeigen, wie viel sie wirklich geschaffen hat. Durch den Wegfall des Urheberrechts kann ich diese nun auch zum ersten Mal herausgeben. Diese erste Sammlung unter dem Titel „Mathematik des Herzens“ wurde von mir unter dem Thema „Die Frau und die Liebe“ zusammengestellt. Ich hoffe damit, meine Begeisterung für diese vielen, immer noch lesenswerten Geschichtchen mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen zu können. Ihre bildgewaltige Sprache, intensive Emotionen, aber auch der sanfte Humor — all dies macht es lesenswert — auch heute noch.
Viele der Erzählungen wurden oft vielfach abgedruckt und auch in viele Sprachen in ganz Europa übersetzt. Die hier vorgestellten entstanden im Wesentlichen zwischen 1905 — sie ist gerade 17 Jahre alt — bis 1914. Ausnahmen bilden nur die drei letzten Erzählungen, die sich erst 1921, 1922 bzw. 1937 nachweisen lassen.
Durch ihre Abstammung spielen die Geschichten oft im Rahmen der vornehmen oder adeligen Gesellschaft, aber auf der anderen Seite zeigt sie auch das Bild der einfachen Leute, dessen Not und doch auch des Vertrauens. Thea von Harbou führt uns durch viele Kulturen und auch auf das Aufeinandertreffen der verschiedenen Kulturen.
Ich will nicht viele Worte machen — wer mehr zum Hintergrund wissen will, sei oben genannten Buch an Herz gelegt — sondern gleich Thea von Harbou zu Wort kommen lassen . . . 1922 sammelte die niederländische Wochenschrift „Kehr wieder" charakteristische Bemerkungen bedeutender Frauen der Zeit über Liebe und Ehe und nahm folgendes Zitat von Thea v. Harbou auf:
Eine Frau, die liebt, wird für den Mann zum Helden, zur Verbrecherin, zur Märtyrerin. Sie liebt, wo die Vernunft verachtet; sie wirft das Urteil der ganzen Welt einfach beiseite und bekennt sich zu dem geliebten Mann auch dann noch, wenn ihn die Vernunft schon lange aufgegeben hat. Und warum? Sie hat nur einen einzigen Grund: sie liebt ihn.
Dies findet sich in der 1911 veröffentlichten Skizze Mathematik des Herzens wieder, der ich auch den Namen dieser Sammlung entnommen habe. Es geht um Geschichten mit Herz, über Treue und Vertrauen — über den Weg, den die Liebe doch endlich findet. Sie zeigt die „lächelnde“ Seite der Liebe, die sich trotz oder gerade wegen einer ungewollten Situation ergibt, aber auch deren Dramatik — oder gar deren dunkle Seite, wenn der Tod oder die Trennung sich als einziger Weg zur Liebe finden.
Auf Ehrenwort!
Humoristische Skizze
Hauptmann von Boggesiel erklärte jeden Morgen, den Gott werden ließ: das Furchtbarste, was einem Menschen passieren könnte, sei, Kompagniechef zu werden. Von seinem Standpunkte aus hatte er recht: daß er bei dem beständigen Aerger noch im Besitz seines dunklen Haarschopfs war, galt als ein Wunder, das er zum großen Teil dem Rotmühl verdankte.
Rotmühl? Komischer Name! Bitte sehr, von höchster Bedeutung! Hasso von Rotmühl war die Rettung der Kompagnie, ein armer Teufel, aber immer fidel und trotz aller Musterhaftigkeit weder ein Tugendprediger noch Spielverderber. Einen einzigen Fehler hatte er: das schöne Geschlecht war für ihn nicht vorhanden, was bei einem schmucken Leutnant Sr. Majestät entschieden ein Mangel ist. Er hatte schwer darunter zu leiden, denn die Streiche die ihm die Kameraden spielten, füllten Bände. Aber was half's? Er blieb doch der Alte, bis man ihm schließlich den heiligen Antonius nannte, — welchen Namen er auch über Jahr und Tag still resigniert getragen hat.
Da er von jeher eine Neigung für fremde Sprachen gezeigt hatte, reifte in ihm der Entschluß, sich zum englischen Dolmetscherexamen vorzubereiten. Ernstestes Selbststudium füllte seine freie Zeit aus, er lernte und schrieb und las, doch ohne daß er sich befriedigt fühlte. Der mündliche Verkehr fehlte ihm.
„Lutz!“, wandte er sich etwas vorsichtig an seinen besten Freund, „kannst Du gut englisch?“
„Na, was man noch vom Korps her weiß!"
„Wollen wir's zusammen treiben?“
„Erbarm' Dich mein Junge, was fällt Dir ein!“ Hasso seufzte. „Und ich gebrauche jemanden dazu.“ Lutz überlegte. „Weißt Du, heiliger Antonius, ich glaube, Wörnitz sprach neulich von einer Engländerin, die vorzügliche Konversation treiben soll, nur zu ihrem Vergnügen, denn sie ist doll reich. Frag' ihn doch mal nach ihr!“
„Eine Frau?“ sagte Hasso ziemlich mißtrauisch.
„Ich weiß weder, ob sie Fräulein, noch ob sie schön ist,“ bemerkte Lutz phlegmatisch. „Sie steht als Dame tadellos da, ist Vollblutengländerin, — was willst Du mehr, Antonius?“
So kam's, daß Hasso von Rotmühl eines schönen Tages in full dress vor Miß Lilian Dunship stand. Wie sie aussah, wußte Hasso, der Ungeübte, natürlich nicht zu sagen, aber eine weiche dunkle Stimme hatte sie und kühle, schöne Hände. In drolligem Deutsch hieß sie ihn willkommen, und bald überwand er alle Befangenheit. Sie fragte nach seinen Absichten und machte verwunderte Augen, als er vom Dolmetscherexamen sprach.
„O, Kriegssachen! Aber davon weiß ich noch weniger als sie. Ich habe nie darüber gelesen!“
Hasso glaubte ihr das und versprach, ihr die betreffenden Bücher zu schicken.
„Oh no, no, no!“ wehrte sie lebhaft ab. „Wir wollen nicht verlieren so schöne Zeit. Bringen Sie sie selbst. Wir müssen fleißig sein, wir haben viel zu lernen, haben wir nicht?“
Sie plauderten wohl ein Stündchen zusammen und freuten sich am Ende auf die gemeinsame Arbeit.
„Ich muß Ihnen noch etwas sagen,“ begann sie, als sie schon an der Tür standen. „Ich habe schon ein paarmal versucht, Ihren Kameraden Stunden zu geben, aber die wurden dann immer so komisch und sagten, sie wollten mich heiraten. Dann war's immer aus und oh! — was habe ich mich geärgert! Werden Sie mir das auch sagen, Herr von Rotmühl?“
„Nein, das ist ganz ausgeschlossen,“ sagte der verblüffte Hasso mit unbewußter Grobheit. Aber Miß Lilian fand das sehr vernünftig.
„Versprechen Sie mir das?“ fragte sie
„Auf Ehrenwort!“ versicherte er kaltblütig, drückte ihr zur Bekräftigung die kühle, schmale Hand und pfiff sich ein Lied auf dem Heimweg.
Die ersten Stunden machten ihm tüchtig zu schaffen, denn seine Lehrerin ließ ihm trotz aller rührenden Geduld keinen Fehler durch. Und wenn sie ihn so ruhig beobachtend ansah, merkte er, daß sie kluge, helle Augen hatte, mehr nicht.
Er dachte überhaupt sehr wenig über Miß Lilian Dunship nach, der heilige Antonius. Hätte sie jetzt gesagt: „Mein lieber Herr von Rotmühl, ich habe die Plackerei mit Ihnen satt, kommen Sie ja nicht wieder“ — er wäre aus allen Wolken gefallen. Doch Miß Lilian sagte das nicht, und er fand das auch ganz in der Ordnung so. Sie war ein guter Kamerad und ein kluger dazu, mit dem er alles besprach. Und kam er einmal in schlechter Laune, weil ihm etwas quer gegangen oder Hauptmann von Boggesiel allzu sehr gewettert hatte, dann spielte sie ein Lied, das er liebte, und alles war wieder gut.
So kam der Sommer ins Land, die Manöverzeit und mit ihr die erste Trennung von Lilian Dunship. Hasso war ein bißchen verdutzt, als er daran dachte. Er stand am Fenster und starrte in den Regen hinaus, und aus diesem einförmigen Grau löste sich das Bild ihres Zimmers mit seiner vornehmen Behaglichkeit und sie selbst in ihren hellen Gewändern. Die wundervolle Harmonie, die um das Mädchen waltete, war ihm bisher als selbstverständlich erschienen; nun fühlte er's wie ein Geschenk.
Herrgott, ich glaube gar, ich werde poetisch! Ach was, sentimental ganz einfach, und Lilian hatte ihm erklärt, daß sie das hasse. Na, er brauchte ihr's ja nicht zu sagen — aber sie kannte ihn so gut und hatte so feine Fühler!
Was nun? Zu ihr gehen und sagen: „Lilian, ich hab' mir redliche Mühe gegeben, brav zu sein, aber's ging halt nicht, — ich hab' Dich lieb, lieber als mein Leben . . .“
Und sie? Er hörte sie schon sagen: „Oh — Sie sind auch nicht anders als die anderen und hatten mir doch versprochen — “
„Auf Ehrenwort!“
Hasso von Rotmühl sagte das ganz laut: vor diesen vier Silben machten seine Gedanken unbarmherzig Halt. Ach was, — war's damals nicht halb im Scherz gesprochen? Aber sein Ehrenwort gibt man nicht im Scherz, wenigstens er nicht, der immer so hochmütig auf seine Ehre pochte.
O Lilian, Lilian, was machst du aus mir!
Mitten in sein Grübeln hinein kam ein Telegramm für ihn: seine Mutter sei schwer, wohl lebensgefährlich erkrankt. Es traf ihn wie ein Beilhieb, er wollte auf der Stelle fort. Aber Hauptmann von Boggesiel fiel fast in Ohnmacht, als er's hörte. Acht Tage vor'm Ausrücken ins Manöver! „Rotmühl, wollen Sie mein Leben auf dem Gewissen haben?“
Nein, das wollte Hasso nicht: aber sobald eine schlimmere Nachricht käme . . .
„Ja, ja!“ stöhnte der geplagte Kompagniechef. „Seien Sie keine solche Trauerweide, Rotmühl, wer wird denn gleich das Schlimmste fürchten!“ Und im tiefsten Innern flehte er zu allen Engeln, das Leben der trefflichen, alten Dame noch recht, recht lange zu erhalten, wenigstens, bis nach dem Manöver!
Hasso lief mit zusammengebissenen Zähnen herum; Lutzens phlegmatische Trostworte brachten ihn zur Verzweiflung. Endlich hielt er's nicht mehr aus, er riß die Mütze vom Tisch, warf sich den Mantel über und stürmte durch den strömenden Regen, durch die einbrechende Dunkelheit zu Lilian Dunship.
Sie spielte auf dem Flügel, als er dicht hinter der meldenden Zofe bei ihr eintrat. Aber ohne viel Fragen gab sie ihm die Hand, wies ihm den Sessel an, der ihr gegenüberstand, und sah ihm forschend in das verstörte Gesicht.
Da gab er ihr das Telegramm und sprach von der Unmöglichkeit für ihn, zur Mutter zu reisen, von seiner marternden Sorge, von der Verlassenheit der geliebten Kranken, die keine verwandte Menschenseele um sich habe.
Alle seine vergötternde Liebe zu der Mutter trat ihm auf die Lippen, all seine Sorge und Ratlosigkeit, — und ihre ernsten Augen sprachen von warmem Verstehen und herzlicher Teilnahme; doch das merkte er nicht, er sah sie gar nicht an.
„Nun werden Sie sagen, ich sei sentimental,“ murmelte er in förmlicher Angst vor dem verhaßten Wort.
Sie hatte sich erhoben und stand dicht neben ihm.
„Oh no!“ sagte sie ganz leise, und plötzlich fühlte er ihre geliebte Hand zaghaft auf seinem gesenkten Kopfe ruhen.
Er griff nach dieser Hand und preßte die Stirn hinein. Wie wohl das den fiebernden Schläfen tat!
„Ich will Ihnen etwas sagen, dear friend!“ fuhr sie fort, sich sacht befreiend. „Ich will zu Ihrer Mutter fahren und sie pflegen.“
Er sprang auf und sah sie ganz entgeistert an. „Lilian — Lilian!“
„Denken Sie, ich kann nicht?“ Nun war sie Feuer und Flamme. „O, ich kann sehr gut Kranke pflegen! Ich fahre noch in diese Nacht, ich denke, es ist sehr weit, ist es nicht?“
„Lilian!“. Seine Augen flimmerten. „Das kann Ihr Ernst nicht sein! Es ist unmöglich!“
„But!“ — in der Aufregung sprudelte sie ihr Englisch so rasch hervor, daß er sie kaum verstand. „Warum sollte ich scherzen? Sie sind doch auch ernst! Oh — und kommen Sie mir nicht mit so kleinlichen Bedenken, weil ich Ihrer Mutter fremd bin! Ich will's ihr nicht lange bleiben. Geschwind, lassen Sie mich hinaus!“
Sie reiste wirklich noch in selber Nacht, und er ließ es geschehen, ohne ein Wort zu finden. Er brachte sie zur Bahn und sah dem davoneilenden Zuge nach und schämte sich, weil er so glücklich war, — so glücklich wie noch nie. Er wußte, die Mutter schwer erkrankt, wußte, welch berghohe Hindernisse seiner Liebe im Wege standen und meinte doch, er müsse durch die regenkalte Nacht einen Jodler schicken, wie ihn der beste Gaisbub nicht schöner heraus brachte.
Dann kam ihr erster Brief, nur ein paar Zeilen, aber voll guten Mutes, tröstend, beruhigend. Die Krankheit sei wohl ernst, doch nicht hoffnungslos, — es werde alles gut gehen!
Jeder Tag brachte ihm so ein Brieflein, auch als er im Manöver war. und er liebte diese Briefe, wie er die Schreiberin liebte. Er antwortete ihr selten, nur das Notwendigste, und auch daran probierte er lange. Ihm war's, als müßte jedes schlichte Wort ihr viel zu viel sagen, als wäre jeder Gruß, den er ihr sandte, ein Werben um ihre Liebe, — — und das durfte er nicht. Er hatte ihr's versprochen — auf Ehrenwort!
So kam das Ende des Manövers; Hasso nahm Urlaub und fuhr zu seiner Mutter. Er hoffte innerlich. Lilian nicht mehr im Pflegeramt zu finden und sehnte sich dabei wie ein Toller nach ihrem ersten Gruß. Und sie kam entgegen, heiter und herzlich, aber blaß zum Erschrecken mit blauen Schatten um die geliebten Augen.
„Lilian!“ sagte er, kaum seiner Bewegung Herr werdend. und ein heißes, sorgendes Gefühl der Zärtlichkeit wallte in ihm auf. „Lilian, wie kann ich Ihnen das vergelten!“
„Pst!“ machte sie schelmisch. „Erst schauen Sie sich Ihre Mutter an; aber leise gehen müssen Sie, und die Hand dürfen Sie ihr auch nicht zerbrechen, wie eben mir!“
Sie schob ihn ins Krankenzimmer und schloß die Tür hinter ihm. Müde war sie zum Umsinken, aber glücklich, ach so glücklich! Sie setzte sich in den großenLehnstuhl am Arbeitstischchen seiner Mutter und wartete, die Hände faltend, eine halbe Stunde und länger: dann kam Hasso wieder. Sie blieb in ihrer molligen Ecke und sah ihm lächelnd entgegen.
„O Lilian, Sie machen mir's furchtbar schwer, Ihnen zu danken!“
„Sie sollen mir auch gar nicht danken,“ meinte sie ungerührt. „Setzen Sie sich und erzählen Sie mir. Was machen die Studien? Ich denke mir, ich habe viel Not mit Ihnen, wenn wir wieder anfangen.“
Er ging auf ihren scherzenden Ton nicht ein: schweratmend stand er vor ihr.
„Lilian, ich kann — ich — wir werden keine Stunden mehr zusammen haben!“
„Warum?“ fragte sie erschrocken.
„Lilian, — “ er beugte sich zu ihr nieder, „wissen Sie noch, was ich Ihnen habe versprechen müssen?“
„O ja!“ sagte sie und wurde blutrot.
„Ich gab Ihnen mein Ehrenwort darauf, Lilian, — wissen Sie, was das heißt? Wer sein Ehrenwort bricht, ist ein Lump. Aber — — wenn ich jetzt wieder mit Ihnen zusammen käme, ich könnte mein Wort nicht halten, Lilian; und Sie sehen wohl ein, daß ich — daß das nie geschehen darf — — nicht wahr, Lilian?“
Sie spielte mit ihren Fingern und gab keine Antwort; das galt ihm als ein Nein. — Er ging.
„Gibt es — gibt es da keinen Ausweg?“ fragte sie endlich, und im Nu stand er wieder neben ihr. Aber er wollte Gewißheit haben.
„Nein!“ sagte er grausam und sah mit strafbarer Freude, wie blaß sie wurde. „Es sei denn — ein Ausnahmefall — der andere gäbe einem das verpfändete Wort zurück. Aber das wollen Sie doch wohl nicht. Lilian?“
Er hob ihr das gesenkte Gesichtchen sanft empor; Tränen glitzerten an ihren Wimpern.
„Lilian!“ sagte er bezwingend.
Da sah sie ihn ehrlich an.
„Doch, ich will!“ rief sie tapfer, und er hob sie auf eine Arme, wie ein Kind, küßte ihr die Tränen aus den Augen, — und die schmalen Wangen wurden rosig vom Glück.
„Mein Liebling, mein Liebling!“ sagte er mit grenzenloser Zärtlichkeit. „Wieviel hab' ich Dir zu danken!“
Sie lächelte und überließ sich seiner tragenden Kraft.
„Es war ja für Deine Mutter!“, flüsterte sie, und er küßte ihr das erste Du von den Lippen und trug sie hinüber zu der wartenden Frau.
„Mutting, werde gesund! Du sollst sie mir bewahren, bis ich sie mir hole!“
Puck
Novellette
„Waldl“, sagte Komteß Puck zu ihrem vierbeinigen Freund und streichelte sein glänzendes Fell, „wenn Du dem hochweisen, blondlockigen, schmachtlappigen Jüngling einmal gehörig an die Waden fährst, die er nicht hat, dann stelle ich Dir eine ellenlange Leberwurst zu freier Verfügung.“
Sprach's, nahm den Strohhut vom Tisch, überzeugte sich, daß sie ihr Messer bei sich hatte, und ging in Waldls Assistenz nach dem Park. Auf der Freitreppe kam ihr Sepp entgegen, der Jägerbursch des Vaters, der sein pfiffigstes Gesicht schnitt, wie er den Hut vor dem Herrenkinde zog.
„Grüß Gott, Sepp! Was willst Du denn im Schloß? Der Vater ist noch nicht sichtbar,“ meinte sie leichthin.
Der Sepp bückte sich, um den Waldl zu tätscheln, der wie verrückt um ihn herumsprang. „Dem jungen Herrn möcht' ich einen Hirsch melden, ein Prachtstück mit so einem Geweih!“ und zog mit beiden Armen einen Kreis in der Luft.
„Du mein Gott!“ spottete Puck mitleidig, „bis unser Junker auf den Anstand kommt, wechselt Dir der Hirsch dreimal ins Wardeiner Revier hinüber.“
Sepp zeigte seine prachtvollen Zähne in grimmiger Zustimmung. „Aber der Herr Graf haben befohlen!“
„So? Da wirst Du wohl müssen, mein guter Sepp! Gelt, nimm Dir genug Heftpflaster mit für die Bäume, die er totschießt! Komm Waldl.“
Und trällernd ging sie in den Garten hinaus, hing den Hut an den Arm und pflückte sich einen großmächtigen Blumenstrauß, was Waldl ziemlich langweilig fand.
„Was bloß der liebe Gott dazu sagen wird, wenn ihm dieser Jüngling wieder seine himmelblaue Atmosphäre durchlöchert!“ murmelte sie, endlich stehen bleibend. „Ob der wohl schon in seinem ganzen Leben einen Hasen ums Dasein gebracht hat? Gott bewahre, — er wird doch seine Familie schonen!“
Sie kauerte sich auf die Bank unter der Rotbuche, zog den Waldl heran und hielt ihm die Ohren kerzengerade in die Höhe.
„Weißt Du, was er ist? — Ein Greuel ist er!“ erklärte sie ihm laut zum besseren Verständnis. Waldl schüttelte seine mißhandelten Gehörwerkzeuge und sah seine Herrin vorwurfsvoll an. Ob das ihrem Benehmen gegen ihn oder dem armen Junker galt, blieb unentschieden.
Ueberhaupt fand Puck bei ihrer Empörung nur von Sepp Unterstützung, der ungerechtfertigterweise erklärt hatte: „Wann ich noch ein paarmal mit dem Junker auf die Pirsch muß, dann hab' ich mit 25 Jahren weiße Haare. Ich dank schön! Bei dem ist's ja ein Gottesglück, daß er nichts trifft, wer weiß, ob er nicht ein Schmaltier für einen Hirsch hält und mir mein ganzes Jungwild über den Haufen schießt. So ein Stadtfrack, so ein zarthändiger!“ —
Wenn's je zwischen dem alten Grafen Strauching und seinem Töchterchen zu einem Gewitter kam, dann war sicher Achim das Karnickel Graf Strauching liebte den Sohn seiner verstorbenen Stiefschwester zärtlich und hatte dem jungen, heimatlosen Neffen ein für allemal zwei der schönsten Gemächer auf Schloß Buenretiro anweisen lassen. Nur eins war ihm unverständlich an dem jungen Offizier: der hockte ihm zuviel über den Büchern und war ein Jäger — unter aller Kanone! Das wollte ihm der gute Ohm austreiben! Jeden Sommer hetzte er ihm den Sepp auf den Hals mit den heiligsten Versicherungen: „So einen Prachthirsch hat auf unserem Berg seit hundert Jahren keiner geschossen! Den müssen Sie kriegen, Herr Graf! Heute abend kommt er gewiß!“
Achim zog auch geduldig mit dem jagdeifrigen Sepp los, — aber Puck hatte recht, es war immer resultatlos!
„Mit dem Hut hätt' er ihn erwischen können!“ jammerte der Sepp dann jedesmal, „gestanden hat er wie ein Sägebock, der Hirsch, — und weiß Gott, er macht's möglich und trifft ihn nicht! Ja Kruzitürken noch einmal — “
Puck legte das Kinn in die Hände und starrte geradeaus. O, dieser Mensch mit dem Stubenhockergesicht! Im Grunde genommen, konnte er ihr doch ganz gleichgiltig sein . . . Aber da war etwas, ein kleines, böses Gesichtchen, das nie auszulöschen war . . .
Im Hochsommer war's, da kam er zum ersten Male, und sie hatte ihm imponieren wollen, vom hohen Olymp herab, mit ihrem sechzehnjährigen Wissen. Er sollte nichtdenken, daß so ein Backfischchen überhaupt nichts kenne und leiste. Potztausend, was wollte sie auftischen! Sie sprach überhaupt nur noch von Horaz und Homer, Hartmann und Schopenhauer, stellte Betrachtungen über die Urzelle an und schwärmte für Darwin. Ehrlich gesagt, war er ihr greulich, und sie erzählte dem Waldl, wer sich zu dieser Lehre bekenne, dem dürfe man ja zu seinen Ahnen gratulieren. Aber was tut man nicht alles, um einem Vetter zu imponieren, vor dessen Wissen so viele den Hut zogen. —
Vetter Achim aber schien gar nicht sehr entzückt zu sein, sondern sah sein kluges Bäslein ganz absonderlich an, ungefähr wie ein Pascha von drei Roßschweifen — aber noch ein bißchen anders, — darüber wollte Puck nicht nachdenken. Nun steifte sie sich aber erst recht darauf, Bekennerin Darwins zu sein.
Und da war’s einmal an einem wonnigen Sommertag, — sie glaubte den Vetter über alle sieben Berge — und hatte sich mit ihrem Lieblingsbuch in den Garten geflüchtet, hatte das Köpfchen in die Hände gelegt, die Finger auf die Ohren. — und las, mit heißen Wangen und leuchtenden Augen . . . Und auf einmal bückte sich einer neben ihr über das Buch und schlug das Titelblatt auf . . .
„Tausend und eine Nacht!“ jubelte Junker Achim, — ja, er jubelte, das Greul! „O Du süßes, herziges, einziges Kind Du! Jetzt habe ich Dich einmal ohne Maske gefunden! Jetzt hast Du Farbe bekannt Puck!“
„Kind!“ hatte er gesagt! Hatte ihre feine, schmiegsame Gestalt in strahlender Seligkeit hochauf in die Sonne gehoben mit widerstandsloser Kraft, das hatte sie noch gefühlt, — und dann, heidi! hatte sie am Boden gestanden und sprudelte ihm all ihren Haß, all ihren Zorn ins Gesicht, — und raffte ihr Buch auf und lief davon, weil ihr die Tränen, die dummen, stromweis über das heiße Gesichtchen purzelten.
Seitdem haßte sie ihn! Das wurde kein offizieller Kampf. — Papa Strauching hatte das Kriegsbeil unter Verschluß, — aber Pucks Spöttereien huschten durch's ganze Haus, und Sepp sekundierte, — es war ein Kreuz mit so einem Schützen!
Nun gar heut! Der Junker war mit seinen Gedanken allerorten, nur nicht auf dem Anstand. Die Nacht war schon dämmrig geworden, — Seppl hob das Gewehr an die Wange . . . Schußlicht!
„Gehen wir, Herr Graf!“ wisperte er, und sie traten aus der Hütte. Achim sah in die Höhe, — wie ein Bleistiftstrich zog sich die Wardeiner Straße am Berge hin, blaugrau wich die Ferne zurück, die Sterne wurden halb — ganz im Osten wallte esrot und glutvoll hinter den Wolken auf. Da flimmerten die Spitzen der Schneeberge herüber.
Achim holte tief, tief Atem.
„Lassen Sie mich voran, Herr Graf,“ flüsterte Sepp, dem der Eiser in die Füße gefahren war. „Aber jetzt dürfen Sie nicht mehr schnaufen wie ein Büffel, hübsch still gehen und geben Sie Obacht . . .“
Er sprach nicht fertig. Droben am Hang war ein Schuß gefallen, dröhnend in der hehren Stille — , drei-, viermal warf ihn das Echo zurück, — und in sein Hallen klang's wie Brechen und Knacken trockener Aeste, wie die rasende Flucht eines waidwunden Tiers.
Seppls Augen weiteten sich. „Himmelelement noch einmal, so ein Lump, so ein miserabler! Jetzt laß ich mich totschlagen, daß das der Brucknertoni gewesen ist! Aber dich krieg ich, du Wilderer, du! Bleiben Sie hier, Herr Graf! Das ist nichts für Sie! Das ist Ernst!“
Und in Sätzen wie ein Panther stürmte er vorwärts, Achim nach mit eiserner Entschlossenheit. Doch er kannte die Wege nicht so genau und die Dämmerung machte ihn irre, er mußte sich auf sein Ohr verlassen, endlich hörte er Stimmen vor sich, heisere, zornerstickte Worte, er stürzte blind drauf los, — die niederen Zweige schlugen ihm ins Gesicht, er gab nicht acht darauf. Und da auf einer Lichtung, lag das verendete Tier, neben ihm auf den Knien der Wilddieb mit rußigem Gesicht, der Seppl ihm an der Kehle, — und die beiden wußten, hier ging's auf Leben und Tod.
„Sepp, ich komm schon!“ schrie Achim und eilte über die Blöße. Der Wilderer sah ein, daß er gegen zwei verloren war; mit einem Ruck stieß er den Jäger zurück, raffte sein Fangmesser auf und hetzte talab.
„Das war aber zur rechten Zeit, Herr,“ stieß Seppl hervor. „Der Kerl hat gestochen, wie ein verrückt gewordener Imm'!“ Pustend stand er auf. „Was machen wir nun? So ein Prachthirsch! Schauen Sie nur, Herr Graf!“
„Jetzt geht mir's nicht um den Hirsch, sondern um Dich,“ sagte Achim. „Was hast Du denn? Hat er Dich getroffen? So nimm doch nur die Kappe herunter! Du blutest ja!“
„Freilich, hat er getroffen,“ sagte Sepp und fuhr sich über die Stirn, „und am Arm spür ich's auch . . .“
„Jetzt führe ich Dich hinunter,“ erklärte Achim nachdrücklich „Komm her, Du taumelst ja! Wirst Du gehen können?“ Und sorgsam legte er seinen Arm um die Schulter des Burschen.
„Ich mein schon, ja! Aber gehen Sie, Herr Graf, Sie machen sich ja ganz fleckig! Das geht doch nicht! Lassen Sie mich nur hier und seien Sie so gut und schicken mir einen herauf!“
„Ich glaube gar!“ sagte Achim ruhig, „jetzt hältst Du Dich fest an mir und wir gehen zusammen. Und wenn Du irgendwo ein Quellchen weißt, dann führe ich Dich hin, damit ich Dir den Kopf verbinden und kühlen kann.“
Und so geschah's auch. Es ging langsam, sehr langsam, aber Achim war ein tröstlicher Führer, der seinem Schützling jeden Stein aus dem Wege schob. Am Bach tauchte er sein Tuch ins Wasser und verband die Wunde an der Stirn.
„Schau, es dauert nicht mehr lang',“ meinte er. „Dort unten sehe ich schon das Schloß. Willst Du ein wenig rasten? Komm, gib Obacht, da liegt ein Ast im Weg! Und stütz' Dich nur fest auf mich, ich hab' schon Kraft für uns zwei!“
Seppl war still geworden, er dachte an den Stadtfrack, den zarthändigen . . .
Drunten im Schloß gab's ein Hallo, als die beiden ankamen. Puck wurde ganz weiß im Gesicht, wie sie das absonderliche Pärchen sah.
„Erschrecken Sie sich nicht so arg, Komteßchen!“ tröstete der Sepp, während Achim seinen Schützling dem alten Diener übergab und aus dem Zimmer verschwand, ohne einen Blick für Puck zu haben. „Den Junker hat er nicht getroffen, ich hab' bloß ein bissel abgefärbt.“
„Das glaub ich, daß sich der Junker nicht persönlich beteiligt hat!“ meinte Puck mit zuckenden Lippen. Da wurde der Seppl aber munter.
„Aber nein, Komteßchen! Alles, was recht ist, aber den Junker, den hab' ich kennen gelernt! Der ist ein Mensch und ein Mann, wie man ihn mit der Laterne suchen kann! Springt wie der Teufel auf uns beide zu und trägt mich dann bald drei Stunden weit wie eine Mutter. Ein Jäger ist er, um sich die Haare auszuraufen, — aber ein Mensch, vor dem man die Kappe ziehen muß — und das ist ja wohl von den beiden Sachen das wichtigere!“
Er zog die Binde von der Stirn und faltete sie sorglich. „Sein eigenes Tücherl hat er mir gegeben . . .“ da streckte Puck die Hand darnach aus.
„Seppl, gib mir's! Ich bitt' Dich, Sepp!“
„Guck einmal einer!“ dachte Sepp, als sich die Tür ganz achtsam hinter dem Herrenkinde geschlossen hatte, „mir scheint, da hat der Junker ohne's Gewehr seinen ersten guten Schuß getan!“
Am nächsten Morgen mußte Achim zum Regiment zurück. Beim Abschied, der diesmal besonders herzlich war, fehlte Puck, wie gewöhnlich, dafür aber traf er im Tale den Sepp, der ihm mit verbundenem Kopf, aber lachenden Augen entgegenkam. „Das Tücherl hab' ich dem Komteßchen gegeben!“ schloß er seinen Bericht über sein Befinden mit dem unschuldigsten Gesicht von der Welt.
„Warum?“ fragte Achim mit gefalteten Brauen.
„Weil sie mich darum bat! Und wie herzlich! Und die Tränen haben ihr dabei in den Augen gestanden!“
Achim machte eine Bewegung, als wollte er sein Pferd herumreißen und zurückstürmen. Aber er bezwang sich. Er rief dem Burschen ein freundliches Wort zu, und dann kam's jäh über ihn, er hob sich im Sattel, wie einer, der fliegen möchte, beugte sich vor mit weitschauenden Augen: „Greif aus, mein Tier . . .“
„Weißt Du auch, daß Achim vielleicht zum letzten Male hier war?“ fragte Graf Strauching sein Töchterchen am Abend. „Er hat sich zur Schutztruppe nach Südwestafrika gemeldet und wird Anfang nächsten Monats abreisen. Gott weiß, ob er wiederkommt!“
„Unter die Kaffern paßt er auch!“ vermutete der alte Graf, daß sein Mädel sagen würde. Aber siehe da, es blieb aus!
Gott weiß, ob er wiederkommt! klang's ihr in den Ohren, und seitdem ging sie herum, wie ein verschüchtertes Vögelchen; kein Schatten war da mehr von dem herrschsüchtigen Komteßchen. Nur einmal, als die Beschließerin die Zimmer Achims umstürzen und abschließen wollte, erhob sie Einspruch.
„Die Zimmer bleiben, wie sie sind! Es soll alles sein, als ob er da wäre. Und ich will die Schlüssel haben!“
Da war’s nun ihre liebste Arbeit, jedes Möbel selbst abzustauben, sie band sich eine große, blaue Schürze um das ernste Köpfchen und kletterte auf die Treppenleiter, um zu den Bildern zu gelangen. Allerorten mußten Blumen stehen, — als ob er da sei — und Gott weiß, ob er wiederkommt!
Briefe kamen sehr, sehr selten, — und nie ein Wort für die arme, kleine Puck — und um die Weihnachtszeit blieb jede Nachricht aus. Puck sagte nichts, aber sie verschlang die Meldungen in den Blättern, die vom afrikanischen Deutschland erzählten. Drunten wütete der Typhus, und im Norden droben schmückte am Christtag ein blasses, stilles Menschenkind die Zimmer Junker Achims mit Tannengrün. Sie hörte die Tür gehen, drehte sich um, — und da war's ein Glück, daß der Eindringling so rasch herzusprang und das fassungslos weinende Mädchen mit beiden Armen auffing.
„Puck!“ sagte er, „Du hast mir die Zimmer geschmückt! Deinem Todfeind, der gar nicht wiederkommen wollte! Warum, Puck? Jetzt will ich Antwort haben!“
Aber er bekam keine. Sie hatte die Arme um seinen Hals geschlungen und lag ganz still.
„Es ist nicht wahr, daß Du ein schlechter Schütze seist,“ meinte sie endlich mit leis erwachendem Uebermut. „Mich hast Du auf ewig waidwund gemacht — mich hast Du ins Blatt getroffen!“
Signe
Novellette
Das Häuschen oben auf dem Damm, seitab vom Dorfe, sah mit seinen blinden Scheiben recht unwirtlich in den Wintertag hinein, — und Michel Obenaus, der Gemeindevertreter von Langenbühl, guckte unsicher zu seinem Begleiter auf.
„Schau, so besonders schön wirst Du's freilich nicht haben, aber es ist doch eine Mauer zwischen Dir und dem Sturm und ein Dach überm Kopfe . . .“
Hannes Werkh nickte und sah sich in dem dämmerigen Stübchen um.
„Es ist alles geblieben, wie's Signe Rajot vor zwei Jahren verlassen hat. Sie nahm eine kranke Dame bei sich auf, und die wollte nimmer wieder ohne Signe sein. Die hat in der Welt niemanden, der ein Recht auf sie hat, und so gab sie jedem, der sie brauchte.“
Hannes Werkh sah dem Plaudernden ins Gesicht wie einer, der das Wundervolle, das er hört, gern glauben möchte, und sich's nicht traut. Dann fuhr ihm der alte Schatten um die Augen und seine Lippen zuckten in Hohn und Gram.
Michel Obenaus strich den Kindern mit seiner breiten Tatze verlegen übers Haar und ging, schickte aber seine Frau herüber, die dreiviertel Gemeindevorstand war, mit einem Kännchen Oel für die Lampe und einer Schürze voll Holz. „Der liebe Gott segne Deinen Einzug“ sagte die gute Alte, aber Hannes Werkh gab keine Antwort.
„Vater“, begann das Liesel, weil er gar so lang schwieg. „Bleiben wir nun immer hier?“
Hannes Werkh lachte so hart auf, daß sich die kleine Dän erschrocken duckte. „Immer? Ja, mein Liesel! Wart' nur! Wenn die kommt, die hier daheim ist, die wirft uns wieder auf die Straße.“
„O!“ machte das Liesel entsetzt und empört, und seitdem dachte sie an Signe wie die Hexe im Buch, mit grasgrünen Augen und pechschwarzem Haar und auf der Schulter einen fauchenden Kater.
Der Vater war sehr selten daheim, denn so klein das Häuschen war, die Not hatte doch Raum darin.
Bei ruhiger Arbeit im Knechtdienst litt es den Hannes nicht. Er übernahm die Botengänge in die Stadt, die jenseits drei gute Stunden ins Land hinein, dem Dörfchen gegenüber, lag. Das war ein großer Weg, aber der Hannes hatte eine Unrast im Blut, die es zur Lust machte. gegen den heulenden Nordostwind anzuschreiten.
Die schlechte Brücke, die eine Stunde stromaufwärts nach Düppelhain führte, war ihm ein zu gemächlicher Pfad; er wanderte quer übers Eis, das ihn geduldig trug, so hart er auch auftrat unter seinen Lasten.
Nicht lange vor Weihnachten sprang der Wind nach Westen um, da gab's ein tolles Schneetreiben.
„Hannes“, sagte der Gemeindevorstand, und nahm ihn beim Rock, „tu mir den Gefallen und nimm Verstand an! Schau, wenn's so schön linde bleibt, steht ja der Fluß keinen Tag mehr sicher . . .“
„Wen kümmert's denn, ob ich wiederkomme?“ fragte Hannes Werkh mit seinem kurzen Lachen. „Wenn so ein Mensch im Fluß wegtreibt, um so besser! Da spart die Gemeinde die Begräbniskosten!“
„So, du Tropf!“ polterte Michel los, „und die Kinder?“
Hannes Werkh stieß den Stecken vor sich in den Schnee. „Die sind besser dran ohne mich! Die finden erst Liebe, wenn mein elendes Leben erloschen ist!“
„So wünsch' ich Dir doch“, schrie Michel Obenaus ihm nach, — und er mußte wacker schreien gegen den Sturm, — „daß Du Deinem Herrgott noch einmal auf den Knien für Dein Leben dankst!“
In Signes Häuschen stäubte der Schnee durch die Fensterglinzen ins Stübchen, wo das braune Liesel und der blonde Jens auf dem Ofenbänkchen kauerten zitternd vor Kälte.
Da fuhr sich das braune Liesel verschlafen über die Augen. Hatte nicht was an der Tür gepoltert? Kam denn der Vater heute noch heim? Im schmalen Gang wurden Schritte laut, doch die tönten anders . . . und da ging die Tür und der Eindringling stand auf der Schwelle, — eine Frau mit einem Laternchen in der Hand und einem dunklen Tuch ums Gesicht, das still und fein heraussah.
„Wer bist Du denn, Dirnlein?“ fragte eine linde Stimme. Das klang, wie wenn eine Mutter fragt
„Liesel Werkh“, antwortete das Kind und zitterte vor Frost, daß es kaum die Lippen regen konnte.
„Wohnst Du hier?“ fragte die Fremde weiter. Liesel nickte. Die Frau ließ das Laternchen sinken und sah sich um. „In Gottes Namen!“ sagte sie laut und ging durch den wirbelnden Schnee nach dem nächsten Gehöft, dem Hübnerhof.
Mit Decken und Betten und einem dicken Reisigbündel kam sie wieder; ein lustig Feuer wurde angehrannt, der dünne Strohsack mußte den Staatsbetten der Hübnerin weichen und eh' sich's die Kinder versahen, staken sie selbst mitten drin. Der Jens tat einen brunnentiefen Seufzer und war eingeschlafen. Aber Liesel war allzu erstaunt!
„Bist Du Muttchen?“ fragte sie ganz beklommen.
„Hm!“ machte die Fremde zweideutig.
„Oder das Christkind?“
„Nein, du Kleines, Signe bin ich!“
„O!“ Das Liesel machte trotz der Decken fast einen Sprung im Bett, denn Signe hatte kein bißchen Aehnlichkeit mit der Hexe im Buch. Signe hatte lichte Augen und schimmerndes Haar und . . . „Hast Du einen schwarzen Kater?“ fragte die Kleine.
Signe beugte sich über das kleine Fragezeichen. „Weißt Du, mein Dirnlein, jetzt schlafen wir fein, und morgen plaudern wir weiter!“
Da stand sie nun noch lange am Bett der Kinder. Und dann gab sie sich einen Ruck und wanderte nach dem neuen Heim auf dem Hübnerhof, wo sie wie eine Schwester angenommen wurde.
Hannes Werkh brauchte fast eine Woche, ehe er merkte, daß sich um ihn her alles veränderte. Dann fragte er beim Michel an, und bekam nur eine kürze Antwort: „Signe ist da!“
Ihm war das Blut in die Schläfen gefahren. Almosen wollte er keine. Signe Rajot sollte kommen und abrechnen mit ihm!
„Von einem Almosen weiß ich nichts“, hatte Signe zum Michel Obenaus gesagt. „Etwas muß ich zu schaffen haben; wenn Hannes mir das an den Kindern erlauben will, dann laß ich ihm noch recht schön dafür danken.“
Seitdem grübelte der Hannes viel auf seinen weiten Wegen. — So kam Weihnachten heran, ein Tag voll Südwind, der alle Dächer tropfen machte. Hannes Werkh ging langsam heim, er hatte leere Hände. Die Glocken läuteten nah und fern.
Um wie Hannes Werkh in die Tür des Stübchens trat, stand auf dem Tisch ein kleiner, strahlender Lichterbaum, und die Kinder saßen davor und hatten sich umschlungen, und alle Kerzen waren in ihren Augen.
Der Mann sagte kein Wort und tat keinen Laut. Er stand an der Tür und starrte das kleine Wunder an mit kämpfenden Zügen. Dann schob er sich auf den Stuhl am Tisch und legte das Gesicht in die Hände und trank mit dürstenden Augen das friedevolle Bild. Liesel und das Brüderchen kauerten schweigsam auf dem Lieblingsplatz; und wie sich der Vater gar nicht rührte und endlich die Arme auf den Tisch legte und den Kopf darauf, da rutschte das Dirnlein von der Bank herunter und brachte wispernd das Brüderchen zu Bett. Dann schlüpfte es ihm nach und lag mäuschenstill; denn Kinder, die das Leid zur Pate haben, gehen achtsam mit dem Glück.
Am nächsten Tag, als die Kirche vorüber war, trat Hannes Werkh in Signe Rajots Weg. „Ich hab' Dich was zu fragen!“ meinte er rauh, und wie sie ruhig zu ihm aufsah und den Schritt verhielt, da stieß er's jäh heraus: „Du! Warum tust Du mir das? Warum drängst Du mir eine Guttat nach der andern auf?“
„Dir?“, Signe Rajot sah ihm klar in die brennenden Augen. „Ich hab' nur mir eine erwiesen. Das dunkle Fenster an Deinem Häusel war mir wie ein Fleck im Auge, der mir die Freude an der Weihnacht nahm. Die wollt' ich mir wahren, und so brannt' ich Dir den Christbaum an.“ Sie strich sich das Haar aus der Stirn. „Wir Menschen sollen Licht bringen, soviel wir können; es bleibt noch allzeit genug dunkel in der Welt.“
Sie ging dem Hübnerhof zu und Hannes fuhr sich mit zitternden Fingern übers Gesicht.
Ein paar Tage nach Neujahr trat der Hannes seinen Weg wieder an. Aber diesmal trat ihm Signe entgegen. „Ich hab' eine Bitte.“ sagte sie und sah über Land. „Geh' nicht mehr über den Fluß, es knistert im Eise . . .“
„Gelt, jetzt sorgst Du wegen der Kinder?“ erkundigte sich Hannes Werkh, und als sie nickte, machte er kurz kehrt und ging der Brücke zu. Signe stand und sah ihm nach und wußte, daß sie zum erstenmal in ihrem Leben gelogen hatte.
Am nächsten Tag war's in der Luft wie Gewitter. Die Leute in Lengenbühl musterten den gelbbraunen Himmel, die Männer arbeiteten am Damm.
Michel Obenaus und Signe standen nebeneinander.
„Wenn das so fortweht“, meinte er nachdenklich, „dann haben wir noch vor Abend den schönsten Eisgang.“
Signes Hand zitterte. „Ich hab' ihn gebeten, er soll über die Brücke gehen . . .“ Michel fragte nicht wer.
„Du lieber Gott! Wenn das Wasser vom Knie so toll kommt, dann steht in ein paar Stunden alles unter Flut da oben. Da kann Hannes nicht durch. Und wenn wir ihm einen Boten schicken, dann schneiden wir zweien den Rückweg ab. Ein Zeichen mußte ihm werden, das ihm den gradsten Weg weist . . . “
Signe klomm den Damm hinauf. Noch lag der Fluß gefangen da. Wenn Hannes Werkh bald kam, vielleicht trug ihn das Eis noch! Aber ein Zeichen mußte ihm werden, ein weithin greifendes, rufendes Zeichen, das auch die frühe Dämmerung überwand . . .
Es ward dunkel um Signe, die Männer stellten die Arbeit ein. „Arme Kinder!“ sagte der eine.
Signe drehte sich um und jagte ihrem Hüttchen zu. Sie hatte die Kinder vergessen können! Die saßen noch im Dunkeln in der Stube und schauten nach Muttchen Signe aus. Wie sie hereintrat, kam ihr das Paar entgegengekollert und hing sich an ihre Kniee. Signe griff nach der Lampe, und wie sie die Glocke herunterhob, fiel ihr Blick durchs Fenster auf den Fluß hinaus, und da durchfuhr sie ein Gedanke, der ihr alle Glieder beben machte . . . klirrend schlug das Glas auf dem Tisch in Scherben.
„Muttchen, was hast Du denn?“ fragte Liesel, aber Signe raffte mit liegenden Händen zusammen, was sich ergreifen ließ, schlang's in der großen Decke zu einem Bündel zusammen und schleppte es weit in den Schnee hinaus.
„Frag nicht, Kindl“, sagte sie ruhelos, nahm das Liesel und den Jons bei der Hand und schob sie aus der Stube. „Jetzt wartet hier, ich komm' gleich wieder.“
Die Liesel hielt den Jens krampfhaft fest und guckte in die Runde; da kam Signe aus dem Häuschen, raffte keuchend ihr Bündel auf, und rannte mit den Kindern dem Dorf zu, dem Hübnerhof.
Da gellte vom Damm herüber ein Schrei:
„Feuer!“
Das braune Liesel zuckte zusammen und wollte sich umschauen, aber Signe hielt es fest. „Lauf, Kindl!“
Die Hübnerin stürzte ihr entgegen und schlug die Hände überm Kopf zusammen vor Entsetzen. Das Mädchen ließ ihr zum Reden keine Zeit. „Behüt' mir die Kinder!“ stieß sie hervor und ließ ihre Last von der Schulter gleiten und sprang nach dem Damm zurück. Dort lag der Schnee überflutet von roter Brunst, die hinter den Fenstern von Signes Hütte auflohte. Noch war's nur ein Schwelen und Glimmen, noch war’s zu ersticken — und der alte Michel Obenaus war der erste, der zum Löschen herbeisprang. Da warf sich ihm ein Weib in den Weg.
„Laß brennen, um Christi Lieb'! Laß brennen! Schau, das leuchtet weit hin! Das muß er doch sehen! Meinst Du nicht? Das muß ihm den kürzesten Weg weisen . . .“
Dem Alten sanken die Hände nieder. Und hoch auf schoß die erste Feuergarbe in den Himmel hinauf.
„Signe, — das weist ihm auch den rechten Weg durchs Leben und den kürzesten zum Glück!“
Signe hörte nicht, hörte nicht die Leute schreien, nicht das Gebälk krachen, nicht den Sturm heulen. Sie folgte mit dem Blick der roten Glut über Land. Wird er sie sehen?
Ja, Hannes Werkh sah sie just, als er droben am Hügel nach der Brücke hin abbiegen wollte. Er sah durch die Nacht die Lohe am Damm und wußte, da steht nur ein Haus . . . Da rannte er quer über die Felder, durch den Schnee stürzte, und raffte sich wieder auf und jagte weiter.
Jetzt war er am Damm; keuchend klomm er hinauf, hundert Hände streckten sich ihm entgegen, — und da gab's einen rollenden Krach, wie ein heftiger Donnerschlag. und knirschend begann das Eis zu treiben, sich tosend zwischen den Ufern hin.
Hannes Werkh stand mit pfeifendem Atem, starrte beim Feuerschein die rufende Menschheit an und hörte, was geschehen war, und daß die Kinder wohl aufgehoben seien und was Signe getan hätte, — und hinter ihm lag der Tod.
Da drängte Hannes Werkh die Menschen zur Seite.
„Signe!“ rief er, und es klang wir Schluchzen und Jauchzen durch den gebrochenen Laut. „Signe!“
Abseits im Dunkeln kniete sie im Schnee, vielleicht war's, weil sie zum Stehen keine Kraft mehr gehabt, vielleicht zum Beten. Hannes Werkh fand nicht gleich ein rechtes Wort. „Signe“, sagte er. „Dein Häusel brennt, dein liebes kleines Haus . . .“
Sie gab ihm keine Antwort. Da bückte er sich und zog sie in die Höhe und streichelte mit zitternden Händen ihr blasses Gesicht.
„Signe“, bat er. „Du mußt nicht weinen. Ich bau' Dir ein neues Haus, ein schönes, starkes, das Raum hat für uns und das Glück. Aber Du mußt mir helfen, Signe!“
Und als sie die Arme um seinen Hals schlang und mit einem tapfern „In Gottes Namen“ ihr Leben in seine Hände legte, da kniete der trotzige Hannes Werkh vor seinem Herrgott im Schnee, um ihm zu danken, daß er lebte.
Und da war der zornige Segenswunsch des guten Michel Obenaus doch in Erfüllung gegangen.
John Hunters Brautfahrt
Humoreske
„Lieber Pa'! Wenn Du mir schriftlich und an Eidesstatt erklärt hast, daß Du mich mit Deinem Heiratsprojekt verschonen willst, kehre ich nach dieser kleinen europäischen Spritztour zu Dir zurück. Briefe zu Teiler u. Braun, Hamburg. Dein gehorsamer Sohn Johny.“
Als John Hunter diese Karte geschrieben hatte, sagte er: „Das ist nun zwar die höhere Ironie, aber da sieht er gleich, wozu es führen kann, wenn ein Vater seinen Sohn partout ins Unglück stürzen will! Mich zu verheiraten. — Gott bewahre! Und noch dazu mit einer Deutschen, die, um das Maß voll zu machen, auch noch Isabella heißt! So viel Zeit habe ich ja gar nicht, um den Namen alle Tage auszusprechen!“
Er streckte seine langen Glieder in den bequemsten Stuhl, der auf Deck in seinem Bereich stand, und beobachtete mit dem Behagen eines Menschen, der va banque gespielt und gewonnen hat, wie der Hafen von Newyork mit der riesigen Freiheitsstatue ins Meer versank, — bis das letzte Rauchwölkchen eines flinken, kleinen Kutters in Dunst zerflatterte. Dabei kam er ins Träumen, was ihm ab und zu passierte. Das war so ein Erbteil seiner deutschen Mutter.
„Möchte wissen“, dachte er, „ob wir wirklich da drüben in dem alten, häßlichen Hamburg landen werden, oder unterwegs bei der Insel der Seligen vor Anker gehen. Ist mir übrigens ganz egal! Wenn ich nur dem Frauenzimmer mit dem unmöglichen Namen nicht begegne! Ich sehe sie förmlich: lang, blond, dürr, mit niedergeschlagenen Augen und einer Stimme wie eine Maus, — und zu allem sagt sie: „Ja, Papa! — Wie Du willst, Papa!“ — Selbst wenn es sich darum handelt, sich fürs ganze Leben an einen Mann zu binden, den sie gar nicht kennt, — nur weil ihr und mein Vater drüben im alten Lande dieselbe Schulbank gedrückt haben. Gott bewahre mich, — ich will doch keinen Automaten! — Ich will eine Frau . . . das heißt, ich will auch keine Frau, — meine Ruhe will ich haben!“ Und mit dieser etwas gewaltsamen Logik schloß John Hunter die Augen, faltete die Hände über dem Magen und ließ sich vom Rhythmus des Schiffes wiegen. Keine fünf Minuten lag er so, und war eben an der Grenze des verdämmernden Bewußtseins angelangt. Daflog neben ihm hinter dem Sonnensegel, das wie ein Zelt bis zu den Planken niederfiel, ein Buch oder so etwas ähnliches zu Boden, und eine helle, vergnügte Stimme sagte: „Laß das nur liegen, Schwesterherz! Ich bin viel zu fidel, um lesen zu können? Herrgott, Kinder, ist mir wohl! So, als hätte ich eine ganz tolle Schlacht gewonnen!“
„Eigentlich geht die Schlacht aber erst los!“ antwortete jemand, den sich John Hunter sofort mit einem Madonnenscheitel vorstellte.
„Ach, Lisi — sei kein Frosch! Im Grunde freust Du Dich gerade so wie ich, daß ich der Gesellschaft da drüben ein Schnippchen geschlagen habe. Mich so verschachern zu lassen, — pfui Pudel! Lieber wandere ich nach Indien aus!“
„Ein Prachtmädel!“ sagte John Hunter.
„Aber Isa, Isa, — was wird Dein Vater sagen?“ mahnte die andere lachend.
„Vorerst werde ich ihm einmal etwas sagen!“ rief die gereizte Sünderin, und der lauschende John sah im Geist ihre Augen blitzen. „Höre, Väterchen!“ werde ich ihm sagen, „wenn Du die Illusion hegst, daß ich zu allem Ja und Amen sage, was Du und Dein verrückter alter Freund in Boston ausbrütet, dann ist das eben eine Illusion! Da kennt Ihr meines Vaters einzige sehr schlecht. Ich hab Dich lieb, aber das kannst Du nicht verlangen, daß ich um Deiner Schulfreundschaft willen einen Mann heirate, der gar kein Mann ist, der kein Herz und kein Gemüt hat! Denn sonst würde er es sich nicht gefallen lassen, daß man ihm eine Frau wie ein Warenbündel zuschickt, das kennen zu lernen er sich nicht einmal die Mühe gibt! Ich habe Dir den Gefallen getan und bin hinüber gegondelt, um mich von Deinem Freunde unter die Lupe nehmen zu lassen, aber Dein Protegee war weg und wollte die Sache durch sein Papachen ausfechten lassen, so daß er dann nur den Kontrakt fürs Leben zu unterschreiben brauchte! Und das soll ich mir bieten lassen? Das werde ich meinem Papa in aller Liebe auseinandersetzen, und wenn er mir dann noch ein einziges mal mit seinem Johny kommt, — dann, — na, dann wandere ich eben aus! Dixi!“
John Hunter hatte seit etwa dreißig Sekunden zu atmen aufgehört. Jetzt holte er aber so ausgiebig Luft, daß sein weißer Anzug in allen Nahten krachte und hinter dem Sonnensegel ein erschrockenes „Pst!“ hörbar wurde.
„Ach was!“, sagte dann die Stimme der jungen Kämpferin resolut, „das ist höchstens so ein langweiliger Amerikaner, der kein Wort deutsch versteht!“
Dabei kam die Stimme näher, und jetzt wurde das Sonnensegel ein klein wenig zurückgeschlagen. John Hunter drückte krampfhaft die Lider zu, aber er hatte doch vorher mit einem blitzschnellen Blick das Köpfchen da vor sich zu umfassen vermocht — ein goldiges, feines, energisches Köpfchen mit tiefdunklen Brauen und in der Erregung zitternden Lippen — dann lag er steif wie ein Gipsabguß und markierte tiefste Schlafversunkenheit.
„Er schläft!“ wisperte es drüben. „Aber mein Himmel, Lisi, den Menschen kenne ich doch! Sein Bild zum mindesten muß ich kennen! Das ist doch — nein!“
„Ja!“ sagte Lisi in heillosem Schreck. „Natürlich mußt Du's kennen! Du hast es ja unten in Deinem Koffer!“
Ein halberstickter, kleiner Schrei — dann rauschte die Leinwand nieder — und dann war alles still. John Hunter rührte sich nicht, — er kam sich vor wie behext. Ganz toll aufjauchzen hätte er mögen, — ohne jeden Grund, und auf einmal kam er ins Lachen, und lachte, daß er sich bog. Das war das Großartigste, was ihm je im Leben passierte. Ganz aufgelöst vor Vergnügen legte er sich zurück — „Au — Donnerwetter! fuhr er in die Höhe. Vor ihm saß ein kleines, zähnefletschendes vierbeiniges Ungeheuer, das John Hunters Bewegungen als persönliche Beleidigung aufgefaßt zu haben schien, und mit der Frechheit, nur ein Dackel besitzt, dem Störenfried in die Waden gefahren war.
„I, du bist ja eine reizende Kreatur!“ rief John Hunter und hob die Hand um dem rasseechten Uebeltäter liebkosend den Rücken zu klopfen. Mit gesträubtem Fell schnappte der Hund aber nach ihm, und hätte ihn der junge Mann nicht im letzten Moment energisch beim Kragen gehabt, so wären seine schönen, weißen Beinkleider unabänderlich in Fetzen gegangen. Jetzt riß John Hunter der Geduldsfaden. „O Du Ausgeburt der Hölle!“ rief er, und im nächsten Moment schallte ein Geheul über das Deck, als ob Freund Krummbein bei lebendigem Leibe gehäutet werden sollte.
Da flog das Sonnensegel wieder zur Seite, und während der Hund wie der Blitz dahinter verschwand, erschien seine Schutzgöttin und Eigentümerin, und ihre Augen, die kurz vorher in Uebermut und Siegesfreude geleuchtet, blitzten jetzt den armen Hunter mit vernichtender Entrüstung an. „Mein Herr, wie können Sie sich unterstehen, meinen Hund zu mißhandeln?“
„Da erziehen Sie Ihren Liebling besser“, verwahrte sich John, dem nun auch die Galle überlief, „daß er nicht friedliche Leute grundlos attackiert.“
„Wenn Sie mir eine Anleitung geben wollten, wie man Dackel erzieht, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet!“ erwiderte die erzürnte Schöne mit niederschmetternder Kaltblütigkeit. „Aber natürlich, ein Mensch ohne Gemüt macht sich kein Gewissen daraus, an wehrlosen Tieren seine vielleicht schlechte Laune auszulassen, ebensowenig wie er in gewissen Fällen seine Mitmenschen mit der nötigen Rücksicht zu behandeln weiß!“
John Hunter verbeugte sich, aber nur vor dem Segel, — seine junge Feindin war verschwunden und ließ sich nur aus fernster Ferne sehen, — drei ganze Tage lang. Komischerweise hatte John während der ganzen Zeit das Gefühl, als ob ihm etwas fehle, das ihm zum Leben notwendig sei. Jedesmal, wenn er der schlanken, weißen Gestalt ansichtig wurde, faßte er den Entschluß, zu ihr zu gehen und sie anzusprechen, aber Isa Lenhusen wußte dem regelmäßig sehr geschickt auszuweichen; und sich noch einmal so vernichtend von ihren Blauaugen anblitzen zu lassen, — nein. Schließlich, was wollte er denn eigentlich von ihr? Sie konnte ihn nicht leiden, — er konnte sie nicht ausstehen, etwas Einfacheres gab's doch gar nicht! In drei Tagen war die Fahrt zu Ende, dann ging man an Land, trennte sich und war sich los für alle Ewigkeit.
John Hunter stöhnte, — vor Behagen natürlich. Da drüben ging Lady Isa wie ein schöner junger Sonnentag auf dem Deck spazieren, den Dackel an der Seite. Ihre Blicke begegneten sich und die Miene der jungen Dame vereiste sich förmlich. Sie beugte sich, um den Hund zu liebkosen, und John Hunter hörte, wie sie sagte: „Bleib hier, mein Lump! Es gibt so viele gemütlose Menschen, die ein Vergnügen darin finden, arme Tiere schlecht zu behandeln.“
Um zu zeigen, welche tiefe Gleichgültigkeit ihn beseelte, suchte John Hunter seinen bequemen Stuhl wieder auf und winkte sich einen kleinen Portugiesen heran, der auf dem Schiffe als Mädchen für alles die Ueberfahrt mitmachte.
„Mache Deine Ohren auf!“ sagte John. „Wenn es Dir gelingt, den Dackel der Dame da drüben in einem unbeobachteten Augenblick über Bord zu werfen, schenke ich Dir fünf Pfund zum Lohne. Verstanden?“
Wie gut der kleine Bengel verstanden hatte, bewies ein Tumult, der urplötzlich auf dem friedlichen Schiffe ausbrach. John Hunter unterschied ganz deutlich Isa Lenhusens flehende Stimme und die bedauernde, aber unerbittliche Antwort des Kapitäns.
„Was ist denn los?“ fragte er mit größter Ruhe den Matrosen, der ihm zunächst stand.
Isa wandte ihr verweintes Gesicht nach ihrem Feinde.
„Der Hund der Lady ist über Bord gegangen, und der Kapitän kann wegen des Hundes doch nicht die Fahrt unterbrechen!“ lautete die mitleidige Antwort.
„Well, dann also eines Menschen wegen“, sagte John Hunter phlegmatisch, streifte die Tennisschuhe von den Füßen, warf den Rock ab und sprang mit einem prachtvollen Hechtsatz über die Reeling.
„Wundervoll!“ war sein erster Gedanke, als er durch die Wucht des Sprunges tief unter das laue Wasser tauchte. Dann schoß er in mächtigen Stößen in der Linie des Kielwassers zurück, in dessen Strudeln ein zappelndes, schwarzes Etwas bald auftauchte, bald verschwand. Auf dem Deck des Schiffes herrschte eine unbeschreibliche Aufregung. Der helle, verzweifelte Schrei einer Frauenstimme kreuzte sich mit dem scharfen Kommando des Kapitäns. — Der ganze mächtige Körper des Dampfers zitterte unter den Stößen der mit voller Kraft rückwärts arbeitenden Maschine. Oben an der Reeling stand eine helle, schlanke Gestalt weit übergebeugt und verfolgte den Schwimmer mit angstvollen Augen. John Hunter fühlte sich unsagbar wohl, und die Lust zum Jauchzen kam wieder über ihn. Jetzt hatte er den Hund erreicht, packte ihn beim Fell und warf sich auf den Rücken, um einen Augenblick auszuruhen. Dann ging's gemächlich mit der Beute im Arme zurück, wo ihn das blitzschnell ausgesetzte Boot in Empfang nahm.
„Sehr schön!“ sagte Hunter, als er sich überzeugt hatte, daß der Dackel zwar noch am Leben, aber wenigstens für die nächste halbe Stunde zu jeglicher Schandtat unfähig war. Wieder an Bord ließ er den Hund vorsichtig zu Boden gleiten, machte seiner Herrin eine steife Verbeugung und wollte weiter.
„Mr. Hunter!“ begann eine bittende Stimme zwischen Lachen und Weinen.
„Bitte!“
„Ich habe Ihnen so maßlos viel zu danken . . .“
„Bitte!“ wehrte der tropfnasse Held ab.
„Ach, machen Sie es mir doch nicht so furchtbar schwer! Ich bin Ihnen wirklich so dankbar . . .“
„Oh bitte!“ sagte John Hunter zum dritten Male. „Ich habe sehr einfach ein Bad genommen und dabei zufällig einen Hund aus dem Wasser gefischt. Dafür kann ich unmöglich Dank beanspruchen!“
„Aber Sie konnten dabei ums Leben kommen!“
„Nun, wäre es denn um einen so gemütlosen Menschen, wie ich bin, schade gewesen?“ fragte er boshaft.
„Seien Sie einmal ehrlich, Mr. Hunter“, sagte sie mit flammenden Augen, — „was mußte ich von einem Manne denken, der so — so . . .“
„Gemütlos!“
„Jawohl, gemütlos einen Bund fürs ganze Leben schließen wollte?“
„Aber mein Gott, — ich wollte ja gar nicht!“ verteidigte sich John — und als sie ihn verständnislos ansah, holte er aus seiner Brieftasche die Karte an seinen Vater, die dort in dunkelster Verborgenheit geschlummert hatte.
Isa Lenhusen las und wurde dunkelrot. Ihre Lippen zuckten vor verhaltenem Lachen, — Johns Augen und die ihren begegneten sich, und — nun war's aus. A Tempo brachen sie in ein Lachen aus, wie es der alte Ozean wohl selten so lustig und erlösend gehört.
„Also jetzt sind wir quitt!“ sagte Isa aufatmend und streckte ihm die Hand entgegen, in die er so energisch einschlug, daß sie ihre halb zerquetschten Finger mit einem Schreckensschrei zurückziehen wollte. Aber nun hatte John Mut bekommen und hielt sie unbarmherzig fest.
„Fräulein Isa!“ sagte er treuherzig, „wir haben uns beide in uns getäuscht! Wenn es Ihnen aber recht ist, schicken wir an Stelle dieser Karte ein Kabeltelegramm an meinen Vater: „Miß Lenhusen und John Hunter soeben auf Dampfer „Nürnberg“ verlobt!“ . . .“
An der Verlobungsfeier, die sie in der Kajüte des Kapitäns mit diesem zusammen hielten, nahm auch der vierbeinige Held des Tages, Freund „Lump“ teil. „Er ist doch eigentlich schuld daran, daß ich meinen Johny bekommen habe!“, sagte Isa, indem sie ihm ein saftiges Stück Braten servierte.
„Hm“, machte John hinter der Serviette, und die Blicke der beiden Männer trafen sich, wobei der Kapitän mit dem Finger drohte.
„Haben Sie schon 'mal um eine Frau geworben?“ fragte John. „Nein? — Na, wer weiß, ob Sie nicht in diesem Falle noch ganz andere Dinge begehen, als Bestechungen, Selbstmordversuche und Uebertretungen sämtlicher Paragraphen der Schiffsordnung!“
Kamerad
Novelle
Es war eine tolle Nacht.
Als Dr. Magnus Steijn, von windverwehter Stimme bei Namen gerufen, aus seinem einsamen Landhaus trat, peitschte ihm der Regen so eisig ins Gesicht, daß er kaum die Augen öffnen konnte und nur mit Mühe unterschied, wer vor ihm stand. Und auch dann glaubte er's noch nicht. Zu ähnlich einem phantastischen Nachtgebilde war das Pferd, das mit schlagenden Flanken an der steinernen Treppe hielt und leise schnaubend den Kopf nach ihm wandte, — und die windzerzauste Gestalt auf seinem Rücken.
„Fräulein von Kaub, . . . um Gotteswillen“
„Ja, — ja, — ich selbst! Es gab keinen anderen Boten, sonst wäre ich gewiß nicht zu Ihnen gekommen, Herr Doktor! Aber es blieb keine Wahl, und „Kamerad“ duldet keine andere Hand am Zügel als die meine. Sie müssen hinter mir aussitzen, es war in dem ganzen gottverlassenen Nest kein zweiter Gaul aufzutreiben. Aber worauf warten Sie denn noch! Sie können doch hoffentlich auf Decke reiten?“
Das bereit gehaltene Verbandzeug unterm Arm, denn nur die Verzweiflung konnte bei diesem Wetter nach dem Arzte rufen, — tat er wie sie geheißen, schwang sich mühelos hinter sie, — und mit einem Zungenschlag ließ sie das Tier in Trab fallen.
Sie schwiegen beide. Er hatte eine Zeitlang das vage Gefühl zu träumen, aber der Regen, der unbarmherzig bis auf die Haut durchschlug, belehrte ihn bald eines anderen. Es war ein Höllenritt. Die Bäume längs der Straße ächzten mit beinahe menschlichen Lauten, die Telegraphendrähte über ihnen pfiffen und sausten in gellender Melodie, und unter ihnen stöhnte das abgehetzte Pferd.
„Lassen Sie „Kamerad“ Schritt gehen, oder er bricht zusammen!“ befahl er hart.
Sie antwortete erst nach einer Weile, ohne zu gehorchen. „Das Pferd oder das Kind,“ sagte sie.
„Es ist eine zwecklose Grausamkeit, auf diese Weise kommen wir nicht bis Folkwang!“ fuhr er fort.
Wieder zögerte sie mit der Antwort. „Kamerad“ hält aus! „Kamerad“ hat mich noch nie getäuscht!“ sagte sie dann, und sich niederbeugend sprach sie in gebrochenen Worten der Zärtlichkeit zu dem zitternden Goldfuchs.
Magnus Steijn preßte die Zähne auseinander. Der Wind trieb ihm einzelne, lose Strähnen ihres Haares, dessen Schimmer ihm nie aus den Gedanken weichen wollte, mochte er in dumpfen Krankenstuben mit dem Tode um ein Leben kämpfen, oder daheim am Schreibtisch arbeiten, bis ihm der Kopf wirbelte, ins Gesicht.
„Ich glaubte, Sie liebten Ihren guten „Kameraden““, sagte er zwischen den Zähnen.