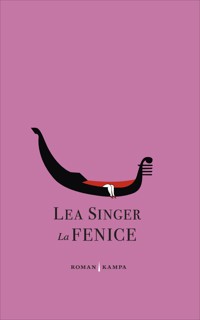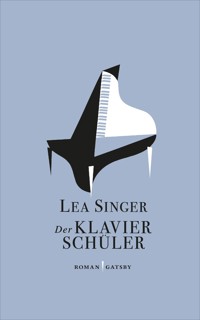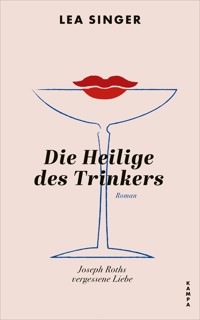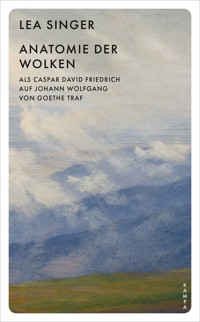
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keine Ahnung von Mythologie und klassischen Regeln, doch Wolken malen kann dieser Friedrich«, ereifert sich Geheimrat von Goethe über den jungen, wilden Romantiker. Im Jahr 1810 begegnen sie sich erstmals: Goethe, berühmter Dichter und alterndes Universalgenie, und Friedrich, der Maler, der sich weder aufs Reden noch aufs Schreiben richtig versteht. Der eine ist diplomatischer Minister, der andere Habenichts ohne Manieren. Ein betuchter Frankfurter Großbürgersohn und ein Seifensiedersprössling aus Greifswald. Goethe ist auf dem Zenith seines Ruhms, während Friedrich mit allen Konventionen seiner Zeit bricht. Doch eines verbindet sie: Beide sind gebannt von den Wolken. Lea Singer erzählt von der Begegnung zweier großer Künstler, die einander fremd bleiben, obwohl sie die Größe des anderen erkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lea Singer
Anatomie der Wolken
Roman
Atlantis
Für Hildegard, die Wolkenbilder liebt, weil sie
»das Unberührbare berührbar machen«.
I
Er hatte ihn immer gehasst. Weil er ihn an eine Leicheerinnerte, eine riesige, Raum und Zeit füllende Leiche. Ihr Verwesungsgeruch stieg mit dem Rauch aus den Kaminen, ihr Leichentuch aus Schnee verdreckte durch den Ruß. Er konnte sich aber nicht erinnern, jemals einen Winter so sehr gehasst zu haben wie diesen, den sechzigsten in seinem Leben.
Im Dezember 1809 hatte der berühmteste Schriftsteller des Landes, nein: des Kontinents das Gefühl, wie das Jahr an einem Ende angelangt zu sein. Also so gut wie tot. Einsam in einer Stadt, wo ihn jeder kannte. Freundelos und freudlos. Vor allem aber fühlte er sich unverstanden. Gab es eine größere Einsamkeit als das Unverstandensein?
Überall in den Salons von Weimar bis Karlsbad dasselbe. Unmoralisch sei der neue Roman von Geheimrat Goethe. Der erste, den er nach zwölf Jahren Abstinenz geschrieben hatte. Abgesang auf die Ehe, Hohelied des Betrugs, Hymne auf den Ehebruch, schimpften sie. Nichts hatten sie verstanden. Gestern hatte er zum soundsovielten Mal einer Verehrerin erklärt, der Roman sei keineswegs unmoralisch, sondern sein bestes Buch. Aber sie war wohl schon eine Verehrerin außer Dienst und zu dumm dafür. Wusste nicht, was Wahlverwandtschaft hieß, was es in der Chemie bezeichnete: Die Triebkraft einer chemischen Reaktion, eine Bindung einzugehen. Die neun, zehn Seiten von dreihundert, in denen es um das Eigentliche ging, das Experiment, die Versuchsanordnung von vier Personen, hatten die Verurteiler überblättert oder einfach nicht begriffen.
Chemie? Wahlanziehungen? Hörte sich für die in Weimar nach einer Perversion an; keiner kannte hier den Schweden Bergman. Es kannte auch keiner den großen Lavoisier. Darin waren sich der Geheimrat Goethe und Napoleon bei ihrem Treffen in Erfurt sofort einig gewesen: Dass die Jakobiner diesem Mann, dem Entdecker des Wasserstoffs und des Sauerstoffs, 1794 den Kopf abgehackt hatten, war eine Schande für die Revolution. Der Naturwissenschaft gehörte die Zukunft, den Erkundern der Wahlanziehungen und der wahren Verbindungen.
Sechzig war Lavoisier gewesen, als sie ihn unters Fallbeil geschnallt hatten. Sechzig wie er. Ein Zufall?
In diesem Dezember 1809 hungerte Goethe weder nach Leberpastete noch nach gefüllter Gans, nur nach Zukunft, nach Verstandenwerden und Liebe. Nein, nicht die Suppentopfliebe, die ihm seine Christiane servierte, eine frische, prickelnde Champagnerliebe. Sein Uraltfreund Knebel, der seit Jahrzehnten Bewunderung frei Haus lieferte, hatte ihm nach dem ersten Band der Wahlverwandtschaften erklärt: Nimm’s mir nicht übel, ich kann das nicht verdauen. Goethe hatte ihm geantwortet: Ich hab das nicht für dich geschrieben, sondern für die jungen Mädchen!
Kein zweiter Band für Knebel. Basta.
Und nun kam mitten im Dezember dieser Brief. Aus Dresden, von Caroline Bardua. Natürlich kannte er sie, erinnerte sich an sie. Schwarze Locken, schwarze Augen, schwarze Wimpern, Wespentaille, sie hatte jahrelang hier in Weimar bei Heinrich Meyer zeichnen gelernt. Goethe hatte Meyer damals mit gutem Grund aus der Schweiz nach Weimar gelotst. Der sollte hier einmal Balken im Kunstweltsumpf verlegen. Für Struktur, Statik, Ordnung sorgen. Für Beurteilungsgrundlagen. Viele Ungenauigkeiten hatte Meyer bei der Bardua bemängelt, sehr viele. Erfolg könne sie trotzdem haben, hatte Goethe ihm erklärt: Wer schaute schon so genau hin, bei diesen Locken, Augen, Wimpern, dieser Taille. Trotzdem, ein Brief von zwölf Seiten? Eine Zumutung eigentlich. Aber –
Erstens war die Absenderin eben sehr jung und sehr schön, italienisches Erbe wohl. Zweitens legte diese sehr junge und sehr schöne Frau ihm dar, warum die Wahlverwandtschaften sein bestes Buch seien und ein zukunftsweisendes außerdem. Sie lechze nach Band zwei. Drittens schrieb sie etwas von Verliebtsein.
Dieser Landschaftsmaler Friedrich in Dresden hatte ein Gedicht des Geheimrats gemalt, Schäfers Klagelied. Alle seien begeistert, schrieb Caroline Bardua weiter. Und dann: Dieser Friedrich ist auch ganz verliebt in Sie und wünscht sich sehnlich, Sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Ja, wie denn sonst?
Die Liebe von Friedrich war ihm ziemlich egal, außerdem war sie durchschaubar. Er, der Geheimrat, hatte diesem Hungerleider vor vier Jahren zu seinem ersten und bisher einzigen Preis verholfen. Gegen die Statuten des Weimarer Kunstwettbewerbs, in dem die Illustration eines antiken Themas verlangt worden war: Herakles beim Ausmisten der Ställe des Augias. Friedrich hatte weder den Helden noch Ställe gezeichnet, sondern Mönche im Sonnenaufgang, sehr unheldisch. Dazu eine abgestorbene Eiche in öder Landschaft. Aber wie er mit Sepiatinte zeichnen konnte, das hatte Goethe beeindruckt. Das halbe Preisgeld hatte er ihm zugeschustert, für diesen Friedrich offenbar damals die Rettung.
Bilder zu verkaufen gelang ihm wohl nach wie vor nur selten. Waren die meisten seiner Bewunderer selbst Habenichtse? Vermutlich.
Schäfers Klage, schrieb die Bardua, habe Koethe gekauft, neuerdings Kirchengeschichtsprofessor in Jena. Das wunderte Goethe nicht; Koethe war halt einer dieser deutschpatriotisch glühenden Redner, keine Dreißig, von denen derzeit viele unterwegs waren. Einer, der bei Studenten gut ankam und bei Künstlern wie diesem Friedrich. Der sollte bloß nicht meinen, sich zu erhitzen sei Sache der Jungen. Sache der Jugend, das schon. Innere Jugend war aber keine Frage des Alters, sondern der Aufbruchsbereitschaft, der Neugier.
Goethe spürte: Er wollte wissen, was dieser Friedrich aus seinem Gedicht gemacht hatte. Die Neugier wuchs noch mit dem neuen Jahr.
Als der Schnee schmolz, machte er sich auf den Weg nach Jena, zu Koethe. Zu Schäfers Klagelied auf Leinwand.
Bei Koethe roch es schon vor der Haustür nach Entsagung. Graupensuppe, angebrannte Milch, Kohl. Ja, Goethe hatte sich nicht getäuscht. Auf Fleisch und vergorene Getränke verzichte er, eröffnete ihm Koethe beim Kamillentee. Noch keine Dreißig! Wie sollte so einer eine Frau erobern, eine begehrenswerte?
Das Bild hing in Koethes sogenanntem Salon, über dem Esstisch, auf dem nichts zu essen stand. Stühle, so bequem wie Kirchenbänke.
Es war acht Jahre her, dass er Schäfers Klagelied gedichtet hatte. Trotzdem stand noch jedes Wort in Goethes Kopf. In den Details hatte Friedrich sich an die Vorlage gehalten. Schäfer oben, Blick ins Tal. Die weidende Herde war vorhanden, auch das Haus der Geliebten, nach unbekannt verzogen. Vielleicht gar über die See. Die See war auch da. Regenbogen über dem Haus ebenfalls. Dass Friedrich die schönen Blumen aus Strophe drei vergessen hatte, sagte schon einiges. An diesem Bild stimmte fast alles und doch nichts, gar nichts. Weltschmerz statt Liebesschmerz. Und dann dieser Regenbogen! Fahl vor grauen Wolken. Überhaupt: das Bild bestand zu zwei Dritteln aus Wolken, dräuenden Wolken. Schäfers Klagelied hieß sein Gedicht, nicht Wolkenklagelied.
Die Figur rechts sei der Künstler, wusste Koethe. Friedrich als Wanderer. Versunken in Gottes großartiges Schauspiel.
Mit den Göttern hatte es dieser Friedrich nicht. Vermutlich hatte er keine Ahnung von Mythologie, deshalb auch kein Herakles damals beim Wettbewerb. Mit olympischer Heiterkeit hatte er es auch nicht. Dafür versank er, laut Koethe, in den Anblick irgendwelcher Naturschauspiele. Aber bitte! Einen Regenbogen, der eine Viertelstunde dastand, schaute doch keiner mehr an. Was sollte das.
Von düsterem Gewölk sei bei ihm nicht die Rede, meinte Goethe.
Kein Regenbogen ohne Regen, kein Regen ohne Regenwolken, sagte Koethe und trank seinen Tee. Kamillentee mit neunundzwanzig.
Koethe. Schon sein Name klang wie ein angestrengtes Echo von Goethe.
Für seinen Kreislauf, sagte der Geheimrat, sei jetzt ein Glas Port oder Rotwein von Vorteil. Die Reise –
Koethe brachte den Port, ein Bodendeckelrest in einer verstaubten Flasche, immerhin. Aber dann zeigte er auf den Abgrund vor dem Wanderer.
Das symbolisiert den Tod, sagte er.
Der Winter war vorbei, das Leichentuch weggezogen. Und nun faselte der junge Denker schon wieder vom Ende. Vielleicht eine Folge der Entsagung. Man müsste diesen Verzichtern eine Italienreise spendieren, würde Ärger sparen. Ihnen und allen, mit denen sie zu tun hatten.
Goethe schwante, was hier zum Abendessen aufgetischt werden würde. Er war froh, abends im nahen Drackendorf bei den Ziegesars eingeladen zu sein, im Südosten der Stadt. Ein Landgut im besten Sinn. Dass dort der Hungerbach floss, war ein Irrtum der Natur, Gott … nein, den Göttern sei Dank. Der alte Ziegesar verfügte über eine begnadete Köchin und einen Keller, in dem Goethe gerne übernachtet hätte, um seine Französischkenntnisse aufzufrischen.
Der alte Ziegesar? Auch Jurist, auch geheimer Rat und vieles mehr, wichtig, mächtig, drei Jahre älter als er selbst. Aber irgendwie doch deutlich älter. Wie besessen pflanzte er Bäume auf seinem Gut in Drackendorf, Naturpflege statt Naturwissenschaft. Das war ja ehrenwert, aber wie vieles Ehrenwerte einschläfernd. Bäumepflanzen war eine Sache von Männern, die mit dem Akt der Fortpflanzung nichts mehr im Sinn hatten. Männer mit Experimentierfreude setzten nicht, die pfropften wie der Hauptmann in den Wahlverwandtschaften. Setzen war doch nur ein Zeichen banaler Hoffnung; wird schon wieder etwas wachsen. Junges Reis auf junge Stämme zu pfropfen war viel mehr, ein Versuch, ganz neues Leben zu erschaffen, etwas noch nicht Dagewesenes. Wer aus der Natur ein Laboratorium machte, der besaß Zukunft.
Letztes Jahr war die Frau des alten Ziegesar gestorben. Einer wie er dachte nicht an eine neue, nicht im Traum, nicht mal in Karlsbad oder Marienbad, wo die Träume bei fast allen feuchter wurden.
Juristische Verhandlungen mit Ziegesar über Verwaltungskram liefen nach wie vor frisch geölt. Schon weil erst danach Ziegesars Tochter Sylvie dazustieß, brachte Goethe das zügig hinter sich. Das erste Mal hatte er Sylvie beim Anatomen Loder in Jena gesehen. Genau in dem Jahr, als er Schäfers Klagelied über die nicht erreichbare Geliebte dichtete. Das zählte offenbar kaum einer zusammen. Der alte Ziegesar jedenfalls nicht, kein Gespür für Chemie. Auch gut so. Sylvie? Ja, die hatte es verstanden. Es war ein zauberhaftes Spiel gewesen mit ihr in diesen Karlsbader Frühlingswochen 1802. Ah, und wie sie die Spielregeln beherrscht hatte. Immer leicht bleiben, das Handgelenk locker, die Blicke vielsagend, die Berührungen wie zufällig. Damals war Sylvie siebzehn gewesen. Eine fertige Frau, aus Sicht des Naturwissenschaftlers. Lavoisiers Marie war dreizehn gewesen, als er sie geheiratet hatte. Frankreich eben.
Vorletztes Jahr, wieder in Karlsbad, hatte Goethe es dann endlich getan: Sylvie direkt angedichtet, eindeutig. Als Tochter, Freundin, Liebchen hatte er sie angeredet. Reaktion? Keine chemische, wie er sie erwartet hatte. Keine unaufhaltsame Anziehungskraft, die gab es nur beidseitig. Immerhin aber auch keine Abstoßungsreaktion.
In Karlsbad hörte man die meisten Wahrheiten zwischen dem Gluckern. Wenn die Kurgäste in der Wandelhalle ihr Heilwasser tranken, kippten, nippten, schlürften, hinunterquälten oder hinunterschütteten. Überlaut hörten sie ihre Schluckgeräusche, auch jedes Knacksen und Knirschen ihrer Gelenke. Aber sie bemerkten nicht, wie laut sie redeten.
Dieser Abstand! Dreiundfünfzig und siebzehn. Lächerlich. Großvater. Maßlos. Ichbittesie. Wasdenktdersichdenn.
Zwischen dem Gluckern und Schlucken hatte Goethe das mehrmals gehört. Lächerlich? Wenn die natürliche Ordnung zwei Elemente zusammenbringen wollte, dann war die moralische Ordnung außer Kraft gesetzt, aber diese Klatschmäuler hatten keine Ahnung von Naturgesetzen. Dabei wäre es doch ganz einfach: Sie müssten nur ans Urbild Magnet denken. Polarität und Anziehungskraft, das war etwas Elementare, dagegen waren Priester und Moralbürger machtlos. Das hatte er in seinen Wahlverwandtschaften nun vorgeführt, im Laboratorium eines Romans. Das mussten ihm die Kleinschlucker verübeln, sie hatten Angst vor solchen Kräften, Angst vor einem Naturgesetz, das stärker war als ihre Prinzipien.
In Jena würden sich bestimmt mehr Wahlverwandte finden. Jena war nicht Weimar oder Karlsbad. Hier hatte er schon vor zig Jahren, ohne ein Semester Medizin studiert zu haben, das Seziermesser an eine Leiche setzen dürfen, hier gab es ein anatomisches Theater, naturwissenschaftliche Institute, meteorologische Stationen. Überall hatte er Zugang. Was erotische Chemie war, brauchte er hier keinem zu erklären. Auch Sylvie nicht.
Es dämmerte, als Goethe vor dem Gut der Ziegesars vorfuhr. Die Ruine der Lobedaburg brütete über dem Anwesen, und über der Burg dräuten die Wolken. Düster wie diese Wolken auf Friedrichs Gemälde bei Koethe. Armer Hund, dieser Friedrich. Der hatte noch nie reines Wolken-weiß auf Azur pur über dem Golf von Sorrent gesehen. Oder olympische Wolken über antiken Tempeln im Klatschmohnrot. Dort war der Himmel ein Fest. Nichts drohte, alles war gesichert, der Frieden, der Genuss.
Sylvies schlanke Absätze ratterten sofort die Treppe herunter, als sie Goethes Stimme im Treppenhaus hörte, hinter ihr drein in Synkopen die Freundin Pauline Gotter. Auch Freundschaft war eine chemische Verbindung, sie konnte sich rasch auflösen, wenn die Säure der Eifersucht oder der Missgunst sie zersetzte; konnte aber auch noch enger werden durch gemeinsame Affinitäten. Chemisch stimmte das vielleicht nicht ganz, aber menschlich.
Kaum hatte Pauline eine Weste für Goethe genäht, hatte Sylvie ihm eine bestickt. Sagte er Sylvie, sie werde immer hübscher, fragte Pauline: Wie finden Sie mein neues Kleid?
Für den alten Ziegesar waren die beiden nur zwei junge Frauen mit erwünschter Wirkung. Elemente mit hoher Bindungsfähigkeit, mit vielen Valenzen für interessante Gäste. Anziehend wodurch? Weil sie jung und schön waren, heiter, aufmerksam oder verfügbar? Eine Option, zwei Optionen. Sicher war, die Anziehungskraft der beiden brauchte Ziegesar, der mit seinen dreiundsechzig eine Fahrstunde außerhalb der Stadt wohnte. Es war mehr eine rhetorische Frage an Ziegesar, ob er denn viel Besuch habe hier draußen. Die jungen Frauen, die ihm und Goethe gegenübersaßen, machten die Frage bereits überflüssig. Außerdem waren da noch der Keller und die Köchin.
Aber ja, sagte Ziegesar, nicht nur Schlegel samt Frau, Koethe und Konsorten seien in letzter Zeit oft da gewesen. Auch dieser Friedrich aus Dresden war mehrmals da. Meistens sei er mit Sylvie hinauf zur Ruine gewandert. Friedrich sei ganz verliebt, ernsthaft verliebt in sie.
Als Goethe den Wein in die Luftröhre bekam, sagte Ziegesar: In die Lobedaburg.
Sylvies weißer Hals über dem weißen Kleid war so gefährlich wie in Karlsbad. Die Korallenschnur, nicht breiter als ein Messerrücken: Trug sie die seinetwegen? Sie machte ihn nervös, diese rote, straff anliegende Schnur. Ständig überlegte er, was passieren würde, risse sie. Konnte Sylvie verliebt sein? In wen denn! Wenn schon kein Geheimer Rat, kam für Sylvie nur ein Gelehrter, ein Professor infrage, so viel war klar. Ob mit oder ohne Adel. Aber Männern wie Koethe, den neuen Helden in Vielwisserkreisen, fehlte alles, was die beiden Humboldts hatten. Das waren keine Schlafrockhausgeister gewesen, die sich mit Schnupftabak vollsabberten, keine Kohlsuppenesser, keine Kamillenteetrinker. Das waren Champagnerkenner, Risikoartisten, Weltenwanderer, Seelendiplomaten, Handkusssouveräne. Männer von Koethes Sorte hatten keine Ahnung, was eine Frau brauchte. Und dieser Friedrich? Ein Hungerleider. Nur das schreckte nicht jede ab.
Dieser Friedrich, sagte Goethe –
Haben Sie sein Bild bei Koethe gesehen?, fragte Sylvie.
Ein einziger Regelverstoß!, sagte Goethe. Was dieser Koethe nur daran findet! Das sagte er nicht: Regeln. Wer sie befolgte, fand Einlass bei den Geregelten. Goethes Blick ruhte auf dem Teller. Ja, hier stimmte alles. Bei Ziegesars servierten sie die richtigen Kartoffeln, die rotschaligen, weißfleischigen, zum Bœuf à la mode. Außerdem den passenden Gevrey aus einem guten Jahrgang. Die Kartoffeln noch mit Biss, das Rindfleisch mürbe, der Burgunder richtig temperiert.
Das sei Friedrich durchaus bewusst, meinte Sylvie, das mit dem Regelverstoß.
An den Weihnachtstagen des vorletzten Jahres hatte sie diesen Friedrich in seinem Atelier besucht, Dresdner Vorstadt, durchratterte Straße, muffiges Treppenhaus, dritter Stock, kaum geheizt. Schwarz, ganz schwarz habe er das Atelier ausgeschlagen. Die Wände, die Staffelei, sogar den Tisch mit schwarzem Tuch verhüllt. Der ganze Raum ein Andachtsraum. Auf dem Tisch zwischen Kerzen sein Andachtsbild für die Schlosskapelle in Tetschen: Kreuz im Gebirge.
Ich habe darüber gelesen, sagte Goethe. Über das Bild.
Goethe hatte Ramdohrs Verriss in der Zeitung für die elegante Welt gelesen. Verrisse zu lesen erfrischte. Nur den Opfern waren Verrisseschreiber verhasst.
Sylvie sah Goethe an mit diesem Erwartungsblick.
Ein radikaler Bruch mit den Gesetzen der Zentralperspektive, sagte Goethe. Und diese Sonnenstrahlenbahnen: ein Verstoß gegen alle Regeln der Optik!
Auch Pauline sah ihn an mit diesem Erwartungsblick.
… schrieb Ramdohr, sagte Goethe und aß weiter.
Absicht, meinte Sylvie. Alles Absicht, damit der Betrachter nicht weiß, wo er steht, und nicht weiß, wo der Maler gestanden hat. Der Fels wie aus der Ferne gezeigt und doch in jedem Detail, jeder Scharte, jeder Kante, als stünde man direkt davor. Die Verunsicherung sei gewollt, so viel sei sicher.
Und diese Strahlenbahnen, sagte Pauline, könnten gar nicht gegen die Regeln der Optik verstoßen. Sie seien nicht als echter Sonnenuntergang zu verstehen, sondern als Zeichen.
Warum sie dabei ihren Ausschnitt ordnete und Goethes Blick dorthin dirigierte? Pauline wusste genau, was Blicke anzog. Und dieses Wissen allein zog Goethe schon an.
Anziehungskraft. Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Eigentlich konnte man damit alles erklären. Eine Welterklärungsformel zu finden wäre doch eine größere Leistung, als noch etwas und noch etwas auf den himmelhohen Stapel der Weltliteratur zu legen. Er spürte, dass er nah dran war, diese Formel zu entdecken. Die Bindungsneigungen der Stoffe. Die Wahl des energetisch besten Bindungspartners. Immer ging es um Anziehung. Aber da steckte noch viel mehr drin. Auch Wolken ließen sich vermutlich damit erklären. Die Form der Wolken konnte nur mit der Erdanziehung zu tun haben.
Sylvie und Pauline saßen eng nebeneinander, fassten sich am Unterarm an, berührten sich an den Wangen, strichen sich gegenseitig übers Haar. Ja, die wussten ganz genau, wie sie damit den Berührungshunger der Männerhände wachkitzelten. Gespielte Unschuld. Wie viel delikater war die als echte. So gesehen gewann der Park an der Ilm auch gegen märkische Äcker.
Sylvie und Pauline redeten einstimmig, zweistimmig, versetzt mit Pausen, versetzt ohne Pausen. Goethe konzentrierte sich darauf, wie sich die Lippen der beiden bewegten. Das war für ihn interessanter als das, was über diese Lippen kam. Immer wieder dieselbe Leier, wieder und wieder. Dass man mit Gewohnheiten, mit Traditionen, mit Vorschriften brechen müsse, um aufbrechen zu können. Zu neuen Ufern, versteht sich. War doch alles kalter Kaffee. Hatte dieser Friedrich ihnen den aufgetischt? Ein Künstler muss sich verändern, von innen heraus, sagten die beiden Hübschen. Auch das hatte Friedrich ihnen vorgesungen, klar. Der Künstler muss wandern, darf nicht stehenbleiben. Er muss aufbrechen, ohne zu sagen, wohin.
Der tat sich leicht, dieser Friedrich, den kannte ja kein Mensch. Als er, Goethe, sich damals um drei Uhr früh an diesem 3. September 1786 aus Karlsbad weggestohlen hatte, da hatte er auch keinem gesagt, dass es nach Italien ging. Er hatte sich aber als Moeller ausgeben müssen, Maler Moeller aus Leipzig. Als Goethe war er damals schon zu bekannt gewesen, vor bald vierundzwanzig Jahren.
Oje!, jetzt redeten sie auch noch vom Mut, zu wandern, ohne Mittel, ohne fahrbaren Untersatz, ohne zu wissen, wo man nächtigt. Das imponierte denen offenbar. So ein Maler, der, anstatt sich mit Porträts ordentlich Geld zu verdienen, sich stundenlang in Wolken versenkte, der gab diesen jungen Frauen irgendetwas.
Nur was?
Sie leuchteten beide, als sie von Friedrich erzählten, beinahe aufdringlich erleuchtet, wie frisch missioniert. Dieses Kreuz im Gebirge war als eine Art Altarbild gedacht, für die Kapelle von Graf und Gräfin Thun in Tetschen, Ramdohr hatte sich darüber aufgeregt, maßlos aufgeregt. Da schleiche sich die Landschaft durch die Hintertür ins Religiöse ein. Rückfall in den Mystizismus, hatte er gedröhnt. Übertrieben, die Aufregung, hatte Goethe befunden, damals. War da doch etwas dran? Hatte Friedrich die beiden mystisch infiziert? Wäre schade um die hübschen Köpfe.
Sie ließen vor lauter Reden das Rindfleisch kalt werden. Dieses Rindfleisch wegen dieses Pinslers, als habe der einen Kontinent entdeckt, ein malender Alexander von Humboldt. Wo war dieser Friedrich schon gewesen! Von Pommern, sächsischem Land, Ostseeküste und Nordböhmen war die Rede. Vermutlich bei schlechtem Wetter. Sonst hätte er nicht ein so schlecht gelauntes Bild aus Schäfers Klagelied gemacht. Das war doch kein Lied im Nachtwächterton.
Mit dem Wandern hatte es Goethe seit Langem nicht mehr. In Karlsbad ließ er sich mit den anderen Kurgästen die Promenade hinuntertreiben. Angenehm war das, kein Schmutz, keine Steine, keine Gefahren. Ihm konnte niemand mehr einreden, sich durch Schlammfurchen und Geröllhalden zu quälen sei ein unverzichtbares Erlebnis. In sauberen Bädern zu schwitzen, sich Wickel machen zu lassen und hinterdrein zu erfrischen, das hatte Stil. In der Unwirtlichkeit Schweiß auszudünsten war eine Notlösung. Natur war ja erbaulich. Aber die erbaute ihn auch, wenn er in Weimar bei gutem Wetter mit Gästen an der Ilm entlangspazierte, alles in der Ebene. Wozu sich bergauf und bergab schinden. Es genügte doch, dass er es noch leicht alleine schaffte, aus der Badewanne zu steigen. Dieses Es-ist-erreicht-Gefühl durfte man doch als berühmtester Dichter des Kontinents auskosten.
Vor fünfundzwanzig, zwanzig Jahren, ja, da war das noch anders gewesen. In der Schweiz, in Thüringen, im Harz, in Italien, auf den Brocken hinauf, in Tropfsteinhöhlen und Gruben hinunter, Gebirgsgrate entlang, um den Gardasee herum. Drei Mal hatte er den Vesuv bestiegen und nicht mitgezählt, wie oft er die achtundzwanzig Kilometer nach Kochberg zu Charlotte gewandert war.
Wie alt war dieser Friedrich eigentlich? Vor drei Jahren hatte er erst angefangen, in Öl zu arbeiten. Ein Anfänger war er nicht, trotzdem noch nirgendwo angekommen. Keine Stelle, kein anständiges Zuhause, kein verlässlicher Erfolg. Keine Frau?
Wie – wie ist dieser Friedrich eigentlich?, fragte Goethe.
Uneitel, völlig uneitel sei er. Die Kleider sauber, mehr nicht. Die Hosen geflickt, an den Knien vor allem.
Was trieb der Kerl auf den Knien?, wunderte sich Goethe. Was hatte Sylvie, die Kleider in sämtlichen Schattierungen von Weiß kultivierte, auf einmal gegen Eitelkeit? Goethe trug seinen neuesten Rock und auf der neuen seidenen Halsbinde den neuen Orden von Napoleon am schmalen roten Band.
Ein Mensch, der eitel ist, kann nie ganz roh sein, sagte Goethe. Er will gefallen und macht sich den anderen angenehm.
Die beiden Frauen lächelten. Was war das für ein Lächeln?
Es wurden Armagnac-Pflaumen mit Vanillecreme aufgetragen. Goethe genoss langsam, Ziegesar löffelte rasch. Und die beiden? Redeten weiter von Friedrich. Von seinen Joppen, filzig formlos. Von seinen Hemden, am Kragen durchgescheuert. Von seinen Schuhen, grobgezimmerte Kähne, vermutlich nicht ganz wasserdicht. Aber sie beschrieben die Armseligkeiten mit – ja, mit was? Aufmerksamkeit, sagte er sich zuerst. Frauen achteten eben auf solche Dinge.
Aber diese Begeisterung hatte Goethes Misstrauen geweckt. Er hörte nun genau hin. Kein Ekel, nicht ein Unterton von Angewidertsein in dem, was Pauline und Sylvie von Friedrich erzählten. Nein, es war Zärtlichkeit. Sie beschrieben seine Schuhe, als wären es Wesen, die viel durchlitten hatten und die man schon deswegen lieben musste mit ihren Wunden und ihren Narben. Dann fingen sie an, Friedrichs Gesicht abzutasten. Den Wulst in einer Kummerfurche zwischen den staubig weißblonden, struppigen Brauen, den man glattstreichen wolle. Dann den Backenbart.
Ein Mann mit Backenbart konnte diese eidechsenglatten jungen Wesen doch nicht anziehen. Der Gedanke allein, was sich darin verfangen konnte. Tabakkrümel, Brotkrümel, Bierschaum. Alles, was sie von ihm erzählten, hörte sich an nach einem vorgealterten Mann, einem Weltfremdling, nur in der Einsamkeit zu Hause.
Oh nein, auch noch die Augen. Wenn Frauen von Augen sprachen, wurden sie rührselig. Blau, tiefblau, aha. Jetzt kam sicher etwas mit Weihern und Tiefe und Geheimnis.
Wie dunkle Weiher, sagte Sylvie, irgendwie tief und geheimnisvoll.
Ich finde, es sind Kinderaugen, sagte Pauline. Er sieht die Welt mit Kinderaugen.
Sie wirken, als ob er immer den ziehenden Wolken nachsähe, meinte Sylvie.
Schon wieder diese Wolken.
Goethe schloss eine Wette mit sich selbst ab. Modell Wahlverwandtschaften. Hier waren die Elemente des Versuchs S wie Sylvie, P wie Pauline, G wie Goethe, F wie Friedrich. In der Versuchsanordnung würden auf keinen Fall die Elemente S und F oder P und F einander anziehen. Eher S und G oder P und G. Er musste nur den Beweis antreten. Hinweise dafür, dass die Chemie zwischen Friedrich und diesen Frauen nicht stimmte, sammelte er schon. Siehe Backenbart. Nein, da gab es keine aufregenden Reaktionen zu erwarten. Vermutlich reagierte da überhaupt gar nichts.
Narkotisierender Dunst wehe einen von dem Kreuz im Gebirge an, hatte Ramdohr in seinem Verriss geschrieben, das war’s wohl. Ein Narkotikum, mehr nicht. Sie waren benebelt, wieder nüchtern, würden die beiden erkennen: Dieser Friedrich und seine Welt, das war nichts für sie.
Kinderaugen, Friedrichs Kinderaugen: Aus solchen Worten sprach nichts als mütterliche Gefühle, einwandfrei. Es gab schließlich den Typ des greisen Kindes. Unbeholfen, noch oder schon wieder, blieb sich gleich. Blondweiß, weißblond, blieb sich gleich. Jung machte diese Traumverlorenheit nicht, konnte sie gar nicht machen.
Entdeckerdrang hielt frisch. Präzision machte jung. Knackiges Wissen, nicht diese wabernden Ahnungen von irgendwelchen Geheimnissen der Natur. Auch deswegen kamen die Humboldts bei Frauen so gut an. Deswegen hatte dieser Lavoisier eine dreizehnjährige Schönheit erobert. Wenn einer die Weltformel kannte, gab es keine Frau, die nicht bettelte: Erklären Sie mir das unter vier Augen, nur mir. Genies kannten kein Verfallsdatum, die waren mit achtzig noch begehrt.
Ziegesar hatte, schweigend essend, die anderen überholt.
Wolken malen kann dieser Friedrich, sagte er, während ihm Pflaumen nachgelegt wurden. Also, Wolken malt der wie kein anderer.
Goethe schlief miserabel in dieser Nacht. Trotz Eichenbett mit Rosshaarmatratze und Daunenbett in einem Dreifensterzimmer, erste Etage, Gartenblick. Das lag nicht am Bœuf à la mode oder am Gevrey.
Was machte einen Wolkengucker begehrenswert? Warum hatte Ziegesar plötzlich angefangen, Friedrich als Wolkenmaler zu loben? Auf dem Kreuz im Gebirge waren doch offenbar nur Strahlen und Glut, gar keine Wolken zu sehen.
Goethe trat ans vorderste Fenster und öffnete beide Flügel. Wolkenfetzen vor dem beinahe vollen Mond. Die Nacht war kälter als gedacht. Kalt? Alte Männer froren. Brauchten Wärmflaschen und Kniedecken und Bierwärmer. Junge froren nie.
Die Wolken veränderten sich in aberwitzigem Tempo. Von schwer in schlank, von düster in hell, von geballt in gefiedert. Grenzenlos, pausenlos verwandelten sie sich.
Ihm ließen sie in Weimar nicht das Recht, sich zu verändern. In Weimar? Nein, überall, wo sie Goethe lasen oder auch nur kannten. Sie sprachen ihm die Freiheit ab, zu riskieren und zu experimentieren. Sie verübelten ihm den Versuch der Wahlverwandtschaften. Weihevoller und würdevoller durfte er werden, auch fetter. Lebend sollte er das Denkmal seiner selbst sein. Das wollten sie, das erwarteten sie. Oder Goethe, in Goethesaft konserviert. Alles durfte er, bloß nicht sich ändern.
Und nun tief durchatmen, sagte er sich. Er breitete im Nachthemd beide Arme aus. Einatmen, tief einatmen. Freiheit einatmen. Es kratzte im Hals, juckte im Rachen, ließ Wasser in die Augen schießen. Er hustete. Keckernd hustete er ins Freie hinaus. Ein Reizhusten, ließ ihn nicht los. Konnte Sylvie das hören oder Pauline? Sahen sie sich im Auftrag ihres Wanderers die Wolken an, aus einem anderen Fenster, drüber, darunter, daneben? Hörten sein Husten, erwogen sein Alter, seine Hinfälligkeit?
Er presste die Hand auf den Mund, nahm die Wasserkaraffe vom Nachttisch, füllte das Glas, kippte es hinunter, goss nach, leerte, ohne abzusetzen, das zweite Glas, atmete vorsichtig auf Probe, ob der Husten sich gelegt hatte, spürte den Reiz lauern, goss Wasser nach, schüttete das dritte Glas hinab. Atmen, vorsichtig, ganz vorsichtig.
Ah – geschafft.
Kein Geräusch störte. Er schaute und atmete in die Nacht und die Wolken. Was störte, war der Gedanke an Friedrich.
Sein Kreuz im Gebirge stand nun doch nicht in der Kapelle in Tetschen, hatten die beiden jungen Frauen gewusst. Die Thuns hatten es in einem Raum neben dem Schlafzimmer aufgestellt, direkt gegenüber von Raffaels Sixtinischer Madonna. Nur eine druckgrafische Wiedergabe, trotzdem! Goethe selbst hatte es verkündet: Hätte Raffael nichts außer diesem Bild gemalt, er wäre unsterblich. Und das nun auf einer Höhe mit Friedrichs Narkosegemälde, ausgestellt, als wären sie gleichwertig. In Dresden lagen zweitausend Meter zwischen der Gemäldegalerie mit Raffaels Madonna und Friedrichs Atelier. Großer Abstand, recht so.
Schon wieder trieben die Wolken in Goethes Gedanken. Es waren die Wolken unter den nackten Füßen, die aus dieser süditalienischen Mama mit Säugling eine Erscheinung machten. Sie erhöhten das Irdische ins Überirdische.
Die Wolken, sie waren fürs Erheben und fürs Erhabene da. Ein Vehikel fürs Göttliche. Und was transportierte Friedrich darauf? Seine Ideen. Dass die Natur nur in der Natur verstanden werden könne! Was für ein Wahn! Sollten sich etwa alle Maler ins Freie setzen, um Wolken malen zu lernen? Mit nassem Hintern auf Felsen hockend, die Schuhe im Dreck, das Geistige erfassen? Vermutlich bildete sich Friedrich ein, dort sei er im Dialog mit Gott. Ramdohr hatte recht: Hier drohte der Rückfall in den Aberglauben. Diese Friedrichs waren Rattenfänger der Finsternis.
Was den Künstler groß und unverwechselbar macht, kann er nur aus sich selbst schaffen!, erklärte Goethe dem Himmel.
Sylvies Stimme kam aus dem Fenster nebenan.
Sie können auch nicht schlafen? Das muss der Vollmond sein.
II
Er machte es nicht, weil sie sich angekündigt hatte.Er machte es, weil er es gerne tat. Jeden Tag fegte Friedrich den Dielenboden in seiner Wohnung in der Pirnaischen Vorstadt in Dresden, dritter Stock, Straßenseite. Er fegte im Atelier, in der Kammer, in der er unter nichts als einer Wolldecke schlief, in der Küche, in der er sich wusch, sich Roggenbrot vom Laib schnitt, Milch einschenkte, Kartoffeln briet und die Pfanne mit einem Leinenlappen auswischte.
Friedrich liebte das Fegen. Der Boden wurde ihm dabei so vertraut. Er begrüßte jede Spalte zwischen den Bohlen, keine glich der anderen, jede abgesprungene Ecke an der Fußbodenleiste, jeden Fleck im Fichtenholz samt seiner Vergangenheit in einer ausgelassenen Speckschwarte, einem Sepiatintenfass, einer Schlehensaftflasche. Der Rosshaarbesen bewegte sich beim Fegen ähnlich wie Friedrichs Hand beim Zeichnen. Nicht mit Schwung, nein, ganz langsam, zögernd und achtsam vorrückend. Fegte einen abgesprungenen Knopf unter der Kommode hervor, fegte Krümel unter dem Tisch zusammen, fegte Blätter oder Sand oder Erdbrocken weg, die der Wanderer an den Schuhen hereingetragen hatte, Späne von den Föhrenscheiten, die Friedrich für den Herd oder den Ofen gespalten hatte.
Manchmal strandete vor dem Bug der schwarzen Borsten ein zertretener Regenwurm oder eine tote Spinne. Dann hielt er inne, nahm den Kadaver auf und entschuldigte sich.
Viele wunderten sich, dass er diesen Wulst zwischen den Brauen hatte, meistens gerötet. Es gab doch niemanden, der ihm etwas befahl, ihn mahnte oder quälte. Den Kindern machte dieser Wulst Angst. Wie Gewitterwolken, hatte eines gesagt. Viele wunderten sich auch, dass Friedrich vorgebeugt, mit hängenden Schultern ging, manchmal sogar gekrümmt, auf dem Land immer mit einem Knotenstock in der Hand. Ein Mann von Mitte dreißig, der stundenlang gegen den Sturm anwanderte, Klippen erkletterte, an Steilküsten balancierte, durch Eisbäche auf Steinen watete und durch den schweren nassen Sand am Meer rannte, müsste stark und aufrecht daherkommen. Dass es die Schuld war, die ihm auf den Schultern hockte, in den Unterleib stach und unter der Schädeldecke pochte, wusste niemand, fast niemand. Welche Schuld?, hätten sie gefragt. Aber in seine Vergangenheit und seine Seele brauchte kein Neugieriger seine Nase zu stecken. Schlimm genug, dass er noch in so vielen Nächten den jüngeren Bruder durch die Kälte schreien hörte und im zerborstenen Eis ertrinken sah. Den Bruder, der Friedrichs Leben hatte retten wollen und dabei das eigene verlor.
Sich eine Hornhaut wachsen zu lassen gegen die Rippenstöße des Daseins war Friedrich nie gelungen. Die Bauern auf dem pommerschen Land streichelten keinen ihrer Stallhasen, blickten keinem Kalb in die Augen. Sie hatten keines ihrer Kinder lieb, bis die ersten Lebensjahre überstanden waren. Weil sie es sich mit dem Tod leichter machen wollten. Er beneidete und bemitleidete sie. Beneidete sie, weil sie diese Gefühlsblindheit schützte. Bemitleidete sie, weil sie dadurch das Wesentliche nicht sehen konnten.
Ihn verletzte der Alltag ständig. Für die Schrammen und Wunden interessierte sich keiner. Ein Seifensiedersohn war niemand, Trost erwartete er gar nicht erst von seinen Mitmenschen. Doch es gab die Wolken –
Auf so vieles konnte man sich nicht verlassen. Das hatte er schon mit sieben Jahren eingesehen, als seine Mutter nach der Geburt ihres zehnten Kindes gestorben war. Ohne krank zu sein oder elend auszusehen, war sie gestorben. Den Säugling auf der Brust, hatte sie eines Morgens tot im Bett gelegen. Nicht einmal auf die Reihenfolge der Todesfälle konnte man sich verlassen. Nicht nur drei der vor Caspar David geborenen, auch zwei der vier nach ihm geborenen Geschwister waren schon tot. Sogar auf die eigene Amme, die ihn und alle Geschwister danach gestillt hatte, war kein Verlass. Kummt eten!, hatte sie jeden Tag aus der Küche geschrien, und wenn er es genau so auf seine Tafel kritzelte, traf ihn hart die Hand des Lehrers am Kopf. Auf Wörter war ohnehin kein Verlass. Am besten redete man nur dort, wo alle so viel Bier tranken, dass sogar die Studierten den Halt in ihren Sätzen verloren.
Schreiben war eine besonders unzuverlässige Sache. Mit der Feder in der Hand kam er sich immer noch vor, als wäre er in einen Sumpf geraten, wo er bei jedem Schritt, den er weiter hinauswagte, tiefer sank. Zusammen mit den Wörtern, die glucksend aus dem Morast spotteten. Wie schrieb man das überhaupt: Sunf oder Summf?
Selbst der eigenen engsten Verwandtschaft durfte man nicht trauen. Es war erst eineinhalb Jahre her, im November 1808 war es gewesen, da hatte er seinem Schwager, einem Pastor, ins Gesicht gesagt, dass er ein Schurke sei, der unter dem Güte-Talar seine Niedertracht trug. Der den alten Schwiegervater über den Tisch gezogen hatte, seine Redlichkeit ausgebeutet. Aber Scheiße! Nicht einmal auf den eigenen Rachedurst war Verlass gewesen. Friedrich hatte zwar seine Fäuste vor der Nase des Schwagers geballt, grobknochige Fäuste vor einer glasdünnen Nase. Zugeschlagen hatte er doch nicht. Nur weil der Schwager auf krank machte.
Am wenigsten Verlass war auf Frauen. Schlimm genug, dass ihr Kichern nie zum Mitlachen gedacht war, vielen rannen die roten Wangen im Regen weg, und manche, die seine Not zu Tränen rührte, rührten dann keinen Finger für ihn.
Doch es gab die Wolken –
Beim Fegen war er so zufrieden wie beim Zeichnen. Er fühlte sich nicht gedrängt, wusste aber, dass er diese Arbeit zu einem Ende bringen würde. Selbst wenn ihm einer gesagt hätte: Heute ist der letzte Tag deines Lebens. Morgen bist du tot. Er hätte nichts anderes getan, als die Böden fertig zu fegen und seine Zeichnung fertig zu zeichnen und jeder Linie die Zeit zu gönnen, die sie verlangte. Ihm entging nichts, und er überging nichts. War er unterwegs, zeichnete er nicht nur das Große und Mächtige von Ruinen und Friedhöfen und Meeresweiten und Gebirgseinsamkeiten. Er zeichnete eine Sense, ein zerrissenes Segel, einen Holzpantoffel, ein paar aufgehängte Wäschestücke oder ein hölzernes Scheißhaus.
Nebensachen? Gibt es nicht, sagte er denen, die sich wunderten.
Aus einem, der sich mit solchen Kleinigkeiten aufhält, wird nichts Großes, hatte er reden hören. Kein Grund, etwas daran zu ändern. Im Gegenteil. Heikel war nur, dass er es zu spüren bekam, wie wenig er vielen galt. Der Monat dauerte immer viel zu lange. In der letzten Woche röstete er regelmäßig die Schalen der Kartoffeln. Er bekam auch zu spüren, dass es ein Hindernis war, keine Briefe schreiben zu können. Briefe, in denen man den Wichtigen sagte, was sie hören wollten, und so Einlass in die Häuser der Wichtigen bekam. Er konnte nur schildern, was war. Dass er seinen Husten überstanden und sich zahnlos grinsend gezeichnet hatte, dass er ein Fenster in seinem Atelier ganz mit Papier zugeklebt hatte und sich im Gasthof zum Braunen Hirschen ein Rindfleisch mit Kohl geleistet hatte. Oder dass sich jemand geekelt hatte, mit ihm zu reden, weil jedes dritte Wort bei ihm Scheißen war. Was konnte er dafür, dass es so oft notwendig wurde.
Also schrieb man einem Goethe besser gar nicht. Auch wenn es hieß: Mit Goethe kommst du überallhin. Er wollte ja gar nicht überallhin. Was sollte er dort.
Meistens machte es ihm nichts aus, wenn sie ihn und seine Bilder nicht verstanden. Meistens. Wenn einer allerdings auf sein ganzes Leben einstach wie dieser Ramdohr, stach der auch auf seine Überzeugungen ein, und da wehrte Friedrich sich. In solchen Zeiten wurde die Sehnsucht heftig nach etwas wie der Ammenhand, früher, auf dem Unterleib, die Schmerzen nach zu vielen grünen Äpfeln einfach wegstrich. Hier in Dresden gab es so etwas nicht, für ihn jedenfalls nicht.
Doch es gab die Wolken –
Sah er zu, wie eine kleine Wolke die große Sonne verdunkeln konnte, fühlte er sich in seinen Visionen von einer gerechten Welt bestärkt. Jeder, den Gott liebte, konnte sich behaupten. David gegen Goliath.
Auch heute würde er nach dem Fegen, vor ihrem Besuch, die Elbe entlanglaufen. So, wie er als Halbwaisenkind jeden Tag zum Greifswalder Bodden gelaufen war und als Hungerstudent in Kopenhagen jeden Tag an den Hafen, bei jeder Windstärke und jeder Temperatur. Fast immer waren sie da, die Wolken. Oft wartete er auch auf sie. Und wenn sie da waren, dann las er in ihnen. Bücher zu lesen strengte ihn an, selbst die von Freunden wie Koethe. Ständig verhakte er sich im Dornengestrüpp dieser Sätze.
Die Wolken machten keine Scherereien. In ihnen las er leicht und mühelos.
Louise Seidler kam, als er gerade erst den Dreck von seinen Sohlen schabte. Ihr Gesicht war schön wie ein Entenei. Ihr Kleid aus weißem Wollmusselin, reinweißem Wollmusselin, bettete es weich, dieses Ei.
Friedrich führte sie ins Atelier. Er konnte sie nur dorthin führen. Nackt die graugrün gestrichenen Wände, nackt der Dielenboden. Ein ausgeweideter Leichnam, lästerten manche. Kein Sitzmöbel, nichts außer seinem alten harten Stuhl, seiner Staffelei und dem kleinen Tisch mit dem Nötigsten: Pinsel, Palette, ein paar Tuben. Malkasten, Terpentin, Leinwände, Lappen, Firnis, all das war ins Nebenzimmer verbannt.
Die Seidler kam aus einem Maimittag. Sah zuerst einmal nichts, denn hier drin war es dämmrig. Hätte er die Holzläden an dem rechten der beiden Fenster geöffnet oder die Verschalung abgenommen, die am linken Fenster das untere Drittel verschloss, es wäre taghell gewesen. Dann hätte das Licht jedoch doppelte Schatten auf die Leinwand geworfen. Das musste er einer Malerin wie der Seidler nicht erklären. Aber dass ihr Kleid ihm Angst machte, das musste er ihr erklären. Bei ihm lauerten überall Fleckenmacher aus Ruß, Rost, Pech zum Abdichten oder Leinöl. Louise Seidler lachte, als er das sagte. Ihr Lachen wischte seine Angst weg. Nur kam unter dieser Angst die andere zum Vorschein: ihr nichts anbieten zu können. Doch, ein Glas Milch oder einen Schlehensaft, auch ein Solei, eine Salzgurke oder einen Rettich, aber nichts von dem, was eine junge und schöne Frau gewohnt war, die bei Goethe ein und aus ging.
Ja, der Geheimrat, sagte sie, der hat auch Personal. Einen Kammerdiener, zwei Köchinnen, einen Kutscher, ein Hausmädchen und ein Garderobenmädchen, einen Bedienten, einen Laufburschen. Außerdem einen Schreiber.
Aber er kann doch selbst schreiben, sagte Friedrich.
Sie lächelte. Bei Goethe zu arbeiten sei eine Ehre. Da rissen sich die Leute drum. Brächte viel fürs Ansehen. Also für die nächste Anstellung.