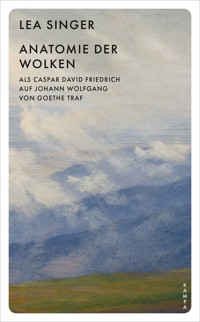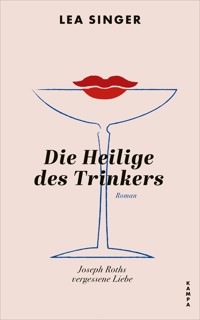
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 30. Mai 1939 wurde er beerdigt - der bankrotte Schriftsteller, der sieben Jahre zuvor zu den bestbezahlten Journalisten Deutschlands gehört hatte: Joseph Roth. Viele waren gekommen. Aber nur eine wurde von Weinkrämpfen geschüttelt: Andrea Manga Bell, verheiratet mit dem designierten König des Duala-Volkes in Kamerun, Mutter zweier Kinder, gelernte Grafikerin, Hanseatin mit sehr dunkler Haut. Sie war Roths große Liebe, sein erotisches Ideal, Struktur seines Daseins, geistige Inspiration und unbezahlte Sekretärin. Die Schönheit aus gebildetem bürgerlichen Hause zog mit dem bald hoch verschuldeten Roth, den sie zugleich hässlich und unwiderstehlich fand, von Hotel zu Hotel. Konnte sie den Heimatlosen davor bewahren, seine Ängste und Zweifel in Alkohol zu ertränken? War sie, die nirgendwo- und überallhin gehörte, ihm eine Heimat? Die Geschichte dieser Liebe begann 1929 in einer Villa bei Berlin, als Joseph Roth sich in die gescheite Frau im quittengelben Badeanzug vernarrte und sie sich in ihn, den blauäugigen Schicksalserfinder mit den absurd schmalen Offiziershosen, den Juden aus einer Kleinstadt am äußersten Rand des österreichisch-ungarischen Reichs. Er war zärtlich und krankhaft eifersüchtig, wahrhaftig und verlogen, vergötterte und verleumdete sie. Und konnte ohne sie nicht leben. Diese Geschichte wurde noch nie erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lea Singer
Die Heilige des Trinkers
Roman
Kampa
1
Die Erdbeeren schwitzten. Ihre Oberfläche schimmerte schmierig feucht, und ihr helles Rot hatte sich bordeauxrot verfärbt. Schon um elf Uhr vormittags war es gewitterschwül gewesen bei dreißig Grad. Die Kellner schlichen über die fast leeren Caféterrassen, die frischen Topfblumen vor den Ladeflächen der Lieferwagen welkten, die Bettler bettelten nicht, die Erdnusshändler schrien nicht, die Hausfrauen schlurften schweigend nach Hause und die Buchverkäufer an der Seine schliefen auf ihren Klappstühlen. Ein Frühlingstag in Paris, der vorletzte Tag im Mai, an dem nichts war wie an einem Frühlingstag im Mai in Paris.
Als A. an diesem Dienstagnachmittag kurz nach zwei zur Metro hinabtauchte, den Spankorb mit den Erdbeeren in der linken Hand, dankbar für die Kühle, taumelte sie im Dunkel kurz.
Bin ich denn schon tot, dass ich unter die Erde muss?, hatte ihre Schwiegermutter sie gefragt, als A. ihr die Metro zeigen wollte, für die Schwiegermutter etwas Fremdes. Sie hatte sich geweigert, nur eine Stufe abwärtszugehen. Vierzig war die damals gewesen, klein und ehrfurchtgebietend. A. war jetzt siebenunddreißig und auf dem Weg zum Friedhof weit draußen in Thiais, kurz vor Orly. Auf dem Plan sah die Linie 7 aus wie ein gerader Strich Richtung Süden, als ginge es von dort schnurstracks weiter bis Marseille. Endstation, sagte die Frau von der Metro, fahren Sie einfach bis zur Endstation an der Porte d’Ivry. Von dort sind es mit der Straßenbahn und dann zu Fuß noch fünfzig Minuten. Nehmen Sie etwas mit für den Sitz, Arbeiterviertel, Sie wissen schon.
Endstation. Er hatte es mit diesem Zucken in den Mundwinkeln gesagt, dass er an einer Endstation zur Welt gekommen und aufgewachsen war, der letzten Station des Habsburger Reiches vor der russischen Grenze, ein Abseits. Vielleicht gefiel ihm das, weil er in der Mitte der Mitte Europas gelandet war, selbst Mittelpunkt einer Kopfelite, die sich um ihn drängte.
Hier draußen, wo die Banlieues an Felder grenzten, hätte die Luft leichter sein müssen. Sie drückte genauso wie in der Stadtmitte. Zwei Eingangstore in der Friedhofsmauer, nah beieinander, gleich streng, gleich grau. Sie nahm das rechte. Es war das falsche.
Am linken saß der Aufseher. Rodd, Schoseff, Rodd, wiederholte er und fuhr mit dem Finger seine Liste abwärts. Division 7.
Jüdische Abteilung?, fragte A.
Nein, katholische.
Sein Telefon klingelte. Warten Sie, ich habe eine Kundin, sagte er und legte den Hörer auf den Tisch. Kundin – färbte der Tod auf einen ab, wenn der Tote mit einem verwachsen war?
Geradeaus, sogar lang geradeaus, mindestens zehn Minuten, dann die siebte links, die erste rechts, dann wieder links, am Ende liegt es, ein Reihengrab, daneben ist alles noch leer.
Klang wie ein Angebot. An die Kundin.
Der Aufseher schielte auf den Erdbeerkorb, sagte aber nichts.
Sie wusste, dass der Cimetière de Thiais der zweitgrößte Friedhof war, den Paris verwaltete, und der jüngste, erst zehn Jahre alt, dass er an freies Land grenzte, also bisher nur ein Stück ummauerte Natur war. A. hielt die Hand über die Augen. Vor ihr gähnte eine Einöde aus Stein, bewohnt von ein paar weinenden Madonnen, Engeln, Christussen an weißen Kreuzen, grün war kaum etwas. Nur Grasnarben hatten Chancen zwischen den Grabplatten; doch entlang des Hauptwegs, eher eine Hauptstraße, standen Kastanien. Ihn hätte das an die Alleen im Prater erinnert. Je näher sie dem Grab kam, umso trostloser wurde es. Unkraut wucherte über die freien Plätze, auf den wenigen Gräbern dorrten alte Kränze vor sich hin, die getretenen Wege waren rissig. A. war früh dran. A., so hatte Joseph sie in seinen Notizbüchern oder Tagesnotizen genannt. In seinen Briefen war sie Frau Manga Bell, selbst wenn die Briefe an Freunde gerichtet waren, die sie gut kannten. Seine Ehefrau, die vor mehr als zehn Jahren lebend aus seinem Dasein verschwunden war und die kurze Liebe, eher eine Affäre, direkt danach, wurden immer bei ihren Vornamen genannt, Friedl und Sybil, nur sie nicht, dabei war er mit keiner Frau länger und enger zusammen gewesen, von der Mutter abgesehen.
Dort, wo die frisch ausgehobene Erde dampfte, standen nur ein paar junge Männer in weißen Reithosen, hohen Stiefeln, mit Tellermützen, strammen Jacken, die blanken Degen an der Seite, schräg über der Brust die schwarz-gelbe Schärpe. Ihre Gesichter waren eingefroren, trotz der dreißig Grad. Sie nahmen A. nicht wahr, eine, die so aussah wie sie, hatte nichts zu suchen am Grab eines Monarchisten. A. ging ein paar Meter weiter, als gehörte sie nicht dazu.
War die Eisenbahnüberführung, die das Gelände hier hinten durchschnitt, gebaut worden, bevor es Friedhof wurde oder erst danach? Ein Friedhof, auf dem auch Juden und Muslime bestattet wurden, brauchte keine Rücksichtnahme; es hieß, dort sollten sogar Clochards und andere namenlose Tote einen Platz finden.
Irgendeine Glocke schepperte vier Uhr, kurz danach hörte A. die anderen kommen. Offenbar hatten sie sich vor dem Eingangstor getroffen, der innerste Kreis jedenfalls, aber zu dem gehörte sie seit bald drei Jahren nicht mehr. Wer hatte den Sarg hier herausschaffen lassen? Von keinem der Intimen, die sich Taxis so weit hinaus leisten konnten oder Autos besaßen, war sie gefragt worden: Können wir Sie mitnehmen?
Vorneweg gingen zwei katholische Geistliche, vermutlich die beiden, die ihn seit Jahren hatten taufen wollen, einer, das wusste sie, war konvertierter Jude. Direkt dahinter schleppte sich Frau Zweig trauerschwer, als wäre sie die Witwe, rechts und links von ihr Josephs Nachbarn auf der Etage, Soma Morgenstern und Stefan Fischbein, der sich Fingal nannte, beide Juden. Mit Soma hatte A. im Deux Magots Witze gerissen über Josephs Besuche in der katholischen Sonntagsmesse. Wann er zurückkommt? Wenn der Messwein ausgetrunken ist. Friderike Zweig war übergetreten und wie Konvertierte oft katholischer als die echten Katholiken. Sie hatte offenbar über Soma und Fingal gesiegt. Hatte sie mehr gezahlt für die Beerdigung? Viel konnte es nicht gewesen sein, Thiais, das hatte A. vom Milchmann erfahren, war der billigste aller Friedhöfe. Wenig, das wusste sie aus eigener Erfahrung war für einen, der wie Fingal von der Hand in den Mund lebte, auch noch zu viel.
Von ihrem Platz aus konnte A. nur erahnen, wie viele hinter dem Sarg herschlichen, ein schwarzes Reptil, dessen Schwanz sich noch irgendwo in der Allee bewegte. Es wurde Zeit, näher ans Grab zu gehen, die Plätze mit guter Sicht waren begehrt. Soma hatte A. erspäht und zog sie ganz nach vorn, zwischen eine große dünne und eine kleine stämmige Frau.
Der Sarg war aus hellem Holz, golden verziert. Arg kurz kam er A. vor, wie für einen Halbwüchsigen, so klein war Joseph doch nicht gewesen. Beide Geistliche standen im weißen Messgewand am Rand der Grube, einer spritzte Weihwasser auf den Sarg. Wie ging es weiter? Als Protestantin kannte A. die katholischen Riten nicht. Ganz hinten erhob sich ein Jammern, jiddisches Jammern, es kam von dort, wo einige Männer mit Kippas oder Hüten und langen Bärten standen und andere, die nicht wollten, dass man ihnen die Zwangsvornamen Sara oder Israel im deutschen Pass ansah. Der andere im weißen Messgewand fing an, ein Gebet zu sprechen mit der künstlich hohen Stimme, die Fremdenführer sich angewöhnen, um durchzudringen. A. hörte, wie hinten einige nach einem Rebbe riefen. Es war kein Rabbiner da, der dem Geistlichen ins Wort gefallen wäre, aber es gab die Eisenbahn. Ein Güterzug ratterte dröhnend und pfeifend vorüber, der Mund des Geistlichen bewegte sich lautlos und der Zug ratterte dröhnend und pfeifend weiter; bis der letzte Wagen verhallt war, hatte der Geistliche den Mund wieder zugemacht.
Reden haben sie verboten, unverschämt, zischte ein Besucher neben A., der ein Monokel trug, machte einen Schritt auf Friderike Zweig zu und überreichte ihr einen Kranz mit schwarz-gelber Schleife. Otto stand drauf. Dann nahm er die Schaufel, hielt sie so hoch wie möglich und ließ eine Scholle auf dem Sarg bersten. Dem treuen Kämpfer der Monarchie im Namen seiner Majestät, Otto von Österreich, deklamierte er. Die mit den eingefrorenen Gesichtern traten im Gleichschritt an den Rand der Grube, salutierten, sagten dasselbe wie der mit dem Monokel und platzierten rechts, weit rechts einen wagenradgroßen Kranz mit schwarz-gelber Schleife. A.s Blick fiel auf die drei, nein, vier in Straßenanzügen mit Wut auf den Stirnen, den Dunkelgelockten kannte sie, viele kannten ihn, Egon Erwin Kisch war als Reporter ein Star und als Kommunist international aktiv. Er drängte sich vor und schrie: Im Namen deiner Kollegen vom Schutzverband deutscher Schriftsteller. Knallte seine Scholle auf den Sarg und schmiss einen Strauß roter Nelken hinterher.
Verlegen schwiegen jetzt alle, ein paar Männer mit Hut oder Kippa nutzten die Chance, schlängelten sich durch bis zum Grab und fingen an, flüsternd zu beten, während sich die Monarchisten und Kommunisten über das Grab hinweg anstarrten, feindliche Fronten und zwischendrin in ewigem Frieden der Tote.
Die große Dünne neben A. kicherte, die kleine Stämmige schwieg. A. wankte, als bebe die Erde. Endstation, sagte sie, Endstation, Liebster, warf den Korb mit den Erdbeeren in die Grube und verlor das Gleichgewicht. Die beiden Frauen umklammerten ihre Oberarme. Wir bringen sie besser nach hinten, sagte Soma Morgenstern.
Da stand sie allein, sah nicht mehr zu, wer was ins Grab warf, und ließ endlich alle an sich vorbeiziehen, die Menschen in Kutten und in teils speckig gewordenem schwarzem Festtagsgewand, die in Soutanen, die mit Orden an der Brust und die im Kostüm mit Mottenkugelgeruch, die mit Schläfenlocken und die mit rasiertem Nacken, die Gebeugten und die Stolzierenden, die Schluchzenden und die Zufriedenen. Ihm hätte das hier gefallen, sagte einer laut, genauso hätte er sich’s vorgestellt, nur den Radetzkymarsch hätte er noch spielen lassen.
Es war eine abgelebte Welt, die an ihr vorüberzog, lauter Leute, die schon gestorben waren und es selbst noch nicht wussten. Viele Gesichter kamen ihr vertraut vor, im Café Le Tournon, wo sie bis vor wenigen Tagen alle von Mitternacht bis drei oder fünf Uhr morgens an Josephs Tisch gesessen hatten, wären ihr auch die Namen eingefallen, hier war es, wie wenn man den Kellner im Pullover beim Friseur trifft oder den Friseur beim Zahnarzt. Sie wusste nicht mehr, wer wie hieß. Der, dessen Kopf ohne Hals auf den Schultern saß, ein Kopf mit Kaltwasseraugen, den kannte sie auch, ein Zuckerlfabrikant aus Wien und einer der ganz wenigen, mit denen Joseph sich geduzt hatte, ein Typ, den die meisten in der Runde nicht ausstehen konnten, er hatte Mussolini jahrelang hohe Summen zugeschustert; auch sein Name fehlte ihr. Neben ihm ging Soma, die beiden blieben genau vor ihr stehen, so als existiere sie überhaupt nicht.
Natürlich hat sich zwischen uns nichts geändert, Dr. Morgenstern, sagte der Zuckerlfabrikant.
Warum sollte sich zwischen uns was ändern, Herr Heller?, fragte Soma.
Heller faltete die Hände vor dem Bauch, ließ die Daumen kreisen, räusperte sich lange. Das sage ich Ihnen ein anderes Mal.
Warum nicht jetzt?
Gut … Also, ich habe unserem Verblichenen seit einem Jahr jeden Monat einen Betrag für Sie zukommen lassen, er hatte mich angefleht: Wir müssen dafür sorgen, dass Morgenstern in Paris bleiben kann. Wenn Sie, lieber Dr. Morgenstern, das nicht peinlich finden, soll der Betrag ab jetzt direkt …
Ein Betrag für mich? Ihm haben Sie Geld für mich gegeben? Ihm?
Somas Gelächter kannte kein Halten. Der Zuckerlfabrikant verstand es offenbar, nach einer Schrecksekunde lachte auch er. Untergehakt gingen Soma und er Richtung Ausgang.
Nur einer sprach A. an, der mit dem Otto-Kranz.
Bei Ihnen in Afrika kennt man doch keine Erdbeeren. War das ein kommunistischer Gruß, gnädige Frau?
Ich komme aus Hamburg, sagte sie, und gehöre keiner Partei an.
Und die Erdbeeren?
Das verstehen Sie nicht.
Bis zum Pfingstsamstag morgens kurz vor sechs hatten für Joseph Roth Erdbeeren Glück bedeutet, seit seiner Kindheit war das so, ein Glück, das nichts kostete, man musste sich nur danach bücken. Er hatte sich die letzten dreißig Jahre nicht mehr nach den Erdbeeren gebückt und die letzten zehn, seit A. ihm begegnet war, keine mehr gegessen. Waren neun Jahre oder nur acht vergangen, seit er sie in das Geheimnis seiner Erdbeeren eingeweiht hatte und was er damit vorhatte? A. machte kehrt. Nur noch die Totengräber waren da. Alle waren sie abgezogen, die zeigen wollten: Der dort unten gehört uns. Für die Monarchisten hatte er den Plan ausgeheckt, den jungen Otto von Habsburg in einem Sarg nach Wien zu transportieren, ihn dort auszupacken und dann zum Kaiser auszurufen. Für die Katholiken hatte er gelernt zu beichten, eine Oblate auf der Zunge zergehen zu lassen und Luther als das Übel der Welt zu geißeln. Von den Kommunisten hatte er sich verabschiedet, aber mit einem wie Kisch Nächte in Ostende durchzecht, von ihm hatte er sich eine neue Geliebte ins Bett legen lassen. Mit den Juden teilte er seine Kindheit und ihnen hatte er seine Sprache gewidmet; weil er nicht jiddisch schrieb, hatte er alles Gojische aus seinem Deutsch verbannt, alles Geschwollene und Gekünstelte, für die Juden hatte er seinen Hiob erzählt und die Geschichte von den Juden auf Wanderschaft. Wie oft hatte er, vor allem wenn es ihm dreckig ging, erklärt, sofort wolle er getauft werden, aber nur dann, wenn kein Geistlicher in der Nähe war. Er hatte A. jiddische Lieder beigebracht und selbst am liebsten gesungen: Wir sind vom k. und k. Infanterie-Regiment Hoch- und Deutschmeister Numero vier.
A. hörte das Schrappen der Schaufeln im lehmigen Boden, und zwischendrin hörte sie etwas anderes, sie musste die Ohren spitzen, um es zu hören. Es war sein Lachen, laut war es nie gewesen, und hell war es darin auch nie so richtig geworden, es war ein Lachen, das keiner genau beschreiben konnte und keiner nachmachen. Und jetzt lachte er. Er gehörte nirgendwohin und niemandem, nicht einmal zu sich selbst hatte er gehört.
So langsam wie möglich zu gehen, wenn die Füße und Beine gesund sind und die Trostlosigkeit einen verjagt, ist keine leichte Übung. A. strengte sich an.
Es hatte sich gelohnt. Als sie aus dem Tor trat, war dort fast niemand mehr von den Trauergästen zu sehen. Nur Fingal, mit dem Rücken zum Tor, unterhielt sich mit der großen Dünnen.
Ich weiß schon, liebe Sybil, es war kein Vergnügen für eine Frau, mit Roth zu leben. Er quälte alle Frauen. Auch Sonja Rosenblum, das war die Litauerin, die mit Ihnen und Manga Bell am Grab stand. Zuletzt war es sie, die sich um ihn gekümmert hat.
Ich habe nicht mit ihm gelebt, sagte Sybil, ich habe nur den Schaum oben weggeschlürft. Wenn er sturzbetrunken etwas von mir wollte, habe ich gesagt: Du gehörst ins Bett, und zwar in deines.
Still ging A. an ihnen vorbei Richtung Haltestelle, froh, dass Fingal sie nicht bemerkte. Die möglichen Worte waren mit den Erdbeeren in die Grube gefallen. Als sie vor einem Schnapsausschank stehen blieb, um ihr feuchtes Gesicht abzuwischen, brüllte einer: Verbrennte sind doch solche Temperaturen gewöhnt. Die anderen grölten. Es waren die mit den blanken Degen.
Ein Auto bremste neben ihr, aus dem heruntergelassenen Fenster hinten schaute einer der wenigen, die sie jetzt aushalten würde. Landauer, sagte er, als könnte sie all die Nächte im Zigarettennebel mit ihm und Roth vergessen haben.
Dürfen wir Sie mit in die Stadt nehmen?
Walter Landauer war einer von drei Freunden, die frei von Gift waren, ganz frei. Vielleicht hatte er deswegen diesen Weltschmerzblick. A. stieg ein. Zu spät merkte sie, wer noch im Taxi saß. Was sollte das mit den Erdbeeren?, kam vom Beifahrersitz diese Stimme, aus der jeder Saft ausgepresst war. Hermann Kesten ist einer von denen, die sich auf die Gräber von anderen stellen, damit sie größer wirken, hatte Soma über Roths Lektor gelästert. Nun stand ein Grab mehr zur Verfügung, in dem einer lag, den Kesten zum Freund erklärte, der selbst aber in Kesten einen Feind gesehen hatte. A. sagte nichts, aber in ihr hüpfte Genugtuung. Der wusste also nichts von Roths großem Vorhaben mit den Erdbeeren und dem, was davon übrig war.
Von seiner anderen Seite stach die nächste Stimme in A.s dünne Haut.
Rot ist die Liebe, wie abgeschmackt und sentimental, erdbeerrot.
Lass sie, sagte Landauer.
Warum soll ich sie lassen? Roth hat nicht nach ihr verlangt, als es ans Sterben ging. So tief kann die Liebe nicht gewesen sein. Geliebt hat er nur seine Ehefrau, bedaure.
Hohenlohe, Max (von oder) zu Hohenlohe und Weißderteufelwas. Was hatte den auf den Friedhof getrieben?
Ich trug, sagte A. ins Schweigen hinein, einen roten Badeanzug, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Im August vor bald zehn Jahren.
Und dann sagte sie kein Wort mehr, bis sie sich an einer Metrostation absetzen ließ.
Erst als sie wieder auftauchte aus dem Untergrund, fiel ihr ein: Den roten Badeanzug hatte eine andere angehabt, ihr Badeanzug war gelb gewesen.
2
Durchs offene Fenster eines Fords, auf dem Weg hinaus aus der Stadt zu einem der Badeseen, konnte sie es an jeder größeren Kreuzung irgendwo lesen: REKLAME – DERSCHLÜSSELZUMWOHLSTANDDERWELT. Es stand auf Mauern, Schaufensterscheiben, Litfaßsäulen, Ladentüren. In ganz Berlin hatte der Weltreklamekongress 1929 seine Plakate geklebt. Der Ford war nicht ihrer, der Besitzer saß am Steuer. A. besaß nicht einmal ein Fahrrad und auch sonst nur das, was im Bücherregal und im Kleiderschrank der möblierten Zweizimmerwohnung Platz hatte. Ihr Geld verdiente sie mit Reklame, mit Weltreklame bei der Zeitschrift Gebrauchsgraphik. Ein Vorzeigeobjekt des Ullstein-Verlags, erschien nicht nur auf Deutsch in Berlin, auch auf Englisch in New York; russische und französische Avantgardekünstler, kühne Plakatentwürfe, die besten Typographen. Der Name des Verlags leuchtete nachts von den Dächern und Fassaden. Selbst Nichtleser kannten das Ullsteinhaus im Zeitungsviertel; wächst schneller als jedes Geschwür, sagten die weniger Erfolgreichen. Seit zwei Jahren war sie dort als Redakteurin angestellt, aber sie gehörte nicht dazu, Heimarbeit in den privaten Räumen des Textchefs. In einer Woche, am zweiten Augustsonntag, sollte der Kongress eröffnet werden, Bankett in den Marmorsälen, Bälle, Empfänge. Da waren andere eingeladen zu Sekt, Reden und kaltem Buffet.
Der Mann am Steuer interessierte sich nicht für ihre Arbeit, nur für ihre Beine, man trug die Kleider jetzt kurz, so kurz wie noch nie. Sie interessierte sich nicht für den Mann am Steuer, aber für einen Besuch bei Lotte Israel, die mit ihrem neuen Liebhaber ein Landhaus direkt am Stölpchensee gemietet hatte, nahe beim Wannsee. Eine Pfütze, sagten die Wannseeadler, die Villenbesitzer auf der Insel Schwanenwerder sprachen Stölpchensee gar nicht aus. Beim Namen Israel dachte jeder in Berlin an das größte Kaufhaus der Stadt, das war die Familie von Lottes Ehemann Felix. Er war Lampenfabrikant und hatte mit seinem Bruder Leo den Strom in der Stadt installiert. Lotte hatte alles aufgegeben, was seit der Hochzeit mit Felix ihr Alltag war, die Beletage in Charlottenburg, zehn Zimmer mit Personal, die Villa in Potsdam mit Personal, ihren offenen Mercedes Sport in Cremeweiß, die Wochenenden mit Jagdausflügen rund ums eigene Schloss, aufgegeben für diesen Schriftsteller. Dass sie ihren Mann schon oft betrogen hatte, war stadtbekannt, jetzt aber zum ersten Mal mit einem, der in einem Gartenhaus zur Miete wohnte, vor ein paar Jahren noch irgendwo in Bayern im Knast gesessen hatte und als Theaterautor mit dem Zusatz revolutionär oder spektakulär gehandelt wurde, Buhkonzerte und Prügeleien waren bei den Uraufführungen inbegriffen. A. kannte den neuen Liebhaber und verstand Lotte. Dieser Ernst Toller war der einzige schöne Mann in der ganzen Literatenszene, ein schmales Hemd, in der Sommerfrische noch kerkerblass, aber diese Augen … Nur dass Lotte sogar die eigene Tochter für ihn aufgegeben hatte, noch keine neun, das verstand A. nicht.
Volksbelustigung, sagte der Mann am Steuer, sie bieten beim Weltreklamekongress irgendwo bei den Messehallen am Funkturm auch Volksbelustigung an. Wissen Sie, was die da machen?
Er sah sie von der Seite an, sie blickte aus dem Fenster. Als A. ein Kind war, hatte es daheim in Hamburg im Tierpark Hagenbeck auch Volksbelustigung gegeben, wenig Eintritt, viel Vergnügen, hieß es. Völkerschauen nannte sich das. Wurden Völker aus Afrika gezeigt, mussten sie so gut wie nackt auftreten. Als sie sieben war, hatte sich der Kaiser zu einem Besuch ansagt. Danach war ein Klassenausflug dorthin Pflicht. Sie war die Einzige, die nicht dabei war, ihre Mutter hatte Nein gesagt, ohne einen Entschuldigungsbrief zu schreiben.
Ich glaube, dort wird getanzt, Charleston, Shimmy und so, sagte A. Sie zeigte nach rechts. Da, sehen Sie.
Am Bahnhof Zoo leuchtete ein Plakat in Schwarz, Weiß und Rot. Zwei Tänzer drauf, zwischen ihnen ein Grammophon am Boden, Hände und Füße verdreht, ganz klar beim Charleston; die beiden waren nur bis zur Hüfte zu sehen, er in Nadelstreifenhosen, seine Hände schwarz, ihre Hände und Beine weiß. Weltreklame kannte keine Grenzen.
Wo sind Sie eigentlich her?, fragte der Mann am Steuer.
Aus Hamburg.
Ich meine ursprünglich.
Ich bin dort geboren.
Und Ihre Mutter?
Ist Friesin hugenottischer Herkunft.
Er fuhr auf einmal schneller, dabei hatte er ihr gesagt, er habe keine Lust zu schwimmen, schon gar nicht im Stölpchensee mit seinen vielen Algen.
Das Haus konnte kaum atmen unter seinem Efeubewuchs. Lotte stand nicht allein am Eingang, ihre Freundin Marita Hasenlever war bei ihr, deren Bruder, ebenfalls Schriftsteller, war ein Freund von Lottes Liebhaber.
Der Fordbesitzer wurde mit seiner himbeerroten Berliner Weiße auf die Terrasse verbannt, Lotte verteilte im Schlafzimmer Badeanzüge, beste Wolle; sie selbst war blond und blauäugig, nahm sich den blauen, Marita hielt sie den roten hin. Blieb der quittengelbe für A. Macht uns zu blass, sagte Lotte. A. zog sich hinter dem Wandschirm um, als sie wieder hervorkam, tuschelten die beiden anderen. Es war diese Art Tuscheln, bei dem sich in A. jedes Mal Misstrauen regte; Lotte wusste, dass A. zwei Kinder hatte, Marita wusste es also auch. Im letzten Winter, es war nasskalt, und A.s Mantel, Erbstück ihres immer frierenden Vaters, war dick und zu groß, da hatte einer sie am U-Bahn-Eingang angequatscht. Wir wär’s mit uns, Hottentotten-Venus? War klar, was das meinte: breites Becken, hängende Brüste. Dass sie kinderschmal war um die Hüften, konnten Lotte und Marita jetzt sehen, den Zustand ihrer Brüste nicht, teurer Badeanzug mit BH-Einlage. Wortlos griff sich A. einen der Bademäntel, rannte blind durch den Garten zum Wasser, tauchte ab.
Der Stölpchensee hatte wirklich zu viele Algen. A. zitterte, als sie aus dem Wasser stieg, zog sich den Frotteemantel an, den sie auf die Treppe geworfen hatte, und sah diesen Mann am Gartentisch hocken, neben einer großen Flasche und einem kleinen Glas. Wo kam der auf einmal her? Er war vollständig angezogen, Jackett und Hemd mit Schlips. A. blieb stehen, hörte die beiden anderen aus dem Wasser rauschen, A. zitterte noch immer, spürte plötzlich Lottes Hände, die sie rubbelten, ihr wurde warm. So hatte ihre Mutter sie gerubbelt, wenn sie aus der Badewanne stieg und im ungeheizten Bad bibberte. Lotte rubbelte weiter. Als A. anfing zu schnurren, riss sie ihr mit einem Ruck den Frotteemantel herunter und den Badeanzug. Schwer und nass klatschte er zu Boden.
Der Mann neben der Flasche lächelte sie an. Sie, nicht ihre Brüste. Seine Augen waren blau, nicht groß, seine Haare waren Babyhaare, dünn und blond, seine Lippen kirschrot.
Haben Sie nicht den Eindruck, gnädige Frau, dass die anderen Damen vergebens den Bauch einziehen?
Wie langsam er sprach, schleppend fast. Dann stand er auf und ging zum Haus hinauf, seinen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen, ein Mantel Anfang August, hatte er über die Schulter geworfen und hielt ihn wohl mit einem Finger im Aufhänger fest. Er ging langsam, so hatte sie einen Bekannten auf der Beerdigung seiner Frau gehen sehen, zu jung gestorben. A. ging auf einmal ebenfalls langsam. Als sie oben anlangte, posierte Lotte bei diesem Mann auf der Terrasse. Tut mir leid, sagte er leise, dass ich schon aufbreche, ich muss ein reiches Mädchen treffen, ich werde wegheiraten. Er gab Lotte einen Handkuss, dann fiel die Haustür ins Schloss. A. glotzte auf den See, die anderen drei sahen ihr beim Glotzen zu. Toller kam, sprang mit nichts als seiner Brille bekleidet ins Wasser, A. schwieg vor sich hin. Als das Telefon klingelte, rannte Lotte hinein, platzte, als sie zurückkam. Das ging aber schnell. Ist wohl nichts geworden mit der neuen Braut. Roth will dich unbedingt sofort sprechen.
Wer will mich sprechen?
Roth, Joseph Roth, kennst du ihn nicht? Kennt doch jeder von uns.
Das Telefon hing im Dunkel der Diele.
A. verstand ihn nur schwer, Geschirrklappern, Menschenlärm, und er klang wie einer, der im Bett lag, den Mund unter der Decke. Können Sie nachher noch zu Mampe kommen?
Lotte, Marita und der Mann mit dem Ford füllten den Türrahmen.
Ich … ich komme bei Gelegenheit vorbei, sagte A. und legte auf. Sechs Augen auf ihr.
Wie … wie kann er schon wieder in Berlin sein?
Taxi, natürlich, sagte Lotte. Was das kostet, ist ihm egal. Der kriegt von den Zeitungen eine Mark pro Zeile.
Auf den ersten Kilometern hielt der Fordbesitzer das Lenkrad umklammert, als könnte es jeden Moment fliehen. Also, ich soll Sie bei Mampe absetzen? A. nickte. Sehr freundlich, sagte er, auffallend nett von Ihnen. Dabei haben Sie anscheinend noch gar nichts von ihm gelesen. Ich habe die Berliner Zeitung abonniert, da ist er Kolumnist.
Und?
Keine Ahnung, was bei seinen Berichten stimmt und was erfunden ist. Einmal ging’s mir zu weit. Mitten im Weihnachtsfrieden erschien dort sein Text Der blonde Neger Guilleaume, das stand obendrüber, man glaubt es nicht. Angeblich hat er den im Zug getroffen. Veilchenblaue Augen, erstklassiges Deutsch, Goethekenner. Eine Zumutung. Und dieser Roth gilt als Starjournalist. Ich habe sofort einen Leserbrief … Egal, also, Sie wollen ihn bei Mampe treffen.
Jeder kannte Mampes gute Stube am Ku’damm, ein Platz zum Anmachen und Versumpfen, viele kleine Kabinette mit Kachelöfen, mit alten Stichen und Fayencen, die kein Mensch ansah, Holztäfelung, schummriges Licht, Ledersessel, Erbsensuppe, Eisbein auf Sauerkraut, alles billig, niemals Kopfwehweine, Weinbrände, Liköre aus Mampes eigener Produktion. Und Magenbitter.
Ich habe ja gar keine Lust, sagte A. und sah, wie die Hände am Lenkrad lockerließen, seine Stimme klang noch immer nach Verhör.
Was ich Sie auf der Hinfahrt vergessen habe zu fragen, Ihr Vater …
Mein Vater? Ist tot, als er starb, da war ich erst fünfzehn. Aber das wollen Sie nicht wissen: Er hat in Leipzig Klavier studiert, war Schüler von Liszt, erfolgreich im Klaviertrio mit Vater und Bruder, hat Wagner vorgespielt in einem Bayreuther Gasthaus. Später war er Leiter eines Konservatoriums in Hamburg.
Aber ich meine, verstehen Sie …
José Manuel Jiménez. Als er jung war, nannten sie ihn Ebony Liszt.
Deswegen. Der Fahrer atmete durch.
Am Ku’damm bremste er gegenüber von Mampe. Auf der anderen Straßenseite, den Mantel über der Schulter, wartete bereits Roth. Er rannte nicht, machte nur kleine Schritte, war aber blitzschnell am Auto.
A. ging an diesem 6. August allein ins Bett, nüchterner als gedacht.
Der Fordbesitzer hatte, bevor sie ausstieg, noch in ihr Haar fassen dürfen, sein Wunsch, und hatte gefragt, wie sie es doch halbwegs glatt und weich kriege; um es zu bügeln, wie manche Jüdinnen in seinem Bekanntenkreis, sei es doch zu kurz.
Roth hatte weder ihre Telefonnummer noch ihre Adresse bekommen. Vermutlich war Lotte undicht gewesen. Er rief sie in der Privatwohnung von Franz Blei an, dem Textchef der Gebrauchsgraphik, Arbeitsbeginn frühestens drei Uhr nachmittags, wenn Blei den Rausch des letzten Abends ausgeschlafen hatte. A. ließ sich verleugnen. Versuchte er, sie bei Mampe zu erreichen, sagte sie dem Kellner jedes Mal: Ich bin nicht da.
Roths Blick, als sie aus dem Wasser kam und dann nackt vor ihm stand: War er spöttisch, freundlich, mitleidig, alles zusammen oder etwas ganz anderes gewesen? Zwei Wochen waren seither vergangen, an den Blick erinnerte sie sich noch immer.
Als er A. zu Hause erwischte, sagte sie: Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Erst dann fiel ihr ein, dass es Sonntag war.
Wovor floh sie? Dass sie vor einem Rendezvous zurückschreckte, war neu. Angst hatte sie immer nur vor etwas Ausweglosem gehabt.
Am Montag begab sie sich auf die Suche nach Roth. In der nächsten Buchhandlung war das Fenster voll mit dreißig, vierzig Exemplaren desselben Buches, der erste Roman eines Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Man kannte sie dort, es wäre bestimmt aufgefallen, wenn sie, anstatt einfach einen Remarque einzupacken, nach irgendetwas von Roth gefragt hätte. Sie wusste nicht einmal, ob es von ihm etwas Gebundenes gab, der Fordbesitzer hatte von Kolumnen, journalistischen Essays und Reiseberichten erzählt.
Zur französischen Buchhandlung ging sie eine halbe Stunde, ja, es gab zwei Werke von Roth, die bereits übersetzt waren, der sei, wusste die Buchhändlerin, in Paris zu Hause.
A. war bereits auf den letzten Seiten seines Hôtel Savoy angekommen, als am Dienstboteneingang bei Mampe ein Strauß Rosen abgegeben wurde für Frau Manga Bell, gelbe Rosen mit einer Visitenkarte, Bütten, hatte etwas gekostet. Vorne unter seinem Namen zwei Adressen: Hotel am Zoo Berlin W 15 Kurfürstendamm 25 und Hotel Englischer Hof Frankfurt am Main gegenüber dem Hauptbahnhof. Offenbar schrieb er so viele Zeilen pro Monat, dass ein fester Wohnsitz im Hotel drin war. Hintendrauf stand irgendein Gruß. Eine derartige Handschrift hatte A. noch nie gesehen, grotesk klein, gestochen scharf und regelmäßig, jede Zeile dekorativ wie eine Borte. Lesbar war sie kaum. A. verglich die Buchstaben miteinander, um hinter das Geheimnis dieser Schrift zu kommen. Sie vergaß, dass sie nicht allein am Tisch saß. Der Bekannte gegenüber nannte sich Julius, hieß eigentlich Gyula, wollte ihr aus seinem neuen Theaterstück vorlesen, hatte ihre Buletten bezahlt und das kleine Bier dazu und angekündigt, er müsse danach pünktlich auf eine kommunistische Versammlung. Er wippte so heftig mit Füßen und Knien, dass ihre Sohlen es am Holzboden spürten. Endlich hatte sie raus, was Roth geschrieben hatte: Ich habe das Gefühl, dass Sie nicht gern angerufen werden. Wollen Sie nicht mal mich anrufen? Herzlich Ihr Joseph Roth.
Die Rezeption stellte durch. Seine Stimme sah anders aus als er, sie hatte breitere Schultern und einen dunklen Bartschatten. Und was war das für ein Deutsch? Er sprach wie gedruckt, aber es erinnerte sie etwas an ihren Freund Billie Wilder; der kam aus Galizien, Bahnhofsrestaurant in der Provinz, jüdische Familie, und war bis vor zehn Jahren in Wien zu Hause gewesen. War das irgendetwas, das man in Galizien sprach, Polnisch oder Ukrainisch, was bei Roth mitklang, oder war es Jiddisch oder Wienerisch? Nichts an ihm war eindeutig, so wenig, wie sein Blick es gewesen war. Gyula schwärmte ihr immer vor von den Kommunistentreffen. Zehntausend Leute und alle einer Meinung, großartig. Roth war das Gegenteil.
Aus der Konditorei in der Potsdamer Straße, Höhe Lützowstraße, drang Butter- und Vanilleduft auf die Straße. Kein Ort für Alkoholiker, die sich bei Mampe trafen. Er hatte den Ort bestimmt und auch den Tag, nachdem sie den 13. September vorgeschlagen hatte. Nein, Donnerstag, 12. September. Für einen 13. vereinbare er generell keine wichtigen Termine und schon gar nicht, wenn der ein Freitag sei.
Sie kamen einander vor der Tür entgegen. Er trug einen Hut mit zu breiter Krempe und einen Anzug mit Weste. Sein Dreiteiler passte, als wäre es ein Maßanzug, nur mit den Hosen stimmte etwas nicht, sie waren offenbar enger genäht worden, wurden unten extrem schmal und saßen stramm im Schuh.
Die Bedienung begrüßte ihn mit Namen. Lang waren Sie nicht mehr da. Dann warf sie A. einen Blick zu und fragte ihn: Ist Ihre Frau verreist?
Sie ist … in einem Sanatorium zur Kur, vermutlich noch für ein paar Monate.
A. stand auf. Roth ging um den Tisch herum, stellte sich hinter sie, legte eine Hand auf ihre Schulter und flüsterte ihr ins Ohr: Das ist anders, als Sie denken, bitte. Er schob ihr den Stuhl zurecht, sie setzte sich wieder hin.
Stumm tranken sie ihren Kaffee. Seine weinrote Fliege, Seide offenbar, war routiniert gebunden. Dass seine Augen etwas vorstanden, fiel ihr jetzt erst auf. Die weißen Manschetten seines Hemds ragten zu weit aus den Ärmeln, seine Hände, klein und dünn, waren fast genauso weiß. Ehering trug er keinen.
Sie trug seit acht Jahren keinen mehr, mit neunzehn hatte sie ihren Mann aufgegeben, keine Chance, dass er zurückkam, da gewesen war er nach der Hochzeit ohnehin nur ein Jahr.
Beim zweiten Kaffee zeigte die Wanduhr erst Viertel nach acht, so früh frühstückte sie nie, vor ein Uhr, zwei Uhr kam sie selten ins Bett. A. hatte behauptet, sie müsse spätestens um neun zur Arbeit antreten.
Spazieren gehen, schlug er vor. Zum Tiergarten war es zu Fuß nur eine Viertelstunde, er bestellte ein Taxi.
Warum sie Parks nicht ausstehen konnte, wusste A. selbst nicht. Vielleicht wegen der Vorschriften dort, was man nicht betreten und was man sonst noch alles nicht tun durfte. Oder weil die Natur hier sortiert wurde, das Sortieren von Lebendigem gefiel ihr nicht.
Für wie alt halten Sie mich?, fragte er im Gehen.
Sechsundfünfzig, sagte sie.
Er fragte nicht, warum, wortlos beobachtete er ihren Blick auf seine Beine, sie waren ungewöhnlich dünn, was die Hosen betonten.
Wie Skihosen, sagte sie.
Wie Leutnantshosen, sagte er. Ich war im Krieg Leutnant. Er ging einen halben Schritt hinter ihr. Dann, unvermittelt: Was haben Sie überhaupt für einen Gang, so ein protestantisches Mädchen wie Sie.
Sie blieb stehen und schob den Ärmel über der Uhr nach oben. Sie müsse jetzt zur Arbeit.
Als habe er das nicht gehört, fing er an zu erzählen, von seinen jungen Jahren in Wien.
Jung, wann war er jung gewesen?, überlegte A. Vielleicht nie.
Wissen Sie, dass mich die Liebe gelehrt hat, Gewalt über die Uhr zu gewinnen? Ich suchte die Zeit zu hintergehen und stahl ihr täglich ein paar Stunden. Um acht trafen wir uns. Um halb zehn schob ich den Zeiger um eine Stunde zurück. Wir hatten nur bis zehn Uhr Zeit, uns zu lieben. Meine Uhr zeigte zehn, als wir aufhörten. Aber es war halb eins, als ich zur Votivkirche kam. Ich konnte und konnte die Uhr nicht bezwingen. Nun kam mir ein Einfall. Er war einfach wie das Ei des Kolumbus. Ich begriff, dass die Stunde hohl ist. Ein Gefäß für das Geschehen. Und ich stopfte die Sekunden voll mit dem Glück meiner Liebe. Die Minuten mit der Überfülle meines Herzens. Und goss Ewigkeit in die Stunden. Sekunden, Minuten, Stunden sprangen, barsten, liefen über. Glockenschläge ertranken rettungslos im Meer meiner Liebe. Die Uhr ward machtlos. Ich hatte sie bezwungen. Man kann eine Stunde nicht gewinnen oder verlieren. Man kann ihr Sklave sein oder ihr Herr. Man bezwingt sie, indem man sie ausnützt, das heißt erfüllt.
Seine Worte tanzten auf dem Parkweg, leicht und anmutig. Er wirkte nicht wie einer, der gut tanzte.
Jetzt blieb A. stehen. Und wo ist Ihre Frau?
Weit weg, so weit weg, dass ich sie nicht mehr erreiche.
Das Stadtbad in Charlottenburg war am späten Vormittag fast leer, A. war erleichtert, dort niemanden zu treffen, der sie kannte. Roth hatte sie bis zur U-Bahn begleitet, sie am U-Bahn-Eingang mit Handkuss verabschiedet, sie musste jetzt die Zeit totschlagen, bis Blei aufgestanden war; nach Hause zu fahren, weit in den Süden der Stadt, lohnte sich nicht. Die Fliesen glänzten frisch geputzt, das Wasser war an die dreißig Grad warm und niedrig, sie ließ sich auf dem Rücken treiben. Der Chlorgeruch war für sie das Parfum der Freiheit. Der Badeanzug steckte meistens in ihrer Handtasche. Freigeschwommen hatte sie sich erst allmählich hier in Berlin; als sie vor vier Jahren angekommen war, hatte sie noch darum gekämpft, nicht unterzugehen, überstanden war der Kampf keineswegs. Dieser Rettungsring namens Franz Blei war alt, noch keine sechzig Jahre, wirkte jedoch wie achtzig, mürbe und brüchig von den Angriffen auf seine Wissbegierde seit Jahrzehnten; engen Geistern erschien sie schamlos grenzenlos, was für Blei Erotik war, hielten sie für Pornographie.
Dahindümpelnd beobachtete A. die Badegäste, die kurzbeinigen, die langbeinigen, die mit fallenden Schultern und die mit waagrechten; Roths Frau, wie sah sie aus, wo steckte sie? Weit weg, so weit weg, dass ich sie nicht mehr erreiche. Der Satz gluckerte um ihren Körper herum.
Der Ehemann von A. war in seine Heimat zurückgekehrt, ohne sie, räumlich war er sicher weiter weg als Roths Frau, in Kamerun gab es keine Kursanatorien. Innerlich befand er sich nicht nur auf einem anderen Kontinent, er befand sich auf einem anderen Stern, die Menschen lagen dort vor ihm auf dem Bauch. Alexandre 4. Prince de Douala et Bonanyo, designierter Thronfolger seines ermordeten Vaters. In diesem Juni war es zehn Jahre her gewesen, dass sie ihn geheiratet hatte, ohne große Feierlichkeiten, nur ein Essen bei ihr zu Hause mit Sekt vorneweg, direkt nach dem Standesamt mit den zwei Trauzeugen, ihrer Mutter, ihrem großen Bruder, ihrer älteren Schwester. Ihr Vater war damals schon zwei Jahre tot, seiner fast fünf. Ihrer war an der Spanischen Grippe gestorben, seinen hatten sie erhängt wegen Hochverrats. Seit 1918 war seine Heimat keine deutsche Schutzkolonie mehr, sein Vater wurde zum Helden ausgerufen, seine Hinrichtung als Verbrechen gebrandmarkt, der Vorwurf des Hochverrats als Lüge. A.s Vater hatte es nicht zum Helden geschafft. Sie war bei der Hochzeit siebzehn, ihr Mann einundzwanzig gewesen, beide Protestanten, protestantisch getraut. Hatte Roth das ausgekundschaftet oder gerochen? So ein protestantisches Mädchen wie Sie …
Sie lachte im Dahintreiben. Andere hier dachten nicht daran, dass eine Frau mit ihrem Aussehen protestantisch sein könnte. Was die beschäftigte, war A.s Haut, damit fing jeder an, der sie beschrieb, manchmal kam noch das Wort schön hinzu, zwischendrin ein gedachtes aber; die meisten hörten damit auch auf.
Roth hatte auf dem Weg bis zum U-Bahn-Eingang gefragt. Es war ein weiter Umweg geworden. Frage für Frage hatte er sich vorgetastet, behutsam, als wäre ihr Innenleben ein rohes Ei. Woher ihre Eltern kamen, hatte ihn nicht interessiert.
Ich bin verliebt, dachte sie, als sie am Ausgang des Stadtbads einen Kiesel aus ihrem Schuh fischte.
Was? Sie sprechen Deutsch? Der Mann mittleren Alters, dessen Blicke sie bereits durch die Vorhalle verfolgt hatten, streckte ihr seine Eintrittskarte zum Bad und einen Füllfederhalter entgegen. Ein Autogramm auf die Rückseite, wenn ich bitten darf. Ich habe Sie leider verpassen müssen Silvester fünfundzwanzig, ihre Tickets im Nelson-Theater waren schweineteuer, nichts für einen ohne Knete.
Ich glaube, Sie verwechseln mich.
Seine Mundwinkel landeten fast bei den Ohren.
Sie wusste, von wem er sprach. Es war ihr erstes Silvester in Berlin gewesen, das Gedränge vor dem Kartenschalter am Ku’damm war jedem aufgefallen, sie hatte die Kritiken hinterher gelesen, durchweg begeisterte Feuilletonisten bejubelten eine »Giraffe«, eine »Schlange«, einen »Affen«, auch »Halbaffen« oder »Urwaldgelichter«. Sie waren im Nelson-Theater gewesen, nicht im Zoo.
Wie kommen Sie darauf, dass ich das bin?, fragte A. Ihre Beine sind einen halben Meter länger, und auch sonst sehe ich ihr so ähnlich wie … wie Ihnen.
Was er stotterte, versuchte sie im Davonrennen abzuschütteln.
Es gab nur ein Merkmal, das sie mit Josephine Baker teilte.
3
Wer nicht Bescheid wusste, verstand nicht, wie es sich irgendjemand antun konnte, dort hineinzugehen. Draußen blendete die tief stehende Oktobersonne, dort war es wie immer düster im großen Saal, nur direkt an den Fenstern nicht. Es roch zu unangenehm, nach ungewaschener Unterwäsche und nach schalem Bier in den Gläsern, Alibi, um sitzen zu bleiben und nichts Neues zu bestellen. Diese hohen Säulen, diese vom Zigarettenrauch geschwärzten Dekorationen in einer falschen Romanik, diese Stühle, auf denen das Sitzen wehtat, der Fußboden, der frisch geschrubbt dreckig aussah, und direkt gegenüber der Drehtür eine Theke, bei der knurrende Mägen zu knurren aufhörten. Ein Bahnhofswartesaal konnte nicht trostloser sein, der Kaffee schmeckte sauer, Kuchen, Würste und Gebäck schienen aus Sägemehl zu bestehen. Trotzdem war das Romanische Café am Kurfürstendamm immer voll besetzt. Frauen, jung, zu jung, teils Gymnasiastinnen oder Berufsanfängerinnen, waren unverzichtbar für diejenigen, die sich hier das Kokain der Anbetung hereinzogen. A. fühlte sich nur auf der Terrasse wohl. Das Wesentliche aber spielte sich im Inneren ab, in dem kleineren der beiden Säle gleich links vom Eingang mit nur rund zwanzig kleinen Marmortischen, nicht in dem mehr als doppelt so großen. Bassin für Schwimmer hieß er und wurde beleuchtet, Bassin für Nichtschwimmer hieß der düstere große. Die Schwimmer hatten es irgendwie geschafft, sich mit ihrer Kunst über Wasser zu halten, hatten einen Verlag oder einen Galeristen gefunden, einen Vertrag in der Tasche mit einer der zahllosen Zeitungen oder einem der Theater, oder sie arbeiteten draußen in Babelsberg beim Film. Die Toiletten lagen so, dass die Schwimmer das Bassin der Nichtschwimmer, die meisten vom Absaufen bedroht, durchqueren mussten. Das war die Gelegenheit, jemanden anzugehen. Falls Sie zufällig … hier meine Visitenkarte. Es konnte auch ein Porträtfoto, sein oder, schwer loszuwerden, ein unveröffentlichtes Manuskript. A. hockte oft mit Billie Wilder im Nichtschwimmerbassin zusammen, er gehörte zu den halb verhungerten Schreibern, denen sie bei der Gebrauchsgraphik Aufträge zuschanzte. Hier im Romanischen war die Idee zu einem Film entstanden, Drehbuch Billie und Kurt Siodmak, Regie Kurts Bruder Robert. Jetzt wurde gedreht, viel Zoff, kein Geld; ein Taxifahrer spielte einen Taxifahrer, eine Plattenverkäuferin eine Plattenverkäuferin, ein Weinhändler einen Weinhändler, alles Berliner Milieu.
Wird gut, sagte Billie, da richtig hinzuschauen habe ich von Roths Feuilletons gelernt, der ist ein Genie.
Lob für jemand anderen war im Romanischen seltener als Trinkgeld für die Toilettenwärter.
A.s Blick erstarrte.
Hoppla, du kennst ihn, sagte Billie. Intim?
Das Café war ein Brutkasten, und nichts brütete es rascher aus als Klatsch und Gerüchte. A. tauchte nie mit einem festen Begleiter auf, sie bemühte sich um keinen; eine Frau von Ende zwanzig, die ihre zwei kleinen Kinder in Hamburg bei ihrer Mutter abgestellt hatte, aber ernähren musste, war keine, die man sich in Künstlerkreisen ans Bein hängte, für ein paar Nächte war das etwas, aber nicht auf Dauer. Der Einzige, mit dem sie zwar selten, aber wiederholt aufkreuzte, war Franz Blei, über dreißig Jahre älter, der die Öffentlichkeit tagsüber mied, dabei dürstete er danach. A. wusste, warum. Als bei ihm zu Hause unangemeldeter Besuch klingelte, hatte er seine Havanna in den Ascher geworfen und sich mit einer Flasche Cognac von ihr in seinen Bunker einsperren lassen, ein Kabuff hinter dem Schrank. Dr. Blei ist nicht da, hatte A. den Gerichtsvollziehern erklärt. Und der Zigarrenrauch? Wissen Sie denn nicht, dass ich aus Havanna stamme? Ich rauche Zigarren.
Wenn er irgendwo mit ihr aufkreuzte, die Hand auf ihrer Schulter, wie üblich als Priester verkleidet in schwarzem Priestermantel, einen Priesterhut auf den langen weißen Haaren, drehten sich alle um nach dem Paar. Die Blicke in ihrem Rücken kannte sie auswendig. Als Schnorrer war Blei so vielseitig begabt wie als Schreibender und ebenso ungeniert, bestellte bei Schwanneke Champagner und Kaviarbrötchen, verinnerlichte mit A. beides zügig und verließ das Lokal würdig, ohne zu zahlen, irgendein Mäzen übernahm. Im Romanischen gab es keine Mäzene. Wer hier Stammgast war, konnte gezielt hinwegsehen, über unerwünschte Tischgenossen und über Schnorrer. Das Romanische war ekelhaft und großartig, dort flogen die Funken, dort spritzte das Gift, die Gäste fieberten, schwitzten und intrigierten eiskalt. Roth hielt sich im Romanischen meistens am Nachmittag auf, leicht zu entdecken, dort, wo zwei, drei Marmortische zusammengeschoben waren. A. mied nun die Zeit, wo er dort anzutreffen war. Es hätte etwas zerstört, was bei ihren Begegnungen mit ihm zögerlich gewachsen war, Funken, Frost und Gift hielt diese junge Pflanze nicht aus.
Roth hatte sie eingelassen in sein Heimweh, hatte von Schwaby erzählt, dem deutsch geprägten kleinen Ort, wo er geboren worden war in der galizischen Abgeschiedenheit. Schwaby, hatte er gesagt, gibt es nicht mehr, es wurde 1914