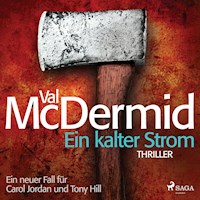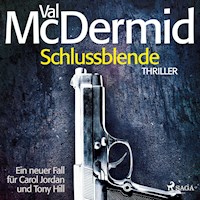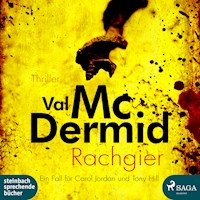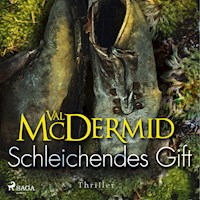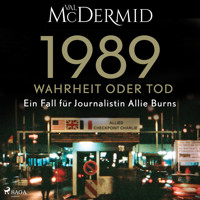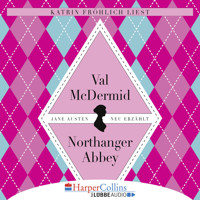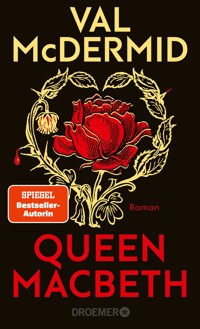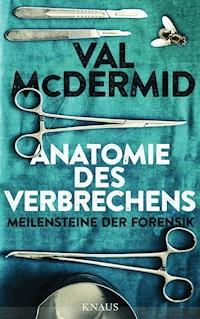
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autorin Val McDermid lässt die Toten sprechen
In ihren Romanen schreibt Val McDermid seit Jahren vom unvorstellbar Bösen. Jetzt geht sie zum ersten Mal realen Verbrechen auf den Grund und schildert die Methoden der Forensik von ihren Anfängen bis an die Grenzen künftiger Wissenschaft und Technologie. Denn die Toten sprechen. Denen, die genau hinhören, erzählen sie alles über sich: woher sie kommen, wie sie lebten, wie sie starben – und wer sie umgebracht hat. Wie minimal die Spur auch sein mag, dem scharfen Blick der Gerichtsmedizin entgeht nichts…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Zum ersten Mal geht die große Krimiautorin Val McDermid realen Verbrechen auf den Grund und schildert die Methoden der Forensik. Denn die Toten sprechen. Denen, die genau hinhören, erzählen sie alles über sich. Wie minimal die Spur auch sein mag, dem scharfen Blick der Gerichtsmedizin entgeht nichts …
»McDermid bleibt auch in diesem Buch die geniale und leidenschaftliche Krimiautorin, die sie ist.« The Times
Die Autorin
Val McDermid, 1955 im schottischen Kirkcaldy geboren, war als Dozentin für englische Literatur und als Journalistin tätig. Die Schriftstellerin zählt weltweit zu den größten Namen der Spannungsliteratur. Ihre Krimis und Thriller wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Für ihr Lebenswerk erhielt sie den »Diamond Dagger«, die höchste Auszeichnung für Kriminalliteratur in Großbritannien.
Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de
VAL McDERMID
ANATOMIE DES VERBRECHENS
MEILENSTEINE DER FORENSIK
Aus dem Englischen vonDoris Styron
KNAUS
INHALT
Einleitung
1 Der Tatort
2 Spurensicherung am Brandort
3 Entomologie, Forensische Insektenkunde
4 Pathologie
5 Toxikologie
6 Fingerabdrücke
7 Blutspuren und DNA
8 Anthropologie
9 Gesichtsrekonstruktion
10 Digitale Forensik
11 Forensische Psychologie
12 Vor Gericht
Schlussbemerkung
Dank
Ausgewählte Bibliografie
Bildnachweise
Für meinen lieben Cameron
Ohne die Wissenschaft gäbe es dich nicht;
Ohne dich böte mir die Zukunft weit weniger Perspektiven.
Eine tolle Sache, diese Wissenschaft.
EINLEITUNG
Unsere heutige Rechtsprechung basiert auf Grundsätzen der Vernunft. Das war durchaus nicht immer so. Die Vorstellung, dass sich das Strafrecht auf Beweise stützen sollte, ist relativ neu. Jahrhundertelang wurden Menschen angeklagt und für schuldig befunden, weil ihnen ein bestimmter Status fehlte, weil sie Fremde waren, weil sie, ihre Frauen oder ihre Mütter sich mit Heilkräutern auskannten, weil sie eine andere Hautfarbe hatten, weil sie Sex mit einem für unpassend gehaltenen Partner hatten, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren – oder aus irgendeinem anderen Grund.
Das änderte sich erst, als man begriff, dass der Tatort einen großen Reichtum an nützlichen Informationen bot, und als sich Wissenschaftsgebiete entwickelten, mit deren Hilfe man diese Hinweise entschlüsseln und vor Gericht verwenden konnte.
Das spärliche Rinnsal wissenschaftlicher Entdeckungen im 18. Jahrhundert wuchs mit dem 19. Jahrhundert zu einer regelrechten Flut heran, die bald weit über den Labortisch hinaus praktische Anwendung fand. Die Idee von so etwas wie polizeilicher Ermittlungsarbeit begann sich gerade erst durchzusetzen, weswegen so mancher der frühen Kriminalbeamten eifrig bemüht war, Beweise zu finden, die seine Theorien zu den aufzuklärenden Verbrechen stützten.
So entstand die Forensik – die Wissenschaft, die bemüht ist, rechtskräftige Beweismittel zu liefern. Schon bald zeigte sich, dass viele Teilgebiete wissenschaftlicher Forschung etwas zu dieser neuen Methodik beitragen konnten.
Eines der ältesten Beispiele brachte die Pathologie mit dem zusammen, was wir heute Dokumentenprüfung nennen würden. Im Jahr 1794 wurde Edward Culshaw durch einen Kopfschuss mit einer Pistole ermordet. Damals waren Pistolen Vorderladerwaffen, und ein Pfropfen aus zusammengeknülltem Papier wurde in den Lauf gestopft, um die Kugeln und das Schießpulver dort zu halten. Als der Chirurg die Leiche untersuchte, fand er diesen Pfropfen in der Kopfwunde. Er faltete ihn auseinander, und es zeigte sich, dass es die abgerissene Ecke eines Flugblatts war.
Der Mordverdächtige, John Toms, wurde durchsucht. Er trug ein Flugblatt in der Tasche, dessen abgerissene Ecke genau zu dem Pfropfen aus der Pistole passte. Bei seinem Prozess in Lancaster wurde Toms wegen Mordes verurteilt.
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie aufregend es gewesen sein muss mitzuerleben, wie das Rechtswesen durch diese Entwicklungen zu einem genaueren Instrument der Gerechtigkeit wurde. Die Wissenschaftler halfen den Gerichten dabei, Verdachtsmomente zur Gewissheit zu machen.
Betrachten wir zum Beispiel Gift. Über Jahrhunderte war für Mörder Gift das Mittel der Wahl gewesen. Denn ohne verlässliche toxikologische Tests war es fast unmöglich, einen Giftmord zu beweisen. Doch das sollte sich bald ändern.
In den frühen Anfängen der Forensik war das wissenschaftliche Beweismaterial allerdings noch keine unumstößliche Tatsache. Im späten 18. Jahrhundert war ein Test entwickelt worden, mit dem man Arsen aufspüren konnte, allerdings nur in größeren Mengen. Später wurde der Test durch den britischen Chemiker James Marsh verfeinert und wirkungsvoller gemacht.
Die Staatsanwaltschaft zog ihn 1832 als Gutachter für Chemie bei einem Mordprozess gegen einen Mann heran, der angeklagt war, seinen Großvater mit Arsen in einer Tasse Kaffee vergiftet zu haben. Marsh hatte eine Probe des verdächtigen Kaffees seinem Test unterzogen und gezeigt, dass sie tatsächlich Arsen enthielt. Aber als er dies den Geschworenen vorführen wollte, war die Probe verdorben und das Ergebnis nicht mehr eindeutig. Der Angeklagte kam wegen berechtigter Zweifel ungeschoren davon.
Für die noch unerfahrenen Experten war dies jedoch kein Rückschlag. James Marsh war ein echter Wissenschaftler: Ein solcher Misserfolg spornte ihn nur noch mehr dazu an, einen besseren Test zu entwickeln. Sein endgültiger Test war so leistungsfähig, dass man damit selbst eine winzige Spur von Arsen finden konnte; auf ihn war es schließlich zurückzuführen, dass so mancher viktorianische Giftmörder am Galgen endete, der nicht mit der forensischen Wissenschaft gerechnet hatte. Der Test wird auch heute noch verwendet.
Die Geschichte der forensischen Kriminaltechnik bietet auf diesem Weg vom Tatort zum Gerichtssaal Stoff für Tausende von Kriminalromanen. Die Anwendung der Wissenschaft zur Aufklärung von Verbrechen ist der Grund dafür, dass ich einer gewinnbringenden Tätigkeit nachgehen kann. Wir Krimiautoren behaupten gern, unser Genre habe seine Wurzeln in den entlegensten Winkeln der Literaturgeschichte. Wir sehen Vorläufer in der Bibel: Betrug im Garten Eden, Brudermord von Kain verübt an Abel, Totschlag bei König David, der Urija ermorden ließ. Wir versuchen uns einzureden, dass Shakespeare einer der Unseren gewesen sei.
In Wahrheit ist es aber so, dass die Kriminalliteratur erst mit einem Justizsystem beginnt, das sich auf Beweise stützt. Und das ist es, was die Pioniere dieser Wissenschaft und der Kriminaltechnik uns hinterließen.
Bereits in den Anfangstagen der Forensik zeichnete es sich ab, dass die Wissenschaft den Gerichten helfen konnte, zugleich aber die Gerichte die Wissenschaftler zu größeren Leistungen anregen konnten. Beiden Seiten kommt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung von Gerechtigkeit zu. Bei den Vorarbeiten zu diesem Buch habe ich mit führenden Forensikern über die Geschichte, die praktische Tätigkeit und die Zukunft ihrer Fachgebiete gesprochen. Um hinter das Geheimnis von Maden zu kommen, bin ich auf den höchsten Turm des Naturhistorischen Museums gestiegen. Ich wurde an meine eigene Konfrontation mit gewaltsamen Todesfällen erinnert; ich hielt das Herz eines Menschen in meinen Händen. Es war eine Reise, die mich mit Ehrfurcht und Respekt erfüllt hat. Die Geschichten über die oft langwierige Etappe, die zwischen Verbrechen und Gerichtssaal liegt, werden Sie nicht loslassen. Sie zeigen, dass die Wirklichkeit alles, was man erfinden kann, weit hinter sich lässt
Val McDermid
EINS DER TATORT
Der Tatort ist der stumme Zeuge.
Peter Arnold, Spezialist für Tatortarbeit
»Code Zero. Notruf – Verstärkung schicken!« Das ist das Funksignal, das jeder Polizist fürchtet. An einem grauen Nachmittag im November 2005 ließen Police Constable Teresa Millburns abgerissene Worte alle in der Leitstelle der West Yorkshire Police erstarren. Ihr Notruf war der Vorbote eines Falls, der alle Mitarbeiter der Polizei betroffen machen würde. An jenem Nachmittag wurde für zwei Kriminalbeamtinnen die Angst, mit der Polizisten jeden Tag leben müssen, harte Wirklichkeit.
Teresa und ihre Partnerin, PC Sharon Beshenivsky, die erst neun Monate zuvor eingestellt worden war, waren gegen Ende ihrer Schicht im Streifenwagen unterwegs. Bei der Streifenfahrt sollten die beiden die Nachbarschaft beobachten und nach dem Rechten sehen. Bei kleineren Vorkommnissen sollten sie eingreifen. Präsenz auf den Straßen zeigen. Sharon freute sich darauf, nach Hause zu kommen zur Geburtstagsparty ihres Jüngsten, und da es nur noch knapp eine halbe Stunde bis Feierabend war, sah es aus, als würde sie pünktlich zu Geburtstagstorte und Partyspielen eintreffen.
Dann, um kurz nach halb vier, kam eine Nachricht. Bei Universal Express, einem Reisebüro im Viertel, war ein Fernalarm ausgelöst worden, der direkt an die Polizeizentrale ging. Die beiden Frauen würden auf dem Rückweg zum Revier sowieso dort vorbeikommen, so beschlossen sie, den Auftrag zu übernehmen. Sie parkten gegenüber dem Reisebüro und überquerten die verkehrsreiche Straße zu dem langen einstöckigen Backsteingebäude, an dessen großen Fenstern Jalousien angebracht waren.
Als sie das Büro erreichten, sahen sie sich einem Trio bewaffneter Einbrecher gegenüber. Sharon bekam aus kürzester Entfernung einen Schuss in die Brust ab. Beim Prozess gegen Sharons Mörder sagte Teresa später: »Wir waren nur einen Schritt auseinander. Sharon ging vor mir. Dann hielt sie an. Sie blieb stehen, weil sie tot war – sie hielt so plötzlich an, dass ich ins Straucheln geriet. Ich hörte einen Knall, und Sharon fiel zu Boden.«
Nur Augenblicke später wurde auch Teresa in die Brust geschossen. »Ich lag auf dem Boden. Ich hustete und spuckte Blut. Ich spürte, dass Blut an meiner Nase herunterlief und überall im Gesicht war, ich bekam kaum noch Luft.« Trotzdem gelang es ihr, den Notfallknopf zu drücken und die Leitstelle mit den schicksalsschweren Worten »Code Zero« zu alarmieren.
Peter Arnold, ein Tatortermittler der Yorkshire and Humberside Scientific Support Services, hörte den Notruf über Funk. »Das werde ich nie vergessen. Ich sah den Tatort vom Polizeirevier aus, es war buchstäblich nur ein Stück weiter vorn an der Straße. Und plötzlich rannte da eine ganze Schar Polizisten die Straße entlang. Ich habe nie so viele Kollegen auf einem Haufen gesehen, es war wie bei einer Feueralarmübung.
Zuerst wusste ich gar nicht, was los war. Dann hörte ich über Funk, jemand sei erschossen worden, möglicherweise eine Polizeibeamtin. Da rannte ich auch einfach los. Ich war der Erste von der Tatortermittlung vor Ort. Ich wollte den Kollegen helfen, die Absperrung einzurichten, damit wir sicher sein konnten, dass der Tatort nicht beschädigt wurde, weil alles sehr emotional war in dem Moment, wie Sie sich ja vorstellen können, und wir mussten da einfach etwas Ordnung reinbringen.
Fast zwei Wochen habe ich mich mit diesem Tatort befasst. Oft bis in die Nacht hinein. Um sieben Uhr früh fing ich an und kam erst gegen Mitternacht nach Haus. Ich erinnere mich, dass ich danach vollkommen erschöpft war, aber damals kümmerte mich das nicht. Es wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Diesen Tatort werde ich niemals vergessen. Nicht weil es ein so aufsehenerregender Fall war, sondern weil eine Kollegin ermordet worden war. Die Tatsache, dass Sharon Polizistin war, bedeutete, dass sie zu meiner Familie gehörte. Andere, die sie gekannt hatten, waren noch verstörter, aber alle steckten ihren Kummer weg und widmeten sich wieder ihrer Arbeit.
Die Polizeibeamtin Sharon Beshenivsky, die von einer Gruppe bewaffneter Raubmörder aus kürzester Distanz erschossen wurde
Und wir konnten gute kriminaltechnische Beweismittel sichern, die wirklich zur Aufklärung des Falls beitrugen, nicht nur am Tatort selbst, sondern auch in der Umgebung: In den Fluchtfahrzeugen und an den Orten, wo die Flüchtigen sich danach aufhielten.«
Die Männer, die für den bewaffneten Raubüberfall verantwortlich waren, der Sharon Beshenivskys Mann zum Witwer machte und durch den ihre drei Kinder ihre Mutter verloren, wurden später vor Gericht gestellt und bekamen eine lebenslange Haftstrafe. Die Verurteilung kam hauptsächlich dank der Arbeit der Tatortermittler und anderer forensischer Spezialisten zustande, Menschen, die Beweise suchen, sie auswerten und schließlich vor Gericht vorlegen. Den Weg solchen Beweismaterials werden wir in diesem Buch verfolgen.
Edmond Locard, der das erste Labor für Ermittlungen am Tatort eröffnete, prägte auch das Motto der Kriminaltechniker: »Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur«
Jeder plötzliche gewaltsame Tod hat seine eigene Geschichte. Um sie lesen zu können, beginnen die Ermittler mit den zwei grundlegenden Informationsquellen – dem Tatort und der Leiche. Idealerweise finden sie die Leiche vor Ort; betrachtet man die Verbindungen zwischen diesen beiden, so hilft das den Ermittlern, die Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Allerdings ist das nicht immer der Fall. In der vergeblichen Hoffnung, dass sie wiederbelebt werden könnte, wurde Sharon Beshenivsky eilig in ein Krankenhaus gebracht. In anderen Fällen gelingt es tödlich verwundeten Personen, sich eine gewisse Strecke von der Stelle zu entfernen, wo sie angegriffen wurden. Manche Mörder schaffen die Leiche weg, entweder mit der Absicht, sie zu verstecken, oder einfach, um die Kriminalbeamten zu verwirren.
Selbst für die komplexesten Umstände haben Wissenschaftler Methoden entwickelt, die die Ermittler mit einem ganzen Spektrum an Informationen ausstatten, um die Geschichte eines Todes lesen zu können. Um diese Geschichte vor Gericht glaubhaft darzustellen, muss die Staatsanwaltschaft zeigen, dass das Beweismaterial belastbar und unverfälscht ist. Genau deshalb ist die Tatortarbeit bei der Untersuchung von Mordfällen in den Vordergrund gerückt. Wie Peter Arnold sagt: »Der Tatort ist der stumme Zeuge. Das Opfer kann uns nicht erzählen, was sich zugetragen hat, der Tatverdächtige möchte uns wahrscheinlich nicht sagen, was passiert ist, deshalb müssen wir eine Hypothese aufstellen, die erklärt, was sich abgespielt hat.«
Je besser die Methoden der Spurensicherung am Tatort wurden, desto akkuratere Hypothesen konnten über den Vorgang eines Verbrechens aufgestellt werden. Im 19. Jahrhundert wurden beweisgestützte Gerichtsverfahren zwar zur Regel, die Sicherung des Beweismaterials war aber noch nicht sehr weit entwickelt. Der Gedanke, dass Verunreinigungen oder Verfälschungen zu vermeiden seien, blieb unberücksichtigt. Bedenkt man, wie begrenzt das war, was die wissenschaftliche Analyse damals leisten konnte, stellte das kein sonderlich großes Problem dar. Aber diese Grenzen wurden erweitert, als die Wissenschaftler ihr zunehmendes Wissen in der Praxis anwendeten.
Eine der Schlüsselfiguren, die für das Verstehen der Beweislage am Tatort sorgte, war der Franzose Edmond Locard. Nach seinem Studium der Medizin und Rechtswissenschaft in Lyon begründete er 1910 das weltweit erste Labor für Ermittlungsarbeit. Die Polizei von Lyon stellte ihm zwei Assistenten und zwei Räume unter dem Dach zur Verfügung. In diesen beengten Verhältnissen der Anfangszeit entwickelte er das Labor zu einem internationalen Zentrum. Schon von klein auf hatte Locard eifrig Arthur Conan Doyle gelesen und wurde besonders von A Study in Scarlet (1887) (Eine Studie in Scharlachrot) beeinflusst, wo Sherlock Holmes zum ersten Mal auftritt. In diesem Roman sagt Holmes: »Ich habe eine spezielle Studie zu Zigarrenasche durchgeführt, ja, ich habe eine Monografie zu dem Thema geschrieben. Ich bilde mir ein, dass ich mit einem Blick die Asche jeder bekannten Zigarre – und auch Tabakmarke von anderen unterscheiden kann.« Im Jahr 1929 veröffentlichte Locard einen Aufsatz über die Bestimmung von Tabak anhand der am Tatort gefundenen Asche: »Die Analyse von Staubspuren.«
Er schrieb ein bahnbrechendes siebenbändiges Lehrbuch über den Gegenstand, den er »Kriminalistik« nannte, aber sein einflussreichster Beitrag zur forensischen Wissenschaft ist wahrscheinlich diese simple Aussage: »Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur«, die als der Locardsche Grundsatz des Austauschs bekannt ist. Er schrieb: »Es ist unmöglich, dass ein Verbrecher handelt, ohne Spuren seiner Anwesenheit zu hinterlassen, besonders wenn man die Intensität eines Verbrechens berücksichtigt.« Es mögen Fingerabdrücke sein, Fußspuren, identifizierbare Fasern von seiner Kleidung oder der Umgebung, Haare, Haut, eine Waffe oder Gegenstände, die ihm versehentlich herunterfielen oder die er mitzunehmen vergaß. Und auch das Gegenteil ist wahr: das Verbrechen hinterlässt Spuren am Verbrecher. Schmutz, Fasern vom Opfer oder dem Tatort selbst, DNA, Blut oder andere Flecken. Locard demonstrierte die Möglichkeiten dieses Prinzips mit seinen eigenen Ermittlungen. In einem Fall entlarvte er einen Mörder, der ein stichhaltiges Alibi für die Zeit zu haben schien, als seine Freundin ermordet wurde. Locard analysierte Spuren von rosa Staub, den er im Schmutz unter den Fingernägeln des Tatverdächtigen fand, und bewies, dass der Staub von einem ungewöhnlichen Make-up stammte, das für das Opfer hergestellt worden war. Als man den Mörder mit dem Beweis konfrontierte, gestand er.
Der Einfluss engagierter, im Labor arbeitender Wissenschaftler wird rasch größer. Aber ohne das anfängliche akribische Sammeln von Spuren am Tatort hat die Wissenschaft nichts, womit sie arbeiten kann. Eine unerwartete Pionierin, die Tatorte wie eine Erzählung las, war Frances Glessner Lee, eine reiche Erbin aus Chicago, die 1931 die Harvard School of Legal Medicine gründete – das erste gerichtsmedizinische Institut dieser Art in den USA. Lee konstruierte eine Reihe komplizierter Nachbildungen echter Tatorte inklusive funktionierender Türen, Fenster, Schränke und Beleuchtung. Sie nannte diese makabren Puppenstuben »Nutshell Studies of Unexplained Death« (Studien ungeklärter Todesfälle im Taschenformat) und verwendete sie als Anschauungsmaterial bei einer Reihe von Tagungen. Ermittler hatten bis zu neunzig Minuten lang Zeit, sich die nachgebauten Schauplätze genau anzusehen, und wurden dann aufgefordert, einen Bericht über ihre Schlussfolgerungen zu schreiben. Erle Stanley Gardner, der Verfasser von Kriminalromanen, dessen Perry-Mason-Reihe die Grundlage einer sehr erfolgreichen Fernsehserie war, schrieb: »Jemand, der diese Modelle studiert, kann in einer Stunde mehr über Indizienbeweise lernen als in monatelangem abstraktem Studium.« Die achtzehn Modelle werden nach mehr als fünfzig Jahren auch heute noch zu Übungszwecken vom Office of the Chief Medical Examiner of Maryland, dem Institut des obersten Gerichtsmediziners von Maryland, genutzt.
Obwohl Frances Glessner Lee Einzelheiten der Spurensicherung auch bei moderner Tatortarbeit wiedererkennen würde, wären ihr die meisten Einzelheiten fremd. Schutzanzüge aus Papier, Nitrilhandschuhe, Schutzmasken – dieses ganze Zubehör hat der heutigen Auswertung des Tatorts eine Präzision und Strenge verliehen, von der die frühen Kriminalisten nur träumen konnten. Diese Strenge kam beim Mordfall Sharon Beshenivsky zum Tragen. Er wurde ein Musterbeispiel dafür, wie Ermittler jeden Erfolg versprechenden Hinweis bis zum Schluss verfolgen. Wie immer konnten sich die Ermittler weitgehend auf die Informationen verlassen, die ihnen vom forensischen Team geliefert wurden.
Im Vordergrund stehen bei diesem Vorgang zunächst die Beamten der Spurensicherung. Sie beginnen ihre Laufbahn mit einem Lehrgang, der ihnen die Grundkenntnisse über die wichtigsten Fertigkeiten und Methoden zum Erkennen, Sammeln und Aufbewahren von Beweisen vermittelt. Nachdem sie zu ihrer Zentrale zurückkehren, werden sie intensiv geschult, während sie bei der praktischen Arbeit Erfahrung sammeln; sie beginnen mit einfacheren Verbrechen, arbeiten sich zu den komplizierteren Fällen hoch und eignen sich dabei Wissen und Kompetenzen an. Im Lauf der Zeit müssen sie eine ganze Sammlung an Beweismaterial liefern, um ihr Können zu beweisen.
Im Fernsehen haben wir oft genug gesehen, wie Tatorte untersucht werden. Wir glauben alle zu wissen, wie vorgegangen wird; die Spezialisten in den weißen Anzügen fotografieren mit großer Sorgfalt die wesentlichen Beweisstücke, stecken sie in Tüten und bewahren sie auf. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Was macht die SpuSi wirklich? Was passiert, nachdem eine Leiche entdeckt wird?
Im Allgemeinen sind die ersten Polizeibeamten, die am Tatort erscheinen, Schutzpolizisten. Die Entscheidung, ob bei dem entsprechenden Todesfall ein Verdacht vorliegt, wird von einem Kriminalbeamten in Zivil gefällt, der mindestens den Rang eines Detective Inspector (DI) (Kommissars) hat. Wenn der DI festgestellt hat, dass es sich um einen Tötungsdelikt handeln könnte, wird der Tatort für die Spurensicherung abgesperrt. Die Schutzpolizei zieht sich zurück, umgibt den Tatort mit Absperrband und legt eine Liste der Personen an, die den Tatort betreten und verlassen. Jeder, der kommt oder geht, wird registriert, damit jede mögliche Quelle der Verfälschung des Beweismaterials nachvollzogen werden kann.
Ein Senior Investigating Officer (SIO) (Ermittlungsleiter) wird ernannt, der die Tatortuntersuchung koordiniert. Alle Mitarbeiter der Spurensicherung müssen sich ihm gegenüber verantworten. Der Ermittlungsleiter wird von einem Forensiker beraten, der die nach Maßgabe des SIO geforderten wissenschaftlichen Hilfsmittel koordiniert.
Peter Arnold, ein solcher forensischer Berater, ist ein drahtiges Energiebündel mit dem wachen Blick einer Amsel und einer offensichtlichen Begeisterung für seine Arbeit. Seine Abteilung arbeitet mit vier verschiedenen Polizeibehörden zusammen. Sie ist, abgesehen von der Metropolitan Police, mit einem Stab von rund 500 Mitarbeitern die größte Unterstützergruppe des wissenschaftlichen Dienstes. Sie arbeitet 24-Stunden-Schichten, um der Kriminalpolizei, die jede vorstellbare Art von Verbrechen untersucht, rund um die Uhr mit ihrem Service zur Verfügung zu stehen. Der forensische Dienst ist in der Nähe der Autobahn bei Wakefield in einem für diesen Zweck erbauten Zentrum angesiedelt, das den Namen von Sir Alec Jeffrey, dem Vater des genetischen Fingerabdrucks, trägt. Man hat von dort Ausblick auf einen künstlichen See, dessen ländliche Beschaulichkeit in scharfem Gegensatz zu der topaktuellen, in dem Gebäude betriebenen Wissenschaft steht.
»Sobald ich den ersten Anruf erhalte, fange ich an, die Einsatzmittel zu koordinieren«, sagt Peter. »Ist der Tatort in einem Gebäude, dann ist die Eile nicht so groß, weil dort kein Schnee oder Regen fallen wird. Es ist jetzt ein Ort, der steril bleiben und gesichert sein muss, wir können ihn mit etwas mehr Ruhe bearbeiten. Aber wenn es ein Tatort im Freien und es mitten im Winter ist, werde ich die Mitarbeiter sofort dorthin schicken, um das Beweismaterial zu bergen, bevor es durch Schneefall oder Regen zerstört wird.«
Im Fall Sharon Beshenivsky lag der Tatort im Freien, an einer verkehrsreichen Straße, darum war die Erhaltung des Beweismaterials oberste Priorität. Aber das war für Peter und seine Kollegen nicht die einzige Sorge. »Die Leute denken bei Tatort im Singular. Aber oft haben wir schließlich fünf oder sechs relevante Orte für ein Tötungsdelikt – wo eine Person getötet wurde, wo die Verdächtigen danach hingingen, ein Fahrzeug, in dem die Verdächtigen fuhren, die Stelle, wo die Verdächtigen verhaftet werden, und, wenn die Leiche entfernt wurde, der Ort, wo sie dann verblieb. All diese verschiedenen Orte müssen, jeder für sich, untersucht werden.«
Das erste Problem für die Spurensicherung, die an diesen Orten arbeitet, ist Sicherheit. Es kann sein, dass jemand erschossen wurde, und der Verdächtige ist noch auf freiem Fuß. Die SpuSi trägt weder schusssichere Westen, noch hat sie Schusswaffen, Elektroschocker oder Handschellen bei sich. Tatortermittler sind nicht ausgebildet, um gewalttätige Personen zu verhaften, auch wenn sie sich oft an den Tatorten aufhalten, die diese hinterlassen. Es werden also bewaffnete Polizeibeamte eingesetzt, um die Kollegen von der Spurensicherung zu schützen.
Nach der Sicherheit der Beamten kommt die Spurensicherung. Peter erklärt: »Es ist möglich, dass wir am Tatort ankommen, wo der Zutritt zu einem Haus schon durch Absperrung verwehrt ist, aber die Tatverdächtigen sind die Straße entlanggerannt und in ein Fluchtfahrzeug gestiegen. Wenn auf dieser Straße noch Fahrzeuge unterwegs sind, könnten sie über Kugeln, Blutflecken oder Reifenspuren fahren. Es wäre also sinnvoll, die ganze Straße zu sperren, bis wir das Beweismaterial sammeln können.«
Wenn die Absperrung angebracht ist, legen die Tatortermittler ihre komplette Schutzausrüstung an: einen weißen Schutzanzug, ein Haarnetz oder eine Kapuze, zwei Paar Schutzhandschuhe (weil manche Flüssigkeiten durch das erste Paar durchsickern können) und Überschuhe. Außerdem setzen sie eine OP-Maske auf, damit sie nicht den Tatort mit ihrer DNA verunreinigen und um sich selbst vor Blut, Erbrochenem, Fäkalien und Ähnlichem zu schützen.
Dann begehen sie den Tatort und decken den Boden mit Trittplatten ab, um die Oberfläche zu schützen. Bei der ersten Begehung wird nach Beweisen gesucht, die helfen können, die Täter schnell zu identifizieren. Diese Anscheinsbeweise werden im Schnellverfahren behandelt. Zum Beispiel ein blutiger Fingerabdruck an einem Fenster, durch das der Täter ausgestiegen ist, oder Blutstropfen, die aus dem Haus und die Straße entlangführen. Es ist möglich, aus einem einfachen Blutfleck in nur neun Stunden einen genetischen Fingerabdruck zu generieren, und schon reduzieren sich die Kosten entsprechend der benötigten Bearbeitungszeit.
Peter muss auf solche Dinge achten. Die nationale DNA-Datenbank ist nur einen Teil des Wochenendes geöffnet; es würde also nichts bringen, für eine Eilbearbeitung zu zahlen, wenn das Material nur herumsteht, bis die Datenbank wieder aufmacht. Es kann günstiger sein, sich für die 24-Stunden-Bearbeitungszeit zu entscheiden, damit der Fingerabdruck montagmorgens fertig ist, wenn die Datenbank öffnet. »Wir müssen daran denken, was gebraucht wird, um die Resultate zu bekommen, die wir benötigen. Manche der Dinge, die man ständig im Fernsehen sieht, kommen in der Realität nur ganz selten vor. Sie sind dann meist der letzte Ausweg. Aber das Timing ist im juristischen Sinn wichtig. Die Teams der Kriminaltechnik müssen auch mal schlafen, um fachgerecht arbeiten zu können. Aber wenn die Polizei einen Verdächtigen verhaftet, fängt die gesetzlich vorgeschriebene Zeit des Gewahrsams an abzulaufen, und es ist unsere Aufgabe, Ergebnisse aus gleich zu Anfang gewonnenen Beweisen abzuleiten. Nach diesen richtet sich die Entscheidung, ob jemandem etwas angelastet wird. Es geht dabei immer um eine Gratwanderung.«
Während man sich also mit den Entscheidungen über das weitere Vorgehen befasst, geht die Arbeit am Tatort weiter. Tatortermittler stehen in jeder Ecke eines Raums und fotografieren die jeweils entgegengesetzte Ecke. Sie erfassen jede Perspektive jedes Raums inklusive Fußboden und Decke, damit sie später sehen können, woher ein Beweisstück kam, das sie eventuell wegnehmen. Manchmal scheint nichts davon relevant zu sein, aber zehn Jahre später wird der Fall wiederaufgenommen, und ein neues Team entdeckt etwas von entscheidender Bedeutung.
Es ist auch möglich, eine rotierende Kamera mitten in einen Raum zu stellen. Diese nimmt dann eine Fotoserie auf, die von einer Software so zusammengesetzt wird, dass die Geschworenen später einen virtuellen Gang durch den Raum machen und dabei bestimmte Gegenstände anschauen können. Sie können sogar eine Tür anklicken und ins nächste Zimmer gehen. »Zum Beispiel«, sagt Peter, »wenn mehrere Schüsse durch ein Fenster abgegeben wurden, die Wände durchdrungen und jemanden im Haus getroffen haben, kann man den Raum abfotografieren und zu einem späteren Zeitpunkt gewissermaßen vom Haus zurücktreten und die Flugbahn der Kugeln sehr, sehr genau sichtbar machen. Das geht sogar so weit, dass man zeigen kann, wo der Schütze stand.« Auf diese Weise können zwei Schlüsselorte der Handlung – die Straße draußen und der Ort des Auftreffens im Haus – für die Geschworenen verknüpft werden.
So ähnlich nahmen sich an jenem Nachmittag in Bradford die Tatortermittler gleich als Erstes die Straße, wo die Schüsse der Mörder gefallen waren, und die Räume des Reisebüros vor, wo die Mitarbeiter bedroht, mit einer Pistole auf sie eingeschlagen und sie dann gefesselt wurden. Auf der Straße fanden sich Blutflecke, die fotografiert und von Spezialisten für Blutspurenmuster analysiert werden mussten, um Zeugenaussagen zu den Geschehnissen und ihrer Reihenfolge zu bestätigen. Die Umgebung wurde mit Fingerspitzen durchkämmt. Die Suche brachte schließlich drei Patronenhülsen von einer 9-mm-Handfeuerwaffe zutage, eine leicht erhältliche illegale Handfeuerwaffe, die häufig von Berufsverbrechern verwendet wird.
Im Reisebüro förderte eine sorgfältige Suche einige der Schlüsselbeweise zutage: eine Laptoptasche, in der die Schusswaffen versteckt waren, ein Messer, das von einem der Männer benutzt wurde, und eine Kugel, die in der Wand steckte. Experten für Ballistik identifizierten den Waffentyp, mit dem die Kugel abgefeuert wurde. Heutzutage haben Läufe von Schusswaffen spiralförmige Rillen – den »Geschossdrall« – der an der Innenseite verläuft, damit die Kugeln sich besser drehen und auf einer genaueren Bahn fliegen. Jeder Waffentyp hat einen spezifischen, von anderen Waffen unterschiedenen Geschossdrall. Anhand der Kerben und Kratzer auf der Kugel aus der Wand des Reisebüros waren die Spezialisten für Ballistik damals in Bradford in der Lage festzustellen, dass die Kugel mit einer MAC-10, einer kleinen Maschinenpistole, abgegeben wurde. Später erklärten sie, dass die MAC-10 wahrscheinlich eine Ladehemmung hatte, was an jenem Nachmittag wohl Leben rettete.
Obwohl die Experten in Bradford bei ihrer Untersuchung leistungsstarke Mikroskope und riesige digitale Datenbanken nutzten, hat die Ballistik als Zweig der Kriminaltechnik ihre Wurzeln in der Detektivarbeit des 19. Jahrhunderts. Damals wurden Kugeln nicht in Massenproduktion in Fabriken, sondern in individuellen Gussformen hergestellt, oft vom Besitzer der Waffe selbst. Im Jahr 1835 wurde Henry Goddard, ein Mitglied der Bow Street Runners, der ersten professionellen Einheit Kriminalbeamter in Großbritannien, in Southampton ins Haus einer Mrs. Maxwell gerufen. Joseph Randall, ihr Butler, behauptete, ein Einbrecher, den er unter Einsatz seines Lebens abgewehrt habe, hätte auf ihn geschossen. Goddard hatte bemerkt, dass die hintere Tür aufgebrochen worden und das Haus in Unordnung war, aber er war trotzdem misstrauisch. Er nahm Randalls Waffe, seine Munition, Gussformen und die Kugel, mit der auf ihn geschossen wurde, mit und entdeckte, dass sie alle zusammenpassten. Die Kugel hatte eine winzige runde Unebenheit, die mit einer fehlerhaften Stelle von ähnlicher Größe in Randalls Gussform übereinstimmte. Als Randall mit diesem Beweis konfrontiert wurde, gestand er, den ganzen Vorfall eingefädelt zu haben, weil er hoffte, von Mrs. Maxwell eine Belohnung für seine Tapferkeit zu erhalten. Dies war die erste Gelegenheit, bei der eine Kugel durch kriminaltechnische Mittel einer bestimmten Schusswaffe zugeordnet werden konnte.
Der Tatort mag der stumme Zeuge des Verbrechens sein, aber oft werden Menschen zu Zeugen und können mit ihren Aussagen Hinweise geben. Im Fall Sharon Beshenivsky gaben Zeugen an, dass die Raubmörder in einem silberfarbenen Geländewagen geflüchtet waren. Die Verkehrspolizei begann sofort, das Material der Überwachungskameras am Ort durchzusehen. Bald fand man das Fahrzeug und konnte es als einen Toyota RAV4 identifizieren. Einige Monate früher wäre damit wohl die Geschichte zu Ende gewesen. Aber im Jahr 2005 hatte Bradford als eine der ersten Städte in Großbritannien gerade das Stadtgebiet mit einem Ring von Überwachungsanlagen umgeben, die jedes hinein- oder herausfahrende Fahrzeug erfassten. Bis zu 100 000 Bilder wurden täglich aufgenommen und vom Big-Fish-Programm gespeichert.
Die Polizei verlor die Spur des Fahrzeugs, als es die Innenstadt von Bradford verließ. Aber als man das Autokennzeichen in die nationale automatische Nummernschilderkennung eingab, konnten die Mitarbeiter den Kriminalbeamten sagen, dass der silberfarbene Geländewagen am Flughafen Heathrow gemietet worden war. Innerhalb weniger Stunden hatte die Metropolitan Police das Fluchtfahrzeug gefunden und sechs Tatverdächtige festgenommen.
Aber wieder schienen die Kripobeamten von Bradford Pech zu haben. Die verhafteten Männer konnten schnell beweisen, dass sie mit dem Raubüberfall in Bradford nichts zu tun hatten. Sie wurden ohne Anklage auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei schien in eine Sackgasse geraten zu sein.
Wieder kamen die Kriminaltechniker zu Hilfe. Die Durchsuchung des RAV4 ergab eine reiche Ausbeute an Beweisstücken: einen Ribena-Getränkekarton, eine Wasserflasche, ein eingewickeltes belegtes Brot und einen Kassenbon von der Raststätte Woolley Edge an der Autobahn südlich von Leeds. Der Kassenbon war um 18 Uhr ausgedruckt worden, kaum zwei Stunden nach der folgenschweren Begegnung zwischen den Gangstern und Sharon Beshenivsky. Alle diese Gegenstände waren klassische Beispiele für Anscheinsbeweise, deren Untersuchung zum Zweck rascher Identifikation vorgezogen werden kann.
Als die Polizei die Videoaufnahmen aus der Überwachungsanlage der Raststätte überprüfte, entdeckte sie einen Mann, der die in dem RAV4 gefundenen Gegenstände kaufte. Inzwischen wurden diese Gegenstände auf Fingerabdrücke und DNA hin untersucht, und als die Ergebnisse in die nationalen Datenbanken eingegeben wurden, fand die Polizei die Namen von sechs Verdächtigen, die alle mit einer gewalttätigen Verbrecherbande in London in Zusammenhang standen.
Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schuldigen aufgespürt waren. Drei von ihnen, die bei dem Raubüberfall den Wagen gelenkt oder Schmiere gestanden hatten, wurden wegen Raub und Totschlag verurteilt. Zwei wurden wegen Mordes angeklagt und erhielten lebenslängliche Haftstrafen. Einem der Täter war es gelungen, das Land zu verlassen und sich, in einer Burka gekleidet, als Frau auszugeben und in seine Heimat Somalia zu fliehen. Aber die Polizei von West Yorkshire gab nicht auf. Nach einer verdeckten Auslieferung an das Innenministerium wurde endlich auch er vor Gericht gestellt und ebenfalls zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Sharon Beshenivskys Kollegen ließen nicht locker. Sie sorgten dafür, dass jedes verfügbare Hilfsmittel bei dem Bemühen um Gerechtigkeit eingesetzt wurde.
Die Tatortgruppen setzen nicht nur dann alle Hebel in Bewegung, wenn es um schlagzeilenträchtige Fälle geht. Auch bei Fällen von Massenkriminalität, zu der Einbrüche zählen, werden Speichelproben für DNA-Analysen sowie die Untersuchung von Fingerabdrücken und Fußspuren in Betracht gezogen. Manchmal ergibt sich durch einen Test eine Antwort, die kompliziertere Untersuchungen überflüssig macht. Wenn z. B. Fingerabdrücke auf einem Messer gefunden werden, das als Stichwaffe benutzt wurde, braucht man nicht nach DNA auf dem Messer zu suchen. Peter erklärt: »Wir wollen keine Hightech-Methoden einsetzen, wenn wir das Ergebnis, das wir brauchen, auf einfachere und billigere Art und Weise bekommen können.« Dieser Grundsatz wird von Beamten, die voller Begeisterung Krimis im Fernsehen schauen, gelegentlich außer Acht gelassen. Die Forensikerin Val Tomlinson sagt: »Das kann etwa der Ermittlungsleiter sein, der nicht viel praktische Erfahrung hat. Ich erinnere mich, dass ich einmal an einen Tatort kam, wo ein toter Mann saß, in dem ein Messer steckte, und der Ermittlungsleiter sagte: ›Sie werden dann also eine Metallanalyse an der Schnittwunde durchführen, damit Sie beweisen können, dass dieses Messer benutzt wurde?‹ Und ich sagte: ›Vielleicht ist das nicht vorrangig, da das Messer noch drinsteckt.‹«
Aber wenn die Hightech-Methoden gebraucht werden, können sie angewendet werden, wie sich in vielen Fällen in diesem Buch zeigen wird. Peter greift besonders gern auf die UK National Footwear Database zurück, eine Datenbank, die die Tatorte anhand der Abdrücke von Schuhen verknüpfen kann. Er nutzte sie erst kürzlich, als er einen seltenen Abdruck am Tatort eines sexuellen Übergriffs gefunden hatte. Der Abdruck war auch an einigen anderen Tatorten im Gebiet von West Yorkshire gefunden worden, und die Übereinstimmung veranlasste die Polizei, sich auf den Mann zu konzentrieren, der schließlich für schuldig befunden wurde.
Peter bleiben die erfolgreich gelösten Fälle am längsten in Erinnerung. »Ich erinnere mich an einen, wo wir ein wirklich gutes Ergebnis zuwege brachten, was nicht jeden Tag vorkommt. Einer unserer Kollegen von der Spurensicherung machte Fotos von einer Frau, die zusammengeschlagen worden war und auf der Intensivstation lag. Die Frau starb anschließend an ihren Verletzungen, aber als der Ermittler sie sah, bemerkte er merkwürdig geformte Abdrücke auf ihrem Gesicht. Also schickten wir einen unserer Tatortfotografen hin, der weitere Aufnahmen mit ultraviolettem und Infrarotlicht machte. Bei genauer Betrachtung der Fotos konnten wir feststellen, dass es sich um deutliche Abdrücke der Sohlen von Turnschuhen handelte.
Später, als wir die Schuhe des Tatverdächtigen bekamen, fanden wir nicht nur Blutspuren daran, sondern unser Experte für Schuhspuren konnte feststellen, dass das Opfer mindestens acht Mal getreten wurde, weil er das gleiche Abdruckmuster in mindestens acht verschiedenen Ausrichtungen zeigen konnte. Sein Beweismaterial verdeutlichte, dass die Frau einem längeren Übergriff ausgesetzt war. Der Verdächtige hatte behauptet, er hätte vielleicht ›aus Versehen auf ihr Gesicht getreten‹. Ich glaube, der zweifelsfreie forensische Beweis war dann aber Grund dafür, dass er vor Gericht eine hohe Strafe erhielt.«
Am Ende des langen Verfahrens der Beweissicherung liegt der Gerichtssaal, wo das Beweismaterial, das Peter und seine Kollegen gesammelt haben, von Anwälten bis ins letzte Detail überprüft und von Richtern und Geschworenen sorgfältig abgewogen wird. Das ist so weit von der leidenschaftslosen Welt des Wissenschaftlers entfernt, wie man sich nur vorstellen kann. Und dabei gibt es keine Rücksicht auf den Status der Person, wie Peter sich erinnert.
»Ich erinnere mich daran, dass ich einmal drei Stunden lang im Zeugenstand ein Kreuzverhör über mich ergehen lassen musste. Es gab einen klaren DNA-Beweis, der dafür sprach, dass der Verdächtige eine Frau überfallen und ausgeraubt hatte. Ich muss dazu sagen, dass ich ungewöhnliche Mühe aufgewendet hatte, um an diese Beweise zu kommen. Vielleicht über das hinaus, was man normalerweise erwarten würde.
Am Ergebnis zur DNA konnte kein Zweifel bestehen, aber die Verteidigung war der Auffassung, ich hätte diesen Beweis deponiert. Hier ging es darum, meine Integrität zu verteidigen, und da wurde die Dokumentation wirklich wichtig. Ich konnte die Fotos vom Originalzustand des Tatorts vorlegen, bevor ich etwas berührt oder weggenommen hatte, sodass die Geschworenen den ursprünglichen Tatort sehen konnten. Die Aufnahmen waren der Reihe nach gemacht worden, während ich die Gegenstände sicherstellte, letzten Endes kamen wir zu dem Gegenstand, der den genetischen Fingerabdruck ermöglicht hatte. Die Geschworenen konnten genau sehen, was ich tat, in welcher Reihenfolge ich vorging, und sie sahen die Identifizierungsmerkmale an dem Gegenstand.
Dann wurde die kritische Frage gestellt, ob sich nicht jemand hinterher daran zu schaffen gemacht haben könnte. Aber ich war in der Lage, jeden Schritt zu dokumentieren, den er durchlaufen hatte. Es lag eine klare, ununterbrochene Beweismittelkette vor. Die Angriffe gingen trotzdem weiter. Schließlich zog ich einen Schutzanzug an, legte eine Maske an, zog Handschuhe und ein Haarnetz über und legte ein steriles Blatt Papier im Gerichtssaal aus. Dann öffnete ich den Asservatenbehälter, zeigte den Gegenstand den Geschworenen und legte meine Fotos vor, um zu demonstrieren, dass es das genau gleiche Asservat mit den gleichen spezifischen Merkmalen war. Das Beweismaterial bestand den Test, aber es zeigte mir auch, wie weit die Verteidigung beim Versuch gehen kann, ihren Mandanten zu entlasten.
Persönlich fand ich das recht ärgerlich, aber ich verstehe die Notwendigkeit eines kontradiktorischen Verfahrens [bei dem zwei widerstreitende Parteien, der Anklagevertreter und die Verteidigung, gegeneinander antreten, um die Informationen über den Fall zusammenzutragen]. Ich wurde herausgefordert, aber letztendlich stärkte das die Argumentation, weil klar wurde, dass es keine Probleme mit den Beweisen gab. Wir werden nicht erleben müssen, dass der Fall zehn Jahre später noch einmal aufgerollt wird mit der Begründung, die Beweise hätten manipuliert sein können. Es ist mir lieber, es gleich offen anzusprechen. Soll man unsere Darstellung doch jetzt anfechten, und wir stellen uns der Überprüfung.«
Technik und Methoden haben sich sehr weit entwickelt. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Und wir Erfinder fiktiver Mordfälle sind nicht immer hilfreich, wie Peter bestätigt. »In der Öffentlichkeit werden oft Erwartungen geweckt durch das, was man im Fernsehen sieht. Wenn wir kommen und erklären, wieso wir etwas nicht untersuchen können, glaubt man uns manchmal einfach nicht. Schließlich kommen wir uns wie der Bösewicht vor, weil wir die Erwartungen nicht erfüllen können.«
Dabei bezog sich Peter auf den »CSI-Effekt«, der nach der bekannten amerikanischen Fernsehserie CSI – Crime Scene Investigation(Den Tätern auf der Spur) – benannt ist und von dem manche glauben, dass er die öffentliche Wahrnehmung von dem verzerrt, was die Forensik zu leisten vermag. So werde vor allem eine DNA-Analyse inzwischen von recht vielen Geschworenen als unverzichtbares Beweismaterial betrachtet. Andererseits wird häufig bestritten, dass der CSI-Effekt solch große Wirkung entfaltet; stattdessen hält man ihn für ein Zeichen, dass auch Laien ein grundlegendes, wenn auch unvollständiges Verständnis für das entwickeln, was die forensische Wissenschaft leistet. Und wenn Sachverständige und Richter ihre Arbeit ordnungsgemäß verrichten, können sie den Geschworenen helfen, die Bedeutung verschiedener Beweise zu verstehen.
In einem außergewöhnlichen Fall im Jahr 2011 in Wiltshire kopierte eine Frau, die Opfer eines Verbrechens geworden war, einen Trick, den sie in einer Episode von CSI gesehen hatte, um der Tatortgruppe bei der erhofften Untersuchung zu helfen. Schon seit Monaten trieb in Chippenham ein Mann sein Unwesen. Mit einer Maske vermummt, zerrte er ein potenzielles weibliches Opfer in sein Auto, fuhr zu einer nicht mehr genutzten Kaserne, vergewaltigte die Frau und zwang sie, sich mit Handtüchern sauber zu machen, damit die kriminaltechnisch erfassbaren Spuren zerstört waren. Er wurde erwischt, nachdem sich sein letztes Opfer Haarsträhnen ausriss und in seinem Auto zurückließ, bevor er es gehen ließ. Die Frau sagte der Polizei, sie hätte gewusst, dass es eine Ermittlung geben würde, ob sie nun überlebte oder nicht, und dies würde einen DNA-Beweis ergeben. »Ich war schon immer ein Fan von CSI-Serien. Ich habe so viele davon gesehen, dass ich weiß, was zu tun ist.« Mithilfe ihrer Haare und des Speichels, den sie ebenfalls auf dem Autositz hinterlassen hatte, wurde der Obergefreite Jonathan Hayes wegen sechs Vergewaltigungen verurteilt.
In mancher Hinsicht ist Peter Arnold der Meinung, dass britische Kriminaltechniker ihren Pendants im Fernsehen mehr ähneln sollten. »Tatortermittler brauchen eine vernünftige Lösung für die mobile Datenerfassung, die es ihnen ermöglicht, am Tatort Zugriff auf Informationstechnik zu haben, damit sie Informationen bearbeiten und Beweismittel dokumentieren können, ohne immer wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu müssen, wodurch viel Zeit verloren geht. Das klingt doch wirklich einfach, oder? Das Problem dabei sind die Kosten für die Entwicklung und die Verfügbarkeit von Software. Wir haben keine Millionen, um eine App für Tatortermittler zu entwickeln. Und dann ist da das Problem des Datenschutzes.
Ermittlungsbeamte suchen den Bereich um den Tatort des Mordes an Sharon Beshenivsky nach Beweismitteln ab
Wenn wir kriminaltechnische Spuren in Echtzeit weiterverarbeiten könnten, welchen Unterschied das machen würde! Wenn wir nach einem Einbruch potenzielle DNA-Spuren finden, müssen wir diese DNA immer noch per Kurier zum Labor bringen lassen. Dort muss sie registriert und schließlich untersucht werden. Zurzeit beschleunigen wir die Bearbeitung des Beweismaterials von Einbrüchen und bekommen die DNA innerhalb von neun Stunden analysiert, weil Einbrüche hohe Priorität haben. Warum sollte man zwei oder drei Tage warten, bis man die Identität des Einbrechers bekommt, wenn man sie in neun Stunden kriegen, ihn in Gewahrsam nehmen und heute Nacht schon von einem weiteren Einbruch abhalten kann? Wir nutzen also Verfahren, die für schwerwiegende Straftaten gedacht sind, für Massenkriminalität. Ähnlich ist es mit der Behandlung von Fingerabdrücken. Wir haben das wirklich schon beschleunigt, aber wenn wir den Abdruck am Tatort einscannen könnten, würde das Tempo damit noch einmal erhöht.
Stellen Sie sich das vor. Wenn wir innerhalb einer Stunde nach einem Einbruch vor Ort sind und alles innerhalb von einer halben Stunde untersuchen, könnten wir möglicherweise anderthalb Stunden nach der Entdeckung des Verbrechens den Namen eines Einbrechers haben. Die Polizei kann dann an seine Tür klopfen, und er ist noch da mit dem Diebesgut in der Tasche. So bekommen die Opfer ihr Eigentum zurück. Und die Einbrecher beginnen zu verstehen, dass sich das nicht lohnt.«
Ebenso wie die Zufriedenheit gehören aber auch Stress und Belastungen zur Arbeit. Wir stellen hohe Anforderungen an die Menschen, von denen wir erwarten, dass sie für Gerechtigkeit sorgen, und wir wissen ihren Einsatz nicht immer zu schätzen. Wir können nicht nachvollziehen, wie sehr sie das, was sie erleben, belastet. Peter Arnold sagt: »Wir sehen manche der schrecklichsten Dinge, die Menschen einander antun können. Von einigen Fällen bin ich noch heute schockiert. Die meisten Leute können nach Haus gehen und mit ihren Familien über das reden, was sie bei der Arbeit getan haben. Wir können das nicht. Und selbst wenn ich es könnte, möchte ich nicht, dass meine Familie über manche der Dinge Bescheid weiß, die ich gesehen habe.«
ZWEI SPURENSICHERUNG AM BRANDORT
»Es ist gewöhnlich ziemlich dunkel dort, es stinkt, die Arbeit ist unangenehm und körperlich anstrengend. Man macht Überstunden und kommt verdreckt und nach verbranntem Plastik stinkend nach Hause. Es hat überhaupt nichts Großartiges. Aber es ist faszinierend.«
Niamh Nic Daéid, Sachverständige für Brandortermittlung
Sonntag, der 2. September, 1666. Ein Diener der Familie in der Pudding Lane in London erwacht hustend aus dem Schlaf. Als er merkt, dass es im Laden ein Stockwerk unter ihm brennt, klopft er an die Schlafzimmertür seines Meisters, des Bäckers Thomas Farriner. Alle Hausbewohner bringen sich, über die Dächer kriechend, in Sicherheit, außer der Dienstmagd Rose, die gelähmt vor Angst, in dem Feuer umkommt.
Bald beginnen die Flammen an den Wänden der Nachbarhäuser hochzuzüngeln, und der Oberbürgermeister Sir Thomas Bloodworth wird gerufen, damit er die Feuerwehrmänner bevollmächtigt, Gebäude einzureißen, um den Brand an der Ausbreitung zu hindern. Bloodworth ärgert sich, dass seine Nachtruhe gestört wurde, und ignoriert die dringenden Appelle der Feuerwehrmänner, es seien drastische Maßnahmen nötig. »Pah, sogar eine Frau könnte das mit ihrer Pisse löschen.« Damit verlässt er den Ort des Geschehens.
Am Vormittag verzeichnet der Tagebuchautor Samuel Pepys: »Der Wind ist sehr heftig und treibt das Feuer in die Innenstadt, alles erweist sich nach so langer Trockenheit als brennbar, selbst die Steine der Kirchen.« Bis zum Nachmittag ist London von einem Feuersturm erfasst, der durch »die Lagerhäuser mit Öl, Wein und Brandy« fegt und die Holzhäuser, Strohdächer, Pech, Stoffe, Fette, Kohle, Schießpulver – alle brennbaren Materialien des Lebens im 17. Jahrhundert – in Brand setzt. Durch die enorme Hitze der Feuersbrunst verbreiten sich die austretenden Gase rasch und steigen auf, ziehen frische Luft mit der Geschwindigkeit eines Sturms nach und versorgen auf diese Weise das Inferno mit noch mehr Sauerstoff. Das Große Feuer hatte sein eigenes Wettersystem geschaffen.
Als sich das Feuer vier Tage später legt, hat es den größten Teil des mittelalterlichen Zentrums von London zerstört, mehr als 13 000 Häuser, 87 Kirchen und die St. Paul’s Cathedral. Rund 70 000 der 80 000 Einwohner der Stadt sind mit einem Mal obdachlos.
Die Asche war noch warm, als sich die ersten Verschwörungstheorien verbreiteten. Die meisten Londoner konnten einfach nicht glauben, dass der Brand zufällig ausgebrochen war. Zu viele Umstände trafen zusammen: Das Feuer war in einem eng bebauten Stadtteil – alle Häuser waren aus Holz – entstanden. Ausgerechnet an dem Wochentag, an dem niemand auf der Straße unterwegs war und zu einer Uhrzeit, zu der alle schliefen. Dazu fegte ein Sturm durch die Stadt, und bei Ebbe stand die Themse niedrig.
Gerüchte grassierten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Ein Arzt, Thomas Middleton, hatte von einem Kirchturm aus beobachtet, wie zur gleichen Zeit verschiedene Feuer an mehreren unterschiedlichen und voneinander entfernten Stellen auszubrechen schienen. »Diese und ähnliche Beobachtungen ließen in mir die Überzeugung keimen, dass der Brand absichtlich genährt wurde«, schrieb er.
Vor allem Ausländer wurden verdächtigt, und in Moorfields wurde ein Franzose fast zu Tode geprügelt, weil er »Feuerbälle« in einem Behälter getragen haben sollte; sie stellten sich als Tennisbälle heraus. Gedichte und Lieder gaben der Verwirrung über Entstehung und Ursache des Brandes Ausdruck:
Niemand weiß, woher all der Wein kam;
Aus der Hölle, Frankreich, Rom – Amsterdam?
Anonym. »Ein Gedicht über den Großen Brand von London«
Der Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, ging von ganz oben aus. Karl II. hatte bei dem Feuer mehr Besitz verloren als irgendjemand sonst. Der König ermächtigte das Parlament, einen Ausschuss einzurichten, der die Feuersbrunst untersuchen sollte. Viele Augenzeugen meldeten sich. Einige sagten aus, sie hätten Leute Feuerbälle werfen sehen, oder sie gestanden gar, sie selbst geworfen zu haben. Ein gewisser Edward Taylor gab an, er sei mit seinem holländischen Onkel in die Pudding Lane gegangen, habe das Fenster von Thomas Farriners Bäckerei offen stehen sehen und »zwei Feuerbälle aus Schießpulver und Schwefel« hineingeworfen. Aber da Edward Taylor erst zehn Jahre alt war, wurde seine Darstellung nicht ernst genommen. Robert Hubert, der einfältige Sohn eines französischen Uhrmachers, gestand, das Feuer gelegt zu haben. Eigentlich glaubte ihm niemand, aber weil er darauf bestand, befanden ihn die Geschworenen für schuldig, und er wurde in Tyburn gehängt.
Ein Mitglied des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Sir Thomas Osborne, schrieb: »… all diese Behauptungen sind völlig unseriös, und die Menschen geben sich im Großen und Ganzen damit zufrieden, dass das Feuer zufällig entstand«. Letzten Endes fand der Ausschuss, dass die schreckliche Feuersbrunst durch »Gottes Hand, den starken Wind und das sehr trockene Wetter« verursacht worden sei.
Dass der Ausschuss nur zu einer so unbefriedigenden Schlussfolgerung kam, überrascht nicht. Damit Untersuchende komplexe Brandorte auswerten können, müssen sie verstehen, wie ein Feuer funktioniert. Damals im 17. Jahrhundert waren die wissenschaftlichen Kenntnisse beklagenswert ungenügend. Erst 1861 wurde solches Wissen für eine breitere Öffentlichkeit leicht zugänglich, als Michael Faraday seine Vorlesungen über Feuer in einem Buch veröffentlichte. The Chemical History of a Candle (Naturgeschichte einer Kerze) war die gedruckte Version von sechs Vorlesungen, die er für ein junges Publikum hielt. Das Buch wird auch heute noch als wichtiger Text zu diesem Thema betrachtet. Faraday nahm die Kerze als Beispiel, um den Verbrennungsvorgang im Allgemeinen zu erläutern. In einem Schlüsselvortrag seiner Vorlesungen demonstrierte er das Auslöschen einer Kerze, indem er ein Glasgefäß darüberstülpte. »Luft ist unbedingt notwendig für die Verbrennung«, erklärte er. »Und darüber hinaus müssen Sie verstehen, dass es frische Luft sein muss.« Mit »frischer Luft« meinte er »Sauerstoff«.
Michael Faraday, dessen Buch Naturgeschichte einer Kerze (1861) den Weg für die moderne Spurensuche am Brandort bereitete
Faraday war ein früher Sachverständiger, und er nahm seine Forschungsergebnisse – manchmal buchstäblich – aus dem Labor mit. Die Besitzer einer Zuckerraffinerie in Whitechapel, London, die bei einem Brand zerstört wurde, verklagten ihre Versicherung, die sich geweigert hatte, ihnen als Schadenersatz £ 15 000 auszuzahlen. Die Entscheidung des Falls hing davon ab, ob ein neu entwickeltes Verfahren unter Verwendung von erhitztem Walöl die Wahrscheinlichkeit eines Brandes erhöht oder reduziert hatte. Die Besitzer hatten ohne Wissen der Versicherer begonnen, das Verfahren anzuwenden. Bevor Faraday aussagte, führte er Experimente mit Walöl vor; er erhitzte es auf 200 °C, um zu zeigen, dass »alle Dämpfe des Öls außer Wasser leichter entflammbar sind als das Öl selbst«. Einer der Geschworenen im Gericht glaubte ihm nicht, also entzündete Faraday einen Teil der destillierten Dämpfe (Naphtha) aus dem Öl, das er in einem Fläschchen mitgebracht hatte, und »ein sehr abstoßender Geruch wurde sogleich überall im Gerichtssaal wahrgenommen«.
ENDE DER LESEPROBE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisenDas Original erschien 2014 unter dem Titel »Forensics – The Anatomy of Crime« bei Profile Books, London.
Copyright der Originalausgabe © Profile Books
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagillustration: © Dario Lo Presti/Shutterstock.com
Umschlagfoto: © Alan Peebles
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18468-1V001
www.knaus-verlag.de