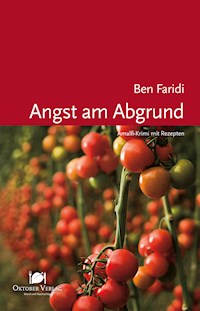
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Monsenstein und Vannerdat
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mord und Nachschlag
- Sprache: Deutsch
Jao Baptistas zweiter Fall führt den Kommissar von Europol an die italienische Amalfi-Küste, wo der millionenschwere britische Investor David Jefferson mit einer Kugel im Kopf und grausam verstümmelt aufgefunden wird. Baptista, der sich in der steilen abweisenden Felslandschaft äußerst unbehaglich fühlt, kämpft mit seiner eigenen psychischen und körperlichen Gesundheit, während er versucht, die letzten Wochen des exzentrischen Jefferson nachzuvollziehen. Dieser hatte offenbar ein Verfahren entwickelt, bei dem in den traditionellen Papiermühlen Amalfis neuartige Beschichtungen für eine revolutionäre Batterietechnologie erzeugt werden. Je näher Baptista der Lösung kommt, desto mehr bringt er sich selbst in tödliche Gefahr ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Faridi
Angst am Abgrund
Amalfi-Krimi mit Rezepten
Ben Faridi
Angst am Abgrund
Der zweite Baptista-Roman
Amalfi-Krimi mit Rezepten
Haftungsausschluss: Die Rezepte dieses Buchs wurden von Verlag und
Herausgeber sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Die Haftung des Verlags bzw. des Herausgebers für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
© 2012 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung des
Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
www.oktoberverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Britta Gerloff
Umschlag: Thorsten Hartmann
unter Verwendung eines Fotos von ozgurdonmaz/iStockphoto.com
Rezepte: Roland Tauber und Christina von Jakubowski
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN: 978-3-941895-22-5
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
»Ich glaube, letzten Endes ist zu wenig Hoffnung da. Der Mensch sieht eigentlich nicht, wenn man es einmal ganz grob ausdrückt, zu was er, wozu er kommuniziert. Wo ist sein Ziel? Es ist keine Vision da, auf die er hinsteuern kann. Er hat wenig Hoffnung und weiß eigentlich selbst nicht, was er will.«
Erich Fromm
Sonntag, 26. August
Jefferson war kein Mensch, der Angst vor etwas hatte. Er war sehr, sehr reich und hatte in seinem Leben so viel erlebt, dass er glaubte, es gäbe kaum Situationen, in denen er Angst haben würde. Vor diesem Mann hatte er Angst. Es war nicht die große Narbe, die quer über sein Gesicht lief. Es waren seine Augen. Sie waren ohne Leben, nahmen nicht Anteil an dem, was um ihn herum geschah.
Jefferson war mit dem Mann alleine in einer Höhle. Es war sehr dunkel, nur eine Fackel verbreitete flackerndes Licht, das an der Höhlenwand Schattenspiele erzeugte. Jeffersons Hände waren auf seinem Rücken mit einem Kabelbinder eng zusammengeschnürt. Er spürte seine Finger schon eine Weile nicht mehr.
Die rauchige Stimme des Mannes war vollkommen monoton und verbreitete in der Höhle eine eisige Kälte.
»Hast du geglaubt, dass du mit dieser Geschichte alleine durchkommst, so nah bei Neapel. Wir werden das Land verändern und du wirst uns nicht im Weg stehen.«
»Eure Zeit ist vorbei«, antwortete Jefferson. »Lange schon. Von mir werdet ihr nichts bekommen.«
Eigentlich wusste Jefferson, dass seine eigene Zeit vorbei war. Dennoch wollte er zeigen, dass er zu keinerlei Kooperation bereit war. Der Mann griff in die Innentasche seines Mantels und zog einen Revolver hervor. Jefferson hoffte, dass es schnell gehen würde.
Der Mann stellte sich direkt vor Jefferson und hielt die Waffe an seine Stirn. Jefferson spürte die Metallkugel, die seinen Schädel durchschlug, nicht mehr. Und er bemerkte nicht mehr das Ausstechen seiner Augen, nicht das Abschneiden seiner Finger und auch nicht den tiefen Fall und harten Aufschlag, der ihm das Genick, seine Oberschenkel und den Brustkorb brach. Für ihn spielte es keine Rolle mehr. Seine Angst war vorbei.
Am Rande des steilen Felsabhangs stand der Mörder in einem dunklen Mantel und hörte regungslos, wie der Körper dumpf aufschlug. Der Mann unterschied sich kaum von der Dunkelheit des Abhangs, an dem er stand. Das hagere Gesicht war untypisch für diese Gegend, ebenso wie der schwarze Mantel. Die Perfektion passte nicht in das südliche Italien.
Es war das erste Mal, dass er sich bei einem Auftrag unsicher fühlte. Er musste dem Opfer in den Kopf schießen und seinen Körper malträtieren. Denn es ging hier um ein Ritual. Der Mensch, der vom Weg Gottes abkam und in die Tiefe stürzte. Dafür musste der Körper unbedingt auf diesen gut einsehbaren Weg gebracht werden.
Abschließend überprüfte er mit einem Nachtsichtgerät nochmals, ob ihn jemand beobachtet haben könnte. Dann ging er zu seinem Wagen zurück und verschwand in der Dunkelheit.
Montagnachmittag, 3. September
Schon nach der ersten Haarnadelkurve war ihm schlecht. Jao Baptista wurde von einem amalfitanischen Polizisten namens Gianluca Festevola am Flughafen in Neapel abgeholt. Festevola blickte mit seinen dunkelbraunen Augen, die durch eine riesige dünne Nase getrennt waren und bei der man das Gefühl hatte, sie könnte die Sonne verdecken, unruhig zum Ausgang des Terminals. Da Gianlucas Cousine in den Wehen lag, übersprang der Italiener das übliche Espressotrinken sowie andere Höflichkeiten und stieg mit seinen schlaksigen langen Beinen rasch in den Fiat Punto ein, noch während Baptista sein schweres Gepäck in den Kofferraum packte.
Sobald die Türen geschlossen waren, fuhr er zügig vom Flughafen in Richtung der Bergstraße, die über Agerola und Furore nach Amalfi führte. Baptista konnte recht gut Italienisch sprechen, da er als Kind und Jugendlicher mit seinen Eltern in Europa mehrfach umziehen musste und dabei einige Jahre in Italien verbracht hatte. Aber die Worte schienen ihm alle entfallen zu sein, als Festevola mit immer höherer Geschwindigkeit fuhr. Für einen Ortsunkundigen war die Straße durch das Gebirge unübersichtlich. Man konnte den entgegenkommenden Verkehr nur ahnen, nicht sehen. Darüber hinaus schien es in den Kurven so eng zu sein, dass selbst zwei Kleinwagen kaum aneinander vorbeikommen dürften. Doch Gianluca Festevola fuhr auf dieser Straße, als gäbe es solche Einschränkungen einfach nicht.
Für einen Moment schloss Baptista seine Augen und hoffte dadurch, keine weiteren Panikanfälle bei heranrasenden Reisebussen zu bekommen, aber das machte alles nur noch schlimmer. Nach rund vierzig Minuten kamen sie am Stadtrand von Amalfi an, parkten vor einem der Palazzi und Festevola sprang eine Treppe in das erste Stockwerk hinauf. Baptista öffnete dagegen scheinbar in Zeitlupe die Beifahrertür, hievte seinen unbeweglichen und zu dicken Körper aus dem kleinen Wagen und musste sich sofort übergeben, weil ihm die Autofahrt auf den Magen geschlagen war. Schnaufend stand er einige Minuten da und atmete einfach nur. Dann säuberte er sich den Mund mit einem Taschentuch.
Eigentlich wollte er seinen Kollegen alles Mögliche gefragt haben, aber die Höllenfahrt hatte jedes Gespräch verhindert. Immerhin ging es um einen bestialischen Mord an einem reichen Engländer. Der Mord war so bestialisch und der Engländer so reich, dass Baptista überlegte, ob er der richtige Ermittler für diesen Fall war. Aber sein Chef war in diesem Punkt unmissverständlich deutlich gewesen.
Da die Spuren der Ermittlung quer durch Europa führten, wurde der Fall an die Sonderkommission der Europol weitergeleitet, für die Baptista arbeitete. Sofern sich in einem Kriminalfall die lokalen oder Landesbehörden nicht zuständig fühlten oder aus anderen Gründen nicht ermitteln konnten, wurde Baptistas Sonderkommission mit den Ermittlungen beauftragt. So kam es, dass Baptista sich im Spätsommer an der Amalfiküste wiederfand, die sich von Neapel nach Salerno zog und in deren Mitte sich das Städtchen Amalfi befand. Die kleine Stadt lag in einem engen Tal. An beiden Seiten strebten Berge steil in den Himmel. Die Stadt zog sich bis hinunter zum Meer und ergoss sich dort in einen Hafen, an dem viele Yachten Zwischenstation machten, wenn die Hautevolee der ganzen Welt von Positano oder Capri aus ihre Ausflüge startete.
In der Mitte des Tals verlief eine Straße, an deren beiden Seiten sich in unerträglicher Enge ein Wirrwarr an Häusern die Berge hochzog. Ohrenbetäubender Lärm hupender Autos und überlauter Reisegruppen, es war faszinierend und abstoßend zugleich. Nur wenige Meter davon entfernt stand Baptista über einem Abwasserkanal und versuchte sich an die Situation zu gewöhnen. Eigentlich badete er in Selbstmitleid. Ein herzzerreißender Schrei gellte durch die schmalen Gassen und weckte Baptista aus seinem Zustand. Kurz darauf folgte ein kleiner, nicht minder bewegender Schrei. Das Baby war geboren. Eine Hausgeburt, bemerkte Baptista überrascht mit nun etwas klarerem Kopf.
Er wusste nicht, ob er hinaufgehen und gratulieren sollte. Das Thema »Geburt« war ihm suspekt. Er hatte keine Kinder und war auch sonst Blut, Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten gegenüber sehr distanziert. Außerdem erinnerte es ihn daran, dass ihn zwei Frauen verlassen hatten, weil er keine Kinder wollte.
Da Festevola nicht herunterkam und Baptista nicht hinaufwollte, entschloss er sich, einen Kaffee zu trinken. Er lief wenige Schritte durch die enge Straße, wurde zweimal von Vespas zur Seite gehupt und setzte sich vor eine Bar. Er hatte sich in Erwartung des üblich heißen Wetters in Italien sehr sommerlich angezogen. Doch der kühle Wind in der Abenddämmerung zwischen den steilen Hängen von Amalfi ließ ihn frösteln. Trotzdem wollte er nicht in die Bar hineingehen, da Festevola ihn sonst nicht finden würde. Die Bedienung war ein schlanker, junger Mann mit schwarzen, gegelten Haaren. Er sah Baptista herablassend aus seinen hervorquellenden, übergroßen Augen an und zog lediglich die Augenbrauen fragend nach oben.
Als Baptista ebenfalls die Augenbrauen fragend nach oben zog, fragte der Kellner: »Expresso or Coffee?« Dabei entblößte er ein Gebiss, das nur vereinzelt Zähne enthielt. Baptista hatte eine leichte Gänsehaut, gleichzeitig ärgerte er sich. Obwohl sein Italienisch nicht besonders gut war, wusste er, dass mit dieser Formulierung nur Touristen belästigt wurden. Denn Italiener bezeichnen den Espresso immer als Caffè. Die Bedienung wartete noch, schien aber schon zu überlegen, ohne Bestellung wieder zu gehen.
Jao Baptista entschied sich für den Caffè. Irgendwie schien ihm die Situation abwegig. Er war schließlich kein Tourist, konnte sehr gut Italienisch und war dienstlich hier. Aber weder seine äußere Erscheinung noch seine innere Haltung ließen Menschen besonderen Respekt vor ihm zeigen. Das war er gewohnt.
Ein eigenartiger Ort, dachte Baptista, während er auf seinen Caffè wartete. Was mochte Menschen wohl früher bewegt haben, hier sesshaft zu werden? Aber es gab auf dem rund 50 Kilometer langen Küstenabschnitt zwischen Neapel und Salerno nicht nur Amalfi, sondern eine Vielzahl an kleineren und größeren Siedlungen. Insbesondere die Städte Positano und Amalfi der Costiera Amalfitana waren berühmt für den internationalen Jetset und sorgten für abstruse Preise im ansonsten eher einfachen und günstigen Süden Italiens.
Ein eigenartiger Ort für einen Mord. Der Tote hieß Jefferson und wurde vor einer Woche fünfzig Meter tief auf einen Felsen geworfen. Doch er erlebte den schrecklichen Sturz nicht. Denn zuvor bekam er eine Kugel in den Kopf geschossen und wurde laut Aktenlage gefoltert.
Baptista wusste von Jefferson lediglich, dass er Partner in einer Private Equity Gesellschaft namens Powerstream war. Und dass Jefferson sehr, sehr reich war. Er besaß einen Privatjet, mehrere Anwesen auf unterschiedlichen Kontinenten und das im zarten Alter von fünfundvierzig Jahren. Immerhin diese Eigenschaft passte zur Costiera Amalfitana.
Während Baptista fröstelnd auf den Caffè wartete, wurde ihm bewusst, dass er sich zwar auf längere Ermittlungen eingestellt und seinen großen Reisekoffer vollgepackt hatte, allerdings nur mit Sommersachen. Eine Erkältung war vorprogrammiert.
Mit einem unglaublich ignoranten Blick brachte ihm der Kellner schließlich den Caffè. Es war nur ein winziger Schluck in der Tasse. Das kleine Tütchen Zucker, das er hineinschüttete, verdoppelte den Inhalt schlagartig. Dann kitzelte ein lakritzartiger Geschmack seinen Gaumen und sein leerer Magen begann, wild gegen den Koffeinschub zu rebellieren.
In diesem Augenblick trat Gianluca Festevola überglücklich aus der Haustür und rief Baptista quer über die Straße zu: »Ein Junge!«
Er klatschte in die Hände und sah verklärt in den Himmel. Dann setzte sich Festevola zu Baptista und bestellte sich mit einer kurzen Handbewegung einen Caffè, der ihm nur wenige Sekunden später von dem gleichen Kellner mit einer freundlichen Geste serviert wurde.
»Giovanna hat einen Sohn bekommen«, sagte er noch einmal beglückt.
»Wie soll er denn heißen?«, fragte Baptista, um überhaupt etwas zu sagen.
»Filippe Alessandro«, sagte Festevola begeistert, als wäre es sein eigener Sohn. »Du musst meine Cousine Giovanna unbedingt kennen lernen. Sie ist eine großartige Frau. Ich werde dann wohl Taufpate werden.«
Obwohl Italiener in Amtsdingen zu ausufernder Höflichkeit und überbordenden Titulierungen von allem und jedem neigen, duzte Gianluca ihn sofort. Vielleicht war es der amalfitanische Überschwang oder auch nur der stolze Moment eines Taufpaten.
»Hast du auch Kinder?«, fragte er Baptista.
Da war sie wieder, Baptistas Lieblingsfrage. Er schüttelte den Kopf energisch und wechselte das Thema.
»Ich würde mich gerne umziehen und etwas frisch machen«, sagte Baptista.
»Gerne, gehen wir.«
Festevola goss den winzigen, starken Caffè hinunter, legte einige Münzen auf den Tisch und verabschiedete sich überschwänglich von mindestens zehn Männern, die im Inneren der Bar an der Theke standen und denen er allen im Gehen noch lauthals von draußen über die erfolgreiche Geburt berichtete. Dann ging er mit Baptista zum Wagen.
Er hupte kurz, als er losfuhr, und wählte erneut eine Strecke, die Baptista kalten Angstschweiß auf die Stirn trieb. Sie fuhren mitten über die Hauptstraße. Es wimmelte rechts und links von Touristen, die sich in Busstärke durch den Ort quetschten, und Vespas, die – ohne die geringste Notiz von Kindern und Alten zu nehmen – verbotenerweise in der Gegenrichtung an ihnen vorbeifuhren.
Irgendwie bewältigte Festevola den Weg, ohne auch nur nervös zu werden, und bog dann mit zwei gezielten Rangierzügen in eine winzige Steilstraße ein. Schließlich hielt er auf einem Parkplatz, der genau für diesen Wagen in den Fels gehauen schien, und stieg beschwingt aus.
»Ich gehe vor«, sagte er und nahm das Gepäck von Baptista.
Im ersten Moment wollte Baptista es ihm wieder aus der Hand nehmen, doch dann sah er eine steile Treppe, die sie nach oben steigen mussten und beschloss, sich ein anderes Mal zu revanchieren. Denn er wusste, dass sein Übergewicht und sein untrainierter Kreislauf ihn bis aufs Äußerste fordern würden. Und in der Tat schwitzte er sein dünnes Hemd am Rücken vollkommen durch.
Nach 78 Treppenstufen standen sie vor einem kleinen Häuschen. Festevola schloss auf, machte Licht und zeigte ihm ein reizendes kleines Apartment, dessen Balkon einen atemberaubenden Ausblick auf die Bucht von Amalfi bot.
»Ich hole dich in einer Stunde zum Abendessen ab«, rief er, während er sich schon wieder nach unten begab.
Jao setzte sich und atmete einige Minuten, um wieder zur Ruhe zu kommen. Er hatte in seiner Laufbahn schon oft Angst gehabt, aber noch nie hatte er dieses Gefühl einer Landschaft gegenüber. Der Blick die Steilküste hinab zum Meer war schwindelerregend. Alle Straßen schienen zu eng zu sein. Es gab an keiner Stelle die Weite, die er von anderen Landschaften Italiens gewohnt war, nur steile und abweisende Berghänge.
Er fühlte sich in einen Grundzustand der Panik versetzt und beschloss, dass er diesen Fall schnell beenden musste, um seinem Wohlbefinden etwas Gutes zu tun.
Beim Auspacken legte Baptista seine Akte über den Fall auf den Tisch. Auf der Titelseite stand als betreuende Organisation »Carabinieri – Ministero della Difesa – Legione Campania, Polizia Giudiziaria, Amalfi«. Carabinieri und Polizia hatten in Italien im Sinne einer föderalen Struktur ähnliche Aufgaben und kontrollierten sich gegenseitig. So wurde verhindert, dass sich zu viel Macht in einer Polizeiorganisation konzentrierte. Andererseits entstanden auf diese Weise auch immer wieder Kompetenzrangeleien. Aber das kannte er aus jeder Polizeiorganisation. Seine Aufgabe war es, durch seine Position außerhalb der Landesorganisation möglichst wenig in solche Rangeleien involviert zu werden.
Montagabend, 3. September
Pünktlich um acht Uhr abends holte ihn Festevola ab. Diesmal hatte sich Baptista passender für das Wetter gekleidet. Aber natürlich begann er bereits beim Hinabsteigen der 78 Stufen erneut zu schwitzen. Sie stiegen in Festevolas Wagen und fuhren im Dunkeln zu einem Restaurant. Bei der Fahrt wurde Baptista wieder übel von den engen Kurven und steilen Abgründen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er das Essen überstehen sollte.
Der Parkplatz war von der Straße aus kaum einzusehen. Festevola bog zügig in eine Parklücke. An einem kleinen Brunnen vorbei traten sie in ein typisches italienisches Ristorante. Das eigentliche Spektakel war jedoch der Gastraum selbst, der zur Hälfte frei über einem Abgrund schwebte. Große Glasscheiben verstärkten den Effekt. Sie setzten sich an den Tisch, der mit einer blendend weißen Tischdecke und wunderbaren Tellern und Gläsern gedeckt war.
Baptista konnte seinen Blick jedoch kaum vom Abgrund wenden, der in der Abenddämmerung vermutlich noch dramatischer wirkte als tagsüber. Wieder ergriff ihn eine leichte Panik. Schließlich nahm er die Menükarte, aber Festevola stoppte ihn und rief den Wirt.
»Buona sera, Francesco. Come stai?«
Francesco lächelte milde mit seinen dunkelbraunen Augen, die sich über seinem stoppeligen und ergrauten Bart befanden. Festevola lächelte zurück. Seine Nase warf einen großen Schatten über die rechte Wange. Baptista überlegte kurz, ob die beiden Augen von Festevola wegen der großen Nase jemals das gleiche Bild der Welt sehen konnten. Vielleicht entsteht dadurch eine gänzlich andere Wahrnehmung der Welt, überlegte er. Dann verwarf er den unsinnigen Gedanken und lenkte seine Aufmerksamkeit auf Festevola und den Wirt.
»Es könnte mir nicht besser gehen, wenn ich dich bei mir begrüßen darf«, sagte er. »Und deinen Gast Signor Baptista.«
Baptistas Name kam mit einem Unterton über Francescos Lippen, der zu sagen schien, dass er bereits alles über den Commissario wusste.
»Da vergesse ich sogar das schlechte Wetter, das im Moment angekündigt ist«, fuhr Francesco fort. »Übermorgen soll immerhin Linda Barnes hier erscheinen, um etwas Besonderes zu essen.«
»Die Linda Barnes?«, fragte Baptista verblüfft.
Barnes war im Moment eine der angesagtesten Hollywood-Sternchen und verdiente Gagen im mehrstelligen Millionenbereich. Ihr neuester Film war eine Fantasysaga und lockte halb Europa ins Kino.
»Nun ja«, antwortete Francesco mit einem minimalen Achselzucken, dem zugleich ein offensichtlicher Stolz beiwohnte. »Das ist hier in der Saison nicht ungewöhnlich. Für Linda Barnes wird es allerdings der erste Besuch in meinem Hause sein.«
Francesco hielt kurz inne.
»Habt ihr spezielle Wünsche oder darf ich euch einfach überraschen?«
Gianluca Festevola sah gespannt zu Jao Baptista. Der zögerte keine Sekunde.
»Ich lasse mich gerne überraschen.«
Die beiden anderen atmeten erleichtert auf, weil damit eine zentrale kulturelle Frage geklärt war, die eine der wichtigsten italienischen Institutionen betraf, das Essen. Mit Zufriedenheit verschwand Francesco in der Küche und brachte zunächst einen Bitterino, um die Zeit bis zur Vorspeise zu verkürzen. Das Getränk leuchtete Rot gegen den schwarzen Nachthimmel und das mondbeschienene Meer am Horizont.
»Wo stehen wir denn mit den Ermittlungen aus Ihrer Sicht im Moment?«, fragte Baptista, während er an seinem Getränk nippte und feststellte, dass seine Übelkeit anscheinend verschwunden war.
»Fangen wir von vorne an: Zwei kanadische Spaziergänger haben die Leiche vor acht Tagen gefunden, am Sonntagabend. Sie liefen einen der Wanderpfade entlang, den Sentiero degli Dei. Dieser Weg führt von dem Bergdorf Agerola, das gleich hier hinter Furore gelegen ist, sieben Kilometer an steilen Felswänden entlang nach Positano ans Meer. Bei vielen Touristen ist das ein beliebter Wanderweg. Das kanadische Pärchen wurde von drei wilden Hunden begleitet. Manchmal suchen die Hunde die Nähe der Wanderer und hoffen auf eine kleine Belohnung. Nun ja, die Hunde begannen plötzlich zu bellen und rannten überraschend fort, nachdem sie die Wanderer mehrere Stunden begleitet hatten. Nach einiger Zeit kamen sie aufgeregt zurück und ließen sich erst beruhigen, als die Touristen ihnen folgten. Von einem steilen Pfad aus konnten sie die Leiche sehen. Mit einem Mobiltelefon verständigten die Wanderer die Polizei.«
Sie wurden durch die Ankunft der Antipasti unterbrochen. Eine Platte mit Mozzarella di Bufala, gegrillten Auberginen, eingelegten Bohnen und in Weinblättern eingerollten Sardellen stand garniert mit Basilikum und verträufeltem Honig auf dem Tisch. Baptista lief unwillkürlich das Wasser im Mund zusammen, obwohl ihm nach der Fahrt mit dem Auto eben noch übel gewesen war. Dazu wurde ein Hauswein aus Amalfi serviert. Bei den ersten Bissen vergaß er, dass er auf einer Dienstreise war. Der Bericht von Festevola holte ihn in die Wirklichkeit zurück.
»Die Polizei kam, so schnell es die engen Wege zuließen. Der Fundort der Leiche befand sich zum Glück in der Nähe eines Wegs, den der Wagen gerade noch bewältigen konnte. Den Leichnam konnte man allerdings nicht ohne weiteres bergen. Ein Bauer aus der Nachbarschaft stellte einen kleinen Lastwagen mit Kran zur Verfügung. Über fünfzig Meter musste sich ein junger Bergsteiger aus Agerola abseilen lassen, um den Toten zu erreichen. Selbstverständlich wurde alles bestens dokumentiert, denn man sah sofort, dass es sich um einen Ausländer handelte. Der Tote hatte Ausweis, Geld und sonstige Papiere bei sich. Vom Weg aus gesehen dachten alle an ein Unglück. Als man die Leiche schließlich oben hatte, war offensichtlich, dass es kein Unfall war. Der Gerichtsmediziner ließ mitteilen, dass Jefferson durch einen gezielten Schuss in den Kopf getötet wurde.«
Baptista war eigenartig hin- und hergerissen zwischen dem köstlichen Wein, den Antipasti und dem Bericht von Festevola. Dann kam eine reizende Bedienung und räumte das benutzte Geschirr ab. Festevola hielt kurz inne und sah aus dem Fenster. Der Himmel war inzwischen nachtschwarz. Deutlich sahen sie die Sterne und die Beleuchtung der einzelnen Häuser an der schmalen Küste. Wärme und Zufriedenheit erfüllten Baptista. Der Primo Piatto wurde serviert, Spaghetti al pescatore mit Venusmuscheln in einer Weißweinsoße. Schon beim ersten Bissen tropfte es auf Baptistas Hemd. Er war seine eigene Ungeschicklichkeit bereits gewohnt und schüttelte lediglich tief im Innern seinen Kopf darüber. Gianluca bemerkte es nicht einmal und erzählte weiter.
»Wir konnten den Namen Jefferson trotz möglicher Namensähnlichkeiten eindeutig identifizieren. Es handelt sich um eine sehr begüterte Person, wie man sie in Amalfi, Positano oder auf Capri häufig antrifft. Jefferson wohnte in London in einem noblen Apartment. Er war nicht verheiratet und ist standesamtlich als Vater von drei unehelichen Kindern eingetragen. Weder die Frauen noch die Kinder wollten mit ihm zu tun haben, als wir sie benachrichtigen ließen.«
»Eigenartig«, sagte Baptista. »Wahrscheinlich gibt es doch einiges zu erben.«
»Das schon. Aber das wird alles über einen Anwalt geregelt. Niemand wollte herfliegen. Nein, halt. Sein Vater lebt noch. Ein alter Mann, über achtzig, lebt in Spanien. Der wollte kommen, fühlte sich aber zur Zeit gesundheitlich nicht in der Lage. Er wollte so bald wie möglich nachkommen.«
Baptista fand die äußeren Umstände schon bei den ersten Informationen zutiefst merkwürdig. Welches Geheimnis verbarg diese Person, dass ihn keiner mochte, nicht einmal bei seinem Ableben und dem vielen Geld? Vielleicht würde er es lüften, möglicherweise blieb das eigentlich Wichtige aber im Dunkeln. Die Menschen nehmen das Wesentliche mit ins Grab, obwohl sie uns ihre Spuren hinterlassen, dachte er. Der Rotwein machte ihn gefühlsduselig.
»Noch etwas anderes: Jefferson besitzt die spanische und die englische Staatsangehörigkeit. Wir haben daher den Fall schnell an übergeordnete Behörden abgegeben, da wir keine Befugnisse zur direkten Recherche in diesen Ländern besitzen.«
»Gibt es denn aus der Spurensicherung heraus erste Hinweise?«
»Wir haben wegen der fehlenden Finger natürlich keine Fingerabdrücke nehmen können.«
»Aber die Papiere hatte der Mörder bei der Leiche gelassen, nicht wahr?«, wendete Baptista ein.
»Das ist richtig.«
»Der Leichnam sollte entstellt werden«, resümierte Baptista.
»Die Leiche hat mehr als vierundzwanzig Stunden am Fundort gelegen«, fuhr Gianluca fort. »Der Mörder war wahrscheinlich ein Profi. Es ließen sich auch keine auffälligen Reifenspuren in der Nähe des Fundortes entdecken. Wir haben an der Absturzstelle Blut von Jefferson gefunden. Vermutlich wurde er also in der Nähe getötet. Wir haben aber noch keine Anhaltspunkte, wo das hätte sein können. Entweder war das ein sehr raffinierter Auftragskiller oder jemand, den Jefferson kannte.«
In diesem Moment wurde der Hauptgang serviert, ein gegrillter Schwertfisch, garniert mit Zitronen und etwas Gemüse. Der neue Gang führte auch zum Themenwechsel.
»Wie geht es Ihrer Cousine?«, fragte Baptista. »Hat sie die Geburt gut überstanden?«
»Danke der Nachfrage. Sie war natürlich noch geschwächt, aber wohlauf. Ihre Mutter, also meine Schwester, hilft ihr.«
»Was ich fragen wollte: Sind Hausgeburten hier eigentlich üblich?«
»In Italien insgesamt eher nicht. An der Amalfiküste sind sie häufiger, weil die Fahrt in ein gut ausgestattetes Krankenhaus nach Salerno oder Neapel für eine Schwangere über die Bergstraßen risikoreich sein kann. Als Verkehrspolizist habe ich schon mehrfach beobachtet, wie ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht nicht vorankam, weil sich zwei Busse an einer Haarnadelkurve rangierunfähig verkeilt hatten.«





























