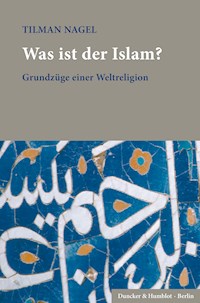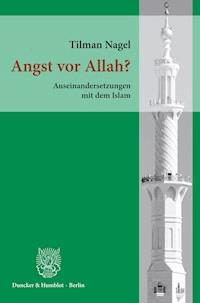
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Sprache: Deutsch
Die veröffentlichte Wahrnehmung des Islams wird von Tabus beherrscht, die eine freimütige, intellektuell redliche Beschäftigung mit den Eigenheiten dieser Religion und mit den Machtansprüchen vieler ihrer Funktionsträger behindern, wenn nicht gar verhindern. Dieser Umstand ermöglicht das Heranwachsen einer Parallelgesellschaft, durch die das freiheitliche, säkularisierte Gemeinwesen, dessen Vorzüge der erdrückenden Mehrheit eine Selbstverständlichkeit sind, schroff abgelehnt wird. Angesichts dieses Sachverhalts plädiert Tilman Nagel für eine tabufreie Auseinandersetzung mit den Merkmalen des Islams, die seinen Bekennern eine fruchtbare Teilhabe an unserem Gemeinwesen erschweren. Aus verschiedenen Blickwinkeln beschreibt der Autor die geschichtliche wie auch die gegenwartsbezogene Dimension dieser Merkmale. Denn erst deren zuverlässige Kenntnis befähigt zu einer Analyse der Probleme, vor die Europa durch die Zuwanderung von Muslimen gestellt wird. Probleme, die durch Beschönigen und Beschweigen nicht zum Verschwinden gebracht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
TILMAN NAGEL
Angst vor Allah?
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlag: Minarett der Großen Moschee in Abu Dhabi (© bARTiko, fotolia)
Alle Rechte vorbehalten © 2014 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Berlin Druck: AZ Druck und Datentechnik, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-14373-3 (Print) ISBN 978-3-428-54373-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-84373-2 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Den vielen Bürgern, die sich durch Verlautbarungen über den Islam ein ums andere Mal hinters Licht geführt fühlen,
den Angehörigen der politisch-medialen Klasse, die sich das Nachdenken über die muslimischen Machtansprüche nicht von den Sachwaltern der politischen Korrektheit verbieten lassen,
den mutigen Muslimen, die ihren Weg in einen freiheitlichen Rechtsstaat suchen oder schon gefunden haben,
ist dieser Band gewidmet.
Vielleicht hilft er bei der Beantwortung der Fragen, von denen sie alle bedrängt werden.
Vorwort
„Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“ Mit Erstaunen las ich diesen Satz in einer Rede, die im Jahre 2010 der damalige Bundespräsident zum Tag der Deutschen Einheit gehalten hatte. Eine politisch-religiöse Heilsbotschaft, deren Vorschriften wesentliche Teile unserer deutschen Kultur als Unglauben verurteilen,1 nämlich die Musik, die Malerei, die Bildhauerei,2 desgleichen die Früchte unserer Wissenschaft, sofern sie nicht durch den Koran, eine Schrift aus dem frühen 7. Jahrhundert, gerechtfertigt werden, soll nun Teil unserer Geschichte sein!3 Eine Religion, die unsere Volkskultur als pures Teufelszeug verunglimpft, etwa den Karneval und das Oktoberfest! Wieso gehört diese Religion, deren eifrige Anhänger unseren Tageslauf ihren Ritualpflichten unterwerfen und ihren Töchtern den Umgang mit unseren Söhnen verbieten wollen,4 „inzwischen“ zu Deutschland? Haben die Wortführer dieser Religion auch nur in irgendeinem Punkte mit eindeutigen Äußerungen ein Abweichen von ihren sozialen Dogmen, eine Bereitschaft zum Überdenken ihrer diesbezüglichen Maximalforderungen zu erkennen gegeben, und zwar nicht nur vor Vertretern der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch gegenüber ihren Glaubensbrüdern in der islamischen Welt? Nur dann wäre doch überhaupt von einer „inzwischen“ erworbenen Zugehörigkeit zu reden oder wenigstens vom Willen, dazuzugehören! Jene politisch-religiöse Heilslehre, deren Vordenker eine Grundfähigkeit der deutschen, ja der europäischen Kultur vermissen lassen, nämlich die [8] Fähigkeit zur kritischen Selbstprüfung, die einen dazu drängt, die eigenen Gewißheiten wenigstens vorübergehend hintanzustellen und sich in den Anderen hineinzudenken, soll nunmehr zu Deutschland gehören? Jene Heilslehre mit ihrem rücksichtslosen „sozialen Imperialismus“ (Georges Anawati, vgl. Abschnitt D., Einführung), ihrer Unterdrückung der Frau, ihrer Ablehnung der Religionsfreiheit, soll ein Teil unseres Landes und unserer Geschichte geworden sein, ohne daß ihre Wortführer die Prinzipien unseres säkularen Gemeinwesens, zu denen jene Heilslehre in einem krassen Widerspruch steht, ausdrücklich, vollständig und in verbindlicher Form anerkannt hätten? Eine absurde Vorstellung, selbst wenn der höchste Vertreter der deutschen politischen Klasse sie vorträgt!
Längst hat sich im öffentlichen und im veröffentlichen Reden über den Islam eine befremdliche Asymmetrie eingebürgert: Muslime, insbesondere Angehörige der islamischen Interessenverbände, brauchen nur zu behaupten und zu fordern. Wer diese Behauptungen und Forderungen wegen ihrer meist evidenten Unvereinbarkeit mit unserem säkularen Gemeinwesen ablehnt, hat einen bestens dokumentierten Nachweis dieser Unvereinbarkeit zu leisten, der am Ende doch nicht beachtet wird, da es den Argumenten an „islamischer Authentizität“ mangele. Hier schnappt die Falle zu, in die der Europäer gerät, der die Selbstreflexivität des eigenen Denkens, die produktiven Zweifel an der Angemessenheit der eigenen Position auch bei seinem muslimischen Gegenüber unterstellt. Bei jenem aber sucht man sie meist vergeblich; was der Muslim im Dialog mit Nichtmuslimen vorträgt, ist in der Regel keineswegs eine nach innerer Prüfung und Anfechtung errungene und daher revidierbare Ansicht. Es ist für ihn vielmehr die ewige, unanfechtbare Wahrheit: „Ihr (Muslime) seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen gestiftet wurde. Ihr gebietet, was recht ist, und verbietet, was verwerflich ist, und glaubt an Allah. Wenn die Schriftbesitzer“ – nämlich die Juden und die Christen – „(ebenfalls) glaubten, wäre es besser für sie. Einige unter ihnen sind zwar“ – im Sinne der koranischen Botschaft – „gläubig geworden. Aber die meisten von ihnen sind Frevler“ (Sure 3, 110). Der Muslim spricht zum Andersgläubigen stets aus der Position des Rechthabenden, warum sollte er sich um Empathie mit dem Unrechthabenden bemühen? Allah hat es so bestimmt, daß die Muslime stets die Überlegenen, die Oberen sind (vgl. den zweiten Abschnitt). So forderte der türkische Ministerpräsident Erdoğan den Abriß eines bei Kars errichteten Mahnmals, das an den Völkermord an den Armeniern erinnerte; es überschatte eine Moschee und die Grabstätte eines Sufis, machte er zur Begründung geltend. 5 Im Umgang mit deutschen Regierungsorganen pflegen die Vertreter der muslimischen Verbände ebenso den Ton des Überlegenen, der zu for[9]dern, nicht aber zu geben hat. Und sie haben damit Erfolg. So wurde ich Zeuge, wie ein von der Arbeitsgruppe 1 der ersten Deutschen Islamkonferenz verabschiedeter Text nach einem nachträglichen Einspruch der beteiligten muslimischen Verbandsvertreter ohne Wissen der übrigen Mitglieder abgeändert wurde; der damalige Innenminister verteidigte dieses grob regelwidrige Vorgehen. Man stelle sich einen analogen Vorgang vor, jedoch mit vertauschten Rollen! Er ist nicht vorstellbar.
Gern und ausgiebig kritisiert man in der Öffentlichkeit das Christentum, insbesondere die beiden großen Kirchen, sei es aus gutem Grund, sei es einfach aus Konvention. Aber über den Islam, von dem man in der Regel ebenso wenig oder noch weniger weiß, soll kein kritisches Wort fallen. Kommt beispielsweise in der Diskussion nach einem Vortrag die islamische Knechtung der Frau zur Sprache, so finden sich sofort lebhafte Stimmen, die genau wissen, daß es so schlimm gar nicht sei und daß die christlichen Kirchen bis vor kurzem ja ähnliche Positionen vertreten hätten: Was man im Hinblick auf das Christentum nie und nimmer zu dulden gewillt wäre, sondern zum Anlaß schärfster Verurteilung nähme, ist man geneigt, mit Bezug auf den Islam für erträglich zu erklären. Hat man Angst vor Allah?
Eine in langjähriger Erfahrung gesammelte Enttäuschung über die mangelnde Bereitschaft vieler, wenn nicht der meisten Mitglieder unserer politisch- medialen Klasse zur nüchternen, wirklichkeitsnahen Wahrnehmung des Islams6 und derjenigen seiner Charakterzüge, die unserer Kultur zuwiderlaufen, hat mich in dem Plan bestärkt, einige meiner Aufsätze und Vorträge, die sich mit dieser Thematik befassen, zusammenzustellen und zum Teil erstmalig zu veröffentlichen. Indem sich die Mehrheit unserer politisch- medialen Klasse auf die politische Korrektheit beruft, verbittet sie sich die kritische Auseinandersetzung mit dem Islam.7 Ein solcher Versuch der Einschränkung der Wissenschafts- und Meinungsfreiheit ist nur damit zu erklären, daß man sehr wohl weiß, daß die Kritiker einen wunden Punkt ansprechen. Doch um des lieben Friedens willen und wider besseres Wissen soll mit Bezug auf den Islam die Erinnerung an die Grundwerte [10] unserer geistigen, politischen und sozialen Kultur unterbleiben, vor allem aber jeder Hinweis darauf, daß unsere Kultur es wert ist, gegen ihre frommen Verächter muslimischen Glaubens verteidigt zu werden. Freiheit und Rechtssicherheit sind nichts Selbstverständliches. Zuzuschauen, ob sie gleichsam von selbst den Attacken illiberaler Kräfte standhalten, das ist ein unverantwortbares Experiment! Verständnislos beobachten Muslime, die sich bewußt für unser freiheitliches säkulares Gemeinwesen entschieden haben, wie sich viele seiner Verantwortungsträger auf eben dieses Experiment einlassen. Diesen Muslimen Argumente für das Gespräch mit Vertretern der politisch-medialen Klasse an die Hand zu geben, ist eines der Ziele dieses Buches. Zweitens soll es dem nichtmuslimischen Bürger fundierte Aussagen liefern, mit denen er die alltäglichen Schönfärbereien zurückweisen und die Saumseligen und Bequemen der politisch-medialen Klasse zur Wahrhaftigkeit auffordern kann. Druck von unten ist nötig, sowie vor allem eine sachgerechte Unterstützung jener Politiker und Journalisten, die sich ihrer Pflicht zur Bewahrung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht entziehen.
Nur scheinbar geben die Umstürze, die seit einiger Zeit die arabische Welt erschüttern, denjenigen recht, die es für ausgemacht halten, daß Demokratie und Islam wahlverwandt (vgl. unten, dritter Abschnitt) seien. Von Freiheit und Selbstbestimmung ist in der Tat viel in den Berichten über jene Ereignisse die Rede. Nirgends aber davon, daß der Islam nicht das oder ein Grundelement der angestrebten neuen Ordnung sein solle. Damit aber bleibt, wie immer die Geschehnisse sich entwickeln werden, die Zugehörigkeit zu dieser Religion das entscheidende Kriterium für die uneingeschränkte Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben. Wie sich Parlamentarismus und Demokratie unter dieser Bedingung verformen, ist am Beispiel Pakistans zu studieren. Im Jahre 1930 forderte Muhammad Iqbal (1877–1938), auf dem indischen Subkontinent müsse ein eigener islamischer Staat errichtet werden, damit sich der Geist des Islams unter den Voraussetzungen der Neuzeit frei entfalten könne.8 Auf der Basis islamischer Grundsätze sollte, wie 1949 versprochen wurde, eine Verfassung ausgearbeitet werden, die „Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Toleranz und soziale Gerechtigkeit“ für jeden Staatsbürger garantieren sollte. Dieser 1955 verabschiedeten Verfassung wurde schon ein Jahr später eine Klausel hinzugefügt, in der in allgemeinen Formulierungen bestimmt wurde, daß keinerlei Gesetze erlassen werden dürften, deren [11] Inhalt nicht mit dem in Koran und Hadith auffindbaren islamischen Recht, der Scharia, übereinstimme. Bereits geltende Gesetze sollten im Hinblick hierauf überprüft und nötigenfalls geändert werden.9 Die pakistanische Verfassungsgeschichte ist seither als ein Ringen um eine immer strengere Auslegung dieser Klausel zu interpretieren. Die Schriften des pakistanischen Wortführers der totalen Islamisierung, Abū l-ʿAlāͱ Maudūdīs (1903–1979), sind längst ins Arabische übersetzt, und es wäre ein Wunder, wenn die in ihnen propagierten Verheißungen nicht einen großen Teil der jugendlichen Protestierer beflügelten. Unter der AKP-Regierung hat auch die Türkei, die von den meisten Vertretern unserer politisch-medialen Klasse als ein Musterbeispiel für Demokratie im Islam oder für islamische Demokratie gepriesen wird, den Weg zur Islamisierung der Staatsorgane eingeschlagen, der zu einer Einschränkung von Bürgerrechten führt.10
Selbstverständlich geht es in diesem Buch nicht darum, einer Politik weltweiten Eingreifens zugunsten von Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit usw. das Wort zu reden. Im Gegenteil, wir sollten erkennen, daß es nicht in unserer Macht steht, unsere politische Kultur in Weltgegenden einzupflanzen, in denen die geschichtlichen Voraussetzungen für die Rezeption ihrer Grundideen fehlen. Inzwischen gibt es genug Beispiele dafür, daß derartige Unternehmungen der Überdehnung der „Vormacht“ des Westens scheitern und vor allem den Haß gegen ihn schüren. Vielmehr wendet sich das Buch an den deutschen Leser, der vor der durch unsere politische Klasse bislang nicht beantworteten Frage steht, ob man es zulassen soll, daß sich innerhalb des säkularisierten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens eine Bevölkerungsgruppe etabliert, die die Religionszugehörigkeit von einer privaten Angelegenheit zu einem Faktor der Ausübung von Macht erhebt. Soll es hingenommen werden, daß unter Berufung auf die von der Verfassung garantierte Religionsfreiheit die politische Religion Islam für ihre Anhänger ein eigenes Recht durchsetzt, auf welchen Bereichen des Alltags auch immer? Kann es zugelassen werden, daß die gegen unsere säkularisierte Ordnung gerichteten Lehren, die der Koran und das Hadith enthalten, verbreitet werden, ohne daß man ihnen widersprechen dürfte, da sie ja religiös begründet seien? Eine Diskussion über solche Fragen kann nur gelingen, wenn man sich eingehend über den Islam informiert hat. Dann wird es möglich werden, die vorhin erwähnte fatale Asymmetrie des Diskurses über den Islam zu unterlaufen und mit den Wortführern dieser Religion die spannungsgeladenen, aber redlichen Auseinandersetzungen zu führen, die man bislang [12] so beharrlich gemieden hat. Unserer politisch-medialen Klasse wird dabei hoffentlich aufgehen, welch ein unschätzbares Erbe sie zu wahren und zu mehren hat, ein Erbe, das dann seine Anziehungskraft auch auf die Mehrheit der Muslime in Deutschland entfalten wird.
Wie bereits erwähnt, wendet sich das Buch auch an jene muslimischen Mitbürger, die sich bewußt für unseren Staat und seine Gesellschaft entschieden haben. Sie geraten, sobald ihre Religionszugehörigkeit zur Sprache kommt, oft in eine schwierige Lage. Gegen ihren Willen werden sie als Verfechter jener islamischen politisch-religiösen Vorstellungen wahrgenommen, denen ihre schariagebundenen Glaubensgenossen nun auch in Europa zum Durchbruch verhelfen wollen. Wie sollen sie sich verhalten, wenn sie auf ihre vermeintlichen Überzeugungen angesprochen werden? Manche unter ihnen haben die Kraft, das Bekenntnis zum Islam für ihre Privatsache zu erklären und darauf zu bestehen, daß für sie die Einhaltung der Glaubenspraxis nur eines der Rechte des Bürgers dieses Staates darstellt: Das Recht der Religionsausübung ist in ihrer Sichtweise lediglich ein Teilaspekt der Rechte und Pflichten des Bürgers eines säkularisierten freiheitlichen Rechtsstaates, die nicht aus einer bestimmten religiösen Heilsbotschaft abgeleitet, sondern selbst mit einer atheistischen Weltanschauung vereinbar sind. Diese „säkularisierten“ Muslime nehmen in Kauf, von einem großen Teil ihrer in Deutschland lebenden Religionsgenossen eben deswegen als Verräter an der Sache des Islams gebrandmarkt zu werden, dem es doch von Allah bestimmt sei, über die Glaubenspraxis hinaus Gesellschaft und Politik zu prägen.
Andere, vielleicht die meisten der sich dem säkularen Gemeinwesen verbunden fühlenden Muslime, meiden religiöse Themen und ziehen sich notfalls auf die Position zurück, eine Kritik am Islam sei unzulässig; jene Gruppierungen, die für eine Islamisierung Deutschlands einträten, interpretierten allerdings den Koran falsch. Nähere Erläuterungen, worin die falsche Auslegung denn nun bestehe und, vor allem, warum man nicht öffentlichkeitswirksam gegen sie Einspruch erhebe, unterbleiben. Und damit berühren wir den entscheidenden Punkt: Der nichtmuslimische Bürger fragt sich, warum selbst in wichtige Ämter gewählte „säkulare“ Muslime so viel Zurückhaltung zeigen, wenn es darum geht, die erheblichen Differenzen zwischen den Grundsätzen ihrer Religion und denen des freiheitlichen Rechtsstaates auf den Begriff zu bringen. Wer, wenn nicht sie, ist gefordert, unter den eigenen Religionsgenossen aufklärend zu wirken? Es entspricht sicher den Tatsachen, daß manche Muslime in Deutschland den Islam nur noch „als einen Teil ihrer Identität“ betrachten und somit den „Taufscheinchristen“ vergleichbar sind.11 Doch gerade diejenigen unter ihnen, die in [13] Deutschland öffentliche Verantwortung tragen, sollten sich, auch wenn es sie nicht sonderlich interessiert, ernsthaft mit dem Konfliktpotential befassen, das in dem Problem „Islam und freiheitlicher Rechtsstaat“ verborgen ist. Schon die Skepsis, mit der viele ihrer Glaubensbrüder ihr Eintreten für unser Gemeinwesen beobachten, desgleichen die Skepsis, mit der der nichtmuslimische Bürger ihre Äußerungen zum Islam aufnimmt, sollten sie dazu anspornen, den solchen Reaktionen zugrunde liegenden Konflikt eingehend zu analysieren und sich nicht damit zufrieden zu geben, daß sie im Augenblick eine unreflektierte Rückendeckung durch die politisch Korrekten genießen. Der Islamwissenschaftler seinerseits ist weder befugt, noch berufen, an ihrer Stelle unter den Muslimen Aufklärungsarbeit zu leisten. Seine Sache ist es, die Grundlinien jenes Konflikts aufzuzeigen. Er kann den säkularen Muslimen helfen, eine Welt zu verstehen, die nicht oder nicht mehr die ihrige ist; er kann darlegen, inwiefern die Gemeinschaft der Muslime in Deutschland gleichsam durch die Zugehörigkeit zu zwei unterschiedlichen politisch-religiösen Kulturen gespalten ist. Und er kann die säkularisierten Muslime dazu ermuntern, ihre abseits stehenden Glaubensgenossen an die politische Kultur unseres Gemeinwesens heranzuführen und mit deren Prinzipien vertraut zu machen.
Wie aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich ist, habe ich den Stoff in vier Sachgebiete gegliedert. Jedes von ihnen wird durch eine Einführung erschlossen. Ein Teil der in diesem Buch gesammelten Vorträge bzw. Aufsätze wurde schon an anderer, meist recht entlegener Stelle veröffentlicht. Für die Erlaubnis, sie noch einmal abzudrucken, spreche ich den betreffenden Verlagen meinen verbindlichen Dank aus. Der andere Teil wird hier zum ersten Mal in gedruckter Form vorgelegt. Fast alle Arbeiten wurden für ein Publikum geschrieben, dem zusammen mit dem spezifischen Gegenstand auch allgemeine Kenntnisse vom Islam vermittelt werden sollten. Deswegen ergeben sich bisweilen inhaltliche Überschneidungen zwischen einzelnen Beiträgen. Wenn es mir tunlich schien, habe ich die betreffenden Passagen gekürzt. Da jeder Text jedoch ursprünglich für sich allein hatte stehen müssen, war darauf zu achten, daß die Kürzungen nicht den jeweils verfolgten Gedankengang beeinträchtigen.
Dransfeld, im Dezember 2013 Tilman Nagel
1 Vgl. z. B. Abdullah Leonhard Borek. Islam im Alltag. Eine Handreichung für deutsche Muslime, Hamburg 1999, Einleitung.
2 Die 45-bändige „al-Mausūʿa al-fiqhīja“ („Enzyklopädie des islamischen Rechts“, erschienen in Kuweit zwischen 1993 und 2007) enthält unter den Stichwörtern al-ġināͱ, at-tašbīb und (sehr ausführlich!) at-taṣwīr einen Überblick über die einschlägigen Vorstellungen. Auf einem schlichten Niveau handelt Jusuf al-Qaradawi in seinem in der ganzen Welt verbreiteten Buch „Erlaubtes und Verbotenes im Islam“ (München 1989 und öfter) vielerlei hier einschlägige Bestimmungen ab, z. B. das Verbot von Statuen und Porträtbildern (147–171); Gesang ist nur erlaubt, wenn der Inhalt nicht gegen den Islam verstößt (417–422); es dürfen nur „reine“ Filme angesehen werden, in den Kinos hat strenge Geschlechtertrennung zu herrschen (425 f.) usw.
3 Vgl. Leif Stenberg: The Islamization of Science: Four Muslim Positions. Developing an Islamic Society, New York 1996; zur Verächtlichmachung der europäischen, nicht vom Koran ausgehenden Wissenschaft in der heutigen Türkei vgl. Martin Riexinger: Die verinnerlichte Schöpfungsordnung (noch nicht erschienene Habilitationsschrift), insbesondere das sehr ausführlich dokumentierte Kapitel 3.
4 Borek, 35 f.
5 FAZ vom 20. April 2011, S. 27.
6 Der eingangs zitierte Satz des ehemaligen Bundespräsidenten verdankt sich, wie man hört, keineswegs einer sorgfältigen Sachanalyse, sondern gelangte nach einem beiläufig geäußerten Wunsch eines Journalisten in die Rede zum Tag der deutschen Einheit (vgl. Wolfgang J. Ruf in: Mut Nr. 536, Juli / August 2012, 71) – ein erschreckendes Beispiel für den leichtfertigen, inkompetenten Umgang der politischen Klasse mit dem Thema Islam. Nichtsdestoweniger wird jener Satz seither vielfach zur wichtigsten Hinterlassenschaft des vorzeitig aus dem Amt geschiedenen Bundespräsidenten Wulff hochstilisiert.
7 Vgl. hierzu die grundlegenden Überlegungen von Hans-Peter Raddatz: Von Gott zu Allah? Christentum und Islam in der liberalen Fortschrittsgesellschaft, München 2001, insbesondere Teil II.
8 Erwin Rosenthal: Islam in the Modern National State, Cambridge 1965, 196 f. Selbst Iqbal nimmt an, daß der Islam zur Gestaltung seiner religiösen, politischen und gesellschaftlichen Zukunft gleichsam ein von ihm allein beherrschtes „Biotop“ benötige; die Wortführer des Islams sind bis jetzt zu einer Auseinandersetzung mit anderen religiösen und politischen Ideen und Systemen von gleich zu gleich und zu politischen Kompromissen nicht fähig oder nicht bereit.
9 Ebd., 209 f. und 224.
10 Vgl. den Vortrag der unlängst von ihrem Amt zurückgetretenen Obersten Richterin der Türkei, Emine Ülker Tarhans, gehalten bei einer Veranstaltung des Büros für Integration Groß-Gerau, abgedruckt in der FAZ vom 8. April 2011, S. 33.
11 So Cem Özdemir in dem Artikel „Wir sind doch keine statistischen Ausreißer“, Feuilleton der FAZ vom 27. Mai 2011. „Teil der Identität“ ist natürlich ein schwammiger Ausdruck, den letzten Endes selbst der unsere politische Kultur schroff ablehnende Muslim als auf ihn zutreffend billigen würde. Ich halte Herrn Özdemir zugute, daß sein mit diesem Ausdruck verbundener Hinweis auf die Taufscheinchristen belegen soll, daß für ihn die aus den Lehren des Islams resultierenden politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen nicht mehr zählen. Sich von ihnen klipp und klar und unwiderruflich zu distanzieren, wäre allerdings dem inneren Frieden unseres Gemeinwesens dienlicher.
Inhaltsverzeichnis
Einführung: Denkverbote und was sie bezwecken sollen
1.
Tabus und Denkverbote
2.
Eine aufschlußreiche Rede
3.
Was auf dem Spiele steht
A. Grundsätzliches über den Islam
Einführung
1.
Der eine Allah und die „Religion des Verstandes“
2.
Die „rechtgeleitete“ Gemeinde
3.
Die uneinholbare Überlegenheit der islamischen
umma
I.
Schöpfer und Kosmos im Koran
1.
Der Beginn der Offenbarungen
2.
Der Ursprung des mohammedschen Monotheismus
3.
Allah auf dem Thron
II.
Das Menschenverständnis des Islams
1.
Der Mensch als Stellvertreter Allahs und der Islam
2.
Kämpferische Gläubigkeit und die Freiheit des Willens
3.
Die Entmächtigung des geschaffen Werdenden
4.
Der Mensch und das „Verborgene“
III.
Die muslimische Glaubensgemeinschaft als die Verwirklichung des göttlichen Willens auf Erden
1.
Das Hadith
2.
Die Islamisierung der Gesellschaft durch die Gelehrten
3.
Zweifel an den autoritativen Texten
4.
Schlußbemerkung
IV.
Religion und Staat im Islam seit dem 11. Jahrhundert
V.
Die Überbietung der Riten – Gesetzesfrömmigkeit und Sufismus im Islam
1.
Vorbemerkung
2.
Wert und Unwert der Welt
3.
Der Sinn der Riten
4.
Die Überbietung der Riten
VI.
Islam als Ideologie
1.
Islam und arabische Nation
2.
Nationen im Islam?
3.
Ideologischer Synkretismus: Islam als diesseitsbezogene Heilslehre
4.
Der Totalitätsanspruch
B. Das Weltbild des Christentums und des Islams im Vergleich
Einführung
1.
Nicht von dieser Welt
2.
Offen für das verantwortliche Handeln des Menschen
3.
Die theokratischen Grundzüge des Islams
I.
Das Christentum im Urteil des Islams
1.
Die „Torheit des Christentums“
2.
Der religionsgeschichtliche Hintergrund der Abwertung des Christentums
II.
Die „Legitimität der Neuzeit“
1.
Säkularisierung als eigenständiger Sachverhalt
2.
Die Verklärung der frühen islamischen Geschichte
3.
Geschlossene gegen offene Fortschrittsidee
4.
Formen der Selbstbehauptung gegen religiöse Autorität
5.
Verzicht auf ewige, endgültige Wahrheit
6.
Religion im Zeitalter fehlender endgültiger Wahrheit
C. Der Islam und der säkulare Staat – Grundlinien eines Konflikts
Einführung
1.
Islam und Politik
2.
Die Widersprüchlichkeit schariatischer Urteile
3.
Recht als Moral
4.
Islamische Säkularität?
I.
Kann es einen säkularisierten Islam geben?
1.
Vorbemerkung
2.
Die Heilslehre des Islams
3.
Die gesellschaftliche und politische Verwirklichung der islamischen Heilslehre
4.
Islamische Heilslehre und säkularisierte Gesellschaft
II.
Staatliche Machtausübung und private Gewalt im Islam
1.
Die religiös-politische Dimension der Botschaft Mohammeds
2.
Die islamische Machtausübung und die Botschaft des Propheten
3.
Die zweifache Mediatisierung der Machtausübung
4.
Schlußbetrachtung
III.
Islam oder Islamismus? – Probleme einer Grenzziehung
1.
Vorbemerkung
2.
Christliche Endzeithoffnung – islamische Diesseitserfüllung
3.
Glaube, bewiesen durch die Teilnahme am Krieg
4.
Abstufungen der Gesetzesfrömmigkeit
IV.
„Erst der Muslim ist ein freier Mensch!“ Die Menschenrechte aus islamischer Sicht
1.
Die Menschenrechte, eine die Kulturen übersteigende Idee?
2.
Islamische Voraussetzungen
3.
Islamisches Menschenrecht
4.
Aktuelle Aspekte
V.
Auszüge aus einem Gutachten, betreffend die Notwendigkeit des Vollzugs des rituellen Gebets in einer staatlichen allgemeinbildenden Schule
Fazit des ersten Teils
Zweiter Teil: Die Bedeutung der Pflichtgebete im Rahmen des Rechtssystems der Scharia
Vorbemerkung
a)
Anrufung Allahs versus Pflichtgebet
b)
Ritualrecht als unabdingbare Grundlage des islamischen Gemeinwesens
c)
Die Inkompatibilität des Ritualrechts
d)
Die Befolgung des Ritualrechts als Keimzelle islamischer Staatlichkeit
e)
Die kollektivistische, politische Seite des Ritualrechts
f)
Geltung des Ritualrechts und Ausdehnung des „Gebiets des Islams“
g)
Das „Gebiet des Vertrags“
Fazit des zweiten Teils
D. Mit Muslimen streiten
Einführung
I.
Die Bringschuld der Muslime – Säkularer Staat und religiöser Wahrheitsanspruch im Konflikt
1.
Einführung
2.
Grundlinien der islamischen politischen Kultur
3.
Über die Religions- und Gedankenfreiheit im Islam
4.
Können die Wortführer des Islams ihr intellektuelles Gefängnis verlassen?
II.
Islamophobie
III.
Textkritik und Weltverständnis – Motive für die historisch-kritische Analyse heiliger Texte
IV.
Islamische autoritative Texte und das Grundgesetz: Ein thematischer Überblick
1.
Die allgemeine Herabwürdigung und Verächtlichmachung Andersgläubiger und Glaubensloser
2.
Die Geringschätzung von Normen und Werten, die nicht auf der Botschaft des Korans, sondern auf eigenverantwortlichem Gebrauch des Verstandes beruhen
3.
Die Verwerfung der Pluralität
4.
Verweigerung der Religionsfreiheit durch Bedrohung des Austritts aus dem Islam mit der Todesstrafe
5.
Die koranischen Strafen
6.
Gewalt gegen Andersgläubige, Dschihad
a)
Allgemeines
b)
Der Glaube
c)
Der Dschihad
d)
„Kein Zwang im Glauben“
7.
„Meine Diener sind die Erben der Erde“
8.
Fehlende Gleichberechtigung der Frauen
V.
Schariatischer Islam und säkulares Denken
1.
Voraussetzungen der Argumentation der KRM-Verbände
2.
Argumentationsmuster
a)
Die Aussage ist als Metapher zu verstehen
b)
Argumentationstaktische Leugnung der Maxime „Religion und Politik sind im Islam eins“
c)
Die Wahl des „schonenden“ Begriffs
d)
Das Ineinander von Diesseits und Jenseits
e)
„Kontextbezogenheit“
f)
Das
argumentum ad hominem
3.
Schlußfolgerungen
Register
I.
Begriffe und Sachen
II.
Personen
III.
Arabische Termini
IV.
Zitierte oder im Text erwähnte Koranverse
Totalitäre oder autoritäre Regierungsformen weisen sehr oft unauffällige Anfänge und sehr feine Methoden sozialer Kontrolle auf. Erst mit der Zeit wurde uns deutlich, wie geschickt wir manchmal in die Netze des Totalitarismus verwickelt wurden.
Václav Havel: Vom Wert der Freiheit (FAZ vom 24. Dezember 2011, S. 7)
Einführung
Denkverbote und was sie bezwecken sollen
1. Tabus und Denkverbote
„Auseinandersetzungen mit dem Islam“ – gleich in mehrfacher Weise verstößt dieser Untertitel gegen die ungeschriebenen Tabus der politischen Korrektheit.1 Das erste lautet: Den Islam gibt es gar nicht! Und da es ihn nicht gibt, kann man sich auch nicht mit ihm auseinandersetzen. Also: Schluß der Debatte, bevor sie überhaupt begonnen wurde! Den einen Islam gibt es nicht, sondern Sunniten und Schiiten, und diese wiederum lassen sich in Gruppierungen untergliedern, die Sunniten in „gemäßigte“ – was immer das bedeuten mag – und in Muslimbrüder und Salafisten, die Schiiten in Imamiten, Ismailiten und zahlreiche weitere Richtungen. Bekanntlich hat der Islam – oder muß ich korrekterweise hier sagen: die islamische [20] Religion, die muslimische Glaubensgemeinschaft? Was eigentlich? – bekanntlich hat jene religiöse Überlieferung, die vulgo und unkorrekterweise „der Islam“ genannt wird, kein Priestertum hervorgebracht, somit auch keine Lehrautorität. Jeder Muslim sei in seinem Verhältnis zu Allah auf sich selber gestellt,2 heißt es, und hieran zeige sich die vermeintlich grenzenlose Toleranz dieser Religion: Es existiere eine unüberschaubare Fülle von inhaltlich gleichberechtigten „Individualislamen“. Geschützt sei der private Glaube des Individuums durch das angeblich im Koran verkündete Prinzip der Religionsfreiheit; ein jeder „Individualislam“ entziehe sich infolgedessen einer kritischen Bewertung. So hört und liest man es immer wieder.
Doch wollen wir uns von dem Spruch: „Den Islam gibt es gar nicht“ wirklich ins Bockshorn jagen und das Nachdenken verbieten lassen? Auch das Christentum läßt sich in Kirchen und Konfessionen unterteilen. Trotz dem Priesteramt, dessen Aufgaben unterschiedlich bestimmt und auf verschiedenartige Weise begründet und aus der Geschichte hergeleitet werden, bleibt jedem Christen eine unüberschaubare Fülle persönlicher Gotteserfahrungen. Was ein jeder als „Nachfolge Christi“ versteht, ist, sobald man ins Detail geht, nicht auf einen Nenner zu bringen. Gleichwohl gibt es unabhängig von Kirchen und Konfessionen und von individuellen Gotteserfahrungen doch das Christentum. Es besteht in der durch das Neue Testament bezeugten Botschaft von der Erlösung des Menschen durch Jesu Opfertod und Auferstehung. Mit dem Islam verhält es sich mutatis mutandis ebenso. Jenseits aller streitenden Glaubensrichtungen und jenseits sämtlicher bekannter und unbekannter „Individualislame“ wird der Islam Tag für Tag durch das Glaubensbekenntnis bezeugt: Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Gesandter, nämlich der Überbringer des Korans, der Rede Allahs. So wenig wie das Christentum ohne das Neue Testament denkbar ist, ebenso wenig der Islam ohne den Koran. Der Islam ist mithin die in der eben zitierten zweigliedrigen Formel bekundete und vor allem durch den Koran inhaltlich konkretisierte Glaubensausübung, die in der sogenannten umma3 ihre spezifische gesellschaftliche und politische Ausprä[21]gung besitzt.4 Ein Muslim, der dies bestritte und sich nicht mehr als ein Glied der wie auch immer aufgefaßten umma empfände, hätte mit seiner Religion gebrochen.5 Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Islam ist infolgedessen sehr wohl möglich. Sie hat sich mit den Aussagen des Korans zu befassen und der Frage nachzugehen, wie jene zweigliedrige Formel im Laufe der Geschichte den Inhalt des Glaubens sowie die Art und Weise seiner Ausübung und die politische Erscheinungsform der muslimischen Glaubensgemeinschaft bestimmt hat. Trotz allem Zwist der muslimischen Richtungen und trotz unüberschaubar vielfältigen individuellen Glaubenserfahrungen bilden der Koran, die Bekenntnisformel und die Mitgliedschaft in der von ihr zusammengehaltenen Gemeinschaft den überindividuellen Kern des Islams, der einer wissenschaftlichen Analyse offensteht und darüber hinaus einer kritischen Bewertung zugänglich ist, sei es in interreligiösen Erörterungen, sei es von der Warte des Säkularismus aus.
Das zweite Tabu lautet: Die Auseinandersetzung mit dem Islam in seiner Eigenschaft als Religion verbietet sich; denn nach muslimischer Überzeugung ist dieser Islam durch Allah gestiftet worden, und zwar so, daß er für jeden Ort und jedes Zeitalter tauglich sei, also auch für Deutschland im 21. Jahrhundert. Daraus folge, daß er die Werteordnung eines Rechtsstaats umfasse, wie sie sich u. a. im Grundgesetz niedergeschlagen hat. Jede Debatte beispielsweise über die Vereinbarkeit von Islam und Grundgesetz sei somit verfehlt. Sie zeuge von einem „Generalverdacht“, der Unfrieden säe. Über den Inhalt von Religionen dürfe man ohnehin nicht mit rationalen Argumenten debattieren, weil er eine durch die gesetzlich garantierte Religionsfreiheit geschützte Privatsache sei. Gerne greifen die Verfechter dieser Thesen bestimmte Aussagen auf, die der muslimischen Abwehr gegen den Einfluß der europäischen politischen Zivilisation entstammen: Der Islam sei eine fortschrittsorientierte Religion, die der Befreiung des Menschen aus der Bevormundung durch die Priesterschaft diene, worauf schon hingewiesen wurde. Dem Islam eigne daher ein demokratischer Wesenszug, stehe doch im Koran, daß die wechselseitige Beratung ein Merkmal der muslimischen Gemeinschaft sei (Sure 42, 38). Es sei ferner hervorzuheben, daß der Islam die Religion des Friedens sei; im Wort „Is[22]lam“ stecke der Begriff „Salam“, der Frieden bedeute. Daher sei der Islam von Anfang an ein durch und durch toleranter Glaube gewesen. Allah selber fordere im Koran, im Glauben dürfe kein Zwang herrschen (Sure 2, 256; hierzu vgl. Abschnitt D., Text IV). An diese Maxime hätten sich die Muslime im Laufe ihrer Geschichte streng gehalten. Wie anders sei denn zu erklären, daß in islamischen Ländern bis auf den heutigen Tag andersgläubige Minderheiten lebten?
Meist sind die Gesprächspartner, die so lebhaft oder aufgeregt die vermeintlichen Vorzüge des Islams und die bruchlose Übereinstimmung seiner Lehren mit den Grundsätzen des Rechtsstaates preisen, genau dieselben, die in anderem Argumentationszusammenhang ebenso aufgeregt darauf beharren, den Islam gebe es gar nicht. Insofern als er die geläufig über die Lippen gehenden Merkmale unseres Gemeinwesens aufweisen soll, gibt es ihn offenbar doch. Um so unerwünschter ist jegliche Störung dieses auf tatsächlicher oder gespielter Unwissenheit beruhenden Gaukelbildes durch die Frage nach den verbürgten Tatsachen, die in eine ganz andere Richtung deuten. Zwar wird in den für westliche Ohren bestimmten Verlautbarungen immer wieder eine Frage gestellt, die Sorge um intellektuelle Redlichkeit vortäuscht: „Von welchem Islam reden Sie überhaupt?“ Die Freitagspredigten hingegen, um nur diese zu nennen, handeln stets von dem Islam als der einzig wahren politisch-religiösen Ordnung der Welt, von den Muslimen, die den höchsten Gipfel moralisch geprägten Menschentums einnähmen, da Allah ihren Propheten durch die letzte Botschaft an die Menschheit ausgezeichnet habe. Wenn es Muslimen darum geht, den eigenen Glauben als die religiöse, politische und gesellschaftliche Heilslehre anzupreisen, der es bestimmt sei, den ganzen Erdball zu beherrschen, dann kann sich selbst die erbitterte Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten zur Marginalie verkleinern. Dies belegen Schriften so unterschiedlicher Autoren wie Ḫumainis (Ajatollah Chomeini)6 (1902–1989) und des „liberalen“ Marokkaners Muḥammad ʿĀbid al-Ğābirī (Jabri) (1935–2010), dem wir uns später zuwenden werden.7
[23] Gerade diesem von der erdrückenden Mehrheit der Muslime für selbstverständlich genommenen Islam gelten unsere Fragen:8 Inwiefern stehen der Dschihad gegen Andersgläubige oder gegen innerislamische Widersacher sowie die Gewalt gegen Personen, die den Islam aufgeben, im Einklang mit Toleranz und Glaubensfreiheit? Wie verhält es sich mit der im Koran vorgeschriebenen höchst ungleichen Bewertung von Mann und Frau? – Nach Meinung der politisch Korrekten fragen hiernach nur „Feinde des Islams“, „Islamkritiker“, und darum ist das Aufwerfen solcher Fragen das Zeichen einer krankhaften Furcht vor dem Islam, einer „Islamophobie“. Durch eine Beantwortung solcher Fragen wäre den von ihr Geschlagenen also gar nicht zu helfen. Der Vorwurf der „Islamophobie“ macht aus der Ignoranz eine Tugend, aus dem Wissenwollen ein Vergehen.9
Tabuisiert ist drittens die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Aussagen islamischer autoritativer Texte und bestimmten bei vielen Muslimen beobachteten Rede- und Verhaltensweisen. So dürfen koranische Aussagen über die gattungsspezifische Minderrangigkeit von Nichtmuslimen10 und die alltäglichen Schmähungen andersgläubiger Schüler durch ihre muslimischen Klassengenossen bei politisch-korrekter Betrachtung nicht zueinander in Beziehung gebracht werden. Da nicht alle muslimischen Schüler sich so verhalten, laufe eine solche Verknüpfung auf einen angeblich unzulässigen, weil wissenschaftsgeschichtlich überholten „Essentialismus“ hinaus.11 Derartige scheinbar wohlmeinende Mahnungen sind der Nachhall eines sozialphilosophischen Paradigmenwechsels, dessen Ergebnis zu einem unanfechtbaren Dogma aufgewertet wird. Das die sozialphilosophische Diskussion über lange Zeit beherrschende Problem der Entfremdung setzte voraus, daß es ein [24] bestimmbares Wesen des Subjekts gebe und daß dieses in der Lage sei, nach einer Aufklärung über sich selbst die Entfremdung, unter der es leide, zu durchschauen und gegen sie anzugehen. Inzwischen wandte sich die Sozialphilosophie jedoch einem neuen Lehrsatz zu, demzufolge die Wahrheit von Urteilen stets abhängig sei „von der Rechtfertigbarkeit gegenüber den Mitgliedern der eigenen epistemischen Gemeinschaft“.12 Einen nicht durch „kontingente Macht und Wissensregime“13 geprägten Zugang zum Individuum gibt es demnach nicht, dem Individuum kommt keine „Essenz“ zu, weshalb es auch nicht sich selber entfremdet sein kann. Und ebenso wenig darf einem Gedankengebäude eine die Zeiten überdauernde, Mentalitäten formende „Essenz“ zuerkannt werden, denn was immer unter Bezugnahme auf jenes Gebäude ersonnen und ausgesagt wird, ist in Wirklichkeit nur den wechselnden „Wissensregimen“ zuzuordnen.
In der Islamwissenschaft wird der Vorwurf des „Essentialismus“ freilich völlig willkürlich ausgesprochen: Einen Zusammenhang zwischen dem religiös bestimmten Individuum und seinem Referenzsystem, dem Islam, darf es nicht geben, weil ein solcher Zusammenhang im Verdacht steht, im Zuge einer „Islamisierung des Islams“ vom Westen erfunden worden zu sein.14 Die Tatsache, daß zahllose muslimische Schüler unablässig ihren andersgläubigen Mitschülern mit üblen Verbalinjurien zusetzen, darf somit nicht zu Fragen nach einer mentalitätsformenden Wirkung bestimmter Elemente der islamischen Botschaft führen; sie muß einzig und allein aus kontingenten gesellschaftlichen Verhältnissen abgeleitet werden. Der Inhalt der tagtäglichen religiösen Indoktrinierung – der sich erfreulicherweise viele zu entziehen verstehen – und das diesem Inhalt entsprechende Verhalten zahlreicher Muslime müssen zwei getrennte Sachverhalte bleiben.15 Gleichwohl [25] wäre – „Essentialismus“ hin oder her – die Aufklärung darüber, wie solch grobes Fehlverhalten durch Aussagen von Koran und Hadith gerechtfertigt wird, sehr nützlich, beispielsweise für die Erörterung der Frage nach den Diskrepanzen zwischen der koranischen Botschaft einerseits und dem Menschenverständnis eines säkularisierten Gemeinwesens andererseits.
Eine vierte Gattung von Tabus, die eben schon anklang, kann man unter den Schlagwörtern „Orientalismus“ und „Alterität“ zusammenfassen. Die Frage nach den Eigentümlichkeiten des Fremden wird nicht nur moralisch diskreditiert, es soll ihr auch die wissenschaftliche Legitimität abgesprochen werden. Der islamische und daher nicht-europäische Charakter der islamischen Welt sei nichts weiter als ein Konstrukt einer verfehlten Orientwissenschaft. 16 Diese habe vorgegeben, sich dem Studium außereuropäischer Kulturen zu widmen, um diese zu beschreiben und um sie so zu verstehen, wie sie sich dem forschenden Blick und dem zergliedernden Verstand darböten. Aber in Wahrheit sei es den Gelehrten nur darum gegangen, das Bild einer wesensfremden Kultur zu konstruieren, um vor dem Hintergrund dieses Konstrukts die eigene als vorbildlich und überlegen herauszustreichen. Man müsse sich klarmachen, daß das Fremde nichts weiter als eine Fiktion sei, die man zu benötigen vermeine, um ein spezifisches eigenes Ich zu postulieren. Die inhaltlich definierte Gegenüberstellung des Eigenen und des Fremden ist demnach aufzulösen in die inhaltsleere Gegenüberstellung des Ichs und des Anderen, von Identität und Alterität. Benennbare und beschreibbare Unterschiede in der kulturellen Tradition und religiösen Grundeinstellung werden beiseite gewischt. Den Gegensatz von „fremd“ und „eigen“ gibt es gar nicht; es existieren nur noch Relationen, nämlich letzten Endes bedeutungslose individuelle Befindlichkeiten.
Gegen ein schlimmes Tabu verstößt schließlich, wer es wagt, die Gegenüberstellung von „fremd“ und „eigen“ zu einer Debatte darüber zu erweitern, worin sich die islamische Kultur von der europäischen unterscheide und weshalb erstere spätestens seit der frühen Neuzeit der letzteren in mannigfacher Hinsicht unterlegen sei. Max Weber (1864–1920) ist der Erzschelm solch einer verwerflichen Wißbegierde, die allzu oft zu dem Ergebnis gelangt, daß dem Islam das eine oder andere fehle, das für den Aufstieg [26] des Westens zu politischer und zivilisatorischer Weltgeltung ausschlaggebend gewesen sei. So hat laut Weber der calvinistische Glaube an die Vorherbestimmung das Bestreben des Individuums gefördert, durch die Tat seine Auserwähltheit unter Beweis zu stellen, während der islamische Prädestinationsglaube dem einzelnen die entmutigende Einsicht vermittelt habe, gegen Allahs Ratschluß könne man ohnehin nichts ausrichten – Tatkraft hier, Lähmung der eigenen Initiative dort.17 Nur nebenbei sei angemerkt, daß dieses Vergleichsverbot den gescholtenen „Essentialismus“ auf einer höheren Ebene nicht nur hoffähig macht, sondern ausdrücklich erfordert. Denn es muß ja zunächst festgestellt werden, daß die westliche Zivilisation und die islamische jede für sich dergestalt in ihrer jeweiligen „Essenz“ befangen sind, daß ein Vergleich so sinnlos ist wie der berüchtigte zwischen Äpfeln und Birnen.
Weite Kreise der politisch-medialen Klasse Deutschlands sowie auch der Orientwissenschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten diesen Typen von Tabus anbequemt. Der sogenannte Mainstream der Äußerungen über den Islam und über die Schwierigkeiten der Einfügung der Muslime in die deutsche Gesellschaft leidet unter meist unausgesprochenen Vorbehalten, die sich einem oder mehreren der skizzierten Typen von Tabus zuordnen lassen. Nun soll nicht bestritten werden, daß sich diese Tabus aus ursprünglich durchaus angebrachten Mahnungen entwickelt haben. Es wäre in der Tat bedenklich, einen für das Sunnitentum festgestellten Sachverhalt ohne weitere Prüfung auf eine andere Glaubensrichtung zu übertragen. Es wäre intellektuell unredlich, allein Zeugnisse für ein nach unserem Empfinden verwerfliches Handeln Mohammeds zusammenzutragen und dann zu folgern, so sei Mohammed gewesen. Es wäre höchst anfechtbar, wollte man aus einem Koranvers und seinem normativen Gehalt ableiten, daß sich alle Muslime grundsätzlich dementsprechend verhalten. Es wäre gegen jeglichen wissenschaftlichen Standard, bei der Bewertung der Aussagen der Quellen das hartnäckige Streben nach Vorurteilslosigkeit und nach Angemessenheit der Analyse zu vernachlässigen. Das heißt auch, daß Vergleiche der Weberschen Art einer sorgfältigen Einbettung in eine Untersuchung der jeweils obwaltenden geschichtlichen Begleitumstände bedürfen. Doch sind das nicht durchweg Selbstverständlichkeiten?
Längst sind solche Ermahnungen zu ideologischen Vogelscheuchen geworden, die den Forschenden umstellen und ihn vom Fragen abschrecken [27] sollen. Je nach Bedarf wird die eine oder andere drohend vor ihm hin und hergeschwenkt; zu einer in sich stimmigen Auslegung des Islams vermögen sie, wie schon angedeutet, nicht im mindesten anzuregen. Ihre Aufgabe ist allein, das nüchterne, auf die einschlägigen Quellen zurückgreifende Nachdenken über die islamischen Angelegenheiten zu behindern, am besten wohl zu verhindern.18 Das aber ist nicht hinnehmbar. Schließlich erheben viele Muslime den Anspruch, dank ihrer Religion die Lösung aller Probleme nicht nur der islamischen Länder selbst, sondern der ganzen Welt zu kennen, und sie leiten aus diesem Anspruch gesellschafts- und machtpolitische Forderungen ab, auch in Europa. Sie müssen es sich nicht zuletzt deswegen gefallen lassen, daß man ihre Gedankenwelt und die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, die mit dieser Gedankenwelt zusammenhängen, unter die Lupe nimmt. Es ist höchste Zeit, jene Tabus als intellektuellen Sperrmüll zu entsorgen und endlich auf breiter Front eine an der vielfach schmerzhaften Wirklichkeit orientierte Auseinandersetzung mit den Lehren des Islams und mit den Gewißheiten, Hoffnungen und Befürchtungen der Muslime in Angriff zu nehmen.
Glücklicherweise ist es eine Tatsache, daß nicht wenige Muslime zu Bürgern unseres Staates geworden sind und dessen rechtliche, politische und kulturelle Grundlagen uneingeschränkt bejahen. Es ist aber auch eine Tatsache, daß ein erheblicher Prozentsatz muslimischer Zuwanderer das Land, das sie aufgenommen hat und allzu oft auch alimentiert, schroff ablehnt und diese Ablehnung mit Prinzipien des muslimischen Glaubens begründet. Hierin werden sie durch Imame bestärkt, die, meistens des Deutschen nicht mächtig, sich als Pioniere der Islamisierung der „Ungläubigen“ begreifen und den kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten Deutschlands im besten Falle verständnislos gegenüberstehen. Immer häufiger machen auch deutsche Islamkonvertiten von sich reden, die im religiösen Überlegenheitsdünkel und im Haß auf den „Westen“ jene Imame noch zu übertreffen bestrebt sind. Wie ist dies alles zu erklären? Um Antworten zu erhalten, wird man nicht darum herumkommen, Fragen an den Islam als eine Religion zu richten. Es kann nicht sein, daß einerseits muslimische Männer sich herausnehmen, ihre Frauen und Töchter zu drangsalieren, um [28] sie möglichst von der nichtmuslimischen Gesellschaft fernzuhalten, andererseits aber die Frage danach, inwiefern der Islam solche Unterdrückung rechtfertigt oder gar fordert, mit einem Schweigegebot belegt wird: „Mit dem Islam hat das alles gar nichts zu tun!“
„Die Flucht der Intellektuellen“ überschreibt Paul Berman eine ausführliche Studie, die er dem Ausweichen vieler Wortführer der westlichen veröffentlichten Meinung vor ihrer Verantwortung für die Respektierung der Prinzipien eines freiheitlichen Gemeinwesens gewidmet hat. Als Salman Rushdie 1988 seine Satanischen Verse veröffentlichte und Chomeini im Februar 1989 in einem Fetwa zur Tötung Rushdies und aller Personen aufrief, die an der Publizierung des Textes mitgewirkt hatten, erklärten sich die westlichen Intellektuellen, die Medien und die politische Klasse mit dem Bedrohten solidarisch. Als man 1995 Annemarie Schimmel mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels auszeichnete, erregte dies noch Anstoß, da sie Verständnis für Chomeinis Fetwa bekundet hatte. Einer ihrer entschiedensten damaligen Kritiker, Gernot Rotter, war zwölf Jahre später auf Annemarie Schimmels Position des allumfassenden Verständnisses für den Islam eingeschwenkt, wie aus einem in einer Illustrierten dokumentierten Streitgespräch deutlich wird.19 Aus einem Kritiker war eine Art fellow traveller geworden. Diesen hier mit einem deutschen Beispiel belegten Vorgang beleuchtet Berman anhand vieler analoger Vorkommnisse und äußert am Schluß die Vermutung, daß sich hierin die Auswirkungen des Erstarkens radikal-islamischer Strömungen bis hin zum Terrorismus niederschlügen.20
2. Eine aufschlußreiche Rede
Allzu viele Vertreter der politisch-medialen Klasse Deutschlands haben, indem sie jahrzehntelang derartige Tabus aufrechterhielten, den unseren Rechtsstaat zurückweisenden Kräften unter den Muslimen in die Hände gearbeitet. Überdies haben sie mit ihrem angestrengten Wegschauen dazu beigetragen, daß die Zahl der redlich arbeitenden, Steuern zahlenden und gegenüber dem freiheitlichen Gemeinwesen loyalen Bürger, die empfinden, daß „die da oben“ von ihnen nichts mehr wissen wollen, ständig steigt. Der Bürger, dessen Kinder in der Schule als „Schweinefleischfresser“ gedemütigt werden, weiß längst, daß das Palavern über die angeblich tolerante Religion des Friedens nichts mit der ihn umgebenden Wirklichkeit zu tun hat. Er spürt, wie die Verhältnisse schöngeredet werden, spürt auch, wie seine vitalen Interessen jener Klasse gleichgültig sind, und ballt in ohn[29]mächtigem Zorn die Faust in der Tasche. Eben deshalb erzielte das Buch Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ einen so durchschlagenden Verkaufserfolg. Die Klasse reagierte aufgeschreckt und verlangte dienstrechtliche Konsequenzen gegen den Verfasser. Sobald diese durch die formal unabhängige Institution, der er ohne Fehl und Tadel gedient hatte, vollzogen worden waren, wurden sie als respektable Antwort auf die Aussagen des Verfassers gerühmt – da diese „unanständig“ seien, habe er sich moralisch diskreditiert. Die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung bewertete dieses Vorgehen als das, was es war: die Ahndung des Aussprechens und Begründens einer unerwünschten Meinung und daher eine gröbliche Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Dem damaligen Bundespräsidenten fiel in dieser Situation die Aufgabe zu, in seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit des Jahres 2010 sowohl das inzwischen deutlich und von vielen Seiten geäußerte Mißbehagen an der Klasse, deren höchster Vertreter er war, zu dämpfen, als auch die seit Jahren eingefahrene Einwanderungs- und Integrationspolitik als im Kern gut zu rechtfertigen. Dies geschah auf die bewährte Weise. Es wurde eingeräumt, daß wegen mangelhafter Durchführung einiger vom Gesetzgeber beschlossener Maßnahmen gewisse Mißstände zu beklagen seien. In Wahrheit jedoch sei man „weiter“, als die Debatten vermuten ließen, lediglich in einigen Bereichen bestehe ein Nachholbedarf. „Ich nenne nur als Beispiele: Integrations- und Sprachkurse für die ganze Familie, mehr Unterrichtsangebote in den Muttersprachen“ – weshalb eigentlich? – sowie „islamischen Religionsunterricht von hier ausgebildeten Lehrern. Und ja, wir brauchen viel mehr Konsequenz bei der Durchsetzung von Regeln und Pflichten – etwa bei Schulschwänzern. Das gilt übrigens für alle, die in unserem Land leben.“ Ob diesen Worten Taten folgten oder nur weitere sozialwissenschaftliche Erhebungen, ist schwer auszumachen.
Herr Wulff fuhr fort: „Zuallererst brauchen wir eine klare Haltung: Ein Verständnis von Deutschland, das Zugehörigkeit nicht auf einen Pass, eine Familiengeschichte oder einen Glauben verengt. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Vor fast 200 Jahren hat es Johann Wolfgang von Goethe in seinem ‚west-östlichen Divan‘ zum Ausdruck gebracht: ‚Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.‘“21
[30] Auf Herkunft oder Glauben soll sich die Zugehörigkeit nicht verengen, forderte der Redner mit Recht. Aber außer der Religion fiel ihm bzw. seinen Redenschreibern nichts ein, worauf sich das „Verständnis von Deutschland“ stützen könnte. Gerade an dieser Stelle wäre die Nennung einender Faktoren jenseits der Religion bzw. der Religionen nicht nur „hilfreich“, sondern sogar notwendig gewesen. Wie angesichts dieser Unterlassung nicht anders zu erwarten, hakten hier die Kritiker ein. Wieso gehört der Islam inzwischen zu Deutschland? Worin bestehen denn seine Beiträge zur heutigen Kultur Deutschlands und zu unserer politisch-gesellschaftlichen Zivilisation? „Deutsche und Türken können dazu beitragen, dass ein demokratieverträglicher Islam in Europa ankommt.“ In diesen Worten, in denen, wie leider üblich, die Muslime mit den Türken gleichgesetzt werden, brachte der „Berliner Tagesspiegel“ zum Ausdruck, daß von einer Zugehörigkeit des Islams zu unserem Land erst in einer rosarot gemalten Zukunft werde die Rede sein können. Nüchtern machten die „Kieler Nachrichten“ auf die tatsächlich gegebenen Verhältnisse aufmerksam: „Das Gerede von der Willkommenskultur ist inhaltsleeres Gesäusel. Man muss nicht jeden gleich umarmen, der fremd ist. Es wäre schon viel gewonnen, wenn man sich gegenseitig verstünde. Sind die Muslime bei uns bereit, die Trennung von Staat und Religion anzuerkennen, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzutreten, sich nicht nur für Moscheen in Deutschland, sondern auch für christliche Kirchen in der Türkei einzusetzen, das Christentum als gleichrangige Religion neben dem Islam zu akzeptieren? Wenn ja, dann sind Muslime bei uns herzlich willkommen. Wenn nicht, dann gehören sie nicht zu Deutschland.“22 Viel Zustimmung erhielt der Bundespräsident hingegen von muslimischer Seite. „Laut Wulffs Rede fand das Grabgespenst des Vorurteils keine Ruhe“,23 faßte das türkische Massenblatt „Sabah“ die Rede in einer Schlagzeile zusammen: Mithin ging es dem obersten Repräsentanten der politisch-medialen Klasse, so die türkische Sicht, um eine Schelte seiner Landsleute.
Daß die Rede, nimmt man einmal den ganzen Text in den Blick, diese Auslegung zuließ, wäre keine gesteigerte Aufmerksamkeit wert. Der deutsche Bürger ist daran gewöhnt, daß ihm seine politisch-mediale Klasse die Leviten liest – und damit oft um Beifall aus dem Ausland oder von stimmkräftigen inländischen Minderheiten buhlt. Was jedoch in diesem Falle ein genaues Hinsehen und einen entschiedenen Widerspruch verlangt, ist die Geschichtsverfälschung, die in der Verengung der Fundamente unseres Ge[31]meinwesens auf das Religiöse liegt. Der Bundespräsident machte sich auf diese Weise die islamische Sicht der Weltgeschichte zueigen: Der Islam ist von Allah dazu bestimmt, die Herrschaft über die ganze Erde zu gewinnen; zuerst war Deutschland christlich-jüdisch, jetzt aber ist der Islam, die endgültige Wahrheit, ein Teil Deutschlands geworden. Endlich hat das Staatsoberhaupt eines der großen Länder Europas verkündet, der Islam gehöre inzwischen zu dessen Wesensart – könnte man sich eine nachdrücklichere Bekräftigung der diesseitsbezogenen muslimischen Heilserwartungen wünschen, die einem der Mann auf der Straße in Ägypten oder der Türkei seit Jahr und Tag ganz unbefangen darlegt? Und warum sollten sich die Muslime hier in eine Gesellschaft und ein Gemeinwesen integrieren, die nach Allahs Willen ohnehin den Weg in den Islam eingeschlagen haben? – Es ist durchaus denkbar, daß den Redenschreibern des Bundespräsidenten solche Vorstellungen bekannt waren; sie haben sie dann eben nicht ernst genommen. Bei meiner Arbeit in staatlichen Gremien, die sich mit dem Thema der Integration befaßten, mußte ich leider allzu oft beobachten, wie Angehörige der Ministerialbürokratie, sofern sie von islamischen Glaubenslehren überhaupt etwas wußten, diese gern als politisch und gesellschaftlich belanglose fromme Phantastereien abtaten; eine Intensivierung der Sozialarbeit werde sie zum Verschwinden bringen. Angefügt sei hier, daß eine für die Vorlieben der politisch-medialen Klasse offene „Wissenschaft“ unlängst herausgefunden hat, daß der Koran ein europäischer Text sei, da er jüdische und christliche Elemente verarbeite – wie denn Europa aus der jüdischen und christlichen Tradition hervorgegangen und ebendeswegen auch islamisch sei.24
Niemand wird in Abrede stellen, daß das Christentum die geistige Grundlage der europäischen und daher auch der deutschen Geschichte ausmacht. Freilich handelt es sich um ein Christentum, das weit mehr umfaßt als eine religiöse Botschaft. Es ist die Heilslehre, die sich den Staatsapparat des Römischen Reiches aneignete. Dies war möglich, weil die Wortführer der Christen lernten, ihre Glaubensüberzeugungen mit dem gedanklichen Instrumentarium der griechischen philosophischen Überlieferung zu erfassen und zu propagieren. Das Christentum, das die einende geistige Kraft des europäischen Mittelalters werden sollte, barg zudem in sich die theologische und [32] philosophische Hinterlassenschaft der griechischen und lateinischen Kirchenväter. In der Spätantike wuchs die römische Gesittung mit der barbarischen, dem Lebenszuschnitt und Gedankengut der in das Reich eindringenden Völker, zu etwas Neuem zusammen, dessen Leitideen nicht mehr dem heidnischen Rom, sondern dem „romanisierten“ christlichen Glauben verpflichtet waren.25 Zu den großartigen Leistungen jener Übergangszeit zählt das corpus iuris civilis, das Kaiser Justinian (reg. 527–565) in den Jahren 528 bis 534 zusammenstellen ließ. Es handelt sich um eine neue Kodifizierung des römischen Rechts und enthält u. a. Erlasse der Kaiser seit Hadrian (reg. 117–138), wählt den Stoff also nicht nach dem Gesichtspunkt eines Zusammenhangs mit dem Christentum aus, sondern öffnet dieses für das Erbe der vorchristlichen Vergangenheit. Im lateinischen Westen vermochte sich das corpus iuris civilis zunächst nicht durchzusetzen, zumal Italien dem Oströmischen Reich verlorenging. Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts bewährte sich das unter Justinian geschaffene Werk jedoch auch hier als die Hauptquelle der aufblühenden Jurisprudenz. Nicht zu Unrecht hat man betont, daß dieses Vermächtnis die unabdingbare Voraussetzung für die Herausbildung des modernen Rechtsstaates gewesen ist.26 Es hätte Herrn Wulff gut angestanden, in seiner dem Thema der Integration gewidmeten Rede auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. Denn was sonst könnten die Bürger eines Landes, die entweder einer Religion angehören oder sich als Agnostiker oder Atheisten verstehen, als eine allen gemeinsame Ordnung bejahen, wenn nicht dessen säkulare, rechtsstaatliche Verfassung?
Problematisch ist übrigens auch die pauschale Aussage, das Judentum gehöre zu Deutschland. Sollte der Redner den Kanon der Schriften des Alten Testaments gemeint haben, so hat er zweifellos recht. Dieser Kanon ist ähnlich wie das griechisch-römische Erbe als ein unaussonderbarer Bestandteil des Christentums in Europa heimisch. Es darf aber nicht übersehen werden, daß Jesus bestimmte Erscheinungsformen des Judentums seiner Zeit verwarf, deren Verfechter auf eine strenge Erfüllung der Ritualgesetze sahen, eine theokratische Herrschaft anstrebten und in der Verschmelzung von beidem das Eigentliche der Frömmigkeit zu erkennen glaubten.27 Das Judentum, das, verkürzt gesagt, seine Lebensmitte in den Vorschriften des Talmud findet, existierte zwar seit der Spätantike auf europäischem Boden, es wurde im Mittelalter von der christlichen Mehrheit jedoch keineswegs als [33] ihr zugehörig empfunden. Wie Jacob Katz in seiner grundlegenden Studie über das Verhältnis von Juden und Nichtjuden im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa gezeigt hat, herrschten auch innerhalb der jüdischen Gemeinden erhebliche Vorbehalte gegen die christliche Umgebung. Erst die Aufklärung, die auf beiden Seiten die Einsicht in das Vorhandensein eines jenseits der religiösen Schranken bestehenden Menschseins förderte, machte eine gegenseitige Toleranz möglich. Aus gegeneinander abgesonderten Fremden wurden gleichberechtigte Staatsbürger.28 Mit dem die Geschichte schönenden Satz: „Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland“ gab der Redner die Gelegenheit aus der Hand, die Muslime auf die integrierenden Kräfte eines die Religionszugehörigkeit übersteigenden Staatsverständnisses hinzuweisen.
Dies wäre um so angebrachter gewesen, als die Geschichte des Islams so verlaufen ist, daß er mit dem römischen Recht allenfalls am Rande in Berührung kam. Der Islam drang nicht als ein dem Ursprung nach unpolitischer Glaube in ein bestehendes Staatswesen ein, um diesem eine neue Deutung zu verleihen. Er schuf sich vielmehr gleich zu Anfang ein eigenes Gemeinwesen, das sich durch militärische Expansion Teile des Byzantinischen Reiches – Palästina, Syrien, das östliche Nordafrika – sowie den Iran der Sasaniden einverleibte, der sich vom Zweistromland bis in das westliche Innerasien erstreckte. Die fiskalische Ausbeutung dieser riesigen Landmasse durch die Eroberer erfolgte zunächst nach den jeweils vorgefundenen Verwaltungsrichtlinien, die von Fall zu Fall hinter die Interessen der neuen Herren zurücktreten mußten. Im Zuge der Islamisierung der unterworfenen Gebiete wurde die im Koran bezeugte Auffassung, alle Lebensverhältnisse würden ein für allemal durch Allah geregelt (vgl. Sure 6, 38 und Sure 16, 89), verbreitet und mit Inhalt gefüllt. Es bildete sich die Scharia heraus, ein umfängliches Gefüge von Einzelnormen, die, unmittelbar oder mittelbar, auf Aussagen des Korans oder auf Aussprüche Mohammeds zurückgeführt wurden und daher auf Allahs Rede oder zumindest auf eine von ihm angeleitete Handlungsweise zurückgehen sollten. Seit dem 11. Jahrhundert betrachteten Schariagelehrte dieses System als inhaltlich abgeschlossen und waren zugleich der Überzeugung, es regele sämtliche Lebensbereiche des Muslims – von der Staatslenkung bis hin zu den privaten, intimen Angelegenheiten des Einzelnen: Das ganze Dasein, jede Lebensregung, ist Bewertungen unterworfen, die von Allah herrühren und den Menschen in der einzig wahren Glaubens- und Lebensordnung festhalten, im Islam.29 Das Korpus [34] dieser Bewertungen, die Scharia, zeichnet sich dadurch aus, daß es sowohl das irdische Rechtswesen formen als auch das Jenseitsentgelt einer jeden Denk- und Handlungsweise feststellen will; das islamische Recht ist in eine allumfassende aus Koran und Hadith abgeleitete religiöse Moral eingehüllt.30 Für Erlasse heidnischer Herrscher wäre in der Scharia höchstens dann Platz, wenn nachgewiesen werden könnte, daß ihr Inhalt mit den Forderungen des Korans bzw. mit dem Reden und Handeln Mohammeds übereinstimme. Eine Öffnung des Islams hin zu einer nichtislamischen Rechtsordnung, ein corpus iuris civilis justinianscher Prägung, wäre undenkbar. Die Religion ist der oberste Gesichtspunkt, bis auf den heutigen Tag. Die zeitgenössische islamische Rechtswissenschaft plagt sich daher vor allem mit dem Problem ab, wie aus dem Westen importierte Rechtsbereiche wie etwa das Versicherungsrecht als „islamisch“, d. h. von Anfang an in der Scharia enthalten, erwiesen werden können.31
Seit dem 19. Jahrhundert sind in der islamischen Welt Versuche unternommen worden, mittels Anleihen bei europäischen Rechtssystemen Breschen in die Scharia zu schlagen. Allerdings sind solche Versuche stets die Sache kleiner Minderheiten gewesen, die auf die Modernisierung ihrer Länder nach westlichem Muster hinarbeiteten; die breite Masse der Muslime nahm an derlei Bemühungen kaum Anteil. So entwickelten sich vielerorts in der islamischen Welt duale Rechtsverhältnisse: Bereiche, die für die internationalen Beziehungen von Gewicht waren – Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht im weitesten Sinne –, wurden nach westlichem Vorbild gestaltet, andere blieben an die Scharia gebunden. Für das Personenstandsrecht galt dies selbst dann, wenn offiziell europäische Standards eingeführt wurden. Mit dem Verlust an Ansehen, den Europa und der „Westen“ allgemein seit der Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erlitten, rückte die eigene, die schariatische Rechtstradition wieder in den Vordergrund. Daß der Islam eine oder gar die Quelle der staatlichen Ordnung und des Rechts sei, steht seitdem in den Verfassungen fast aller islamischen [35] Länder und findet sich wie selbstverständlich auch in den Grundgesetzen des Irak und Afghanistans, in denen Streitkräfte unter Führung der USA die Grundlage für den Aufbau demokratischer Verhältnisse schaffen sollen. Auch die AKP-Regierung in Ankara arbeitet zielstrebig darauf hin, den Islam wieder als den Kern des türkischen Selbstverständnisses zur Geltung zu bringen.
Politisch korrekt ist es, hierüber den Mantel des Nichtwissens zu breiten. Die aufs neue den Islam zum allgültigen Richtmaß erhebende Türkei soll schließlich auf alle Fälle ein „privilegierter Partner“ der europäischen Union werden, was zumindest mittelfristig den freien Zuzug von Angehörigen der gering gebildeten Schichten bedeutet, die in unserem Sozialsystem komfortabler leben als in ihrem Heimatland. Und welche Vorteile für die türkische Politik die AKP sich davon verspricht, hat Herr Erdoğan in seiner Kölner Rede vom 10. Februar 2008 in dankenswerter Offenheit verkündet. Unverwandt auf die Türkei gerichtet sollten die Augen und Ohren der ausgewanderten Türken sein, forderte er. Man könne von ihnen nicht verlangen, daß sie sich der aufnehmenden Gesellschaft einpaßten; hierauf hinzuarbeiten, sei ein Verbrechen. Drei Millionen Türken bzw. Türkischstämmige – Erdoğan differenziert augenscheinlich nicht zwischen beiden Gruppen – lebten in Deutschland; sie sollten in der Lage sein, in Solidarität mit ihrem Herkunftsland ihr politisches Gewicht zur Geltung zu bringen. Das Erlernen der deutschen Sprache und andere Integrationsbemühungen müßten nach Erdoğans Ansicht vor allem diesem Zweck dienen. Um einer seinen Unwillen erregenden Kritik am Milieu dieser Parallelgesellschaft vorzubeugen, verlangte er, auf einige nach seiner Auffassung anstößige Fernsehsendungen verweisend, eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit.32 Dies alles und mancherlei vergleichbare Zumutungen, die von muslimischer Seite in der jüngsten Vergangenheit vorgebracht worden waren, kamen einem in den Sinn, als der Bundespräsident von der nunmehrigen Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland sprach. Er überging die den einfachen Bürger bedrängenden Probleme mit Schweigen, was ihm immerhin so viel Kritik eintrug, daß sich der Generalsekretär der CDU veranlaßt sah, zu versichern, die Rede mache doch deutlich, daß Herr Wulff für die Werteordnung des Grundgesetzes eintrete.33
[36] 3. Was auf dem Spiele steht
Zwei Wochen später hielt der deutsche Bundespräsident anläßlich eines Staatsbesuchs in der Türkei vor dem Parlament in Ankara eine Rede. Er bemühte sich um die Eindämmung der Kritik, die in Deutschland seine Ansprache am Tag der Deutschen Einheit ausgelöst hatte, indem er nun unterstrich, das Christentum gehöre „zweifelsfrei“ zur Türkei. Auch wies er darauf hin, daß, wer in Deutschland ansässig werden wolle, sich an die dort geltenden Regeln halten und „unsere Art zu leben“ akzeptieren müsse.34 Zur Erwähnung dieser Selbstverständlichkeiten, die nach wie vor als politisch bedenklich gelten, ließ er sich immerhin herbei. Die muslimische Führungselite der Türkei wird das verschmerzen und nachdrücklicher als zuvor den Geldsegen und den Machtzuwachs einfordern, den sie sich vom Beitritt ihres Landes zur EU verspricht. Denn da der Präsident selbst in Andeutungen nicht die Probleme berührte, die der deutsche Bürger mit dem anmaßenden Auftreten vieler aus der Türkei stammender muslimischer Einwanderer und sie betreuender türkischer Religionsfunktionäre hat, vermittelte er seinen Gastgebern die Gewißheit, daß derlei Mißhelligkeiten in den Augen der deutschen politisch-medialen Klasse auch künftighin ohne Belang sein würden.
Warum, so fragt man sich, liegt den meisten Wortführern der politischmedialen Klasse und ihren intellektuellen Ideengebern das Wohl der muslimischen Einwanderer, und zwar gerade derjenigen unter ihnen, die unser Gemeinwesen ablehnen, so sehr am Herzen, daß sie sich nicht trauen, ihnen in klaren Worten abzuverlangen, was für das Wohl des ganzen Landes unabdingbar wäre? Woher kommt diese Respektlosigkeit gegenüber den legitimen Interessen der eigenen Bürger, des eigenen Landes, die sich auch auf anderen Politikfeldern offenbart? Mehrere Antworten sind möglich.
Die deutsche politisch-mediale Klasse der Gegenwart hat sich in einem besiegten und zerstörten Land herausgebildet, das wegen zahlreicher in seinem Namen begangener Untaten diskreditiert war und dessen Überleben und Wiederaufstieg zunächst auf Gedeih und Verderb von der Gnade der Sieger abhingen. Es ist nicht angenehm, als Machtloser die elementaren Belange der Geschlagenen und Geächteten bei den Übermächtigen zu vertreten. Deshalb liegt die Versuchung nahe, sich durch Distanzierung von der Geschichte und vom Volk dieses Landes aus der Masse der mit Schmach Beladenen fortzustehlen und sich gleichsam von hinten ein Plätzchen auf dem Siegerpodest zu erschleichen. Die großen Männer und Frauen der frühen Jahre der Bundesrepublik Deutschland haben dieser Versuchung jedoch [37] in erstaunlichem Maße widerstanden. Noch mußte man es scheuen, als „Kanzler der Alliierten“ gebrandmarkt zu werden. Aber seit der Mitte der fünfziger Jahre mehrten sich die Anzeichen dafür, daß im veröffentlichten politischen Diskurs die Häme über alles, was mit Deutschland und den Deutschen zu tun hatte, den guten, richtigen Ton auszumachen begann. Durch Verachtung des Eigenen und durch kritiklose Hochachtung des Fremden erwarb man sich die Aura desjenigen, der die Dinge durchschaut, und zugleich, da das Eigene mit dem schlechthin Verwerflichen in eins gesetzt wurde, den Heiligenschein unanfechtbarer moralischer Überlegenheit. Die zur intellektuellen Pose verfestigte Schmähung des Eigenen macht zudem den Wirklichkeitsbezug solcher Äußerungen zu etwas Zweitrangigem, so daß Lob und Anerkennung auch ohne authentische geistige Anstrengung einzuheimsen sind. Seit den achtziger Jahren und in verstärktem Maße seit dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums ist der Islam zum wichtigsten Nutznießer dieser Pose geworden.
Hier muß ein zweiter Gesichtspunkt ins Spiel gebracht werden. Angesichts der massiven militärischen Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland und ganz Westeuropas durch den Warschauer Pakt hatte sich jene das Gute stets auf der Seite des Anderen vermutende Geisteshaltung insofern radikalisiert, als die von diesem Anderen ausgehende Bedrohung verdrängt bzw. als eine legitime Konsequenz des Bestrebens interpretiert wurde, sich selber und das Eigene vor der Vernichtung zu schützen. Vor lauter Angst wurden an die vermeintliche Tugend der Selbstvergessenheit immer weiter reichende Anforderungen gestellt. Nicht Deutschland, der Westen an sich wurde zur Quelle alles Kritikwürdigen; die freiheitlich-demokratische Ordnung und das liberale, auf die Eigenverantwortung des Individuums zählende Wirtschaftssystem wurden als die bösartigsten Störer des Weltfriedens verunglimpft. In diesem geistigen Milieu der achtziger Jahre machten zum ersten Mal muslimische Immigranten lautstark von sich reden. In den neunziger Jahren, mit dem Wegfall der Bedrohung durch das sowjetische Imperium und der Zunahme der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Taten und Untaten muslimischer Kampfverbände in verschiedenen Gegenden der Welt, übertrug sich die zu verdrängende Feindesangst auf den Islam. In Wahrheit ist die Lage freilich nicht mit der im Kalten Krieg vergleichbar. Denn erstens gibt es kein gegen Europa gerichtetes Militärbündnis islamischer Staaten, und zweites besteht ein Zwanzigstel der Bevölkerung Deutschlands aus Muslimen; eine Frontlinie zum Islam läßt sich somit nicht definieren. Gleichwohl ist die Angst vor dem Islam in den übrigen neunzehn Zwanzigsteln weit verbreitet, und die Kompensierung dieser Angst durch ostentatives Wohlmeinen ist im veröffentlichten Diskurs über den Islam bzw. mit den Vertretern der Islamverbände geradezu endemisch. Das ist übrigens nicht nur in Deutschland zu beobachten. Die koloniale Vergangenheit einiger [38] Nachbarländer35 bietet dort den Vorwand für eine ritualisierte Selbstanklage und für eine fahrlässige Duldsamkeit gegenüber muslimischen Herausforderungen. Man wagt es nicht, die Grenzen aufzuzeigen, die ein freiheitliches, säkularisiertes Gemeinwesen den Machtansprüchen einer religiös-politischen Ideologie bzw. einer sich als politische Gemeinschaft verstehenden Religion setzen muß.