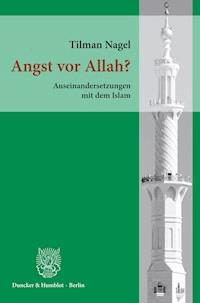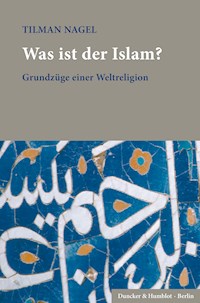
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Islam bedeutet, das Selbst vorbehaltlos Allah zu überantworten und allein ihn als gestaltende Macht anzuerkennen. Unentwegt erschafft Allah den Kosmos und bestimmt alles, was darin vorgeht, gemäß seinem Ratschluss, den der Mensch nicht zu durchschauen vermag. Es steht einzig fest, dass Allah für sein fortwährendes Schöpfungshandeln einen ebenso fortwährenden Dank fordert. Als ein verstandesbegabtes Geschöpf hat sich der Mensch diesen Sachverhalt bewusst zu machen und folglich Allah unermüdlich anzubeten. Einzig zu diesem Zweck hat Allah den Menschen erschaffen (Sure 51, 56). Tilman Nagel zeigt, wie sich diese im Koran vielfach betonten Grundlehren des Islams in den muslimischen Auffassungen von Religion und Ritus, Gesellschaft und Gemeinwesen, von universalem Geltungsanspruch und Machtausübung, widerspiegeln. Er analysiert das spezifische Gottes- und Weltverständnis der Muslime sowie die daraus resultierenden innerweltlichen Konsequenzen und erörtert auch die Schwierigkeiten, die eine nüchterne Bestandsaufnahme islamischer Überzeugungen dem Westen bis zum heutigen Tag bereitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TILMAN NAGEL
Was ist der Islam?
Was ist der Islam?
Grundzüge einer Weltreligion
Von
Tilman Nagel
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlag: Gazergah, Fliesenmosaik im Mausoleum des Ansari (© Roland and Sabrina Michaud / akg-images)
Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany
ISBN 978-3-428-15228-5 (Print) ISBN 978-3-428-55228-3 (E-Book) ISBN 978-3-428-85228-4 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort
Seit einem halben Jahrhundert widmet sich der Verfasser dieser Zeilen der Aufgabe, Kenntnisse vom Islam zu vermitteln, sei es im akademischen Unterricht, sei es in Vorträgen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zu einem Teil der Allgemeinbildung sind die Grundzüge der islamischen Religion und Geschichte in Deutschland bislang nicht geworden – sofern Allgemeinbildung überhaupt noch als eine Aufgabe des Unterrichtswesens auf all seinen Ebenen geduldet wird. Was sich in den vergangenen fünfzig Jahren jedoch verändert hat, das sind die Erwartungen, die die Zuhörer hegen. In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts herrschte nahezu unangefochten das verklärte Bild von den Muslimen, das sich bis in die Zeit Lessings zurückverfolgen läßt. Vor allem aber speiste sich damals die überaus positive Einstellung gegenüber dem Islam aus der gehobenen Unterhaltungsliteratur, für die der Name Karl May (1842–1912) steht. Die von ihm erdichteten muslimischen Gestalten verfügen über die Fähigkeit, den des Orients unkundigen Europäer durch die Fährnisse jener Weltgegend zu lotsen. Was hat es mit jenem Orient auf sich, mit seinen Sitten, seiner Religion, seiner Geschichte? Solche Fragen bewegten die Zuhörer. Es war ausgemacht, daß von einer vergehenden, wenn nicht bereits vergangenen Welt die Rede war. Die existierenden islamischen Länder, das brauchte nicht eigens erwähnt zu werden, hatten den Weg zum Nationalstaat nach westlichem Muster eingeschlagen. Allenfalls der Ost-West-Konflikt überlagerte diese „natürliche“ Entwicklung und versah sie für den politisch Interessierten mit einem Fragezeichen: Man konnte nicht voraussagen, für welche Seite jene Länder Partei ergreifen würden.
Fünfzig Jahre später ist die verklärende Sicht auf den Islam keineswegs verschwunden, und immer noch behauptet sich die Gewißheit, daß die islamische Welt auf dem Weg zu Demokratie, Parlamentarismus usw. sei. Jedenfalls ist dies im tagtäglichen Nachrichtenrauschen der gleichbleibende Grundton. Er liefert die Rechtfertigung für Interventionen, wenn es einmal nicht so läuft, wie erwartet, er verurteilt Ereignisse, die sich in eine unerwünschte Richtung auszuwirken drohen. Seit den siebziger Jahren drängt sich in diese simple Szenerie ein Mitspieler, den man zuvor, wie angedeutet, für tot gehalten hatte: der Islam selber, oder besser: Bewegungen mit machtpolitischem Durchsetzungswillen, die ihre Legitimität mit den Kernaussagen des Islams begründen, nicht aber mit dem westlichen Staats- und Gesellschaftsmodell. Dessen Verfechter sehen sich nicht zuletzt wegen der kaum beschränkten muslimischen Zuwanderung in Erklärungsnöte gebracht. Wie [6] vor fünfzig Jahren bewegt die Besucher von Vortragsveranstaltungen zum Islam das Interesse an seiner Geschichte, seinem Weltverständnis, seinen Glaubenslehren. Aber es sind besorgte Fragen hinzugekommen: „Was bedeutet der Islam für uns? Können islamische Länder unsere zuverlässigen Partner sein? Werden wir den muslimischen Einwanderern zuliebe auf unsere freiheitliche säkulare Grundordnung in Teilen verzichten müssen? Und wenn der Islam mit den Fundamenten unseres Gemeinwesens kompatibel ist, wie uns ja immer wieder versichert wird, warum werden diese Fundamente in keinem islamischen Land beachtet?“
Die politisch korrekte Antwort – mit der sich das Publikum aber nicht mehr immer beschwichtigen läßt – ist von zweierlei Art. Erstens sei darauf zu verweisen, daß erst der westliche Imperialismus wegen der Leiden, die er der islamischen Welt gebracht habe, eine durchaus legitime Feindseligkeit gegen die westliche Zivilisation verursacht habe. Zweitens sei es unzulässig, zur Erklärung dieser Feindseligkeit in die islamische Religions- und Geistesgeschichte der vorkolonialen Epochen zurückzublicken. Muslimische Selbstzeugnisse aus früheren Zeiten, die in der Gegenwart von Muslimen zur Bekräftigung ihres Anspruchs auf künftige Weltgeltung ihrer Religion und zur Ermunterung des Kampfes für dieses Ziel herangezogen werden, dürfe man nicht zur Beschreibung der Gedankenwelt des Islams verwenden. Denn diese ist eben durch das Leiden am westlichen Imperialismus bestimmt.
Den Anhängern dieses engen Zirkelschlusses ist die intime Kenntnis des islamischen Schrifttums, des heutigen wie des älteren, ein Dorn im Auge.1 Denn solche Kenntnis sprengt jenen engen Zirkelschluß, für dessen Gültigkeit sich keine wissenschaftlichen, sondern allein pseudomoralische Begründungen finden lassen. Den Islam, so lautet die wichtigste Konsequenz aus jener Freistellung der Islamforschung von der Mühsal des Quellenstudiums, gebe es gar nicht, sondern nur die vielen Privatislame der muslimischen Individuen. Daher seien die Bedenken gegen eine Islamisierung der freiheitlichen säkularen Gesellschaft gegenstandslos. Wenngleich es den Islam als eine Gesamtheit also nicht gibt, so ist es doch politisch korrekt, ihn insgesamt als friedlich, tolerant und für die westliche Vorstellung von Demokratie aufgeschlossen zu charakteriseren. Aussagen des Korans und des Hadith, die zuhauf in eine ganz andere Richtung weisen, dürften nicht geltend gemacht [7] werden. Diese Textgattungen seien so vieldeutig, daß man leicht etwas anderes, Passenderes herauslesen könne.
Die vorliegenden „Grundzüge einer Weltreligion“ setzen sich über diese ideologischen Anweisungen hinweg. Sie sollen auf die besorgten Fragen die Antworten geben, die man von einem Wissenschaftler erwarten darf. Die „Grundzüge“ fußen zum einen auf den Ergebnissen einer jahrzehntelangen akademischen Lehrtätigkeit, insbesondere auf den Überblicksvorlesungen zur Geschichte des Islams, zur islamischen Theologie, zur Scharia, zum Sufismus. Desweiteren stützen sie sich auf viele wissenschaftliche Publikationen, fremde wie eigene, die jenen Kernthemen der islamischen Zivilisation gewidmet sind. Sie befassen sich mit der gesamten Zeitspanne der islamischen Geschichte. Denn es gilt, die in ihr obwaltenden religiösen, machtpolitischen und gesellschaftlichen Leitideen und deren sich wandelnde Ausprägungen in den Blick zu nehmen. Enge, vielfältige Beziehungen bestehen zudem zwischen den „Grundzügen“ und meiner umfangreichen Studie „Die erdrückende Last des ewig Gültigen. Der sunnitische Islam in dreißig Portraitskizzen“.2
Nicht unerwähnt bleibe die langjährige Mitarbeit in Gremien, die sich mit den Schwierigkeiten der Eingliederung von Muslimen in unser freiheitliches, säkulares Gemeinwesen auseinanderzusetzen hatten (u. a. in der Lehrplankommission für den islamischen Religionsunterricht am Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest; in der ersten Deutschen Islamkonferenz). Diese zum Teil recht mühsame und insgesamt enttäuschende Arbeit schärfte den Blick für die enge Verflechtung von islamischem Gedankengut einerseits und skeptischer bis schroff ablehnender Haltung gegenüber der freiheitlichdemokratischen Grundordnung andererseits. Die Hohlheit und Unredlichkeit der knapp beschriebenen ideologisierten Islambetrachtung offenbart sich in solchem Zusammenhang besonders erschreckend. Nicht zu Unrecht hat man jene politisch korrekte, von der großen Mehrheit der Angehörigen der politisch- medialen Klasse eingeforderte Beschönigung des Islams, die in Wahrheit auf seine Geringschätzung hinausläuft, mit „Elfenbeintürmen auf Sand“ verglichen.3
Kurz einige Worte zum vorliegenden Buch: Die Reihenfolge der Kapitel ist keinen tieferen Überlegungen geschuldet. Um das Studium zu erleichtern, sind die einzelnen Teile durch Querverweise vielfach miteinander verbunden. Da die einzelnen Teile in sich selber verständlich sein sollen, läßt sich die Wiederholung mancher Aussagen nicht völlig vermeiden. Diese sind aber [8] jeweils in einen anderen Zusammenhang eingebettet. Ein thematischer Index soll die Benutzung erleichtern. Wenn es inhaltlich möglich ist, beginnt jede der Informationen mit den einschlägigen Aussagen des Korans und des Hadith. Sie werden in der islamischen Welt wie auch in der islamischen „Diaspora“ nach wie vor als die Grundlage der jeweiligen Themen betrachtet; denn nach wie vor müssen sich alle für die islamische Daseinsordnung, für die Politik, die Theologie und die Weltanschauung bedeutsamen Aussagen auf diese beiden Textgattungen zurückführen lassen. Dies ist einer der wichtigsten Grundzüge, in denen sich der Islam von der westlichen Zivilisation radikal unterscheidet. Politisch korrekt ist es, in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, daß auch in der Präambel westlicher Verfassungen ein Gottesbezug vorkomme. Es ist aber keineswegs so, daß das Alte und das Neue Testament in westlichen Verfassungen als eine oder die eine Quelle der Gesetzgebung ausgewiesen würden und daß Kirchenvertreter anhand von Aussagen der beiden Testamente die Rechtmäßigkeit der Ergebnisse der Beratungen des Parlaments überprüften.
Mit diesem Beispiel sind wir schon mitten in die Thematik der Grundzüge des Islams hineingeraten.4 Es ist das Ziel dieses Buches, den Leser gerade auf die erheblichen Differenzen aufmerksam zu machen, die zwischen der Weltauffassung des Muslims und derjenigen des jeglichen überindividuellen Bezug zum Transzendenten leugnenden zeitgenössischen Europäers bestehen. Um dem nun fälligen „Nani“-Einwand – „nicht alle, nicht immer“ – zuvorzukommen: Mir ist bewußt, daß es Muslime gibt, die sich gänzlich der westlichen, individualistischen Auffassung von Religion angepaßt haben, und mir ist ebenso bewußt, daß es Christen gibt, die der Botschaft Jesu mehr Einfluß auf die Gesellschaft und die Tagespolitik verschaffen möchten. Durch diese Ausnahmen wird aber nicht der Inhalt dessen widerlegt, worum es in den „Grundzügen“ geht. Ihr Ziel ist es, Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit dem Islam zu schaffen, die diesen als einen Gegner unseres Gemeinwesens ernstnimmt. Diejenigen, die von Amts wegen für die Geltung der freiheitlichen Grundordnung eintreten müssen, und alle Bürger, denen deren unangefochtene Geltung am Herzen liegt, benötigen klare Vorstellungen von dem geistigen Ringen, dem sie sich zu stellen haben.
17. Juli 2017
Tilman Nagel
1 Diese Kenntnis sei geeignet, „Vorurteile“ über den Islam hervorzubingen; Unkenntnis ist mithin eine Tugend. Die Aussagen der Quellen ernstzunehmen und mit machtpolitischen Bestrebungen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten in Beziehung zu setzen, zeuge zudem von einem unwissenschaftlichen „Essentialismus“, lautet der zweite ad nauseam wiederholte Topos der politisch korrekten Islambetrachtung. Beide Topoi bieten den unschätzbaren Vorteil, daß man quellenbasierte Forschungen, wenn sie einem nicht passen, gar nicht erst zu lesen braucht.
2 Dieses Buch erscheint ebenfalls 2018 bei Duncker & Humblot.
3 Martin Kramer: Ivory Towers on Sand. The failure of Middle East studies in America, Washington 1986. Vgl. im übrigen das zwanzigste Kapitel (Was ist Islamwissenschaft?).
4 Vgl. das achte Kapitel (Was sind Imamat, Kalifat und Sultanat?), V.
Inhaltsverzeichnis
Erstes KapitelWas ist der Islam?
I.
Grundsätzliches
II.
Grundzüge des Islams
1.
Einleitung
2.
Der Begriff „Islam“ und seine Bedeutung
3.
Die Daseinsordnung
4.
Allah, der eine Gott der Gemeinwesenreligion
5.
Der Ursprung des Unislamischen
6.
Die „beste Gemeinschaft“ und ihre selbstgezeugte Radikalisierung
7.
Der „Aufruf“ zum Islam, die daʿwa
8.
Die „großen Erzählungen“
III.
Die häufigsten Irrtümer über den Islam
1.
„Islam ist Friede“
2.
„Der Islam ist die religiöse Toleranz an sich“
3.
„Der Islam enthält Judentum und Christentum in sich“ und „Der Islam ist die Religion des Verstandes“
4.
„Der Islam ist die natürliche Form der Religiosität des Menschen“
5.
„Mit dem Islam hat der Islamismus nichts zu tun“
Zweites KapitelWer ist Allah? Das Gottesverständnis des Islams
I.
Grundsätzliches
II.
Allah im Koran
III.
Wie ist Allah im Geschaffenwerdenden gegenwärtig?
IV.
Die Eigenschaften und die Namen Allahs
V.
Das absolute und das konditionierte Sein
VI.
Komplementarität und Koinzidenz
VII.
Resümee
Drittes KapitelWer war Mohammed?
I.
Grundsätzliches
II.
Das Leben des geschichtlichen Mohammed
1.
Name und Herkunft
2.
Früheste Zeugnisse des Wirkens Mohammeds
3.
Künder der Einsheit Allahs
4.
Mohammed als Prophet und seine Vertreibung nach Medina
5.
Der Anführer der Kampfgemeinschaft der Gläubigen
III.
Mohammed in der muslimischen Geschichte
1.
Mohammeds Unfehlbarkeit
2.
Der Geburtstag des Propheten
Viertes KapitelWas ist der Koran?
I.
Grundsätzliches
II.
Der Inhalt des Korans
1.
Die ältesten Texte
2.
Der Beginn des Nachdenkens über Allah
3.
Die Verschriftlichung der Eingebungen
4.
Die Daseinsordnung
III.
Der Koran als Spiegel des Wirkens Mohammeds
IV.
Die Kraft der koranischen Rede
1.
Die Kunst der Rezitation
2.
Die magische Eigenschaft des Korans
V.
Aspekte der muslimischen Korangelehrsamkeit
1.
Die Erarbeitung eines allgemein anerkannten Textes
2.
Die Kommentierung des Korans
3.
Mohammeds Beglaubigungswunder
Anhang: Koranübersetzungen
Fünftes KapitelWas ist das Hadith?
I.
Grundsätzliches
II.
Die Hadithgelehrsamkeit
1.
Vorformen des Hadith
2.
Die Tradentenkette
3.
Das „Wissen“ und das „gesunde“ Hadith
4.
Die numinose Seite der Hadithgelehrsamkeit
III.
Das Hadith , ein Kernbereich des islamischen Geisteslebens
1.
Das Hadith im erbaulichen Schrifttum
2.
Das Hadith als das Fundament islamischer Geistestätigkeit
Sechstes KapitelWas ist die Scharia?
I.
Grundsätzliches
II.
Die Geschichte der Scharia
1.
Die islamische Auffassung
2.
Die Einsicht (arab.: al-fiqh) in die rechtliche Bedeutung des Offenbarten und des Überlieferten
3.
Die Scharia
4.
Die Rechtsschulen und die Schariagelehrsamkeit
5.
Die Scharia und die Machtausübung
III.
Wie funktioniert die Scharia?
1.
Bewertungskategorien und Sachgebiete der Scharia
2.
Das schariatische Schrifttum
Siebtes KapitelWas lehrt der Islam über das Jenseits?
I.
Die Erzählungen über das Ende der Zeiten
1.
Der Koran
2.
Ergänzungen des koranischen Stoffs
II.
Das Jenseits und der verborgene Seinsbereich
1.
Das Ineinander von Diesseits und Jenseits
2.
Der verborgene Seinsbereich
3.
Die metaphysische Begründung des „Verborgenen“
4.
Das Ende des Schöpfungshandelns Allahs
III.
Zusammenfassung und vergleichender Blick auf das Christentum
Achtes KapitelWas sind Imamat, Kalifat und Sultanat?
I.
Einführung
II.
Das Imamat
1.
Das kleine Imamat
2.
Das große Imamat
3.
Die islamische Ausübung von Macht über andere
III.
Das Kalifat
1.
Die Anfänge
2.
Formen des Kalifats
IV.
Das Sultanat
V.
Das islamische Gemeinwesen und die europäische politische Zivilisation
1.
Geschichtlicher Überblick
2.
Die Mehrdeutigkeit der Begriffe
3.
Die verschwimmenden Grenzen islamischer Staatlichkeit
Neuntes KapitelWas ist der Dschihad?
I.
Vorbemerkung
II.
Der Dschihad im Koran
III.
Der Dschihad im Hadith
1.
Der geschichtliche Hintergrund
2.
Der Dschihad im Hadith
IV.
Der Dschihad in der Scharia
V.
Die Islamisierung der Welt als Staatszweck: das Sultanat
VI.
Dschihad als privat geübte Ritenerfüllung
VII.
Weitverbreitete Desinformationen über den Dschihad
1.
Der Dschihad, ein „Unfall“ der islamischen Geschichte?
2.
Der Dschihad, eine Folge der Kreuzzüge?
3.
Der „kleine“ und der „große“ Dschihad
Zehntes KapitelWas sind Sunniten?
I.
Vorbemerkung
II.
Die Anfänge des sunnitischen Islams
1.
Die innere Zerrissenheit der Urgemeinde und der Weg in den Ersten Bürgerkrieg
2.
Erste Spuren des Sunnitentums
3.
Geschichtsverständnis und Wahrheitsgarantie
III.
Die hauptsächlichen sunnitischen Lehren
1.
In der Epoche der Vollendung des Hadith
2.
Das Problem der Prädestination
3.
Der sunnitische Begriff des Wissens
4.
Die sunnitische Gotteslehre
IV.
Verflechtungen mit dem Sufismus
V.
Der Geltungsanspruch der Sunniten
Elftes KapitelWas sind Schiiten?
I.
Die Selbstvergewisserung der Minderheit
II.
Die Schiiten in der frühen islamischen Geschichte
1.
ʿAlī b. abī Ṭālib und die Anfänge des Schiitentums
2.
Das Schiitentum bis ins 10. Jahrhundert
III.
Die Arbeit schiitischer Gelehrter
1.
Endzeit und Recht
2.
Der verborgene Imam
3.
Gelehrsamkeit in der Zeit der Verborgenheit des Imams
4.
Die Entstehung eines zwölferschiitischen „Klerus“
IV.
Die schiitische Revolution
Zwölftes KapitelWas versteht der Muslim unter Religion? Die Riten des Islams
I.
Vorbemerkung
II.
Die Riten im frühen Islam
1.
Die Riten im Koran
2.
Die „fünf Säulen des Islams“
3.
Formalisierung und Anrechenbarkeit
III.
Der „Katechismus“
IV.
Der Sinn der Daseinsordnung
1.
Die „Geheimnisse der Säulen des Islams“
2.
ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūds (1910–1978) Auslegung der Riten
Dreizehntes KapitelWie sieht der Islam den Menschen?
I.
Das Problem
II.
Die dogmatischen Wurzeln des islamischen Menschenbildes
1.
Grundlagen des christlichen Menschenbildes
2.
Das frühislamische Menschenverständnis
3.
Der Allah Dienende
4.
Die Handlungsfähigkeit des Menschen
5.
Der Mensch und der verborgene Seinsbereich
III.
Die islamischen Menschenrechte
IV.
Zusammenfassung
Vierzehntes KapitelWas ist Sufismus?
I.
Eine um das Jahr 1000 n. Chr. verfaßte Beschreibung
II.
Zur Geschichte des Sufismus
1.
Die Nähe zum sunnitischen Islam
2.
Zeugnisse mystischer Religiosität
3.
Die Systematisierung der sufischen Erfahrung
III.
Der Sufismus und die muslimische Gesellschaft
1.
Die Früchte der sufischen Erziehung
2.
Die Bruderschaften
3.
Der Sufismus, ein Kernthema des muslimischen Geisteslebens
Anhang: Zwei weitverbreitete Irrtümer über den Sufismus
Fünfzehntes KapitelWas ist islamischer Rationalismus?
I.
Grundsätzliches
1.
Islam – die „Religion des Verstandes“
2.
„Verstand“ in den autoritativen Texten
II.
Allah, der Mensch und die Daseinsordnung
1.
Die Bestimmungsmacht des Menschen
2.
Die Geschaffenheit des Korans
3.
Die Muʿtaziliten
4.
Die Aschʿariten
III.
Die göttliche Weisheit oder Maß und Zahl
1.
Die im Schöpfungshandeln verborgene Weisheit
2.
Maß und Zahl
3.
Die Vereinbarkeit von Überlieferung und Rationalität
Sechzehntes KapitelWas ist Salafismus (reformierter Islam)?
I.
Heutige Erscheinungsformen des Salafismus
1.
Die Flagge des Islamischen Staates
2.
Ein salafistischer Schulungstext
II.
Schlüsselbegriffe des Salafismus
1.
Allah
2.
Große, kleine und verborgene „Beigesellung“
3.
Die ständigen Versuchungen des
ṭāġūt
III.
Salafismus und Reformdruck
1.
Auf dem Weg zum Wahhabismus
2.
Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (gest. 1792)
IV.
Der Salafismus und die Reform des Islams
Siebzehntes KapitelWovon berichten die „großen Erzählungen“ des Islams?
I.
Allgemeines
II.
Höhepunkte der Prophetenvita
1.
Die Berufung
2.
Der Aufstieg in den Himmel
3.
Der Triumph im Krieg
III.
Die Eroberung der Welt
1.
Der muslimische Alexander
2.
Die legendäre maġāzī-Literatur
IV.
Der Geburtstag des Propheten
1.
Die Entstehung eines Gedenktages
2.
Das „Mantelgedicht“ des al-Būṣīrī (gest. 1294)
3.
Der kosmische Mohammed
V.
Resümee
Achtzehntes KapitelWie sieht der Islam die Nichtmuslime?
I.
Mohammed und die Ungläubigen
1.
Der koranische Befund
2.
Ergänzungen aus der Prophetenvita
II.
Die „Schützlinge“ auf islamischem Territorium
1.
Die „ʿumarschen Bedingungen“
2.
Die Kopfsteuer als Strafabgabe?
III.
Das „Gebiet des Islams“ und das „Gebiet des Krieges“
1.
Die Zweiteilung der Welt
2.
Die Apostaten
3.
Verträge mit den Ungläubigen
IV.
Muslime als Nutznießer der westlichen Religionsfreiheit
Neunzehntes KapitelWas lehrt der Islam über die Frauen und die Ehe?
I.
Mohammed und die Frauen
1.
Ein Blick in die vorislamische Epoche
2.
Die Frauenfrage in der medinensischen Urgemeinde
II.
Die Frauen im Hadith und in der Scharia
1.
Die Frau als Gattin
2.
Die Unreinheit der Frau
3.
Die Bedeckung der Blöße
4.
Die Unmündigkeit
5.
Die Mannesehre und die Steinigung
III
Die Muslimin in der Gegenwart
1.
„Die neue Frau“
2.
Die Frauenfrage und der Fortbestand der Scharia
Zwanzigstes KapitelWas ist Islamwissenschaft?
I.
Die Erziehung des Menschengeschlechts, erster Teil
1.
Der Islam als eine Häresie
2.
Die europäische Fiktion des reinen Monotheismus
II.
Das Studium der Quellen
1.
Das Aufblühen der Arabistik
2.
Quellenstudium und Einsicht in die Eigenständigkeit des Islams
III
Islamwissenschaft als „Provenienzforschung“
1.
Ignaz Goldziher (1850–1921)
2.
Der Islam als eklektizistische Religion
IV
Die Erziehung des Menschengeschlechts, zweiter Teil
1.
Die Ausmerzung der Fremdheit
2.
Die Tilgung der Geschichte
V
Was ist der Islam?
Indices
Zur Transliteration der arabischen Wörter
Erstes Kapitel
Was ist der Islam?
I. Grundsätzliches
Der Islam ist eine leidenschaftlich missionierende1 monotheistische Universalreligion, deren Anhängerzahl Ende 2015 auf 1,6 Milliarden Menschen geschätzt wurde. Sein Hauptverbreitungsgebiet sind die tropischen und subtropischen Regionen Asiens und Afrikas. Durch Zuwanderung sind in einigen europäischen Ländern bedeutende islamische Minderheiten entstanden.
Der Islam erhebt den Anspruch, für jeden Menschen die einzig wahre und ewig gültige Beziehung zum Göttlichen zu stiften. Dieses stellt man sich als den einen niemals ruhenden Schöpfergott Allah2 vor, der das Diesseits fortwährend nach seinem souveränen Ratschluß gestaltet und der zum Dank dafür unablässig anzubeten und zu verehren ist. Durch solche Verehrung eröffnet sich der Mensch, der die Einsheit und Einzigartigkeit dieses Schöpfergottes bezeugt, die Aussicht auf das vollkommene Glück in dieser Welt und im Jenseits. Denn Allah bevorzugt die Gemeinschaft der Muslime schon in dieser Welt auf vielfache Weise. Wenn er am Ende aller Zeiten sein gegenwärtiges Schöpfungshandeln einstellt, wird er alle Menschen, die je gelebt haben, aufs neue erschaffen, um über sie zu Gericht zu sitzen. Die Muslime haben die Aussicht, in das Paradies zu gelangen, den Andersgläubigen und erst recht den Gottlosen droht die Hölle.3
Damit der Mensch weiß, wie er Allah gemäß dessen Willen anzubeten und zu verehren und darüber hinaus das diesseitige Leben zu führen hat, berief Allah Propheten, zuletzt den größten unter ihnen: Mohammed (569–632).4 Dieser überbrachte den Menschen den Koran, Allahs wortwörtliche Rede. Der Koran lehrt die Muslime, die Menschen also, die die Einsheit und Einzigartigkeit Allahs bezeugen, nicht nur die Grundzüge des zu befolgenden göttlichen Gesetzeswillens. Er zeigt ihnen auch, welche Vorstellungen über die Welt, die fortlaufend durch Allah geschaffen wird, diesem einen Schöpfer [18] genehm und daher die einzig richtigen sind.5 Angesichts der Vielgestaltigkeit des Diesseits wäre der Muslim allerdings überfordert, wenn er einzig aus dem Koran erfahren könnte, wie er sich in jeder denkbaren Lebenslage gemäß dem Willen Allahs verhalten soll und wie er jede Erscheinung der Welt und jede diesbezügliche Ansicht zu beurteilen hat. Diese Schwierigkeit vermag der Muslim jedoch zu lösen, indem er das Hadith zu Rate zieht, das Korpus der zahlreichen Überlieferungen vom durch Allah geleiteten Reden und Handeln des Propheten.6 Auf der Grundlage des Korans und des Hadith errichteten die Muslime die Scharia, ein System von Normen, welches alle Lebensregungen und alle Gedanken des Menschen der Bewertung durch Allah unterwirft.7 In der Scharia und in der durch sie geregelten Ritenerfüllung findet die große Mehrheit der Muslime ihre Daseinsmitte.
Der Islam ist ferner dadurch gekennzeichnet, daß er seit seinen Anfängen, schon seit Mohammed, als ein Gemeinwesen in Erscheinung tritt, das über die Glaubenden Macht ausübt, um den kollektiven Vollzug der Pflichtriten und die Befolgung des Gesetzeswillens Allahs zu gewährleisten. Der Islam hat sich also nicht in bestehenden politischen Gebilden entwickelt und diese über einen längeren Zeitraum hin von innen her seinen Lehren angepaßt, wie man dies beispielsweise mit Bezug auf das Christentum an der allmählichen Christianisierung des Römischen Reiches beobachten kann. Der Islam tritt in der Geschichte stets als ein Herrschaftsgebilde eigener Art auf, das den Anspruch erhebt, mit der Ausbreitung der Botschaft des Propheten zugleich einen Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten herbeizuführen und eine spezifisch islamische, d. h. an der Scharia ausgerichtete Machtausübung zu etablieren.8
Die gegenwärtige politische Ordnung der Welt orientiert sich am Prinzip des Territorialstaates, das der westlichen Kultur entstammt und den islamischen politischen Ordnungsvorstellungen zuwiderläuft. Die „Organisation für islamische Zusammenarbeit“, die 1969 gegründet wurde und heute (Ende 2015) 56 Staaten umfaßt, soll der westlichen politischen Kultur entgegenwirken. 9 Sie soll u. a. eine die Staatsgrenzen übersteigende islamische Solidarität fördern und die Anstrengungen der Muslime zur Wahrung ihrer Würde und zur Sicherung der islamischen heiligen Stätten koordinieren.10 Diesen Zielen [19] entsprechend hat eine islamische Umsturzbewegung wie die „Moro National Liberation Front“, die für die Errichtung islamischer Herrschaft auf den philippinischen Inseln kämpft, seit 1977 einen Beobachterstatus.
II. Grundzüge des Islams
1. Einleitung
In seinem 1999 erschienenen Buch Allahs Schatten über Atatürk berichtet Peter Scholl-Latour von einem Besuch beim usbekischen Großmufti. Beiläufig sei sein Blick auf eine Landkarte gefallen, die in dessen Arbeitszimmer hing. Sie stellte die islamische Welt dar. Länder, in denen es nennenswerte islamische Minderheiten gibt, waren dem „Gebiet des Islams“11 zugeschlagen. Durch grüne Schraffierung waren die Missionsländer kenntlich gemacht: „Hoffnungsvolle Territorien künftiger Bekehrung“, unter anderen Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten.12 Aus der Sicht des Muslims durchlebt die Menschheit wieder eine der Phasen der raschen Ausbreitung seiner Religion, wie es sie in der Geschichte schon mehrfach gegeben hat, und keine dieser Phasen war frei von Gewalt gegen Andersgläubige.
Daß die Menschen, auf die sich diese Bekehrungsbestrebungen richten, von den Grundzügen der Botschaft, die ihnen als ihre neue, die einzig richtige Daseinsordnung angetragen wird, fast nichts wissen, war stets ein wesentlicher Faktor des Erfolgs des Islams. Zu den Strategien der Verbreitung gehört deswegen, daß man die Frage, was der Islam eigentlich sei, zunächst möglichst ins Leere gehen läßt. So empfiehlt schon al-Ġazālī (gest. 1111), einer der berühmtesten muslimischen Theologen, Konvertiten zu strengster Erfüllung der Ritualpflichten zu zwingen.13 Erst wenn ihnen deren Ausübung in Fleisch und Blut übergegangen ist, könne man sie, sofern sie dafür überhaupt aufgeschlossen seien, mit der Dogmatik und mit den Fundamenten der Scharia bekanntmachen.14
Fragen nach den Lehren des Islams lösen heute meist eine Gegenfrage aus: „Von welchem Islam wollen Sie denn reden? Es gibt unendlich viele Richtungen!“ Man hofft, daß der Frager nun vermutet, es komme im Islam genau so wenig auf die Lehre an wie in dem weitgehend entkirchlichten Taufschein[20]christentum. Nur daß der Muslim noch freier als der moderne Christ sei, wird man ihm sagen; denn im Christentum werde das Verhältnis zu Gott durch die Priesterschaft vermittelt. Im Islam gibt es keine Priester, und deshalb stehe der Einzelne ganz in eigener Verantwortung vor Allah, seinem Schöpfer – Islam als die endgültige religiöse Emanzipation des Menschen, Islam als die zeitgemäße Form schlechthin einer jeglichen Gottesverehrung.
Lassen wir uns durch den Hinweis auf die unendlich vielen „Islame“ nicht ins Bockshorn jagen! Er dient gerade nicht der Unterrichtung des Fragers, sondern ist in Wahrheit ein gesprächstaktischer Einwand, der den Gefragten von der Last einer sachgerechten Antwort befreien soll, einer Antwort, die die Vorstellung von der islamischen Emanzipierung des Menschen vor Gott allzu rasch als ein Trugbild entlarven würde. Fragen wir also: „Was ist der Islam?“ Die Antworten, die wir erhalten werden, liegen diesseits der großen islamischen Glaubensrichtungen, der Schiiten und Sunniten15, gelten also für die Muslime allgemein.
2. Der Begriff „Islam“ und seine Bedeutung
In den Konversationslexika erhalten wir meistens die Antwort, Islam sei die Unterwerfung des Menschen unter Allah bzw. unter den Willen Allahs. Diese Antwort ist nicht völlig falsch, aber sie verfehlt doch Entscheidendes, das für ein Verständnis des Wesens dieser Religion unentbehrlich ist. „Islam“ ist das Verbalnomen – wir würden sagen: der Infinitiv – eines transitiven arabischen Verbums der Bedeutung „vollständig weggeben“, „im Stich lassen“ (arab.: aslama). Verbunden wird dieses Verbum mit dem Objekt „das Gesicht“, verstanden als ein bildlicher Ausdruck für die gesamte Person des Menschen. Dieser übergibt „sein Gesicht“, mithin sich selber, vorbehaltlos Allah, und dieser Akt des Weggebens heißt „Islam“. In diesem Sinne liest man beispielsweise in Sure 4, Vers 125: „Wer hätte eine bessere Daseinsordnung als derjenige, der sein Gesicht vorbehaltlos Allah übergibt und dabei recht handelt und der Kultgemeinschaft Abrahams, eines Hanifen,16 folgt? Allah erwählte sich Abraham zum Freund!“ Mit den Begriffen „Daseinsordnung“17 – arabisch dīn – und „Kultgemeinschaft“18 – arabisch milla – enthält dieser Vers neben dem Verbum „weggeben“ zwei weitere für [21] das Verständnis des Islams grundlegende Begriffe, auf die unten kurz einzugehen ist. Vorerst bleiben wir bei dem Wort „Islam“ und seiner Bedeutung.19
Es wird in den Suren der medinensischen Periode des Wirkens Mohammeds (622–632) im Sinne einer Abgrenzung von den beiden konkurrierenden Religionen, dem Judentum und dem Christentum, verwendet. So liest man in Sure 2, die anderthalb Jahre nach der 622 erfolgten Vertreibung Mohammeds aus Mekka entstand, Juden und Christen seien sich dessen sicher, daß nur sie nach dem Weltgericht das Paradies betreten würden (Vers 111). „Aber nein! Wer sein Gesicht vorbehaltlos Allah übergibt und dabei recht handelt, dem steht bei seinem Herrn sein Lohn bereit!“ Es sind die Muslime, die sich vor dem Jüngsten Tag nicht zu fürchten brauchen. Die Lehren der Juden und der Christen können überdies nicht wahr sein, da beide miteinander zerstritten sind. Allah wird über sie am Jüngsten Tag sein Urteil fällen (Vers 112 f.). Denn sie haben mit den Botschaften, die frühere Propheten ihnen einst überbrachten, ihr mutwilliges Spiel getrieben und nicht bedacht, daß diese Botschaften die eine ewige Wahrheit enthielten (Sure 2, 213).
Nur dann wandert man entsprechend dem Willen Allahs durch das irdische Dasein, wenn man ein „Muslim“ ist, d. h. jemand, der das Gesicht Allah überantwortet und diese Lebenshaltung ununterbrochen bewahrt. Was bedeutet das? Wieder und wieder preist der Koran Allah als den unentwegt tätigen Schöpfer, dem der Mensch und überhaupt alles, was das Diesseits ist, seine Existenz verdankt, und zwar in jedem Augenblick des Daseins. Der Koran kennt keine Parallele zum biblischen Schöpfungsbericht, in dem geschildert wird, wie Gott „am Anfang“ die Welt schuf. Die Welt ist vielmehr immer, in jedem Moment ihrer Zeit, unmittelbar durch Allahs allumfassendes Schöpfungshandeln bestimmt. Er ist der in sich selber Bestehende, alles, was fortwährend geschaffen wird, hat in sich selber kein Bestehen, es ist in jedem Augenblick davon abhängig, daß Allah ihm ein Bestehen, ein Dasein, verleiht. Dies bringt der Koran z. B. im sogenannten Thronvers (Sure 2, 255) zum Ausdruck, und zwar wiederum in deutlicher Abgrenzung zur jüdischen bzw. christlichen Vorstellung, die besagt, daß Gott am siebten Tag geruht und damit seinem Schöpfungswerk ein gewisses Maß an eigener Beständigkeit zugemessen hat: „Allah! Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen, in sich selber Bestehenden! Weder Schlummer noch Schlaf ergreifen ihn. Ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Wer könnte sich erkühnen, bei ihm Fürsprache einzulegen, es sei denn, mit seiner Erlaubnis. Er weiß (ohnehin), was vor (den Geschöpfen) und was hinter ihnen ist, sie aber erfassen von seinem Wissen nichts, es sei denn, er wollte es! Sein Fußschemel umschließt die Himmel und die Erde. Beides zu erhalten ist ihm keine Last. Er ist der Hohe, Gewaltige!“ (vgl. Sure 55, 29).
[22] Es liegt nahe, daß islamische Theologen den Gedanken formulierten, daß das Diesseits, so, wie es ist, die beste aller möglichen Welten sei, eben weil sie das fortwährende Werk Allahs sei. Schon der Koran klagt jedoch an vielen Stellen darüber, daß der Mensch diesen Sachverhalt, insbesondere seine eigene Handlungsohnmacht,20 nicht in der ganzen Tragweite begreife. Vielmehr vermeine er, aus sich selber heraus etwas bewirken, schaffen zu können, oder, schlimmer noch, er schreibe seine Leistungen und sein Lebensgeschick irgendwelchen Kräften oder Gottheiten zu, die er sich durch Opfergaben gewogen zu machen hoffe. So tadelt Abraham seinen Vater, weil dieser Götzenbilder verehrt, die weder sehen noch hören, weder sprechen noch handeln können. Er, Abraham, habe von Allah das Wissen von der Verfehltheit des Götzenkultes erhalten; es sei der Satan, der die Menschen zu solchen Irrtümern verführe (Sure 19, 41–50). Auch wird im Koran erzählt, daß Abraham die Götzenbilder zerschlug, mit Ausnahme des größten; denn die Götzenanbeter sollten meinen, dieses habe den Schaden angerichtet. Für kurze Zeit schien es, als ließen sich die Ungläubigen durch dieses Gleichnis belehren, aber als sie erkannten, daß Abraham den Frevel begangen hatte, kehrten sie zu ihren Ansichten zurück (Sure 21, 51–67). Angesichts der Lehre, daß Allah in jedem Augenblick alles schafft und bestimmt, kann es keine schwerere Verfehlung geben als eine derartige „Beigesellung“: Dem Einen und Einzigen Allah stellt man andere angeblich aus sich selber heraus wirkende Kräfte an die Seite – und verläßt dadurch den „Islam“, die vorbehaltlose Weggabe der eigenen Person an Allah.
Immer wieder verfallen die Menschen, unachtsam, wie sie sind, in diesen Fehler der „Beigesellung“. Wie kann man dieser Gefahr begegnen? Durch den Vollzug der Riten, die Allah den Muslimen zur Pflicht macht. Sie alle verfolgen den Zweck, die Glaubenden in der Lebenshaltung der vorbehaltlosen Hingewandtheit zu Allah zu bewahren, vor ihm, dem Einen und Schöpfer, stehend, von Angesicht zu Angesicht. Insbesondere das rituelle Gebet, das seit frühislamischer Zeit fünfmal am Tag zu vollziehen ist, hält den Muslim im Islam fest. Seine Zeitpunkte sind so gewählt, daß ein jedes einen bestimmten Abschnitt des Tageslaufs dieser Hingewandtheit unterwirft: vom Mittag bis zum Nachmittag, vom Nachmittag bis zum Versinken der Sonnenscheibe unter den Horizont; von da an bis zum vollständigen Eintritt der Dunkelheit, von da an bis zur Morgendämmerung. Das dann zu vollziehende Morgengebet überbrückt die Stunden bis zum Mittag. Die Bewegungsabläufe und die Formeln, die zu sprechen sind, sind im Ritualrecht festgelegt und bilden einen weitläufigen Gegenstand islamischer Gelehrsamkeit.21
[23] Das schon im Koran verwendete Wort für das rituelle Gebet, ṣalāh, ist aus dem Christlich-Syrischen entlehnt, wo es soviel wie „Verbeugung“ bedeutet. Befremdlich wirkt auf den ersten Blick die im Koran bezeugte Vorstellung, auch Allah vollziehe, zumindest gegen seinen Propheten Mohammed, eine solche Verbeugung (Sure 33, 56). Dieser Gedanke entspricht jedoch vollkommen dem koranischen Verständnis vom gottgefälligen Verhältnis, das zwischen Allah und seinen Geschöpfen obwaltet. So wird auch der Akt der Buße, der Umkehr nach einer Verfehlung der „Beigesellung“, als eine von Allah ins Werk gesetzte erneute gegenseitige Zuwendung verstanden. In Sure 9 ist beispielsweise davon die Rede, daß die Beduinen und die „Heuchler“, Medinenser, die nur vorgeben, Mohammed zu unterstützen, ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen und dadurch den Islam verlassen. Es könne sein, daß Allah sie bestrafen werde. Aber ebenso sei denkbar, daß er sich ihnen wieder zuwende, ja, er nehme ihre Hinwendung zu ihm an, wie er selber derjenige sei, der sich stets den Geschöpfen zuwende (Vers 104 und 106). Im rituellen Gebet in seinem eben beschriebenen Sinn, der Bewahrung der gegenseitigen Zugewandtheit von Schöpfer und Geschöpf, haben denn auch bereits die frühen Muslime das wesentliche Merkmal gesehen, das sie von allen anderen Religionen unterscheidet und sie zugleich bei allen machtpolitischen oder dogmatischen Zwistigkeiten eint: Sie sind diejenigen, die das rituelle Gebet vollziehen, arabisch al-muṣallūn.
3. Die Daseinsordnung
Kommen wir jetzt zum ersten Mal wieder auf Sure 4, Vers 125, zurück! „Wer hätte eine bessere Daseinsordnung als derjenige, der sein Gesicht vorbehaltlos Allah übergibt und dabei recht handelt und der Kultgemeinschaft Abrahams, eines Hanifen, folgt?“ lautete die rhetorische Frage, deren Antwort „Niemand!“ dem Zuhörer in den Mund gelegt ist. Was aber heißt „Daseinsordnung“? Das hier auftauchende arabische Wort dīn wird meistens leichtfertig mit „Religion“ übersetzt. Das gibt, obwohl nicht direkt falsch, zu schwerwiegenden Mißverständnissen Anlaß. Denn natürlich verstehen die Muslime, sofern sie sich nicht mit der westlichen säkularisierten Kultur vertraut gemacht und auf sie eingelassen haben – und das ist unter ihnen eine verschwindende Minderheit – unter dem Begriff „Religion“ etwas ganz anderes als der seinem Glauben weitgehend entfremdete Durchschnitteuropäer der Gegenwart.22 Und auch mit dem christlichen Begriff von Religion deckt sich der Inhalt von dīn nur zum Teil.
Man kann sich den Unterschied am einfachsten daran verdeutlichen, daß der Christ nicht als solcher geboren wird, sondern durch die Taufe in die [24] Gemeinde Jesu Christi aufgenommen wird. Durch das Credo, dessen Bedeutung ihm im Konfirmanden- bzw. Kommunionsunterricht erschlossen wird und das er in der Konfirmation bzw. Firmung bekräftigt, unterscheidet er sich von den Nichtchristen. Anders der Muslim: Er versteht sich seit dem Augenblick, in dem er gezeugt wird, als einen Teil bzw. als einen Zugehörigen des fortwährend durch Allah geschaffen werdenden Diesseits, der besten denkbaren Welt. Er ist, da er ja ein Geschöpf Allahs ist und dessen allumfassender Bestimmung unterliegt, in der einzigen durch Gewißheit gekennzeichneten Beziehung zum Transzendenten geborgen23 und braucht das Heil – die Christen sagen: die Erlösung – nicht erst zu erhoffen bzw. durch einen immer wieder zu bekennenden Glauben oder durch Werke der „Gerechtigkeit“ zu erwerben. „Ihr Leute!“ läßt Mohammed Allah in Sure 22, Vers 5, sagen, „solltet ihr an der Auferweckung der Toten (am Ende der Zeiten) zweifeln, (dann hört): Wir schufen euch aus Erde, dann aber aus einem Samentropfen, dann aus einem Blutgerinnsel, dann aus einer Leibesfrucht, wohlgestaltet oder mißgestaltet, um euch Klarheit zu geben, und bergen euch im Mutterleib nach unserem Belieben bis zu einer festgelegten Frist. Dann holen wir euch als Säugling hervor, dann sollt ihr die Reife erreichen. Einige werden bald abberufen, anderen ist das Erreichen eines jämmerlichen Greisenalters beschieden, so daß sie, nachdem sie Wissen gehabt haben, gar nichts mehr wissen. Du siehst im übrigen, wie die Erde erstarrt ist, aber wenn wir auf sie Wasser hinabsenden, regt sie sich, gedeiht und treibt allerlei herrliche Arten von Früchten hervor.“24
Wie in einem Brennpunkt faßt dieser Vers das Schöpfungshandeln Allahs zusammen: Nach der kurzen Erinnerung an die Schaffung Adams aus Lehm, von der wir noch hören werden, geht Mohammed sogleich zum tagtäglich zu beobachtenden Wirken Allahs über. Allah läßt jedes Kind im Mutterleib heranreifen und hat auch schon dessen Lebensschicksal bestimmt. Alles ist sein Werk. Mohammed verwendet dieses Argument aber nicht nur, um Allah als den alles Lenkenden zu zeigen, sondern auch mit einem zweiten Ziel. Am Ende der Zeiten wird Allah das Diesseits, das er so lange in Gang gehalten hat, zerstören. Danach wird er jeden Menschen neu schaffen, um über ihn zu Gericht zu sitzen. Er wird ihn dem Paradies oder der Hölle zuweisen. Die [25] heidnischen Mekkaner nahmen Mohammed das nicht ab und beharrten, es gebe nur dieses eine Leben (Sure 6, 29; Sure 23, 37; Sure 45, 24–26) und niemand werde in einem Jenseits von ihnen Rechenschaft fordern. Wie Allah jedes Jahr die verdorrte Erde zu neuem Leben erweckt, so auch vor dem Weltgericht die längst verstorbenen Menschen: Sein Schöpfungshandeln übersteigt die Vorstellungskraft seiner Geschöpfe. Die Androhung des Weltgerichts und die Möglichkeit der Verdammnis scheinen in einem offenkundigen Widerspruch zu dem Dogma zu stehen, daß die fortwährend durch Allah so und nicht anders geschaffen werdende Welt prinzipiell im Heil ist.
Es sei aber nicht vergessen, daß der „Islam“, die vorbehaltlose Hinwendung des Gesichts zu Allah, die durch den Vollzug der Riten auf Dauer gestellt wird, die eine Handlung25 des Menschen ist, mit der er der Tatsache Ausdruck verleiht, daß er in jedem Augenblick des Daseins unmittelbar von Allah abhängt. Diese Handlung ist freilich auch nicht ein selbstbestimmtes Werk des Menschen, sondern wird durch Allah gewirkt. Im Hadith, den nach Mohammeds Tod entstandenen Aussagen über seine vermeintlichen oder tatsächlichen Worte und Taten, endet die der zitierten Koranstelle nachempfundene Schilderung des Heranwachsens der Leibesfrucht dann auch mit der Vorherbestimmung des Jenseitsschicksals: zur Hölle verdammt oder glückselig im Paradies. Allah selber schafft mithin das Böse, wider ihn Gerichtete, und auch dies gehört zur besten aller möglichen Welten. Wie ist dies zu verstehen? Mohammed war kein systematischer Denker, und die islamischen Theologen haben sich hierüber seit mehr als tausend Jahren den Kopf zerbrochen, ohne zu einer überzeugenden Lösung zu gelangen. Ich werde auf diese Debatten an dieser Stelle26 nicht eingehen, sondern die grundsätzlichen Gedanken vortragen, die der Koran zu diesem Thema bietet und die bis auf den heutigen Tag von der erdrückenden Mehrheit der Muslime geteilt werden.
Die Riten haben das Ziel, den Menschen im „Islam“ festzuhalten. Wer das Gesicht zu Allah wendet und dabei recht handelt, ist im Besitz der besten Daseinsordnung, hörten wir. Recht handeln meint nach der Ansicht der meisten muslimischen Kommentatoren nicht etwa eine an ethischen Maßstäben orientierte Bewältigung des irdischen Daseins, sondern den pünktlichen und fehlerfreien Ritenvollzug, der, wie schon gesagt wurde, im Idealfall den gesamten Tageslauf vor das Angesicht Allahs stellt und dadurch jegliche Mißdeutung menschlichen Tuns im Sinne einer eigenen Leistung verhindert. Das Regelwerk, dessen Beachtung diesen heilserfüllten Zustand des Muslims gewährleistet, heißt dīn, ein Begriff, der wie schon erwähnt, irreführend mit [26] Religion wiedergegeben wird und den ich als die gottgegebene Daseinsordnung bezeichne.
Die Konkretisierung dieser Daseinsordnung nennt man die Scharia, ein Begriff, den Mohammed in dieser Bedeutung noch nicht kannte. Es wird etwa vier Jahrhunderte dauern, bis sie voll ausgebildet ist. Sie umfaßt dann das gesamte Ritualrecht, ferner die zwischenmenschlichen Beziehungen, worunter das Vertragsrecht im weitesten Sinne verstanden wird, sowie die Strafen und Bußen. Seit dem 11. Jahrhundert regelt sie auch die Höflichkeit gegen Allah, d. h. die allgemeine Sittlichkeit und das Reden und Denken, nimmt also einen totalitären Charakter an.27
Aber ich bleibe bei der Bedeutung des Wortes dīn im koranischen Zusammenhang. Die konkreten Bestimmungen der gottgegebenen Daseinsordnung lassen sich dem Koran nur in Rudimenten entnehmen, Allerdings beschreibt er sie in einer Weise, die für den Islam in allen seinen Erscheinungsformen kennzeichnend ist. Es war vorhin von Sure 2, Vers 255, die Rede, dem in der muslimischen Frömmigkeit unzählige Male zitierten und in seiner spirituellen Tiefe ergründeten Thronvers. Er endet mit den Sätzen: „Sein Fußschemel umschließt die Himmel und die Erde. Beides zu erhalten, ist ihm keine Last. Er ist der Hohe, Gewaltige!“ Diese Gedanken setzt Mohammed wie folgt fort (Vers 256 f.): „In der Daseinsordnung gibt es kein Zwingen. Denn der rechte Weg ist nun klar vom Irrtum unterschieden. Wer nunmehr nicht an das Götzentum glaubt, sondern an Allah, der hat den sichersten Halt ergriffen, der sich nicht auflösen wird. Allah hört und weiß alles!“ Allah geleitet die Glaubenden aus der Finsternis ins Licht,28 wohingegen das Götzentum seine Adepten in die ewige Höllenpein führt. Die mekkanischen Heiden, so hören wir des öfteren, pflegten ihre Götzenbilder um Fürsprache bei Allah, ihrer obersten Gottheit, anzuflehen. Damit muß es nun ein Ende haben. Denn es gilt jetzt die gottgegebene Daseinsordnung, in der es kein Zwingen gibt, weil sie vollkommen auf das von Allah fortwährend ins Werk gesetzte Schöpfungshandeln abgestimmt ist; jegliche Art von Beigesellung hat sich ein für allemal erledigt.
Was Mohammed mit dem Fehlen von Zwang29 in der durch ihn verkündeten Daseinsordnung meint, wird uns klar, sobald wir wieder seine Vorstellungen vom Judentum und vom Christentum in Augenschein nehmen, gegen die er, wie vorhin angemerkt, mit den Worten des Thronverses polemisiert. [27] Durch Mose und durch Jesus sei einst auch den Juden und den Christen die wahre Daseinsordnung verkündet worden. Aber sie hätten sie verfälscht, indem sie sie durch Erschwernisse ergänzt hätten, die Allah gar nicht gewünscht habe. Mohammed befreie die Juden von den komplizierten Speisegeboten (Sure 7, 157) und die Christen vom Mönchtum; in beiden Religionen würden zudem die Gelehrten und die Mönche so sehr verehrt, daß der Islam, die ausschließliche Hingewandtheit zu Allah, in Frage gestellt sei, ja, Ezra, den Schreiber, und den Messias betrachte man sogar als Götter (Sure 9, 30–33). Hierdurch werde die mit dem ununterbrochenen Schöpfungshandeln Allahs harmonierende Daseinsordnung zum Nachteil der Glaubenden verändert. Es besteht somit ein als Zwang bezeichnetes Spannungsverhältnis zwischen dem natürlichen, jedem Menschen durch Allah anerschaffenen Wesen und den Formen der jüdischen bzw. christlichen Gottesverehrung. Die Annahme der von Mohammed gepredigten Daseinsordnung ist deshalb in Wahrheit die Rückkehr zu der ursprünglich von Allah erlassenen, noch nicht durch einen solchen von Menschen ersonnenen Zwang entstellten Lebensweise. Mohammed suchte mit diesen Aussagen Anschluß an die Gottsucher seiner Zeit, an die Hanifen.30 Diese lehnten die Vielgötterei ab und suchten nach einer eigenen Daseins- und Kultordnung, die allerdings nicht die jüdische oder die christliche sein durfte. Denn auf das überkommene Pilgerwesen mit seinen Tieropfern wollten sie nicht verzichten. Abraham war für die Ḥanīfen der erste, der ihre Ideen im Kultus verwirklichte. Indem Abraham nun durch den Propheten des Islams zu der herausragenden Vorläufergestalt erhoben wird, stilisiert dieser sich zum Erfüller der ḥanīfischen Hoffnungen, was allerdings nicht von allen damaligen Anhängern des Gottsuchertums anerkannt wurde.
In Abraham beginnt Mohammed also den ersten Muslim zu sehen. Abraham ist es, der zusammen mit seinem Sohn Ismael in Mekka die Kaaba errichtet, den Mittelpunkt des Allah geweihten Kultes. Laut Koran flehte Abraham, Allah möge bewirken, daß er, Abraham, und sein Sohn standhafte Bekunder des Islams blieben und daß aus ihrer Nachkommenschaft eine Gemeinde erwachse, die demselben Kult anhänge. „Zeig uns unsere Riten und kehre dich zu uns! Denn du bist derjenige, der sich stets (den Geschöpfen) zukehrt, du bist der Barmherzige!“ – Nebenbei bemerkt, wird an dieser Stelle des Korans für „sich jemandem zuwenden“ das Verbum tāba verwendet, das, vom Menschen ausgesagt, die durch Allah gewirkte bußfertige Umkehr des Menschen zu Ihm meint, die hier, wie auch sonst oft, supplementär und koinzident zur Hinwendung Allahs zum Menschen verstanden wird. Dies ist ein [28] weiteres Beispiel für die vorhin angesprochene Gegenseitigkeit der Zuwendung von Geschöpf und Schöpfer als den Inbegriff des „Islams“. – „Unser Herr!“ fleht Abraham weiter, „berufe unter (diesen Nachkommen) einen Gesandten, der ihnen deine Verse vorträgt und sie das Buch und die Weisheit31 lehrt sowie sie läutert …“ Wer die Kultgemeinschaft Abrahams verschmähe, sei ein Tor. Denn Allah habe Abraham im Diesseits erwählt, und auch im Jenseits gehöre er zu den Frommen. „Einst sagte der Herr zu Abraham: ‚Wende (arab.: aslim) (vorbehaltlos)!‘ und er erwiderte: ‚Ich wende (vorbehaltlos) (das Gesicht) zum Herrn der Welten!‘ “ Mohammeds Widersacher beharren: „Seid Juden oder Christen, dann geht ihr den rechten Weg!“ Darauf soll Mohammed laut Allahs Anweisung antworten: „Nein, (folgt) der Kultgemeinschaft Abrahams, denn dieser war ein Hanif und gehörte nicht zu den Beigesellern!“ (Sure 2, 127–135). Abraham lebte lange vor Mose und vor Jesus, und deshalb ist die durch Mohammed erneuerte abrahamische, die authentische Kultgemeinschaft allen späteren überlegen. Abraham war weder Jude, noch Christ, sondern eben ein Ḥanīf, kein Beigeseller, und am engsten dürfen sich mit ihm diejenigen verbunden fühlen, die sich zu seinen Lebzeiten ihm anschlossen, sowie „dieser Prophet und diejenigen, die in den Glauben eintraten“ (Sure 3, 67 f.).
Hier ist eine Zwischenbemerkung erforderlich. Das Wort Ḥanīf stammt aus dem Christlich-Syrischen, wo es Heide bedeutet. Im Arabien der Zeit Mohammeds bezeichnete man mit diesem Wort einen Angehörigen einer Frömmigkeitsströmung, die die Vielgötterei der Mehrheit der Zeitgenossen ablehnte, sich aber nicht entschließen konnte, das Judentum oder das Christentum anzunehmen. Das wurde eben erwähnt. Wie schon für das frühe Christentum Abraham die Gestalt war, die einen Anschluß an die Botschaft Jesu ermöglichte, ohne zuvor Jude zu werden und ohne sich auf die Befolgung des mosaischen Gesetzes zu verpflichten,32 so auch für die Ḥanīfen: Der von ihnen erinnerte Abraham erschloß den Heiden die monotheistische Gottesverehrung, ohne daß von ihnen ein Übertritt, ein Bekenntnis zu einer der beiden „Schriftreligionen“, verlangt worden wäre. Denn eines wollten die Ḥanīfen nicht: Sie wollten nicht auf das heidnische Tieropfer verzichten; sie meinten, die Juden und Christen hätten sich wegen eines solchen Verzichts den Zorn Gottes zugezogen.33 Der Islam, der solche Opfer fordert (Sure 22, 31–33), ist vor Allah die einzige Daseinsordnung, die zählt, versichert ihnen [29] Mohammed; auch die „Schriftbesitzer“ hätten diese Botschaft erhalten. Sie hätten sich über sie zerstritten; sie und die „Beigeseller“ sollten schleunigst wieder das Gesicht vorbehaltlos Allah zuwenden (vgl. Sure 3, 19 f.).
Man könnte viele weitere Koranverse beibringen, in denen mittelbar oder unmittelbar der Anspruch erhoben wird, der Islam sei die eine, unveränderte und unveränderliche Daseinsordnung, in die die Juden und Christen zurückkehren und die die Heiden bedingungslos annehmen müßten, wie aus der vorhin zitierten Stelle Sure 2, Vers 256 f., hervorgeht. Die frühen arabischislamischen Grammatiker und Lexikographen, die sich ernsthaft mit dem befaßten, was über die vorislamischen Araber überliefert wurde, charakterisierten die Hanifen als Araber, die beschnitten waren und zur Kaaba pilgerten; auch sollen sie die rituelle Waschung vollzogen haben.34 „Richte das Gesicht auf die Daseinsordnung wie ein Gottsucher! Das ist die Beschaffenheit (arab.: al-fiṭra), in der Allah die Menschen schafft. Es gibt keinen Ersatz für Allahs Schaffen! Das ist die ewig bestehende Daseinsordnung, die meisten Menschen aber wissen das nicht!“ (Sure 30, 30). Daß Allah alle Menschen als Hanifen schafft, findet man auch im Prophetenhadith.35 Allerdings verwarf Mohammed asketische Strömungen innerhalb des Hanifentums: Sein Islam ist das „großzügige Hanifentum“ (arab.: al-ḥanīfīja as-samḥa); schließlich lehnt er ja auch das Mönchtum und die strengen jüdischen Speisegebote ab.36 Wie ein Gottsucher, ein Araber, der sich vom heidnischen Götzenkult abgewendet hat und nun nach dem durch den einen Schöpfer erlassenen unverfälschten Ritualgesetz verlangt,37 soll man sich den Lehren Mohammeds anschließen. Denn jeder Mensch, den Allah schafft, ist zu dieser wahren Daseinsordnung hin veranlagt.38 Es gibt keinen Menschen, der von sich aus zum Judentum, zum Christentum oder Heidentum geschaffen wäre! Verkürzt gesagt, jeder Mensch wird als Muslim geboren; es sind seine Eltern oder andere schlechte Einflüsse, die ihn gemäß Allahs unauslotbarem Ratschluß aus der wahren Daseinsordnung herausreißen.
[30]4. Allah, der eine Gott der Gemeinwesenreligion
„Das Ende des Opferkults“ ist eine tiefschürfende Studie über die Wandlungen des Religiösen in der Spätantike überschrieben.39 Der Mensch der Antike wurde in die Kulte hineingeboren, deren sich das Gemeinwesen widmete, dem er meist ebenfalls von Geburt an angehörte. Diese Kulte, in denen Opferhandlungen wesentlich waren, sollten die Gewogenheit der Gottheiten sicherstellen, die durch das Gemeinwesen verehrt wurden. Überdies war es in höchstem Maße ratsam, auch jenen übernatürlichen Kräften zu opfern, die das Wohl der engeren Gemeinschaft des Einzelnen, seiner Sippe, seines Hauses, seines Gesindes, gewährleisteten. Diese überkommene Religiosität löste sich in der Spätantike allmählich auf. Selbst Männer, die noch in den alten Bräuchen lebten, stellten sich die Frage, ob die Götter wirklich Opfer verlangten; konnten sich die Unsterblichen tatsächlich am Blut eines geschlachteten Stiers erfreuen? Der Sinn der Tieropfer wurde bezweifelt. Insbesondere das spätantike Judentum und das sich aus diesem heraus entwickelnde Christentum lehnten derartige Opfer ab, zumal sie auch die Verehrung der zahlreichen übernatürlichen Numina zugunsten der Anbetung des Einen Schöpfergottes verwarfen.
Der byzantinische Kaiser Konstans II. (reg. 641–668) verfügte die Einstellung der öffentlichen Opferzeremonien.40 Diese Verordnung bildet den Kontrast zu dem, was der Koran verkündet; denn dem Hanifentum war es der Inbegriff religiöser Praxis, zu einem Heiligtum – wie der Kaaba – zu pilgern und dort die mitgeführten geschmückten Opfertiere zu schlachten.41 Im selben Sinn sagt Mohammed, Allah habe die Opfertiere zu den charakteristischen Merkmalen des ihm zu widmenden Kultes erhoben. Zwar sei ihm nicht an dem Fleisch gelegen. Er nehme das Opfer jedoch als einen Dank für die Rechtleitung entgegen (Sure 22, 36 f.). In der frühmedinensischen Sure 2, die die Überschrift „Die Kuh“ erhalten hat, erläutert Mohammed, daß sich die Juden einst geweigert hätten, eine Kuh zu schlachten, die Allah von ihnen als ein Opfer gefordert habe. Erst als Mose ihnen genau beschrieben habe, wie das Tier beschaffen sein solle, hätten sie sich dazu bereitgefunden; „fast hätten sie es nicht getan“ (Sure 2, 67–71). Wegen derartigen Ungehorsams zürne und fluche Allah den Juden und Christen. Den Zorn und den Fluch Allahs hätten aber die Hanifen, die auf der Suche nach der richtigen Ritualpraxis gewesen seien, nicht auf sich laden wollen. Deshalb seien sie weder [31] für das Judentum, noch für das Christentum zu gewinnen gewesen. Mohammed präsentiert sich daher als der durch Allah berufene Sachwalter aller Hanifen und somit auch des ersten unter ihnen, Abrahams: Einer besseren Daseinsordnung als derjenigen, die Allah Abraham schenkte und die er nun Mohammed auferlegt, kann man sich nicht anschließen (Sure 2, 124–141; Sure 4, 125).
Abraham, der Hanif, ist in Mohammeds Augen ein für allemal das Vorbild für den Weg zum wahren Eingottglauben. Im Koran erzählt er davon in Sure 6, die gegen Ende seines Wirkens in Mekka entstand. Abraham tadelt seinen Vater Azar, da dieser Götzenbilder anstelle des einen Allah anbetet. In den Himmel blickend, vermutet Abraham zuerst in einem großen Stern, dann im Mond und zuletzt in der Sonne den einen Herrn, den er sucht, den Einen niemals ruhenden Schöpfer, dem man nichts und niemanden beigesellen kann. Doch jedes der Gestirne geht unter, keines ist bleibend, keines kann daher der Eine sein. Indem Abraham das zu Bewußtsein kommt, spricht er: „Ich wende jetzt mein Gesicht zu dem, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Ich tue dies als ein Hanif, ich bin kein ‚Beigeseller‘!“ (Vers 79). Doch nicht der eigenen Einsicht verdankt Abraham diese Erkenntnis, er gewinnt sie, weil Allah ihn „rechtleitet“ (Vers 77). Zur „Beigesellung“ hat Allah nämlich niemandem eine Vollmacht erteilt (Vers 81), und deshalb ist die „Beigesellung“ falsch, nicht etwa wegen einer Einsicht, zu der ein Mensch selbständig vordringt. Vor diese Episode schiebt der Koran einen Vers ein, der verhindern soll, daß man auf diese irrige Meinung verfällt: „So zeigen wir (d. h. Allah) Abraham (unser) Walten über die Himmel und die Erde, und (wir zeigen es ihm), damit er einer von denen sei, die Gewißheit erlangen“ (Vers 75).
Wesentliche Topoi dieser Darstellung finden sich bei dem Juden Philo von Alexandrien, einem Zeitgenossen Jesu und wichtigen Ideengeber der christlichen Kirchenväter. Er erzählt, wie Abraham auf Geheiß Gottes Chaldäa verläßt, nach Charran und schließlich nach Kanaan wandert. Philo legt diesen Weg als das erfolgreiche Ringen um die wahre Gotteserkenntnis aus, die Abraham in zwei Etappen gewinnt. Die Chaldäer hätten angenommen, daß außerhalb der materiellen Phänomene nichts die Ursache eines anderen sein könne. Allein aus dem Umlauf der Gestirne resultierten das Gute und das Böse, daß einem jeden zuteil werde. Indem Abraham das Land der Chaldäer verläßt, erkennt er, daß es keineswegs die Gestirne sind, die das Diesseits lenken; koranisch gesprochen, gibt er die „Beigesellung“ auf. Bei Philo erfolgt nun in Charran der zweite, nach seiner Überzeugung unentbehrliche Schritt auf dem Weg zur Gotteserkenntnis: Abraham begreift, daß das Werk des Schöpfergottes so verfaßt ist, daß dem Menschen die jenseits des Materiellen liegende Einsicht in gut und böse sowie ein ihr entsprechendes Handeln abverlangt werden. In Kanaan kommt sie zur Reife; denn, sein Denk[32]vermögen nutzend, wendet sich Abraham zu sich selber zurück. Es ist nämlich unmöglich, daß jemand zur Erkenntnis des seienden Gottes gelange, während er noch stärker durch die sinnliche Wahrnehmung als durch die Reflexion bewegt wird.42
Der Koran beendet den Weg Abrahams, noch ehe dieser Charran erreicht.43 Die selbstverantwortete denkende Wendung zum Immateriellen und die ethische Bewertung des Handelns unterbleiben. Mit dieser Einsicht wird es uns möglich, den Inhalt des Begriffs Islam genauer zu erfassen. Der Mensch befindet sich, wie die islamische Theologie später sagen wird, in der besten aller Welten, denn da sie ja nicht nur „am Anfang“ von Allah geschaffen wurde, sondern fortwährend durch ihn in allen Einzelheiten gestaltet wird – es gibt keine Kräfte und Mächte außer ihm –, muß es so sein. Islam meint, diesen Sachverhalt ohne Wenn und Aber zu bezeugen, ganz so wie Allah selber es laut Sure 3, Vers 18, tut: „Allah bezeugt, daß es keinen Gott außer ihm gibt, ebenso bezeugen es die Engel und alle, die das (offenbarte, schon Adam übertragene) Wissen haben.“44 Mittelbar haben wir hier den ersten Teil der šahāda, der islamischen Glaubensbezeugung, vor uns, die nicht mit einem Bekenntnis, dem Ergebnis einer von den materiellen Erscheinungen absehenden Glaubenseinsicht, zu verwechseln ist, wie sie Abraham erst in Charran und Kanaan gelang.
Der Islam ist daher keine Bekenntnisreligion. Man wird nicht Muslim, indem man ein Credo ablegt, über dessen Gültigkeit eine Institution wacht. Allahs fortwährendes Schöpfungshandeln läßt sich ohne vorherige Reflexion an der Natur ablesen – Allah sendet Regen, das Verdorrte wird belebt, es dient den Menschen zur Nahrung – und genauso am Heranreifen der Leibesfrucht: Jeder Mensch wird als ein winziges Element dieses Schöpfungshandelns geboren (Sure 22, 5 und Sure 23, 14), somit als jemand, der unmittelbar zu Allah ist, diesem das Gesicht zuwendend, in der ursprünglichen Geschaffenheit, also als Muslim. Niemand kann diese Art der Geschaffenheit (arab.: al-fiṭra) austauschen (Sure 30, 30). Auch sein Lebens- und sein Jenseitsschicksal hat Allah bereits entschieden, und so mag es sein, daß gemäß Allahs Ratschluß die Eltern das neugeborene Kind zu einem Juden oder Christen erziehen und dadurch die vorausbestimmte Verdammnis eintreten [33] lassen. Prinzipiell ist der Islam daher die Religion des die gesamte Menschheit umfassenden Gemeinwesens.45
Religionsgeschichtlich betrachtet, zeigt sich der Islam als ein Glaube, der hinter die schon gut erforschten Tendenzen spätantiker Religiosität zur Individualisierung zurückgeht. Er ist eine grundsätzlich den ganzen Weltkreis einschließende Gemeinwesenreligion, der jeder Mensch vom Augenblick der Zeugung an zuzurechnen ist. Ursprünglich waren die Menschen eine einzige Gemeinschaft heißt es in Sure 2, Vers 213, und Mohammed, der sich in ebendieser Sure als den neuen Abraham zu erkennen gibt, verfolgt, indem er den Islam verkündet, das Ziel, diesen Zustand wiederherzustellen. Denn jedem Menschen, der durch Allah im Mutterleib herangebildet wird, ist diese geschöpfliche Bindung an Allah, die fitra, eigen,46 die niemand abändern kann (Sure 30, 30). Selbst wenn zu einer anderen Religion fehlgeleitete Eltern ihr Kind zu deren Bekenner heranziehen, dann wird dieser Kern davon nicht berührt, genau wie in ihnen dieser wahre Kern nur verdeckt, nicht aber zerstört wurde. Von einer selbst zu verantwortenden Ausrichtung und Bewertung des Handelns als gut oder böse bzw. von der Pflicht, eigenständig gut und böse zu erkennen, ist dementsprechend im Koran nicht die Rede. Handeln bedeutet vielmehr, dem Islam, der Auslieferung der Person an den Einen, Dauer zu verleihen.
Dies nötigt uns, ein letztes Mal in die spätantike Religionsgeschichte zu blicken. Der Hanif Abraham, der Freund Allahs, steht offensichtlich für eine andere Art des Ein-Gott-Glaubens, als sie sich im spätantiken Judentum und, auf diesem aufbauend, im Christentum herausbildet. Für Philo wie für die Kirchenväter ist wahre Gotteserkenntnis wie selbstverständlich an die Versittlichung der Weltauslegung geknüpft. Wahre Gotteserkenntnis sei nur bei gleichzeitiger Übung von Tugend und Gerechtigkeit möglich, sagt beispiels[34]weise Justin der Märtyrer (2. Jahrhundert).47 Sichtbar wird die durch das spätantike Judentum ausgelöste und durch das Christentum vorangetriebene Abkehr von überkommenen Konzepten des Göttlichen und seines Verhältnisses zum Menschen in der berühmten Streitschrift des Origenes (gest. 254) gegen Celsus (zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.), einen Apologeten der tradierten Religion. Die Ausführungen Origenes’ vermögen unseren Gegenstand unter mehreren Gesichtspunkten zu erhellen. Celsus ist der Meinung, die Initiierung des Kosmos, die in seinen Augen nicht mit dem Schöpfungsbericht des Alten Testaments gleichzusetzen ist, sei ein Werk, das der höchsten Gottheit würdig sei; denn dieser Kosmos sei vollkommen, allem sei der angemessene Platz zugewiesen. Die Gottheit sorge für den Fortgang ihres vollkommenen Werkes, dessen künftiger Abbruch unverständlich sei. Die Linearität des Geschichtsverlaufs, beginnend mit dem Schöpfungsakt und endend mit der Vernichtung des Diesseits und dem Weltgericht, vermag Celsus mit seiner Idee eines überzeitlichen Zusammenwirkens des Göttlichen mit dem Irdischen nicht zu vereinbaren. Den Kosmos stellt sich Celsus als ein Gebilde vor, das unter dem höchsten numen wie ein Beamtenstaat organisiert ist. Über diesem numen nachgeordnete Kräfte wird das Gebilde in Gang gehalten und gelenkt. An der Spitze der von der obersten Gottheit gelenkten Kräfte nimmt Celsus die Gestirne an, dann folgen die verschiedenen Klassen der Dämonen. Durch deren Tätigkeit werden die von höchster Stelle ausgehenden Anweisungen bis in den entlegensten Winkel des Kosmos und bis in die einzelnen Gliedmaßen eines jeden Menschen hinein ausgeführt. 48
Im Gegensatz zum Kosmos des Celsus ist derjenige des Origenes unvollkommen und deswegen veränderlich, er befindet sich erst auf dem Weg zur Vollkommenheit.49 Die Menschen, bei Celsus den kosmischen Kräften ausgeliefert, steigen laut Origenes auf in die dem Höchsten unterstehende Einheitskategorie der Geister, Engel und „Untergötter“, die er als die Seelen bezeichnet. Sie allesamt streben zu Gott, zur Erlösung. Sie genießen daher die Willensfreiheit, die den Wesen des Zwangssystems des Celsus fehlt.50 Jeder Mensch hat bei Origenes einen Anteil an der Vernunftseele, der ihn dazu befähigt, widergöttliche Regungen zu bekämpfen. Siegt er in diesem Kampf, den er als Individuum zu bestehen hat, wird er Gott ähnlich, erringt [35] die Gottebenbildlichkeit und damit die Vollendung, die Adam zugedacht war, als Gott ihn schuf.51
Der Hanif Abraham ist insofern fest in der nach christlicher Ansicht überholten Religiosität verwurzelt, als er in der materiellen Welt den Beleg für die Existenz Allahs findet. In Sure 6, Vers 75, erfährt der Koranleser, daß dies der richtige Weg zur Gotteserkenntnis ist. Allah führte Abraham diesen Weg, weil er wollte, daß dieser Gewißheit erlange.52 Das klingt wie eine ausdrückliche Zurückweisung der in Judentum und Christentum für unentbehrlich gehaltenen Wendung des Erkennenden nach innen nebst einer sittlichen Fundierung der Einsicht in das Wesen Gottes.53 Was erkannt wurde, die Einsheit Allahs, bleibt für Abraham etwas Äußerliches: Hätte Allah eine Vollmacht zum Götzenkult herabgesandt, dann würde Abraham Idole anbeten (Sure 6, 81).
5. Der Ursprung des Unislamischen
Wie aber kann Allah es zulassen, daß fehlgeleitete Eltern ihr Kind von der Geschaffenheit zum Islam hin abbringen, wie kann er zulassen, daß es überhaupt „unislamische“ Eltern gibt? Auch hierauf erteilt der Koran eine einfache Antwort, die ganz anders lautet, als der Christ sich das vorstellt. Eine Urschuld kennt der Islam nicht; sie kann es nicht geben, denn jeder Mensch wird, wie wir eben gehört haben, als Muslim geboren. Daß er nicht im Bewußtsein seines fortlaufenden Geschaffenwerdens durch Allah verharrt, ist Einwirkungen zuzuschreiben, die nicht in seiner Macht liegen. Ohnehin hat Allah doch den Verlauf des diesseitigen Lebens und das Jenseitsschicksal schon vor der Geburt eines jeden Menschen festgelegt. Ja, nach islamischer Vorstellung registrierte Allah den gesamten künftigen Weltenlauf, bevor er überhaupt mit dem Schöpfungshandeln begann, mittels eines Schreibrohrs auf einer in seiner Gegenwart verwahrten Tafel. Zu den Eintragungen gehört übrigens auch der Koran, den er allen Propheten, zuletzt Mohammed, offenbart hat (Sure 85, 22). Aus dem Vorherbestimmten gibt es keine Befreiung, keine Erlösung, und folglich kennt der Islam auch keinen an die Glaubenden auszuteilenden Gnadenschatz und keine Organisation, die diesen verwalten könnte. Mittelbar schafft Allah demnach auch das Widerislamische. Wie dies zu verstehen ist, erklärt der Koran an mehreren Stellen.