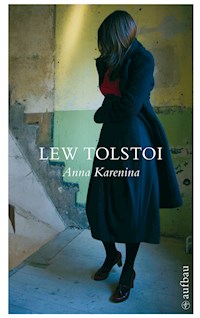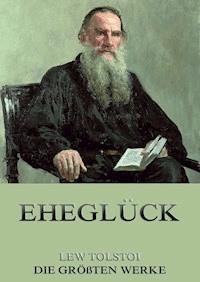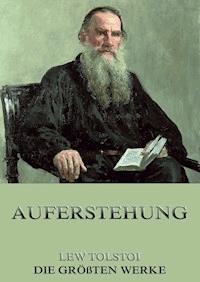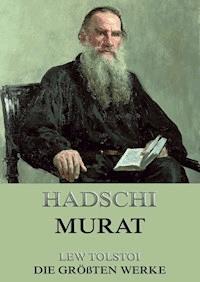1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Krieg und Frieden", einem der herausragendsten Werke der Weltliteratur, entfaltet Lew Tolstoi ein vielschichtiges Panorama der russischen Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts, inmitten der napoleonischen Kriege. Durch die kunstvolle Verknüpfung fiktiver Charaktere mit historischen Figuren gelingt es Tolstoi, die komplexen Verflechtungen zwischen Schicksal, Freiheit und Determinismus zu ergründen. Sein literarischer Stil, geprägt von epischer Breite und psychologischer Tiefe, offenbart die innere Konflikte der Protagonisten und reflektiert die großen Themen des Lebens – Liebe, Krieg, Verlust und die Suche nach Sinn. Die reichhaltigen Beschreibungen der Schlachten und das intime Porträt der aristokratischen Kreise machen das Werk zu einem einzigartigen Erlebnis. Lew Tolstoi, geboren 1828 in eine wohlhabende Familie, erlebte selbst die Umbrüche seiner Zeit und stellte häufig die moralischen und philosophischen Fragestellungen seines Lebens in den Mittelpunkt seiner Werke. Nach einer tiefen persönlichen Krise und einer spirituellen Wiedergeburt wandte er sich der Schriftstellerei zu, mit dem Ziel, das menschliche Leiden und die Suche nach einem guten Leben zu thematisieren. Diese biografischen Elemente spiegeln sich in "Krieg und Frieden" wider, wo er sowohl die Grausamkeit des Krieges als auch die Schönheit des menschlichen Miteinanders thematisiert. Dieses epochale Werk ist eine Einladung an den Leser, die historischen und philosophischen Dimensionen des Lebens zu reflektieren. Es bietet nicht nur einen tiefen Einblick in die turbulente Zeit Napoleons, sondern auch universelle Einsichten in die menschliche Natur und die Suche nach Identität und Frieden. Tolstois Meisterwerk ist ein Muss für jeden, der sich für die menschliche Existenz und das Zusammenspiel von Geschichte und individuellem Schicksal interessiert. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Krieg und Frieden (Klassiker der Weltliteratur)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Ein Kanonenschlag zerreißt die Musik eines Ballsaals: So prallen in diesem Werk private Sehnsucht und die unbarmherzige Mechanik der Geschichte aufeinander. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi entfaltet die Spannung zwischen Intimität und Weltgeschehen, zwischen der verletzlichen Wärme des Hauses und dem frostigen Atem der Schlachtfelder. In dieser Reibung entsteht ein Panorama des Lebens, das sich weigert, in einfachen Gegensätzen zu verharren. Der Roman fragt, wie Menschen Sinn, Liebe und Haltung bewahren, wenn Ereignisse sie überrollen. Er zeigt, dass das, was wir Frieden nennen, oft nur ein flüchtiger Zwischenraum ist, in dem Entscheidungen Gewicht gewinnen.
Geschrieben in den 1860er Jahren und 1869 in Buchform veröffentlicht, gehört Krieg und Frieden zu den maßgeblichen Werken der Weltliteratur. Tolstoi, russischer Schriftsteller von epochaler Bedeutung, verankert seine Erzählung in den Jahren der napoleonischen Kriege und im Russland der Aristokratie. Entstanden ist der Roman zunächst als Fortsetzungswerk; seine endgültige Gestalt vereint epische Erzählung mit essayistischer Reflexion. Er führt Leserinnen und Leser von Salons und Landgütern zu Marschrouten und Gefechten und zurück. Dabei bleibt das Zentrum stets der Mensch, seine Motive, Irrtümer und Hoffnungen. Die historische Kulisse ist groß, doch ihr Sinn wird am gelebten Detail verhandelt.
Warum gilt dieses Buch als Klassiker? Weil es die Möglichkeiten des Romans erweitert und Maßstäbe gesetzt hat, an denen sich noch heute Erzählungen messen. Tolstoi verbindet psychologische Genauigkeit mit sozialer Weite, moralischer Ernsthaftigkeit und lebendiger Anschaulichkeit. Er zeigt das Private, ohne das Politische zu vernachlässigen, und entfaltet Geschichte, ohne das Individuum zu verlieren. Die Zeitlosigkeit liegt in der geduldigen Beobachtung menschlicher Regungen, in der Genauigkeit des Blicks für Gewohnheit, Zufall und Gewissen. So entstand ein Werk, das Epochen überbrückt und Leserinnen und Leser verschiedenster Zeiten in dieselben Fragen verstrickt.
Seine Wirkung reicht weit über die russische Literatur hinaus. Krieg und Frieden wurde zum Modell des großen Gesellschafts- und Ideenromans, der Panorama, Charakterstudie und Geschichtsdeutung miteinander verschaltet. Viele spätere Autorinnen und Autoren fanden hier Anregungen für multiperspektivisches Erzählen, für die Darstellung kollektiver Erfahrung und für die kritische Befragung historischer Narrative. Der Roman prägte Vorstellungen davon, was erzählerische Totalität leisten kann, ohne auf Simplifizierung zu verfallen. Seine reichhaltige Prosa und sein moralisches Ethos haben Generationen inspiriert, das Menschliche im Strom der Ereignisse zu suchen – und den Roman als Kunstform neu zu denken.
Inhaltlich spannt der Roman den Bogen über die Jahre 1805 bis 1812, als Europa von Napoleons Feldzügen erschüttert wird und Russland in den Strudel gerät. Im Mittelpunkt stehen Angehörige des Adels und ihr Umfeld, deren Lebenswege Liebe, Freundschaft, Pflicht und Irrtum verbinden. Salongespräche, Familienfeste und Erbstreitigkeiten stehen neben Märschen, Befehlen und Schlachtengetöse. Ohne sich in Einzelhelden zu verengen, zeigt Tolstoi, wie persönliche Entscheidungen auf historische Kräfte treffen. Der Ausgang bleibt hier unausgeführt; entscheidend ist die Bewegung: das Wachsen, Scheitern, Prüfen, das Ringen um eine Haltung in Zeiten, die Gewissheiten zersetzen.
Formal überzeugt das Werk durch eine wandlungsfähige Erzählweise, die Nähe und Distanz souverän balanciert. Tolstoi wechselt von der feinsten Beobachtung eines Blicks oder einer Handbewegung zur weiten Kartographie einer Schlachtordnung. Das Ergebnis ist ein organischer Rhythmus, in dem Szenen atmen und Gedanken nachhallen. Die Sprache macht soziale Welten hörbar, spiegelt Bildungsansprüche und Unsicherheiten, und zeigt ein Milieu, das zwischen Sprachen, Moden und Idealen pendelt. Ebenso wichtig sind die essayistischen Passagen, in denen das Nachdenken über Geschichte, Zufall und Notwendigkeit die Handlung begleitet und ihre Erfahrungswerte vertieft.
Thematisch erkundet der Roman die Zerbrechlichkeit des Friedens und die Übermacht des Krieges – nicht nur als militärisches Geschehen, sondern als Dauerzustand der menschlichen Seele. Fragen nach Sinn, Verantwortung, Glauben und Gemeinschaft durchziehen die Erzählung. Liebe erscheint als Möglichkeit und Prüfung, Freiheit als Aufgabe und Zumutung. Der Zufall greift störend ein und offenbart, wie begrenzt die Kontrolle des Einzelnen bleibt. Gleichzeitig zeigt sich, wie Gewöhnung, Bildung und Gewissen Entscheidungen formen. Aus diesen Spannungen entsteht ein intensives Nachdenken über das, was bleibt, wenn Ruhm verblasst und Lärm verhallt.
Tolstoi entwickelt eine eigentümliche Geschichtsphilosophie, die die Macht des sogenannten großen Mannes relativiert. Statt heroischer Allmacht betont er die Vielzahl kleiner Ursachen, die sich unüberschaubar verschränken. Die Bewegung der Geschichte erscheint als Ergebnis ungezählter Handlungen, Missverständnisse und Notwendigkeiten. Diese Perspektive rückt Verantwortung in ein neues Licht: Sie entlastet nicht, aber sie verkompliziert. Leserinnen und Leser lernen, Kausalität als Geflecht zu sehen und Ruhm als unsicheres Konstrukt. Dadurch gewinnt das Epos eine nachdenkliche Tiefe, die über das Geschehen hinausweist und die Deutungshoheit der Geschichtsschreibung befragt.
Gleichzeitig ist das Buch eine Schule des Blicks und des Mitgefühls. Es zeigt Menschen, die irren, lernen, an Grenzen geraten und in der Auseinandersetzung mit sich und anderen reifen. Moral erscheint nicht als starres Gesetz, sondern als Praxis im Angesicht widersprüchlicher Anforderungen. Der Roman prüft, was Treue, Mut, Demut oder Verantwortung bedeuten, wenn Worte zu Taten werden müssen. Er zeigt, wie die Erfahrung von Verlust neue Maßstäbe setzt, ohne die Würde des Alltags zu mindern. So entsteht eine Ethik des Hinsehens, die ohne Sentimentalität Nähe schafft.
Die Lektüre ist ein weites Erlebnis: dichte Gesellschaftsszenen, leises Komödienlicht, raues Kriegslicht, Naturbilder, die Raum und Zeit fühlbar machen. Tolstoi inszeniert Gespräche, in denen Eitelkeit und Sehnsucht aufblitzen, und Landschaften, in denen Entschlüsse reifen. Ironie und Ernst gehen Hand in Hand. Das Tempo variiert, erlaubt Atempausen und Zuspitzungen, wechselt zwischen inneren Monologen und beobachtender Erzählung. Dadurch bleibt die Prosa zugleich zugänglich und anspruchsvoll. Wer sich einlässt, findet eine Welt, die das Denken anregt und das Fühlen schärft, ohne die Komplexität der Wirklichkeit zu glätten.
Auch heute spricht der Roman mit überraschender Klarheit. In Zeiten globaler Verwerfungen zeigen seine Einsichten über Macht, Information, Angst und Hoffnung eine ungebrochene Gültigkeit. Er erinnert daran, dass Geschichte nicht fern verläuft, sondern in Wohnstuben, auf Straßen und in Gewohnheiten fortlebt. Die Fragen nach Verantwortung in großen Systemen, nach der Rolle des Zufalls und nach der Würde des Einzelnen sind aktueller denn je. Krieg und Frieden lädt dazu ein, Urteile zu verlangsamen, Unterschiede auszuhalten und menschliche Erfahrung in ihrer Vielstimmigkeit ernst zu nehmen.
So bleibt Krieg und Frieden ein Werk von dauernder Anziehungskraft: weit, lebendig, nachdenklich und fordernd. Es verbindet erzählerische Fülle mit einer beharrlichen Suche nach Wahrheit jenseits von Parolen. Als Klassiker wirkt es nicht museal, sondern gegenwärtig, weil es die Unruhe der Welt und die Zähigkeit des Alltags gleichermaßen versteht. Wer dieses Buch aufschlägt, betritt kein Denkmal, sondern eine lebendige Ordnung von Stimmen, Gesten und Ideen. Aus ihr entsteht ein Echo, das lange trägt: eine Einladung, im Strom der Geschichte Menschlichkeit als Aufgabe zu begreifen.
Synopsis
Der Roman setzt 1805 in den Salons Sankt Petersburgs ein und führt in die Welt des russischen Adels ein. Im Mittelpunkt stehen drei Familien: die lebensfrohen Rostows in Moskau, die pflichtbewussten Bolkonskis auf dem Land und der unbeholfene, idealistische Pierre Besuchow, der zwischen Vergnügen und Sinnsuche schwankt. Andrei Bolkonski ist von der höfischen Oberflächlichkeit ernüchtert und sucht im Militär eine Aufgabe, während seine Schwester Maria ein stilles, religiös geprägtes Leben führt. Natascha und Nikolai Rostow verkörpern jugendliche Erwartung. Vor dem Hintergrund europäischer Spannungen kündigen sich Krieg, gesellschaftliche Umbrüche und persönliche Bewährungsproben an.
Mit Ausbruch der Feldzüge gegen Napoleon verlagert sich der Blick an die Front. Andrei tritt in den aktiven Dienst und erlebt die Diskrepanz zwischen glanzvollen Vorstellungen vom Ruhm und der ernüchternden Realität militärischer Planung. Die Schlachtfelder offenbaren Zufall, Missverständnisse und menschliche Grenzen. In der Hauptstadt durchläuft Pierre die Mühlen der vornehmen Gesellschaft, lässt sich blenden und merkt zugleich, wie leer viele Pose wirkt. Die politischen Bündnisse Europas verschieben sich, und in den Petersburger Salons spiegeln sich Hoffnungen, Gerüchte und Angst. Erste Verluste, Irrtümer und kleine Erfolge bestimmen den Kriegsalltag, ohne scheinbar klare Sieger oder einfache Erklärungen.
Zwischen den Kampagnen rückt das häusliche Leben in den Blick. Bei den Rostows wechseln Feste, Jagden und wirtschaftliche Sorgen einander ab; Freigebigkeit und Naivität geraten in Spannung. Natascha wächst heran und entdeckt Tanz, Musik und die berauschende Aufmerksamkeit der Gesellschaft. Auf dem Gut der Bolkonskis herrschen Disziplin und Strenge; Maria ringt um Selbstbehauptung und Mitgefühl. Andrei kehrt verändert zurück, reflektiert Einsamkeit und Pflichten und richtet den Blick auf Reformen und Verantwortung. Zwischen Moskau und Petersburg blühen Bälle und Maskeraden, während Europa nach kurzen Friedensphasen erneut unruhig wird. Private Sehnsüchte verschränken sich mit Fragen nach Ehre, Loyalität und Zukunft.
Beziehungen treten in den Vordergrund und stellen die Figuren vor heikle Entscheidungen. Begegnungen zwischen Natascha und Andrei eröffnen Perspektiven, in denen Hoffnung und Zurückhaltung ringen. Parallel dazu entfaltet die Bühne der Gesellschaft ihren Sog: Verführerische Gesten, berechnende Bekannte und unbedachte Schwärmereien erzeugen Missverständnisse. Eine übereilte Versuchung bringt Natascha in einen Loyalitätskonflikt, dessen soziale Folgen spürbar werden. Die Rostows müssen die fragile Balance zwischen Gefühl und Anstand wahren, während Andrei Abstand sucht und über verletzte Erwartungen nachdenkt. Aus den privaten Irritationen erwachsen Reifeprozesse, die späteres Handeln prägen, ohne die Bindungen endgültig zu bestimmen.
Pierre gerät unterdessen in einen inneren Wandel. Begegnungen mit neuen Glaubensvorstellungen und ein Kreis von Gleichgesinnten eröffnen ihm eine ethische Perspektive jenseits eitler Selbstdarstellung. Er versucht, persönliche Fehler zu korrigieren, zeigt Hilfsbereitschaft gegenüber Abhängigen und stößt dabei auf praktische Grenzen. Eine Zuspitzung privater Spannungen führt zu einem gefährlichen Duell, das seine Selbstbilder erschüttert, ohne alle Fragen zu beantworten. Aus Scham, Tatendrang und Gewissensnot entsteht ein tastender Weg zur Verantwortung. Gleichzeitig zeigt sich, wie schwer es ist, hehre Einsichten in widersprüchlichen Verhältnissen umzusetzen, in denen Gewohnheit, Prestige und Bedürftigkeit ineinander greifen.
Die Invasion Napoleons 1812 verändert den Rhythmus des Landes. Mobilmachung, Freiwilligengeist und Skepsis begegnen einander, während die Armee unter vorsichtigen Befehlshabern die Kräfte sammelt. Kutusow setzt auf Zeit, Gelände und Erschöpfung des Gegners, statt auf schnelle Siege. Nikolai Rostow erlebt Frontdienst, Reitergefechte und Kameradschaft, die ihn ernüchtern und festigen. In Moskau wägen Familien zwischen Flucht und Beharren, sichern Habseligkeiten und helfen Bedürftigen. Gerüchte über Vor- und Rückzüge wechseln im Tagesrhythmus. Hinter den strategischen Linien entstehen Netzwerke aus Logistik, Pflege und improvisierter Verwaltung, die zeigen, wie sehr Kriege vom unsichtbaren Einsatz vieler abhängen.
Eine große Entscheidungsschlacht zeichnet sich ab und verdichtet die zuvor verstreuten Erfahrungen. Der Kampf bei Borodino wird zum Symbol zäher Ausdauer und zeigt die Grenzen militärischer Planung angesichts Chaos und Zufall. Pierre beobachtet als Zivilist entscheidende Momente aus nächster Nähe und begreift die Kluft zwischen Erzählung und Wirklichkeit. Andrei findet sich erneut an vorderster Linie, wo Tapferkeit und Ohnmacht ununterscheidbar werden. Befehle, Missdeutungen und das Schweigen nach dem Lärm lassen die Bedeutung von Verlust sichtbar werden. Die Frage, ob Standhalten oder Rückzug klüger ist, bleibt umstritten und führt zu schmerzhaften Konsequenzen.
Nach der Schlacht fällt die Entscheidung zugunsten der Räumung Moskaus. In der Stadt mischen sich Panik, Plünderung, Fürsorge und trotziges Festhalten; Brände vernichten Straßenzüge. Die Rostows stehen vor schwierigen Prioritäten und zeigen Mitgefühl gegenüber Fremden und Verwundeten. Unter französischer Besatzung treten Improvisation und Moral auf die Probe, während außerhalb der Stadt Partisanen und reguläre Truppen den Gegner zermürben. Der Rückzug der Grande Armée wird zu einer Prüfung für beide Seiten. Für die Hauptfiguren bringt diese Phase Begegnungen, Entbehrungen und Einsichten, die ihren Blick auf Schuld, Vergebung und das Gewicht des Augenblicks verändern.
Mit dem Ende der Feldzüge verlagert sich der Fokus auf Erholung, Anpassung und Deutung. Familien ordnen Besitz, pflegen Wunden und suchen nach verlässlichen Bindungen. Manche Wege kreuzen sich erneut, Versprechen werden neu verhandelt, doch die endgültigen Lebensentscheidungen ergeben sich eher aus stiller Reifung als aus großen Gesten. In essayistischen Passagen reflektiert der Roman über Geschichte: Er stellt die Wirkmacht der sogenannten großen Männer infrage und betont das Zusammenspiel unzähliger kleiner Ursachen. Freiheit und Notwendigkeit erscheinen als Spannungsfeld menschlichen Handelns. Am Ende tritt als Kernbotschaft die Würde alltäglicher Pflicht, Liebe und Mitmenschlichkeit hervor.
Historischer Kontext
Krieg und Frieden spielt vornehmlich im Russischen Reich zwischen 1805 und 1812, mit Ausblicken bis in die Jahre danach. Der Fokus liegt auf den politischen und militärischen Verwerfungen der napoleonischen Epoche unter Zar Alexander I. sowie auf den sozialen Strukturen eines noch von der Leibeigenschaft geprägten Adelsstaats. Zeitlich rahmen die Dritte Koalition gegen Napoleon, der Frieden von Tilsit und der Feldzug von 1812 die Handlung. Dieser Kontext erlaubt, Krieg als europäisches Systemereignis und als Erfahrung der russischen Gesellschaft zugleich zu zeigen: von Hof und Salons bis zu Regimentern, Dörfern und den weiten Ebenen westlich von Moskau.
Die Topographie des Romans umfasst Sankt Petersburg als politische Schaltzentrale, Moskau als kulturelles Herz und symbolische Stadt, sowie verstreute Landgüter, in denen Adelsfamilien Wirtschaft und Herrschaft ausübten. Kriegsschauplätze reichen von Österreich (Austerlitz) über die russischen Gouvernements Smolensk und Moskau bis zu den Rückzugswegen der Grande Armée. Damit verschränken sich europäische Räume mit russischer Binnenwelt: Salons in Petersburg spiegeln diplomatische Konjunkturen, während Dörfer die Realität der Leibeigenen und der Versorgungsökonomie des Heeres zeigen. Diese Orte bilden den historischen Resonanzraum, in dem Tolstoi die politischen Entscheidungen und ihre sozialen Folgen sichtbar macht.
Das Gefecht bei Schöngrabern (Hollabrunn) am 16. November 1805 war eine Rückzugs- und Verzögerungsaktion der russischen Truppen unter P. I. Bagration gegen französische Verbände unter J. Lannes und J. Murat. Strategisch sollte es den Anschluss an die österreichischen Kräfte sichern und Zeit bis zur Konzentration vor Austerlitz gewinnen. Historisch handelte es sich um ein taktisches Abwehrgefecht mit begrenztem Geländegewinn, aber hohem operativem Wert. Im Roman erscheint dieses frühe Kriegsbild als Schule des Realismus: Reiterattacken, Unübersichtlichkeit und Angst prägen die Erfahrungen junger Adliger im Dienst, die mit heroischen Vorstellungen in die grausame Praxis stoßen.
Die Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805, die Napoleon gegen die russisch-österreichischen Alliierten gewann, gilt als Musterbeispiel seiner operativen Kunst. Mit etwa 73.000 Franzosen gegen rund 85.000 Alliierte errang er durch Täuschung und Schwerpunktbildung einen entscheidenden Sieg; die Verluste der Verbündeten überstiegen 25.000 Mann. Politisch führte dies zum Zusammenbruch der Dritten Koalition. Im Buch ist Austerlitz der Zusammenstoß idealisierter Kriegsbilder mit der Wirklichkeit: Kommandounordnung, Nebel, Höhenstellungen und die Zerreißprobe des Offizierkorps werden konkret. Tolstoi bindet die Schlacht an individuelle Wahrnehmungen, um den Mythos strategischer Allmacht historisch zu relativieren.
Der Friede von Tilsit (7.–9. Juli 1807), geschlossen nach den Schlachten von Preußisch Eylau und Friedland, brachte eine vorübergehende russisch-französische Annäherung. Alexander I. und Napoleon verabredeten auf Flößen auf dem Niemen die Neuordnung Mitteleuropas, einschließlich des Herzogtums Warschau, und Russlands Beitritt zur Kontinentalsperre gegen Großbritannien. Tilsit beendete die Vierte Koalition und führte in Russland zu einer Phase höfischer Bewunderung französischer Macht bei gleichzeitig wachsendem Misstrauen. Im Roman spiegelt sich diese Ambivalenz in den Petersburger Salons: mondäne Faszination trifft auf patriotische Skepsis, die später die Mobilisierung gegen Napoleon prägt.
Die Kontinentalsperre (ab Berliner Dekret vom 21. November 1806) war ein großangelegter Handelskrieg Napoleons gegen Großbritannien. Russland verpflichtete sich 1807 zur Blockade, litt jedoch insbesondere an der Ostsee unter Schmuggel, Preissteigerungen und fiskalischem Druck. 1810 lockerte Alexander I. faktisch die Sperre (Verbot britischer Waren, zugleich neue Zollpolitik), was die Beziehungen zu Frankreich massiv belastete. Wirtschaftlich trafen die Störungen Handelshäuser und Gutswirtschaften, die auf Absatz und Kredit angewiesen waren. Im Roman erscheint dies als Hintergrund materieller Unsicherheit: Adelsvermögen geraten unter Druck, Verschuldung nimmt zu, und politische Loyalitäten werden ökonomisch fragil.
Zwischen 1809 und 1812 trieb M. M. Speranski als enger Berater Alexanders I. Reformprojekte voran: Plan einer Staatsumgestaltung (1809), Einrichtung des Staatsrats (1810), Ansätze zu Rechtskodifikation und Verwaltungsmodernisierung. Ziel war eine rationalisierte, rechtsgebundene Monarchie. Der Widerstand der Hofaristokratie und die Krisenatmosphäre 1812 führten zu Speranskis Entlassung und Verbannung. Im Roman sind diese Reformen als politischer Ton präsent: Petersburgs Bürokratie, Kommissionen und Hofzirkel werden sichtbar, ebenso die Spannung zwischen moralisierender Modernisierung und standesbewusster Selbstbehauptung. Die Begegnungen mit Speranski zeigen, wie administrative Vernunft an gesellschaftlichen Interessen zerschellen kann.
Die Freimaurerei gewann im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Russland unter Adligen und Beamten Einfluss. Logen förderten Selbstvervollkommnung, Wohltätigkeit und eine Ethik jenseits bloß höfischer Konvention. Ihre philanthropischen Projekte trafen auf die Realität der Leibeigenschaft und staatlicher Überwachung; 1822 wurden die Logen verboten. Historisch spiegeln sie die Suche nach moralischem Halt in Zeiten politischer Unsicherheit. Im Roman fungiert die maurerische Initiation als historischer Marker dieser Bewegung: Sie bindet das Ideal persönlicher Reform an die Grenzerfahrungen von Krieg und Hofleben und stellt die Frage nach tatsächlicher sozialer Wirkung solcher Elitenethik.
Die Zuspitzung 1812 ergab sich aus Russlands wirtschaftlicher Absetzbewegung von der Kontinentalsperre und dem polnischen Faktor (Herzogtum Warschau als französischer Satellit). Militärisch standen sich die russischen Westarmeen unter M. B. Barclay de Tolly (1. Armee) und P. I. Bagration (2. Armee) einer multinationalen Grande Armée gegenüber. Russland setzte auf Raum, Nachschublinien und das Aufzehren des Gegners, notfalls durch Rückzug und verbrannte Erde. Am 17./29. August 1812 wurde M. I. Kutusow Oberbefehlshaber. Im Buch ist diese strategische Wendung zentral: Geduld und defensive Klugheit erscheinen als historisch wirksamere Kräfte als spektakuläre Offensive.
Napoleon überschritt am 24. Juni 1812 mit über 400.000 Mann den Niemen. Die russische Führung wich einer großen Entscheidungsschlacht zunächst aus, vereinigte ihre Armeen und verschleppte die französischen Operationen. Bei Smolensk (16.–18. August 1812) kam es zu heftigen Kämpfen und hohen Verlusten, ehe die russische Armee geordnet zurückwich. Strategisch blieb die französische Versorgung angespannt, während Russland Zeit gewann. Im Roman verdichtet sich diese Phase in Marschbewegungen, Verwundungen und der Bewusstwerdung nationaler Bedrohung. Die Bevölkerung erlebt Rekrutierungen, Einquartierungen und Flucht; adelige Haushalte und bäuerliche Existenzen geraten in den Sog der Großereignisse.
Die Schlacht bei Borodino am 7. September 1812 westlich von Moskau war eine der blutigsten des Jahrhunderts. Rund 130.000–140.000 Franzosen trafen auf etwa 120.000–130.000 Russen; Brennpunkte waren die Flèches Bagrations und das Große Reduit (Rajewski-Redoute). Beide Seiten erlitten zusammengerechnet etwa 60.000–70.000 Verluste. Taktisch behauptete Napoleon das Feld, strategisch blieb Russland handlungsfähig. Kutusow wich, um Armee und Staat zu retten. Im Roman erscheint Borodino als Kulmination des „Vaterländischen Krieges“: Erzählte Topographie, Kommandos, Sanitätswesen und das Erleben einzelner Figuren verbinden sich zu einer historischen Darstellung, die heroische Legenden kritisch bricht.
Nach dem Kriegsrat von Fili am 13. September 1812 wurde die Aufgabe Moskaus beschlossen. Napoleon marschierte am 14. September in die entleerte Stadt ein, die zwischen dem 14. und 18. September großflächig brannte. Die Ursachen lagen in chaotischer Evakuierung, Brandstiftungen und Witterung; die Rolle des Moskauer Generalgouverneurs F. W. Rostoptschin bleibt umstritten. Er organisierte Propaganda, harte Maßnahmen gegen vermeintliche Verräter und die Räumung. Im Roman wird Moskau als moralischer Prüfstein gezeigt: Adelige helfen Verwundeten, Vermögen geht verloren, Gefangennahmen und Willkür herrschen. Die Besatzung entzaubert die französische Macht und radikalisiert russische Entschlossenheit.
Napoleon verließ Moskau am 19. Oktober 1812. Die Gefechte bei Tarutino (18. Oktober) und Malojaroslavez (24. Oktober) zwangen ihn auf die verwüstete Smolensker Straße. Kälte, Nachschubmangel, Typhus und Partisanen setzten der Grande Armée zu. Der Übergang über die Beresina (26.–29. November) gelang unter schweren Verlusten; die Reste der Armee traten den Rückzug über die Niemen an. In Russland wuchs das Selbstbewusstsein, die Initiative ging an die Alliierten über. Im Buch korrespondieren diese Etappen mit den Schicksalen von Gefangenen, Verwundeten und Zivilisten und mit der Erfahrung, dass Kriege durch Logistik, Wetter und Volkswiderstand entschieden werden.
Die russische Mobilisierung 1812 umfasste neben der Feldarmee auch Landmilizen (Opoltschenije), gebildet durch Ukase im Sommer. Kaufleute spendeten, Adelige stellten Ausrüstung, Frauen organisierten Lazarette; Geistlichkeit und Ikonenprozessionen stärkten den Patriotismus. Gesellschaftlich verschob sich die Balance: die höfische Frankophilie wurde durch eine russischsprachige Öffentlichkeit herausgefordert. Historisch zeigt sich die Verteidigungskraft eines ständischen Staats, der in der Krise horizontale Solidaritäten erzeugt. Im Roman werden diese Prozesse erfahrbar: von der spontanen Hilfe für Verwundete über den Verzicht auf Güter bis zur Loyalität bäuerlicher Gemeinschaften, die den Krieg als Schutz der Heimat begreifen.
Tolstois Darstellung ist durch seine eigenen Kriegserfahrungen im Krimkrieg (1854–1855) geprägt, wo er in Sewastopol diente und die Illusionen heroischer Führung nachdrücklich hinterfragte. Entstanden 1865–1869, fällt das Werk in die Ära der Großen Reformen nach der Bauernbefreiung von 1861. Die neue Rechtsordnung (Justizreform 1864) und Debatten um Verantwortung des Adels beleuchten rückwirkend die alte Ordnung um 1805–1812. Historisch wirkt das Buch so doppelt: Es rekapituliert die Napoleonischen Kriege und verarbeitet zugleich die Erfahrung staatlicher Modernisierung und sozialer Umbrüche, die Tolstoi zu seiner Kritik an Kommandoillusionen, Bürokratismus und der Moral des Besitzstands anregen.
Das Werk funktioniert als politische Kritik, indem es die Entscheidungsmacht „großer Männer“ relativiert und historische Notwendigkeiten, Zufälle und Masse betont. Strategische Genialität erscheint dem Leser als retrospektive Konstruktion; reale Wirksamkeit liegt in Geduld, Logistik und sozialer Kohäsion. Die Petersburger Bürokratie steht als Sinnbild einer Elite, die Papier erzeugt, aber geringe Realitätstüchtigkeit hat; Kriegsräte, Intrigen und Rangstreit spiegeln institutionelle Dysfunktion. Die Besatzung Moskaus und die Willkürmaßnahmen Rostoptschins zeigen die dunklen Seiten staatlicher Machterhaltung. Insgesamt entlarvt der Roman die Selbsttäuschungen von Hof, Militär und Öffentlichkeit über Krieg, Ruhm und angebliche Kalkulierbarkeit der Geschichte.
Gesellschaftlich kritisiert das Buch die ständische Ordnung: die Abhängigkeit der Leibeigenen, die Verschwendung und Verschuldung des Adels, die instrumentelle Wohltätigkeit und die Macht des Ansehens in Salons. Die Kriegserfahrung macht Klassengegensätze sichtbar: Bauern tragen die Last der Versorgung und Rekrutierung, während höfische Kreise mit Prestige und Sprache (Französisch) Distanz markieren, die erst die Katastrophe von 1812 überbrückt. Geschlechterrollen erscheinen in Pflichten der Pflege und der familialen Loyalität, doch auch als Ressource sozialen Handelns. Politische Konflikte zwischen Reform und Bewahrung werden als Moralproblem der Besitzenden entfaltet und als Appell an Verantwortlichkeit im Angesicht der Geschichte.
Autorenbiografie
Einleitung
Lew Tolstoi zählt zu den bedeutendsten Autoren der Weltliteratur und prägte mit Krieg und Frieden sowie Anna Karenina den europäischen Realismus entscheidend. Geboren 1828 und gestorben 1910, war er zugleich Romancier, Moralphilosoph, Pädagoge und gesellschaftlicher Kritiker. Sein Werk verbindet epische Breite, psychologische Tiefenschärfe und eine kompromisslose Suche nach Wahrheit. Neben den großen Romanen verfasste er prägnante Erzählungen wie Der Tod des Iwan Iljitsch und theoretische Schriften zu Religion, Kunst und Gewaltfreiheit. Tolstois Einfluss überschritt die Grenzen der Literatur: Seine Ideen über Gewissen, Gewaltlosigkeit und soziale Gerechtigkeit inspirierten soziale Bewegungen und Denker auf mehreren Kontinenten.
Bildung und literarische Einflüsse
Tolstoi wuchs als Angehöriger des russischen Adels auf dem Landsitz Jasnaja Poljana in der Provinz Tula auf. Hausunterricht prägte seine frühen Jahre, gefolgt vom Studium an der Universität Kasan, wo er sich zunächst den orientalischen Sprachen, später der Rechtswissenschaft zuwandte. Er brach das Studium ab, setzte jedoch eine intensive Selbstbildung fort, darunter Lektüren in russischer und europäischer Literatur, Geschichte, Philosophie und Pädagogik. Früh zeigte sich sein Streben nach empirischer Genauigkeit und moralischer Reflexion. Sprachkenntnisse und ein wacher Blick für soziale Kontraste schärften seine Beobachtungsgabe, die späteren Realismus, ethische Fragestellungen und erzählerische Vielstimmigkeit überzeugend verband.
Intellektuell beeinflussten Tolstoi unter anderem Jean-Jacques Rousseau mit dessen Natur- und Erziehungslehre, Charles Dickens durch soziale Sensibilität und erzählerische Anschaulichkeit sowie Arthur Schopenhauer, dessen Pessimismus in den 1860er-Jahren auf Tolstois Denken wirkte. Ebenso bedeutsam waren die Evangelien, die er immer wieder neu deutete, und die russische realistische Tradition, etwa die prägnante Präzision Puschkins und die Gesellschaftskritik Gogols. Diese Einflüsse verband er zu einer eigenständigen Poetik: detailgenaue Darstellung konkreter Lebenswelten, psychologische Analyse, moralische Prüfung von Handlungen und Skepsis gegenüber ideologischen Systemen. Aus dieser Mischung erwuchs sein unverwechselbarer Ton zwischen epischer Weite und ethischer Dringlichkeit.
Literarische Laufbahn
Seine literarische Laufbahn begann Tolstoi in den 1850er-Jahren mit der autobiografisch gefärbten Trilogie Kindheit, Knabenalter und Jünglingsjahre. Den Durchbruch brachten die Sebastopoler Erzählungen, entstanden aus Diensterfahrungen im Kaukasus und im Krimkrieg. Diese Texte verbanden Augenzeugenblick, psychologische Beobachtung und Distanz zu heroischer Rhetorik, was ihnen früh Anerkennung einbrachte. Bereits hier ist Tolstois Misstrauen gegenüber abstrakten Theorien spürbar: Er privilegiert konkrete Situationen, innere Monologe und die moralische Zwickmühle des Einzelnen. Die Resonanz in der russischen Öffentlichkeit war lebhaft; Kritiker lobten die Wahrhaftigkeit der Darstellung und die Fähigkeit, Krieg und Alltag ohne Verklärung zu schildern.
Krieg und Frieden, in den späten 1860er-Jahren entstanden, ist ein Panorama der russischen Gesellschaft zur Zeit der napoleonischen Kriege. Tolstoi verknüpft Familiengeschichten, Feldzüge und philosophische Betrachtungen über Geschichte, Freiheit und Notwendigkeit. Die Erzählung wechselt Perspektiven souverän, vom Hofball bis zum Schlachtfeld, und entwirft zugleich eine Theorie der historischen Kausalität, die auf unzählige individuelle Handlungen zurückgeführt wird. Das Werk wurde rasch als literarisches Ereignis wahrgenommen und beeinflusste die Form des historischen Romans weltweit. Zeitgenössische Kritik würdigte die Genauigkeit der Details, die psychologische Glaubwürdigkeit und die kühne Verbindung von Erzählkunst und Geschichtsreflexion.
Anna Karenina, in den 1870er-Jahren veröffentlicht, stellt Tolstois Kunst des Gesellschaftsromans in den Mittelpunkt. Parallel geführte Erzählstränge verbinden intime Tragödie, bäuerliche Lebenswelten und Fragen der Moral mit präziser Milieuschilderung. Berühmt wurde der eröffnende Satz über das Glück und Unglück von Familien, der den Ton für eine Untersuchung von Konvention, Leidenschaft und Gewissen setzt. Das Werk wurde breit rezipiert, nicht nur als Liebes- und Eheroman, sondern als Analyse von Institutionen und Werten einer Epoche. Kritiker rühmten die Balance von empathischer Nähe und schonungsloser Klarheit sowie die sprachliche Ökonomie bei gleichzeitiger erzählerischer Fülle.
In den 1880er-Jahren wandte sich Tolstoi vermehrt kürzeren Formen und dramatischen Arbeiten zu. Der Tod des Iwan Iljitsch gehört zu den eindringlichsten Erzählungen über Sterblichkeit und Selbsttäuschung in der Neuzeit. Weitere pointierte Prosastücke wie Die Kreutzersonate und spätere Erzählungen erkunden die Verflechtung von Begehren, Schuld, Macht und Mitgefühl. Parallel entwickelte er pädagogische Initiativen und publizierte praktische Lehrmaterialien für den Grundschulunterricht, die seine Vorstellung freiheitlicher Erziehung spiegelten. Die Reaktionen schwankten zwischen Bewunderung für moralische Konsequenz und Kritik an moralischem Rigorismus, was die wachsende Spannung zwischen ästhetischem Anspruch und ethischem Imperativ sichtbar machte.
Die späte Phase vereinte künstlerischen Ehrgeiz und theoretische Reflexion. In Was ist Kunst? prüfte Tolstoi den gesellschaftlichen Auftrag der Kunst und forderte Verständlichkeit sowie moralische Wirkung. Das religiös-ethische Hauptwerk Das Himmelreich in euch argumentierte mit Nachdruck für Gewaltlosigkeit und radikale Gewissensfreiheit. Mit Auferstehung erreichte er erneut internationale Breitenwirkung, indem er Justiz, Kirche und sozialstaatliche Praxis scharf beleuchtete. Postum festigte Hadschi Murat seinen Rang als Meister präziser, spannungsvoller Kurzprosa. Insgesamt zeigte diese Periode eine Verdichtung des Stils, die philosophische These, erzählerische Ökonomie und scharfe Gesellschaftsanalyse zu einer unverwechselbaren Spätprosa verband.
Überzeugungen und Engagement
Tolstois geistige Krise in den späten 1870er-Jahren führte zu einer religiös-moralischen Neuorientierung. Aus der erneuten Beschäftigung mit den Evangelien leitete er eine Ethik der Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Bedürfnisbegrenzung und sozialen Verantwortung ab. Er trat für gewaltfreien Widerstand, Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen und eine einfache Lebensführung ein und engagierte sich praktisch, etwa bei Hilfsaktionen während der Hungersnot der frühen 1890er-Jahre. Seine pädagogischen Projekte zielten auf selbstbestimmtes Lernen und soziale Teilhabe. In Essays und offenen Briefen verband er Gesellschaftskritik mit Appellen an individuelle Umkehr. Diese Haltung prägte Stil, Themenwahl und öffentliche Wirkung seiner späten Schriften nachhaltig.
Die Konsequenz seiner Überzeugungen brachte ihn in Konflikt mit staatlichen und kirchlichen Autoritäten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er von der Russisch-Orthodoxen Kirche exkommuniziert, und seine Schriften standen unter Beobachtung. Gleichwohl verbreiteten sich seine Ideen international. Besonders einflussreich wurde sein Plädoyer für Gewaltfreiheit, das Denker und Aktivisten inspirierte, darunter Mohandas K. Gandhi, mit dem er korrespondierte. Tolstois Schriften gegen Todesstrafe, Zensur und soziale Ungleichheit fanden Resonanz in Bewegungen für Reform und Gewissensfreiheit. Seine Autorität gründete weniger auf Institutionen als auf moralischer Glaubwürdigkeit, die er durch persönliche Konsequenz und eine rigorose, öffentlich geführte Selbstprüfung gewann.
Letzte Jahre und Vermächtnis
In seinen letzten Jahren arbeitete Tolstoi weiter an Erzählungen, Tagebüchern und Essays, während gesundheitliche Belastungen und weltanschauliche Spannungen zunahmen. Er strebte nach größerer Übereinstimmung zwischen Lehre und Lebenspraxis, was zu inneren und häuslichen Konflikten führte. 1910 verließ er kurzfristig sein Zuhause und starb wenig später im Bahnhof Astapowo, nachdem sein Gesundheitszustand sich plötzlich verschlechtert hatte. Die Nachricht löste weltweit Anteilnahme aus; Zeitungen berichteten ausführlich, und Leserinnen und Leser reagierten mit Bewunderung und Debatten über sein Erbe. Postum erschienen weitere Texte, die sein Bild als kompromissloser Schriftsteller und Moralist abrundeten.
Tolstois Vermächtnis ist vielschichtig. Literarisch gilt er als Maßstab für psychologisch präzises Erzählen, epische Konstruktion und moralische Ernsthaftigkeit. Seine Romane und Erzählungen bleiben kanonisch und werden kontinuierlich neu übersetzt, interpretiert und adaptiert. Philosophisch prägte er Diskurse über Gewissen, Gewaltlosigkeit, religiöse Freiheit und soziale Verantwortung; seine Ideen beeinflussten Bewegungen des gewaltfreien Widerstands und der Reformpädagogik. Zugleich provoziert er bis heute Diskussionen über Kunst, Moral und die Grenzen didaktischer Literatur. In der Gegenwart behauptet Tolstoi eine zentrale Stellung in Literatur und Kultur, als Autor, dessen Werk historische Erfahrung, individuelle Freiheit und ethische Prüfung exemplarisch verbindet.
Krieg und Frieden (Klassiker der Weltliteratur)
Personenregister (Übersicht der wichtigsten Familien und Personen):
Erster Teil
I
»Nun, sehen Sie wohl, Fürst: Genua und Lucca[4] sind weiter nichts mehr als Apanagen[1] der Familie Bonaparte. Nein, das erkläre ich Ihnen auf das bestimmteste: wenn Sie mir nicht sagen, daß der Krieg eine Notwendigkeit ist, wenn Sie sich noch länger erlauben, all die Schändlichkeiten und Gewalttaten dieses Antichrists in Schutz zu nehmen (wirklich, ich glaube, daß er der Antichrist ist), so kenne ich Sie nicht mehr, so sind Sie nicht mehr mein Freund, nicht mehr, wie Sie sich ausdrücken, mein treuer Sklave. – Jetzt aber guten Tag, guten Tag! Ich sehe, daß ich Sie einschüchtere; setzen Sie sich und erzählen Sie!«
So sprach im Juni 1805 Fräulein Anna Pawlowna Scherer, die hochangesehene Hofdame und Vertraute der Kaiserinmutter Maria Feodorowna, indem sie den durch Rang und Einfluß hervorragenden Fürsten Wasili begrüßte, der sich als erster zu ihrer Soiree einstellte. Anna Pawlowna hustete seit einigen Tagen; sie hatte, wie sie sagte, die Grippe[3] (»Grippe« war damals ein neues Wort, dessen sich nur einige wenige feine Leute bedienten). Die Einladungsschreiben, die sie am Vormittag durch einen Lakaien in roter Livree versandt hatte, hatten alle ohne Abweichungen folgendermaßen gelautet:
»Wenn Sie, Graf (oder Fürst), nichts Besseres vorhaben und die Aussicht, den Abend bei einer armen Patientin zu verbringen, Sie nicht zu sehr erschreckt, so werde ich mich sehr freuen, Sie heute zwischen sieben und neun Uhr bei mir zu sehen. Anna Scherer.«
»Mein Gott, was für eine hitzige Attacke!« antwortete der soeben eingetretene Fürst, ohne über einen derartigen Empfang im geringsten in Aufregung zu geraten, mit einem heiteren Ausdruck auf seinem flachen Gesicht.
Er trug die gestickte Hofuniform, Schnallenschuhe, Strümpfe und mehrere Orden und sprach jenes auserlesene Französisch, welches unsere Großväter nicht nur redeten, sondern in dem sie auch dachten, und zwar mit dem ruhigen, gönnerhaften Ton, wie er einem hochgestellten, im Verkehr mit der besten Gesellschaft und in der Hofluft altgewordenen Mann eigen ist. Er trat zu Anna Pawlowna heran, küßte ihr die Hand, wobei er ihr den Anblick seiner parfümierten, schimmernden Glatze darbot, und setzte sich dann in aller Seelenruhe auf einen Lehnsessel.
»Vor allen Dingen, liebe Freundin, sagen Sie mir, wie es mit Ihrer Gesundheit steht, und beruhigen Sie Ihren Freund«, sagte er, ohne seine Stimme zu verändern, und in einem Ton, bei dem man durch alle Höflichkeit und Anteilnahme doch seine innere Gleichgültigkeit und sogar ein wenig Spott hindurchhörte.
»Wie kann ich körperlich gesund sein, wenn ich seelisch leide? Wer, der überhaupt Gefühl in der Brust hat, kann denn in unserer Zeit seine seelische Ruhe bewahren?« sagte Anna Pawlowna. »Ich hoffe, Sie bleiben den ganzen Abend bei mir?«
»Und die Fete beim englischen Gesandten? Heute ist Mittwoch; ich muß mich dort zeigen«, erwiderte der Fürst. »Meine Tochter wird herkommen und mich dorthin begleiten.«
»Ich glaubte, die heutige Fete sei abgesagt worden. Ich muß gestehen, alle diese Feten und Feuerwerke werden einem allmählich unerträglich.«
»Wenn der Gesandte geahnt hätte, daß dies Ihr Wunsch sei, so hätte er gewiß die Fete absagen lassen«, antwortete der Fürst; er redete eben gewohnheitsmäßig, wie ein aufgezogenes Uhrwerk, etwas hin, wovon er selbst nicht erwartete, daß es jemand glauben werde.
»Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Welcher Beschluß ist denn nun infolge von Nowosilzews Depesche[2] gefaßt worden? Sie wissen ja doch alles.«
»Wie soll ich Ihnen darauf antworten?« erwiderte der Fürst in kühlem, gelangweiltem Ton. »Sie wollen wissen, wie man die Sachlage auffaßt? Man ist der Ansicht, daß Bonaparte seine Schiffe hinter sich verbrannt hat, und es hat den Anschein, daß wir uns anschicken, mit den unsrigen das gleiche zu tun.«
Fürst Wasili sprach immer in trägem, lässigem Ton, etwa wie ein Schauspieler eine schon oft von ihm gespielte Rolle spricht. Dagegen sprühte Anna Pawlowna Scherer trotz ihrer vierzig Jahre von Lebhaftigkeit und Leidenschaftlichkeit.
Die Rolle der Enthusiastin war ein wesentliches Stück ihrer gesellschaftlichen Stellung geworden, und manchmal gab sie sich, auch wenn ihr eigentlich nicht danach zumute war, dennoch als Enthusiastin, nur um die Erwartung der Leute, die sie kannten, nicht zu täuschen. Das leise Lächeln, das beständig auf Anna Pawlownas Gesicht spielte, obwohl es eigentlich zu ihren verlebten Zügen nicht paßte, dieses Lächeln besagte, ähnlich wie bei verzogenen Kindern, daß sie sich ihrer liebenswürdigen Schwäche dauernd bewußt sei, aber nicht beabsichtige, nicht imstande sei und nicht für nötig halte, sich von ihr freizumachen.
Als das Gespräch über die politische Lage einige Zeit gedauert hatte, wurde Anna Pawlowna hitzig.
»Ach, reden Sie mir nicht von Österreich! Mag sein, daß ich nichts davon verstehe, aber Österreich hat den Krieg nie gewollt und will ihn auch jetzt nicht. Österreich verrät uns. Rußland muß allein der Retter Europas werden. Unser Wohltäter auf dem Thron kennt seinen hohen Beruf und wird diesem Beruf treu bleiben. Das ist das einzige, worauf ich mich verlasse. Unserm guten, herrlichen Kaiser ist die größte Aufgabe in der Welt zugefallen, und er ist so reich an trefflichen Eigenschaften und Tugenden, daß Gott ihn nicht verlassen wird. Unser Kaiser wird seinen hohen Beruf erfüllen, die Hydra der Revolution zu erwürgen, die jetzt in der Gestalt dieses Mörders und Bösewichts noch entsetzlicher erscheint als vorher. Wir allein müssen das Blut des Gerechten sühnen. Auf wen könnten wir denn auch rechnen, frage ich Sie? England mit seinem Krämergeist hat kein Verständnis für die ganze Seelengröße Kaiser Alexanders, und kann ein solches Verständnis nicht haben. Es hat sich geweigert, Malta zu räumen. Es will erst noch sehen und findet in allem, was wir tun, einen Hintergedanken. Was haben die Engländer auf Nowosilzews Anfrage geantwortet? Nichts. Sie haben kein Verständnis gehabt, können kein Verständnis haben für die Selbstverleugnung unseres Kaisers, der nichts für sich selbst will und in allem nur auf das Wohl der ganzen Welt bedacht ist. Und was haben sie versprochen? Nichts. Und was sie versprochen haben, selbst das werden sie nicht zur Ausführung bringen! Preußen hat bereits erklärt, Bonaparte sei unüberwindlich und ganz Europa vermöge nichts gegen ihn. Und ich glaube diesen beiden, Hardenberg und Haugwitz, kein Wort, das sie sagen. Diese vielgerühmte Neutralität Preußens ist weiter nichts als eine Falle. Ich glaube nur an Gott und an die hohe Bestimmung unseres geliebten Kaisers. Er wird Europa retten!« Sie hielt plötzlich inne mit einem spöttischen Lächeln über die Hitze, in die sie hineingeraten war.
»Ich glaube«, erwiderte der Fürst gleichfalls lächelnd, »hätte man Sie an Stelle unseres lieben Wintzingerode hingeschickt, Sie hätten die Zustimmung des Königs von Preußen im Sturm errungen. Sie besitzen eine erstaunliche Beredsamkeit. Darf ich Sie um eine Tasse Tee bitten?«
»Sogleich. Apropos«, fügte sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, hinzu, »es werden heute zwei sehr interessante Persönlichkeiten bei mir sein: der Vicomte Mortemart (er ist durch die Rohans mit den Montmorencys verwandt; die Mortemarts sind eine der besten Familien Frankreichs; das ist einer der wirklich achtungswerten Emigranten, einer von der echten Art) und dann der Abbé Morio. Kennen Sie diesen tiefen Geist? Er ist vom Kaiser empfangen worden; Sie wissen wohl?«
»Ah! das wird mich außerordentlich freuen«, antwortete der Fürst. »Sagen Sie«, fügte er, als ob ihm soeben etwas einfiele, in besonders lässigem Ton hinzu, obgleich das, wonach er fragen wollte, der Hauptzweck seines Besuches war, »ist es richtig, daß die Kaiserinmutter die Ernennung des Baron Funke zum ersten Sekretär in Wien wünscht? Dieser Baron ist doch allem Anschein nach ein wertloses Subjekt.« Fürst Wasili hegte den Wunsch, daß sein eigener Sohn diese Stelle erhalten möge, welche andere Leute auf dem Weg über die Kaiserinmutter Maria Feodorowna dem Baron zu verschaffen suchten.
Anna Pawlowna schloß die Augen beinahe vollständig, um zu verstehen zu geben, daß weder sie noch sonst jemand sich ein Urteil über das erlauben dürfe, was der Kaiserinmutter beliebe oder genehm sei.
»Baron Funke ist der Kaiserinmutter durch ihre Schwester empfohlen worden«, begnügte sie sich in melancholischem, trockenem Ton zu erwidern. In dem Augenblick, wo Anna Pawlowna von der Kaiserinmutter sprach, nahm ihr Gesicht auf einmal den Ausdruck einer tiefen, innigen Ergebenheit und Verehrung, gepaart mit einer Art von Traurigkeit, an, ein Ausdruck, der bei ihr jedesmal zum Vorschein kam, wenn sie im Gespräch ihrer hohen Gönnerin Erwähnung tat. Sie äußerte dann noch, Ihre Majestät habe geruht, dem Baron Funke großes Wohlwollen zu bezeigen, und wieder zog dabei ein Schatten wie von Traurigkeit über ihren Blick.
Der Fürst machte ein Gesicht, als ob ihm die Sache gleichgültig sei, und schwieg. Anna Pawlowna hatte mit der ihr eigenen höfischen und weiblichen Gewandtheit und schnellen Erkenntnis dessen, was taktgemäß war, dem Fürsten etwas dafür auswischen wollen, daß er sich erdreistet hatte, über eine von der Kaiserinmutter protegierte Persönlichkeit so abfällig zu urteilen; nun aber wollte sie ihn doch auch wieder trösten.
»Um auf Ihre Familie zu kommen«, sagte sie, »wissen Sie wohl, daß Ihre Tochter, seit sie Gesellschaften besucht, das Entzücken der gesamten höheren Kreise bildet? Man findet sie schön wie den Tag.«
Der Fürst verneigte sich zum Zeichen der Verehrung und Dankbarkeit.
»Ich denke oft«, fuhr Anna Pawlowna nach einem kurzen Stillschweigen fort (sie rückte dabei dem Fürsten näher und lächelte ihm freundlich zu, als wollte sie damit andeuten, daß die Unterhaltung über Politik und Angelegenheiten der Gesellschaft nun beendigt sei und jetzt ein vertraulicheres Gespräch beginne), »ich denke oft, wie ungerecht manchmal das Glück im Leben verteilt ist. Warum hat Ihnen nur das Schicksal zwei so prächtige Kinder gegeben (Anatol, Ihren jüngeren Sohn, schließe ich dabei aus; ich mag ihn nicht«, schaltete sie in einem Ton ein, als dulde sie keinen Widerspruch, und zog dabei die Augenbrauen in die Höhe), »so entzückende Kinder? Wahrhaftig, Sie wissen deren Wert weniger zu schätzen als alle anderen Leute, und daher verdienen Sie nicht, solche Kinder zu haben.«
Ihr Gesicht war wieder von dem ihr eigenen enthusiastischen Lächeln verklärt.
»Was ist da zu machen? Lavater würde sagen, daß mir der Kopfhöcker der elterlichen Liebe fehlt«, erwiderte der Fürst.
»Scherzen Sie nicht darüber. Ich wollte ernsthaft mit Ihnen reden. Wissen Sie, ich bin mit Ihrem jüngeren Sohn nicht zufrieden. Unter uns gesagt« (hier nahm ihr Gesicht wieder einen trüben Ausdruck an), »es wurde bei Ihrer Majestät von ihm gesprochen, und Sie wurden bedauert.«
Der Fürst antwortete nicht; sie aber blickte ihn schweigend und bedeutsam an und wartete auf eine Antwort. Der Fürst runzelte die Stirn.
»Was soll ich denn dabei machen?« sagte er endlich. »Sie wissen, ich habe für die Erziehung meiner Söhne alles getan, was ein Vater nur tun kann, und doch haben Sie sich beide übel entwickelt. Ippolit ist wenigstens nur ein ruhiger Narr, aber Anatol ein unruhiger. Das ist der einzige Unterschied«, sagte er und lächelte dabei gekünstelter und lebhafter als gewöhnlich, wobei mit besonderer Schärfe in den um seinen Mund liegenden Falten ein überraschend roher, unangenehmer Zug hervortrat.
»Warum werden solchen Männern, wie Sie, Kinder geboren? Wenn Sie nicht Vater wären, hätte ich gar nichts an Ihnen zu tadeln«, sagte Anna Pawlowna, nachdenklich aufblickend.
»Ich bin Ihr treuer Sklave, und Ihnen allein kann ich es gestehen: meine Kinder sind die Fesseln meines Daseins. Das ist eben mein Kreuz. So fasse ich es auf. Was soll ich da tun?« Er schwieg und drückte durch eine Gebärde seine Ergebung in dieses grausame Schicksal aus. Anna Pawlowna überlegte.
»Haben Sie nie daran gedacht, Ihrem Anatol, diesem verlorenen Sohn, eine Frau zu geben?« sagte sie dann. »Es heißt immer, alte Jungfern hätten eine Manie für das Ehestiften. Ich verspüre diese Schwäche noch nicht an mir; aber ich habe da ein junges Mädchen, das sich bei ihrem Vater sehr unglücklich fühlt, eine Verwandte von uns, eine Tochter des Fürsten Bolkonski.«
Fürst Wasili antwortete nicht, gab jedoch mit jener schnellen Auffassungsgabe, wie sie Leuten von Welt eigen ist, durch eine Kopfbewegung zu verstehen, daß er diese Mitteilungen zum Gegenstand seines Nachdenkens mache.
»Wissen Sie wohl, daß mich dieser Anatol jährlich vierzigtausend Rubel kostet?« sagte er dann, anscheinend nicht imstande, von seinem trüben Gedankengang loszukommen. Dann schwieg er wieder eine Weile.
»Was soll daraus werden, wenn es noch fünf Jahre so weitergeht? Das ist der Segen davon, wenn man Vater ist. Ist sie reich, Ihre junge Prinzessin?«
»Der Vater ist sehr reich und geizig. Er lebt auf dem Land. Wissen Sie, es ist der bekannte Fürst Bolkonski, der noch unter dem hochseligen Kaiser den Abschied erhielt; er hatte den Spitznamen ›der König von Preußen‹. Er ist ein sehr kluger Mensch, hat aber seine Sonderbarkeiten und ist schwer zu behandeln. Das arme Kind ist kreuzunglücklich. Sie hat noch einen Bruder, der bei Kutusow Adjutant ist; er hat vor einiger Zeit Lisa Meynen geheiratet. Er wird heute bei mir sein.«
»Hören Sie, liebe Annette«, sagte der Fürst, indem er plötzlich die Hand der Hofdame ergriff und in etwas wunderlicher Weise nach unten zog. »Arrangieren Sie mir diese Sache, und ich werde für alle Zeit Ihr treuester Sklave sein (›Sklafe‹, wie mein Dorfschulze immer in seinen Berichten an mich schreibt, mit einem f). Sie ist von guter Familie und reich. Das ist alles, was ich brauche.«
Und mit jenen ungezwungenen, familiären, graziösen Bewegungen, die ihn auszeichneten, ergriff er die Hand des Fräuleins, küßte sie und schwenkte dann diese Hand hin und her, während er sich in den Sessel zurücksinken ließ und zur Seite blickte.
»Warten Sie einmal«, sagte Anna Pawlowna überlegend. »Ja, ich will gleich heute mit Lisa, der Frau des jungen Bolkonski, reden. Vielleicht läßt sich die Sache arrangieren. Ich werde bei Ihrer Familie anfangen, das übliche Gewerbe der alten Jungfern zu erlernen.«
II
Anna Pawlownas Salon begann sich allmählich zu füllen. Die höchste Noblesse Petersburgs fand sich ein, Menschen, die an Lebensalter und Charakter höchst verschieden waren, aber doch etwas Gleichartiges hatten durch die gesellschaftliche Sphäre, in der sie alle lebten. Da kam die Tochter des Fürsten Wasili, die schöne Helene, die ihren Vater abholen wollte, um mit ihm zusammen zu der Fete des Gesandten zu fahren; sie war in Balltoilette und trug als Abiturientin des Fräuleinstiftes eine Brosche mit dem Namenszug der Kaiserin. Dann kam die als »die reizendste Frau Petersburgs« bekannte, junge, kleine Fürstin Bolkonskaja, die sich im letzten Winter verheiratet hatte und, weil sie sich in anderen Umständen befand, größere Festlichkeiten nicht mehr besuchte, während sie an kleinen Abendgesellschaften noch teilnahm. Es erschien Fürst Ippolit, der Sohn des Fürsten Wasili, zusammen mit dem Vicomte Mortemart, den er vorstellte; auch der Abbé Morio fand sich ein, und viele andere.
»Haben Sie meine liebe Tante noch nicht gesehen, oder sind Sie vielleicht noch gar nicht mit ihr bekannt?« fragte Anna Pawlowna die eintreffenden Gäste und führte sie sehr feierlich zu einer kleinen alten Dame mit einem Kopfputz von hochragenden Bandschleifen, welche, sobald die Gäste begonnen hatten sich einzufinden, aus dem anstoßenden Zimmer zum Vorschein gekommen war. Anna Pawlowna nannte die Namen der einzelnen Gäste, indem sie langsam ihre Augen von dem betreffenden Gast zu der Tante hinüberwandern ließ, und trat darauf ein wenig zurück. Alle Gäste machten die Begrüßungszeremonie mit dieser lieben Tante durch, die niemandem bekannt war, niemanden interessierte und mit niemandem irgendwelche Beziehungen hatte. Anna Pawlowna beaufsichtigte mit wehmütig feierlicher Teilnahme diese Begrüßungen, wobei sie ein beifälliges Stillschweigen beobachtete. Die Tante sprach mit jedem Gast in denselben Ausdrücken von seinem Befinden, von ihrem eigenen Befinden und von dem Befinden Ihrer Majestät, welches heute, Gott sei Dank, besser sei. Alle Gäste, die die Tante begrüßt hatten, traten dann mit einem Gefühl der Erleichterung, wie nach Erfüllung einer schweren Pflicht, höflichkeitshalber jedoch, ohne irgendwelche Eile merken zu lassen, von der alten Dame wieder fort, um nunmehr den ganzen Abend über auch nicht ein einziges Mal mehr zu ihr heranzukommen.
Die junge Fürstin Bolkonskaja hatte sich in einem samtenen, goldgestickten Beutelchen eine Handarbeit mitgebracht. Ihre hübsche Oberlippe mit dem leisen Schatten eines schwärzlichen Schnurrbärtchens war etwas zu kurz für die Zähne; aber um so reizender sah es aus, wenn sie sich öffnete, und noch mehr, wenn sie sich manchmal ausstreckte und zur Unterlippe hinabsenkte. Wie das immer bei hervorragend reizenden Frauen der Fall ist, erschien ihr Mangel, die Kürze der Lippe und der halbgeöffnete Mund, als eine besondere, nur ihr eigene Schönheit. Es war für alle ein herzliches Vergnügen, diese hübsche, von Gesundheit und Lebenslust erfüllte Frau anzusehen, die bald Mutter werden sollte und ihren Zustand so leicht ertrug. Die alten Herren und die blasierten, finsterblickenden jungen Leute hatten die Empfindung, als würden sie selbst ihr ähnlich, wenn sie ein Weilchen in ihrer Nähe geweilt und sich mit ihr unterhalten hatten. Wer mit ihr sprach und bei jedem Wort, das er sagte, ihr strahlendes Lächeln und die glänzend weißen Zähne sah, die fortwährend sichtbar wurden, der konnte glauben, daß er heute ganz besonders liebenswürdig sei. Und das glaubte auch ein jeder.
Die kleine Fürstin ging in schaukelndem Gang, mit kleinen, schnellen Schritten, den Arbeitsbeutel in der Hand, um den Tisch herum, setzte sich auf das Sofa, nicht weit von dem silbernen Samowar[7], und legte vergnügt ihr Kleid in Ordnung, als ob alles, was sie nur tun mochte, eine Erheiterung für sie selbst und für ihre gesamte Umgebung sei.
»Ich habe mir eine Handarbeit mitgebracht«, sagte sie, sich an alle zugleich wendend, während sie ihren Ridikül auseinanderzog.
»Aber hören Sie mal, Annette«, wandte sie sich an die Wirtin, »solche häßlichen Streiche dürfen Sie mir nicht spielen. Sie haben mir geschrieben, es wäre bei Ihnen nur eine ganz kleine Abendgesellschaft. Und nun sehen Sie, in was für einem Aufzug ich hergekommen bin.«
Sie breitete die Arme auseinander, um ihr elegantes graues, mit Spitzen besetztes Kleid zu zeigen, um welches sich ein wenig unterhalb der Brust an Stelle eines Gürtels ein breites Band schlang.
»Seien Sie unbesorgt, Lisa, Sie sind doch immer die Netteste von allen«, antwortete Anna Pawlowna.
»Sie wissen, daß mein Mann mich verlassen wird«, fuhr sie, zu einem General gewendet, in demselben Ton fort. »Er will sich totschießen lassen. Sagen Sie mir, wozu nur dieser abscheuliche Krieg?« sagte sie zu dem Fürsten Wasili und wandte sich dann, ohne dessen Antwort abzuwarten, zu seiner Tochter, der schönen Helene.
»Was ist diese kleine Fürstin für ein allerliebstes Wesen!« sagte Fürst Wasili leise zu Anna Pawlowna.
Bald nach der kleinen Fürstin trat ein plumpgebauter, dicker junger Mann ein, mit kurzgeschorenem Kopf, einer Brille, hellen Beinkleidern nach der damaligen Mode, hohem Jabot und braunem Frack. Er war ein unehelicher Sohn des Grafen Besuchow, der einst unter der Kaiserin Katharina einer der höchsten Würdenträger gewesen war und jetzt in Moskau im Sterben lag. Dieser dicke junge Mann war noch nie im Staatsdienst tätig gewesen, war soeben erst aus dem Ausland, wo er erzogen worden war, zurückgekehrt und befand sich heute zum erstenmal in Gesellschaft. Anna Pawlowna begrüßte ihn mit derjenigen Art von Verbeugung, mit welcher die auf der hierarchischen Stufenleiter am niedrigsten stehenden Besucher ihres Salons sich zu begnügen hatten. Aber trotz dieses niedrigsten Grades von Begrüßung prägte sich beim Anblick des eintretenden Pierre auf Anna Pawlownas Gesicht eine Unruhe und Furcht aus, wie man sie etwa beim Anblick eines übergroßen Gegenstandes empfindet, der nicht an seinem richtigen Platz ist. Obwohl aber Pierre tatsächlich etwas größer war als die andern im Zimmer befindlichen Männer, so konnte doch diese Furcht nur durch den klugen und zugleich schüchternen, beobachtenden und ungekünstelten Blick seiner Augen veranlaßt sein, durch den er sich von allen anderen in diesem Salon Anwesenden unterschied.
»Sehr liebenswürdig von Ihnen, Monsieur Pierre, daß Sie eine arme Patientin besuchen«, sagte Anna Pawlowna zu ihm, indem sie mit der Tante, zu der sie ihn hinführte, einen ängstlichen Blick wechselte. Pierre murmelte etwas Unverständliches und fuhr fort, etwas mit den Augen zu suchen. Mit frohem, vergnügtem Lächeln verbeugte er sich vor der kleinen Fürstin wie vor einer guten Bekannten und trat dann zu der Tante hin. Anna Pawlownas Furcht erwies sich als nicht unbegründet, da Pierre, ohne die Äußerungen der Tante über das Befinden Ihrer Majestät zu Ende zu hören, von ihr wieder zurücktrat. Erschrocken hielt ihn Anna Pawlowna mit den Worten auf: »Sie kennen den Abbé Morio wohl noch nicht? Er ist ein sehr interessanter Mann …«
»Ja, ich habe von seinem Plan gehört, einen ewigen Frieden herzustellen, und das ist ja auch sehr interessant, aber allerdings schwerlich ausführbar.«
»Meinen Sie?« erwiderte Anna Pawlowna, um nur überhaupt etwas zu sagen und sich dann wieder ihren Aufgaben als Wirtin zuzuwenden; aber Pierre beging nun die andere Unhöflichkeit. Vorher war er von einer Dame weggegangen, ohne das, was sie zu ihm sagte, bis zu Ende anzuhören, und jetzt hielt er eine Dame, die von ihm fortgehen wollte, durch sein Gespräch zurück. Den Kopf herabbiegend, die dicken Beine breit auseinanderstellend, begann er der Hofdame zu beweisen, warum er den Plan des Abbé für eine Schimäre halte.
»Wir wollen das nachher weiter besprechen«, sagte Anna Pawlowna lächelnd.
Damit verließ sie den jungen Mann, der so gar keine Lebensart hatte, und nahm ihre Tätigkeit als Wirtin wieder auf. Sie hörte aufmerksam zu und ließ ihre Augen überall umherschweifen, bereit, an demjenigen Punkt Hilfe zu bringen, wo etwa das Gespräch ermattete. Wie der Herr einer Spinnerei, nachdem er den Arbeitern ihre Pläne angewiesen hat, in seiner ganzen Fabrik umhergeht, und, sobald er merkt, daß eine Spindel stillsteht oder einen ungewöhnlichen, kreischenden, überlauten Ton von sich gibt, eilig hinzutritt und sie anhält oder in richtigen Gang bringt: so wanderte auch Anna Pawlowna in ihrem Salon hin und her, trat hinzu, wo eine Gruppe schwieg oder zu laut redete, und stellte durch ein Wort, das sie hinzugab, oder durch eine Veränderung der Plätze wieder einen gleichmäßigen, anständigen Gang der Gespräche her. Aber mitten in dieser geschäftigen Tätigkeit konnte man ihr immer eine besondere Befürchtung in betreff Pierres anmerken. Besorgt beobachtete sie ihn, als er herantrat, um zu hören, was in der um Mortemart herumstehenden Gruppe geredet wurde, und dann zu einer anderen Gruppe hinging, wo der Abbé das Wort führte. Für Pierre, der im Ausland erzogen worden war, war diese Soiree bei Anna Pawlowna die erste, die er in Rußland mitmachte. Er wußte, daß hier die Vertreter der Intelligenz von ganz Petersburg versammelt waren, und seine Augen liefen, wie die Augen eines Kindes im Spielzeugladen, bald hierhin, bald dorthin. Immer fürchtete er, es möchte ihm irgendein kluges Gespräch entgehen, das er mitanhören könne. Wenn er die selbstbewußten, vornehmen Gesichter der hier Versammelten betrachtete, erwartete er immer etwas besonders Kluges zu hören. Endlich trat er zu Morio. Das Gespräch interessierte ihn, er blieb stehen und wartete auf eine Gelegenheit, seine eigenen Gedanken auszusprechen, wie das junge Leute so gern tun.
III
Die Unterhaltung auf Anna Pawlownas Soiree war in vollem Gang. Die Spindeln schnurrten auf allen Seiten gleichmäßig und unausgesetzt. Abgesehen von der Tante, neben welcher nur eine bejahrte Dame mit vergrämtem, magerem Gesicht saß, die sich in dieser glänzenden Gesellschaft etwas sonderbar ausnahm, hatte sich die ganze Gesellschaft in drei Gruppen geteilt. In der einen, welche vorwiegend aus Herren bestand, bildete der Abbé den Mittelpunkt; in der zweiten, wo namentlich die Jugend vertreten war, dominierten die schöne Prinzessin Helene, die Tochter des Fürsten Wasili, und die hübsche, rotwangige, aber für ihr jugendliches Alter etwas zu volle, kleine Fürstin Bolkonskaja. In der dritten Gruppe waren Mortemart und Anna Pawlowna das belebende Element.
Der Vicomte war ein nett aussehender junger Mann mit weichen Gesichtszügen und angenehmen Umgangsformen, der sich offenbar für etwas Bedeutendes hielt, aber infolge seiner Wohlerzogenheit der Gesellschaft, in der er sich befand, bescheiden anheimstellte, seine Persönlichkeit zu genießen, soweit es ihr beliebe. Anna Pawlowna betrachtete ihn augenscheinlich als eine Art von Extragericht, das sie ihren Gästen anbot. Wie ein geschickter Maître d’hôtel dasselbe Stück Rindfleisch, das niemand essen möchte, der es in der schmutzigen Küche sähe, als etwas ganz außergewöhnlich Schönes präsentiert, so servierte bei der heutigen Abendgesellschaft Anna Pawlowna ihren Gästen zuerst den Vicomte und dann den Abbé als etwas ganz besonders Feines. In der Gruppe um Mortemart drehte sich das Gespräch sogleich um die Ermordung des Herzogs von Enghien. Der Vicomte bemerkte, der Herzog von Enghien[5] habe seinen Tod seiner eigenen Großmut zu verdanken und der Ingrimm Bonapartes gegen ihn habe seine besonderen Gründe gehabt.
»Ach, bitte, erzählen Sie uns dieses, Vicomte!« sagte Anna Pawlowna erfreut; sie hatte dabei das Gefühl, daß der Ausdruck: »Erzählen Sie uns dieses, Vicomte!« wie eine Reminiszenz an Ludwig XV. klang.
Der Vicomte verbeugte sich zum Zeichen des Gehorsams und lächelte höflich. Anna Pawlowna wirkte darauf hin, daß sich ein Kreis um den Vicomte bildete, und forderte alle auf, seine Erzählung anzuhören.
»Der Vicomte ist mit dem Herzog persönlich bekannt gewesen«, flüsterte Anna Pawlowna dem einen zu. »Der Vicomte besitzt ein bewundernswürdiges Talent zum Erzählen«, sagte sie zu einem andern. »Wie man doch sofort einen Mann aus der guten Gesellschaft erkennt!« äußerte sie zu einem Dritten, und so wurde der Vicomte in der besten und für ihn vorteilhaftesten Beleuchtung der Gesellschaft präsentiert wie ein mit allerlei Gemüse garniertes Roastbeef auf einer heißen Schüssel.
Der Vicomte wollte nun seine Erzählung beginnen und lächelte fein.
»Kommen Sie doch hierher zu uns, liebe Helene«, sagte Anna Pawlowna zu der schönen Prinzessin, welche etwas entfernt saß und den Mittelpunkt einer anderen Gruppe bildete.
Die Prinzessin Helene lächelte; sie erhob sich mit ebendemselben unveränderlichen Lächeln des vollkommen schönen Weibes, mit welchem sie in den Salon eingetreten war. Mit ihrem weißen Ballkleid, das mit Efeu und Moos garniert war, leise raschelnd und von dem weißen Schimmer ihrer Schultern und dem Glanz ihres Haares und ihrer Brillanten umleuchtet, ging sie zwischen den auseinandertretenden Herren hindurch. Sie blickte dabei keinen einzelnen an, lächelte aber allen zu und schien in liebenswürdiger Weise einem jeden das Recht zuzuerkennen, die Schönheit ihrer Gestalt, der vollen Schultern, des nach damaliger Mode sehr tief entblößten Busens und Rückens zu bewundern; es war, als ob sie in ihrer Person den vollen Glanz eines Balles in diesen Salon hineingetragen hätte. So schritt sie geradewegs zu Anna Pawlowna hin. Helene war so schön, daß an ihr auch nicht die leiseste Spur von Koketterie wahrzunehmen war; ja im Gegenteil, sie schien sich vielmehr gewissermaßen ihrer unbestreitbaren und allzu stark und siegreich wirkenden Schönheit zu schämen. Es war, als ob sie den Eindruck ihrer Schönheit abzuschwächen wünschte, es aber nicht vermöchte.
»Welch ein schönes Weib!« sagte jeder, der sie sah. Gleichsam überrascht von etwas Ungewöhnlichem, zuckte der Vicomte zusammen und schlug die Augen nieder, als sie sich ihm gegenüber niederließ und auch ihn mit ebendemselben unveränderlichen Lächeln anstrahlte.
»Ich fürchte wirklich, daß einer solchen Zuhörerschaft gegenüber mich meine Fähigkeit im Stich läßt«, sagte er und neigte lächelnd den Kopf.
Die Prinzessin legte ihren entblößten vollen Arm auf ein Tischchen und fand es nicht nötig, etwas zu erwidern. Sie wartete lächelnd. Während der ganzen Erzählung saß sie aufrecht da und blickte ab und zu bald auf ihren vollen, runden Arm, der von dem Druck auf den Tisch seine Form veränderte, bald auf den noch schöneren Busen, an dem sie den Brillantschmuck zurechtschob; einige Male ordnete sie die Falten ihres Kleides, und sooft die Erzählung eindrucksvoll wurde, schaute sie zu Anna Pawlowna hinüber und nahm sofort denselben Ausdruck an, den das Gesicht des Hoffräuleins aufwies, um gleich darauf wieder zu ihrem ruhigen, strahlenden Lächeln überzugehen. Nach Helene kam auch die kleine Fürstin vom Teetisch herüber.
»Warten Sie noch einen Augenblick, ich möchte meine Handarbeit vornehmen«, sagte sie. »Nun? Wo haben Sie denn Ihre Gedanken?« wandte sie sich an den Fürsten Ippolit. »Bringen Sie mir meinen Ridikül.«
So führte die Fürstin, lächelnd und zu allen redend, auf einmal einen Aufenthalt herbei und ordnete, als sie nun zum Sitzen gekommen war, vergnügt ihren Anzug.
»Jetzt habe ich alles nach Wunsch«, sagte sie, bat, mit der Erzählung zu beginnen, und griff nach ihrer Arbeit. Fürst Ippolit hatte ihr ihren Ridikül geholt, war hinter sie getreten, hatte sich einen Sessel dicht neben sie gerückt und sich zu ihr gesetzt.
Der »charmante« Ippolit überraschte einen jeden durch die auffällige Ähnlichkeit mit seiner schönen Schwester und noch mehr dadurch, daß er trotz dieser Ähnlichkeit in hohem Grad häßlich war. Die Gesichtszüge waren bei ihm die gleichen wie bei seiner Schwester; aber bei dieser glänzte das ganze Gesicht von einem lebensfrohen, glücklichen, jugendlichen, unveränderlichen Lächeln, und die außerordentliche, wahrhaft antike Schönheit des Körpers steigerte diese Wirkung noch; bei dem Bruder dagegen war dasselbe Gesicht von einem trüben Stumpfsinn wie von einem Nebel umschleiert und zeigte unveränderlich einen Ausdruck selbstgefälliger Verdrossenheit, dazu kam ein dürftiger, schwächlicher Körper. Augen, Nase und Mund, alles war gleichsam zu einer einzigen verschwommenen, mürrischen Grimasse zusammengedrückt, und seine Hände und Füße nahmen stets eine absonderliche Haltung ein.
»Es wird doch keine Gespenstergeschichte sein?« sagte er, während er sich neben die Fürstin setzte und eilig seine Lorgnette vor die Augen hielt, als ob er ohne dieses Instrument nicht reden könnte.
»Ganz und gar nicht«, erwiderte erstaunt der Erzähler mit einem Achselzucken.
»Ich frage nämlich deswegen, weil ich Gespenstergeschichten nicht leiden mag«, sagte Fürst Ippolit in einem Ton, aus dem man merken konnte, daß er erst nachträglich, nachdem er jene Worte gesprochen hatte, sich über ihren Sinn klargeworden war.
Aber infolge der Selbstgefälligkeit, mit welcher er sprach, kam es niemandem recht zum Bewußtsein, ob das, was er gesagt hatte, etwas sehr Kluges oder etwas sehr Dummes war. Er trug einen dunkelgrünen Frack, Beinkleider, deren Farbe er selbst als »Lende einer erschreckten Nymphe« bezeichnete, sowie Strümpfe und Schnallenschuhe.
Der Vicomte erzählte in allerliebster Weise eine damals kursierende Anekdote: Der Herzog von Enghien sei heimlich nach Paris gereist, um dort ein Rendezvous mit der Schauspielerin Georges zu haben, und sei dort mit Bonaparte zusammengetroffen, der sich gleichfalls der Gunst der berühmten Schauspielerin erfreut habe. Bei dieser Begegnung mit dem Herzog habe Napoleon einen Ohnmachtsanfall gehabt, ein bei ihm nicht selten auftretendes Leiden, und sich auf diese Art in der Gewalt des Herzogs befunden. Der Herzog habe diesen günstigen Umstand nicht benutzt; Bonaparte aber habe sich später für diese Großmut durch die Ermordung des Herzogs gerächt.
Die Erzählung war sehr hübsch und interessant; besonders bei der Stelle, wo die beiden Rivalen einander plötzlich erkannten, schienen auch die Damen in Aufregung zu sein.
»Reizend!« sagte Anna Pawlowna und blickte dabei die kleine Fürstin fragend an.
»Reizend!« flüsterte die kleine Fürstin und steckte ihre Nadel in ihre Handarbeit hinein, wie um damit anzudeuten, daß ihr lebhaftes Interesse für die reizende Erzählung sie daran hindere weiterzuarbeiten.