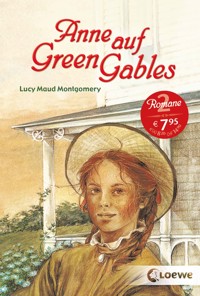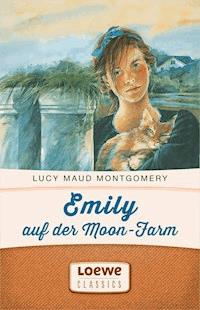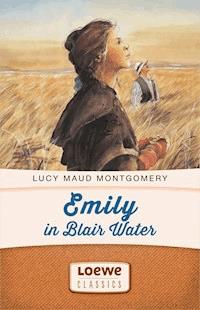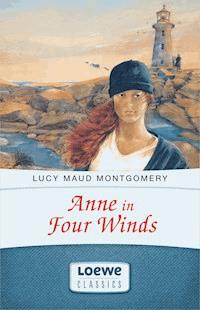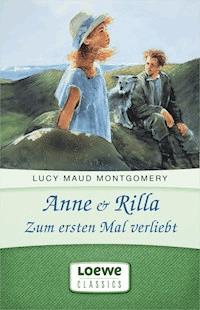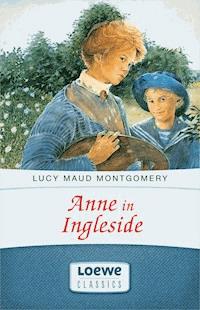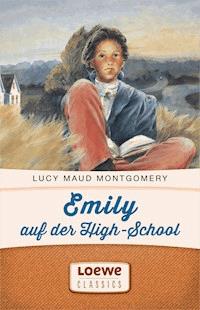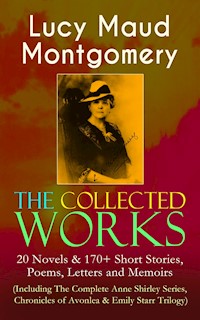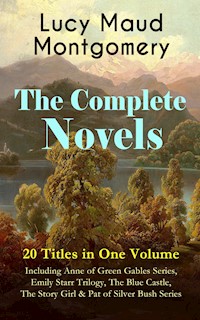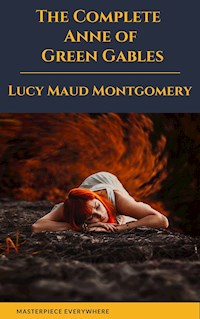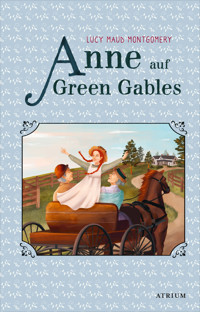
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie ist quirlig, hat eine blühende Fantasie, hasst ihre roten Haare und findet für alles die richtigen Worte. Mit über 50 Millionen weltweit verkauften Exemplaren ist Anne auf Green Gables einer der größten Erfolge der kanadischen Literatur. Seit über 100 Jahren inspiriert das Mädchen, das sich selbst mit einem E am Ende schreibt, weil es "so viel schöner aussieht", nicht nur Astrid Lindgren, sondern auch Millionen von Kindern auf der ganzen Welt. Jetzt erscheint der beliebte Klassiker in moderner Ausstattung und neu und ungekürzt übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lucy Maud Montgomery
Anne auf Green Gables
Kinderbuch
Neu übersetzte Ausgabe
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2021
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien erstmals 1908 unter dem Titel Anne of Green Gables bei L. C. Page & Co., Boston.
Aus dem Englischen von Bettina Münch
Lektorat: Johanna Schwering
Coverillustration: Delia Razak
Zitat: Der kürzere Westminster Katechismus von 1647. In der Übersetzung von Kurt Vetterli. © 2005 MBS Texte 61, Reformiertes Forum, Bonn.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-182-1
www.atrium-verlag.com
www.instagram.com/atrium_kinderbuch_verlag
Zur Erinnerung an meinen Vater und meine Mutter
»Die Sterne waren dir hold,
Formten dich aus Geist und Feuer und Tau.«
Robert Browning
EINSMrs. Rachel Lynde erlebt eine Überraschung
Mrs. Rachel Lynde lebte genau dort, wo die von Erlen und orange blühendem Springkraut gesäumte Hauptstraße von Avonlea durch eine kleine Senke führte. Der Bach, der diese Senke durchfloss, entsprang tief in den Wäldern der alten Cuthbert Farm, und es hieß, dass er in seinem Unterlauf wild und gewunden dahinströme, voller geheimnisvoller Tümpel und Wasserfälle. Aber hier, in Lynde’s Hollow, war er bereits ein braves kleines Rinnsal, denn an Mrs. Rachel Lyndes Haustür konnte nicht einmal ein Bach vorbeifließen, ohne auf Sitte und Anstand zu achten. Wahrscheinlich wusste er, dass Mrs. Lynde an ihrem Platz am Fenster alles im Auge behielt, was draußen vorbeikam – angefangen bei Bächen und Kindern –, und dass sie, wenn ihr irgendetwas merkwürdig oder ungewöhnlich vorkam, keine Ruhe geben würde, bis sie über das Wieso und Weshalb genau Bescheid wusste.
Es gab viele Menschen in und um Avonlea herum, die sich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischten, indem sie ihre eigenen vernachlässigten. Aber Mrs. Rachel Lynde gehörte zu jenen tüchtigen Geschöpfen, die in der Lage sind, sich sowohl um ihre eigenen als auch um die Angelegenheiten anderer Leute zu kümmern. Sie war eine fleißige Hausfrau, der alles leicht von der Hand ging, sie leitete den Handarbeitskreis, half in der Sonntagsschule aus und war die wichtigste Stütze der Kirchengemeinde und des örtlichen Hilfsvereins der christlichen Auslandsmission. Trotzdem fand Mrs. Lynde noch genügend Zeit, um stundenlang an ihrem Küchenfenster zu sitzen und feine Baumwolldecken zu stricken (von denen sie bereits sechzehn Stück fertiggestellt hatte, wie die anderen Hausfrauen von Avonlea einander ehrfürchtig zuraunten). Dabei ließ sie die Hauptstraße nicht aus den Augen, die sich hinter der Senke den steilen Hügel hinaufwand. Da Avonlea auf einer kleinen spitzen Landzunge lag, die in den Sankt-Lorenz-Strom hinausragte, musste jeder, der in den Ort hinein- oder aus ihm herauswollte, diese Straße nehmen und sich dem scharfen Blick von Mrs. Lynde aussetzen.
Dort saß sie auch an einem Nachmittag Anfang Juni. Die Sonne schien hell und warm durchs Fenster, der Obstgarten unterhalb ihres Hauses leuchtete wie ein rosa-weißer Brautstrauß, und ein Heer von Bienen schwirrte summend über der Blütenpracht. Thomas Lynde – ein sanftmütiger kleiner Herr, der in Avonlea nie anders als »Rachel Lyndes Mann« genannt wurde – säte auf dem Hügelacker hinter der Scheune gerade seine Herbstrüben, und eigentlich hätte Matthew Cuthbert auf seinem großen Feld am Bach, drüben auf Green Gables, genau das Gleiche tun müssen. Mrs. Lynde wusste das, weil sie ihn am Vorabend in William Blairs Laden in Carmody zu Peter Morrison hatte sagen hören, dass er am Nachmittag Rüben säen wollte. Peter hatte ihn natürlich danach gefragt, denn Matthew Cuthbert hatte noch nie im Leben irgendetwas aus freien Stücken erzählt.
Nichtsdestotrotz fuhr Matthew Cuthbert nun am helllichten Nachmittag, um halb vier an einem Werktag, seelenruhig durch die Senke und den Hügel hinauf. Mehr noch: Er trug zudem ein weißes Hemd und seinen Sonntagsanzug, was klar bewies, dass er Avonlea verlassen wollte. Außerdem hatte er die Fuchsstute eingespannt und demnach einen weiten Weg vor sich. Aber wohin wollte Matthew Cuthbert, und was hatte er dort vor?
Bei jedem anderen Mann in Avonlea hätte Mrs. Lynde eins und eins zusammengezählt und vermutlich eine ziemlich gute Antwort auf beide Fragen gefunden. Aber Matthew verließ seinen Hof so selten, dass nur etwas sehr Dringendes und Ungewöhnliches dahinterstecken konnte. Er war der schüchternste Mensch der Welt und hasste es, Fremden zu begegnen oder sich irgendwohin begeben zu müssen, wo er womöglich den Mund aufmachen musste. Dass Matthew im weißen Hemd mit seinem Einspänner davonfuhr, kam nicht oft vor. Mrs. Lynde konnte grübeln, so viel sie wollte, ihr fiel einfach keine gescheite Erklärung ein, und das verleidete ihr die schöne Nachmittagsbeschäftigung.
»Ich gehe nach dem Tee einfach nach Green Gables hinüber und lasse mir von Marilla erzählen, wohin und warum er fortgefahren ist«, beschloss die gute Frau schließlich. »Normalerweise fährt er um diese Jahreszeit nicht in die Stadt, und Besuche macht er sowieso nie. Wenn ihm die Rübensamen ausgegangen wären und er Nachschub besorgen müsste, hätte er sich nicht so fein gemacht und die Kutsche genommen, und für einen Arztbesuch hatte er es nicht eilig genug. Trotzdem muss seit gestern Abend etwas passiert sein. Ich kann es mir einfach nicht erklären und finde keine Ruhe, bis ich weiß, was Matthew Cuthbert heute aus Avonlea fortgetrieben hat.«
Also machte sich Mrs. Lynde nach dem Tee auf den Weg. Sie hatte es nicht weit, denn das große, verwinkelte Haus der Cuthberts mit seinen weitläufigen Obstgärten drum herum lag keine Viertelmeile von Lynde’s Hollow entfernt. Allerdings zog sich der Fahrweg und ließ die Strecke um einiges länger wirken. Matthew Cuthberts Vater, der ebenso schüchtern und still gewesen war wie sein Sohn, hatte sich beim Bau seines Hauses so weit wie möglich von seinen Mitmenschen zurückgezogen, ohne ganz in die Wälder zu flüchten. Green Gables wurde am äußersten Rand des Landes errichtet, das er urbar gemacht hatte, und dort stand es noch und war von der Hauptstraße aus, an der sich die übrigen Häuser von Avonlea so gesellig nebeneinander aufreihten, fast nicht zu sehen. Mrs. Lynde mochte das Leben an einem derart entlegenen Ort kaum als Leben bezeichnen.
»Sie haben es dort recht einsam«, sagte sie sich, als sie den zerfurchten und von wilden Rosen gesäumten Grasweg entlangging. »Kein Wunder, dass Matthew und Marilla ein bisschen wunderlich sind, mit nichts als Bäumen zur Gesellschaft hier draußen. Bäume gibt es allerdings genug. Ich persönlich habe lieber Menschen um mich. Zufrieden wirken die beiden ja, aber wahrscheinlich sind sie’s nicht anders gewohnt. Wie heißt es so schön? Man kann sich an alles gewöhnen, sogar ans Sterben.«
Mit diesen Worten verließ Mrs. Lynde den Fahrweg und betrat das Farmgelände von Green Gables. Es war sehr grün und in makellosem Zustand, mit majestätischen Weiden auf der einen Seite und schmucken Pappeln auf der anderen. Jeder Stock und jeder Stein lagen am richtigen Platz, denn wenn es nicht so gewesen wäre, hätte Mrs. Lynde es sicher sofort bemerkt. Insgeheim war sie sicher, dass Marilla Cuthbert ihren Hof ebenso häufig fegte wie ihr Haus. Man hätte dort buchstäblich vom Boden essen können.
Mrs. Lynde betrat das Haus durch die Milchkammer, klopfte beherzt an die Küchentür und trat auf Marillas Aufforderung hin ein. Die Küche von Green Gables war ein freundlicher Raum – besser gesagt, er wäre es gewesen, wenn er nicht so schrecklich sauber ausgesehen und dadurch eher an eine ungenutzte gute Stube erinnert hätte. Die beiden Fenster schauten nach Osten und Westen, wobei letzteres den Hof überblickte und nun von der warmen Junisonne durchströmt wurde. Das Ostfenster hingegen, durch das man die weiß blühenden Kirschbäume im Obstgarten zur Linken sah und die schlanken, wippenden Birken unten in der Senke am Bach, war von wildem Wein überwuchert. Hier saß Marilla Cuthbert, wenn sie sich überhaupt einmal hinsetzte, denn sie hegte ein gewisses Misstrauen gegen Sonnenschein, der ihr für diese ernste Welt zu beschwingt und unbekümmert erschien. Hier saß sie auch jetzt und strickte. Der Esstisch hinter ihr war bereits für das Abendbrot gedeckt.
Mrs. Lynde hatte die Tür noch nicht richtig geschlossen, als sie auch schon alles erfasste, was auf dem Tisch stand: Marilla hatte drei Teller hingestellt; also ging sie davon aus, dass Matthew jemanden zum Abendessen mitbrachte. Allerdings hatte sie das Alltagsgeschirr genommen, nur ein Glas Apfelkompott und auch nur einen kleinen Kuchen aufgetischt; der erwartete Gast konnte also niemand Besonderes sein. Aber warum dann Matthews weißes Hemd und die Fuchsstute? Mrs. Lynde wurde ganz schwindelig von diesen ungewohnten Geheimnissen im ruhigen und gänzlich ungeheimnisvollen Green Gables.
»Guten Abend, Rachel«, sagte Marilla heiter. »Das ist ein wirklich schöner Abend, nicht wahr? Willst du dich nicht setzen? Wie geht es deiner Familie?«
Obwohl oder gerade weil sie so verschieden waren, bestand zwischen Marilla Cuthbert und Mrs. Lynde seit jeher etwas, das man, in Ermangelung eines anderen Wortes, Freundschaft nennen könnte.
Marilla war eine hochgewachsene, dünne Frau ohne Rundungen oder Kurven. Ihr dunkles Haar war von grauen Strähnen durchzogen und stets zu einem kleinen Knoten gebunden, den sie mit zwei spitzen Haarnadeln am Hinterkopf befestigte. Sie sah aus wie eine Frau mit begrenzter Welterfahrung und strengen Grundsätzen, was auch beides zutraf, doch um ihren Mund gab es einen Zug, der, wenn er sich auch nur ein klein wenig hätte entfalten dürfen, einen gewissen Sinn für Humor erahnen ließ.
»Uns geht es gut«, erwiderte Mrs. Lynde. »Nur hatte ich Angst, dass bei euch etwas nicht stimmt, als ich Matthew heute vorbeifahren sah. Ich dachte schon, er holt den Doktor.«
Marillas Lippen zuckten wissend. Sie hatte mit Mrs. Lyndes Kommen gerechnet, denn ihr war klar gewesen, dass der Anblick des so unerwartet davonfahrenden Matthew ihre Nachbarin neugierig machen würde.
»O nein, mir geht es gut, obwohl ich gestern schlimme Kopfschmerzen hatte«, sagte sie. »Matthew ist nach Bright River gefahren. Wir nehmen einen kleinen Waisenjungen aus Nova Scotia auf. Er kommt mit dem Nachmittagszug an.«
Hätte Marilla behauptet, Matthew wäre nach Bright River gefahren, um ein australisches Känguru abzuholen, hätte Mrs. Lynde nicht erstaunter sein können. Fünf geschlagene Sekunden lang wusste sie nicht, was sie sagen sollte. Im Grunde war es unvorstellbar, dass Marilla sich über sie lustig machte, trotzdem fühlte sich Mrs. Lynde fast gezwungen, es anzunehmen.
»Ist das dein Ernst, Marilla?«, fragte sie schließlich, als sie die Sprache wiederfand.
»Ja, natürlich«, erwiderte Marilla, als wäre es keine unerhörte Neuerung, sondern auf allen gut geführten Farmen von Avonlea üblich, für die Frühjahrsarbeit einen Jungen aus einem der Waisenhäuser von Nova Scotia aufzunehmen.
Mrs. Lynde war wie vor den Kopf geschlagen. Sie dachte nur noch in Ausrufezeichen. Ein Junge! Ausgerechnet Marilla und Matthew adoptierten einen Jungen! Aus dem Waisenhaus! Die Welt stand buchstäblich auf dem Kopf! Nun konnte sie nichts mehr überraschen! Gar nichts mehr!
»Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?«, fragte sie missbilligend. Da man sie in der Angelegenheit nicht um Rat gefragt hatte, musste sie die Sache natürlich missbilligen.
»Nun, wir haben schon länger darüber nachgedacht, genauer gesagt den ganzen Winter«, erwiderte Marilla. »Kurz vor Weihnachten war Mrs. Spencer bei uns. Sie hat erzählt, dass sie im Frühling ein kleines Mädchen aus dem Waisenhaus drüben in Hopetown bei sich aufnehmen will. Ihre Cousine lebt dort. Mrs. Spencer hat sie besucht und kennt sich damit aus. Seitdem haben Matthew und ich immer wieder darüber gesprochen. Und wir haben uns überlegt, einen Jungen zu nehmen. Matthew kommt allmählich in die Jahre, er ist jetzt sechzig und nicht mehr so flink auf den Beinen wie früher. Sein Herz macht ihm ordentlich zu schaffen. Und du weißt ja selbst, wie schwer es heutzutage ist, anständige Gehilfen zu finden. Man kriegt immer nur diese dummen halbwüchsigen Franzosen, und sobald man einen angelernt und ihm etwas beigebracht hat, verschwindet er in die Hummerfabriken oder in die Staaten, weil er sein Geld lieber anderswo verdienen will. Matthew hat vorgeschlagen, einen Waisenjungen aus England kommen zu lassen. Aber das kam für mich nicht infrage. ›Das mögen ja nette Burschen sein. Ich will nichts gegen sie sagen, aber ein Londoner Straßenjunge kommt mir nicht ins Haus‹, habe ich zu ihm gesagt. ›Er muss schon hier geboren sein. Ein Risiko ist es zwar so oder so, aber ich werde mich ruhiger fühlen und nachts besser schlafen, wenn es ein Landsmann ist.‹ Am Ende haben wir beschlossen, Mrs. Spencer zu bitten, einen Jungen für uns auszusuchen, wenn sie nach Hopetown fährt, um ihr Mädchen abzuholen. Letzte Woche haben wir gehört, dass es so weit ist, und ihr über Richard Spencers Familie in Carmody ausrichten lassen, uns bitte einen klugen, netten Jungen von zehn oder elf Jahren mitzubringen. Das ist das beste Alter, haben wir überlegt: alt genug, um gleich mit anzupacken, und jung genug, um richtig angelernt zu werden. Er wird bei uns ein gutes Zuhause haben und eine anständige Schulbildung bekommen. Heute hat uns Mrs. Spencer ein Telegramm geschickt. Der Postbote hat es vom Bahnhof mitgebracht. Darin stand, dass sie mit dem Zug um fünf Uhr dreißig in Bright River eintrifft und den Jungen mitbringt. Also ist Matthew ihn holen gefahren. Mrs. Spencer fährt schließlich weiter nach White Sands.«
Mrs. Lynde war stolz darauf, einer jener Menschen zu sein, die mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. Und das tat sie auch jetzt nicht, nachdem sie die erstaunliche Neuigkeit verdaut hatte.
»Also, Marilla, ich sage dir frank und frei, dass ich das für eine gewaltige Dummheit halte, eine riskante Sache, jawohl. Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da einlasst. Ihr holt euch ein fremdes Kind ins Haus, über das ihr nicht das Geringste wisst: welche Veranlagungen es mitbringt, was für Eltern es hatte, was einmal aus ihm werden wird. Erst letzte Woche habe ich in der Zeitung von einem Ehepaar im Westen gelesen, dem ein Junge, den sie aus dem Waisenhaus geholt haben, das Haus über dem Kopf angezündet hat – mit Absicht, Marilla! Um ein Haar wären sie in ihren Betten verbrannt. Und ich weiß von einem anderen Fall, wo ein adoptierter Junge immer die Hühnereier ausgesaugt hat, was man ihm partout nicht abgewöhnen konnte. Wenn du mich gefragt hättest – was du nicht getan hast, Marilla –, hätte ich dir geraten, um Himmels willen die Finger davon zu lassen, jawohl.«
Diese Hiobsbotschaften schienen Marilla in keiner Weise zu beunruhigen. Sie strickte gelassen weiter. »Ich will gar nicht abstreiten, dass an deinen Worten etwas dran ist, Rachel. Ich hatte selbst meine Bedenken. Aber Matthew hat es sich nun mal in den Kopf gesetzt. Das war offensichtlich, also habe ich nachgegeben. Matthew besteht so selten auf etwas, dass ich das Gefühl habe, es ihm schuldig zu sein, wenn er es einmal tut. Was die Risiken angeht, würde ich sagen, dass fast alles im Leben riskant ist. Eigene Kinder zu bekommen, ist auch ein Risiko – denn auch die können missraten. Außerdem ist es nach Nova Scotia nicht weit. Wir holen den Jungen schließlich nicht aus England oder aus den Staaten. Er kann nicht viel anders sein als wir.«
»Na, hoffen wir, dass alles gut geht«, sagte Mrs. Lynde in einem Ton, der ihre Zweifel mehr als deutlich machte. »Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn er Green Gables niederbrennt oder euer Wasser mit Strychnin vergiftet. Ich habe von einem Fall drüben in New Brunswick gehört, wo ein Waisenkind genau das getan hat, und die ganze Familie ist unter schrecklichen Schmerzen gestorben. Nur dass es in dem Fall ein Mädchen war.«
»Wir kriegen aber kein Mädchen«, sagte Marilla, als sei das Vergiften von Trinkwasser eine typisch weibliche Angewohnheit und nicht auch bei einem Jungen zu befürchten. »Ich würde nicht im Traum daran denken, ein Mädchen aufzuziehen. Es wundert mich, dass Mrs. Spencer es tut. Andererseits würde sie auch nicht davor zurückschrecken, ein ganzes Waisenhaus zu adoptieren.«
Mrs. Lynde wäre gern geblieben, bis Matthew mit seinem importierten Waisenjungen zurückkam. Da das aber gut und gern noch zwei Stunden dauern konnte, beschloss sie, lieber zu den Bells hinüberzulaufen und ihnen die Neuigkeit zu überbringen. Sie würde mit Sicherheit für gewaltiges Aufsehen sorgen, und Mrs. Lynde sorgte gern für Aufsehen. Also verließ sie Marilla, die darüber nicht traurig war, weil Mrs. Lyndes Schwarzmalerei ihre eigenen Ängste und Zweifel wieder aufleben ließen.
»So was hat die Welt noch nicht gesehen!«, rief Mrs. Lynde, als sie wieder draußen auf dem Fahrweg war. »Ich glaube, ich träume. Dieser arme Junge kann einem wirklich leidtun. Matthew und Marilla haben keine Ahnung von Kindern und werden von ihm erwarten, dass er sich besser verhält als sein eigener Großvater, falls er jemals einen hatte, was ich bezweifle. Es ist fast unheimlich, sich ein Kind auf Green Gables vorzustellen. Das hat es dort nie gegeben, denn Matthew und Marilla waren schon erwachsen, als das neue Haus gebaut wurde – falls sie überhaupt jemals Kinder waren. Das hält man eigentlich kaum für möglich, wenn man sie so ansieht. In der Haut dieses Waisenjungen will ich wirklich nicht stecken. Er tut mir richtiggehend leid, jawohl.«
Das alles erzählte Mrs. Lynde vor lauter Aufregung den wilden Rosenbüschen am Weg. Hätte sie das Kind sehen können, das in diesem Moment geduldig am Bahnhof von Bright River wartete, wäre ihr Mitleid sogar noch größer gewesen.
ZWEIMatthew Cuthbert erlebt eine Überraschung
Matthew Cuthbert fuhr die acht Meilen nach Bright River in seinem Einspänner gemütlich dahin. Es war eine schöne Strecke, vorbei an hübschen Farmen, durch würzig duftende Kiefernwälder und Senken, in denen die wilden Pflaumenbäume ihre zarten Blüten reckten. Der süße Duft der Apfelhaine lag in der Luft, und die Wiesen verloren sich in einem Schleier aus Purpur und Perlmutt, während »die kleinen Vögel sangen, als wär ihnen nur ein einz’ger Sommertag beschieden«.
Matthew genoss die Fahrt auf seine Weise, abgesehen von den Momenten, in denen er Frauen begegnete und ihnen zunicken musste, denn auf Prince Edward Island muss man Gott und der Welt zunicken, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, egal ob man sie kennt oder nicht.
Matthew hatte Angst vor allen Frauen, die nicht Marilla oder Mrs. Lynde waren. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass diese geheimnisvollen Wesen heimlich über ihn lachten, und damit lag er womöglich gar nicht so falsch, denn er war ein merkwürdig aussehender Geselle, mit ungelenkem Körper, langen eisgrauen Haaren, die ihm bis auf die hängenden Schultern fielen, und einem dichten braunen Bart, den er trug, seit er zwanzig war. Im Grunde hatte er mit zwanzig nicht viel anders ausgesehen als mit sechzig, nur etwas weniger grau.
Als er in Bright River ankam, war von einem Zug nichts zu sehen. Da er früh dran zu sein glaubte, ließ er Pferd und Kutsche vor dem kleinen Hotel stehen und ging zum Bahnhofsgebäude hinüber. Der lange Bahnsteig war praktisch menschenleer. Das einzige Lebewesen weit und breit war ein Mädchen, das ganz vorn auf einem Stapel Holzziegeln saß. Kaum hatte Matthew bemerkt, dass es sich um ein weibliches Wesen handelte, schlängelte er sich, so schnell er konnte und ohne hinzusehen, an ihm vorbei. Hätte er hingesehen, wären ihm die angespannte Körperhaltung des Mädchens und der erwartungsvolle Gesichtsausdruck wohl kaum entgangen. Die Kleine saß da und wartete auf irgendetwas oder jemanden, und da es sonst nichts für sie zu tun gab, saß und wartete sie mit aller Kraft.
Matthew entdeckte den Bahnhofsvorsteher, der gerade den Fahrkartenschalter schloss, um zum Abendessen nach Hause zu gehen, und fragte ihn, ob der Nachmittagszug bald eintreffen werde.
»Der ist schon vor einer halben Stunde durch«, erwiderte der Vorsteher kurz angebunden. »Aber es wurde ein Fahrgast für Sie abgesetzt – ein kleines Mädchen. Sie sitzt da vorn auf den Holzziegeln. Ich habe ihr vorgeschlagen, im Warteraum für Damen auf Sie zu warten, aber sie hat mich wissen lassen, dass sie lieber draußen bleiben will. Da gäbe es ›mehr Raum für ihre Fantasie‹, hat sie gesagt. Das ist vielleicht eine.«
»Ich erwarte kein Mädchen«, erwiderte Matthew rundheraus. »Ich bin hergekommen, um einen Jungen abzuholen. Mrs. Spencer wollte ihn aus Nova Scotia mitbringen.«
Der Bahnhofsvorsteher pfiff durch die Zähne.
»Da muss etwas schiefgegangen sein«, sagte er. »Mrs. Spencer ist mit diesem Mädchen ausgestiegen und hat es mir übergeben. Sie und Ihre Schwester hätten das Kind aus dem Waisenhaus adoptiert, hat Mrs. Spencer gesagt, und dass Sie bald kommen würden. Mehr weiß ich nicht – und andere Waisenkinder habe ich hier nicht versteckt.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Matthew ratlos und wünschte Marilla herbei, damit diese sich der Sache annehmen konnte.
»Nun, am besten fragen Sie die Kleine«, sagte der Bahnhofsvorsteher leichthin. »Sie kann es bestimmt erklären – denn reden kann sie, so viel ist sicher. Vielleicht gab es im Waisenhaus gerade keine Jungen von der Sorte, die Sie wollen.«
Damit ging er fröhlich davon, denn er war hungrig, und dem unglücklichen Matthew blieb nichts anderes übrig, als zu tun, was für ihn schlimmer war, als eine Löwenhöhle zu betreten: Er musste auf ein Mädchen zugehen – ein fremdes Mädchen! Ein Waisenmädchen! – und es fragen, warum es kein Junge war. Mit einem unterdrückten Stöhnen drehte Matthew sich um und schlurfte mit schweren Schritten über den Bahnsteig auf das Kind zu.
Das Mädchen hatte Matthew beobachtet, seit er am Bahnhof angekommen war, und ließ ihn auch jetzt nicht aus den Augen. Matthew sah das Kind nicht an, und selbst wenn, hätte er nicht gesehen, was ein gewöhnlicher Betrachter nun sah:
Ein etwa elfjähriges Mädchen in einem sehr kurzen, sehr engen und sehr hässlichen Kleid aus grobem, gelblich braunem Wollzeug. Es trug einen ausgeblichenen braunen Matrosenhut, unter dem zwei Zöpfe aus sehr dichtem, feuerrotem Haar bis über den Rücken herabhingen. Das kleine Gesicht war schmal und weiß und voller Sommersprossen, der Mund groß, was auch für die Augen des Kindes galt, die je nach Licht und Stimmung mal grün und mal grau wirkten.
Das wären die Beobachtungen eines gewöhnlichen Betrachters gewesen. Ein ungewöhnlicher Beobachter hätte vielleicht bemerkt, dass das Kinn des Mädchens spitz und energisch aussah, die großen Augen voller Geist und Temperament waren, der Mund schön und ausdrucksstark und die Stirn glatt und hoch. Kurz gesagt: Ein scharfsichtiger Beobachter hätte möglicherweise gefolgert, dass sich im Körper dieses verlorenen Kindes, vor dem der schüchterne Matthew solch lächerliche Angst hatte, keine gewöhnliche Seele verbarg.
Das Mädchen ersparte Matthew die Qual, als Erster das Wort zu ergreifen. Als er auf das Kind zuging, stand es auf, packte mit einer schmalen, braun gebrannten Hand den Griff einer abgewetzten alten Reisetasche und streckte ihm die andere entgegen.
»Sie müssen Mr. Matthew Cuthbert von Green Gables sein, richtig?«, sagte das Mädchen mit einer ungewöhnlich klaren und schönen Stimme. »Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden mich nicht abholen, und mir ausgemalt, was Sie davon abhalten könnte. Falls Sie nicht gekommen wären, hatte ich vor, über die Gleise bis zu dem großen wilden Kirschbaum dort vorn in der Kurve zu laufen und an ihm hinaufzuklettern, um oben zu übernachten. Das hätte mir keine Angst gemacht. Es wäre bestimmt wundervoll, im Mondschein in einem weiß blühenden Kirschbaum zu schlafen, meinen Sie nicht? Man könnte sich vorstellen, in einer Halle aus Marmor zu sitzen, nicht wahr? Und ich war ganz sicher, dass Sie morgen früh kommen würden, wenn es heute nicht geklappt hätte.«
Matthew nahm verlegen die schmale kleine Hand in seine und fasste an Ort und Stelle einen Entschluss. Er konnte diesem Mädchen mit den leuchtenden Augen nicht sagen, dass hier ein Missverständnis vorlag. Er würde es mit nach Hause nehmen, wo Marilla das übernehmen sollte. Das Mädchen in Bright River zurückzulassen, kam ohnehin nicht infrage, egal wie es zu diesem Fehler gekommen war. Also hatten sämtliche Fragen und Erklärungen Zeit, bis er wieder sicher auf Green Gables war.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, sagte er schüchtern. »Komm mit. Das Pferd steht drüben beim Hotel. Gib mir deine Tasche.«
»Oh, die trage ich lieber selbst«, erwiderte das Mädchen fröhlich. »Sie ist nicht schwer. Ich habe meine gesamte irdische Habe darin, aber sie ist nicht schwer. Außerdem fällt der Griff ab, wenn man sie nicht richtig trägt – also behalte ich sie lieber bei mir, denn ich kenne sie in- und auswendig. Die Tasche ist nämlich uralt, wissen Sie? Ach, ich bin wirklich froh, dass Sie gekommen sind, auch wenn es schön gewesen wäre, in einem wilden Kirschbaum zu schlafen. Wir müssen ein gutes Stück fahren, nicht wahr? Mrs. Spencer hat gesagt, es wären acht Meilen. Das freut mich, denn ich liebe Kutschfahrten. Es ist so wunderbar, dass ich jetzt bei Ihnen leben und zu Ihnen gehören darf. Ich habe noch nie irgendwo dazugehört – nicht wirklich jedenfalls. Aber im Waisenhaus war es am schlimmsten. Ich war nur vier Monate dort, aber das hat mir gereicht. Ich nehme an, Sie haben nie als Waisenkind in einem Waisenhaus gelebt, nicht wahr? Dann können Sie unmöglich wissen, wie das ist. Es ist schlimmer als alles, was Sie sich vorstellen können. Mrs. Spencer findet es gemein von mir, so zu reden, dabei meine ich es gar nicht böse. Es ist leicht, gemein zu sein, ohne es zu wissen, nicht wahr? Sie waren gute Menschen, wissen Sie, die Leute im Waisenheim. Aber dort gibt es nichts, was die Fantasie anregt – höchstens die anderen Waisenkinder. Es war ziemlich interessant, sich Dinge über die anderen vorzustellen: zum Beispiel, dass das Mädchen neben mir in Wirklichkeit die Tochter eines Herzogs ist, die als Baby von einem grausamen Kindermädchen entführt wurde, das wiederum starb, bevor es ein Geständnis ablegen konnte. Ich habe nachts oft wach gelegen und mir solche Dinge ausgedacht, weil ich tagsüber keine Zeit dafür hatte. Wahrscheinlich bin ich deshalb so dünn – ich bin furchtbar dünn, finden Sie nicht auch? Nicht das kleinste bisschen Speck auf den Rippen. Ich stelle mir gern vor, dass ich mollig und hübsch bin, mit Grübchen in den Ellbogen.«
Nach diesen Worten verstummte Matthews Begleiterin, denn zum einen war sie außer Atem, zum anderen hatten sie den Einspänner erreicht. Das Mädchen sagte kein Wort mehr, bis sie die Ortschaft hinter sich gelassen hatten und einen steilen kleinen Hügel hinunterfuhren. Die Straße grub sich hier so tief in das weiche Erdreich, dass die mit blühenden Obstbäumen und schlanken weißen Birken bestandene Böschung links und rechts von ihnen aufragte.
Das Mädchen streckte die Hand aus und riss einen Zweig von einem wilden Pflaumenbaum ab, der die Kutsche gestreift hatte.
»Ist der nicht wunderschön? An was hat Sie der Baum erinnert, der sich mit seiner zarten weißen Blütenpracht über die Böschung beugt?«, fragte sie.
»Hm, ich weiß nicht«, sagte Matthew.
»Na, an eine Braut natürlich! An eine Braut in Weiß mit einem wunderschönen Schleier. Ich habe zwar noch nie eine Braut gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie sie aussähe. Ich selbst gehe nicht davon aus, einmal eine Braut zu sein. Ich bin so unscheinbar, dass mich wohl niemand heiraten wollen wird, außer vielleicht ein Missionar. Die sind vermutlich nicht so wählerisch. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich irgendwann ein weißes Kleid haben werde. Das wäre für mich das höchste Glück auf Erden. Ich liebe hübsche Kleider. Dabei habe ich noch nie eines besessen, soweit ich weiß. Aber gerade das ist ein Grund, sich darauf zu freuen, meinen Sie nicht? Dann kann ich davon träumen, ganz hinreißend gekleidet zu sein. Als ich heute Morgen das Waisenhaus verließ, habe ich mich für dieses schäbige braune Wollkleid schrecklich geschämt. Alle Waisen müssen so eines tragen, wissen Sie? Letzten Winter hat ein Kaufmann aus Hopetown dem Waisenhaus fast dreihundert Meter halbwollnes Zeug gespendet. Manche Leute sagen, er hätte das nur getan, weil er den Stoff nicht losgeworden ist, aber ich stelle mir lieber vor, dass er es aus Herzensgüte getan hat. Würden Sie das nicht auch tun? Als wir in den Zug stiegen, hatte ich das Gefühl, dass mich alle Leute anstarren und bedauern. Aber dann habe ich mir ganz fest vorgestellt, dass ich ein wunderschönes blassblaues Seidenkleid trage – wenn man sich schon etwas vorstellt, sollte es auch etwas richtig Schönes sein – und dazu einen großen Hut voller Blumen und wippender Federn, eine goldene Uhr, seidene Handschuhe und Stiefeletten. Da wurde ich sofort fröhlicher und habe die Reise in vollen Zügen genossen. Während der Überfahrt war mir kein bisschen übel. Mrs. Spencer auch nicht, obwohl ihr häufig übel wird. Ihr habe die Zeit dafür gefehlt, hat sie gesagt, weil sie so achtgeben musste, dass ich nicht über Bord falle. Eine Streunerin wie ich sei ihr noch nicht untergekommen, hat sie gesagt. Aber wenn ich sie davor bewahrt habe, seekrank zu werden, war es doch ein Glück, dass ich herumgestreunt bin, oder? Ich wollte mir auf dem Schiff alles ansehen. Wer weiß, ob ich dazu noch einmal Gelegenheit haben werde. Oh, da sind ja noch viel mehr blühende Kirschbäume! Diese Insel ist das reinste Blütenparadies. Sie gefällt mir jetzt schon, und ich bin wirklich froh, dass ich hier leben darf. Ich habe schon oft gehört, es gäbe nichts Schöneres als Prince Edward Island, und ich habe mir vorgestellt, dort zu leben, aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich dazu kommen würde. Es ist herrlich, wenn Träume wahr werden, finden Sie nicht auch? Diese roten Straßen sind wirklich lustig. Als der Zug aus Charlottetown herausfuhr und die roten Wege an uns vorübersausten, habe ich Mrs. Spencer gefragt, warum sie so rot sind, aber sie hat gesagt, sie wisse es nicht und ich solle endlich aufhören, ihr Löcher in den Bauch zu fragen. Ich hätte ihr schon mindestens tausend Fragen gestellt. Wahrscheinlich hatte sie recht, aber wie soll man etwas herausfinden, wenn man keine Fragen stellt? Also was färbt diese Straßen denn nun so rot?«
»Hm, das weiß ich auch nicht«, sagte Matthew.
»Na, dann werde ich es irgendwann herausfinden. Ist es nicht wunderbar, dass es so vieles herauszufinden gibt? Es macht mich so froh, am Leben zu sein – die Welt ist ja so interessant! Wenn wir alles schon wüssten, wäre sie nicht halb so interessant, nicht wahr? Rede ich eigentlich zu viel? Die Leute sagen immer, dass ich das tue. Soll ich lieber still sein? Wenn Sie wollen, höre ich auf zu reden. Ich kann still sein, wenn ich es mir vornehme, aber es fällt mir schwer.«
Zu seiner eigenen Überraschung fühlte Matthew sich ausgesprochen wohl. Wie die meisten stillen Menschen mochte er redselige Leute, solange sie das Reden selbst übernahmen und nicht erwarteten, dass er seinen Teil dazu beitrug. Allerdings hätte er nie damit gerechnet, ausgerechnet die Gesellschaft eines kleinen Mädchens so zu genießen. Frauen waren schon schlimm genug, aber kleine Mädchen eigentlich noch schlimmer. Er hasste es, wenn sie verschreckt an ihm vorbeihuschten und ihm dabei verstohlene Blicke zuwarfen, als rechneten sie damit, in einem Stück verschlungen zu werden, wenn sie auch nur einen Mucks von sich gaben. So jedenfalls verhielten sich die wohlerzogenen kleinen Mädchen von Avonlea. Aber dieses bezaubernde sommersprossige Persönchen war völlig anders, und obwohl Matthew mit seiner langsamen Art Mühe hatte, mit den schnellen Geistessprüngen des Mädchens Schritt zu halten, stellte er fest, dass ihm das Geplapper gefiel. Also sagte er schüchtern wie immer:
»Du kannst reden, so viel du willst. Das stört mich nicht.«
»Ach, da bin ich froh. Wir beide werden uns gut verstehen, das weiß ich. Es tut so gut, reden zu können, wie es einem einfällt, und sich nicht ständig sagen lassen zu müssen, dass man Kinder zwar sehen, aber nicht hören sollte. Ich habe mir das zigtausend Mal anhören müssen. Außerdem lachen mich die Leute aus, weil ich so große Worte benutze. Aber wenn man sich große Gedanken macht, muss man sie auch in große Worte kleiden, finden Sie nicht auch, Mr. Cuthbert?«
»Nun, das scheint mir einleuchtend«, sagte Matthew.
»Mrs. Spencer meint, meine Zunge säße lockerer als bei anderen Leuten, deshalb könnte ich sie doppelt so schnell bewegen wie normale Menschen. Aber das stimmt nicht – sie ist fest angewachsen. Mrs. Spencer hat mir auch erzählt, dass Ihre Farm Green Gables heißt. Ich habe ihr alle möglichen Fragen darüber gestellt. Und als sie sagte, dass die Farm rundherum von Bäumen umgeben ist, war ich noch glücklicher als zuvor. Ich liebe Bäume. Beim Waisenhaus gab es überhaupt keine, nur ein paar winzige Kümmerlinge direkt vor dem Haus, mit weiß getünchten Käfigdingern drum herum. Die Bäumchen sahen selbst wie Waisenkinder aus. Ich hätte jedes Mal heulen können bei ihrem Anblick. ›Ach, ihr armen kleinen Dinger!‹, habe ich immer zu ihnen gesagt. ›Wenn ihr doch nur draußen in einem großen, dichten Wald stehen könntet, mit anderen Bäumen um euch herum und Flechten und kleinen Moosglöckchen, die um eure Wurzeln wachsen, mit einem Bach in der Nähe und Vögeln, die in euren Ästen singen, dann würdet ihr mit Sicherheit wachsen. Aber da, wo ihr jetzt steht, könnt ihr das nicht. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt, ihr armen kleinen Bäumchen.‹ Es hat mir richtig leidgetan, sie heute Morgen zurückzulassen. Manche Dinge gewinnt man einfach lieb, nicht wahr? Gibt es in der Nähe von Green Gables einen Bach? Ich habe vergessen, Mrs. Spencer danach zu fragen.«
»Hm, ja, tatsächlich, es gibt einen, in der Senke unterhalb vom Haus.«
»Na, so was! Ich habe schon immer davon geträumt, in der Nähe eines Baches zu leben. Aber ich hätte nie gedacht, dass es einmal wahr werden würde. Träume erfüllen sich nicht oft. Aber es wäre wirklich schön, wenn sie es täten, finden Sie nicht auch? Im Augenblick bin ich fast vollkommen glücklich. Vollkommen glücklich kann ich nicht sein, weil … Wie würden Sie diese Farbe nennen?«
Das Mädchen zog einen seiner langen, glänzenden Zöpfe über die magere Schulter und hielt ihn Matthew vors Gesicht. Matthew war es nicht gewohnt, den Zöpfen junger Damen Farben zuzuordnen, aber in diesem Fall gab es keinen Zweifel.
»Das ist Rot, oder nicht?«, sagte er.
Mit einem Seufzen, das direkt aus den Zehenspitzen zu kommen und alles Leid der Welt in sich zu tragen schien, ließ das Mädchen den Zopf wieder fallen.
»Ja, er ist rot«, sagte die Kleine resigniert. »Jetzt wissen Sie, warum ich nicht vollkommen glücklich sein kann. Kein Mensch mit roten Haaren kann das. Alles andere finde ich nicht so schlimm: die Sommersprossen, meine grünen Augen und dass ich so mager bin. Ich kann es mir wegdenken und mir vorstellen, ich hätte rosig zarte Haut und wunderschöne veilchenblaue Augen. Aber die roten Haare kann ich einfach nichtwegdenken. Ich gebe mir alle Mühe und rede mir ein, mein Haar wäre tiefschwarz, wie Rabenflügel. Aber ich weiß, dass es einfach nur rot ist, und das bricht mir das Herz. Es ist mein nie endender Kummer. Ich habe einmal in einem Roman von einem Mädchen gelesen, das einen nie endenden Kummer hatte, aber rote Haare waren es nicht. Sie hatte goldblonde Locken, die sich um ihre Alabasterstirn ringelten. Was ist eigentlich Alabaster? Das habe ich nie herausfinden können. Können Sie es mir sagen?«
»Hm, nein, ich fürchte, das kann ich nicht«, sagte Matthew, dem langsam ein wenig schwindlig wurde. Er fühlte sich genauso, wie es ihm einmal in seiner Jugend ergangen war, als ein anderer Junge ihn während eines Ausflugs auf das Drehkarussell gelockt hatte.
»Na ja, was es auch ist, es muss sehr schön sein, denn sie war von überirdischer Schönheit. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sich anfühlen muss, überirdisch schön zu sein?«
»Nein, das habe ich nicht«, gab Matthew offen zu.
»Ich schon oft. Was wären Sie am liebsten, wenn Sie die Wahl hätten: überirdisch schön, atemberaubend klug oder engelhaft gut?«
»Hm, also … ich weiß nicht genau.«
»Ich auch nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber eigentlich spielt es auch keine Rolle, denn es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich auch nur eins davon jemals sein werde. Engelhaft gut werde ich mit Sicherheit nie werden. Mrs. Spencer meint – oh, Mr. Cuthbert! Oh, Mr. Cuthbert!!!«
Das hatte Mrs. Spencer jedenfalls nicht gesagt. Das Mädchen war auch nicht von der Kutsche gefallen, noch hatte Matthew irgendetwas Ungewöhnliches getan. Sie waren einfach nur um eine Biegung gefahren und befanden sich nun auf der Chaussee.
»Chaussee« nannten die Leute von Newbridge ein etwa fünfhundert Meter langes Wegstück, das von den ausladenden Ästen der alten Apfelbäume überdacht wurde, die ein verschrobener Farmer dort vor langer Zeit gepflanzt hatte. Über ihren Köpfen wölbte sich ein duftender, schneeweißer Blütenbaldachin. Die Luft war von purpurnem Zwielicht erfüllt, und in der Ferne leuchtete der Himmel im Abendrot wie das bunte Fensterglas einer Kirche. Die Schönheit dieses Anblicks verschlug dem Kind die Sprache. Es lehnte sich zurück, faltete die schmalen Hände und wandte das verzückte Gesicht der weißen Pracht über sich zu. Selbst als sie das Wegstück hinter sich gelassen hatten und den lang gezogenen Hügel nach Newbridge hinunterfuhren, saß die Kleine immer noch regungslos da und gab keinen Ton von sich. Stumm und ergriffen betrachtete sie den Sonnenuntergang im Westen, während sie vor diesem leuchtenden Spektakel Bilder einer herrlichen Zukunft vorüberziehen sah. Auch auf dem Weg durch Newbridge, ein lebhaftes kleines Dorf, in dem ihnen Hunde nachbellten, kleine Jungen ihnen etwas zuriefen und neugierige Gesichter hinter den Vorhängen hervorspähten, blieben die beiden Reisenden stumm. Drei Meilen später hatte das Mädchen immer noch kein Wort gesagt. Offensichtlich konnte es ebenso lebhaft schweigen wie reden.
»Du bist bestimmt ziemlich hungrig und müde«, traute sich Matthew schließlich zu sagen, denn einen anderen Grund für die Stummheit das Mädchens konnte er sich nicht vorstellen. »Es ist nicht mehr weit, nur noch eine Meile.«
Mit einem tiefen Seufzen erwachte das Kind aus seiner Verzückung und sah ihn mit dem entrückten Ausdruck eines Menschen an, dessen Geist von den Sternen zurückkehrt.
»Oh, Mr. Cuthbert«, flüsterte es. »Diese Stelle, die wir gerade passiert haben – wo alles weiß war –, was war das?«
»Du meinst wohl die Chaussee«, sagte Matthew nach längerem gründlichen Nachdenken. »Sie ist recht hübsch.«
»Hübsch? Nein, hübsch scheint mir nicht das richtige Wort zu sein. Auch nicht schön. Beides sind viel zu kleine Worte. Oh, es war hinreißend – ja, hinreißend. Ich habe zum ersten Mal etwas gesehen, das ich mir selbst in meiner Fantasie nicht schöner hätte ausmalen könnte. Es hat mich mit Zufriedenheit erfüllt, hier« – sie legte eine Hand auf ihre Brust –, »aber gleichzeitig hat es auch ein bisschen wehgetan, obwohl es sich angenehm angefühlt hat. Haben Sie so einen Schmerz schon mal empfunden, Mr. Cuthbert?«
»Hm, nein, nicht dass ich wüsste.«
»Ich schon oft – immer, wenn ich etwas von überwältigender Schönheit sehe. Aber ein so herrlicher Ort sollte nicht einfach nur Chaussee heißen. Der Name sagt ja überhaupt nichts aus. Man sollte ihn – mal sehen – ›die Weiße Allee des Entzückens‹ nennen. Ist das nicht ein herrlich fantasievoller Name? Ich denke mir immer etwas Neues aus, wenn mir der Name eines Ortes oder einer Person nicht gefällt. Im Waisenhaus gab es ein Mädchen, das hieß Hephzibah Jenkins, aber für mich war sie immer Rosalia DeVere. Sollen die anderen Leute den Weg eben Chaussee nennen. Für mich wird es die Weiße Allee des Entzückens sein. Ist es wirklich nur noch eine Meile bis nach Hause? Das macht mich froh und traurig zugleich. Traurig, weil diese Fahrt so schön war, denn ich bin immer traurig, wenn etwas Schönes zu Ende geht. Möglicherweise kommt danach etwas noch Schöneres, aber da kann man nie sicher sein. Meistens wird es eher nicht schöner. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Trotzdem ist es ein wunderbarer Gedanke, nach Hause zu kommen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich noch nie ein echtes Zuhause, wissen Sie? Allein bei der Vorstellung, in ein echtes Zuhause zu kommen, verspüre ich wieder diesen angenehmen Schmerz. Ach, ist das herrlich!«
Sie waren gerade über eine Hügelkuppe gefahren. Unter ihnen schlängelte sich ein Teich so lang und gewunden dahin, dass er fast wie ein Bach aussah. Eine Brücke spannte sich mitten darüber, und von ihr bis an das untere Ende des Gewässers, das durch eine bernsteinfarbene Kette von Sandhügeln vom dunkelblauen Sankt-Lorenz-Strom abgetrennt wurde, glitzerte das Wasser in den schillerndsten Farben: von berückendem Safran und Rosa bis zu himmlischen Grün- und anderen kaum zu beschreibenden Farbtönen, für die es noch gar keinen Namen gab. Oberhalb der Brücke lag der Teich glasig und dunkel im Schatten des ihn umgebenden Kiefern- und Ahornwäldchens. Hier und da neigte sich ein blühender wilder Pflaumenbaum über das Ufer wie ein weiß gekleidetes Mädchen, das heimlich sein eigenes Spiegelbild betrachtet. Aus dem Sumpf am oberen Ende erschollen die melancholisch-süßen Rufe der Frösche. Auf der Anhöhe jenseits des Teiches lugte ein kleines graues Haus aus einem weiß blühenden Apfelgarten, und obwohl es noch nicht ganz dunkel war, leuchtete in einem seiner Fenster bereits Licht.
»Das ist der Barry-Weiher«, sagte Matthew.
»Oh, dieser Name gefällt mir auch nicht. Ich nenne ihn – mal sehen – ›den See des Glitzernden Wassers‹. Ja, das ist der richtige Name dafür. Ich erkenne das am Schauer. Jedes Mal, wenn ich den richtigen Namen finde, überläuft mich ein Schauer. Kennen Sie das Gefühl, Mr. Cuthbert?«
Matthew grübelte. »Hm, also, ja. Tatsächlich. Mich überläuft ein Schauer, wenn beim Umgraben der Gurkenbeete die hässlichen weißen Engerlinge nach oben kommen. Die mag ich gar nicht ansehen.«
»Ich glaube nicht, dass das die gleiche Art von Schauer ist, Mr. Cuthbert. Engerlinge und glitzerndes Wasser haben nicht sehr viel gemeinsam, oder? Aber warum nennen die Leute den Teich Barry-Weiher?«
»Wahrscheinlich, weil in dem Anwesen dort oben Mr. Barry wohnt. Das ist Orchard Slope. Ohne den Wald dahinter könntest du von hier aus schon Green Gables sehen. Aber dafür müssen wir noch über die Brücke und in einem Bogen drum herumfahren. Es ist noch eine halbe Meile entfernt.«
»Hat Mr. Barry kleine Töchter? Also, keine ganz kleinen – eher in meinem Alter?«
»Er hat eine, die ungefähr elf ist. Sie heißt Diana.«
»Oh! Was für ein hinreißender Name.«
»Hm, also, ich weiß nicht. Für mich klingt er ziemlich heidnisch. Mir ist Jane oder Mary oder etwas in der Art lieber. Als Diana auf die Welt kam, wohnte ein Lehrer bei ihnen, den haben sie den Namen aussuchen lassen, und er hat sie Diana genannt.«
»Ich wünschte, es wäre ein Lehrer da gewesen, als ich auf die Welt kam. Ah, da ist ja schon die Brücke. Ich werde die Augen fest zumachen, Mr. Cuthbert, denn ich fürchte mich vor Brücken. Ich stelle mir immer vor, dass sie genau dann, wenn ich in der Mitte bin, zusammenklappen wie ein Taschenmesser und mich zerschneiden. Also mache ich lieber die Augen zu. Allerdings muss ich sie trotzdem wieder aufmachen, wenn ich spüre, dass ich in der Mitte bin. Wenn die Brücke schon zusammenbricht, will ich wenigstens sehen, wie es passiert. Wie lustig es rumpelt! Das Gerumpel gefällt mir. Ist es nicht wunderbar, dass man so vieles mögen kann auf der Welt? Und schon sind wir drüben. Jetzt werde ich mich umdrehen. Gute Nacht, lieber See des Glitzernden Wassers. Ich sage den Dingen, die ich mag, immer Gute Nacht, genau wie den Menschen. Ich glaube, das gefällt ihnen. Das Wasser sieht aus, als würde es mir zulächeln.«
Als sie den nächsten Hügel hinaufgefahren waren und um eine Biegung kamen, sagte Matthew: »Jetzt sind wir fast da. Green Gables liegt …«
»Nein, sagen Sie es mir nicht«, unterbrach ihn die Kleine atemlos, hielt seinen halb erhobenen Arm fest und kniff die Augen zu, um die Geste nicht zu sehen. »Lassen Sie mich raten. Ich errate es bestimmt.«
Dann öffnete sie die Augen und sah sich um. Sie befanden sich auf der Kuppe des Hügels. Die Sonne war bereits untergegangen, doch die Landschaft war im sanften Abendlicht noch klar zu erkennen. Im Westen zeichnete sich vor dem orangefarbenen Himmel eine dunkle Kirchturmspitze ab. Darunter lag ein kleines Tal, in dem sich vor einer sanften Anhöhe hübsche Farmhäuser verteilten. In sehnsüchtiger Erwartung huschten die Augen des Mädchens von einem zum anderen. Schließlich verharrten sie auf einem Gehöft zur Linken, weit abseits der Straße, das inmitten blühender Bäume im Zwielicht des umliegenden Waldes mattweiß schimmerte. Direkt darüber leuchtete ein heller Stern am wolkenlosen Himmel, als wäre er Zeichen und Versprechen zugleich.
»Das ist es, nicht wahr?«, sagte das Mädchen und zeigte darauf.
Matthew gab dem Pferd begeistert die Zügel. »Donnerwetter. Du hast es erraten! Wahrscheinlich hat Mrs. Spencer die Farm so gut beschrieben, dass du sie erkennen konntest.«
»Nein, hat sie nicht. Wirklich nicht. Was sie gesagt hat, passt ebenso gut zu allen anderen Farmen. Ich wusste eigentlich nicht, wie Green Gables aussieht. Aber es hat sich sofort wie ein Zuhause angefühlt. Ach, es kommt mir vor wie ein Traum. Mein Arm muss voller blauer Flecken sein, so oft, wie ich mich heute gekniffen habe. Mir wurde immer wieder übel vor lauter Angst, dass ich das alles nur träume. Also habe ich mich jedes Mal gekniffen, zum Beweis, dass es auch wahr ist – bis mir plötzlich der Gedanke kam, dass, selbst wenn es ein Traum ist, ich lieber aufhören und weiterträumen sollte, solange ich kann. Deshalb habe ich das Kneifen sein lassen. Aber es ist wahr, und wir sind fast zu Hause.«
Mit einem glücklichen Seufzen verstummte das Mädchen. Matthew kutschierte unbehaglich weiter. Er war froh, dass Marilla und nicht er diesem heimatlosen Geschöpf beibringen musste, dass das Heim, nach dem es sich sehnte, nicht dieses hier sein würde. Sie passierten Lynde’s Hollow, wo es bereits dunkel war, aber nicht so dunkel, dass Mrs. Lynde sie von ihrem Fensterplatz aus nicht gesehen hätte. Dann ging es den Hügel hinauf und über den langen Fahrweg auf Green Gables zu. Als sie beim Haus anlangten, grauste es Matthew mit einer Vehemenz vor dem Moment der Wahrheit, die er sich nicht erklären konnte. Er dachte dabei weder an Marilla oder sich selbst noch an die Umstände, die dieses Missverständnis wahrscheinlich nach sich ziehen würde, sondern an die Enttäuschung des Mädchens. Wenn er sich vorstellte, wie das begeisterte Leuchten in den Augen des Kindes erlosch, hatte er das unangenehme Gefühl, gleich an einem Verbrechen mitzuwirken. Ganz ähnlich erging es ihm, wenn er ein Lamm, ein Kalb oder ein anderes unschuldiges kleines Wesen töten musste.
Die Hofreite lag fast im Dunkel, als sie ankamen, und die Pappeln um sie herum rauschten wie Seide.
»Hören Sie nur, wie die Bäume im Schlaf sprechen«, flüsterte das Mädchen, als Matthew es von der Kutsche hob. »Sie müssen etwas Schönes träumen.«
Die Reisetasche umklammert, die seine »gesamte irdische Habe« enthielt, folgte ihm das Kind ins Haus.
DREIMarilla Cuthbert erlebt eine Überraschung
Marilla kam eilig angelaufen, als Matthew die Tür öffnete. Doch beim Anblick der merkwürdigen kleinen Gestalt an seiner Seite in dem potthässlichen Kleid, mit den langen roten Zöpfen und den erwartungsvoll leuchtenden Augen, blieb sie vor Verblüffung wie angewurzelt stehen.
»Matthew Cuthbert«, rief sie aus. »Wer ist das? Und wo ist der Junge?«
»Da war kein Junge«, erwiderte Matthew unglücklich. »Nur sie.«
Er wies mit dem Kinn auf das Mädchen, als ihm einfiel, dass er es noch nicht einmal nach seinem Namen gefragt hatte.
»Kein Junge? Aber es muss ein Junge da gewesen sein«, beharrte Marilla. »Wir haben Mrs. Spencer doch geschrieben, dass sie einen Jungen mitbringen soll.«
»Das hat sie aber nicht. Sie hat das Mädchen mitgebracht. Ich habe den Bahnhofsvorsteher gefragt. Und ich musste sie mit nach Hause nehmen. Dalassen konnte ich sie schließlich nicht, egal wie das Missverständnis entstanden ist.«
»Das ist ja eine schöne Bescherung!«, rief Marilla.
Die Kleine hatte bei diesem Wortwechsel geschwiegen und nur stumm von einem zum anderen geblickt, während alles Leben aus ihrem Gesicht wich. Doch mit einem Mal schien sie die volle Bedeutung dessen zu begreifen, was gesagt worden war. Sie ließ ihre kostbare Reisetasche fallen, ging beherzt auf Marilla zu und rang die Hände.
»Sie wollen mich nicht!«, rief das Kind. »Sie wollen mich nicht, weil ich kein Junge bin! Das hätte ich mir denken können. Niemand hat mich je gewollt. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Ich hätte wissen müssen, dass mich wirklich niemand haben will. Was soll ich jetzt tun? Gleich muss ich weinen!«
Und das tat das Mädchen. Es ließ sich auf einen Stuhl am Tisch fallen und vergrub das Gesicht in den Armen, während es bitterlich zu weinen begann. Marilla und Matthew sahen einander über den Ofen missbilligend an. Keiner von beiden wusste etwas zu sagen.
Schließlich sagte Marilla kleinlaut: »Na, na, das ist nun wirklich kein Grund, so zu weinen.«
»Und ob es das ist!« Mit tränenüberströmtem Gesicht und zitternden Lippen hob das Kind den Kopf. »Sie würden auch weinen, wenn Sie eine Waise wären und geglaubt hätten, endlich ein Zuhause gefunden zu haben, und dann erfahren Sie, dass man Sie nicht haben will, nur weil Sie kein Junge sind. Das ist das Tragischste, was mir je zugestoßen ist!«
Ein zögerliches Lächeln, noch ganz eingerostet vom seltenen Gebrauch, stahl sich auf Marillas grimmige Miene. »Jetzt hör aber auf zu weinen. Wir setzen dich schon nicht vor die Tür. Du bleibst hier, bis wir der Sache auf den Grund gegangen sind. Wie heißt du?«
Das Mädchen zögerte einen Moment.
»Können Sie mich bitte Cordelia nennen?«, fragte sie dann gespannt.
»Cordelia? Ist das denn dein Name?«
»Na ja, nicht direkt. Aber ich würde gern Cordelia heißen. Es klingt so ungeheuer elegant.«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du damit meinst. Wenn du nicht Cordelia heißt, wie heißt du dann?«
»Anne Shirley«, kam es zögerlich von dem Mädchen. »Aber – ach, bitte nennen Sie mich doch Cordelia! Wenn ich ohnehin nicht lange hierbleibe, spielt es für Sie doch keine Rolle. Und Anne ist so unromantisch.«
»Unromantisch, papperlapapp!«, erwiderte Marilla verständnislos. »Anne ist ein schöner, schlichter und vernünftiger Name. Kein Grund, sich dafür zu schämen.«
»Oh, ich schäme mich nicht dafür«, erklärte Anne. »Mir gefällt Cordelia nur besser. Ich habe mir schon immer vorgestellt, dass ich eigentlich Cordelia heiße, zumindest in den letzten Jahren. Als ich jünger war, hab ich mir vorgestellt, Geraldine zu heißen, aber jetzt gefällt mir Cordelia besser. Wenn Sie mich Anne nennen müssen, dann schreiben Sie es bitte am Ende mit ›e‹.«
»Was spielt das für eine Rolle?«, fragte Marilla mit einem weiteren eingerosteten Lächeln, als sie die Teekanne in die Hand nahm.
»Oh, es macht einen gewaltigen Unterschied, denn es sieht viel schöner aus. Wenn Sie einen Namen hören, sehen Sie ihn dann im Geiste nicht auch geschrieben vor sich? Ich schon – und A-n-n sieht einfach schrecklich aus. A-n-n-e wirkt viel kultivierter. Wenn Sie mich Anne mit ›e‹ nennen, versuche ich, mich damit abzufinden, nicht Cordelia genannt zu werden.«
»Also schön, Anne-mit-›e‹, kannst du uns erklären, wie es zu diesem Missverständnis gekommen ist? Wir haben Mrs. Spencer wissen lassen, dass sie uns einen Jungen mitbringen soll. Gab es im Waisenheim keine Jungen?«
»Oh, doch, eine ganze Menge. Aber Mrs. Spencer hat ausdrücklich gesagt, Sie wollten ein etwa elfjähriges Mädchen. Und die Heimleiterin meinte, ich wäre die Richtige. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verzückt ich war. Vor lauter Freude habe ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ach«, fügte sie dann vorwurfsvoll an Matthew gewandt hinzu, »warum haben Sie mir am Bahnhof nicht gleich gesagt, dass Sie mich gar nicht haben wollen, und mich dagelassen? Wenn ich die Weiße Allee des Entzückens und den See des Glitzernden Wassers nicht gesehen hätte, wäre es jetzt nicht ganz so schrecklich.«
»Was, um alles in der Welt, meint sie damit?«, fragte Marilla, die Matthew anstarrte.
»Sie … sie spielt nur auf etwas an, über das wir uns unterwegs unterhalten haben«, erklärte Matthew hastig. »Ich bringe die Stute in den Stall, Marilla. Lass uns zu Abend essen, wenn ich wieder reinkomme.«
»Hat Mrs. Spencer außer dir noch jemanden mitgenommen?«, erkundigte sich Marilla bei Anne, als Matthew hinausgegangen war.
»Sie hat Lily Jones zu sich genommen. Lily ist erst fünf und wunderschön. Sie hat haselnussbraunes Haar. Wenn ich wunderschön wäre und haselnussbraunes Haar hätte, würden Sie mich dann behalten?«
»Nein. Wir wollen einen Jungen, der Matthew bei der Farmarbeit hilft. Ein Mädchen nützt uns nichts. Setz deinen Hut ab. Ich lege ihn mitsamt deiner Tasche auf das Tischchen im Hausflur.«
Anne nahm widerspruchslos ihren Hut ab. Kurz darauf kam Matthew zurück, und sie setzten sich an den Abendbrottisch. Doch Anne konnte nichts essen. Vergeblich knabberte sie an ihrem Butterbrot und stocherte in dem muschelförmigen Schälchen mit Apfelmus, das neben ihrem Teller stand. Sie kam einfach nicht voran.
»Du isst ja gar nichts«, sagte Marilla streng, während sie Anne musterte, als wäre das ein schweres Versäumnis.
Anne seufzte. »Ich kann nicht. Ich bin zutiefst verzweifelt. Können Sie denn essen, wenn Sie zutiefst verzweifelt sind?«
»Das weiß ich nicht, denn ich war noch nie zutiefst verzweifelt«, erwiderte Marilla.
»Nicht? Aber haben Sie sich jemals vorgestellt, zutiefst verzweifelt zu sein?«
»Nein, hab ich nicht.«
»Dann glaube ich, dass Sie mich nicht verstehen können. Es ist ein höchst unangenehmes Gefühl. Bei dem Versuch zu essen kriegt man einen dicken Kloß im Hals und bekommt nichts hinunter, nicht mal, wenn es Schokoladenkaramell wäre. Davon habe ich vor zwei Jahren mal eines gegessen. Es hat einfach himmlisch geschmeckt. Seitdem habe ich oft geträumt, ich hätte einen ganzen Berg von Schokoladenkaramellen, aber kurz bevor ich sie essen kann, wache ich jedes Mal auf. Ich hoffe, Sie sind nicht gekränkt, weil ich nichts essen kann. Das alles sieht sehr schmackhaft aus, aber ich bekomme trotzdem nichts herunter.«
»Sie ist wahrscheinlich müde«, meinte Matthew, der noch kein Wort gesagt hatte, seit er aus der Scheune zurückgekommen war. »Am besten bringst du sie ins Bett, Marilla.«
Marilla hatte sich schon gefragt, wo Anne schlafen sollte. Für den gewünschten und erwarteten Jungen hatte sie eine Liege im Windfang vorbereitet, der vom Hof in die Küche führte. Doch obwohl der Raum sauber und ordentlich war, schien er ihr für ein Mädchen nicht das Richtige zu sein. Andererseits kam das gute Gästezimmer für solch ein heimatloses Geschöpf ebenso wenig infrage, also blieb eigentlich nur das Zimmer im Ostgiebel. Marilla zündete eine Kerze an und forderte Anne auf, ihr zu folgen, die teilnahmslos ihren Hut und die Reisetasche vom Tischchen nahm, als sie im Hausflur daran vorübergingen. Der Flur war beängstigend sauber und wurde nur von dem kleinen Giebelzimmer im Obergeschoss übertroffen, in dem sie sich kurz darauf wiederfand.
Marilla stellte die Kerze auf ein dreibeiniges Tischchen und schlug die Bettdecke zurück.
»Ich nehme an, du hast ein Nachthemd dabei?«, erkundigte sie sich.
Anne nickte. »Ja, ich habe zwei. Die Heimleiterin hat sie für mich genäht. Sie sind schrecklich knapp. Im Waisenhaus mangelt es an allem, daher ist alles immer knapp – jedenfalls in einem armen Waisenhaus wie unserem. Ich hasse kurze Nachthemden. Aber man kann darin genauso gut träumen wie in einem schönen langen, mit Rüschen am Hals, das ist immerhin ein Trost.«
»Dann zieh dich schnell um und leg dich ins Bett. Ich komme in ein paar Minuten zurück und lösche die Kerze. Das übernehme ich lieber selbst, sonst setzt du uns womöglich das Haus in Brand.«
Nachdem Marilla gegangen war, sah Anne sich wehmütig um. Die weiß getünchten Wände starrten ihr so kahl und leer entgegen, dass ihre Blöße sie selbst schmerzen musste. Auch der Fußboden war nackt, bis auf eine geflochtene Baumwollmatte in der Mitte, wie Anne sie noch nie gesehen hatte. In einer Ecke stand das altmodische Bett mit vier dunklen gedrechselten Pfosten. In der anderen das bereits erwähnte dreieckige Tischchen, auf dem ein dickes rotes Nadelkissen aus Samt thronte, das allerdings so hart war, dass es selbst den vorwitzigsten Nadeln die Spitzen verbogen hätte. Darüber hing ein etwa fünfzehn mal zwanzig Zentimeter großer Spiegel an der Wand. Zwischen Tisch und Bett befand sich das Fenster mit einer eisgrauen Musselingardine davor und gegenüber der Waschtisch. Das ganze Zimmer strahlte eine Härte aus, die mit Worten nicht zu beschreiben war, aber Anne bis ins Mark erschaudern ließ. Mit einem Schluchzen entledigte sie sich ihrer Kleider, streifte das knappe Nachthemd über und sprang ins Bett, wo sie das Gesicht im Kissen vergrub und sich die Decke über den Kopf zog. Als Marilla zurückkam, um die Kerze zu löschen, lagen Annes schäbige Kleidungsstücke höchst unordentlich auf dem Boden verstreut, und nur das zerwühlte Bett wies darauf hin, dass sich außer Marilla noch jemand im Zimmer befand.
Sie hob Annes Kleidungsstücke eines nach dem anderen auf und legte sie ordentlich auf einen gelben Stuhl, ehe sie die Kerze nahm und damit zum Bett hinüberging.
»Gute Nacht«, sagte sie ein wenig sperrig, aber nicht unfreundlich, als urplötzlich Annes blasses Gesicht mit den großen Augen über der Bettdecke erschien.
»Wie können Sie von einer guten Nacht sprechen, wenn Sie doch wissen, dass es die schrecklichste Nacht meines Lebens wird?«, fragte Anne vorwurfsvoll.
Dann verschwand sie wieder.
Marilla ging langsam hinunter und machte sich an den Abwasch. Matthew rauchte – ein klares Zeichen von innerer Unruhe. Er rauchte nur selten, weil es in Marillas Augen eine schlechte Angewohnheit war, aber hin und wieder verlangte es ihn danach, und Marilla ließ es ihm durchgehen, denn sie verstand, dass ein Mann mitunter ein Ventil für seine Gefühle brauchte.
»Na, das ist ja ein schönes Malheur«, sagte sie schließlich verärgert. »Das kommt davon, wenn man Nachrichten verschickt, statt selbst hinzufahren. Robert Spencers Verwandte müssen die Nachricht irgendwie verdreht haben. Morgen muss einer von uns hinüberfahren und mit Mrs. Spencer sprechen, das ist klar. Dieses Mädchen muss zurück ins Waisenhaus.«
»Ja, wahrscheinlich«, sagte Matthew zögernd.
»Wahrscheinlich? Bist du dir denn nicht sicher?«
»Na ja, sie ist ein wirklich liebes kleines Ding, Marilla. Es tut mir irgendwie leid, sie zurückzuschicken, wo sie doch so gerne hierbleiben möchte.«
»Matthew Cuthbert, du willst doch nicht etwa sagen, dass wir sie behalten sollen!« Wenn Matthew ihr erklärt hätte, dass er nichts lieber täte, als tagaus, tagein auf dem Kopf zu stehen, hätte Marilla nicht erstaunter sein können.
»Also, nein, wohl eher nicht – nehme ich an«, stammelte Matthew, der sich in die Enge getrieben fühlte. »Ich denke … man kann wohl kaum erwarten, dass wir sie behalten.«
»Das finde ich auch. Wie soll sie uns schon nützen?«
»Vielleicht können wir ihr nützen«, sagte Matthew ganz überraschend.
»Matthew Cuthbert, ich glaube, dieses Mädchen hat dich verhext! Ich sehe doch klar und deutlich, dass du sie behalten willst.«
»Na ja, sie ist wirklich eine interessante kleine Person«, ließ Matthew nicht locker. »Du hättest sie auf der Fahrt vom Bahnhof reden hören sollen.«
»O ja, reden kann sie. Das hab ich schon bemerkt. Und das spricht nicht für sie. Ich mag keine Kinder, die so viel zu sagen haben. Ich will kein Waisenmädchen. Und selbst wenn, wäre sie nicht die, die ich mir aussuchen würde. Ich kann nichts mit ihr anfangen. Nein, sie muss postwendend dorthin zurück, wo sie herkam.«
»Ich könnte einen Franzosenjungen als Gehilfen anheuern«, schlug Matthew vor, und sie würde dir Gesellschaft leisten.«
»Ich brauche keine Gesellschaft«, erwiderte Marilla kurz angebunden. »Und ich werde sie nicht behalten.«
»Ja, natürlich, wie du meinst, Marilla«, sagte Matthew, als er aufstand und seine Pfeife weglegte. »Ich gehe zu Bett.«
Und das tat Matthew. Nachdem sie das Geschirr weggeräumt hatte, ging auch Marilla mit entschlossener Miene zu Bett, während sich im Ostgiebel ein einsames, liebeshungriges Kind in den Schlaf weinte.
VIERDer erste Morgen auf Green Gables
Es war heller Tag, als Anne aufwachte, sich im Bett aufsetzte und verwirrt zum Fenster sah, durch das eine Flut fröhlicher Sonnenstrahlen hereinströmte, während draußen etwas duftig Weißes vor dem blauen Himmel herumwedelte.
Einen Moment lang wusste sie nicht, wo sie war. Ein freudiges Gefühl überkam sie, als wäre etwas Wunderbares geschehen, doch dann holte eine schreckliche Erinnerung sie ein: Sie war auf Green Gables, aber man wollte sie nicht haben, weil sie kein Junge war!
Aber es war Morgen, und ja, dort draußen vor ihrem Fenster stand ein Kirschbaum in voller Blüte. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett und durchs Zimmer. Sie schob das Fenster hoch, das ruckelte und knarrte, als wäre es lange nicht mehr geöffnet worden – was stimmte –, und oben blieb, ohne dass Anne es befestigen musste.
Sie kniete sich hin und schaute mit glänzenden Augen in den Junimorgen hinaus. Ach, war das schön! Was für ein herrlicher Ort! Nicht auszudenken, wenn sie hierbleiben dürfte! Sie würde einfach so tun, als ob. Hier gab es genug Raum für Fantasie.