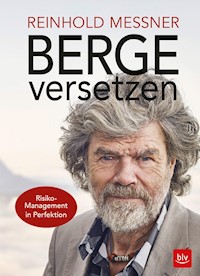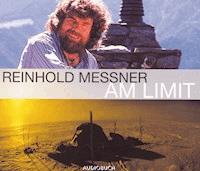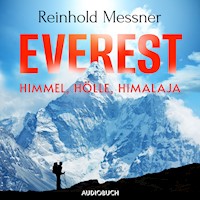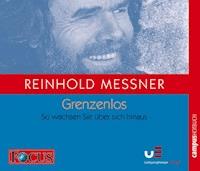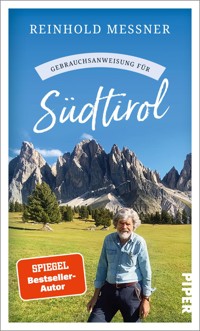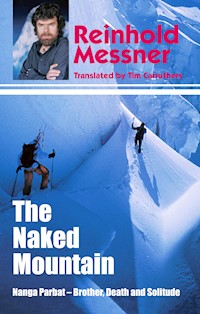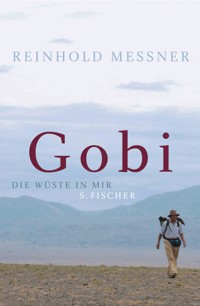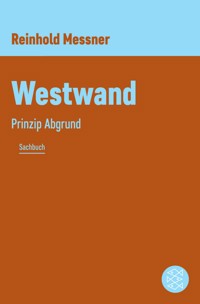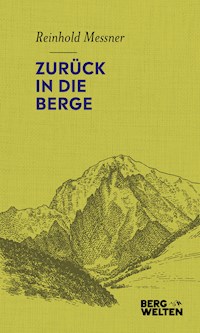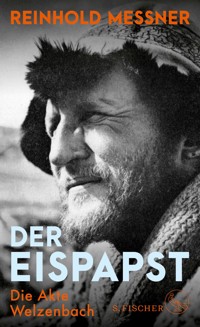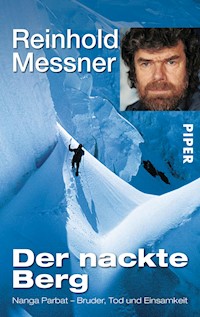12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1914 scheitert Ernest Shackleton spektakulär bei dem Versuch, die Antarktis zu überqueren – in seinem Buch »Wild« erzählt Reinhold Messner auf mitreißende Weise davon. Woran Shackleton und seine Männer noch scheiterten, haben Messner und Arved Fuchs zwischen dem 13. November 1989 und dem 12. Februar 1990 in die Tat umgesetzt – eine Durchquerung vom Rand des antarktischen Kontinents über die Thiel-Berge zum Südpol und von dort zur McMurdo-Bucht am Rossmeer, von wo die Südpolexpedition Robert F. Scotts gestartet war, die ein so tragisches Ende nahm. »Die letztmögliche Landreise auf dieser Erde«, hat Shackleton die Antarktis-Durchquerung genannt. Für Messner und Fuchs bedeutete diese Reise 2800 Kilometer Fußmarsch in 92 Tagen, Temperaturen bis zu minus 40°, Blizzards mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern. Aber Reinhold Messner ging es nicht um eine Eroberung im klassischen geographischen Sinn. Er hat ein Abenteuer gesucht: die Erfahrung der grenzenlosen Weite des Raums, des Alleinseins im schier Unendlichen, wo es kein menschliches Maß gibt und die Begriffe von Himmel und Hölle sich auflösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Reinhold Messner
Antarktis
Himmel und Hölle zugleich
Über dieses Buch
2800 Kilometer Fußmarsch in 92 Tagen. Temperaturen bis zu minus 40 °. Blizzards mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern. Was Ernest Shackleton, der 1914 bei dem Versuch scheiterte, die Antarktis zu überqueren, »die letztmögliche Landreise auf dieser Erde« genannt hat, haben Arved Fuchs und Reinhold Messner zwischen dem 13. November 1989 und dem 12. Februar 1990 in die Tat umgesetzt – eine Durchquerung vom Rand des antarktischen Kontinents über die Thiel-Berge zum Südpol und von dort zur McMurdo-Bucht am Rossmeer, von wo die Südpolexpedition Robert F. Scotts gestartet war, die ein so tragisches Ende nahm.
Reinhold Messner ging es nicht um eine Eroberung im klassischen geographischen Sinn: Er hat ein Abenteuer gesucht: die Erfahrung der grenzenlosen Weite des Raums, des Alleinseins im schier Unendlichen, wo es kein menschliches Maß gibt und die Begriffe von Himmel und Hölle sich auflösen.
»Messners Vorhaben ist es, durch die Reise in die Antarktis der absoluten Stille und unberührten Weite wieder einen Ort im Bewusstsein des gestressten Menschen zu verschaffen, einen weißen Raum, unendlich weit offen für Sehnsüchte, Träume und Phantasien.«
Wilhelm Schmid
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2002 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490832-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Vorrede
»Geh nicht!«
Der Plan
Punta Arenas
Patriot Hills
Endlich ausgesetzt
Sastrugis, nichts als Sastrugis
Die Reise in Farbbildern
Die Thiel-Berge
Wo ist der Pol?
Silvester am Südpol
Die Segel sind gesetzt
Die weisse Unendlichkeit
Entscheidung bei Gateway
Fluchtpunkt McMurdo
Nachspiel
Südpol-Chronik in Stichworten
Karte: Ungefährer Routenverlauf
Tafelteil
Bildnachweis
Für Magdalena, der die Antarktis so bleiben soll, wie sie Shackleton, Scott und Amundsen erlebt haben.
Als ich zum Südpol aufbrach, konnte Magdalena, meine Tochter, noch nicht sprechen. Als ich zurückkam, stellte sie mir viele Fragen:
Was hast du da unten gefunden?
Die Unendlichkeit.
Wie ist die Unendlichkeit?
Weiß, friedlich, still, und alles geht dort langsam.
So ist doch auch der Himmel?
Vielleicht ist das der Himmel.
Hast du in der Antarktis den Himmel gesucht?
Nein, ich habe dort nichts gesucht, dabei aber die weiße Unendlichkeit entdeckt.
Was muß ich tun, um die weiße Unendlichkeit zu sehen?
Dein Leben lang dafür streiten, daß die Menschen die letzte Wildnis nicht verbauen, verdrahten, umwühlen oder unter sich aufteilen.
»Geh nicht!«
Es war Herbst. Herbst nicht nur auf den Bergen um Juval, auch unten im Tal. Die Obstgärten leuchteten nicht mehr. Auf den vorgelagerten, sonst schwarzen Gipfeln der Ortlergruppe lag der erste Schnee. Die Kälte strahlte bis ins Tal hinab. Geruch von Fäulnis. Auf den Wiesen das Gebimmel von Kuh- und Schafglocken. Vor Wochen schon war das Vieh von den Almen gekommen. Die Bauern waren bei der Obsternte und froh, wenn das Vieh die Reste des im Sommer nicht gemähten Grases abweidete. So war es auch in meiner Kindheit gewesen. Hier also war ich daheim.
Seit drei Monaten aber lebte ich ausschließlich mit der Vorbereitung meiner Antarktis-Expedition. Ich las, plante, verhandelte mit Sponsoren und besprach mich mit Arved Fuchs, den ich zur Reise ins Eis eingeladen hatte. Material wurde getestet. Dann wieder war ich tagelang unterwegs, irgendwo auf einem Gletscher, um den Umgang mit dem Segel zu üben, das uns in der Antarktis helfen sollte, unsere Schlitten zu ziehen. Ich lernte es rasch. Ab und zu nächtigte ich im Freien. Zu Hause stand ich oft im Morgengrauen auf und zwang mich, den Weg von Schloß Juval, wo ich wohnte, hinein ins Schnalstal zu laufen und auf die Altrateiseralm. Ich trainierte sonst nicht, schon seit Jahren nicht mehr, aber die Angst ließ mich nicht schlafen.
500 Höhenmeter waren es, die ich steil bergan hetzte. Dann ein Quersteig, über den ich zu den Juvalhöfen und zurück ins Schloß kam. Ich keuchte, schwitzte. Bald fühlte ich mich körperlich fit. Trotzdem, die Ängste blieben. Ich spürte das Übergewicht, das ich mit mir herumschleppte, hatte ich mir doch ein Fettpolster ›angegessen‹, um in der Antarktis nicht zu frieren und Reserven zu haben für die monatelangen Strapazen. Ein Team von Ärzten hatte mir geraten, Fett anzusetzen und beim Training maßzuhalten. Denn die Gelenke mußten geschont werden für den 3000 Kilometer langen Marsch quer über den Eiskontinent.
Seit fünf Jahren war ich in Juval daheim. 1983 hatte ich eine Ruine erworben. Mit Hilfe einheimischer Handwerker hatte ich sie ausgebaut und so weit instandgesetzt, daß wir dort wohnen konnten, Sabine, Magdalena und ich.
Aber wie lange konnte ich es aushalten auf Juval? Ein Jahr vielleicht oder zwei. Noch war ich zu jung, um ein Stubenhocker zu werden. So sehr ich diese bürgerliche Sicherheit zu schätzen wußte, sie konnte mich nicht halten. Vielleicht würde ich später einmal die Gelassenheit und die Ausdauer haben, seßhaft zu werden und den Bergbauernhof am Fuß des Schlosses zu bewirtschaften.
Würde die Antarktis-Überquerung ein Abenteuer mit zu vielen Unbekannten werden? Immer wieder fuhr ich nachts aus dem Schlaf: von Angstträumen geplagt. Dieses unendliche Eis, »wo die Sünder in der Kälte steckten«, warf seine Schrecken voraus. Warum wollte ich ausgerechnet dorthin, wohin Dante die Schlimmsten seiner Feinde verbannt hatte, ins tiefste Inferno? Im Halbschlaf, wenn Bilder aus Dantes »Göttlicher Komödie« heraufdrängten, fror ich.
So waren fahl bis wo man schamrot wird
im Eise ganz erstarrt die Schmerzensschatten,
wie Storchenschnäbel schlugen ihre Zähne.
Nach unten war ein jeder Blick gesenkt,
laut klapperte ihr Mund vor grimmiger Kälte
und aus den Augen trieft’ die Qual des Herzens.
Da tropften ihre vorher feuchten Augen
hinunter auf die Lippen, und die Kälte
ließ durch die Tränen sie zusammenfrieren.
Wenn ich dann beim Laufen meine Energie spürte, wandelte sich die Antarktis in meiner Vorstellung von einem »See von Eis, der aussah so wie Glas und nicht wie Wasser unter kaltem Himmel« in ein Reich der Stille, des Friedens, der Unendlichkeit. Das war Dantes Paradies:
So löst sich an der Sonne auf der Schnee,
so auch verschwand einst der Sibylle Spruch,
im Wind auf leichten Blättern fortgewirbelt.
O höchstes Licht, das so weit übersteigt
die menschlichen Begriffe, leih ein wenig
von dem, wie du dich zeigtest, meinem Geist.
Ja, noch war die Sehnsucht nach der Wildnis übermächtig in mir, wie es auch nie ein weiches Bett und eine üppige Mahlzeit gewesen waren, an die ich mich später erinnerte, sondern Tage und Wochen bei Kälte und Hunger.
Meine Reisen hatten nichts mit Tourismus zu tun, diesem größten Industriezweig der Erde. Sie dienten auch nicht der Wissenschaft. Sie führten abseits aller Wege. Mir ging es beim Unterwegssein in der Wildnis nicht um die Welt draußen, sondern um die Welt in mir drin. Ich war der Eroberer meiner eigenen Seele.
Meine Reisen sollten keine Reichtümer zutage fördern noch der Menschheit irgend etwas beweisen. Vielleicht war es mir gelungen, ab und zu wenigstens, den Paradiesen im Eis, in der Wildnis des Himalaja, einen Teil jener Mythen zurückzugeben, die die Eroberer der Jahrhundertwende – Sven Hedin, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen – mit ihrem viktorianischen Entdeckergeist zerstört hatten. Verzichtete ich doch bei meinen Reisen bewußt auf technische Hilfe. Ich wollte den Menschen das Schützenswerte an der Wildnis bewußt machen, indem ich als Mensch dorthin ging. Die Antarktis, der Himalaja, Grönland waren ja auch ein Potential für menschliche Träume. Und deshalb von unschätzbarem Wert. Trotzdem war es für mich oft nahezu unmöglich, anderen meine Motivation begreiflich zu machen.
»Die meisten Menschen denken an ›Abenteuer‹, wenn das Wort ›Entdeckung‹ fällt. Deshalb will ich den Unterschied zwischen diesen beiden Ausdrücken vom Standpunkt des Entdeckers festlegen. Für den Entdecker ist das Abenteuer nur eine unwillkommene Unterbrechung ernster Arbeit. Er sucht nicht Nervenkitzel, sondern Tatsachen, die bisher unbekannt waren. Oft ist seine Entdeckungsfahrt nichts anderes als ein Wettlauf mit der Zeit, um dem Hungertode zu entgehen. Für ihn ist ein Abenteuer bloß ein Fehler in seinen Berechnungen, den die ›Probe‹ der Tatsachen aufgedeckt hat. Oder ist es ein unglückseliger Beweis dafür, daß niemand alle zukünftigen Möglichkeiten in Betracht ziehen kann? … Jeder Entdecker erlebt Abenteuer. Sie regen ihn an, und er denkt gerne an sie zurück. Aber er sucht sie niemals.«
Schloß Juval, heute Museum
So hat der Entdecker des Südpols, Roald Amundsen, den scheinbaren Widerspruch zwischen dem »Abenteuer« und seiner »Arbeit« aufgelöst. Für mich war es umgekehrt. Ich suchte zwar auch nicht den »Nervenkitzel«, wohl aber das Ausgesetztsein, um mich als Mensch zu entdecken. Abenteuer also als Selbstzweck. Dabei bin ich kein Masochist und habe keine Anlage zum Selbstmörder, auch nicht unbewußt. Ich halte es mit Robert Edwin Peary, dem Entdecker des Nordpols:
»Eingefrorene und blutende Wangen und Ohren sind die Unannehmlichkeiten, die zu einem großen Abenteuer gehören. Schmerz und Unbequemlichkeiten sind unvermeidlich, aber im Zusammenhang mit dem Ganzen gesehen, sind sie kaum wichtig.«
Ich fühlte mich wohl auf Juval. Ich hatte das historische Gebäude nach meinen Vorstellungen ausgestaltet. Trotzdem spürte ich den Drang in die Ferne. Die Nachbarn, Bauern, beobachteten mein Kommen und Gehen mit Skepsis. Ich wußte, daß es keine Freundschaft geben konnte zwischen mir und ihnen, solange ich nicht dablieb und lebte wie sie.
In Villnöß, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich unter der Nähe der Dorfbewohner gelitten. Die Schulfreunde, die Gastwirte, die für ihre Pensionen und Hotels mit meinem Namen warben, schickten mir bei Schlechtwetter ihre Touristen ins Haus. Sie störten mich in meiner Ruhe auf und brachten meinen Lebensrhythmus durcheinander. Auf Juval gab es eine Mauer um meinen Bereich. Ich hatte die Gewißheit, mein Leben leben zu können. Wie es meinen Vorstellungen entsprach.
Und trotzdem mußte ich gehen. Toni verstand es nicht. Toni, mein nächster Nachbar, war mir ein lieber Freund. Früher, als das Schloß langsam verfiel und die Mauern abbröckelten, hatte er die Aufsicht über das Gebäude gehabt. Dann, beim Wiederaufbau, hatte er mit Fleiß und Geschick geholfen. Er war Bergbauer, sechzig Jahre alt und ein naturbegabter Maurer. Er war immer da, wenn es galt, einen Pflasterweg anzulegen oder Mauerreste auszuflicken. Toni beriet mich, er liebte Juval. Zwischen uns war eine schweigende Freundschaft entstanden.
Als Toni hörte, daß ich zum Südpol aufbrechen wollte, wußte er nicht genau, was er sich darunter vorstellen sollte. Er beobachtete mein Training mit Kopfschütteln. Das Beladen des Wagens, mit dem ich immer wieder Teile der Ausrüstung nach München transportierte, wo das Expeditionslager war, gefiel ihm noch weniger. Sein Mißtrauen wuchs. Was hätte ich ihm sagen sollen? Wie der Südpol definiert wird?
»Der geographische Südpol ist der mathematische Punkt, den die gedachte Achse der Erdrotation durchsticht, auf dem sich die Meridiane vereinigen, auf dem es nur noch die Nordrichtung gibt, wo der Wind nur aus Norden kommt und nach Norden weht und der Magnetkompaß stets nach Norden zeigt, wo die Zentrifugalkraft der Erde aufhört und die Gestirne nicht mehr auf- und untergehen.«
Warum war die Antarktis dem »einfachen Mann« so fremd? Sicher, weil sie so weit entfernt war. So unzugänglich. Es kamen fast ausschließlich ökologische, politische und wissenschaftliche Probleme zur Sprache, wenn es in den Medien um die Antarktis ging. Wer war schon dort gewesen?
Die ersten Landexpeditionen, die um die Jahrhundertwende stattgefunden hatten, waren vergessen, wenn man vom Tod des »unsterblichen« Captain Scott absieht. Und die Nationen, die ihre wissenschaftlichen Basen dort unterhielten und damit ihre Claims absteckten, wußten die Antarktis aus dem öffentlichen Interesse auszugrenzen. Dieser Kontinent war für die meisten von uns so weit weg wie der Mond und kälter als das Weltall. Wir konnten ihm gegenüber keine Gefühle entwickeln. Daß die Antarktis wichtig war für den Wasserhaushalt, das Klima, das Leben auf dieser Erde, glaubten wir den Fachleuten, wie wir an die Relativitätstheorie von Einstein glauben. Aber wir empfanden nicht viel dabei. Der Südpol war ein geographisches Neutrum.
Ich wollte von unserer Reise ein Gefühl heimbringen. Ein Gefühl für die Landschaft, Hoffnung für ihr Überleben. Ich wollte der Antarktis ein menschliches Maß geben. Nur wenn Millionen von Menschen Gefühle für dieses Stück Erde entwickelten, konnte ein »Naturpark Antarktis« durchgesetzt werden.
Der Südpol war für Toni das Gegenstück zum Nordpol. Ein Etwas auf der anderen Seite der Welt. Weit weg. Gab es Eisbären dort?
Anfang Oktober, als mich Toni wieder einmal dabei beobachtete, wie ich meinen Wagen vollpackte mit Ausrüstungsgegenständen, winkte ich ihm zu. Vielleicht sah es aus, als wäre mein Gruß ein Abschied für Monate. Toni kam heran.
»Wo geht es diesmal hin?«
»In die Antarktis, das habe ich dir schon erzählt.«
»Also nicht zum Nordpol?«
»Nein«, sagte ich, »genau auf die andere Seite der Welt, zum Südpol. Wir wollen zum Südpol und die Antarktis überqueren.«
Ich merkte, daß die geographischen Angaben für Toni keine Bedeutung hatten. Er kannte nicht viel mehr als die Höfe ringsum, Bozen und Meran. Aber er wußte, was es bedeutete, bei 30 Grad Kälte einen Zaun zu reparieren, mit bloßen Händen Steine zu schleppen oder Eisen zu handhaben. Er konnte sich vorstellen, was es bedeutete, bei 40 Grad unter Null zu überleben.
»Bleib daheim!« sagte Toni. Es klang wie ein Befehl. »Jetzt, wo du alles hast, wo das Schloß repariert ist, wo du ein Kind hast. Bleib doch da!«
Ich sagte, ich könnte diese Expedition nicht mehr absagen, alles sei schon festgelegt.
Er schüttelte den Kopf und sagte: »Wenn du daheim bleiben willst, kannst du daheim bleiben.« – Und er hatte recht.
Die Vorbereitungen für diese Expedition liefen seit drei Jahren. Ich hatte Sponsoren gefunden, eine Logistik entwickelt und Ausrüstungsgegenstände gebastelt. Zwei Jahre vorher hatte ich den idealen Partner für diese Reise gefunden: den norddeutschen Abenteurer und Seemann Arved Fuchs, der für die Bereiche der Expedition die Verantwortung übernahm, für die mir die Erfahrung fehlte: die Navigation, das Funkgerät, das Zusammenstellen der Nahrungsmittel im Detail.
»Jetzt bist du fünf Jahre auf Juval«, setzte Toni das Gespräch fort. »Ja, fünf Jahre, und es ist schön hier.«
»Ja«, sagte ich, »es gefällt mir.«
»Dann bleib doch! Warum mußt du denn immer wieder weg?«
Robert Falcon Scott sollte der »Held« des Südpols werden.
Toni, der jahrzehntelang auf Juval die Verantwortung getragen hatte, der aufgepaßt hatte, daß nicht noch die Balken, die letzten Täfelungen aus der Ruine verschwanden, liebte dieses Gebäude aus dem 8. Jahrhundert ebenso wie ich. Vorher war auf dem Hügel von Juval eine Art Festung entstanden. Errichtet von den Langobarden, die von Norden nach Süden durchzogen. Im 13. Jahrhundert dann haben adelige Herren eine Burg auf dem Felsen gebaut und dort residiert. Im 16. Jahrhundert hat der Kellermeister der Herren von Tirol, Sinkmoser, die zerfallende Burg erworben und wiederhergerichtet. Er, der Norditalien bereist hatte, in der Toskana gewesen war, hat die düsteren Burgmauern auf dem sonnigen Granithügel von Juval in ein stolzes Renaissancegebäude verzaubert. Danach verfiel das Schloß wieder. Zweihundert Jahre lang war es in der Hand von Bergbauern. Nur die Fundamente und Mauern blieben erhalten. Glücklicherweise hat es 1913 ein holländischer Kolonialherr erworben, der in Malaysia Kautschuk- und Teeplantagen besessen hatte. Auf einer Skitour ins Schnalstal hatte er es entdeckt und sofort gekauft. Nachdem er seine Kolonien in Malaysia verloren hatte, zog er 1924 nach Juval. Mit Einfühlungsvermögen und Geschmack baute er die Anlage wieder auf und gab so dem ehemaligen Renaissancegebäude jenes stolze und gleichzeitig verspielte romantische Gesicht, das mir sofort auffiel. Als ich diesen versteckten Hügel 1983 vom Tal aus erstmals erspäht hatte, fuhr ich hinauf – und verliebte mich auf Anhieb.
Ich habe viel Energie, Begeisterung und Kreativität in die alten Gemäuer gesteckt. Dieses Schloß beflügelte meine Phantasie. Nicht nur, weil es mein »Heim« werden sollte, meine »Festung«, mein »Nest«, sondern vor allem, weil es eine Geschichte hatte. Ich brauchte einen Hafen für die Zeit zwischen den Expeditionen, für spätere Jahre, für die Monate nach der Rückkehr. Auch lag mir dieses Stück von Südtirol am Herzen, weil es zu jener Natur- und Kulturlandschaft gehört, die ich, trotz meiner Reisen nach Tibet und Südamerika, zu den schönsten Flecken auf dieser Erde, lieber mochte als jede andere Gegend.
Hier also war ich zu Hause. Mein nomadenhaftes Reisen stand für mich in keinem Widerspruch dazu. Ich brauchte es ebenso wie dieses Daheim. Ich kannte auf Juval jeden Stein, jeden Baum, jeden Strauch und hatte den Ehrgeiz, diesen Burghügel so zu erhalten, wie er vor Hunderten von Jahren gewesen war. Soviel Ruhe, soviel Harmonie hatte ich sonst nur bei tibetischen Klosterfestungen gefunden.
»Geh nicht!« wiederholte Toni. »Du hast ja alles erlebt. Bisher ist alles gutgegangen. Denk daran, was alles hätte passieren können. Geh nicht!«
Toni hatte recht, und er war nicht der einzige, der mich zu warnen versuchte.
Vor dieser Expedition kamen zahlreiche Anrufe, Briefe von Freunden, und bei allen klang dieselbe Sorge durch. Offenbar waren die Befürchtungen diesmal größer als bei meinen früheren Expeditionen, bei Reisen, die ich in Afrika, im Hindukusch, im Himalaja unternommen hatte. Die Achttausender in Tibet waren gefährlich gewesen – doch der Marsch zum Südpol würde noch mehr Einsamkeit, Verlorensein, Lebensgefahr bedeuten.
Auch mochte der Gedanke an die früheren Expeditionen von Shackleton, Scott und Amundsen, die viele von uns aus der Literatur kennen, die Bedenken gegen meinen Plan verstärkt haben.
Vielleicht waren bei dieser Expedition meine Zweifel und Ängste auch deshalb größer als in den zehn Jahren zuvor, in denen ich regelmäßig, Jahr für Jahr, in den Himalaja aufgebrochen war, weil mir die Erfahrung im Eiswandern fehlte. Andererseits hatte ich in den letzten fünf Jahren gemerkt, daß mich gerade diese Spannung, solche Zweifel und Ängste bei den früheren Achttausender-Expeditionen sogar beflügelt hatten. In diesem Spannungsbogen zwischen Begeisterung und Angst, zwischen dem Um-die-Gefahren-Wissen und dem Die-Gefahren-Fürchten war jene Energie entstanden, die mich über mich selbst hatte hinauswachsen lassen.
Ich hatte ein Leben lang von Abenteuern geträumt. Vierzig Jahre lang hatte mich niemand von meinen Vorhaben abbringen können. Nicht die Eltern, nicht die Lehrer, nicht meine Kritiker. Habe ich nicht das Recht, mein Leben einzusetzen, um es leben zu können?
Doch die Worte von Toni gingen mir unter die Haut. Vielleicht deshalb, weil er mehr über das Leben wußte als ich. Seine Einwände wogen schwerer als die eines Intellektuellen. Toni ging es nicht darum, daß da einer aus dem bürgerlichen Leben ausscherte und sein Abenteuer suchte. Er wußte auch, daß der Mensch fähig war, über Monate unter derart harten Umweltbedingungen, wie sie in der Antarktis zu erwarten waren, zu überleben: -30 ° C, immer Wind, immer allein. Ihm ging es darum, den Nachbarn nicht zu verlieren.
Es gab in Südtirol kaum eine Tradition hinsichtlich der Arktis und Antarktis. Obwohl dieser Landstrich seit zweihundert Jahren viele tüchtige Bergsteiger und Bergführer hervorgebracht hat: An den Polen war noch kein Südtiroler gewesen. Drei haben 1983 Grönland durchquert, und zwei Bergbauern aus dem Passeiertal, Johann Haller und Alexander Klotz, hatten 1872 Julius Payer, den berühmten Erschließer der Ortlergruppe, in Richtung Nordpol begleitet. Das war alles. Sie waren Teilnehmer jener berühmt gewordenen Tegetthoff-Expedition gewesen, die Franz-Josef-Land entdecken sollte. Uns Südtiroler hat es nicht zu den Polen gezogen.
In den Wochen vor der Abreise kam es nicht selten vor, daß mich jemand auf der Straße anredete und fragte: »Aha, nach Alaska geht es diesmal?« Geduldig antwortete ich. Immer wieder dasselbe: »Nein, in die Antarktis.« Um es eindeutig zu machen, betonte ich meist, es ginge zum Südpol.
Der Südpol war nur eine Station auf dieser Reise. Natürlich ein Schlüsselpunkt. Wir wollten, von der südamerikanischen Seite kommend, über den antarktischen Kontinent zum Südpol marschieren und über die andere, Neuseeland zugekehrte Seite der Antarktis nach McMurdo zum Meer gehen. Teilweise auf jener Route, auf der Scott den Südpol 1912 erreicht hatte und auf dem Rückweg dann umgekommen war.
Toni ließ sich nicht abschütteln. Er insistierte: »Geh nicht!« Und weiter: »Du hast es nicht mehr nötig. Du hast gezeigt, daß du alles kannst. Du mußt es doch nicht immer wieder beweisen.«
»Ja«, sagte ich, »das stimmt. Ich muß nichts mehr beweisen. Aber ich muß dort hin. Ich kann nicht ein Leben lang hier auf Juval sitzen. Juval ist fertig. Es ist ein phantastischer Ort. In Juval bin ich daheim, auf Dauer aber nicht glücklich. Und ich komme ja wieder. Magdalena zuliebe, dir zuliebe, Sabine zuliebe. Euch allen zuliebe. Vor allem auch mir zuliebe. Ich hänge am Leben, und«, sagte ich schmunzelnd, »ich bin hier so gerne, Toni, du kannst sicher sein, ich komme wieder!«
Schloß Juval, Ruinenteil
Ich verabschiedete mich, fuhr den steilen Bergweg hinunter ins Tal. Nach Süden hin konnte ich einen Teil des Schloßberges sehen. Dort stand die Ruine, die ich als Zen-Garten gestaltet und sonst belassen hatte, wie sie gewesen war. Ein stehender Stein dort symbolisierte den Berg, ein liegender die Wüste.
Ich schlief schlecht. Seit Tagen nahm ich Schlaftabletten. Es half nichts. Gegen drei Uhr früh wachte ich auf, manchmal in Angstschweiß gebadet, manchmal verzweifelt. Die Phantasie spiegelte mir die Antarktis vor. Wie im Film. Gegen derartig viele Eindrücke kam keine Planung an. Immer öfter tauchten die Ängste auf. Ängste, wie ich sie als Fünfjähriger erlebt hatte, unter meinem ersten Berg. Als Fünfzehnjähriger, unter meiner ersten großen Dolomitenwand vor der ersten extremen Klettertour. Ängste wie damals, als ich, fünfundzwanzigjährig, 1970 zur Rupalwand am Nanga Parbat aufgebrochen war, zur höchsten Fels- und Eiswand der Erde, meinem ersten Achttausender. Nochmals zehn Jahre später hatte ich ähnliche Ängste erlebt, als ich mich anschickte, allein und ohne Sauerstoffgerät mitten im Monsun auf den Gipfel des Mount Everest zu klettern. Jetzt, mit fünfundvierzig, packten mich diese Ängste bei dem Gedanken an die Antarktis-Überquerung.
Die Widerspruch war offenkundig: Einerseits gab das Umsteigen von einer Form des Abenteuers auf eine andere mir einen Schub an Energie und Begeisterung, andererseits erlebte ich diese lähmenden Ängste.
In meinen Angstträumen sah ich mich z.B. mit jemandem, der nicht zu identifizieren war, in eine unendliche Schneefläche hineingehen. Es waren nicht die Weite der Landschaft, nicht das Weiß, die mich beunruhigten. Es war die innere Leere, die mich erschreckte. Dieses Ausgesetztsein, ein Gefühl von Ausweglosigkeit, weil kein Weg da war. Ich hatte Sinnlosigkeit vorher nie so vehement erlebt. Am Berg gibt es ein Oben und Unten. Der Landweg hat eine Richtung. Die Antarktis hingegen war unendlich und ohne jeden Anhaltspunkt. Ich wußte nicht, wo diese Bilder herkamen. Ich hatte die Antarktis nur als Bergsteiger kennengelernt. Und sie hatte mich begeistert. Vorerst war alles nur ein Projekt. Noch war ich kein Eiswanderer. Ich wußte, daß ich in der Antarktis umkommen konnte, aber ich glaubte zu überleben. Glaube ist stärker als Wissen.
Sir Ernest Shackleton
Nachdem ich die Historie der geographischen »Eroberung« der Antarktis studiert hatte, wurde meine Angst vor einem Scheitern größer. Die ersten Forscher, vor allem jene, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts versucht hatten, zum Südpol und wieder zurück zu kommen, waren mir vertraut: Shackleton, Amundsen, Scott. In ähnlicher Weise wie sie wollten auch wir zum Südpol und weiter: aus eigener Kraft, mit den einfachsten Mitteln. Den Stürmen, der Kälte, der Einsamkeit ausgesetzt. In derselben unendlich großen Weite.
Durch mein Abenteuerleben setzte ich mich seit Jahren einer wachsenden Kritik aus. Ein Teil der Kritik kam von Naturschützern, die meinten, ich würde die letzten Urlandschaften auf dieser Erde der Fremdenverkehrsindustrie schmackhaft machen. Ein zweiter Teil kam von Bürgern, die sich indirekt über sich selbst ärgerten, wenn sie sahen, daß da einer seine Träume mit letzter Konsequenz auslebte. Ich verstand die Anliegen der Naturschützer und versuchte, bei meinen Reisen keine Spuren zu hinterlassen. Vor allem aber verstand ich eine dritte Gruppe von Kritikern: meine nächsten Nachbarn. Sie hielten mein Tun für unverantwortlich. Daß da einer mit seiner bürgerlichen Verantwortung umging, wie er allein es für richtig hielt, war ein Affront gegen ihre Moral. Daß ich trotz Familie monatelang aus den alltäglichen Zwängen ausstieg, um meinen privaten Zwängen zu folgen, war für sie nicht zu rechtfertigen. Also versuchte ich es gar nicht erst. Ich nahm die Kritik hin und stand zu meinem Egoismus. Und der besagt: nur dann, wenn ich immer wieder meinen Körper und meinen Geist bis an den Rand ihrer Möglichkeiten führe, bin ich ganz ich. Ich bin überzeugt davon, daß die Menschheit friedlicher wäre, würde jeder dann und wann die Möglichkeit haben, sich bis an den Rand seiner Fähigkeiten zu verausgaben. Frieden setzt nicht nur freie Nationen voraus, Frieden ist nur möglich, wenn alle Menschen sich als ganze Menschen entfalten können.
Der Plan
Dreimal hintereinander hatte ich versucht, in die Antarktis zu kommen. 1983, 1984 und 1986. Im Dezember 1986 endlich landete ich am Fuß der Ellsworth-Berge. Um den Mount Vinson besteigen zu können, war ich mit zwei Freunden, Oswald Oelz und Wolfgang Thomaseth, um die halbe Welt geflogen. Mit knapp 5000 Meter Meereshöhe ist der Mount Vinson der höchste Berg der Antarktis. Er zählt zu jenen sieben Bergen, die ein paar Kletterfreaks als die »Seven Summits« bezeichneten: die jeweils höchsten Berge der Kontinente Europa, Asien, Südamerika, Nordamerika, Afrika, Ozeanien, Antarktis. Seit Jahren spielten ein paar reiche Wohlstandsalpinisten ein Spiel, das so dumm war wie jener Tourismus, der lediglich Sehenswürdigkeiten abhakt. Auch ich spielte mit. Ich hatte den höchsten Berg Südamerikas, den Aconcagua, über die Südwand bestiegen; den Mount McKinley über die »Wand der Mitternachtssonne«. Den Elbrus als höchsten Gipfel Europas hatte ich im Schneesturm erlebt. Zweimal hatte ich auf dem Mount Everest gestanden und zweimal auf dem Kilimandscharo. In Ozeanien, dem Erdteil, zu dem auch Australien gehört, hatte ich die Carstensz-Pyramide auf Neuguinea bestiegen. Nun »mußte« ich auch den Mount Vinson schaffen, wollte ich bei diesem kindischen Spiel um die »Seven Summits« nicht zurückstehen. Die Summe dieser Gipfelbesteigungen ergab keine besondere Leistung, aber sie beeindruckte das Medienpublikum.
Sechs der sieben Berge kannte ich seit Jahren. Der Ehrgeiz, mit dem Mount Vinson den siebten zu besteigen, war größer als der Wunsch, den siebten Kontinent zu erleben.
Die Antarktis beschäftigte meine Phantasie. Vage kannte ich die Bücher von Scott und Amundsen, die Expeditionen von Filchner und Shackleton, die zu Beginn des Jahrhunderts versucht hatten, die Antarktis zu überqueren. Meine übrigen Informationen über den Eiskontinent liefen auf das Klischee – steril, unvorstellbar groß, kalt – hinaus. In der Schule hatten wir Scotts Tagebuch gelesen, eine heldenhafte und traurige Geschichte, von der mir das Ende in Erinnerung geblieben war. Am 29. März 1912 starb Robert F. Scott, 18 Kilometer vom nächsten Vorratsdepot entfernt, im Schneesturm. Mit dem Vorrat von 30 Opiumtabletten dämmerte der Engländer in seinem Zelt dem Kältetod entgegen.
Fasziniert war ich von Ernest Shackletons dritter Antarktis-Reise. Nach seinem gescheiterten Versuch, den Südpol zu erreichen, hatte dieser Haudegen den kühnen Plan entwickelt, die Antarktis zu überqueren. Der polarerfahrene »Shack«, wie ihn seine Männer nannten, war der zweite Mann, der den Entschluß faßte, den Eiskontinent von einer Seite zur anderen zu überqueren. »Shack« sollte es viel schlimmer ergehen als dem Deutschen Filchner. Als er in den letzten Monaten des Jahres 1914 auf seinem eisenverstärkten Schiff, das den Namen »Endurance« (»Ausdauer«) trug, in den Südatlantik fuhr, begann eine einmalige Odyssee. Das Schiff kam nicht einmal so weit wie die »Deutschland« unter Kapitän Filchner. Ohne anzulegen, ohne die antarktische Küste auch nur zu sehen, lief Shackletons »Endurance« im Packeis fest und fror ein. Sie wurde von den aufgetürmten Schollen zermalmt und sank. Wie Sir Ernest und seine Männer in monatelanger Schlepparbeit weiterkamen, den Winter unter Beibooten verbrachten, auf dem treibenden Eis und auf sturmgepeitschten Felseninseln überlebten und zuletzt alle gerettet wurden, ist eine der aufregendsten Abenteuergeschichten überhaupt.
Meine Reise in die Antarktis 1986 hatte ich über »Adventure-Network-International« (ANI) organisiert. Diese private kanadische Organisation, die Bergsteiger und Touristen in die Antarktis fliegt, ist noch jung. Um das Innere der Antarktis zu erschließen, hatte eine Handvoll Outdoor-Spezialisten und Piloten eine Logistik aufgebaut, die es erlaubte, mit zweimotorigen Twin-Otters von Punta Arenas in Südchile bis zu den Ellsworth-Bergen zu kommen. An der antarktischen Halbinsel entlang flogen wir bis zu einem Basecamp auf etwa 2000 m Höhe. So war der Mount Vinson auch Bergsteigern, die nur zwei Wochen Zeit hatten, zugänglich.
Nachdem ich mit »Wolfi« Thomaseth, dem Südtiroler Kameramann, und Dr. Oswald Oelz, meinem Expeditionsfreund aus vielen Jahren, den Gipfel erreicht hatte, blieb im Basislager noch eine Menge Zeit, ehe uns der erfahrene Polpilot Giles Kershaw mit der »Twotter«, wie er sein weiß-rotes Flugzeug liebevoll nannte, abholen konnte.
Testlauf mit Schlitten, 1986
Ich saß mitten in der Antarktis. Der Mount Vinson war einfacher zu besteigen gewesen, als ich erwartet hatte. Der Wind hatte zwar ständig an unseren Kleidern gezerrt, und die Kälte war uns bis unter die Haut gekrochen, aber trotzdem: die Antarktis war zugänglich. Das war der Eindruck, der mir blieb. Im Basislager diskutierte ich mit »Wolfi« Thomaseth die Möglichkeit, Shackletons Plan in die Tat umzusetzen. »Wolfi« hatte mit Robert Peroni und Sepp Schrott, zwei weiteren Südtirolern, im Sommer 1983 Grönland durchquert. In 88 Tagen hatten sie eine Strecke von knapp 1100 Kilometern zurückgelegt und die Proviantschlitten selbst gezogen. War es möglich, in diesem Stil quer über den antarktischen Kontinent zu laufen? 3000 Kilometer in 120 Tagen? Mit dem ANI als logistischer Unterstützung? Vielleicht ja.
In diesen Tagen begann ich, mit einem Schlitten, der im Camp herumlag, Versuche zu machen. Ich belud ihn mit 80 Kilogramm und zog ihn über die Schneefläche. Ich schaffte gut vier Kilometer in der Stunde. Die theoretische Rechnung ergab, daß ich einen etwa 80 Kilogramm schweren Proviantschlitten in 100 Tagen 3000 Kilometer weit über die Antarktis ziehen konnte. Ich begann weiterzurechnen: In vier Monaten, zwei Depots vorausgesetzt, konnte ich von der einen Seite der Antarktis bis zur anderen gelangen. Über den Südpol. Der Marsch, den Shackleton »die faszinierendste Landreise auf dieser Erde« genannt hatte, war denkbar. Und er stand noch offen. Eine einmalige Problemstellung! 1989, 75 Jahre nach Shackletons Aufbruch, wollte ich eine Reise beginnen, wie sie niemand vorher auch nur versucht hatte. Ich wollte die Antarktis, die größer ist als Australien, aus eigener Kraft durchmessen: nicht mit Hundeschlitten, wie Filchner und Shackleton es vorgehabt hatten, nicht mit Flugmaschinen und kettengetriebenen Motorfahrzeugen wie die modernen Eroberer, sondern zu Fuß. Auf Skiern. Den Schlitten mit Proviant und Ausrüstung selbst schleppend. Kein Abgasqualm, kein Motorenlärm, nur das Knirschen der Skier und Schlittenkufen auf der Schneekruste. Das war mein Stil! Ein Marsch durch die unabsehbare weiße Wüste.
Damals, auf der Heimreise vom Mount Vinson, hörte ich erstmals von der Idee »Weltpark Antarktis«. Auf unserer überfüllten Erde galt die Antarktis als eine Art Traumland. Die Luft dort ist rein, die Sommersonne scheint länger als in Südeuropa. Im Winter herrscht immer Nacht. Was war, wenn sich die Umweltschützer nicht durchsetzten? Das Tauziehen um die Antarktis hatte längst begonnen. Die Ressourcen, die unter dem Eis vermutet wurden, lockten immer mehr Nationen auf den Siebten Kontinent. Aber wer zeigte den Menschen, wie einmalig und deshalb schützenswert die Antarktis war? Die sie ausbeuten wollten, sicher nicht.
Die Antarktis ist das kälteste, trockenste, stürmischste, unzugänglichste und lebensfeindlichste Gebiet der Erde. Gleichzeitig der friedlichste aller Kontinente: Himmel und Hölle zugleich. Dort wächst so gut wie nichts, obwohl 70 % des Süßwassers der Erde in der gigantischen Eiskappe gespeichert sind.
Überleben konnten auf dem Eiskontinent bisher nur »offizielle Expeditionen«, also Wissenschaftler, die in den nationalen Forschungsstationen arbeiteten. Diese Eiswüste am Rand der Welt war trotzdem ein Paradies geblieben. Hier war der Weltfriede noch Wirklichkeit. Seit 1959 ist die Antarktis ein waffenfreies Territorium, es gibt einen funktionierenden Vertrag, der die Anwesenheit von Menschen regelt. Jeder Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen ist oder der von den Vertragspartnern eingeladen wird, kann dem Vertrag beitreten.[1]
Erster Erfolg der Zusammenarbeit war ein Abkommen über die Erhaltung der antarktischen Meeresfauna und der Versuch, wissenschaftliche Daten untereinander auszutauschen. Ist der Antarktis-Vertrag nicht von zu vielen materialistischen Überlegungen bedroht? Die einen glauben, daß mit den Bodenschätzen, die unter der antarktischen Eiskappe liegen, Riesengewinne zu erzielen seien. Andere errechnen sich Umsätze mit dem Verkauf von Technologie für die Förderung von Öl oder durch den Tourismus.
Große Ölfelder, Edelmetallvorkommen und Tourismus sind die Magnete, die immer mehr Menschen in die Antarktis locken, nicht die ursprüngliche, unverfälschte Landschaft. Schon wird die Frage diskutiert, wie die potentiellen Schätze aus dem Eis zutage gefördert werden könnten.
Neue Stationen, immer größere Forschungsschiffe und Flugplätze werden gebaut.
Die Antarktis ist das gemeinsame Erbe der Menschheit, wie das Meer und die Lufthülle. Wer verteidigt dieses Erbe? In der Antarktis, wo früher offensichtlich nie Menschen gelebt haben, braucht es auch jetzt keine Hoheitsrechte. Es braucht nur eine Umweltpolizei, noch besser: ein Umweltbewußtsein. Eine Kontrolle der Vertragsgemeinschaft durch die UNO wäre nicht nur wegen der Reichtümer des unberührten Kontinents wichtig, sondern vor allem wegen seines empfindlichen ökologischen Gleichgewichts.[2]
Vor 200 Jahren, als der britische Forschungsreisende James Cook zum ersten Mal um die Antarktis segelte, war sie die »terra incognita«. Ob vor hundert Jahren ein amerikanischer Robbenjäger als erster seinen Fuß auf das Eis gesetzt oder vor tausend Jahren ein südamerikanischer Ureinwohner auf der antarktischen Halbinsel Schiffbruch erlitten hat, ist belanglos. Flaggen, welcher Art auch immer, sind in der »Heimat des Eises und der Stürme« eine Farce. Norweger überstanden erstmals einen Winter im Eis. Norweger erreichten als erste den Südpol. Amerikaner schickten das erste Flugzeug dorthin. Briten überquerten als erste den Kontinent. Das erste Antarktiskind kam 1978 in einer argentinischen Station zur Welt. Gebietsansprüche sind auch daraus nicht ableitbar. Trotzdem, seit 1943 beanspruchten sieben Länder keilförmige Stücke des antarktischen Kontinents: Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Australien, Neuseeland, Chile und Argentinien. Australien reklamiert fast die Hälfte des Kontinents für sich. Auf dem von Neuseeland beanspruchten Stück, am McMurdo-Sund, steht die Hauptforschungsstation der USA. Explosiv könnte die Situation auf der antarktischen Halbinsel da werden, wo sich Gebietsansprüche Großbritanniens, Chiles und Argentiniens überlappen. Die Halbinsel ist deshalb so wichtig, weil sie in das relativ eisfreie Wasser nahe der südamerikanischen Landspitze ragt. Auf King George Island vor der Spitze der Halbinsel liegen sieben Forschungsstationen.
Station in der Antarktis
Zwar läßt der Antarktis-Vertrag alle Gebietsansprüche in der Schwebe, aber wer wehrt sie ab? Der ehemalige chilenische Diktator Pinochet hat den Boden der Antarktis geküßt, flammende Reden dort gehalten, ohne daß die Mitbewerber um die Halbinsel ihm Einhalt geboten hätten. Die Argentinier haben eine Kabinettssitzung auf dem Eis abgehalten, und niemand nahm Anstoß. Wäre es nicht ein Protest gegen jede Landnahme, wenn da einer quer über den Kontinent lief: ohne Paß, ohne Genehmigung, ohne ein Ministerium im Rücken? Vor diesem Hintergrund wollte ich mit meiner Reise die Ungebundenheit und Wildnis der Antarktis aufzeigen. Auf die Probleme ihrer Erschließung, Ausbeutung und Aufteilung hinweisen. Eine gerechte Regelung gibt es bei einer etwaigen Nutzung nicht. Es gibt nur den Verzicht zugunsten der Wildnis. Solange niemand den Handelswert des Kontinents wirklich kennt, muß ein Weltpark doch durchsetzbar sein. Deshalb meine Eile.
Eine wachsende Flotte von Versorgungsschiffen arbeitet sich inzwischen Sommer für Sommer durch den Treibeisgürtel. In den vielen Forschungsstationen lagern Millionen Liter Öl. Jedes Leck im Tank bedeutet eine Katastrophe! Wie groß würden erst die ökologischen Risiken sein, wenn der Transport von gefördertem Öl aus der Antarktis begänne? Unausdenkbar.
Auch stehen Tourismusstrategen mit kühnen Unternehmungen in den Startlöchern. Chile hat das erste Hotel für Antarktisbesucher gebaut. Es soll das Tor zum Südpol für Touristen sein. Argentinier feiern auf dem Eiskontinent nicht nur Hochzeiten. Die Bundesrepublik Deutschland, erst 1979 dem Vertrag beigetreten, zieht inzwischen in ihren Forschungsbemühungen mit den Supermächten gleich. Ihr Eisbrecher »Polarstern« ist eines der modernsten Forschungsschiffe auf den Weltmeeren.
Bisher ist jeder förderbare Rohstoff in der Antarktis nur von relativem kommerziellen Wert. Denn die Erschließung der »Reichtümer« ist unvorstellbar schwierig. In jedem Fall ist sie ökologisch nicht zu verantworten.
Die Zukunft des Kontinents hängt ab von der Frage, wer ihn schützen wird. Deshalb darf die Antarktis nicht aufgeteilt werden. Um zu verhindern, daß ein internationales Wettrennen um die Ausbeutung das jungfräuliche Land verwüstet, reichen die Proteste von Greenpeace nicht aus. Wir können die Antarktis nur verteidigen, wenn wir ihre Schönheit begreifen. Der eigentliche Wert des noch unberührten Kontinents für die Menschheit ist nicht in Dollar zu messen. Er ist nur zu messen in der Qualität der Wildnis, die von Natur aus friedlich, unendlich und schön ist.