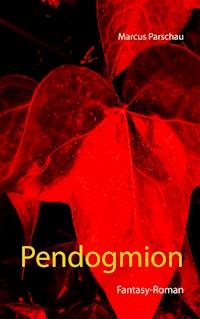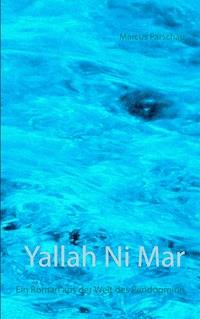Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zahlreich sind die Spezies und die Völker der Welt des Pendogmion. Wer sie betritt, hat unsere Welt verlassen. Weder Zwerge noch Elben oder Menschen bevölkern diese Welt. Es sind andere Wesen, die sie bewohnen. Einsteiger, aber auch Freunde der Welt des Pendogmion können in den vorliegenden Erzählungen tief eintauchen in das Leben der Grauden, Ardesen, Kiris und Einogs. Der Einog E´Lettan ist fassungslos. Seine Schülerin hat gegen selbstverständliche Grundsätze der Einogs verstoßen. Ihre schwerwiegende Tat wird sie vor dem hohen Ratsherrn T´Ascor aus dem inneren Rat der Drei erklären müssen. Gemeinsam mit der Schülerin, die er viele Jahrzehnte ausgebildet hat, ist E´Lettan in der Alten Stadt der Einogs eingetroffen. Natürlich musste das alles seine Schuld sein. Wenn er nur wüsste, wie er sie jetzt noch schützen könnte... Zehn Kurzgeschichten stehen hier für zehn der Völker dieser Welt: Quilt vom Unterflächenvolk der Shintos hat von einer furchtbaren und unbarmherzigen Bedrohung erfahren, die sein Volk, aber auch die Völker der Oberfläche, die der Sonne zugewandt leben, aus der Tiefe bedroht. Aife, die junge Ardesin aus dem Ardesenvolk der großen Wüste will nicht akzeptieren, dass das Männerwissen nicht für sie bestimmt ist. Ther Re Bros, Meister der Ausbilder des isbischen Heeres wird von seinem besten Schüler zum Kampf um Leben und Tod gefordert. Als Zugabe gibt es in der elften Geschichte ein Wiedersehen mit Amadan. Nach den Ereignissen des Pendogmion hat er sein geliebtes Einsiedlerleben wieder aufgenommen. Doch er wird nicht lange alleine bleiben. Wer ist die Schöne, die ihn selbst seine unvermeidlichen Kaupilze vergessen lässt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Aus der Tiefe
Der Dieb und der Kaufmann
Ardesis
Beutemond
Der Clan der Kascad
Quat Trest
Fremde Früchte
Thaku Akhoe
Ungehorsam
Der Hof des Leshan
Die Insel hinter dem Riff
Die Karte der bekannten Welt nach der Neuordnung durch den Than (nur für 2,5,10 und 11)
Aus der Tiefe
Shess tauchte aus dem Meerwasser wieder an die Oberfläche, spuckte das salzige Wasser aus und seufzte zufrieden. Endlich war er wieder zu Hause. Natürlich war es auch schön, die lange Reise gemeinsam mit seinem Vater tief nach unten in das Reich der Flees unternommen zu haben. Immerhin war es eine sehr wichtige Reise. Sein Vater Quilt war schließlich Abgesandter des Königs der Shintos. Offenbar war er der Meinung, dass sein Sohn nun alt genug war, derartige Aufgaben und Zusammenhänge kennen- zulernen. Aber es war ein so heißes Land dort tief unter ihnen. Anders als die Flees, die zu den Insektenartigen gehörten, hatten die Shintos ein dichtes schwarzes Fell, das sie in den kühlen Tiefen dicht unter der Oberfläche warm hielt. Die Flees aber lebten dicht am Herz der Welt und schon in ihren oberen Provinzen war neben der großen Hitze auch der Geruch der Ausdünstungen dieser Gefilde nur schwer zu ertragen.
Wohlig legte sich Shess auf den Rücken und ließ sich noch ein wenig in dem kühlen Wasser des Unterflächenozeans treiben, der sich bis an die Häfen seiner Heimatstadt Taquel erstreckte. Er liebte das Geräusch der an die Felsen schlagenden Wellen und dessen Wiederhall in dem gewaltigen Höhlengewölbe über ihm. Shess wusste, dass drüben am Ufer sein Vater bereits auf ihn wartete, denn sie waren auf dem Weg in die Gesprächshalle von Taquel, um den Beobachter der Kiris zu treffen. Sein Vater war in den letzten Tagen entspannter. Nachdem sie die ernsten Nachrichten über die Geschehnisse in der Tiefe erfahren hatten, war der König äußerst besorgt. Das Gespräch mit den Flees, das sein Vater zu führen hatte, war ein großer Erfolg, aber nun benötigten die Shintos dennoch Hilfe, um das Unheil abwenden zu können. Sein Vater hatte nun die Hoffnung, dass die Einogs in dieser Lage helfen könnten. Shess wusste bisher, dass die Einogs das erste Volk waren. Sie waren die ersten, die einst vor vielen Zeitaltern erwacht waren und sie kannten die Zusammenhänge der Welt mehr als jede andere Art. Die Kiris gehörten zu ihren Kundschaftern oder zu ihren Wissenssammlern, wie die Einogs das nennen würden. Sein Vater Quilt war überzeugt davon, dass die Einogs nun eingreifen würden, denn es gab eine immense Gefahr für viele Völker.
Shess hörte seinen Vater ungeduldig rufen und verließ langsam und etwas missmutig das Wasser. Quilt vernahm, wie sein Sohn zu ihm an Land kam und sich das Meerwasser aus dem nassen Fell drückte. Wie von einer feuchten Höhlendecke prasselte das Wasser auf den Kiesboden. „Um diese Zeit ist es voll auf der Hauptstraße“, sagte er leise. „Du kannst morgen wieder herkommen.“ Shintos trugen keine Kleidung, da ihr kurzes schwarzes Fell dies aus ihrer Sicht überflüssig machte. Sie hatten lange und kräftige Arme mit im Vergleich zu anderen Arten gewaltigen Händen, die ihnen seit jeher das Graben erleichterten. Die Ohren und das Gesicht der Shintos erinnerten entfernt an Hundswesen, doch hatten sie eine weniger ausgeprägte Schnauze. Weiter oberhalb verbargen sich hinter dem Fell die wenig genutzten Augen, denn in der Finsternis der Unterflächenwelt mussten sie in der Hauptsache nur einen kleinen Beitrag dabei leisten, Entfernungen einschätzen zu können.
Es war in der Tat voll auf der Hauptstraße, die an dieser Stelle steil aufwärts zum unteren Eingang von Taquel führte. Shess hörte die vertrauten Geräusche der Lasttiere der Kaufleute und das gleichmäßige und friedliche Gewirr vieler Stimmen. Die Luft war erfüllt von dem würzigen Geruch der Pilze, Knollen und Larven, die von den Anbaugebieten in die Stadt gebracht wurden. Shess war noch niemals einem Wesen von der Oberfläche begegnet und inzwischen sehr neugierig auf dieses Treffen. „Sie hören nicht sehr gut“, erklärte sein Vater. „Ich war schon oft oben an der Oberfläche und es ist dort so, dass es wenige Hindernisse für alle Arten von Laute gibt. An der Oberfläche ist man ungeschützt. Wenn du das erste Mal hinaustrittst, wird dir für einige Zeit schwindlig sein, denn du stehst in einer weiten freien Fläche und es gibt nach allen Seiten keinerlei Begrenzung. Von überall hörst du alle Arten von Lebewesen und viele andere Dinge, die wir bei uns nicht kennen. Das Oberflächenvolk hat diese Geräusche immer um sich und hört daher davon nicht alles. Sie haben sich daran gewöhnt und hören anders. Dafür sprechen sie sehr laut, du wirst sehen. Wir müssen auch sehr laut sprechen, denn sonst hören sie uns nicht.“
Shess spürte, wie sich seine Nackenhaare und die Haare auf der Oberseite seiner Arme aufstellten, denn es schauderte ihm bei dem Gedanken an die Oberfläche ein wenig. „Stimmt es, dass sie sich von oben Feuer mitbringen?“, fragte er. „Ja, das stimmt“, antwortete Quilt. „Aber sie brauchen es nicht wie die Flees der Wärme wegen, obwohl sie bei uns schon häufig ein wenig frieren. Sie brauchen Licht. Es gibt immer Lichter an der Oberfläche. So hell, dass es einem in den Augen schmerzt. Etwa so, wie bei dem großen Feuersee, den wir bei den Flees gesehen haben. Nur ist das Licht nicht so heiß. Ohne das Licht würden sie überall gegenstoßen oder hinfallen, denn sie brauchten es, um sich zu orientieren. Sie riechen und hören nur wenig und sie nutzen vor allem ihre Augen.“ Shess schüttelte den Kopf. Was mochte das für ein Wesen sein, das für einen einfachen Spaziergang Licht benötigt?
Bald öffneten sich auf beiden Seiten der Hauptstraße viele Nebengänge und an den Wänden gab es Türen und Belüftungslöcher. Sie hatten nun die Stadt betreten, die aus einem unübersichtlichem Ganglabyrinth bestand. Es existierten mehrere Ebenen der Stadt, die wie ein großes ovales Gebilde unter der Erde lag. Taquel verfügte über drei eigene Quellen und ein umfangreiches Belüftungssystem. Wie viele Unterflächenvölker hatten die Shintos in ihren Städten Schachtwürmer eingesetzt. Diese großen und wehrhaften Wurmwesen gruben sich, wenn man sie aussetzte, bis hoch zur Oberfläche und legten weitverzweigte Gangsysteme an. Überall in der Stadt gab es die von ihnen geschaffenen Entlüftungslöcher, aus denen immer auch ein wenig Wurmschleim auf den Boden tropfte. Schachtwürmer waren scheu und wagten sich nicht aus ihren Gangsystemen heraus, wurden jedoch versehentlich Gänge geöffnet, verteidigten sie ihren Bau mit messerscharfen Zähnen. Shess wusste, dass es für Fremde immer wieder schwierig war, sich im Straßenwirrwarr von Taquel zurechtzufinden. Für ihn war das kein Problem. Er lief auf dem Weg zur Gesprächshalle immer ein Stück voraus.
Die große Gesprächshalle von Taquel befand sich in einer der inneren Ebenen der Stadt, sodass Vater und Sohn vom unteren Eingang kommend noch einen längeren Weg zurücklegen mussten. Dort angekommen suchten sie sogleich nach der für das Gespräch vorgesehenen Nische. Die Gesprächshallen der Shintos waren meist große Höhlengewölbe, die als Treffpunkt oder zum Informationsaustausch für alle Arten von größeren und kleineren Gruppen genutzt werden konnten. Jeder konnte hier zu allen Zeiten an einem der großen steinernen Tische Platz nehmen und sich mit gezielten oder zufälligen Gesprächspartnern unterhalten. Vom König über einzelne Familien bis hin zu Kaufleuten und jungen Paaren waren alle Arten von Personen vertreten und die unterschiedlichsten Gespräche wurden hier geführt. Für diese Zwecke gab es große zentrale Gruppentische, aber auch abgelegene separate Nischen und eine derartige Nische war für das Gespräch mit dem Kiri vorgesehen.
Es war kein Problem, die Nische mit dem Kiri zu finden; Shess konnte sie schon von Weitem sehen. Man hatte auf den Tisch ein großes, weißes, zylinderartiges Gebilde gestellt, auf dem ein kleines Feuer brannte. Weit um die Nische herum war dadurch alles hell erleuchtet und Shess merkte, wie unangenehm dieser grelle Schein für seine Augen war. Es dauerte eine Weile, bis er die Personen an dem Tisch erkennen konnte. Der Kiri war nicht alleine, offenbar hatte ihn Lorqua gebracht, eine Helferin seines Vaters. Quilt umarmte den Kiri herzlich und stellte seinen Sohn vor. Nun konnte Shess das Wesen genauer erkennen. Der Kiri war sehr klein – nicht einmal halb so groß wie sein Vater – und hatte seltsamerweise nur auf dem Kopf etwas Fell. Er hatte helle Haut und man konnte seine kleinen unbehaarten Ohren erkennen. Ohne Fell war sein Gesicht sehr beweglich, wenn er mit Shess sprach – und er sprach tatsächlich etwas laut –, bewegte er seinen Mund auf recht eigentümliche Art. Außerdem waren da seine Augen. Soweit Shess das erkennen konnte, mussten sie sehr groß sein und er spürte deutlich, wie er von ihnen gemustert wurde. Das Auffälligste aber war der Stoff. Der Kiri hatte seinen Körper in eine Art grauen Stoff eingewickelt, der irgendwie darauf vorbereitet worden war. Es gab einen Teil für den Oberkörper und einen für die Beine. Kopf, Hände und Füße schauten heraus; ein wenig war der Stoff wie ein Fell. Shess verstand, dass die Kiris den Stoff wohl brauchten, um ohne Fell unter der Erde nicht zu frieren. Wahrscheinlich legten die Oberflächenwesen diese Stoffe ab, wenn sie wieder in das warme Licht an der Oberfläche traten.
Der Kiri, der den Namen Kalv trug, hatte bereits für alle einen Krug mit heißem Bitterflechtentee bringen lassen. Shess erhielt einen Becher mit gesüßtem Rotknollensaft. Kalv eröffnete das Gespräch: „Mein lieber Freund, ich freue mich immer, wenn es die Gelegenheit für ein Wiedersehen gibt. Aber Ihr habt mir ausrichten lassen, dass es ernste Nachrichten gibt, die Ihr mir mitteilen wollt.“ „Das ist in der Tat so“, antwortete Quilt. „Vor etwa zwei Monden, wie Ihr diesen Zeitraum ausdrücken würdet, erhielten wir die Nachricht aus einer tiefer gelegenen Provinz. Dort treibt man Handel mit dem Unterflächenvolk der Flees. Die Flees sind ein insektenartiges Volk, das dicht am Herzen der Welt lebt und sich aus dieser Region niemals entfernt. Zufällig hatten die Unseren von den Flees erfahren, dass ein Shartac sich von seiner Gruppe gelöst hat und auf dem Weg nach oben ist.“ „Die Flees“, wiederholte Kalv und redete dann weiter: „Ich habe von diesem Volk schon einmal gehört. Ich weiß, dass auch die Einogs sie kennen, aber man weiß nicht viel über sie und es ist viele Zeitalter her, dass ein Einog einem Flees begegnet ist, tief unter der Erde. Aber was ist ein Shartac?“
Quilt trank einen Schluck von dem Bitterflechtentee, senkte seinen Kopf und sagte: „Ihr wisst, dass es tief unten in der Erde so manches Getier und so manch Wesen gibt, von dem die Oberflächenvölker nichts wissen. Viele dieser Wesen sind friedlich. Sie ahnen nichts von der Oberfläche oder glauben, dass es so etwas wie eine Oberflächenwelt nicht gibt. Sie leben schon seit undenklichen Zeiten in ihren Höhlen und Gängen. Einige von ihnen sind uralt. Sie bewegen sich kaum noch fort und sind scheinbar den Pflanzen näher als den Wesen von Fleisch und Blut. Oft wissen nur wir Shintos von ihnen und können mit ihnen sprechen, denn nicht wenige der Wesen unter der Oberfläche sind im Laufe der Zeiten erwacht und sind eine eigenständige Art wie die erwachten Wesen auf der Oberfläche. Andere Wesen sind kämpferisch und nicht wenige suchten nach Platz und Raum zur Ausbreitung. Voll Hass und Wut sitzen sie in ihren engen Gängen und manch grauenvolle Kreatur verbirgt sich in den Tiefen. Die Shartacs gehören nicht zu den erwachten Wesen. Es sind gewaltige käferartige Allesfresser ohne Verstand. Ihre harten Panzer schützen sie vor fast allen Temperaturen und jedem Angriff. Sie haben enorme zangenartige Greifer, mit denen sie graben, aber auch alles zerreißen können, was sich ihnen in den Weg stellt. Auch sie lebten dicht am Herzen der Welt, denn die Hitze dort unten spüren sie nicht. Sie leben aber weitab von den Flees in großen Gruppen. Wenn sich nun ein Shartac von seiner Gruppe gelöst hat, dann bedeutet das nichts Gutes. Die Shartacs brauchen das Leben in ihren Familienverbänden. Nur wenn sich ein Einzelwesen durch eine Krankheit oder warum auch immer nicht in die Gruppe einfügt, wird er ausgestoßen. Ein Shartac kann aber eigentlich nicht alleine sein. Wenn so etwas geschieht, dann ist das Wesen voll ohnmächtiger Wut und dem Wahnsinn nahe. Dieser Shartac ist nun auf dem Weg nach oben.“
Kalv nickte und sah Quilt nachdenklich an. „Ich habe bisher verstanden“, sagte er, „dass ein sehr großer Käfer sich aus der Tiefe der Welt aufgemacht hat und auf dem Weg zur Oberfläche ist. Was für eine Gefahr verbirgt sich dahinter? Was kann er anrichten?“ Quilt sprach nun für einen Shinto verhältnismäßig laut und Shess konnte sehen, dass sein Vater wieder von dem gleichen Entsetzen heimgesucht wurde, das er an ihm gesehen hatte, als er die Nachricht und seinen Auftrag von dem König erhalten hatte. „Ein Shartac“, sagte er. „Ein Shartac ist von solch einer Größe, dass er in diese Halle nicht hineinpassen würde. Es ist eine grauenvolle Bestie und er benötigt ständig neue Energie und neue Nahrung. Dies wird erst recht der Fall sein, wenn er sich von der Wärme wegbewegt und sein Körper selbst genug Wärme produzieren muss. Setzt dieser Shartac seinen Weg fort, dann liegen mehrere Shinto-Siedlungen und auch Taquel auf seinem Weg. Wir haben nichts, das ihn aufhalten kann, und er wird alles, was auf seinem Weg liegt, zerstören und sich einverleiben. Wenn er dann aber auf geradem Weg durch die Oberfläche bricht – und davon gehen wir aus –, dann ist er in der fergardhonischen Stadt Carnat und dies wird nicht die letzte Oberflächenstadt sein, die durch ihn sein Ende findet.“
„Dann“, sagte Kalv bestürzt, „sollten wir die Fergardhonier warnen. Ich danke euch für diese Nachricht, Freund. Carnat ist auch ein guter Ort für die Kiris. Viele von uns leben dort. Die Fergardhonier haben zahlreiche und gut ausgebildete Krieger in Carnat. Sie werden vorbereitet sein, wenn der Shartac kommt. Aber wie können wir Euch helfen?“ „Ihr versteht noch nicht“, erwiderte Quilt. „Die Fergardhonier, selbst wenn sie noch so stark und zahlreich wären, werden gegen den Shartac nichts ausrichten können. Sein Panzer hat der mächtigen Hitze der Tiefe standgehalten, die selbst alles Metall zum Schmelzen bringt. Seine Greifer bohren sich durch härtestes Gestein. Wenn der Shartac an die Oberfläche dringt, dann ist jeder, der sich ihm entgegenstellt, verloren.“
Kalv schwieg für einen Augenblick und fragte dann: „Nun verstehe ich Eure Aufregung. Was können wir nun unternehmen? Was kann man gegen dieses Unglück ausrichten?“ „Wir kommen gerade von den Flees und ich habe etwas Zeit gewinnen können“, berichtete Quilt. „Auch die Flees fürchten den Shartac. Aber es sieht so aus, als ob er an ihren Siedlungen vorbeiziehen wird. Sie haben ihn weit entfernt von ihren Behausungen gesichtet. Die Flees möchten sich nicht einer Gefahr aussetzen. Sie sind uns aber sehr freundschaftlich verbunden. Es ist ihnen gelungen, den Shartac in ein Gebiet zu locken, in dem massive Felskerne seinen Weg nach allen Seiten versperren. Dies wird ihn nicht aufhalten, denn er kann diese Felskerne zerbrechen, aber er wird einige Zeit dafür benötigen. Nach Eurer Zeitrechnung wird er etwa zwei Monde benötigen, ehe er dieses Gebiet verlassen kann und dann wird er nach einem weiteren halben Mond unsere ersten Siedlungen erreichen. Die Flees wissen sehr viel über die Shartacs und ich konnte herausfinden, dass sie auch einen Weg kennen, den Shartac zu töten. Wenn die Shartacs auch sehr große Hitze unbeschadet überstehen können, so hat dies dennoch seine Grenzen. Unten dicht am Herz der Welt gibt es gewaltige Feuerströme und Seen aus geschmolzenen Metallen. Ihr wisst, von Zeit zu Zeit gelangt etwas davon bis an die Oberfläche. Ein Shartac, der damit in Berührung kommt, würde schon bald vergehen, denn kein Material kann diese Hitze lange überdauern. Die Flees aber wissen, wie man diese Feuerströme umleiten kann. Sie würden einige Zwischenwände abtragen und den Feuerströmen neue Richtungen geben. Sie sagen, es wäre möglich, durch eine Zusammenlegung mehrerer Ströme einen großen Druck zu erzeugen, sodass ein mächtiger Feuerstrom aufsteigen und den Shartac vernichten würde.“
„Das ist doch eine wunderbaren Nachricht, Quilt“, sagte Kalv. „Großartiges habt Ihr da erreicht. Wenn dies geschieht, dann wäre das die Rettung für alle.“ „Wenn die Flees dies vollbringen“, sagte Quilt ernst, „dann setzen sie sich bei diesen Arbeiten großen Gefahren aus. Es ist bereits vorgekommen, dass es bei derartigen Arbeiten zu Unglücken gekommen ist, die nicht alle überlebt haben. Wie gesagt: Die Flees sind nicht in direkter Gefahr. Wenn sie diese Aufgabe vollbringen sollen, dann erwarten sie dafür einen beträchtlichen Lohn. Diesen werden wir Shintos nicht leisten können. Ich habe lange mit den Flees gesprochen, aber an ihren Forderungen führt kein Weg vorbei. Meine letzte Hoffnung ist daher, dass die Einogs eingreifen können. Wir sind sonst alle verloren.“
Kalv schwieg für einen Augenblick und sagte dann ruhig: „Leider weiß ich mit Sicherheit, dass meine Herrn, die Einogs, nicht eingreifen werden. Möglicherweise könnten sie einen Ausweg wissen und in dieser Situation helfen, aber sie werden es nicht tun.“ „Aber warum nicht?“, fragte Quilt bestürzt. „Viele Arten sind von diesem Ereignis betroffen. Es wird ein großes Unglück geben. Wenn sie helfen können, warum tun sie das nicht?“ „Die Einogs betrachten unsere Welt und ihre Entwicklung seit vielen Zeitaltern“, sagte Kalv. „Ihr höchstes Ziel ist es zu wissen und zu verstehen. Aus ihrer Sicht gehört es zu den Gesetzmäßigkeiten der Welt, dass sie in immerwährenden Wandel ist. Sie beobachten dies seit sehr langer Zeit und verstehen viel von den Gezeiten, denen das Leben und seine Entwicklung unterworfen sind. Sie greifen nur dann ein, wenn die Veränderung der Welt durch einzelne Arten aufgehalten oder zum Stillstand gebracht wird, wenn also einzelne Arten beginnen, die Welt nach ihren Bedürfnissen zu formen. Alle anderen Ereignisse gehören zum Prozess der immerwährenden Veränderung. Wenn nun ein Shartac an die Oberfläche gelangt und mehrere Städte vernichtet, dann ist dies für sie ein neues Ereignis von großer Bedeutung, aber es ist kein Grund, in dieses Geschehnis einzugreifen. Das Handeln des Shartac ist Teil der ständigen Veränderung der Welt. Versteht Ihr das?“
„Bei den Göttern“, sagte Quilt. „Ja, ich verstehe. Aber dann sind Taquel und Carnat verloren und noch viele Siedlungen und Städte mit ihnen. Wir müssen sofort damit beginnen, die Bewohner zu informieren. Sie müssen ihre Wohnungen verlassen und so schnell wie möglich fliehen. Meine Mission ist gescheitert.“ Kalv sah in seinen inzwischen leeren Becher und fragte: „Was genau ist denn die Entlohnung, die die Flees eingefordert haben?“ „Sie möchten fünfzig Karren voll von den großen roten Saftbeeren“, antwortete Quilt. „Sie wollen … Obst?“, fragte Kalv fassungslos.
„Das mag sich für Euch seltsam anhören“, sagte Quilt. „Aber wann ist eine Sache wertvoll? Sie ist es dann, wenn sie sehr selten und nur für wenige zu haben ist. In vielen Oberflächenstädten ist Gold von besonderem Wert oder bestimmte Steine sind es. Von all dem haben die Flees tief unter der Oberfläche mehr als genug. Es hat keine Bedeutung für sie. Die großen Saftbeeren sind aber Früchte der Sonne. Sie wachsen nur, wenn es sehr warm ist und die Sonne auf sie niederscheint. Dies gibt es tief unter der Oberfläche nicht. Die Saftbeeren haben ihr Aussehen und ihren Geschmack von der Sonne. Für die Flees sind das Sonnenbeeren und sie finden sie köstlich. Nur die Herrscher und einige wohlhabende Familien konnten sich bisher einige davon beschaffen. Für Flees haben diese Beeren einen ungeheuren Wert. Aber wir können sie jetzt nicht bekommen, nicht wahr? Oben an der Oberfläche liegt dichter Schnee auf den Feldern. Für viele Monde ist es nicht die Zeit, um Saftbeeren zu ernten. Es gibt derzeit einfach keine und ohne die Einogs werden wir dieses Problem nicht lösen können.“
Zu Quilts großem Erstaunen begann Kalv in diesem Moment zu lachen. Er musste seinen Krug abstellen und war offenbar für einige Momente nicht in der Lage weiterzusprechen. „Mein lieber Freund“, sagte er schließlich und lachte dabei noch immer. „Bitte verzeiht meine Unhöflichkeit, aber das ist nicht wirklich ein Problem. Wir sind die Kiris und wir leben in vielen Städten und Herrscherhäusern überall in der bekannten Welt und darüber hinaus. In der Tat können die Saftbeeren hier im Moment nicht gedeihen, aber sie tun dies an anderen Orten, weit entfernt im tiefen Südwesten. Es gibt Kaufleute, die sie mit Schiffen in entlegene südliche Provinzen bringen. Es wird nicht einfach sein, aber die Kiris können so etwas beschaffen.“ „Aber“, sagte Quilt verwirrt. „Werdet ihr dies denn auch tun?“ „Carnat ist bedroht und dies ist ein Wohnort der Kiris. Aber auch unsere Freunde, die Shintos, sind bedroht“, antwortete Kalv. „In spätestens einem Mond werden wir die fünfzig Karren in eurer südlichsten Provinz abliefern können. Werdet ihr den Transport zu den Flees ermöglichen können?“ „Selbstverständlich wird uns dies möglich sein. Die Früchte würden schon nach wenigen Tagen bei den Flees eintreffen“, antwortete Quilt. „Bestelle den Flees Folgendes“, sagte Kalv. „Wir können noch mehr für sie tun. Die Flees möchten Saftbeeren. Die Völker, die im Süden diese Beeren ernten, möchten Gold und edle Steine. Wenn die Shintos mithelfen, können wir den Kontakt herstellen. Die Flees werden immer die Sonnenbeeren haben können. So viel sie davon möchten.“
Quilt lehnte sich zurück und atmete tief durch. „Dann ist es vollbracht“, sagte er erleichtert. „Und der Shartac wird brennen.“ Er schickte nun Lorqua, damit sie die neuen Nachrichten an die Boten weitergeben konnte. Ein Bote sollte sofort zu den Flees aufbrechen, sodass diese sofort mit den Vorbereitungen beginnen konnten und ein Bote sollte den König unterrichten. „Kaum ein Volk an der Oberfläche kennt die Shintos“, sagte Kalv nun nachdenklich. „Und niemand dort oben ahnt, welchen großen Dienst Ihr ihnen heute erwiesen habt.“
Kalv bestellte nun noch einmal einen Krug Bitterflechtentee und einen Rotknollensaft für Shess. Es war ein guter Abend in der Gesprächshalle von Taquel und Shess konnte noch so manchen Rotknollensaft trinken und so manche Frage an den Gast von der Oberfläche stellen. Neben der Sonne gab es offenbar ein weiteres Licht für den Zeitraum, in dem sich die Sonne nicht am Himmel zeigte. Außerdem gab es mächtige Winde. Sehr schnelle Luft, die imstande war, ein Wesen vom Boden zu heben und hinwegzuwirbeln. Shess trank von seinem Rotknollensaft und sah in die sich immer weiter füllende Gesprächshalle. Er sah zu den überall an den Tischen diskutierenden, lachenden oder auch schweigenden Shintos hinüber. Dies war ein guter und vertrauter Ort und er war froh, hier zu sein. Eines wusste er genau: Unter keinen Umständen würde er die Oberfläche jemals betreten wollen.
Da war er ganz sicher. Aber eine Sonnenbeere würde er schon gerne einmal probieren.
Der Dieb und der Kaufmann
Es war, als würde man in dichtem Nebel tasten. Hier stand die alte hölzerne Schatulle, dort stand normalerweise die alte Skulptur von König Konchobaar. Nein, Vorsicht, es war der Krug mit dem Wasser. Der alte Fergardhonier tastete auf dem ovalen Tisch gleich gegenüber seines Nachtlagers in seinem Schlafgemach und war schon ganz verzweifelt. Wo hatte er sie nur hingelegt? Wo waren seine Augengläser? Eine Möglichkeit gab es noch. Wenn das nicht zum Erfolg führte, dann musste er die Kiris rufen, denn ohne Augengläser konnte er inzwischen kaum noch etwas zuwege bringen. Aber wie Keredor das hasste. Er selbst war noch im Nachthemd und musste sich wie ein hilfloser Greis von einem Kiri helfen lassen. Nein, das kam nicht infrage. Da waren sie! Wusste er es doch! Direkt neben der Wasserschüssel auf dem Waschtisch hatte er sie gestern abgelegt. Wo auch sonst!
Er wickelte sich die geflochtenen Bänder der Augengläser um die Ohren, band sie sorgfältig zu und langsam lichtete sich der Nebel. Aber was für ein Schreck! Wer stand da unmittelbar vor ihm? Er musste die ganze Zeit hier bei ihm in seinem Raum gewesen sein. Das Herz schlug dem alten Mann bis zum Hals. Dann sah er die Augengläser bei seinem Gegenüber. Ach ja, der Spiegel. Vor einigen Wochen hatte er diesen über dem Waschtisch befestigen lassen. Wenn er sich doch nur daran gewöhnen würde. Nachdenklich sah er auf den beleibten alten Fergardhonier mit den schief sitzenden Augengläsern vor den trüben hellgrünen Augen und dem ergrauten Fell. Die Frühjahrssonne schien zu dem offenen großen Fenster herein und aus dem Innenhof konnte er zahlreiche Vögel von den großen alten Bäumen singen hören. Was für ein herrlicher Tag es war. Vielleicht sollte er heute seinem Sohn auf dessen Anwesen am Südmeer besuchen und einige seiner nutzlosen Freunde kennenlernen. Alles verzogene Söhnchen ihrer wohlhabenden Väter, so wie sein eigener Sohn ja auch. Aber es war wirklich ein schöner Tag. Der alte Mann schaute durch das Fenster hinaus auf seinen Innenhof. Viel zu schade.
Keredor, der alte Kaufmann, nahm seine Morgenmahlzeit heute auf seiner zum Innenhof gerichteten Terrasse ein. Hier war es angenehm schattig und der Straßenlärm, der von dem geschäftigen Treiben in der Hauptstadt Cybolis um diese Zeit schon zu vernehmen war, klang nur leise und gedämpft zu ihm herüber. Er hatte sich von den Kiris nur etwas gesüßtes Röstbrot und einen Becher mit starkem, heißen Pattai bringen lassen. Langsam und Schluck für Schluck trank er von dem belebenden Aufguss der Gelbnuss und seine Gedanken kamen und gingen. Wann genau war das, als er damals Lethril das erste Mal zu Gesicht bekommen hatte, Lethril den Dieb? König Merthach saß noch längst nicht auf dem Thron von Fergardhon. Es war noch die Zeit seines Vaters. König Celthach herrschte in Fergardhon. Aber nein, Celthachs Krönung stand doch erst noch bevor. Der große Krieg war erst seit kurzer Zeit vorüber. Der Than regierte in Cybolis. Es war das Jahr des Thans, des Herrn der Welt. Keredor schloss die Augen und seine Erinnerungen gingen in längst vergangene Tage zurück, als er noch auf dem Marktplatz von Cybolis stand und seine beiden Marktstände betreute.
Meist standen sich seine beiden Stände auf dem großen zentralen Marktplatz von Cybolis direkt gegenüber. Töpfe und Küchengeschirr an dem einen, Kleider für die Damen aus den Palästen der Adligen und der reichen Händler und Kaufleute an dem anderen Stand. Während der furchtbaren Zeit der Besetzung von Cybolis war jeglicher Handel zum Erliegen gekommen. Keredor hatte seine Münzen und Wertgegenstände bereits vergraben, als er sah, dass die Stadttore gegen den anrückenden Feind verrammelt wurden. Das war auch richtig so, denn alle Vorräte und alle Wertgegenstände hatten die Grauden während der Besetzung aus ihren Häusern geholt und sie hatten kaum das Nötigste in dieser Zeit. Aber gleich nachdem das siegreiche Thansheer Cybolis befreit hatte, hatte er zu seinen alten Geschäftsfreunden wieder den Kontakt aufgenommen und mit seinen versteckten Ersparnissen neue Ware gekauft. Aber es fehlte noch an allem. Es gab nicht viel Ware und die Kunden kauften nicht viel. Dann bemerkte er, dass er fast nach jedem Markttag etwas vermisste. Aber es war nicht sein treuer Verkäufer, den er schon seit so vielen Jahren kannte. Das war völlig ausgeschlossen. Ein sehr geschickter Dieb musste es auf seine Waren abgesehen haben.
Es war an einem trüben Regentag. Es gab ohnehin nicht viel Kundschaft, als er sich entschloss, seine Stände dem Verkäufer zu überlassen und zum Schein die Decken und Teppiche seines Nachbarn zu betrachten. Der war hocherfreut und versprach ihm sofort einen besonders großzügigen Nachlass unter guten Nachbarn und Kollegen. Dann sah Keredor ihn. Erst dachte er, dass er sich täuscht, aber es gab keinen Zweifel. Der Dieb war noch ganz jung. Es war ein dürrer Junge in grauer zerschlissener Kleidung, der soeben blitzschnell einen kostbar verzierten Kupfertopf vom Tisch genommen und unter seinem Umhang verschwinden ließ – einfach so, in einer einzigen Bewegung im Vorbeigehen. Mitten im Gespräch mit dem Teppichhändler drehte sich Keredor weg und lief mit ruhigen, aber beschleunigten Gang zu seinen Ständen hinüber. Wenn der Teppichhändler ihm nur nicht so laut einen noch viel besseren Preis hinterherrufen würde. Nur noch wenige Schritte und er konnte dem Jungen seine Hand auf das schwarze Fell seiner Schulter legen. Doch schon hatte er ihn gesehen und nun musste alles ganz schnell gehen.
Der alte Keredor nahm noch einen Schluck Pattai. In den nächsten Tagen hatte es sich in den Gasthäusern rund um den Marktplatz herumgesprochen. Der Teppichhändler war es wohl, der damals nichts Besseres zu tun hatte, als unter den Händlern das zu verbreiten, was nun geschah. Er war so flink der Junge. In den Augenwinkeln hatte er ihn entdeckt und sofort sprang er davon. Keredor war Zeit seines Lebens und schon in seiner Jugend ein Freund gepflegter Speisen und guter Getränke. Mit wippendem Bauch nahm er entschlossen die Verfolgung auf. Er hatte den Jungen genau im Auge und leider nicht bedacht, dass er am Morgen die gerade eingetroffen Sommerkleider für die reifere wohlhabende Fergardhonierin an dem Dach des Marktstandes befestigt hatte. Sogleich hatte sich ein Exemplar mit dem guten Stoff aus Kampten im Vorbeieilen an seinem Kopf verfangen und nun versuchte er sich, da große Eile geboten war, im Laufen davon zu befreien. Immerhin konnte er mit einem Auge noch ganz gut sehen und – da war der Junge ja noch. Er war noch nicht außer Sichtweite und sah sich ängstlich nach ihm um. Nun war es so, dass auf der anderen Seite neben seinen Ständen damals noch die alte Casia ihren in Kräutersud oder vergorener Milch eingelegten Fisch aus dem Südmeer anbot. Regelmäßig kaufte sie von den Händlern, die täglich direkt aus den Häfen kamen und legte den Fisch in großen Holzfässern und Glasbehältern ein. Auch Keredor kaufte gerne bei ihr und sie hatte da einen besonderen in Lauchmilch eingelegten zarten Fisch, eine besondere Sorte. Während Keredor nun seinen Kopf fast schon von dem Sommerkleid befreit hatte, musste sich doch einer der Ärmel um seine Beine gewickelt haben. Ganz genau wusste er es nicht mehr, jedenfalls hörte er Casias Schrei und ein lautes Krachen und Scheppern und dann wusste er noch, dass es enorm unangenehm war, die vielen kalten Fische überall am Körper zu spüren. Selbst in sein Hemd und in seine Hose waren sie gelangt, auch die mit der guten Lauchmilch. Nachdem er sich wieder aufsetzen konnte und sein Gesicht und die Augen vom Kräutersud befreit hatte, sah er, dass er die Verkaufsauslage durch den Aufprall seines Körpers zerschmettert und dabei wenigstens zwei der Fässer umgerissen hatte. Die alte Casia stand mit schreckensgeweiteten Augen vor ihm. Und der Junge? Der war längst nicht mehr zu sehen.
Für einige Tage ließ sich der Dieb nicht mehr bei ihm blicken, aber schon in der nächsten Woche fehlte wieder etwas. So konnte das doch nicht weitergehen! Keredor beschloss, dem Dieb eine Falle zu stellen. Er platzierte einige besonders kostbare und fein gearbeitete Kupfertöpfe am äußersten Rand seiner Warenauslage, hatte diese aber mit einem dünnen Garn umwickelt, welches wiederum an einer Glocke unter dem Tisch befestigt war. Wenn nun der Dieb etwas mit sich nehmen wollte, erklang sofort die Glocke und Keredor konnte handeln. Etwa sieben Mal läutete die Glocke als seine Kunden interessiert die Töpfe in die Hand nahmen. Das war ihm jedes Mal sehr unangenehm und er musste sich erklären. Selbst die Frau des Großmeisters der Getreidegilde ereilte eines Morgens das Glockenläuten und sie war sofort sehr erschrocken. So eine hochgestellte Dame – wie unangenehm das Keredor war. Da musste er sich einiges von der Frau Großmeisterin anhören. Aber beim achten Mal hatte er den Dieb.
Gerade war er in Verhandlungen mit dem alten Wirt aus dem Wirtshaus gegenüber dem Haupttor vertieft. Der Alte wollte tatsächlich drei der großen gusseisernen Pfannen zum Preis von nur einer, als Keredor die Glocke hörte. Sofort ließ er den verdutzten Greis stehen, der gerade lauthals die angeblich minderwertige Qualität der Holzgriffe beklagte, und stürzte sich in den Gang. Der Junge hatte ihm, noch einen Kupfertopf in der Hand haltend, den Rücken zugekehrt und starrte angsterfüllt auf seinen treuen Verkäufer, der auch das Läuten der Glocke gehört hatte und in den Gang gelaufen kam. Er war flink dieser junge Dieb, aber dieses Mal sollte er nicht nochmals entkommen. Mit einem beherzten Sprung riss Keredor den Jungen zu Boden. Während die alte Casia am Nachbarstand laut schreiend einige Glasbehälter mit ihrem eingelegten Fisch von ihrer neugezimmerten Verkaufsauslage hob, stürzte Keredor mit dem Dieb zu Boden und begrub diesen unter seinen Massen.
Heftig nach Luft ringend und wie betäubt stand der Junge bald wieder auf seinen Beinen und wurde an beiden Armen sowohl von Keredor als auch von seinem Verkäufer festgehalten. Hastig verkaufte Keredor die drei Pfannen zum halben Preis von einer an den alten, schimpfenden Wirt und dann überließ er seine Stände für einige Zeit der alten Casia, denn so tat man das in diesen Tagen auf dem Markt im Notfall unter Nachbarn. Keredor hatte direkt unter seinem Wohnhaus einen geräumigen Keller als Warenlager und dorthin brachte er gemeinsam mit dem Verkäufer den Jungen. Der Krieg war ja noch nicht lange vorbei und sicherlich hätte er den Dieb zum Stadtkerker bringen müssen. Aber der Junge hatte ihn über Wochen bestohlen. Und wer kam nun für seinen Schaden auf? In diesen Tagen niemand. Folglich behielt er den Dieb zunächst einmal bei sich. Rasch eilte er mit dem Dieb nach Hause und sperrte ihn in seinem Lager ein. Er würde später entscheiden, was aus ihm werden würde.
Auf dem Weg zurück zum Markt kamen sie nur schwer voran. Irgendetwas tat sich dort vorne an der Hauptstraße, denn auch um diese Tageszeit war ein derartiges Getümmel nicht üblich. Keredor musste nicht lange fragen, bis er den Grund erfuhr. Schon in seiner Kindheit hatte er von seiner Großmutter die Erzählungen über den sagenhaften Einog M´Attar gehört, der einst als Berater des Königs Konchobaar des Großen in Cybolis lebte. Sehr viel später und lange nach Konchobaars Tod, kurz vor dem Zerfall des ersten fergardhonischen Reiches, hatte M´Attar Cybolis verlassen, denn der damalige Herrscher nahm den Rat der Einogs nicht mehr an. Nun sah er, dass die Hauptstraße dicht gesäumt von Passanten war und immer mehr strömten herbei. Er konnte fragen, wenn er wollte, alle sagten, dass M´Attar leibhaftig zurückgekehrt sei. Der Than habe ihn gerufen und er hielt gerade Einzug in die Stadt. Er hatte das Haupttor durchschritten und kam nun die Hauptstraße herauf, um in den Herrscherpalast zurückzukehren. M´Attar selbst war zurück in Cybolis und gemeinsam mit dem Than und Celthach kam er tatsächlich die Hauptstraße herauf. Es hieß, er käme nicht schnell voran, denn viele Fergardhonier wollten ihn sprechen. Jeder wusste von der tiefen und sagenhaften Weisheit der Einogs und viele, die sich dies trauten, wollten ihn befragen. Keredor wollte damals zumindest einen Blick auf den Einog werfen oder vielleicht sogar den Than selbst aus der Nähe sehen. Tatsächlich sah er nur wenige Schritte vor sich eine Lücke in der Reihe der Passanten, die am Straßenrand standen. Gerade vor ihm hatten sich die Reihen in diesem Augenblick noch nicht geschlossen. Eilig schritt Keredor in diese Richtung und sah sogleich, dass sich von beiden Seiten weitere Fergardhonier mit demselben Ziel näherten. Schneller, er erhöhte sein Schritttempo, es war nicht mehr weit.
Hart war der Aufprall mit den anderen beiden Passanten, die von zwei Seiten kamen und für einen Moment dachte Keredor, er würde nach vorne zu Boden stürzen. Aber dann fing er sich im letzten Moment. Er war einen großen Schritt aus der Reihe und auf die Straße getreten und als er aufsah, stand er unmittelbar dem Than und einem gewaltigen Einog gegenüber. Hinter ihnen stand Celthach, der zukünftige König des neuen Fergardhon, und sie alle sahen ihn aufmerksam an. Für einen Moment schien es ihm, als ob die Zeit nicht mehr vergehen würde und er merkte vor allem, dass ihm sehr warm wurde. Der Than war erstaunlich klein. Er hatte eine sehr helle Haut, ohne Fell, trug einen dunklen Brustpanzer und hielt sein langes dunkles Haar mit einem roten Band zurück, auf dem ein stilisierter Stachelblattbaum abgebildet war. Mit seinen mohnroten Augen sah er Keredor an und was für eine Autorität und Präsenz ging von ihm aus. Dies war der Bezwinger des Dreierbundes, der Befreier von Cybolis, der Herold der Götter und der Herr der Welt. Wahrlich, das war er!
Zu dem Einog musste Keredor aufschauen. Zunächst sah er nur die gewaltigen Stoßzähne, die sich in Augenhöhe fast berührten. Die Haut des Einogs war wie die einer Echse und der stützte sich auf einen gewaltigen hölzernen Stab. Mit schwarzen pupillenlosen Augen sah der Einog ihn an. Es waren uralte Augen, die die Geschehnisse vieler Zeitalter gesehen hatten, und Keredor spürte, dass sie bis in sein Innerstes sehen konnten. Wie erstarrt sah er zu dem Einog und hatte das Gefühl, dass seine Beine nun sehr bald nachgeben würden. Dann sprach der Einog zu ihm. „Wie können wir dir helfen, mein Freund?“, fragte er mit einer seltsam kehligen und gleichzeitig zutiefst vertrauenserweckenden und freundlichen Stimme. „Du brauchst keine Furcht zu haben“, sagte er und berührte Keredor vorsichtig an der Schulter. „Was hast du auf dem Herzen?“ „Ich weiß nicht, Herr“, stammelte Keredor. „Mir ist heute etwas Seltsames widerfahren. Ich bin ein einfacher Händler auf dem Markt von Cybolis. Seit Wochen werde ich bestohlen. Endlich habe ich heute den Dieb gefangen, aber es ist ein Junge. Er sitzt nun im Keller meines Hauses in meinem Lager. Was soll ich nur mit ihm tun?“ Die tiefschwarzen Augen des Einogs ruhten auf Keredor, während er ihn für einen Moment schweigend ansah. Dann antwortete er: „Weißt du es denn nicht selbst bereits? Es hat einen Grund, dass der Junge nun bei dir ist. Du sollst für ihn sorgen in dieser schweren Zeit. Sorge für ihn und zeige ihm dein Handwerk. Er wird dir das, was er dir weggenommen hat, um ein Vielfaches wieder zurückgeben.“ Noch einmal klopfte der Einog M´Attar ihm aufmunternd auf die Schulter, dann zog er gemeinsam mit dem Than und Celthach weiter und Keredor blieb wie betäubt am Straßenrand zurück. Dann bahnte er sich verwirrt seinen Weg durch die Menge und alle hatten gesehen, dass er mit dem Einog gesprochen hatte und dass dieser ihn berührt hatte. So traten sie voll Respekt vor ihm zurück.
Keredor legte das letzte Stück Röstbrot auf seinen Teller und sah sich nachdenklich in seinem grünen Innenhof um. Einige der großen gelbschnäbeligen Vögel hatten sich auf dem Baum vor ihm niedergelassen und beobachteten interessiert, wie er seine Morgenmahlzeit einnahm. In der Tat, so war das damals, als Lethril zu ihm kam und er hätte es nicht für möglich gehalten, welche Folge der Rat des Einogs für ihn hatte. Nein, das hatte er nicht.
Als Keredor seinen Arbeitstag beendet hatte, seine Waren verstaut waren, die Stände abgebaut und seinem Verkäufer den Tageslohn ausgezahlt hatte, kehrte der müde zu seinem bescheidenen Haus zurück, das er zu jener Zeit mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn bewohnte. Doch statt sich zu seiner Familie zu begeben, zündete er sich eine Kerze an und ging hinunter zu dem Jungen in den Lagerkeller. Im Keller war es inzwischen kühl in diesen Abendstunden und es gab dort kein Licht. Der Junge hatte sich auf einen Stoffballen gesetzt, damit er mit den bloßen Füßen nicht den kalten Boden berühren musste. Er sah ihn aus der Entfernung mit in der Dunkelheit funkelnden gelben Augen an. Sein Fell war überwiegend schwarz, nur auf der Stirn war ein leuchtend weißer Fleck zu sehen. Seine Kleidung bestand aus einem völlig zerschlissenen grauen Oberteil und einer kurzen braunen Hose. Keredor setzte sich ihm gegenüber auf einen anderen Stoffballen, sah ihn an und fragte: „Warum hast du mich bestohlen, Junge?“ „Den Topf wollte ich gegen Essen tauschen, Herr“, antwortete der Junge leise. „Ich wollte nicht verhungern.“ Keredor nickte, sah nach unten auf den Kellerboden und fragte schließlich: „Wenn ich dir täglich genug zu essen gebe, würdest du dann für mich arbeiten, ohne dass ich befürchten müsste, dass du mich wieder bestiehlst?“ Der Junge war von dem Stoffballen aufgestanden, blickte Keredor nun an und antwortete: „Herr, wenn ich genug zu essen hätte, dann müsste ich doch nicht mehr stehlen. Ich würde gerne jede Arbeit für Euch ausführen.“ Keredor erfuhr nun, dass der Junge Lethril hieß und seine Eltern Bauern in West-Belkant waren. Sie waren im Krieg von den Grauden erschlagen worden und Lethril war nach Cybolis gegangen, um zu überleben.
Keredors Frau war an diesem Abend überhaupt nicht erfreut. Nicht nur, dass ihr Gatte die Besorgungen, die sie ihm aufgetragen hatte, auf dem Markt nicht erledigt hatte, nicht nur dass die Tageseinnahmen mehr als zu wünschen übrig ließen – nun saß auch noch dieser verlauste und schmutzige Bursche neben ihrem Sohn an der Tafel und schlang große Mengen von dem guten Gemüseeintopf herunter. Therdor, ihr Sohn, schaute den Fremden fassungslos dabei zu. Ohne zu fragen, hatte sein Vater ihm diese fürchterliche Kleidung gegeben, die die Tante ihm geschenkt hatte. Nicht, dass er darauf Wert gelegt hätte, aber was soll dieses Nichts von einem Bauernsohn hier in ihrem Haus. Es gab ein Gästezimmer in dem Haus und sein Vater bestand tatsächlich darauf, dass Lethril zunächst dort wohnen würde.
Gleich am nächsten Morgen nahm er den Jungen mit auf den Markt und sein Verkäufer staunte nicht schlecht, als er ihn wiedersah. Auch die alte Casia war wenig erfreut und warf ihnen misstrauische Blicke zu. Keredor behielt ihn im Auge, aber der Junge gab sich alle Mühe, die Aufgaben zu erfüllen, die sein neuer Herr ihm stellte. Tatsächlich konnte er schon am ersten Markttag zufrieden sein, denn für die Verpflegung und die Unterkunft in seinem Haus hatte er einen willigen und fleißigen Helfer gefunden, der rasch lernte und sich nicht schonte. Von Woche zu Woche wurde es selbstverständlicher, dass der Kaufmann Keredor einen neuen Gehilfen hatte und es dauerte auch nicht lange und Lethril bekam von der alten Casia jeden Tag unauffällig eine kleine Portion von ihrem eingelegten Fisch. Keredor fand das sehr erstaunlich.
Dann kam der Tag, als die Frau des Großmeisters der Getreidegilde wieder ihren wöchentlichen Marktgang unternahm und zusammen mit einer Gehilfin zu seinem Stand kam. Keredor verbeugte sich eifrig und war sogleich in ein umfangreiches Gespräch verwickelt, bei dem es sowohl um die Vorzüge einer soeben eingetroffenen Kupferkasserolle aus der Westmark als auch um einen tiefroten Schal aus Kampten ging. Die Frau Großmeisterin war noch gar nicht überzeugt. War der Schal nicht zu aufdringlich für den Geburtstag der Schwägerin? Diese Kasserolle: War diese seltsame Form auch gut zu reinigen? Mit unvermuteten Krachen landete da eine Person mit dem Kinn voran auf der Warenauslage unmittelbar vor der Frau Großmeisterin und der neue junge Gehilfe Keredors drehte ihr den Arm in eine offenbar äußerst unvorteilhafte Position. „Lauf und sage es allen weiter“, sagte der junge Gehilfe zu der ausgemergelten Gestalt. „Solange ich hier bin, wird hier nichts gestohlen. Versuche es nicht noch einmal.“ Dann versetzte er der Person einen Tritt und ließ sie humpelnd davoneilen. Die Frau Großmeisterin war überhaupt nicht erfreut. Solange solche zwielichtigen Zustände an seinem Stand herrschten, wüsste sie nicht, ob sie sich noch einmal zu ihm wagen sollte. Auch die Ware ließ nun schon seit einiger Zeit zu wünschen übrig. Auch ihrem Mann habe sie schon berichtet und gerade heute würde sie einiges zu erzählen haben. Keredor entschuldigte sich vielmals, verbeugte sich unaufhörlich und selbstverständlich würde er der Frau Großmeisterin den Schal und die Kasserolle für die Unannehmlichkeiten als persönliches Geschenk mit Gruß an den Gemahl überreichen wollen. Schwer atmend musste sich Keredor nach diesem Vorfall auf der Warenablage abstützen und wusste nicht, ob er Lethril für seinen Einsatz loben oder tadeln sollte. „Warum darf diese hässliche dicke Frau so mit Euch sprechen, Meister?“, fragte Lethril verwundert. „Weil unser aller Brot davon abhängig ist, dass Frauen wie diese wieder kommen“, antwortete ihm Keredor.