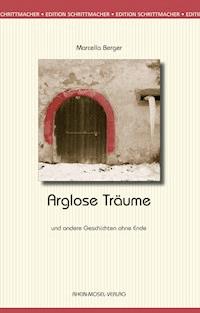
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edtion Schrittmacher
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
'Arglose Träume und andere Geschichten ohne Ende' – das sind spannende und faszinierende Episodenerzählungen. Wie die Prosa zu Paolo Contes Liebesliedern kommen diese Geschichten daher, spezifisch in Timbre und Rhythmus, mit unverwechselbarem Sound in einem atmosphärisch dichten Raum. Hell ausgeleuchtet sind die Szenen und Szenarien, in denen sich die Protagonisten bewegen – und von bemerkenswerter Tiefenschärfe. 'Amüsant, sarkastisch, hintersinnig', urteilt die Presse – ein Lesevergnügen mit Tiefgang, 'Texte, deren Poesie einem nachgeht'. (Saarbrücker Zeitung). 'Marcella Bergers kraftvolle Prosa, gedankliche Tiefe, feine Charakterisierung und die poetischen Bilder gefallen sehr!' (Pfälzischer Merkur). Die Autorin ist 'ganz dicht an ihren Figuren, schildert Gedanken, Träume und Irrtümer. Diese genauen Schilderungen, diese verschiedenen Blickwinkel der Verletzlichkeit und der Missverständnisse verdienen es, gelesen zu werden.' (SWR2 aus dem Land – Musik und Literatur)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Sigfrid Gauch, Arne Houben und Gabriele Korn-Steinmetz.
© 2009 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-777-0 Lektorat: Michael Dillinger Titelfoto: Axel Kiltz
Marcella Berger
Arglose Träume und andere Geschichten ohne Ende
Erzählungen
Edition Schrittmacher Band 19
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Inhalt
1. Buch:Wunschlose Zonen2. Buch:Kisses ’n Rosi3. Buch:Der Hund in der Fremde4. Buch:Arglose Träume5. Buch:Nubische Bemalung6. Buch:More Orpheus!
1. Buch:Wunschlose Zonen
Die Fahrt zum Kap
»Um fünf kommt der Bestatter«, sagte sie und war erstaunt über den Gleichmut, mit dem er die Nachricht aufnahm. Aber er war ja auch tot.
Als sie am Morgen ins Zimmer kam, hatte er mit halb geöffneten Augen im Bett gelegen. Herzversagen, hatte der Notarzt gesagt.
Aus Kurts Gepäck quollen Hemden, T-Shirts, Socken, lauter dunkle Sachen. Selbst unter tropischer Sonne hatte er nur schwarz und anthrazit getragen.
Vroni betrachtete die Bücher und Medikamente, die auf dem Boden lagen, die Wäsche, die aus den aufgerissenen Taschen hing. Noch in der Nacht musste er alles hochgeschleppt haben. Da schlief sie längst, unten, im Anbau. Aus Höflichkeit hatte sie noch einen Whisky mit ihm getrunken, als sie endlich daheim waren, und sich dann verzogen. Doch Kurt musste sich fit gefühlt haben. Hatte das gesamte Gepäck entladen, -zig Koffer und Taschen, denn wie ein Kolonialbeamter des neunzehnten Jahrhunderts führte er auf Reisen den halben Hausstand mit sich, und sich dann Bitter Moon reingezogen – die DVD-Hülle lag heute Morgen auf dem Couchtisch.
Wenn er mit einer Flasche Hochprozentigem allein gelassen wurde, sah er sich mit Vorliebe Bitter Moon an. Mit einer halben Flasche Schnaps im Kopf ging ihm Polanskis Erotik-Thriller um Obsession und Erniedrigung, wie auf dem Cover stand, wohl direkt ins Blut.
Danach hatte er sich zum Sterben gelegt. Sich ins Bett gelegt, um nicht wieder aufzustehen. Aus. Fini. Klappe. Nichts mehr zu machen, hatte der Notarzt gemeint. »Ihr Mann ist schon in der Nacht gestorben. Ist sicher schon sechs, sieben Stunden her.«
Sie öffnete ihren Samsonite und hob mit beiden Händen Kleidung und Wäsche heraus, um sie nach Farben und zulässiger Temperatur zu sortieren.
Sie griff in den Berg sich bauschender Seide in verschiedenen Rottönen, Sachen, die sie in Indien gekauft hatte, zog eine karmesinrote Bluse heraus, ärmellos, im Tunika-Stil, die ihr besonders gut gefiel, und hielt sie vor sich. Dann warf sie alles in einen Plastikbottich und stopfte Kurts Sachen in die Maschine. Als der Waschvorgang einsetzte und die Trommel die Stoffmasse hin- und herzuklatschen begann, sagte sie »na gut, na gut!« und holte tief Luft.
Die Reise war von der ersten Minute an ein Desaster gewesen, und es wurde auch nach der Ankunft in Vijayawada nicht besser. Sie hatten einen Wagen samt Fahrer gemietet, aber Kurt nannte den Mann bald einen durchtriebenen Lumpen, der Umwege fahre, um den Preis hochzutreiben. Es gab ständig Ärger mit irgendwem, und Kurts Laune verschlechterte sich von Tag zu Tag, von Ort zu Ort.
In Madras blieben sie eine Woche. Chennai hieß die Stadt jetzt, aber Vroni mochte den alten Namen lieber, weil er ihr farbiger und prächtiger vorkam. Auch wenn ihm der Makel der Kolonialzeit anhaftete.
Kurt nutzte die Zeit, um den Ort zu besichtigen, an dem Rajiv Gandhi ermordet worden war, und um seine Kontakte zu indischen Filmproduzenten aufzufrischen – vielleicht waren sie irgendwann einmal nützlich. »In meinem Metier muss man die Schnauze in jedes Mauseloch stecken«, sagte er.
Vroni wäre gerne länger in Madras geblieben, aber Kurt hatte sich die Kapspitze in den Kopf gesetzt und hielt verbissen an dem Plan fest. Sie waren schon im Golf von Mannar und Kap Comorin lag nur mehr ein paar Autostunden entfernt, als sie ihm vorschlug, die Reise ohne sie fortzusetzen. Doch das wollte er nicht, und weil sie sich weigerte weiterzufahren, mieteten sie sich in einer schönen, nicht sehr großen Bungalow-Anlage unter Hibiskus-Dächern ein. Das Resort wurde von einer hochgewachsenen Burmesin betrieben, und Jeeval, ihr Mann, chauffierte Vroni mit seinem Pick-up zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Meist fuhren sie schon vor Tagesanbruch los. Sie verließ dann die Kühle des klimatisierten Bungalows, wo Kurt schnarchend seinen Rausch ausschlief, und tauchte in das weiche Tropendunkel ein wie in eine Umarmung. Ihr Fahrer wartete mit abgestelltem Motor vor der kleinen hölzernen Veranda, um sie zu Ashrams, Tempeln und Heiligtümern zu bringen, wo sie in Stein gemeißelte Kopulationen besichtigte, die nie zu einem Ende zu kommen schienen, glatte, gebogene Leiber und vielgesichtiges Schmunzeln.
»Na gut«, sagte Vroni. Jedes »na gut« war Fürbitte und Dankgebet in einem, na gut, na gut, na gut, eine beruhigende und tröstende Litanei, besänftigend und beschwichtigend wie der Rhythmus der sich bewegenden Wäschetrommel, das Gurgeln, Plätschern und Rumpeln.
Sie gab ein wenig Feinwaschpulver in den Bottich mit den Seidenkleidern und drückte den widerspenstigen Stoff unter Wasser. Es färbte sich rosa. Die Spuren der Reise, Signal- und Botenstoffe, Blut, Schweiß und Tränen, wurden jetzt in dieser Brühe gelöst.
Sie spülte ihre seifigen Hände ab und cremte sie sorgfältig ein. Es war jetzt zwei Uhr, in drei Stunden kam der Bestatter.
Sie ging zu Kurt hinüber und setzte sich in den Sessel neben dem kleinen Regal. Eigentlich hätte sie Kurt gerne noch bis morgen behalten, aber der Bestatter hatte Einwände. »Wir sollten nicht so lange warten«, sagte er am Telefon. »Wir sollten ihn noch heute holen. Morgen kriegen wir ihn nicht mehr gut die Treppe runter!« Einen Moment lang war es ganz still in der Leitung, dann fügte er hinzu: »Bedenken Sie, er ist ein großer und schwerer Mann!«
Kurt lag friedlich da, ruhig und gleichgültig. Die Sonne fiel in einem breiten Streifen auf das Fußende des Bettes. Das Messinggestell glänzte, und der Staub tanzte im Licht.
Kurts Kinn war trotzig vorgereckt. Seine Kinnlade zeigte in abstruser Selbstbehauptung zur Zimmerdecke. Dass er ein derart kräftiges Kinn besaß, war ihr zu Lebzeiten nie aufgefallen. Er sah jetzt aus wie Jerry Lewis.
Der Gedanke an den Komiker war Vroni unangenehm, sie hatte den exaltierten Schauspieler noch nie leiden können. Sie war froh, dass Irma bald da sein und sich um alles kümmern würde. Irma kam mit allem zurecht, Irma konnte man, ohne sie zu überfordern, getrost ein Dutzend Neugeborene anvertrauen.
»Ich lege mich mal kurz hin!«,sagte Vroni, als ihre Cousine eintraf.
»Mach das, Schätzchen, mach das!«, antwortete Irma, offensichtlich erleichtert, freie Hand beim Sichnützlichmachen zu haben.
»Das hat dir bestimmt gut getan, das Stündchen Schlaf!«, rief sie fröhlich, als Vroni ins Wohnzimmer zurückkehrte. »Stell dir vor, es ist schon halb sechs, der Rehbein ist längst überfällig!« Sie war damit beschäftigt, die raumhohe Zimmerlinde kräftig zu wässern.
Vroni brauchte eine Weile, um sich an den seltsamen Namen des Bestatters zu erinnern – Rehbein, ja richtig!
Sie stellte sich in die offene Verandatür. Die Sonne war hinter Wolken verschwunden. Ein Windstoß fuhr durch den Garten, bog die Gräser, ließ die Zweige tanzen. Sie fühlte sich jetzt entspannt und frisch, und das Atmen fiel ihr ganz leicht.
»Was?«, rief Irma von der Küchentheke herüber.
»Ich hab nichts gesagt!« Sie sah zu, wie die Baumkronen und die Sträucher vom Wind geschüttelt wurden. »Wenn es Gewitter gibt, ist da so eine Schwingung.«
»Was?« Emsig klapperte Irma mit Geschirr.
»Ist schon gut!«, sagte Vroni. »Es liegt was in der Luft!«
»Ein Gewitter!« Irma stand jetzt neben ihr und hielt ihr eine Tasse Kaffee hin. »Es kann nicht mehr lange dauern. Da, trink! Ist gut für den Kreislauf!«
Es klingelte.
»Endlich!« Irma eilte zur Tür. »Das ist der Rehbein! Ich mache auf!«
Der Bestatter kam mit drei Gehilfen und prüfte mit kritischem Blick die Lage. Sie luden den Sarg aus dem Auto und schoben ihn auf einem Hydraulik-Gestell bis an die Haustür. Dann gingen sie nach oben. Und dann lag Kurt im Sarg.
Seine Haare waren in Unordnung geraten, und Vroni nahm eine kleine Bürste vom Garderobenschrank, um ihm das Haar in die Stirn zu streichen. Jetzt sah Kurt aus wie Charles Bronson in Ein Mann sieht rot. Ein bisschen älter vielleicht.
Der Bestatter protestierte, weil das seine Aufgabe sei, zog einen schmalen Hornkamm aus seiner Brusttasche und kämmte Kurts Haar glatt nach hinten.
Der Sarg wurde auf das Fahrgestell gehievt und auf kleinen Gummirädern über den Gartenweg gefahren. Der jüngste der Gehilfen, vermutlich der Lehrling, lief voraus, um das Gartentor aufzuhalten, neben dem der Goldregen in diesem Jahr wirklich prachtvoll blühte. Die beiden anderen Männer schoben das Gefährt. Rehbein schritt hinterher, nachdem er Vroni den kleinen Stahlschlüssel für die Leichenhalle ausgehändigt hatte.
Der Sarg wurde auf die Ladefläche geschoben, und die rückwärtigen Türen fielen ins Schloss. Es hörte sich satt und zufrieden an.
Dann fuhren die Männer mit Kurt davon.
Vroni sah ihnen nach, bis sie verschwunden waren, die Finger fest um das flache Metall gelegt. Sie würde Kurt noch einmal kämmen, ganz am Schluss, kurz bevor es losging. Dann konnte niemand mehr etwas dagegen tun.
Muttergottesvögel
Als sie nach unten kam, war die Halle leer. Nur ein Kind von acht oder neun Jahren saß an dem schweren Holztisch in der Mitte des Raumes. Das Mädchen sah kurz von seinem Buch auf, sagte freundlich »Hallo« und las weiter.
Die Frau erinnerte sich nicht, es gestern Abend beim Essen gesehen zu haben. »Hallo! Hast du eine Ahnung, wie spät es ist?«
»Halb zwölf. Ich soll dir ausrichten, dass die anderen auf den Markt gegangen sind und der Kaffee in der Küche steht.«
Jemand übte Geige, Brahms, Streichquartett Nummer zwei. Oder drei. Langsamer Satz. Die Tür zum Garten stand offen, und die Töne schienen von draußen zu kommen. Als sie auf die Terrasse trat, war die Musik aber kaum noch zu hören. Und doch schnürte es ihr die Kehle zu, und sie legte den Kopf in den Nacken, damit es wieder versickere, das Augenwasser. Dahin zurücklaufen, wo es hergekommen war. Vorbei! Schnitt! An etwas anderes denken!
Sie saß im Schatten und wartete, bis der Anfall vorbei war. Dann ging sie wieder ins Haus, nahm eine Tasse aus dem Schrank und goss Kaffee hinein. Die Kanne war mit einem Geschirrtuch umwickelt und der Kaffee noch warm.
Sie ging um das Haus herum. Gestern waren sie bei Dunkelheit angekommen, und sie hatte das Gebäude nur schemenhaft wahrgenommen. Jetzt sah sie, dass sie in einem kleinen alten Chateau untergebracht waren. Portallöwen hoben drohend die Tatzen, und ein Wappen zierte, stellenweise verwittert und vom Regen ausgewaschen, den Eingang. Mühelos erkannte sie ein vierspeichiges Rad und einen Fisch, doch das Tier mit dem Schweif hielt sie zunächst für ein Pferd. Dann entdeckte sie das Horn auf seiner Stirn. Stell dir vor, ein Einhorn auf einem Wappen!, sagte eine Stimme in ihr.
Stell dir vor – das war die Formel gewesen. Roberta beim Heimkommen: Mit Schwung flog die Tür auf, Tasche und Jacke fielen auf einen Sessel, stell dir vor, was ich gerade erlebt habe! Sie brachte Geschichten nach Hause wie kleine Geschenke, Komisches, Anrührendes, Merkwürdigkeiten, die manchmal nur Roberta merkwürdig vorkamen, Fundstücke, Beutestücke. Vorbei! Nicht daran denken, nein!
Sie ging ein paar Schritte die Auffahrt hinunter. Katzenkopfpflaster, dachte sie, und dass die kleinen, abgerundeten Steine des Wegs wirklich wie die Schädel grauer, kräftiger Kater aussahen. Dann bog sie wieder in den Garten ein, streifte violett blühende Büsche, schlenderte unter knotigen Bäumen mit spitzig-harten Blättern und folgte dem Pfad durch Brombeerhecken bis an ein verrottetes Lattentor in der Mauer.
Sechs Tage wollten sie bleiben. Lass alles hinter dir, hatte Stefan gesagt, wenigstens für ein paar Tage. Auf andere Gedanken kommen. Andere Luft atmen, bretonische. Sich von bretonischen Mücken stechen lassen, bretonische Musik hören, das Rauschen des bretonischen Meeres. Und des nicht-bretonischen, des ortlosen Ozeans.
Das Mädchen saß immer noch in der Halle, als sie zurückkam.
»Was liest du denn?«
»Die Nachtkinder!«
»Oh, das ist schön, das hab ich auch gelesen, als ich so alt war wie du. Gefällt es dir?«
»Hm.«
Das Kind hob nicht die Augen, und die Frau ging in der Küche, wo im Brotkasten frische Croissants lagen. Als sie in eines hineinbiss, wurde es sofort eng im Hals, und sie legte die Stirn auf die kühle Tischplatte.
Der Schmerz kam in Wellen, wie Wehen. Er näherte sich, umklammerte sie und presste sie zusammen. In ein paar Minuten würde eine unsichtbare Hand den Schraubstock aufdrehen, das wusste sie.
Sie wartete, bis sie wieder Luft bekam, füllte ihre Tasse erneut, gab viel Zucker dazu und tunkte das Gebäck in die lauwarme, süße Flüssigkeit.
Wenn sie erst wieder zu Hause war, musste sie loslegen. Schneiden, texten, die Musik aussuchen. Wenn sie wieder daheim war, würde sie keine Zeit mehr verlieren. Ging auch gar nicht, die Redaktion war ihr schon weit entgegengekommen, hatte die Abnahme ganz nach hinten verschoben. Sie konnte sich nicht beklagen, man nahm Rücksicht auf sie. Aber sie wollte ja arbeiten, sich hineinstürzen in das Material. Ihr Kopf war voll war von Bildern, Bilder, die sortiert, geordnet, in eine Abfolge gebracht werden mussten. Wenn die bretonische Auszeit vorbei war, die Zeit mit Stefan und seinem Freund Joschi, die Musiktage auf Noirmoutier, würde es vorangehen müssen mit der Arbeit, mit den fünfundzwanzig Kassetten. Wenn sie nicht wieder vor dem Bildschirm saß wie vor einer Wand. Wie in den letzten vier Wochen.
»Störe ich dich?«
»Nein!« Das Kind sah sie ruhig und aufmerksam an. »Wie heißt du?«
»Mara!«, erwiderte die Frau. »Und du?«
»Edith!« Das Mädchen ließ das offene Buch gegen die Brust sinken. Es tat dies in einer geschmeidigen Bewegung und hielt den Pappeinband mit schmalen Fingern, die nicht die eines Kindes, sondern einer jungen Frau zu sein schienen. »Hab ich noch nie gehört, Mara, den Namen!«
»Eine Abkürzung.«
»Abkürzung wofür?«
»Marina.«
»Ach so!« Das Kind stand auf und kam mit einem Glas grüner Limonade aus der Küche zurück. »Marina heißt Hafen«, sagte es und blieb in der Tür stehen, um zu trinken.
»Stimmt! Und geboren bin ich als Wassermann!«
Edith setzte sich ihr gegenüber und stützte das Gesicht in beide Hände. »Wo kommst du denn her?«
»Aus Wasserbillig!«
Sie lachten.
»Gibt es da billiges Wasser?«
»Saures, Wasserbillig liegt an der Sauer, das ist ein kleiner Fluss!«
»Du willst mich auf den Arm nehmen!«
»Nein, Ehrenwort, es liegt an der Sauer. Na ja, und an der Mosel. An der Mündung in die Mosel.«
»Sauer!«, wiederholte Edith und verschränkte grinsend die Arme hinter dem Kopf. »Und gibt es auch eine Süß?«
»Nicht dass ich wüsste!« Sie lachten wieder.
»Hat man vielleicht nur noch nicht gefunden«, meinte das Kind und fügte nach einer kleinen Pause hinzu: »Ich finde den schön, den Fleck!«
Die Frau wusste, dass das Mädchen den Leberfleck auf ihrer Oberlippe meinte. Hexenfleck! Hab noch mehr davon. Könnte dir gerne ein paar abgeben.
Dass das Geigenspiel seit geraumer Zeit verstummt war, fiel ihr erst auf, als eine Frau mit einem Instrumentenkasten eintrat.
»Wo ist Udo?«, fragte das Kind.
Die Schlösser des speckig glänzenden Lederkoffers sprangen auf, vorsichtig wischte die Musikerin über den fuchsgelben Lack der Violine. »Am Strand«, sagte sie. »Er wird aber bald zurückkommen, es wird ihm zu heiß werden in der Sonne!«
Sie schloss den Koffer wieder und legte ihn auf den Büffetschrank. Dann ging sie hinaus, und Edith folgte ihr.
Hortensien in hölzernen Pflanzkübeln, deren Anstrich abgeblättert war, säumten die äußere Gartenmauer. Nur an wenigen Stellen bedeckten Reste rostbrauner Farbe das Grau verwitternden Holzes. Hinter dem ummauerten Gelände begann freies Feld. Von dort kam heiseres Krähengezänk. Die Frau schlug den Weg in den Ort ein. Das Pflaster glänzte vor Nässe. In den Vertiefungen sammelte sich Wasser. Offenbar war die Straße vor kurzem besprengt worden. – Dass Roberta damals plötzlich wieder da war, nach all den Jahren, das war wie ein Wunder gewesen. Sie sah sich noch gegen die Bücherwand gelehnt, den Hörer mit der Stimme, die »ich bin’s!« sagte, ans Ohr gepresst, eine Stimme, die sie im ersten Augenblick nicht erkannte, Robertas Stimme, eine Stimme als freier Fall, als Sturz durch die Zeit, zurück, zurück, ins Vertraute. Ein Jahr war das jetzt her. Ein Jahr Dasein. Und dann der Unfall.
Als sie nach der Landung zu Hause anrief, zu Hause, wo Roberta war, wo Roberta hätte sein sollen, wo sich aber ein Mann meldete, hatte sie zunächst gedacht, sie habe sich verwählt und wortlos aufgelegt. Doch beim zweiten Versuch war der Mann immer noch da, und es war Stefan, der alte Freund, der Kumpel, der jahrelang die Pflanzen gegossen hatte, wenn sie auf Reisen war, und die Katze gefüttert und der jetzt sagte: Wildunfall. Direkt ins Auto. Nicht angeschnallt. Ein Wildschwein, Roberta! Stell dir das einmal vor! Ein Wildschwein hat dir das Genick gebrochen! Zack! Zack! Zack!
Wieder kroch das Brennen von der Spitze des Brustbeins in ihre Kehle hoch. Sie schluckte und blieb vor der Auslage eines kleinen Ladens stehen. Mit blinden Augen sah sie auf Schmuck, auf Broschen, Ketten, Ringe, Uhren. – Drei Uhr nachts im Pfälzer Wald, was hatte Roberta da zu suchen gehabt? Was war dort passiert, während sie sich im südchinesischen Meer rumtrieb, am anderen Ende der Welt, drei Wochen Dreh in Brunei, drei Wochen Mangrovenwälder, Kannenpflanzen und das irre gläserne Labyrinth des Sultanspalastes. Was wollte Roberta mitten in der Nacht im Pfälzer Wald, am Gelterswoog? Schwimmen war sie bestimmt nicht. Vor dunklem Wasser hatte sie Angst, das war ihr unheimlich. Schwimmen war ausgeschlossen. Wäre sowieso eine saublöde Idee gewesen, mitten in der Nacht, allein. Aber vielleicht war sie ja gar nicht allein. Vielleicht, vielleicht – man wurde verrückt, wenn man nicht damit aufhörte. Es war ja auch ganz egal. Das Schlimmste war sowieso dieses Ziehen in den Fingern, der Schmerz in den Kuppen, das Verlangen nach Robertas Haut. Wenn nur dieses ziehende Verlangen nicht wäre! Das war das Unerträglichste von allem, dieses richtungslose Ziehen in den Fingern.
Einen Schritt nach dem anderen tun. Wie ein Kleinkind, das laufen lernt. Material sichten, solange Material zu sichten ist. Sichten und Schneiden und Abnahme. Einen Schritt nach dem anderen tun. Über die Runden kommen. Über die nächsten Tage. Und dann wieder die nächsten. Die nächsten Kassetten durchsehen. Den nächsten Film in Angriff nehmen. Aber erst mal Brunei. Sichten, schneiden, abnehmen. Erst mal Waran, Mangrovenwälder, Glaspalast. Der Waran war natürlich ein Glücksfall. So etwas konnte man nicht planen. Aber draufhalten, wenn es einem über den Weg lief. Den Waran in der Küche würde sie in jedem Fall auch in den Trailer nehmen. Ein Riesenvieh, bestimmt drei Meter lang. Ein richtiger Drache. Ihr Kameramann hatte sich geistesgegenwärtig hinter einem Tisch verbarrikadiert, als das Monster über Teller, Tassen und Töpfe stieg. Einen Instinkt für Bilder hatte der Knabe und alles im Kasten. Auch den malaiischen Wirt. Wie das schmächtige Männlein schreiend, mit hochgerissenen Armen, im Dschungel verschwand! Ja, mit dem Kameramann hatte sie einen guten Griff getan. Sie konnte aus dem Vollen schöpfen. Sie musste nur durchhalten.
»Kann ich mit dir kommen?« Edith stand neben ihr. »Wir sind schon seit einer Woche hier. Soll ich dir die Stadt zeigen?« Das Kind schob seine Hand in die ihre. »Guck mal, die Schwalben da vorne!«
Sie folgte Ediths Blick. Die Vögel flogen auf einen Giebel zu und krallten sich in der Hauswand fest. Sie dachte erst, die Tiere wollten sich paaren, aber sie schienen nur ein Schwätzchen zu halten. Dann flogen sie wieder weg.
»Die machen das den ganzen Tag«, sagte das Kind. »Ich wüsste gern, warum!«
Wieder steuerte ein Vogel den Giebel an, und kaum war er da, flatterte ein zweiter herbei. Eilig besprachen sie sich. Dann schossen sie wieder davon.
»Ich glaube eigentlich nicht an Schwalben-Tratsch!«, sagte das Mädchen, zog seine Hand aus der ihren und steckte sie in die Tasche seiner gestreiften Strandhose. »Ich glaube nicht, dass sie sich erzählen, wer Junge gekriegt hat. Oder wer gestorben ist!«
»Vielleicht reden sie ja über uns!«, meinte die Frau.
»Vielleicht!«, antwortete das Kind und sah zu Boden.
Die Frau hätte gerne einen Scherz gemacht, es fiel ihr aber nichts Passendes ein.
»Kennst du das Märchen Der treue Johannes?« Das Kind blieb direkt unter dem Schwalbengiebel stehen, unter dem aufgeregten Gezwitscher.
»Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Um was geht es denn da?«
»Da versteht einer die Sprache der Tiere, die Rabensprache. Aber das ist gar nicht gut, das bringt ihm gar nichts, nur Unglück. Keiner glaubt ihm, und es geht ihm ganz dreckig!«
»Und warum geht es ihm denn so dreckig?«
»Weil ihm keiner glaubt!«
Edith schob ihr Haarband vom Kopf, ordnete ein paar lose Strähnen und zeigte auf einen Kirchturm hinter den Dächern. »Schau, da vorne ist die Kirche, wo die Proben sind. Aber jetzt ist da niemand, die sind alle einkaufen oder am Strand.«
»Und warum bist du nicht am Strand?«
»Ach, ich bin lieber bei dir!«
Die Gasse öffnete sich auf den Kirchplatz. Seitlich, im Schatten der Platanen, spielten ein paar Männer Boule. Das Kind und die Frau setzten sich abseits auf ein Mäuerchen.
»Ist das dein Lieblingsmärchen, der treue Johannes?«, sagte die Frau, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.
Das Kind nickte, blieb aber stumm. Es sah zu den spielenden Männern hinüber. Die Boule-Kugeln lagen locker in ihren Händen und wurden ohne Anstrengung geworfen.
»Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte, es wird wohl das Totenbett sein, auf dem ich liege …« fing das Kind plötzlich in einem singenden Ton an zu sprechen. »Lasst mir den getreuen Johannes kommen! – Kennst du es jetzt?«
»Noch nicht. Vielleicht, wenn du mehr erzählst.«
»Der getreue Johannes war nämlich sein liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war.«
Die Frau nickte. »Und was musste der treue Johannes ma-chen?«
»Auf den Königssohn achtgeben. Aufpassen, dass der nicht das Bild der Königstochter vom goldenen Dache sieht! – Als er nun vor das Bett kam, sprach der König zu ihm: Getreuester Johannes, ich fühle, dass mein Ende herannaht, und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch in jungen Jahren, wo er sich nicht immer zu raten weiß. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen muss, und sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen.«
Das Kind schien den gesamten Text auswendig zu kennen.
»Und dann?«, fragte die Frau. »Was passiert dann?«
»Er soll ihm das ganze Schloss zeigen. Nur die letzte Kammer nicht. Weil da das blöde Bild hängt, und das soll er nicht sehen, weil er dann in Ohnmacht fällt vor lauter Liebe und in große Gefahr gerät.«
»Und? Verliebt er sich und wird ohnmächtig?«
»Klar!«, antwortete das Kind bestimmt und fast trotzig.
»Aber wenn es ein Märchen ist, geht es doch gut aus!«, sagte die Frau.
»Ja, am Schluss schon. Am Schluss ist alles gut, und die, die tot waren, sind wieder lebendig und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, basta!«
»Spielst du auch ein Instrument?«, versuchte die Frau nach einer kurzen, fast beklemmenden Pause das Gespräch wieder in Gang zu bringen.
»Klavier. Zu Hause. Und du? Spielst du auch was?«
»Nein, leider nicht! Ich mache nur Ferien hier, mit einem Freund, Stefan. Der spielt Klarinette. Mit ihm und seinem Freund Joschi. Der spielt Oboe.«
»Aha!«
Dann schwiegen sie wieder.
»Ich bin froh, dass du nichts spielst!«, sagte das Kind.
»Warum?«
»Weil du dann nicht üben musst!«
Vom Boule-Platz drang Lachen und erregtes Stimmengewirr. Offenbar waren sich die Spieler über die Wertung eines Wurfes nicht einig.
»Udo ist nicht mein Papa«, sagte das Kind unvermittelt. »Mein Papa ist gestorben. Udo ist Mamas Freund!«
Die Frau schluckte. Da war wieder der Kloß im Hals. Ist gar kein Kloß. Ist Blutandrang. Blut, das nicht abfließen kann.
»Das tut mir leid«, die Worte kamen hastig und stockend, »war er denn krank, dein Papa?«
»Ja! Willst du mal ein Foto von ihm sehen?«
»Ja, gern, wenn du eines dabei hast!«
Edith zog einen Brustbeutel aus ihrem T-Shirt und nahm ein kleines Foto heraus. Der Mann auf dem Foto sah Stefan zum Verwechseln ähnlich. Die Frau wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie legte ihren Arm um die Schultern des Kindes, das den Kopf wegdrehte, sich aber nicht entzog.
Als sie auf dem Rückweg an dem Schwalbenhaus vorbeikamen, saßen vier Vögel da.
»Man nennt sie auch Muttergottesvögel, die Schwalben«, sagte die Frau. »Aber ich weiß nicht genau warum. Hat irgendwas mit dem Bauernkalender zu tun, wann sie im Frühjahr kommen und wann sie im Herbst wieder fliegen und so.«
»Mein Teddy ist bei ihm, den hab ich ihm mitgegeben!«, sagte Edith, und sie blieben unter dem Zwitschern und Flöten stehen, unter dem Singen und Tirilieren wie unter einem lichten Zeltdach.
Beim Bäcker trafen sie Ediths Mutter. Das Kind schloss sich ihr an, und die Frau schlug den Weg zum Hafen ein.
Die gewaltigen Granitblöcke der Festungsanlage hatten einst unbedingte Wehrbereitschaft bekundet. Jetzt beherrschten Möwen die dunklen Mauern, kreischten ungeduldig und ließen Muscheln auf den Stein fallen. Dann stritten sie um das Fleisch aus den zerbrochenen Schalen.
Zu Hause waren Stefan, Joschi und ein weiterer Mann, Udo, mit dem Schuppen und Ausnehmen von Fischen beschäftigt. Sie erzählte von dem Foto in Ediths Brustbeutel. Die anderen wussten Bescheid. Ich muss wohl ein Doppelgänger sein, meinte Stefan.
Sie verstummten, als Edith und ihre Mutter eintraten. Die Einkäufe wurden ausgepackt, und Ediths Mutter verließ scherzend den Raum.
»Weißt du was, Udo?« Das Kind näherte sich mit schief gelegtem Kopf. Es hatte ein kokettes Lächeln aufgesetzt. Während du am Strand warst, haben Mara und ich dein Geheimnis entdeckt!
»Oha!«, antwortete der Mann, ohne seine Arbeit zu unterbrechen.
»Ja, wir wissen jetzt alles!«, trumpfte Edith auf.
»Ah! Und was ist das – alles?«
Jetzt war wieder die Geige zu hören, die gleiche Melodie wie am Morgen, innig und schwermütig. Das Mädchen stellte sich zu der Frau in die offene Terrassentür.
»Na, alles eben!«, erwiderte Edith schnippisch und zielte in einer blitzschnellen Bewegung mit dem Zeigefinger auf Joschi. »Und über dich auch!«
Joschi torkelte, wie von einer Pistolenkugel getroffen, gegen das Spülbecken.
Das Kind lachte und schob seine Hand, die heiß war und klebrig verschwitzt, in die der Frau. Es zögerte einen Moment, bevor es sich zu Stefan drehte und entschlossen sagte: »Und über dich natürlich auch!«
Stefan hielt den Fisch, den er gerade ausgenommen hatte, unter fließendes Wasser. »Mach mir keine Angst!«, sagte er lächelnd. »Bislang ist mir doch noch niemand auf die Schliche gekommen!«
»Bislang!« Edith dehnte das Wort bedeutungsvoll. »Bislang vielleicht schon! Aber du hast nicht mit den Schwalben gerechnet, die verraten uns alles!«
»Wir verstehen nämlich die Sprache der Tiere!« Die Frau drückte die schmalen Finger in ihrer Hand.





























