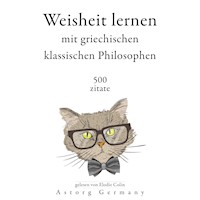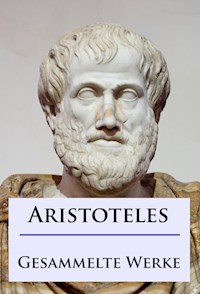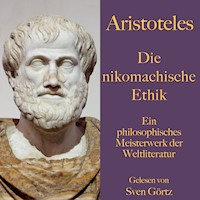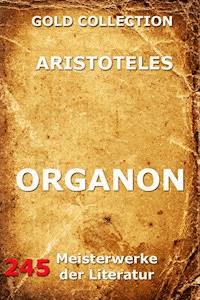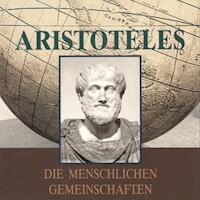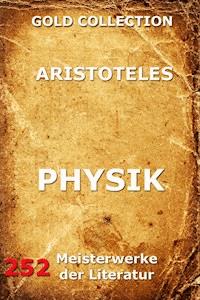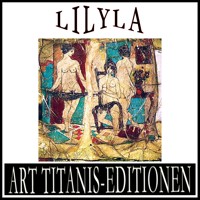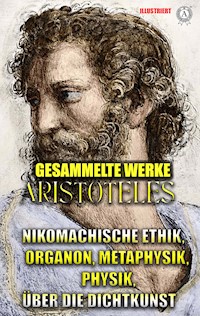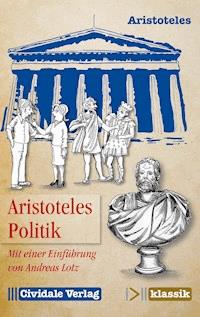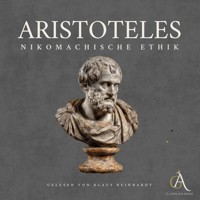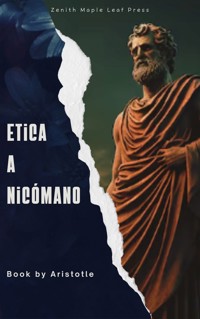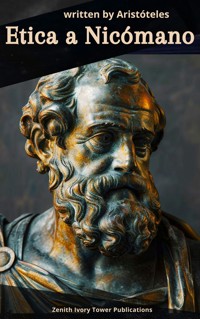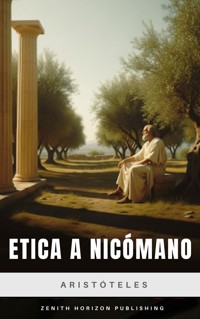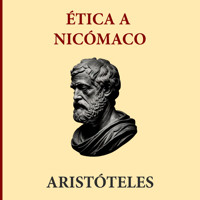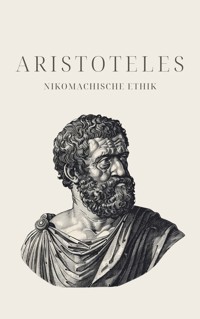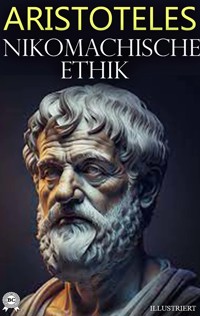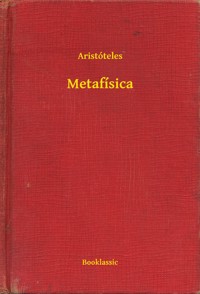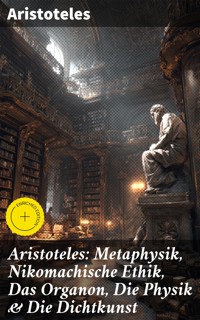
Aristoteles: Metaphysik, Nikomachische Ethik, Das Organon, Die Physik & Die Dichtkunst E-Book
Aristoteles
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
Aristoteles' compendium, encompassing the 'Metaphysik', 'Nikomachische Ethik', 'Das Organon', 'Die Physik', and 'Die Dichtkunst', situates itself at the crux of Western philosophical thought. Through a rigorous analysis of existence, morality, methodology, nature, and art, this collection presents a comprehensive framework of Aristotelian philosophy. His stylistic approach combines meticulous logical reasoning with accessible prose, allowing readers to engage deeply with complex ideas'—from the nature of substance in metaphysics to the principles of ethical conduct in his Nicomachean Ethics. Notably, this work showcases the synthesis of empirical observation and rational discourse that defined Aristotelian inquiry, which remains a cornerstone in the study of philosophy, ethics, and science. Aristotle, a towering figure in ancient Greek philosophy, studied under Plato and later founded his own school, the Lyceum. His diverse interests, spanning biology, ethics, politics, and aesthetics, reflect a relentless pursuit of knowledge and a belief in the interconnectedness of all disciplines. Such curiosity undoubtedly influenced his writing, driving him to encapsulate his vast intellectual legacy in a cohesive narrative that offers both theoretical insights and practical applications. This seminal work is highly recommended for anyone seeking a foundational understanding of Western philosophy. Its exploration of essential themes continues to resonate, making it an indispensable resource for students, scholars, and casual readers alike, eager to grasp the complexity and richness of human thought. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Aristoteles: Metaphysik, Nikomachische Ethik, Das Organon, Die Physik & Die Dichtkunst
Inhaltsverzeichnis
Einführung
This collection assembles five foundational treatises by Aristoteles—Metaphysik, Nikomachische Ethik, Das Organon, Die Physik, and Über die Dichtkunst—presented together to illuminate the breadth and internal coherence of his philosophy. It offers readers a structured view of his inquiries into being, knowledge, action, nature, and artistic representation. Rather than a miscellaneous assortment, the volume foregrounds a comprehensive intellectual project: to explain the world through causes, definitions, and ordered argument. The purpose is not to supply a complete corpus, but to gather texts that, read together, reveal how Aristotle’s method and concepts interlock across distinct domains, forming a durable architecture of understanding.
The works included are philosophical treatises originating in fourth-century BCE scholarly practice. They are not fiction, but technical texts that systematize investigation. Nikomachische Ethik is an inquiry in practical philosophy. Das Organon is the traditional designation for Aristotle’s logical writings, a collection that includes Categories, On Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics, Topics, and Sophistical Refutations. Metaphysik and Die Physik belong to theoretical philosophy, treating first principles and nature respectively. Über die Dichtkunst is a work of literary theory. These distinctive text types—ethical, logical, metaphysical, natural-philosophical, and poetics—exhibit a shared commitment to analysis, definition, and argumentative clarity.
Across these disciplines runs a unifying program: to seek explanations by identifying causes, principles, and structures proper to each subject matter. Aristotle’s hallmark methods include careful classification, attention to ordinary and expert opinions, the use of precise definitions, and the construction of rigorous arguments. The conceptual pair of form and matter, the distinction between potentiality and actuality, and the teleological orientation toward ends recur where appropriate. Logical tools developed in the Organon support demonstrative science in Posterior Analytics and inform investigations in physics and metaphysics; practical reasoning in ethics reflects a parallel concern for method suited to human action; poetics applies analysis to artistic making.
Nikomachische Ethik examines human flourishing and the virtues that enable it. It studies character, choice, habituation, and the role of deliberation in achieving good action. The treatise distinguishes kinds of excellence and considers the conditions under which human beings live well, relating individual virtue to communal life. Aristotle investigates how practical wisdom guides decision-making in contexts where particulars matter and precision is limited by the subject. The work’s manner is analytical yet attentive to experience, moving between general accounts and illustrative cases. Its lasting significance lies in its nuanced model of moral development, responsibility, and rational agency within the dynamics of social and political life.
Das Organon names a later, traditional grouping of Aristotle’s logical writings. Categories and On Interpretation treat basic terms, predication, and meaning. Prior Analytics develops syllogistic theory, articulating valid inference patterns. Posterior Analytics investigates scientific knowledge, emphasizing demonstration from true, explanatory first principles and the role of definition. Topics examines dialectical reasoning from widely accepted premises, and Sophistical Refutations analyzes fallacies. Together these texts articulate a framework for assessing arguments, distinguishing kinds of reasoning, and relating explanation to proof. This logic undergirds the standards of clarity and necessity in the theoretical works and shapes the account of practical deliberation in ethics, albeit with aims and measures appropriate to action.
Metaphysik probes first philosophy: the study of being insofar as it is being, substance and its principles, and ultimate causes. Aristotle investigates substance in relation to form and matter, considers unity and difference, and develops the contrasts between potentiality and actuality. He engages critically with predecessors, examining inherited doctrines to clarify his own positions. The inquiry seeks what grounds the intelligibility and stability of things, and how explanation in terms of causes can be ultimate rather than derivative. Read alongside the Organon, the Metaphysik displays the ambition to combine rigorous argument with a careful mapping of basic concepts that frame inquiry across the sciences.
Die Physik treats nature as an internal principle of change and rest, asking what motion, place, time, and continuum are. Aristotle analyzes natural processes through the scheme of material, formal, efficient, and final causes, showing how explanation varies with subject matter. The work explores the composition of change, the conditions for coming-to-be and passing-away, and the dependence of natural explanation on form. While attentive to observation, it is primarily a conceptual investigation: clarifying the fundamental notions without which the study of natural beings cannot proceed. Its approach shaped centuries of thinking about science, causation, and the relation between experience, definition, and demonstration.
Über die Dichtkunst is a compact treatise on the principles of poetic composition, with special attention to tragedy and epic. Aristotle investigates mimesis as representation, analyzes plot and character, and discusses the arrangement of incidents that make a unified whole. He considers recognition, reversal, and the demands of probability and necessity in crafting a persuasive work, as well as aspects of diction and meter. The surviving text is focused and technical, oriented toward the structure and effects of well-constructed dramas known to classical Athens. Its significance endures as a foundational account of narrative form, genre, and the standards by which complex artistic artifacts can be evaluated.
Taken together, these works exemplify a system in which method is matched to subject. The Organon sets criteria for valid inference and scientific demonstration. Die Physik applies explanatory schemes to changeable, embodied beings. Metaphysik examines the most general structures on which such explanations depend. Nikomachische Ethik adapts rational inquiry to the practical domain, where ends, circumstances, and habituation shape action. Über die Dichtkunst extends analysis to artistic making, clarifying how human craft achieves intelligible forms. Concepts such as cause, form, and purpose link the inquiries without reducing one field to another, modeling an integrated approach that respects differences in evidence, precision, and aim.
Stylistically, Aristotle’s extant treatises are concise, technical, and systematically organized. They proceed by distinctions, definitions, and argumentative sequences, often moving from commonly held views to refined conclusions. Examples are chosen to illustrate principles rather than to entertain. The tone is didactic without rhetoric for its own sake, reflecting their origin in scholarly instruction. This approach has proved durable because it makes claims testable by reasoned analysis and open to further refinement. Readers encounter not only doctrines but a disciplined way of thinking: to ask what a thing is, by what causes it is as it is, and how different kinds of knowledge establish their claims.
The texts gathered here are part of the body of Aristotelian writings that have principally survived: works generally regarded as deriving from teaching and research at the Lyceum in the fourth century BCE. The designation Organon as a set is a later, traditional arrangement adopted by commentators and editors. Over centuries, these treatises shaped philosophical, scientific, and literary discussions in Greek, Arabic, and Latin traditions and beyond. Their influence ranges from theories of proof and science to accounts of virtue, causation, and narrative form. Presented together, they allow readers to observe both historical impact and the inner logic that has sustained their study.
This collection is designed to invite sustained, comparative reading. One can begin with the Organon to grasp Aristotelian standards of argument, or start from ethics, physics, or metaphysics depending on interest; Über die Dichtkunst offers a different yet complementary window on his analytical temperament. However approached, the arrangement underscores continuities of concept and method while preserving the autonomy of each field. The result is a clear view of a philosopher who sought explanations proportionate to what is investigated, and whose ideas remain relevant wherever careful distinctions, principled inquiry, and reasoned evaluation are required. It is an integrated introduction to a lasting intellectual edifice.
Autorenbiografie
Einführung
Aristotle (Greek: Aristoteles) was a Greek philosopher of the 4th century BCE whose writings shaped logic, natural philosophy, ethics, politics, rhetoric, and literary theory. Trained in Athens and later founder of the Lyceum, he developed a program of systematic inquiry that sought causes, classifications, and precise definitions. His major works include Nicomachean Ethics, Politics, Metaphysics, Physics, On the Soul, Poetics, and the logical writings later grouped as the Organon. Although much of his output derives from teaching materials, its analytical power proved enduring. From antiquity through the medieval transmission and into modern scholarship, his thought has remained a central reference in intellectual history.
Bildung und literarische Einflüsse
Aristotle was born in the northern Greek city of Stagira and spent his formative years in environments connected to medicine and the Macedonian court. As a youth he traveled to Athens and entered Plato’s Academy, where he studied for roughly two decades. There he absorbed rigorous training in dialectic, mathematics, and metaphysics, while also developing interests in biology and empirical observation. After Plato’s death in the mid 4th century BCE, Aristotle left the Academy. He spent time in Asia Minor and on Lesbos pursuing research, and later accepted a role in Macedon that placed him near the royal household and its educational projects.
His intellectual formation was shaped above all by Plato, whose teachings he both revered and systematically criticized. Aristotle’s departures from Platonic Forms were informed by attention to substance, change, and the conditions of knowledge. Earlier natural philosophers, including Parmenides, Heraclitus, and Empedocles, provided problems and concepts he reformulated within his own framework. He engaged the practices of the Sophists and the rhetorical culture of classical Greece, while methodological inspirations came from mathematics and Hippocratic medicine. These influences yielded a style that prized classification, careful definition, and argument from observed phenomena, laying the groundwork for the research program he later instituted at the Lyceum.
Literarische Laufbahn
On returning to Athens in the later 4th century BCE, Aristotle established the Lyceum, a school organized around collaborative research, lectures, and collections. Much of what survives of his writing appears to be treatises and notes connected to teaching, rather than polished literary dialogues. Ancient testimony suggests that his dialogues were admired for style, but most are lost. The extant corpus ranges across logic, natural philosophy, psychology, ethics, politics, rhetoric, and literary theory. At the Lyceum he and his associates gathered data, from animal specimens to civic constitutions, integrating observation with theory and creating a durable model for scholarly inquiry.
Aristotle’s logical writings, later grouped as the Organon, established foundational tools for analysis and argument. Works such as Categories, On Interpretation, Prior Analytics, and Posterior Analytics introduce topics including predication, modality, the syllogism, and scientific demonstration. The Topics and Sophistical Refutations examine dialectical reasoning and fallacies. For many centuries these texts defined formal logic in educational systems from late antiquity through the medieval period. Their systematic approach to inference, definition, and classification shaped disciplines beyond philosophy, informing rhetoric, theology, and early scientific method. Even as modern logic diverged, Aristotle’s account of deductive structure remained a touchstone for historians and theorists.
In natural philosophy and biology, Aristotle wrote texts including Physics, On the Heavens, Meteorology, On the Soul, History of Animals, Parts of Animals, and Generation of Animals. He emphasized explanations in terms of causes, paying special attention to purpose in nature, while also cataloging anatomical and behavioral features of many species, especially marine life. His observations, though limited by available instruments, reflect a sustained empirical engagement. The psychological treatise On the Soul connects biology and cognition, proposing faculties of perception, imagination, and thought. Across these works he develops a comprehensive picture of motion, change, and life that influenced inquiry for centuries.
Aristotle’s practical and literary treatises continue to frame debates about human flourishing and art. Nicomachean Ethics proposes virtue as a mean between extremes and conceives happiness as activity in accord with excellence, guided by practical wisdom. Politics studies constitutions, civic education, and the conditions for stable self-government, arguing for the rule of law and mixed forms. Rhetoric analyzes persuasion through ethos, pathos, and logos, while Poetics investigates tragedy, plot structure, and mimesis. In Metaphysics he explores being and substance, causation, potentiality and actuality, and the priority of form. Together these works articulate a capacious vision linking character, community, knowledge, and creation.
Überzeugungen und Engagement
At the core of Aristotle’s ethics is a commitment to eudaimonia, often rendered as flourishing, achieved through the cultivation of stable virtues shaped by habituation and guided by reason. He maintained that moral judgment requires practical wisdom, an excellence that integrates perception of particulars with sound deliberation. The doctrine of the mean expresses a tendency, not a strict formula, for calibrating action between deficiency and excess. These commitments surface in his pedagogical emphasis on character formation and civic friendship, and in a broader belief that good lives unfold within institutions that support learning, conversation, and purposeful work over an entire lifetime.
In politics he argued that humans are by nature suited to life in a polis, where shared deliberation and law cultivate virtue. He favored mixed regimes and constitutional safeguards against domination by any single faction, while insisting on education as a public concern. Some positions, notably his defenses of natural hierarchy, including slavery and restrictive views on women, reflect assumptions of his era and have been widely challenged by later readers. Acknowledging these elements is essential to understanding both the breadth and limits of his program. His Rhetoric connects civic reasoning to persuasive speech, underscoring ethics as integral to communication.
Beyond ethics and politics, Aristotle advanced a vision of inquiry grounded in observation, explanation by causes, and disciplined classification. He treated science as a partnership between careful description and reasoned theory, culminating in demonstrations that show why phenomena must be as they are. The Lyceum embodied this advocacy for collaborative research through its library, collections, and lecture courses. He also valued the arts as modes of understanding, granting poetry a cognitive role through mimesis. Across domains, his stance favors patient accumulation of evidence, openness to revision, and an integrated view of knowledge that balances empirical study with systematic conceptual analysis.
Final Years & Legacy
After the death of Alexander in the early 320s BCE, political tensions in Athens turned against Macedonian associations. Facing a charge of impiety, Aristotle withdrew to Chalcis on the island of Euboea, reportedly to prevent the city from wronging philosophy again. He died there soon after. Leadership of the Lyceum passed to Theophrastus, who continued research in botany and philosophy. Over subsequent generations, Aristotle’s works were collected and edited, notably in the late Hellenistic period, shaping the corpus as later readers know it. The school’s continuity preserved a tradition of scholarship that transmitted methods as well as texts.
The long reception of Aristotle spans ancient commentary, translation into Syriac and Arabic, and transmission into medieval Latin, where figures such as Avicenna, Averroes, Maimonides, and Thomas Aquinas engaged and reinterpreted his system. Renaissance humanists, early modern scientists, and modern philosophers alternately built upon and contested Aristotelian frameworks. His logic influenced curricula into the 19th century, while Poetics and Rhetoric continue to inform studies of literature and communication. Today, scholars examine Aristotle historically and philosophically, debating his analyses of causation, ethics, and politics alongside critical appraisal of his limitations. His work remains integral to liberal education and global intellectual discourse.
Historical Context
Aristotle of Stagira (384–322 BCE) worked during the tumultuous transformation from the Classical polis to the early Hellenistic world. His surviving corpus, transmitted as lectures and notes, addresses first philosophy, natural inquiry, logical method, moral cultivation, and the arts. These areas were not isolated silos: observations in the Lyceum informed arguments about substance, purpose, and causation, while civic experience in Athens supplied examples for virtue, deliberation, persuasion, and drama. The city’s institutions, theaters, courts, and gymnasia formed a living laboratory. From Plato’s Academy to his own Lyceum, Aristotle pursued a unified program that situates Metaphysics, Physics, Organon, Ethics, and Poetics within one sustained inquiry.
Fifth- and fourth-century BCE Greek society centered on the autonomous polis, especially Athens, whose democracy after 508 BCE fostered public speech, forensic debate, and festival performance. The Great Dionysia staged tragedy and comedy; law courts required arguments before large juries; councils and assemblies demanded deliberative rhetoric. These practices shaped the intellectual economy in which logical analysis, ethical reasoning, and poetic theory became practical arts as well as sciences. Sophists such as Protagoras and Gorgias, and teachers like Isocrates, offered training in argument and style, stimulating systematic reflection on language, inference, and persuasion that would culminate in the analytic tools assembled in Aristotle’s school.
At age seventeen, Aristotle left Stagira for Athens (367 BCE), entering Plato’s Academy for roughly twenty years. There he encountered dialectic, mathematics, and speculative metaphysics of Forms, along with the astronomy of Eudoxus of Cnidus. The Academy’s communal inquiry provided pedagogical models and a critical foil. After Plato’s death in 348/347 BCE, and the succession of Speusippus, Aristotle departed, teaching in Assos at the court of Hermias of Atarneus and later researching on Lesbos with Theophrastus. These years established habits of collaborative observation and collection that would later inflect arguments about demonstration, substance, and natural change across his logical, physical, and metaphysical writings.
In 343 or 342 BCE, Philip II of Macedon invited Aristotle to tutor the young Alexander at Mieza. The setting near Pella offered access to royal resources, a network of court scholars, and a climate of political consolidation that reshaped Greece. While direct influence on campaigns is debated, the period concentrated Aristotle’s attention on education, character, and civic institutions, and may have facilitated acquisition of books and specimens. The Macedonian ascendancy reordered Athenian horizons, prompting reflection on constitutions, citizenship, and the conditions of flourishing. These concerns reverberate across analyses of deliberation, causation, and imitation, framing an integrated vision of practical, theoretical, and productive knowledge.
After Alexander secured hegemony, Aristotle returned to Athens in 335 BCE and founded the Lyceum in the gymnasium of Apollo Lykeios. The Peripatetic school combined lecture courses, walking discussions, library curation, and research teams that compiled data on animals, plants, customs, and city constitutions. The Lyceum’s rhythm of morning esoteric instruction and public evening talks shaped textual layers later edited as treatises. Logical treatises supported scientific demonstrations; studies in nature grounded wider ontological claims; critiques of poetry and rhetoric drew on living Athenian practices. The institutional synergy allowed cross-references among topics that modern readers encounter as Metaphysics, Physics, Organon, Ethics, and Poetics.
Aristotle’s investigations in Assos and on Lesbos, especially at Mytilene around 345–342 BCE, inaugurated extensive biological work continued at the Lyceum with Theophrastus. Dissections, fisheries observations, and coastal surveys yielded descriptions in History of Animals and Parts of Animals, informing general principles of teleology and causation. The method combined careful observation with explanatory frameworks of form and matter, potentiality and actuality. This empirical stance supported a program for knowledge that required definitions, classifications, and demonstrations. The same habits of collection and comparison underwrote inquiries into motion, time, and place, and supported evaluations of human practices, character formation, and artistic composition.
Aristotle’s project engages earlier Greek natural philosophy: Milesian searches for archai by Thales and Anaximander; the rational cosmologies of Anaxagoras and Empedocles; the atomism of Leucippus and Democritus; and Eleatic critiques by Parmenides and Zeno. These traditions set problems about change, plurality, and necessity that support systematic accounts of nature and being. By analyzing causes, substance, and negation, Aristotle reframed disputes between Heraclitean flux and Eleatic stasis. He adapted and criticized predecessors rather than dismissing them outright, converting their theses into puzzles for solution. The resulting conceptual toolkit saturates work on natural motion, scientific reasoning, ethical deliberation, and artistic representation.
Mathematical sciences supplied models of rigor and puzzles about application. Aristotle studied under or alongside Eudoxus of Cnidus, whose theory of proportion and concentric spheres informed Greek astronomy. Callippus refined planetary periods in the 330s. Against the background of geometric explanation, Aristotle considered how immaterial form applies to material change, and how number relates to measure in experience. The geocentric cosmos, organized by natural places and teleological motions, framed questions of causation reaching from sublunary physics to the eternal motions of the heavens. This astral architecture provided analogies and contrasts for analyses of demonstration, ontology, and the hierarchy of sciences.
Aristotle’s logic emerged from an argumentative culture of sophistic display, Socratic elenchus, and Academy dialectic. In courts and assemblies, speakers manipulated likelihoods; in schools, teachers tested definitions by counterexample. The need to distinguish valid from merely persuasive inference impelled systematization of terms, propositions, and syllogisms. Categories, predication, and modal notions grew from reflection on grammar and ontology. The same environment generated attention to fallacies and topical reasoning fitting probable domains like ethics and civic life. Logical instruments were conceived to serve scientific explanation and a civic pedagogy, structuring inquiry into nature, being, human excellence, and the techniques of poetic composition.
The fourth-century polis anchored moral education in practices of household management, gymnasium training, symposia, and public service. Citizenship, restricted to free male Athenians, framed debates over law, virtue, and justice, while the realities of slavery, patriarchy, and metic status supplied hard contexts for reflection. After the Peloponnesian War ended in 404 BCE, Athens struggled with instability, amnesties, and restored democracy, forcing citizens to deliberate about common goods amid shifting power. Amid this, philosophers and educators proposed programs for character formation and civic prudence. Aristotle situated personal flourishing within institutional life, linking habituation, practical wisdom, and legislation to wider causal accounts of nature.
Athenian festivals, especially the City Dionysia and Lenaea, institutionalized poetic production from the fifth century onward. Playwrights such as Aeschylus, Sophocles, Euripides, and later Menander provided a repertoire for critical reflection on plot, character, music, and spectacle. Choral training, actor technique, and stage technology formed a shared technical culture. Rhetorical handbooks, performance criticism, and audience expectations converged with philosophical analysis of mimesis and persuasion. The nexus of civic ritual, education, and entertainment supplied data for theorizing genres, emotional responses, and standards of excellence. Aristotle’s critical vocabulary arose within this living art world, not as an abstract treatise isolated from practice.
The Lyceum organized knowledge through catalogues, collections, and surveys. Compilers gathered constitutions of Greek cities, lists of Olympic victors, glossaries of rare words, and histories of philosophy. Such doxographical efforts enabled comparison, causal explanation, and critique. The school’s interest in methods, from definitions to demonstration, supported a classification of sciences into theoretical, practical, and productive, each with appropriate principles and ends. The integration of logic, natural philosophy, and cultural inquiry attempted to render the full range of human activity intelligible within a common causal framework. This institutional scaffolding contextualizes the interlocking agendas discernible across the treatises read today.
Alexander’s campaigns from 334 to 323 BCE dissolved the old city-state order and created new networks from Egypt to Central Asia. Administrative reforms, new foundations, and flows of wealth and objects altered scholarly possibilities. Specimens, reports, and geographical data expanded the horizon of inquiry for Greek researchers. Yet the political dominance of Macedon intensified Athenian anxieties and factionalism. Philosophers navigated royal patronage, civic suspicion, and cross-cultural encounters. The resulting cosmopolitan perspective encouraged reflection on the universality of causes, the scope of scientific explanation, and the variability of customs. Aristotle’s synthesis matured at the cusp of this transition from Classical to Hellenistic worlds.
After Alexander’s death in 323 BCE, anti-Macedonian sentiment fueled the Lamian War. Aristotle, linked to the Macedonian court and to Hermias of Atarneus, faced a charge of impiety in Athens. He withdrew to Chalcis on Euboea, declaring he would not allow the city to sin twice against philosophy, a pointed memory of Socrates’ execution in 399 BCE. He died there in 322 BCE. Theophrastus succeeded him at the Lyceum, ensuring continuity of research. The episode underscores the fragile position of intellectuals within volatile politics, and illuminates Aristotle’s consistent effort to ground ethical, political, and scientific claims within resilient methodological structures.
Aristotle’s writings circulated as lecture notes and school materials rather than polished dialogues, many of which are now lost. According to later reports preserved by Strabo, Neleus of Scepsis inherited manuscripts that were hidden and deteriorated before resurfacing in the first century BCE. Andronicus of Rhodes then edited and arranged the corpus in Rome, shaping the sequence and titles familiar today. The editorial history explains the composite character of some treatises and the cross-references among them. It also underlines the unity of the enterprise: tools of logic, inquiries into nature, reflections on being, ethics, and poetics were treated as mutually illuminating.
Hellenistic schools engaged Aristotle on logic, physics, and ethics—Stoics developed alternative logics and cosmologies; Epicureans defended atomism; Skeptics probed criteria of knowledge. In the Roman era, commentators such as Alexander of Aphrodisias systematized interpretation. From the ninth century onward, scholars in Baghdad translated and transformed Aristotelian texts into Arabic; al-Farabi, Avicenna, and Averroes produced influential syntheses. Latin translations from the twelfth century integrated these materials into European universities at Paris, Oxford, and Bologna. The Organon structured arts of reasoning; Physics and Metaphysics framed natural and first philosophy; ethical and poetic analyses guided moral education and literary criticism.
Renaissance humanists, printers in Venice and Basel, and reforming teachers revived Greek texts, while Thomist, Scotist, and nominalist traditions debated principles of being, motion, and virtue. Early modern science challenged Aristotelian physics, yet retained habits of explanation, classification, and teleological language in biology. The Poetics continued to shape neoclassical aesthetics; ethical treatises informed civic republican and virtue traditions. Archaeological recoveries at Pergamon and papyri from Herculaneum enriched philology. Modern critical editions, from Bekker’s Berlin Academy edition in 1831–1870 to contemporary translators, stabilize textual bases. Across these centuries, Aristotle’s integrated program remained a touchstone for connecting logic, nature, character, and art.
Synopsis (Auswahl)
Nikomachische Ethik
Aristotle investigates the human good (eudaimonia) as rational activity in accordance with virtue, introducing the doctrine of the mean and distinguishing moral from intellectual virtues guided by practical wisdom. He treats justice, friendship, pleasure, and the claim that the contemplative life is highest.
Organon
A collection of logical treatises that establish categories, terms, and propositions and formulate syllogistic inference. It outlines demonstration as the basis of scientific knowledge, dialectical methods, and common fallacies.
Metaphysik
An inquiry into being as such and first causes, centered on substance, form and matter, and the dynamics of potentiality and actuality. It critiques Platonic Forms and advances the notion of a first unmoved mover as ultimate explanatory principle.
Physik
A systematic account of nature and change, analyzing motion, the four causes, place, time, and continuity. Aristotle argues for the teleological character of natural beings and examines topics such as infinity, void, and the eternity of motion.
Über die Dichtkunst
A study of poetry, especially tragedy and epic, defining mimesis and the elements of effective plot and character. It introduces concepts like catharsis, reversal, and recognition, and argues for unity of action and appropriate style.
Aristoteles: Metaphysik, Nikomachische Ethik, Das Organon, Die Physik & Die Dichtkunst
Nikomachische Ethik
Vorbemerkung
1. Die Stufenleiter der Zwecke und der höchste Zweck
Alle künstlerische und alle wissenschaftliche Tätigkeit, ebenso wie alles praktische Verhalten und jeder erwählte Beruf hat nach allgemeiner Annahme zum Ziele irgendein zu erlangendes Gut. Man hat darum das Gute treffend als dasjenige bezeichnet, was das Ziel alles Strebens bildet. Indessen, es liegt die Einsicht nahe, daß zwischen Ziel und Ziel ein Unterschied besteht. Das Ziel liegt das eine Mal in der Tätigkeit selbst, das andere Mal noch neben der Tätigkeit in irgendeinem durch sie hervorzubringenden Gegenstand. Wo aber neben der Betätigung noch solch ein weiteres erstrebt wird, da ist das hervorzubringende Werk der Natur der Sache nach von höherem Werte als die Tätigkeit selbst.
Wie es nun eine Vielheit von Handlungsweisen, von künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten gibt, so ergibt sich demgemäß auch eine Vielheit von zu erstrebenden Zielen. So ist das Ziel der ärztlichen Kunst die Gesundheit, dasjenige der Schiffsbaukunst das fertige Fahrzeug, das der Kriegskunst der Sieg und das der Haushaltungskunst der Reichtum. Wo nun mehrere Tätigkeiten in den Dienst eines einheitlichen umfassenderen Gebietes gestellt sind, wie die Anfertigung der Zügel und der sonstigen Hilfsmittel für Berittene der Reitkunst, die Reitkunst selbst aber und alle Arten militärischer Übungen dem Gebiete der Kriegskunst, und in ganz gleicher Weise wieder andere Tätigkeiten dem Gebiete anderer Künste zugehören: da ist das Ziel der herrschenden Kunst jedesmal dem der ihr untergeordneten Fächer gegenüber das höhere und bedeutsamere; denn um jenes willen werden auch die letzteren betrieben. In diesem Betracht macht es dann keinen Unterschied, ob das Ziel für die Betätigung die Tätigkeit selbst bildet, oder neben ihr noch etwas anderes, wie es in den angeführten Gebieten der Tätigkeit wirklich der Fall ist.
Gibt es nun unter den Objekten, auf die sich die Betätigung richtet, ein Ziel, das man um seiner selbst willen anstrebt, während man das übrige um jenes willen begehrt; ist es also so, daß man nicht alles um eines anderen willen erstrebt, / denn damit würde man zum Fortgang ins Unendliche kommen und es würde mithin alles Streben eitel und sinnlos werden /: so würde offenbar dieses um seiner selbst willen Begehrte das Gute, ja das höchste Gut bedeuten. Müßte darum nicht auch die Kenntnis desselben für die Lebensführung von ausschlaggebender Bedeutung sein, und wir, den Schützen gleich, die ein festes Ziel vor Augen haben, dadurch in höherem Grade befähigt werden, das zu treffen, was uns not ist? Ist dem aber so, so gilt es den Versuch, wenigstens im Umriß darzulegen, was dieses Gut selber seinem Wesen nach ist und unter welche Wissenschaft oder Fertigkeit es einzuordnen ist. Es liegt nahe anzunehmen, daß es die dem Range nach höchste und im höchsten Grade zur Herrschaft berechtigte Wissenschaft sein wird, wohin sie gehört. Als solche aber stellt sich die Wissenschaft vom Staate dar. Denn sie ist es, welche darüber zu bestimmen hat, was für Wissenschaften man in der Staatsgemeinschaft betreiben, welche von ihnen jeder einzelne und bis wie weit er sie sich aneignen soll. Ebenso sehen wir, daß gerade die Fertigkeiten, die man am höchsten schätzt, in ihr Gebiet fallen: so die Künste des Krieges, des Haushalts, der Beredsamkeit. Indem also die Wissenschaft vom Staate die andern praktischen Wissenschaften in ihren Dienst zieht und weiter gesetzlich festsetzt, was man zu tun, was man zu lassen hat, so umfaßt das Ziel, nach dem sie strebt, die Ziele der anderen Tätigkeiten mit, und mithin wird ihr Ziel dasjenige sein, was das eigentümliche Gut für den Menschen bezeichnet. Denn mag dieses auch für den einzelnen und für das Staatsganze dasselbe sein, so kommt es doch in dem Ziele, das der Staat anstrebt, umfassender und vollständiger zur Erscheinung, sowohl wo es sich um das Erlangen, wie wo es sich um das Bewahren handelt. Denn erfreulich ist es gewiß auch, wenn das Ziel bloß für den einzelnen erreicht wird; schöner aber und göttlicher ist es, das Ziel für ganze Völker und Staaten zu verfolgen. Das nun aber gerade ist es, wonach unsere Wissenschaft strebt; denn sie handelt vom staatlichen Leben der Menschen.
2. Form und Abzweckung der Behandlung des Gegenstandes
Was die Behandlung des Gegenstandes anbetrifft, so muß man sich zufrieden geben, wenn die Genauigkeit jedesmal nur so weit getrieben wird, wie der vorliegende Gegenstand es zuläßt. Man darf nicht in allen Disziplinen ein gleiches Maß von Strenge anstreben, sowenig wie man es bei allen gewerblichen Arbeiten dürfte. Das Sittliche und Gerechte, die Gegenstände also, mit denen sich die Wissenschaft vom staatlichen Leben beschäftigt, gibt zu einer großen Verschiedenheit auseinandergehender Auffassungen Anlaß, so sehr, daß man wohl der Ansicht begegnet, als beruhe das alles auf bloßer Menschensatzung und nicht auf der Natur der Dinge. Ebensolche Meinungsverschiedenheit herrscht aber auch über die Güter der Menschen, schon deshalb, weil sie doch vielen auch zum Schaden ausgeschlagen sind. Denn schon so mancher ist durch den Reichtum, andere sind durch kühnen Mut ins Verderben gestürzt worden. Man muß also schon für lieb nehmen, wenn bei der Behandlung derartiger Gegenstände und der Ableitung aus derartigem Material die Wahrheit auch nur in gröberem Umriß zum Ausdruck gelangt, und wenn bei der Erörterung dessen, was in der Regel gilt und bei dem Ausgehen von ebensolchen Gründen auch die daraus gezogenen Schlüsse den gleichen Charakter tragen. Und in demselben Sinne muß man denn auch jede einzelne Ausführung von dieser Art aufnehmen. Denn es ist ein Kennzeichen eines gebildeten Geistes, auf jedem einzelnen Gebiete nur dasjenige Maß von Strenge zu fordern, das die eigentümliche Natur des Gegenstandes zuläßt. Es ist nahezu dasselbe: einem Mathematiker Gehör schenken, der an die Gefühle appelliert, und von einem Redner verlangen, daß er seine Sätze in strenger Form beweise.
Jeder hat ein sicheres Urteil auf dem Gebiete, wo er zu Hause ist, und über das dahin Einschlagende ist er als Richter zu hören. Über jegliches im besonderen also urteilt am besten der gebildete Fachmann, allgemein aber und ohne Einschränkung derjenige, der eine universelle Bildung besitzt. Darum sind junge Leute nicht die geeigneten Zuhörer bei Vorlesungen über das staatliche Leben. Sie haben noch keine Erfahrung über die im Leben vorkommenden praktischen Fragen; auf Grund dieser aber und betreffs dieser wird die Untersuchung geführt. Indem sie ferner geneigt sind, sich von ihren Affekten bestimmen zu lassen, bleiben die Vorlesungen für sie unfruchtbar und nutzlos; denn das Ziel derselben ist doch nicht bloße Kenntnis, sondern praktische Betätigung. Dabei macht es keinen Unterschied, daß einer jung ist bloß an Jahren oder unreif seiner Innerlichkeit nach. Denn nicht an der Zeit liegt die Unzulänglichkeit, sondern daran, daß man sich von Sympathien und Antipathien leiten läßt und alles einzelne in ihrem Lichte betrachtet. Leuten von dieser Art helfen alle Kenntnisse ebensowenig wie denen, denen es an Selbstbeherrschung mangelt. Dagegen kann denen, die ihr Begehren vernünftig regeln und danach auch handeln, die Wissenschaft von diesen Dingen allerdings zu großem Nutzen gereichen.
Dies mag als Vorbemerkung dienen, um zu zeigen, wer der rechte Hörer, welches die rechte Weise der Auffassung, und was eigentlich unser Vorhaben ist.
Einleitung
1. Verschiedene Auffassungen vom Zweck des LebensPreface
Wir kommen nunmehr auf unseren Ausgangspunkt zurück. Wenn doch jede Wissenschaft wie jedes praktische Vorhaben irgendein Gut zum Ziele hat, so fragt es sich: was ist es für ein Ziel, das wir als das im Staatsleben angestrebte bezeichnen, und welches ist das oberste unter allen durch ein praktisches Verhalten zu erlangenden Gütern? In dem Namen, den sie ihm geben, stimmen die meisten Menschen so ziemlich überein. Sowohl die Masse wie die vornehmeren Geister bezeichnen es als die Glückseligkeit, die Eudämonie, und sie denken sich dabei, glückselig sein sei dasselbe wie ein erfreuliches Leben führen und es gut haben. Dagegen über die Frage nach dem Wesen der Glückseligkeit gehen die Meinungen weit auseinander, und die große Masse urteilt darüber ganz anders als die höher Gebildeten. Die einen denken an das Handgreifliche und vor Augen Liegende, wie Vergnügen, Reichtum oder hohe Stellung, andere an ganz anderes; zuweilen wechselt auch die Ansicht darüber bei einem und demselben. Ist einer krank, so stellt er sich die Gesundheit, leidet er Not, den Reichtum als das höchste vor. Im Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit staunen manche Leute diejenigen an, die in hohen Worten ihnen Unverständliches reden. Von manchen wurde die Ansicht vertreten, es gebe neben der Vielheit der realen Güter noch ein anderes, ein Gutes an sich, das für jene alle den Grund abgebe, durch den sie gut wären.
Alle diese verschiedenen Ansichten zu prüfen würde selbstverständlich ein überaus unfruchtbares Geschäft sein; es reicht völlig aus, nur die gangbarsten oder diejenigen, die noch am meisten für sich haben, zu berücksichtigen. Dabei dürfen wir nicht außer acht lassen, daß ein Unterschied besteht zwischen den Verfahrungsweisen, die von den Prinzipien aus, und denen, die zu den Prinzipien hinleiten. Schon Plato erwog diesen Punkt ernstlich und untersuchte, ob der Weg, den man einschlage, von den Prinzipien ausgehe oder zu den Prinzipien hinführe, gleichsam wie die Bewegung in der Rennbahn von den Kampfrichtern zum Ziele oder in umgekehrter Richtung geht. Ausgehen nun muß man von solchem was bekannt ist; bekannt aber kann etwas sein in doppeltem Sinn: es ist etwas entweder uns bekannt oder es ist schlechthin bekannt. Wir müssen natürlich ausgehen von dem, was uns bekannt ist. Deshalb ist es erforderlich, daß einer, der den Vortrag über das Sittliche und das Gerechte, überhaupt über die das staatliche Leben betreffenden Themata mit Erfolg hören will, ein Maß von sittlicher Charakterbildung bereits mitbringe. Denn den Ausgangspunkt bildet die Tatsache, und wenn diese ausreichend festgestellt ist, so wird das Bedürfnis der Begründung sich gar nicht erst geltend machen. Ein so Vorgebildeter aber ist im Besitz der Prinzipien oder eignet sie sich doch mit Leichtigkeit an. Der aber, von dem keines von beiden gilt, mag sich des Hesiodos Worte gesagt sein lassen:
Der ist der allerbeste, der selber alles durchdenket; Doch ist wacher auch der, der richtigem Rate sich anschließt. Aber wer selbst nicht bedenkt und was er von andern vernommen Auch nicht zu Herzen sich nimmt, ist ein ganz unnützer Geselle.
Wir kehren nunmehr zurück zu dem, wovon wir abgeschweift sind. Unter dem Guten und der Glückseligkeit versteht im Anschluß an die tägliche Erfahrung der große Haufe und die Leute von niedrigster Gesinnung die Lustempfindung, und zwar wie man annehmen möchte, nicht ohne Grund. Sie haben deshalb ihr Genüge an einem auf den Genuß gerichteten Leben. Denn es gibt drei am meisten hervorstechende Arten der Lebensführung: die eben genannte, dann das Leben in den Geschäften und drittens das der reinen Betrachtung gewidmete Leben. Der große Haufe bietet das Schauspiel, wie man mit ausgesprochenem Knechtssinn sich ein Leben nach der Art des lieben Viehs zurecht macht; und der Standpunkt erringt sich Ansehen, weil manche unter den Mächtigen der Erde Gesinnungen wie die eines Sardanapal teilen. Die vornehmeren Geister, die zugleich auf das Praktische gerichtet sind, streben nach Ehre; denn diese ist es doch eigentlich, die das Ziel des in den Geschäften aufgehenden Lebens bildet. Indessen, auch dieses ist augenscheinlich zu äußerlich, um für das Lebensziel, dem wir nachforschen, gelten zu dürfen. Dort hängt das Ziel, wie man meinen möchte, mehr von denen ab, die die Ehre erweisen, als von dem, der sie empfängt; unter dem höchsten Gute aber stellen wir uns ein solches vor, das dem Subjekte innerlich und unentreißbar zugehört. Außerdem macht es ganz den Eindruck, als jage man der Ehre deshalb nach, um den Glauben an seine eigene Tüchtigkeit besser nähren zu können; wenigstens ist die Ehre, die man begehrt, die von seiten der Einsichtigen und derer, denen man näher bekannt ist, und das auf Grund bewiesener Tüchtigkeit. Offenbar also, daß nach Ansicht dieser Leute die Tüchtigkeit doch den höheren Wert hat selbst der Ehre gegenüber. Da könnte nun einer wohl zu der Ansicht kommen, das wirkliche Ziel des Lebens in den Geschäften sei vielmehr diese Tüchtigkeit. Indessen auch diese erweist sich als hinter dem Ideal zurückbleibend. Denn man könnte es sich immerhin als möglich vorstellen, daß jemand, der im Besitze der Tüchtigkeit ist, sein Leben verschlafe oder doch nie im Leben von ihr Gebrauch mache, und daß es ihm außerdem recht schlecht ergehe und er das schwerste Leid zu erdulden habe. Wer aber ein Leben von dieser Art führt, den wird niemand glücklich preisen, es sei denn aus bloßer Rechthaberei, die hartnäckig auf ihrem Satz besteht. Doch genug davon, über den Gegenstand ist in der populären Literatur ausreichend verhandelt worden.
Die dritte Lebensrichtung ist die der reinen Betrachtung gewidmete; über sie werden wir weiterhin handeln. Das Leben dagegen zum Erwerb von Geld und Gut ist ein Leben unter dem Zwange, und Reichtum ist sicherlich nicht das Gut, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt. Denn er ist bloßes Mittel, und wertvoll nur für anderes. Deshalb möchte man statt seiner eher die oben genannten Zwecke dafür nehmen; denn sie werden um ihrer selbst willen hochgehalten. Doch offenbar sind es auch diese nicht; gleichwohl ist man mit Ausführungen gegen sie verschwenderisch genug umgegangen. Wir wollen uns dabei nicht länger aufhalten.
Förderlicher wird es doch wohl sein, jetzt das Gute in jener Bedeutung der Allgemeinheit ins Auge zu fassen und sorgsam zu erwägen, was man darunter zu verstehen hat, mag auch einer solchen Untersuchung manches in uns widerstreben, weil es teure und verehrte Männer sind, die die Ideenlehre aufgestellt haben. Indessen, man wird uns darin zustimmen, daß es doch wohl das Richtigere und Pflichtmäßige ist, wo es gilt für die Wahrheit einzutreten, auch die eigenen Sätze aufzugeben, und das erst recht, wenn man ein Philosoph ist. Denn wenn uns gleich beides lieb und wert ist, so ist es doch heilige Pflicht, der Wahrheit vor allem die Ehre zu geben.
Die Denker, welche jene Lehre aufgestellt haben, haben Ideen nicht angenommen für diejenigen Dinge, bei denen sie eine bestimmte Reihenfolge des Vorangehenden und des Nachfolgenden aufstellten; das ist der Grund, weshalb sie auch für die Zahlen keine Idee gesetzt haben. Der Begriff des Guten nun kommt vor unter den Kategorien der Substanz, der Qualität und der Relation; das was an sich, was Substanz ist, ist aber seiner Natur nach ein Vorangehendes gegenüber dem Relativen; denn dieses hat die Bedeutung eines Nebenschößlings und einer Bestimmung an dem selbständig Seienden. Schon aus diesem Grunde könnte es keine gemeinsame Idee des Guten über allem einzelnen Guten geben.
Nun spricht man aber weiter vom Guten in ebenso vielen Bedeutungen wie man vom Seienden spricht. Es wird etwas als gut bezeichnet im Sinne des substantiell Seienden wie Gott und die Vernunft, im Sinne der Qualität wie wertvolle Eigenschaften, im Sinne der Quantität wie das Maßvolle, im Sinne der Relation wie das Nützliche, im Sinne der Zeit wie der rechte Augenblick, im Sinne des Ortes wie ein gesunder Aufenthalt, und so weiter. Auch daraus geht hervor, daß das Gute nicht als ein Gemeinsames, Allgemeines und Eines gefaßt werden kann. Denn dann würde es nicht unter sämtlichen Kategorien, sondern nur unter einer einzigen aufgeführt werden.
Da es nun ferner für das Gebiet einer einzelnen Idee auch jedesmal eine einzelne Wissenschaft gibt, so müßte es auch für alles was gut heißt eine einheitliche Wissenschaft geben. Es gibt aber viele Wissenschaften, die vom Guten handeln. Von dem, was einer einzigen Kategorie angehört, wie vom rechten Augenblick, handelt mit Bezug auf den Krieg die Strategik, auf die Krankheit die Medizin; das rechte Maß aber bestimmt, wo es sich um die Ernährung handelt, die Medizin, und wo um anstrengende Übungen, die Gymnastik.
Andererseits könnte man fragen, was die Platoniker denn eigentlich mit dem Worte »an sich« bezeichnen wollen, das sie jedesmal zu dem Ausdruck hinzufügen. Ist doch in dem »Menschen-an-sich« und dem Menschen ohne Zusatz der Begriff des Menschen einer und derselbe. Denn sofern es beidemale »Mensch« heißt, unterscheiden sich beide durch gar nichts, und wenn das hier gilt, so gilt es auch für die Bezeichnung als Gutes. Wenn aber damit gemeint ist, daß etwas ein Ewiges sei, so wird es auch dadurch nicht in höherem Maße zu einem Guten; gerade wie etwas was lange dauert deshalb noch nicht in höherem Grade ein Weißes ist, als das was nur einen Tag dauert. Größere Berechtigung möchte man deshalb der Art zuschreiben, wie die Pythagoreer die Sache aufgefaßt haben, indem sie das Eins in die eine der beiden Reihen von Gegensätzen einordneten und zwar in dieselbe, wo auch das Gute steht, und ihnen scheint sich in der Tat auch Speusippos angeschlossen zu haben.
Indessen, dafür wird sich ein andermal der Platz finden. Dagegen stellt sich dem eben von uns Ausgeführten ein Einwurf insofern entgegen, als man erwidert: die Aussagen der Platoniker seien ja gar nicht von allem gemeint was gut ist, sondern es werde nur alles das als zu einer Art gehörig zusammengefaßt, was man um seiner selbst willen anstrebt und werthält; das aber was diese Dinge hervorbringt oder ihrer Erhaltung dient oder was das Gegenteil von ihnen verhütet, werde eben nur aus diesem Grunde und also in anderem Sinne gut genannt. Daraus würde denn hervorgehen, daß man vom Guten in doppelter Bedeutung spricht, einerseits als von dem Guten an sich, andererseits als von dem was zu diesem dient. Wir wollen also das an sich Gute und das bloß zum an sich Guten Behilfliche auseinanderhalten und untersuchen, ob denn auch nur jenes unter eine einzige Idee fällt. Wie beschaffen also müßte wohl dasjenige sein, was man als Gutes-an-sich anerkennen soll? Sind es etwa die Gegenstände, die man auch als für sich allein bestehende anstrebt, wie das Verständigsein, das Sehen, oder wie manche Arten der Lust und wie Ehrenstellen? Denn wenn man diese auch als Mittel für ein anderes anstrebt, so wird man sie doch zu dem rechnen dürfen, was an sich gut ist. Oder gehört dahin wirklich nichts anderes als die Idee des Guten? Dann würde sich ein Artbegriff ohne jeden Inhalt ergeben. Zählen dagegen auch die vorher genannten Dinge zu dem Guten-an-sich, so wird man verpflichtet sein, den Begriff des Guten in Ihnen allen als denselbigen so aufzuzeigen, wie die weiße Farbe im Schnee und im Bleiweiß dieselbe ist. Bei der Ehre, der Einsicht und der Lust aber ist der Begriff gerade insofern jedesmal ein ganz anderer und verschiedener, als sie Gutes vorstellen sollen. Mithin ist das Gute nicht ein alledem Gemeinsames und unter einer einheitlichen Idee Befaßtes.
Aber in welchem Sinne wird denn nun das Wort »gut« gebraucht? Es sieht doch nicht so aus, als stände durch bloßen Zufall das gleiche Wort für ganz verschiedene Dinge. Wird es deshalb gebraucht, weil das Verschiedene, das darunter befaßt wird, aus einer gemeinsamen Quelle abstammt? oder weil alles dahin Gehörige auf ein gemeinsames Ziel abzweckt? oder sollte das Wort vielmehr auf Grund einer bloßen Analogie gebraucht werden? etwa wie das was im Leibe das Sehvermögen ist, im Geiste die Vernunft und in einem anderen Substrat wieder etwas anderes bedeutet? Indessen, das werden wir an dieser Stelle wohl auf sich beruhen lassen müssen; denn in aller Strenge darauf einzugehen würde in einem anderen Zweige der Philosophie mehr an seinem Platze sein. Und ebenso steht es auch mit der Idee des Guten. Denn gesetzt auch, es gäbe ein einheitliches Gutes, was gemeinsam von allem einzelnen Guten ausgesagt würde oder als ein abgesondertes an und für sich existierte, so würde es offenbar kein Gegenstand sein, auf den ein menschliches Handeln gerichtet wäre und den ein Mensch sich aneignen könnte. Was wir aber hier zu ermitteln suchen, ist ja gerade ein solches, was diese Bedingungen erfüllen soll.
Nun könnte einer auf den Gedanken kommen, es sei doch eigentlich herrlicher, jene Idee des Guten zu kennen gerade im Dienste desjenigen Guten, was ein möglicher Gegenstand des Aneignens und des Handelns für den Menschen ist. Denn indem wir jene Idee wie eine Art von Vorbild vor Augen haben, würden wir eher auch das zu erkennen imstande sein, was das Gute für uns ist, und wenn wir es nur erst erkannt haben, würden wir uns seiner auch bemächtigen. Eine gewisse einleuchtende Kraft ist diesem Gedankengange nicht abzusprechen; dagegen scheint er zu der Realität der verschiedenen Wissenschaften nicht recht zu stimmen. Denn sie alle trachten nach einem Gute und streben die Befriedigung eines Bedürfnisses an; aber von der Erkenntnis jenes Guten-an-sich sehen sie dabei völlig ab. Und doch ist schwerlich anzunehmen, daß sämtliche Bearbeiter der verschiedenen Fächer übereingekommen sein sollten, ein Hilfsmittel von dieser Bedeutung zu ignorieren und sich auch nicht einmal danach umzutun. Andererseits würde man in Verlegenheit geraten, wenn man angeben sollte, was für eine Förderung für sein Gewerbe einem Weber oder Zimmermann dadurch zufließen sollte, daß er eben dieses Gute-an-sich kennt, oder wie ein Arzt noch mehr Arzt oder ein Stratege noch mehr Stratege dadurch soll werden können, daß er die Idee selber geschaut hat. Es ist doch klar, daß der Arzt nicht einmal die Gesundheit an sich in diesem Sinne ins Auge faßt, sondern die Gesundheit eines Menschen, und eigentlich noch mehr die Gesundheit dieses bestimmten Patienten; denn der, den er kuriert, ist ein Individuum. / Damit können wir nun wohl den Gegenstand fallen lassen.
2. Kennzeichen und Erreichbarkeit der Eudämonie
Wir kommen wieder auf die Frage nach dem Gute, das den Gegenstand unserer Untersuchung bildet, und nach seinem Wesen zurück. In jedem einzelnen Gebiete der Tätigkeit, in jedem einzelnen Fach stellt sich das Gute mit anderen Zügen dar, als ein anderes in der Medizin, ein anderes in der Kriegskunst und wieder ein anderes in den sonstigen Fächern. Was ist es nun, was für jedes einzelne Fach etwas als das durch dasselbe zu erreichende Gut charakterisiert? Ist nicht das Gut jedesmal das, um dessen willen man das übrige betreibt? Dies wäre also in der Medizin die Gesundheit, in der Kriegskunst der Sieg, in der Baukunst das Gebäude, in anderen Fächern etwas anderes, insgesamt aber für jedes Gebiet der Tätigkeit und des praktischen Berufs wäre es das Endziel. Denn dieses ist es, um dessen willen man jedesmal das übrige betreibt. Gäbe es also ein einheitliches Endziel für sämtliche Arten der Tätigkeit, so würde dies das aller Tätigkeit vorschwebende Gut sein, und gäbe es eine Vielheit solcher Endziele, so würden es diese vielen sein. So wären wir denn mit unserer Ausführung in stetigem Fortgang wieder bei demselben Punkte angelangt wie vorher.
Indessen, wir müssen versuchen dieses Resultat genauer durchzubilden. Wenn doch die Ziele der Tätigkeiten sich als eine Vielheit darstellen, wir aber das eine, z.B. Reichtum, ein Musikinstrument, ein Werkzeug überhaupt, um eines anderen willen erstreben, so ergibt sich augenscheinlich, daß nicht alle diese Ziele abschließende Ziele bedeuten. Das Höchste und Beste aber trägt offenbar den Charakter des Abschließenden. Gesetzt also, nur eines davon wäre ein abschließendes Ziel, so würde dieses eben das sein, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt, und bildete es eine Vielheit, dann würde dasjenige unter ihnen, das diesen abschließenden Charakter im höchsten Grade an sich trägt, das gesuchte sein. In höherem Grade abschließend aber nennen wir dasjenige, das um seiner selbst willen anzustreben ist, im Gegensätze zu dem, das um eines anderen willen angestrebt wird, und ebenso das was niemals um eines anderen willen begehrt wird, im Gegensatze zu dem, was sowohl um seiner selbst willen, als um eines anderen willen zu begehren ist. Und so wäre denn schlechthin abschließend das, was immer an und für sich und niemals um eines anderen willen zu begehren ist.
Diesen Anforderungen nun entspricht nach allgemeiner Ansicht am meisten die Glückseligkeit, die »Eudämonie«. Denn sie begehrt man immer um ihrer selbst und niemals um eines anderen willen. Dagegen Ehre, Lust, Einsicht, wie jede wertvolle Eigenschaft begehren wir zwar auch um ihrer selbst willen; denn auch wenn wir sonst nichts davon hätten, würden wir uns doch jedes einzelne davon zu besitzen wünschen; wir wünschen sie aber zugleich um der Glückseligkeit willen, in dem Gedanken, daß wir vermittelst ihrer zur Glückseligkeit gelangen werden. Die Glückseligkeit dagegen begehrt niemand um jener Dinge willen oder überhaupt um anderer Dinge willen[1q].
Das gleiche Resultat ergibt sich augenscheinlich, wenn wir uns nach dem umtun, was für sich allein ein volles Genüge zu verschaffen vermag. Denn das abschließend höchste Gut muß wie jeder einsieht die Eigenschaft haben, für sich allein zu genügen; damit meinen wir nicht, daß etwas nur dem einen volles Genüge verschafft, der etwa ein Einsiedlerleben führt, sondern wir denken dabei auch an Eltern und Kinder, an die Frau und überhaupt an die Freunde und Mitbürger; denn der Mensch ist durch seine Natur auf die Gemeinschaft mit anderen angelegt. Allerdings, eine Grenze muß man wohl dabei ziehen. Denn wenn man das Verhältnis immer weiter ausdehnt auf die Vorfahren der Vorfahren, auf die Nachkommen der Nachkommen und die Freunde der Freunde, so gerät man damit ins Unendliche. Doch davon soll an späterer Stelle wieder gehandelt werden.
Die Eigenschaft volles Genüge zu gewähren schreiben wir demjenigen Gute zu das für sich allein das Leben zu einem begehrenswerten macht, zu einem Leben, dem nichts mangelt. Für ein solches Gut sieht man die Glückseligkeit an; man hält sie zugleich für das Begehrenswerteste von allem, und das nicht so, daß sie nur einen Posten in der Summe neben anderen ausmachte. Bildete sie so nur einen Posten, so würde sie offenbar, wenn auch nur das geringste der Güter noch zu ihr hinzukäme, noch mehr zu begehren sein. Denn kommt noch etwas hinzu, so ergibt sich ein Zuwachs an Größe; von zwei Gütern ist aber jedesmal das größere mehr zu begehren. So erweist sich denn offenbar die Glückseligkeit als abschließend und selbstgenügend, und darum als das Endziel für alle Gebiete menschlicher Tätigkeit.
Darüber nun, daß die Glückseligkeit als das höchste Gut zu bezeichnen ist, herrscht wohl anerkanntermaßen volle Übereinstimmung; was gefordert wird, ist dies, daß mit noch größerer Deutlichkeit aufgezeigt werde, worin sie besteht. Dies wird am ehesten so geschehen können, daß man in Betracht zieht, was des Menschen eigentliche Bestimmung bildet. Wie man nämlich bei einem Musiker, einem Bildhauer und bei jedem, der irgendeine Kunst treibt, und weiter überhaupt bei allen, die eine Aufgabe und einen praktischen Beruf haben, das Gute und Billigenswerte in der vollbrachten Leistung findet, so wird wohl auch beim Menschen als solchem derselbe Maßstab anzulegen sein, vorausgesetzt, daß auch bei ihm von einer Aufgabe und einer Leistung die Rede sein kann. Ist es nun wohl eine vernünftige Annahme, daß zwar der Zimmermann und der Schuster ihre bestimmten Aufgaben und Funktionen haben, der Mensch als solcher aber nicht, und daß er zum Müßiggang geschaffen sei? Oder wenn doch offenbar das Auge, die Hand, der Fuß, überhaupt jedes einzelne Glied seine besondere Funktion hat, sollte man nicht ebenso auch für den Menschen eine bestimmte Aufgabe annehmen neben allen diesen Funktionen seiner Glieder? Und welche könnte es nun wohl sein? Das Leben hat der Mensch augenscheinlich mit den Pflanzen gemein; was wir suchen, ist aber gerade das dem Menschen unterscheidend Eigentümliche. Von dem vegetativen Leben der Ernährung und des Wachstums muß man mithin dabei absehen. Daran würde sich dann zunächst etwa das Sinnesleben anschließen; doch auch dieses teilt der Mensch offenbar mit dem Roß, dem Rind und den Tieren überhaupt. So bleibt denn als für den Menschen allein kennzeichnend nur das tätige Leben des vernünftigen Seelenteils übrig, und dies teils als zum Gehorsam gegen Vernunftgründe befähigt, teils mit Vernunft ausgestattet und Gedanken bildend. Wenn man nun auch von diesem letzteren in zwiefacher Bedeutung spricht als von dem bloßen Vermögen und von der Wirksamkeit des Vermögens, so handelt es sich an dieser Stelle offenbar um das Aktuelle, die tätige Übung der Vernunftanlage. Denn die Wirksamkeit gilt allgemein der bloßen Anlage gegenüber als das höhere.
Bedenken wir nun folgendes. Die Aufgabe des Menschen ist die Vernunftgründen gemäße oder doch wenigstens solchen Gründen nicht verschlossene geistige Betätigung; die Aufgabe eines beliebigen Menschen aber verstehen wir als der Art nach identisch mit der eines durch Tüchtigkeit hervorragenden Menschen. So ist z.B. die Aufgabe des Zitherspielers dieselbe wie die eines Zithervirtuosen. Das gleiche gilt ohne Ausnahme für jedes Gebiet menschlicher Tätigkeit; es kommt immer nur zur Leistung überhaupt die Qualifikation im Sinne hervorragender Tüchtigkeit hinzu. Die Aufgabe des Zitherspielers ist das Zitherspiel, und die des hervorragenden Zitherspielers ist auch das Zitherspiel, aber dies als besonders gelungenes. Ist dem nun so, so ergibt sich folgendes. Wir verstehen als Aufgabe des Menschen eine gewisse Art der Lebensführung, und zwar die von Vernunftgründen geleitete geistige Betätigung und Handlungsweise, und als die Aufgabe des hervorragend Tüchtigen wieder eben dies, aber im Sinne einer trefflichen und hervorragenden Leistung. Besteht nun die treffliche Leistung darin, daß sie im Sinne jedesmal der eigentümlichen Gaben und Vorzüge vollbracht wird, so wird das höchste Gut für den Menschen die im Sinne wertvoller Beschaffenheit geübte geistige Betätigung sein, und gibt es eine Mehrheit von solchen wertvollen Beschaffenheiten, so wird es die geistige Betätigung im Sinne der höchsten und vollkommensten unter allen diesen wertvollen Eigenschaften sein, dies aber ein ganzes Leben von normaler Dauer hindurch. Denn eine Schwalbe macht keinen Frühling, und auch nicht ein Tag. So macht denn auch ein Tag und eine kurze Zeit nicht den seligen noch den glücklichen Menschen.
Dies nun mag als ungefährer Umriß des Begriffes des höchsten Gutes gelten. Es ist zweckmäßig, den Begriff zunächst in grober Untermalung zu entwerfen und sich die genauere Durchführung für später vorzubehalten. Man darf sich dann der Meinung hingeben, daß jedermann die Sache weiterzuführen und die richtig gezeichneten Umrisse im Detail auszuführen vermag, und daß auch die Zeit bei einer solchen Aufgabe als Erfinderin oder Mitarbeiterin an die Hand geht. In der Tat hat sich der Aufschwung der Künste und Wissenschaften in dieser Weise vollzogen; denn was noch mangelt zu ergänzen ist jeder aufgefordert.
Zugleich aber müssen wir im Gedächtnis behalten, was wir vorher ausgeführt haben: wir dürfen nicht die gleiche Genauigkeit auf allen Gebieten anstreben, sondern in jedem einzelnen Fall der Natur des vorliegenden Materials gemäß die Strenge nur so weit treiben, wie es der besonderen Disziplin angemessen ist. So bemüht sich um den rechten Winkel der Zimmermann wieder Mathematiker, und doch beide in sehr verschiedener Weise. Der eine begnügt sich bei dem, was für seine Arbeit dienlich ist, der andere sucht das Wesen und die genaue Beschaffenheit zu erfassen. Denn das eben ist sein Fach, sich nach der reinen Wahrheit umzusehen. In derselben Weise muß man auch bei anderen Objekten verfahren, damit nicht die Hauptsache von dem Beiwerk überwuchert werde. Nicht einmal die Frage nach der Begründung darf man auf allen Gebieten gleichmäßig aufwerfen. Bei manchen Gegenständen ist schon genug damit geleistet, wenn nur der tatsächliche Bestand richtig aufgezeigt worden ist, so auch was die Prinzipien als Ausgangspunkt und Anfang anbetrifft. Die Tatsache ist das Erste und der Ausgangspunkt. Die Prinzipien werden teils auf dem Wege der Induktion, teils auf dem der Anschauung, teils vermittels einer Art von eingewöhntem Takt ergriffen, die einen auf diese, die anderen auf andere Weise. Da muß man nun versuchen, zu ihnen jedesmal auf dem Wege zu gelangen, der ihrer Natur entspricht, und dann alle Mühe darauf verwenden, sie richtig zu bestimmen; denn sie sind für das Abgeleitete von ausschlaggebender Bedeutung. Der Anfang ist nach dem Sprichwort mehr als die Hälfte des ganzen Werkes, und schon vermittels des Prinzips, von dem man ausgeht, tritt manches von dem in den Gesichtskreis, was man zu erkunden sucht.
Wenn wir das Prinzip bestimmen wollen, so dürfen wir uns nicht auf unser Ergebnis und auf seine Begründung beschränken; wir werden gut tun, auch das zu berücksichtigen, was darüber im Munde der Leute ist. Denn mit der Wahrheit stehen alle Tatsachen im Einklang, mit dem Irrtum aber gerät die Wirklichkeit alsobald in Widerstreit.