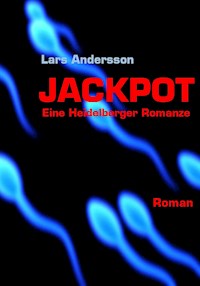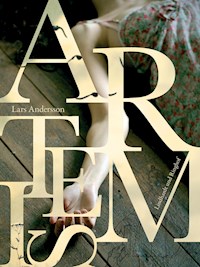
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packender Kriminalroman unter der schwedischen Mittsommernachtssonne. Es ist ein Sommer, wie er schöner nicht sein könnte. Doch er endet abrupt und auf tragische Weise. Denn am Abend der Hochzeit von Madeleine und Stig wird die Pfarrerin, die die beiden getraut hat, ermordet aufgefunden. Und nicht nur das, sie wurde in ein Fischernetz verschnürt, und durch die Maschen hindurch ist auf sie eingestochen worden. Die Hochzeitsgemeinde ist fassungslos. Das Opfer war Madeleines Freundin und auch mit dem Bruder der Braut gut bekannt. Erschüttert macht sich dieser auf die Suche nach dem Täter, nachdem die Polizei nicht Weiterzukommen scheint. Hauptverdächtiger ist sein alter Kindheitsfreund Eino, der am besagten Abend plötzlich verschwand - aber welches Motiv sollte er haben? Eifersucht, weil die von vielen umschwärmte Madeleine einen anderen heiratete? Was ist mit der Archäologin Nella, die Fanggruben im Wald untersuchen will, und deshalb seine Hütte gemietet hat? Ihr Interesse an der Jagd scheint verdächtig. Doch dann verliebt er sich in die junge Frau und setzt damit einen Flächenbrand in Gang, der fast ein weiteres Opfer fordert. REZENSION "Sehr spannender Thriller über einen Mann, der zum Spielball eines Wissenschaftlers wurde und in den Tiefen Schwarz-Afrikas zu sich selbst fand." - MacInspire, Lovelybooks.de AUTORENPORTRÄT Lars Andersson, Jahrgang 1954, ist einer der vielversprechendsten Autoren der jüngeren schwedischen Gegenwartsliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lars Andersson
Artemis
Roman
Aus dem Schwedischenvon Christel Hildebrandt
Lindhardt und Ringhof
Zu dir soll kein Gott kommen
und kein Mann oder Geist
Kein Dämon
denn du bist heilig in dir selbst
Deine Brüste sollen wachsen
Viele
um uns Milch zu geben
Unergründlich sollst du stehen
in der Höhe
Deine Augen wie Sterne
sollen strahlen über unsere Herden.
Gunnar Ekelöf, aus Dïwãn
über den Fürsten von Emigón
Mein Bericht hat einen kurzen, einleitenden Moment. Wie eine dunkle Glasscheibe. Darin enthalten alles oder nichts, man weiß es nicht. Vielleicht ein Flußbett aus Kieselsteinen. Über die das Wasser fließt. Aber Finsternis, frei fließende Finsternis.
Dann kommt die Welt, sie durchbricht sie und tritt hervor, als wenn Licht aus einem Kristall hervorbricht, den du hochhältst und vor deinen Augen drehst.
Die Welt zwängt sich hervor, aus sich selbst?
Tohuwabohu. Öde und Leere. Bereits zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, haben Zeit und Raum nach einander gegriffen, um ihre Fruchtblase um diese Finsternis zu ziehen.
Im kurzen Augenblick der Supergravitation und der Supergeometrie liegt alles bloß da, doch in Finsternis. Im Blick der Milliarden Lichtjahre entfernten Augen bricht dann die Welt hervor. Sie bricht hervor, erfriert oder erstarrt – wie hastig unter fließendes Wasser gehalten.
Nachmanides schreibt: »Zu Beginn brachte Gott aus dem vollkommenen Nichts eine äußerst dünne Substanz hervor, die unberührbar war. Diese Substanz, die die Griechen Hülle nannten, besaß die Fähigkeit, in verschiedene Formen umgewandelt zu werden: zu unserer Wirklichkeit geformt zu werden. Die Hülle wurde von Gott geschaffen. Seit der Hülle schuf ER nichts mehr, sondern formte sie zu allen Dingen in ihrem endgültigen Zustand.«
Die prägeometrischen Welten, tanzend in einer dunklen Glasscheibe. Schattenbilder, noch im Dunkel, am Grunde der Flut.
Ein zweites Mal schuf er: die großen Meeresungeheuer. Und ein drittes Mal: den denkenden Menschen.
»Gott schuf sie nach seinem Bilde, nach Gottes Abbild schuf ER sie, und ER erschuf Mann und Frau.«
Aber zuvor hatte er bereits 18000 Welten geschaffen, einige davon hatten ihm gefallen, die meisten hatte er verworfen.
Meine Erzählung hat nun begonnen.
Als Rabbi Akiva bei lebendigem Leib von den Römern gehäutet wurde, strömten die Engel herbei, weinten und warfen Gott vor, daß er so etwas zuließ. Aber eine Stimme vom Himmel sagte: »Wenn ich noch weitere Proteste höre, werde ich die Welt zwingen, wieder zu Wasser zu werden, ja, ich werde sie wieder zu einem Tohuwabohu werden lassen.«
Ich bin Erzähler und Realist, ich erzähle, wie es gewesen ist.
I
Meine Schwester heiratete. Es war im Juni. Die Sonne schien an diesem Tag, aber als ich am Vormittag rausfuhr, wehte ein kalter Wind. Es war knapp eine Stunde zu fahren. Die Zehn-Uhr-Nachrichten hörte ich, als die Straße von der nach Norden führenden Strecke abzweigte und in einer Kurve zu einer Brücke mit einem Kraftwerk daneben führte, dort, wo die Landschaft erst ihre wirkliche Form annimmt, ihre eigentliche Form, und weiter ging es durch den kleinen Ort F. an die Seen, die einer nach dem anderen aufgereiht daliegen.
Srebrenica. Gorazde. Ich hatte eigentlich geplant, den Kofferraum mit Sachen vollzupacken, die in die Hütte sollten, bevor mein Urlaub in einer Woche anfing, obwohl ich nicht dorthin wollte; hatte gedacht, alles in die Stube zu stellen, aber schließlich waren es nur vier Bilder geworden. Die wollte ich aufhängen, und in verschwommenen Gedanken überlegte ich Kurve um Kurve, wo sie hängen sollten. Ich wollte nicht, daß sie im Haus in der Stadt bleiben würden. Mit dem letzten See erblickt man gleichzeitig auch die Kirche, in der die Trauung stattfinden sollte, um ein Uhr, mit Madeleine, meiner einzigen Schwester, die wie eine Galionsfigur gravitätisch voranschreiten würde, mit den Brautmädchen und -jungen an der Schleppenreling.
Stig stand in kurzer Hose, mit Sonnenbrille, draußen und strich die Spitzen des Lattenzauns, als ich neben dem Haus parkte. Der Zaun hat rote, spitze Latten, und die Enden der Spitzen sind weiß gestrichen. Schon lange war die Rede davon, diese Tatsache deutlicher hervorzuheben. Neben ihrem eigenen Auto standen drei weitere auf dem Platz. Frühgekommene, die, während der Tag noch jung war, Kaffee trinken oder helfen wollten, das Fest vorzubereiten. Stig hatte wie immer eine Gelegenheit gefunden, aus der Planung auszuscheren. Über die Hand, die den Farbeimer hielt, hatte er einen Arbeitshandschuh gezogen, aber nicht über die andere, die Pinselführung war eine heikle Sache.
»Du kommst ja auch schon so früh«, sagte er.
»Mich hat nichts aufgehalten«, antwortete ich.
»Und Dina kommt also nicht.«
»Sie muß da was fertigkriegen.«
»Ach so.« Er konnte sich schon vorstellen, was es damit auf sich hatte. Er nahm neue Farbe auf den Pinsel.
»Das wird wirklich gut«, sagte ich. »Jedenfalls nicht schlecht.«
Auf der Seite des Hauses, die zur Straße und Gartentür zeigt, gibt es einige richtige Hängebirken. Ein leiser Luftzug fuhr durch das Birkenlaub, ein tiefes Flüstern, das anscheinend überhaupt nicht aufhören will. Mindestens zwei Rasenmäher knatterten in den Nachbargärten. Es näherte sich ein Zitronenfalter, den Stig mit der Pinselhand von den Latten zu verscheuchen suchte. Stig fährt eine Planierraupe und noch andere Maschinen im Straßenbauamt. Er ist hier im Ort geboren und aufgewachsen, dabei ist es ja nicht einmal ein Ort, nur eine Anhäufung von Häusern um eine Straßenkreuzung, weshalb es einen Bauplan und kommunale Abwasserkanäle gab. Madeleine war schon damals mit ihm zusammen, als wir noch mit unseren Eltern die Sommer in der Hütte verbrachten. Er hat das Haus seiner Eltern übernommen. Dazu gehören auch einige Meter Wald. Eine Weile hat er Verschiedenes gelernt und ein Jahr in Göteborg gelebt, aber mehr war dann nicht daraus geworden. Die Kinder sind acht, fünf und knapp ein Jahr alt. Madeleine ist Lehrerin in der Oberstufe. Jetzt haben sie beschlossen zu heiraten.
»Ich muß eben noch duschen«, sagte er. »Geh schon rein und trink eine Tasse Kaffee.«
Drinnen begrüßte ich die anderen. Madeleine war mit der Kleidung des ältesten Mädchens beschäftigt, Maja, die Fünfjährige. Ich kannte alle bis auf die Pfarrerin. Sie war eine frühere Freundin von Madeleine, noch aus dem Jahr in Göteborg, und arbeitete jetzt in Varberg. Stig und Madeleine wollten sich gern von ihr trauen lassen und hatten den Termin so gelegt, daß der hiesige Gemeindepfarrer Urlaub hatte, damit es kein böses Blut gab. Die Pfarrerin war rotblond, ziemlich groß und ziemlich hübsch, sie trug ihr Haar offen. Die Pfarrkleidung schien viel zu eng für sie zu sein. Ich erinnere mich an ihren Handschlag, ihren langen, sommersprossigen Handrücken. Sie hieß Elisabet, das wußte ich schon vorher, und Hallby, das hatte ich vergessen oder nie gehört.
Stigs Mutter und seine ältere Schwester mit Familie waren da. Das war das andere Auto. Die Mutter wohnte in einer betreuten Wohnung in der Stadt. Das dritte Auto gehörte Eino. Er ist schon seit langer Zeit ein Freund und wohnt in Växjö. Er war bereits am Abend zuvor gekommen und hatte hier übernachtet, genau wie die Pfarrerin. So wird sie ja wohl genannt.
Und dann kamen die übrigen Gäste, einer nach dem anderen. Einige fuhren natürlich auch direkt auf den Parkplatz vor der Kirche. Ich begrüßte sicher so um die zwanzig Personen. Lehrerkollegen. Jagdfreunde. Eltern von Kindern der Fußballmannschaft, die Stig trainierte. Und wie sonst die Verbindungen beschrieben werden können. Ich habe nie versucht, sie mir der Reihe nach vorzustellen. Sonnengebräunt, durchlüftet, Leute in leichten Sonntagskleidern, Kombiwagen, Kühler an Kühler. Die Kirchenwand blitzte weiß. Alle kannten mich mehr oder weniger. Wir füllten die vordere Hälfte der Kirche. Die Pfarrerin trat nun in einer viel zu großen Robe an den Altar und wartete auf das Glockenläuten. Dann kam der Kinderchor und stellte sich auf.
Es heißt, daß renovierte schwedische Kirchenräume aussehen wie Ausstellungshallen für Kunstgewerbe. Das stimmt. Auch an diesem Tag gab es Birkenlaub, Blumen und Tageslicht, das durch die hohen, blaugetönten Fenster hereinschien. Jetzt kamen sie mittelschiffs nach vorn. Madeleine, sich ganz des Ernstes dieser Stunde bewußt und gleichzeitig mit einem Auge auf das Einjährige, das Stigs Schwester trug. Ich erhob mich wie alle anderen und sah sie an. Sie hatte einen Gesichtsausdruck, der mir noch ganz vertraut war. So hatte sie schon in unserer Kindheit in bestimmten Situationen geguckt. Der Kantor, der auch aus der Gegend stammt und zumindest während der Pfingstferien, als Madeleine in die achte oder neunte Klasse ging, auf ihrer Hitliste einen der vordersten Plätze eingenommen hatte, gab dem Kinderchor das Zeichen zum Einsatz. Er fiel mit der sich vorne befindenden und ziemlich schwächlichen kleinen Orgel ein, nicht mit der großen auf der Empore, die nur bei besonderen Anlässen, Kirchenkonzerten, Weihnachtsmessen oder ähnlichem benutzt wird. (Ich bekam einmal den Schlüssel und spielte eine ganze Nacht, eine Frühlingsnacht, auf ihr: A Whiter Shade of Pale und, wie hieß es noch, Eleanor Rigby? Vanilla Fudge’s Version. The Sky Cried. Oh, no, must be the Season of the Witch ... That’s What Makes a Man ...)
Sie wurden nach einem Ritual getraut, das ich nicht kannte. Aber ich hatte schon lange nicht mehr geheiratet.
Alles wurde per Video gefilmt, von dem Mann von Stigs Schwester – was ist das? –, seinem Schwager. Ich habe mir den Film oft angesehen. Elisabet Hallby steht mit einem kleinen Blatt Papier in der Hand. Und sieht trotzdem majestätisch aus, wie eine Art Druidenpriesterin. Die Schatten sollten weich sein, erscheinen aber grell blau, fast lila. Wenn das Birkenlaub ins Bild kommt, scheint es zu brennen. Das Einjährige wehrt sich und will nach vorn. Ich, Erika Madeleine Gillberger. Ich, Stig Olof Torin. Schwenk über die Bankreihen. Da stehe auch ich. Die Blendenweite reicht von Weiß bis Dunkelgrau. Der Kinderchor, der Kantor. Die Gesichter der Kinder, der Brautkinder, eins nach dem anderen. Dann wieder Elisabet Hallby; wir bleiben eine Weile bei ihr, sie hebt das Kinn und schüttelt mit ruckartigen Bewegungen das Haar vom Kragen los, während wir Stig und Madeleine folgen, wie sie sich umdrehen und wieder hinuntergehen, jetzt jeder mit einem Kind auf dem Arm, Maja kommt hinterher und hält sich am Schleier fest.
Draußen stellten wir uns auf und warfen Reis, und auch das hat er gefilmt, sehr sorgfältig. Jetzt konnte er Regie führen, uns dirigieren, damit es ganz natürlich aussah. Es ist heller Sonnenschein. Zuletzt zieht er den Sucher und den Autofocus langsam auf den See, zoomt dorthin und verdunkelt, man hört ihn dreimal jemanden zum Schweigen mahnen, als es dunkel geworden ist. Das sind die einzigen Äußerungen, die er in diesem Drama von sich gegeben hat, die einzigen Worte von ihm, an die ich mich erinnern kann.
Ich bin vierzig Jahre alt und habe die acht letzten dieser Jahre im zivilen Katastrophenschutzamt gearbeitet. Meine Aufgaben sind immer mehr administrativer Art geworden. Früher bin ich viel herumgereist, auch im Ausland, in erster Linie zum Schutz von Chemikalientransporten. Ich kenne diese Leute, die zwischen echten und gedachten Katastrophen hin und her wandern. Mir gefielen sie, und die Schweden gehörten unter ihnen zu den besten. Unsere Art, eine Katastrophe einzukreisen, hatte oft etwas von einer Elchjagd an sich. Einer gut organisierten Elchjagd, Leute in der richtigen Bekleidung, die sich nicht aufregten, sondern kurz und knapp, aber zuverlässig ins Sprechfunkgerät sprachen. War Lärmen und Schreien angesagt, dann geschah das der Reihenfolge nach und meistens, um einander zu lokalisieren, damit alle wußten, daß jeder an seinem Platz war.
Wenn alles gutging, dann war die Sache klar, und die Katastrophen, die sich aus dem ganzen ergaben, wurden in angemessener Form von dem abkommandierten Schützen erledigt. War abzusehen, daß es schiefging, dann ähnelte die Stimmung einer Suche, nachdem jemand vorbeigeschossen hatte. Der beste Hund wurde geholt, und ein zuverlässiger Schütze machte sich an die Arbeit, die anderen saßen zusammen, während es dämmerte, sicher ein wenig durchnäßt, etwas müde, aber in solidarischer, guter Stimmung, traurig, aber zufrieden, bis man erfährt, ob die Maßnahmen gegen die Katastrophe so gut es ging ergriffen wurden oder ob die Katastrophe einfach ins Unbekannte verschwunden ist, in den an die Dunkelziffer angrenzenden, unerreichbaren Raum.
Mir gefiel diese Stimmung, auch wenn mir jegliche Form der Romantik in Zusammenhang mit Katastrophen fremd war. Uns, die wir nunmehr verstreut auf den Fluren des Katastrophenschutzamtes saßen und eher administrative Aufgaben hatten, fiel es schwerer, den Anblick der anderen zu ertragen. Die realen oder hypothetischen Situationen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten, schienen vom Anblick eines Computerbildschirms ersetzt worden zu sein. Wenn man ins Arbeitszimmer eines Kollegen schaute, sah man einen blau leuchtenden Schirm einer bestimmten Größe auf dem Tisch und einen Mann auf einem drehbaren Stuhl. Man konnte sehen, wie klein der Teil des Gesichtskreises und des Lebensfeldes eines Menschen eigentlich ist, der nach landläufiger Meinung von einem Schirm auf einem Tisch vor ihm aufgenommen wird. Ging man zurück in sein eigenes Zimmer, sah man dort dasselbe. Trotzdem gehe ich davon aus, daß das, womit ich arbeite, ehrenwert und von Bedeutung ist und getan werden muß.
Zwei meiner Kollegen, mit denen ich in der früheren Arbeitsgruppe im Amt am besten zusammengearbeitet hatte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt, im Juni, in einem Lastwagenkonvoi mit Gütern nach Srebrenica. Das beeinflußte mich ziemlich stark in der Einschätzung meiner Arbeit.
Aber der Schatten fiel eben einfach nicht auf mich, auf meinen Tisch, nicht einmal auf mein Arbeitsgebiet.
Ich bin vierzig Jahre alt, mein ältestes Kind ist vierzehn, mein jüngstes zehn. Zwei Jungen. Der Zehnjährige war fünf, als ich mich von meiner Frau nach zehn, nein, nach neun Jahren Ehe scheiden ließ. Helena wohnt mit den beiden Jungen in der gleichen Stadt. Aber nicht in unserem alten Haus. Ich habe sie neu kennengelernt. Ich bin vielleicht auch aus ihrem alten Bild von mir herausgetreten, habe akzeptiert und selbst festgestellt, daß ich ein anderer bin, wenn ich an sie denke – dabei meine ich jetzt vor allem die Kinder –, als der, den ich mir sonst vorstelle, ein anderer, den man aber kennenlernen kann.
Der Charakter unserer Stadt läßt sich gut mit der Route des Flughafenbusses beschreiben. Der fährt vom Busterminal zunächst zum Bahnhof, dort steigen ab und zu welche ein. Danach fährt er in einigen eleganten Schleifen am Hotel der Stadt vorbei, hat dort jedoch selten Gelegenheit, anzuhalten, danach über eine Brücke über den Fluß und am Theater vorbei, und schließlich hält er vor dem großen Komplex »Der Musketier«. Hier steigen die Fahrgäste zu. Ich auch, wenn ich irgendwohin muß. Hier sind drei große staatliche Behörden untergebracht, alle mit Verbindung zur Landesverteidigung, außerdem ein Wehrbüro und der Militärstab. Wir warten dort zu mehreren, wenn der Bus um die Kurve biegt. Einige in Uniform, alle mit Aktentaschen. Wir kennen einander, und viele haben ihren festen Platz im Bus, der also bei der Ankunft größtenteils leer ist. Im letzten Jahr ist es jedoch dreimal vorgekommen, daß ich meine Exfrau weiter hinten im Bus entdeckt habe, zu ihr gegangen bin und mich zu ihr gesetzt habe, auf der anderen Seite des Mittelgangs. Sie war am Markt in der Nähe der Provinzversicherung zugestiegen, bei der sie arbeitet.
Das letzte Mal hatte ich sie in diesem Sommer im April oder Mai gesehen. Sie trug einen grünen, capeähnlichen Mantel und hatte die Haare kürzer geschnitten, so daß ihre bernsteingelben Ohrringe, von denen ich glaubte, sie wiederzuerkennen, mit einer eigenartigen Deutlichkeit hervortraten, und sie lachte ihr übliches leises Lachen und erzählte mir, daß sie eine Karte für ein Stück gekauft hatte, das im Theater gespielt wurde, aber ich weiß um alles in der Welt nicht mehr, welches.
Wenn ich sie wiedersehe, überkommt mich jedesmal nach der Verwirrung des ersten Augenblicks Freude und gleichzeitig Trauer, daß wir jetzt nur noch so geringe Rollen im Leben des anderen spielen.
Mit Dina lebte ich in diesem Sommer seit gut zwei Jahren zusammen. Was soll ich über sie sagen? Sie hat grüne Augen. Sie hat kurzes, blondes, sehr lockiges Haar. Wir sind im gleichen Alter. Das einfachste, oder für mich am einfachsten zu Begreifende, was ich über sie sagen kann – ich stelle mir ihren Rücken vor. Er ist mir zugewandt. Die scharf hervortretenden Schulterblätter und die sommersprossige, nicht mehr ganz junge, aber warme und überraschend duftende Haut sowie die Nackengrube, das Haar. Dieser Augenblick, der sich so oft wiederholt hat: Ich drehe sie sanft auf die Seite, so daß ihr Rücken sich mir zuwendet. Die erste Erinnerung muß von einem der ersten Male sein, als wir miteinander schliefen. Ich drehte sie plötzlich, aber sanft auf die Seite, sie hob ihr Knie, und ich drang in sie ein und sah ihren Rücken und Nacken und spürte eine Einsamkeit und einen Frieden unermeßlichen Ausmaßes. Ich fühlte, daß ich sie mein ganzes Leben lang für diese Einsamkeit und diesen Frieden lieben konnte.
Das erscheint vielleicht sehr merkwürdig und könnte als kompromittierend angesehen werden. Ihre grünen Augen waren schuld, daß ich versucht hatte, sie zu erobern, und mich in sie verliebte. Diese grünen Augen, die funkelten, und all das Ruhige und Intelligente, das sie mit diesem grünen Funkeln sagte. Es gibt so einen grünen Edelstein, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie er heißt. Ihre Familie mütterlicherseits stammt aus Karelien. Sie war kurz vor unserem Kennenlernen in diese Stadt gekommen und war an der Hochschule frischausgebildete Assistentin für Geschichte und Philosophiegeschichte. Ihre eigene Geschichte war lang und machte viel Eindruck auf mich. Diese grünen Augen. Aber das andere war stärker als das Verlieben. Angesichts ihres Rückens, der sich mir zuwandte: Einsamkeit, Stärke und Frieden. Als sähe man in ein langes, einsames Leben, mit tiefer Freude. Später, wie ich zugeben muß, immer häufiger nur Einsamkeit. Das einfachste, was ich über Dina sagen kann: Ich habe mich fast drei Jahre lang in ihrem Rücken gespiegelt.
Worin sie sich bei mir gespiegelt hat, das weiß ich nicht. Vielleicht in dieser Trägheit, einer abwartenden Begriffsstutzigkeit dem Dasein gegenüber, die, wie ich glaube, als Festigkeit und Entschlossenheit mißverstanden werden kann. Vielleicht auch in der überraschenden, fast geheimnisvollen Tatsache, daß ein ungefähr gleichaltriger, geschiedener Mann, der Bürokrat beim Staatlichen Katastrophenschutzamt der Stadt in dem Landesteil ist, in dem sie Hochschulassistentin werden soll, Gedanken einer gewissen Tiefe und Schärfe haben kann (einer freilich nur langsam hervortretenden Schärfe) und von einem ungeahnten Frieden, von einer Stärke übermannt wird, wenn er in sie eindringt. Das geschieht hinter ihrem Rücken, und während der Wollust ihrer Vereinigung betrachtet er stumm, was auch sie betrachtet, sozusagen aus der gleichen Perspektive (und sie mit ihren funkelnden grünen, aber möglicherweise geschlossenen Augen): etwas, das die Form eines gemeinsamen Lebens annimmt, allein, eine lange, friedliche Einsamkeit zu zweit.
Ich lebte also mehr als zwei Jahre mit ihr zusammen, zuerst in ihrer Wohnung, danach in einem Haus, einem Häuschen, muß ich wohl sagen. Das ging sehr gut. Wir mußten feststellen, daß andere Dinge nicht so gut gingen. Jetzt war es Juni. Sie war nicht mit zu Madeleines Hochzeit gekommen, sie hatte ein Sommerseminar vorzubereiten. Das Thema hätte mich interessieren können, war aber nie Gegenstand unserer Gespräche gewesen.
Wir gingen in einer langen Reihe mit dem Teller in der Hand und nahmen uns etwas. Das Brautpaar war das Risiko eingegangen und hatte draußen gedeckt. Wir saßen an einem Tisch, der aus vielen verschiedenen Gartentischen zusammengesetzt war, schlimmstenfalls hätte man sich auch drinnen arrangieren können. Ich habe nicht aus der Erinnerung nachgezählt, aber wir müssen an die fünfzig gewesen sein, alle Kinder eingerechnet. Hoher Himmel, Sonnenfunkeln in Biergläsern, Karaffen und Besteck, vielfarbige Soßen zum Lachs und zu den Salaten, es wurde keine Rede gehalten, statt dessen wurde in langgezogenen Dialogen gesprochen, genau plazierte lange Pässe und sicheres Zuspiel, zwischendurch ein schnellerer, überraschender Einwurf aus dem toten Winkel, wahrscheinlich würde niemand auf dem Tisch tanzen. Ich will nicht näher darauf eingehen. Einige waren einmal meine Freunde gewesen. Ein Mann saß da mit spärlichem Haar und breiten Händen, den ich immer noch sehe, wie er bleich im Gesicht wird, als sich die Puch Dakota seines Bruders aufbäumt, die er sich ohne dessen Erlaubnis ausgeliehen hatte, und wie der Kies am Fußweg bei der Kiesgrube ihm um die Ohren spritzt und er geradewegs auf dem Rücken wegrutscht, das Moped zwischen den Beinen. Und ich erinnere mich daran, wie er mich einmal im Winter anrief, bei mir zu Hause in der Stadt, in der ich damals wohnte, weil die Top Ten von der nächsten Stadt aus gesendet wurden, was ich schon wußte, und er, weil er in der Jury war, auf den Abstimmungsknopf drücken durfte! Er hatte für Lady Madonna an erster Stelle gestimmt. Es klang, als wolle er dafür eine deutliche Bestätigung haben. Ich sagte, ich hätte für Hole in My Shoe mit Traffic gestimmt, und er verstummte sofort, und später sagte er, es sei ein verdammtes Glück, daß er mich im Sommer nicht mehr sehen müßte. Und ich merkte, daß daraufhin nichts weiter zwischen uns aufzubauen war, deshalb sagte ich, daß ich eigentlich für eine ganz andere Platte gestimmt hätte, wie hieß sie noch, was war das noch für eine: »This is the captain of your ship, your mind speaking ...«