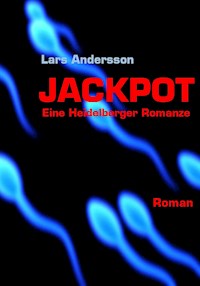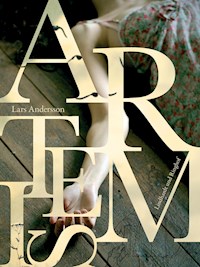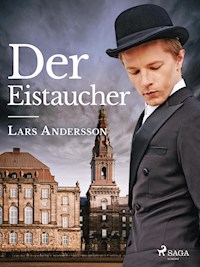
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Pastorensohn Emil Thorelius um 1880 nach Uppsala geht, um Medizin zu studieren, ist es vor allem der industrielle und wissenschaftliche Aufschwung, der ihn reizt und lockt. Emil Thorelius ist getrieben von dem Wunsch und der Suche nach einem besseren, sinnvollen Leben. Schon bald wird er auch auf die brennenden politischen und gesellschaftlichen Fragen aufmerksam. Sozialismus, Meinungs- und Religionsfreiheit und die aufklärerischen Ideale faszinieren den jungen Studenten gleichermaßen, wie der naturwissenschaftliche Fortschritt. Nächtelang debattiert er mit seinen Kommilitonen über Linné, Darwin und Marx. Doch mit seinem Zweifel an den alten Gewissheiten wächst auch seine innere Verlorenheit.DER EISTAUCHER ist ein flirrender Bericht über Menschen, Ideen und Konflikte in einer Zeit, als das moderne Schweden Gestalt annimmt. Anhand des Emil Thorelius wird eindrucksvoll beschrieben, wie nah Faszination und Verzweiflung auf der Suche nach einer neuen Wahrheit beieinander liegen. Es ist ein historischer Roman, dessen Bilderreichtum und dargestellte Spannungen unweigerlich auf die unmittelbare Gegenwart verweist. Lesenswert!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lars Andersson
Der Eistaucher
Aus dem Schwedischen von Verena Reichel
Saga
Der Eistaucher ÜbersetztVerena Reichel OriginalBikungskupanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1982, 2019 Lars Andersson und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711504628
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Für Egil
Die Eigenschaften der Bienen sind so bewunderungswürdig und lehrreich, daß die Bienen es allein schon deshalb verdienten, gezüchtet, gehegt und studiert zu werden. Kann man auch dem Wissenschaftler durch das grenzenlose All folgen und einen geblendeten Blick in die Festsäle der Schöpfung und auf die höhere Weltordnung werfen, oder in die verborgenen Werkstätten der Natur, um ihre Gesetze, ihre Ordnung und ihre Thätigkeiten zu bewundern, und ist nicht bloß auf die allgemeine Wahrnehmung angewiesen, so gibt es doch womöglich nichts, das allein so viele Anlässe zu Verwunderung, Bewunderung und lehrreichen Betrachtungen bietet wie ein Bienenvolk. Man findet dort zahlreiche, überaus treffliche Abbilder sowohl geistlicher als auch weltlicher Verhältnisse; man sieht sich an so vieles erinnert, was das rein geistige, das bürgerliche und das häusliche Leben in seiner edelsten Gestaltung betrifft. Ihr seid alle eins in Christo Jesu – wo wird dies deutlicher abgebildet als im Verhältnis eines Bienenvolks zu seinem Weisel?1 Wo findet sich ein anschaulicheres Bild für die höchste Entfaltung gesetzmäßiger Freiheit? Wo wird ein besseres und innigeres Familienleben abgebildet? Welche Geschöpfe legen edlere Triebe und ein besseres Verhalten untereinander an den Tag? Ja, man kann ein Bienenvolk nicht bloß mit einer Pflanze, einem Thier vergleichen;2 es läßt sich selbst mit vernunftbegabten Wesen in ihrer höchsten Offenbarung gleichsetzen. Die Schrift, die uns lehrt, in den sichtbaren Dingen die verborgene Welt wie in einem Spiegel zu erschauen, »in Gleichnissen«, weshalb verweist sie nicht öfter auf die Bienen?3 Wohl aus keinem anderen Grund, als daß die Eigenschaften der Bienen dazumal nicht so bekannt waren, wie sie es jetzt geworden sind, vielmehr war das Innere eines Bienenvolkes, was es für manch einen heute noch ist: ein Buch mit sieben Siegeln. Möge nun der Bienenstock für uns ein neues Blatt in jenem »Buch der Weisheit« werden, das in der Schöpfung aufgeschlagen vor uns liegt, und dessen Deutung wir in der Offenbarung, im göttlichen Wort, finden. Dann wird nicht bloß der Bienen Honig unseren Gaumen erquicken und unserer Gesundheit dienen, ihr Wachs uns leuchten usw., sondern ihre rechte Pflege und ihr Anblick werden unser Herz erfreuen und nach ihrer Maßgabe erbauen, sowie zu einer nützlichen und vernünftigen Zucht beitragen. Diese geflügelten Äolsharfen, diese fliegenden Honigblüthen, können uns in freien Stunden, sommers wie winters, eine kurzweilige Gesellschaft sein, indem sie unser Gemüth edel stimmen und uns zu nützlichen Betrachtungen anleiten, wie thunlichst aus dem Folgenden hervorgehen möge:
Prolog. Stilles Frühjahr. Arild Andersson 1980
Eine Horde einsamer und zänkischer Helden
saß fröstelnd nah am Straßenrand.
Die Nacht war dicht und finster zwischen ihnen,
so hockten sie beim kargen Proviant.
»Meine Geschichte will ich erzählen«,
sagte einer von ihnen, so jung und hold.
»Ich sagte: meine Geschichte will ich erzählen,
bevor ich werde zu Gold.«
Der Tag war kalt gewesen; abends lag die ganze sumpfige, überschwemmte Rasenfläche zwischen der Bushaltestelle und der südwestlichen Ecke des Wohnviertels mit Glatteis überzogen da. Ich strebte mit kurzen, schnellen, lächerlich trippelnden Schritten heimwärts, wach genug, um damit zu rechnen, irgendwo in eine vereiste Schlammgrube einzubrechen, von Müdigkeit zu benommen, um einen Unterschied zu merken; vorgebeugt und die Arme in den Taschen meines grünlichen, gefütterten Dufflecoats vergraben, auf dessen steif abstehendem Kragenrand der Sonnenbutton wie ein verirrter Käfer hockte, schief unter der Last meiner weißen, von Autospritzern braungefleckten Schultertasche, wo sich Bücher, Manuskripte, Briefe, Zeitungsausschnitte aneinander scheuerten wie Krebse in einer Reuse. Durch die Dunkelheit rings um mich her trieben dumpfe, ferne Geräusche wie eine versprengte Herde ohne Hirt. Im Altersheim linker Hand waren alle Fenster dunkel, im Wohnviertel selbst leuchteten spärliche Lebenszeichen, ohne jeden Zusammenhang.
Ich zog mechanisch einen Schlüssel aus dem Bund und steckte ihn ins Türschloß. Ragnhild telefonierte mit ihrer Mutter. Sie wollten sich am nächsten Tag in Stockholm treffen. Und als fernen Reflex spürte ich, wie sich alle mögliche Unlust auf den Magnetpol in diesem » Stockholm« orientierte, und wie sich ganz von selbst alle rationalen Argumente dafür einstellen würden, daß ich in Uppsala blieb.
Auf dem Küchentisch Zeitungen, Postanweisungen, Briefe. Cilla Johnson brachte kluge und finnlandschwedisch bedächtige Gesichtspunkte zu einem Übersetzungsprojekt vor, das wir bis zum Sommer anleiern wollten, und teilte mit, sie habe jetzt vor, für etwa einen Monat mit der Eisenbahn durch die Welt zu fahren. Simen Skjønsberg vom norwegischen Dagbladet schickte die Reinschrift eines Interviews, in dem ich als zurückhaltender, wenig mitteilsamer, vage talentierter jüngerer Schriftsteller erschien, der im Höllenlärm eines Stockholmer Lunchrestaurants seine Worte auf die Goldwaage legte. Lars Grahn von Bonniers Litterära Magasin schickte einen Prosatext über den bemerkenswerten Arzt Emil Thorelius aus Forshaga zurück, den ich im Herbst zuvor mangels anderer Texte eingesandt hatte, und tat sein Bestes, um meinen Katzenjammer wegen eines verhunzten Programmartikels zu kurieren, mit dem ich zur Autorenumfrage des kommenden Hefts beigetragen hatte. Das Postgiroamt teilte mit, mein Konto, das ich während seines einjährigen Bestehens dreimal benutzt hatte, sei für eine Privatperson registriert, ich könne jedoch, falls ich in Wirklichkeit ein Unternehmen oder ein Geschäftsmann, eine Kommune, Organisation, Stiftung oder ein Verein sei, Zinsen für das Konto beziehen.
Ragnhild erzählte von einer Prüfung, die sie an diesem Tag hinter sich gebracht hatte. Für einen meiner ehemaligen Mitstudenten, der jetzt denselben Kurs absolviert hatte wie sie, war dies die letzte Prüfung des medizinischen Staatsexamens. Er hatte uns und andere ins Restaurant Gillet eingeladen und versprochen, sich die Fliege umzubinden, die er beim Abitur getragen hatte.
Und Ragnhild, die gerade entdeckt hatte, daß in diesem Frühjahr außer dieser noch fünf Prüfungen auf sie zukamen, statt fünf Prüfungen mit dieser, wie sie bis jetzt angenommen hatte – es war eine Art Formel, ein Merkmal dafür, wie es sich mit den meisten Dingen in diesem Winter verhielt, man tauchte in eine Wake und schwamm in die Richtung, wo offenes Wasser sein sollte, und wenn man den Kopf wieder in die Luft streckte, zeigte es sich, daß man nur bei einer neuen Wake im Eis angelangt war – und für die fast der ganze Sommer in Arbeitstage und Bereitschaftsnächte eingeteilt war, und danach noch ein Herbst, bis es wieder irgendeinen Spielraum in ihrem Leben geben würde, sie hatte genau wie ich keine rechte Lust, ins Gillet zu gehen und auf kommende Tage anzustoßen.
Ich legte eine Platte auf, schleppte den Kontrabaß mitten ins Zimmer, machte mich unempfänglich für alles, was sich in meinem Kopf um Platz kabbelte, und hing den Klangfolgen wie ein dösender Galeerensklave nach. Und durch Phil Spectors abscheuliches Arrangement mit Posaunen und Mädchenchören, durch meine hämmernden, falschen Synkopen, bahnten sich, lange nachdem ich die Platte abgestellt und mich mit einem unbegreiflichen Buch aufs Sofa gelegt hatte, die Worte von Leonhard Cohens »True Love Leaves No Traces« mit ihrem Unterton von Gewißheit einen Weg.
Wie der Nebel keine Spur
im Gras hinterläßt,
läßt mein Körper keine Spur
an dir, keinen Rest.
Durch die Fenster der Nacht
kommt ein Kind, geht ein Kind.
Wie ein Haus, aus Schnee gemacht,
wie ein Pfeil im Gegenwind.
Spurlos ist die Liebe,
wenn du und ich vereint,
verblaßt sie wie die Sterne,
wenn hell die Sonne scheint.
Wie das Blatt im Fallen ruht
auf der Herbstluft so klar,
ruht dein Kopf auf meiner Brust
meine Hand auf deinem Haar.
Wie manche Nächte vergehn
ohne Mond und unbesternt,
werden wir es überstehn,
wenn das eine sich entfernt.
Spurlos ist die Liebe,
wenn du und ich vereint,
verblaßt sie wie die Sterne,
wenn hell die Sonne scheint.
Ich schlief auf dem Sofa ein, Walter Benjamins Baudelairestudie auf dem Bauch. Als ich aufwachte und ins Schlafzimmer schlurfte, stand der Wecker auf zwei. Der Kopf funktionierte durch provisorisch zusammengebastelte Schaltungen und rostige Relais, wie irgendein klappriges Heimwerkerprodukt, notdürftig mit mehreren Schichten Isolierband zusammengehalten. Ich zog mich aus und kroch fröstelnd neben Ragnhilds tief aus dem Schlaf antwortenden Körper, und während ich gierig wie ein Neunauge Körperwärme aus ihrem Rücken und ihren Schenkeln sog, versuchte ich den Traum zu erzählen, aus dem ich auf dem Sofa erwacht war.
»Es war auf Hedås, aber auch wieder nicht so ganz . . . Wir saßen mit einer Menge von Leuten in einem Zimmer, und da war ein Bus, den wir nehmen wollten . . . Die Leute quatschten und redeten ununterbrochen, die Diskussionen waren nicht zu stoppen, immer wenn wir aufstehen wollten, gab es jemanden, der um jeden Preis noch etwas beitragen mußte . . . Und als wir dann auf die Straße rannten, war der Bus vorbeigefahren.«
Sie murmelte, die Worte sanken in ihren Schlaf hinein und lösten sich in Vergessen und Dunkelheit auf, genauso wie sich der Traum in meiner wachen Sprache in sinnlose Fragmente auflöste. Ich legte mich auf den Rücken und schloß die Augen. Auf meiner Netzhaut, oder noch tiefer drinnen, in den Kolumnen der Sehrinde, spielten eigentümliche Lichtphänomene, die sich nicht unter Kontrolle bringen ließen. Wie von beweglichen Lichtkegeln wurden die äußeren Teile des Sichtfeldes in kurzen, rhythmischen Sequenzen erleuchtet. Wie ein Stroboskop, eins von diesen unerträglichen Lichtspektakeln in Diskotheken. Als ich die Augen öffnete, war es dasselbe. Meine Gedanken schraubten sich träge auf einen Leuchtturm an der französisch-spanischen Grenze zu, der die ganze Nacht seine Lanze aus Licht über unseren Köpfen geschwungen hatte, als ich mit zwei Freunden auf einer Interrailreise im Sommer 1972 in Schlafsäcken inmitten fürchterlich dorniger Büsche an dem Berghang über Port Bou lag. Hunde, die aus der Stadt heraufbellten, ein kleines, bösartiges Insekt, das ganz in der Nähe in einem Baum kreischte, und das wir der Reihe nach aufzuspüren und totzuschlagen versuchten, und dann der Lichtkegel des Grenzturms, der wie ein glitzernder Wellenkamm über den Abhang glitt und dicht über unseren Stirnen vorbeistrich. Irgendwann in der Nacht hörten wir auch Schüsse, glaube ich, doch da war alles schon verschwommen.
Allmählich sank ich unter den Rand des Schlafs. Und dann träumte ich wieder, und wieder waren da Hunde, die bellten, wieder waren Soldaten an den Flanken der Berge postiert . . .
Ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Ich glaube, es muß tief drinnen in der Sowjetunion gewesen sein, es hatte die Farbe der Wochenschauen von der Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Ich trug eine Uniform, weiß aber nicht, von welchem Land. Deutsche Posten legten von einem Berghang aus ein Sperrfeuer über das Tal, in dem ich mit einer Gruppe anderer Soldaten kauerte. Es muß auch Artilleriefeuer dabeigewesen sein, ich sah flüchtig Projektile dicht vor uns durch die Luft streifen. Eine Art Tunnel oder Schützengraben bot den einzigen Fluchtweg aus dem Tal. Ich versuchte mich durch eine Öffnung zu quetschen – es erinnerte stark an meinen qualvollen und lächerlichen Abgang mit dem Kopf voraus durch ein ca. 30 30 Zentimeter großes Fenster, als ich mich auf dem Plumpsklo beim Sommerhäuschen eingeschlossen hatte – doch ich kam nicht durch. Danach befand ich mich übergangslos auf einem Bahnhof, einer Endstation, wie ich mir einbildete, im Inneren Sibiriens. Die Zivilbevölkerung betrachtete mich mit einem gewissen Mißtrauen, ich glaube, ich trug die falsche Uniform, doch irgendwie verstanden die Leute trotzdem, daß ich auf ihrer Seite war. Noch immer war ich in Begleitung einer Gruppe von Soldaten, die vollständig anonym wirkten. Der Zug war abgefahren, wartete jedoch an einem kleinen Bahnhof einige hundert Meter weiter weg. Wir rannten auf ihn zu und hatten ihn fast erreicht, als er uns davonfuhr.
Durchgewalkt und durchgedroschen von anderen und barmherzig vergessenen Träumen erwachte ich am Samstag früh und wußte, daß ich wieder bei mir selber angelangt war. Eine Reihe von Monaten, die sich in einer Art von leer hallendem, labyrinthischen System aus immer engeren, immer dunkleren Gängen abgespielt hatten, wo ich in verbissenem Stumpfsinn mein Leben in der Dunkelheit wie eine Schafherde vor mir hertrieb, geleitet von grellen, fremden Signalen der Menschen droben auf der Erdoberfläche, schrillenden Telefonen, Briefstapeln, die auf dem Tisch wuchsen, Kalenderblättern, die gewendet wurden, und unkenntlichen Menschenstimmen, die mich über die Uhrzeit aufklärten – waren zu Ende. Ich war wieder in der Biosphäre gelandet.
Dieses ungewohnte Gefühl, Arme und Beine bewegen, nach Belieben herumlaufen, planen zu können, ließ mich den ganzen Tag untätig bleiben. Umschlossen von einem bleichen Licht angenehmer Trägheit trottete ich in der Wohnung herum, blätterte in Papieren, hörte mit halbem Ohr Schallplattenmusik.
Es war das letzte Wochende im März.
Das Land lag schlaff und apathisch wie ein Betrunkener in einem Container, der angefüllt war mit dem Müll eines ganzjährig ununterbrochen abgehaltenen Appells, der sich gerade vor einer Woche in allgemeiner Verwirrung aufgelöst hatte. Wenn sich in dem Müll etwas rührte, so war es nur der Betrunkene, der bei der verzerrten Erinnerung an Stimmlagen, hektisch plappernde Münder, rote, grimassierende Gesichter im Schlaf zusammenzuckte. Eine dünne, körnige Eisschicht wurde von einem halbherzigen Wind blankgefegt.
Es war genauso, wie wir uns das Ganze vorgestellt hatten, als wir, einige alte Jugendfreunde, in einem Haus bei Hjuljärn in der Neujahrsnacht die achtziger Jahre einweihten, genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten, als wir den Leichenschmaus für die siebziger Jahre hielten, jeder mit seiner Flasche Dünnbier, das im Laufe des Abends neben dem Herd schal geworden war, und dann um Mitternacht hinter der Hausecke Zeichen in den Schnee pinkelten –
»Piss brother!«
ihr wißt schon, diese Kreise mit dem Peace-Zeichen drin, um die Wende des letzten Jahrzehnts herum pflegte ich eines an einer Kette um den Hals zu tragen, gekauft in irgendeinem Kramladen in P-town auf Cape Cod –, es war genauso, wie wir es uns hatten denken können.
Doch jetzt das Gefühl, Arme und Beine wieder bewegen zu können; mein Aufhilfsjob bei einer Stockholmer Zeitung war abgelaufen, vor mir auf dem Tisch lag ein Umschlag mit Zugfahrkarten, der Frühling konnte nicht mehr beliebig lange auf sich warten lassen: Any Day Now, Any Day Now, I Shall Be Released.
Wir kamen am Montag, dem letzten Tag im März, morgens mit dem Nachtzug im Hauptbahnhof von Malmö an und traten in eine Stadt hinaus, die wie leergefegt war von einem starken, gelben Licht, das sich an den braunen Ziegelfassaden brach und in den Fugen des Kopfsteinpflasters glomm. Wir bummelten durch die Straßen, kauften Filme und Reiseproviant, wechselten Geld, saßen auf einem Marktplatz, wo die Rentner zwischen den Ständen herumschlenderten und Preise in Zeit und Raum verglichen. Man kann sich einbilden (ganz besonders natürlich, wenn man Ende März kommt und südwärts Weiterreisen will), Europa beginne dort, in Malmö. Die Leute sehen ausnahmsweise so aus, als sei die Stadt ihr natürliches Biotop, und nicht etwas, wohin sie sich verirrt haben und dem sie möglichst schnell mit heiler Haut wieder entrinnen möchten. Das gibt mir das Gefühl, ein Besucher zu sein, fasziniert und verständnislos.
Spät abends saßen wir in einem Kurswagen nach Budapest, in einem Abteil, das wir mit einer Frau im Alter zwischen fünfunddreißig und vierzig, mit einer etwas älteren Ungarin, die schon lange die schwedische Staatsbürgerschaft hatte und in demselben Ort in Småland wohnte wie eine Reihe von Ragnhilds Verwandten, und ihrem zwölf- oder dreizehnjährigen Sohn teilten. Die jüngere Frau weinte bis halbwegs nach Trelleborg still vor sich hin. Die Ungarnschwedin, nennen wir sie Magda, erklärte: die Frau sei in Malmö gewesen, um an der Beerdigung ihres Bruders teilzunehmen. Die Leute, denen sie, wie wir gesehen hätten, am Bahnhof gewunken hatte, seien nach Schweden geflüchtete Verwandte.
Nach einer Weile wischte sie die Tränen ab, steckte sich eine Zigarette an und schwatzte mit dem Jungen, der von Haus aus Ungarisch konnte, möglicherweise mit einem leichten kronobergschen Akzent, das lasse ich dahingestellt sein, und der auf das technische Gymnasium gehen wollte. Magda selbst sprach von der Verwandtschaft, der ihre Besuchsreise galt, von Budapest, vom småländischen Winterwetter, und kontrollierte immer wieder, ob auch alles in ihrem kolossalen Handgepäck verstaut war. Sie war mehrmals in Ungarn gewesen, seit sie ’56 zusammen mit ihrem Mann geflüchtet war, doch dies war das erste Mal, daß sie den Weg durch Ostdeutschland nahm.
Auf der Fähre nach Sassnitz aßen wir abends im Restaurant und befanden uns tatsächlich schon in Ostdeutschland: Deckenlampen mit einem Hauch von Kristallüstern, Kellner in weißen Jacketts und mit Pomade im Haar, Tischtücher, mit Durchschlag geschriebene Speisekarten, auf denen sich die üppigen Fleischgerichte drängten, bitteres Flaschenbier mit pompösen Etiketten.
Schlafend wurden wir über die preussische Lehmebene befördert, diesen endlosen Kartoffelacker, der mich selbst im Schlaf mit einer Vorstellung von Blutgeruch und der Körperwärme von in plombierten Viehzügen zusammengedrängten Menschen verfolgt, und rollten in einem naßkalten, kohlenrauchgeschwängerten Morgengrauen im Berliner Ostbahnhof ein. In der Nacht hatte ich nichts anderes gehört als das Geklapper der Weichen und Wagenkupplungen und die lauten Rufe der Bahnarbeiter, die einander in der Dunkelheit dirigierten. Es war dies ein Geräusch, das einem mehr als jedes andere das Gefühl vermittelte, auf der Durchreise zu sein, ein zugleich erschreckendes und robust zuverlässiges Geräusch, dem man entnahm, daß man in den Händen anderer Leute war, ein Gut unter anderen Gütern. Im Ostbahnhof mischte es sich mit den Geräuschen von krächzenden Lautsprechern und Gabelstaplern, und als ich die Gardinen aufzog und auf den Bahnsteig hinausschaute, meinte ich sie fast alle wiederzuerkennen: den älteren Mann im langen, zerknitterten Mantel, der seinen Zigarettenstummel wegwarf und die Glut austrat, während er mit zusammengekniffenen Augen nach dem Vorortzug Ausschau hielt, den jüngeren, irgendwie ironisch eleganten Mann, der seine Uhr aufzog, die Volkspolizisten in derben, klobigen Uniformen und hohen Lederstiefeln.
Auf dem Weg hinaus nach Berlin, längs der Meilen von vereinzelt auftauchenden, enormen Wohnhauskomplexen inmitten verfallener Siedlungsviertel mit kahlen, gespreizten Obstbäumen hinter den Zäunen, suchte ich vergeblich nach den Parolen, die ich im Jahr zuvor auf den Fassaden gelesen hatte, Parolen wie
Weil die Partei uns leitet
Ist der Sieg gewiss
und
Ewige Freundschaft mit der Sowjetunion
Ohne die Parolen hätte es, wie ich fand, mit kleinen Abweichungen die Ausfahrt von Stockholm, Oslo oder Göteborg sein können. Es war nur der schwere, klebrige Geruch von Kohlenrauch, der diese düstere Schönheit zu einer fremdartigen Schönheit und Düsterkeit machte.
Wir durchquerten die Lehmebene und erstellten auf den Notizblöcken ungarische Wörterverzeichnisse, eine zeitraubende und sozial ergiebige Prozedur. Abends stieg an einem Bahnhof eine Bande sturzbetrunkener Schuljungen ein, und mit der Zeit wurde es ein bißchen lästig, weil einer von ihnen unbedingt die jüngere der Ungarinnen auf Hals und Mund und Brüste küssen wollte, doch schließlich konnten wir sie aus dem Abteil scheuchen. Der jugoslawische Schaffner warf einen Stapel Decken herein; die Nacht verstrich, die dritte Nacht der Karwoche, wir schliefen abwechselnd auf der oberen Liege, in einem Luftzug, wie in einem Tunnel am Rand eines Gletschers, wo er seine Endmoräne auftürmt, man konnte dort sehr gut schlafen und sich dazwischen die Beine vertreten. Hätte man Eier dabeigehabt, man hätte sie auf der unteren Liege braten können.
Eine Sache jedoch hatte uns beunruhigt und beunruhigte uns zusehends, je mehr wir uns der tschechischen Grenze näherten. Wir hatten Magda zeigen müssen, wo sie für sich und den Jungen vor der Ankunft in Sassnitz ein Transitvisum für die DDR kaufen mußte, sie hatte nicht gewußt, daß man das brauchte. Auch hatte das Reisebüro in der nächstgelegenen småländischen Stadt nichts von einem Visum für die Tschechoslowakei gesagt. Tschechische Visa konnte man, soviel ich wußte, nicht an der Grenze ausstellen lassen. Andererseits wollten wir ihr keinen unnötigen Schrecken einjagen. Wir hatten uns vorsichtig erkundigt, hatten unsere Zeit abgewartet, und als dann kurz nach Mitternacht der tschechische Grenzpolizist mit seiner Taschenlampe im Abteil stand, wurde die Sache geklärt.
»Sie nehmen den ersten Zug zurück nach Berlin! Dort beantragen Sie morgen in der Botschaft ein Visum!«
Magda protestierte aufgeregt in ihrem seit dreißig Jahren vergrabenen Schuldeutsch mit vielen småländischen Lehnwörtern, ich versuchte den Mann mit mannigfach gebeugten Verben zu erweichen, doch er war bald der Worte müde und zerrte an dem Bettzeug, um Mutter und Kind von den Liegen herunterzuschütteln.
»Raus! Zurück nach Berlin!«
»Aber«, rief Magda, und ihre Augen leuchteten weiß im Strahl der Taschenlampe, »aber ich habe eine kleine Gosse!«
Das Problem wurde schließlich gelöst. Es zeigte sich, daß sie einige schwedische Devisen dabeihatte. Sie wurde aus dem Zug gelotst, den Bahnsteig hinunter, und, wie sie später erzählte, zu einem Kontor an der Grenzstation gebracht, vor dem sie eine Weile sitzen mußte, während man dort drinnen beratschlagte, wurde dann vom Grenzpolizisten im Korridor beiseite genommen und bezahlte ihm zweihundert schwedische Kronen, worauf sie sich im Kontor ein gestempeltes Transitvisum holen konnte, für eine einfache Reise.
Verschwitzt und atemlos kam sie wieder im Abteil an, kurz bevor der Zug abgepfiffen wurde.
»Ich dachte die ganze Zeit«, sagte sie, »man würde mich dabehalten und den Zug mit dem Jungen abfahren lassen.«
Wir näherten uns bereits Budapest, als Magda ihre Geschichte erzählte. Sie war unter den achttausend Studenten gewesen, die sich an einem Dezembertag 1956 vor dem Parlament versammelt hatten, als die russischen Soldaten in die Volksmenge zu feuern begannen. Ein junger Mann zog sie hinter eine Treppe und legte den Arm um sie, damit sie in Deckung blieb. Als die Salven verebbten, stürzten sie wie alle anderen zum Haupteingang, um in das Gebäude zu flüchten. Der Mann lief hinter ihr und schob sie durch die Türöffnung. Als sie sich umdrehte, lag er erschossen auf der Treppe.
Später am Abend ging sie heim in ihr Zimmer am Stadtrand von Budapest. Bevor sie das Treppenhaus betrat, bekam sie von jemandem die Mitteilung, daß ein Nachbar, der Parteimitglied war, sie als Teilnehmerin an der Studentendemonstration angezeigt habe, und daß sie gewärtigen müsse, von der Polizei festgenommen zu werden. Noch in derselben Nacht verließ sie die Stadt und schloß sich auf dem Weg zur österreichischen Grenze einer Gruppe von anderen Flüchtlingen an.
»Wir bewegten uns in den Nächten fort. Wir gingen im Schutz der Bahndämme und in Tälern und Mulden. Es gab natürlich hier und da russische Posten, doch sie hatten noch keine wirksame Kontrolle über das Gelände. Dann kamen wir zur Grenze. Sie war ja noch nicht vermint, nach dem Rückzug von Österreich. Die Russen versuchten, die Felder so gut wie möglich mit Scheinwerfern und Maschinengewehren zu decken. Wir krochen und robbten uns dort durch, wo das Gelände ein wenig Schutz bot. Die Eltern unter uns hatten ihren kleinen Kindern Schlaftabletten gegeben, und wir zogen sie an Riemen hinter uns her.«
Ihr Verlobter war auf einem anderen Weg geflüchtet. In Schweden kamen sie wieder zusammen.
Und plötzlich erinnerte ich mich an die allerersten Male, als für mich daheim auf dem Küchenfußboden ein wenig Wirklichkeit wurde, daß Menschen in anderen Ländern wohnten – aber das muß ein paar Jahre später gewesen sein, vielleicht ’58 oder ’59 –, als meine Eltern alte Schals, Mützen, Kinderkleider in große Pappkartons packten, die für eine Familie in Budapest bestimmt waren, und dann kamen ein Photo und Briefe, über denen meine Mutter mit ihrem deutschen Schullexikon saß, um sie zu entziffern. »Gewesen.« Ja, undeutlich wie auf einer Radiofrequenz, die sich nie richtig einstellen läßt, doch verbunden mit irgendwelchen unbestimmten optischen Erinnerungen, einem Fußboden, einer Tür, hörte ich meine Eltern wieder über etwas diskutieren, das die Wortstellung von diesem »gewesen« betraf. Das muß das erste ausländische Wort gewesen sein, das ich aufschnappte.
Kurz vor fünf Uhr nachmittags am Aschermittwoch stiegen wir im gigantischen, an eine halbwegs ausgeräumte Markthalle erinnernden Budapester Hauptbahnhof aus. Dann gingen wir von einem Hotel zum anderen, wegen Ostern war alles belegt, und landeten zu guter Letzt in einer Jugendherberge hoch oben in Pest.
In der nachmittäglichen Dämmerung des Gründonnerstags kletterten wir in Siófok am südlichen Ufer des Balaton aus dem Zug. Auf gut Glück; und so off season wie nur möglich, wie uns klar wurde, als wir den Koffer durch dunkle Straßen schleppten, vorbei an einer halb verdunkelten Kneipe, in ein völlig verlassenes Hotel Europa hinein, wo man bedauerte, daß man erst in etwa einer Woche anfangen würde, die Zimmer zu heizen.
Am Karfreitag nachmittag standen wir ganz hinten, neben der Säule, an der die Eintretenden die äußerste Kuppe des Handschuhs ins Weihwasserbecken tauchten und sich damit die Stirn befeuchteten, in der überfüllten Kirche von Siófok, und eine Stunde lang war es, als vibriere alles, was wir hörten und sahen, auf den Spitzen einer Stimmgabel, die man mit einem enormen Resonanzkasten in Kontakt gebracht hatte.
Es wehte eine steife, eiskalte, hartnäckige Brise über dem See. Immer noch am Nachmittag des Karfreitags parkten wir einen gemieteten Fiat an der offenbar verriegelten Kirche, ein gutes Stück weiter weg, in einem winzigen Dorf, gingen in die Dorfwirtschaft, wo die Bauern hereinkamen und ein Glas Palinka kippten, während der Traktor draußen im Leerlauf brummte, wanderten auf dem lehmigen Weg zwischen Häusern und Hühnerställen in ein Tal herab, wo man eine Kiesgrube ausgehoben hatte, und kamen auf einen Friedhof mit einem riesigen Steinblock, dessen vier Seiten mit den Namen von gefallenen Soldaten der Roten Armee bedeckt waren, und dicht gedrängten, niedrigen Holzkreuzen auf dem Boden.
Am Abend des Ostersamstags saßen wir jeder in eine graue Decke gehüllt da und hatten eine Flasche Weißwein und einen Brotlaib vor uns auf dem Tisch, als ein mißtrauisch glotzender Hausmeister hereinkam, um eine Glühbirne auf der Toilette einzuschrauben.
Am Morgen des Ostersonntags wurden wir um halb sechs geweckt und trugen unser Gepäck zum Bahnhof, beobachteten einen Zug, der ostwärts davonfuhr, und wunderten uns über eine Bahnhofsuhr, die eine Stunde vorging, bis uns klar wurde, daß die ungarische Eisenbahn (doch keine andere) pünktlich in dieser Nacht auf Sommerzeit geschaltet hatte. Ein schönes und teilnahmsvolles Mädchen in der Hotelrezeption schaffte es, nach einer Rundfahrt durch die Stadt einen Bekannten aufzutreiben, der uns zum Freundschaftstarif nach Budapest fuhr, wo sich unser Zug, mit starker Verspätung durch Schneeverwehungen in Vojvo Dina, nordwärts in Bewegung setzte.
Am Dienstag, dem 8. April, trafen wir wieder im Bahnhof von Uppsala ein, und das Frühjahr versprach nichts Bestimmtes.
Nur noch ein einziger Zug: an einem Sonntag Mitte April gehen Arild Andersson, Ragnhild und der Freund F. die Straße zur Dänischen Kirche entlang, biegen an einer Scheune ab, die zum Treffpunkt eines Motorradclubs umgebaut worden ist, klettern über den Zaun eines Schafpferchs und stehen auf der einzigen Andeutung von Hügel, die auf dieser Seite des Flüßchens Fyris zu entdecken ist. Der Sonnenschein ist hell und scharf. Die Ackerfurchen der Felder liegen nur auf der Sonnenseite bloß, mit einer Schwärze, die nur möglich ist, wenn man lange keine nackte Erde mehr gesehen hat. Auf der Schattenseite liegt noch eine Schicht Schnee. Die Landschaft zeichnet sich mit graphischer Schärfe ab. Von der Anhöhe aus sieht man jenseits der Klötze der Fabrikanlagen und Mietskasernen den anderen, den wirklichen Hügel, das Schloß ist daraufgedrückt wie ein roter Fez, und aus der Mulde daneben steigen souverän die beiden watvogelartigen Türme des Doms auf.
Sie haben sich hingehockt und angefangen, Kaffee einzuschenken, als sich Schnee in die Luft mengt. Dann wird der Schneefall rasch dichter, ein niedrig dahinjagender Wind kommt auf, im Laufe von Minuten herrscht ein heftiges Schneetreiben. Sie sind dünn angezogen und brechen bald auf, nehmen den kürzesten Weg zum Bahndamm, wo die Bahnlinie nach Länna, auf der im Sommer sonntags ein Ausflugszug verkehrt, die Ebene durchquert.
Im Näherkommen sehen sie, daß eine Lok auf dem Gleis steht. Sie hat vorn einen Schneepflug, ist aber offenbar steckengeblieben, zwei Männer sind ausgestiegen und schaufeln den Schnee weg. Wenn diese Lok sie mitnähme, könnten sie praktisch zu Hause vor der Tür abspringen. Sie beschleunigen ihr Tempo, die Männer sind in die Lok gestiegen, und als sie nur noch zehn Meter entfernt sind, startet die Lok und kommt durch, fährt davon.
Knapp hundert Meter weiter bleibt sie wieder stecken. Arild Andersson, Ragnhild und der Freund F. legen wieder Tempo zu. Jetzt haben sie vielleicht noch fünfzehn Meter vor sich, als die Lok losruckelt.
Dies wiederholt sich ein drittes Mal. Sie schwören, niemals nach Länna zu fahren.
Doch der Frühling pochte unter der Erde, rechthaberisch, unerschütterlich. Die Fluren begannen zu trocknen. Der Schnee kehrte in raschen, geordneten Attacken zurück, besetzte die Felder, brachte das Pochen zum Verstummen, befestigte seine Macht, zog sich aber genauso schnell wieder zurück. Und mit jedem Mal war die Zeit stärker aufgestaut: sobald der Boden nackt dalag, brach der Strom der Zeit mit neuer Kraft hervor.
Auf dem Rasen vor dem Haus strömten die Kinder zusammen, sie konnten nicht alle vom Hof kommen (ich kannte kaum die Hälfte davon), er mußte zum Treffpunkt der Kinder aus der ganzen Gegend geworden sein. Ich saß vor einem unbeschriebenen Blatt Papier in der Schreibmaschine, stand mit irgendwas in den Händen herum, beugte mich über die eine oder andere eilig zusammengewürfelte Mahlzeit und schaute zum Fenster hinaus, auf die Kinder, die beispielsweise mit Eishockeyhelmen auf dem Kopf Rugby spielten, die Tore mit Stöcken markiert. Sie hatten jede Größe zwischen 90 und 150 Zentimeter, und faßte man ein einzelnes ins Auge, so schienen Kopf, Körper, Bewegungen, Gesten absolut und richtig, passend in dem speziellen Maß, wenn man sie aber zusammen betrachtete, entstanden absurde Kontraste, unvereinbare Proportionen, wie in einem Aquarium. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie es gewesen war: in einer Welt zu leben, in der Alter und Körpergröße das waren, was zählte, was ganz eindeutig definierte, wer man im Verhältnis zu allen anderen war. Dadurch war festgelegt, welchen Platz man bei den Spielen hatte, welchen Wert bei den Mannschaftskämpfen, wie lang der Tag für einen war, wie groß das Revier. All die Systeme von Maßen und Dimensionen, in denen das Kind lebt! All die Ordnungen, die das Kind im Laufe eines Tages mit seinem Körper durchläuft! Rechtsordnungen, die keine einfachen Hierarchien waren – ein feines Netz von Rücksichtnahmen, Ehrenkodexen, Vorteilen und Trumpfkarten. Doch im Grunde genommen ist das gesamte Dasein topologisch nach diesen Zeichen geordner: >, <. Größer als, kleiner als.
Abgesehen von ein paar besonderen »Spielgefährten« war es fast ausnahmslos die Plazierung um diese Zeichen herum, die den Menschen so etwas wie eine Identität schenkte. Zwar verband sich mit jedem eine vage Charakterfärbung, etwa: »nett«, »gemein«, »mutig«, »feige«. Doch darüber hinaus war das einzig Interessante das, was diese Zeichen signalisierten: >, <. Auch für die Erwachsenenwelt, für alle bis auf die nächsten Angehörigen, war man möglicherweise »lieb«, »böse«, doch im großen und ganzen nichts anderes als ein Körper, der sich irgendwo in den Serien von > und < plazierte. Die Kinder, die draußen auf dem Rasen Rugby spielten, untereinander die Fahrräder ausliehen und ums Viertel rasten, atemlos von Schaukel zu Schaukel kletterten, sonderbare Gebilde im Sandkasten bauten, alle miteinander, angefangen mit denen, die gerade laufen gelernt hatten, bis hin zu den Grenzfällen, die an den ersten Vergiftungssymptomen der Pubertät litten und deshalb mit einem Ausdruck herumliefen, als wüßten sie nicht recht, ob sie sich hier befanden oder nicht – alle miteinander lebten sie fast vollständig eingeknöpft in Alter und Größe ihres Körpers, seinem Platz in der Ordnung der Körper.
Was sich in den Köpfen der anderen regte, besaß nicht den leisesten Schimmer von Realität.
Ich befand mich, rief ich mir selbst in Erinnerung, in der Jahreszeit, in der ich meine Erzählung über das Moor schreiben wollte.
Sie sollte in dem Stadium des Frühjahrs spielen, das der Zeit jetzt auf der Zunge lag: der Boden noch hart, ein Bodenfrost, der sich in der Erde festzubeißen suchte, jedoch langsam in Stücke gerissen wurde, eine trübe, feuchte Dämmerung, ein böiger Wind.
So war es stets mit dem, was aufs Papier sollte: es mußte in einer Zeitvorstellung festgenagelt werden, und es mußte ein Stückchen in der Zukunft liegen. Im Winter eine Erzählung über den Sommer zu schreiben, war natürlich zum Scheitern verurteilt, geradeso, als wollte man ein einziges wahrhaftiges Wort über den Schnee sagen, der im vorigen Jahr gefallen war. Es war aber auch möglich, genau über die Zeit zu schreiben, die jetzt war, man mußte sich nach etwas strecken, was gerade außerhalb des Blickfelds lag.
. . . Ein Mann, der tief im April ins Torfmoor kommt. Seine wenigen Habseligkeiten hängt er an die Nägel der Barackenwand. Noch ist das Moor bloß eine leere, fremde Fläche, die sich vor seinem Fenster rasch in Dunkelheit hüllt. Er wird mindestens zwei Monate lang allein im Moor sein, bis das Häufeln beginnt.
Er tritt die Nachfolge des alten Torfstechers an: es ist eine Stichstelle, eine der letzten. Er soll die Torfbruttoproduktion des nächsten Jahres ausgraben. In der Dunkelheit draußen, ein Stück von der Baracke entfernt, steht das Fabrikgebäude, eine große, rotgestrichene Scheune, in der die Maschinen, von Lederriemen getrieben, stillstehen, schweigen, warten.
Als ich mich in den Schlafsack eingepackt hatte, bis nur noch der Kopf herausschaute, lag ich vollständig still. Eine Weile war da irgendein Geräusch, das ich zu deuten versuchte. Es war stockfinster. Ich lag wie eine eingelegte Kassette in der Dunkelheit. Ich dachte an Frösche und Eidechsen, die in einem Laubhaufen oder einem Erdloch überwintern, an Schlangen, Maulwürfe. Ich stellte mir einen schlaflosen Frosch im April vor, der ins Dunkel hinauslauscht.
In Umrissen war mir die Geschichte klar. Die Moorleiche, das Geheimnis, das er mit keinem zu teilen beschließt, der Gedanke, der sich zu einer Zwangsvorstellung auswächst, irgendwie die Erfahrungen des Toten zu extrahieren, den Augenblick des Todes zu rekonstruieren, von der anderen Seite her zu sehen, was geschah, als Abel getötet und in einen Sumpf geworfen wurde . . . Ich hatte meine Entwürfe zur »neolithischen Revolution« und eine Menge Geistesblitze im Umkreis derselben Idee, sie verwoben sich mit einer ungeschriebenen Erzählung über einen Hünengrabforscher und einer über Ishtar in der Unterwelt und noch einem halben Dutzend anderer, ungeschriebener, hier und da deutlich aufblitzender Räubergeschichten. Ich war sogar ein Stückchen mit meinen Notizen über eine verlorene Zivilisation vorangekommen, in der die Menschen nur ein Substrat für frei übertragbare endogene Viren waren, ein Hyperorganismus, der längst kollabiert war und nur in den Annalen einer Sekte von Eingeweihten lebte, welche Vorbereitungen für ihre Wiederkehr traf . . .
Allmählich sammelten sich Notizen auf allen möglichen Blocks und in Aktenordnern und Schubladen, doch sie begannen nie zu sprechen. Immer wenn ich mich ihnen zuwandte, rutschte ich aus wie auf Bohnerwachs. Alles versteckte sich hinter allem. Was ich aufs Papier brachte, waren kryptische, abgegriffene Kompilationen von Gedankengängen, die sich wie Aale über den Boden geschlängelt hatten, um im dunklen Wasser zu verschwinden.
»Formwechsel« Sprache–Schrift und vice versa. Die Erzählung handelt davon, wie jemand versucht, ein Sprechender zu werden. Nietzsche: kein Unterschied zwischen der Welt und den Erzählungen von der Welt.
Alle historischen Phänomene können als Skalen betrachtet werden, als Schriftsysteme, Wortschatz, Distinktionen, die es dem Sprechenden ermöglichen, ein Netz von Bedeutungen zu knüpfen. Der Torfstecher sucht eine Inschrift, eine Hieroglyphe für das, was geschieht, wenn der Mensch seßhaft wird, das Reich der Geschichte gründet.
Bestimmte Pflanzenarten, ebenso wie der Lemming (und eine Hunderasse?) haben vermutlich die letzte Eiszeit überlebt, hoch oben in einem Fjäll oder auf dem schmalen Küstenstreifen, der »vom Sognefjord bis hinauf zum Eismeer eisfrei war« (Ekholm: Vorzeit und Vorzeitforschung in Skandinavien, Stockholm 1935). Könnte dasselbe möglicherweise für Menschen gelten?
Magdalénien – die letzte Kulturepoche im Paläolithikum, d. h. kurz vor dem Ende der Eiszeit. Hier erreichen die Höhlenzeichnungen und Felsbilder ihren Höhepunkt – Altamira, La Madeleine. Die Bilder gehen von einfachen Strichzeichnungen in Rot und/oder Schwarz in »polychromatische« Bilder über. Meist sind es Tierbilder – Rentier, Moschusochse, Bison – die manchmal einen Zug von Fabel- oder Totemtieren haben.
Der Dolmen war ursprünglich ein Einzelgrab, wurde jedoch mit der Zeit zum Massengrab. Bei allen Megalithgräbern ist die Altersbestimmung schwierig, da man oft die alten Leichen hinausgeworfen hat, um für neue Platz zu schaffen.
Anbau von Hirse, Gerste und Weizen. Vermutlich Pflug. Zu den Haustieren der ä. Steinzeit kommen jetzt der Ochse, das Schaf, die Ziege und das Schwein sowie das Pferd.
Narben, stumme Punkte, Lücken zwischen Bewußtsein und Verhalten, die es den objektiven Strukturen erlauben, sich hinter meinem Rücken zu schließen der blinde Fleck: der Teil der Netzhaut, wo das Gehirn hineinwächst, wo eine Verbindung zur Erinnerung/ Ratio besteht – und wo das Bild unmöglich wird
Isak Mårgårds Utopie: der äußere Zwang vollständig abgeschafft, die Gemeinschaft total verinnerlicht. Das Verhalten wird von einer »inneren Stammesgemeinschaft« kontrolliert, die niemals in Worte oder Rituale gekleidet wird. Versteck!
Zettel von der Art zerknitterter, fest geschlossener Salatköpfe in schattigen Winkeln eines verwilderten Gartens, die ich hin und wieder von Unkraut und Überschuß befreite, öfter jedoch nur befingerte, und die eintrockneten und verschrumpelten, unappetitlich wurden, eine Behausung für Ungeziefer, sich aus klebriger Berechnung mit Mehltau überzogen.
Ragnhild brachte die Augenprüfung hinter sich und stürzte sich auf die Ohren. Eine Klinik des Zentralkrankenhauses in Karlstadt gab Bescheid, daß sie dort eine Sommervertretung bekommen könne. Wir würden also auch in diesem Sommer in Hedås wohnen können, und ich begann in Gedanken, Aktenordner und Bücher und Papiere im Waschhaus auf die richtigen Plätze zu verteilen. Aus der kühlen, trockenen Dunkelheit der Universitätsbibliothek Carolina wurden Titel bestellt, die im Literaturverzeichnis am Ende eines anderen Buches ein wenig vage verheißungsvoll geblinzelt hatten. Ich las Bücher, die ich vor zehn Jahren gelesen hatte, noch einmal. Ich räumte angefangene und von selbst gestorbene Artikel vom Schreibtisch, stocherte nachts in einer Fahnenkorrektur herum, beschaffte diverse Literaturlisten und ein kompliziertes Anmeldungsformular für die Universitätskurse des Herbstes. Als ich Gershom Scholems Buch über Walter Benjamin suchte, geriet ich statt dessen an ein Buch desselben Scholem über »Sabbatai Sevi. The Mystical Messiah 1626-1676« und füllte ganze Seiten mit Notizen über die Stadt Z’fat, über Isaak den Löwen und »the breaking of the vessels«. Es deutete auf irgendwas, das ich schreiben sollte, doch es deutete nicht genau genug. Der Frost war noch nicht aus dem Gehirn gewichen.
Nachts versuchte ich mich an Cohen:
Die Glocken, die dein Reich geschmückt,
liebte so mancher Mann.
Und jeder, der dich je begehrt,
fand, was er immer mehr begehren muß.
Die Schönheit dir verloren ging,
so verloren wie für sie.
Lös meiner sehnend Zunge Band
nimm alles eitle Tun aus meiner Hand
zeig deinen Körper mir in Brand
als wäre ich der, den du liebst.
Dein Körper wie ein Flutlicht
auf meiner Ärmlichkeit.
Gern würd ich deine Güte erproben
bis du weinst – probier jetzt meine Gier.
Und alles hängt nun davon ab
wie nah du bei mir schläfst.
Lös meiner sehnend Zunge Band
nimm alles eitle Tun aus meiner Hand
zeig deinen Körper mir in Brand
als wäre ich der, den du liebst.
Hungrig wie ein Torweg
den der Troß durchzog,
steh ich verwittert hinter dir
mit deinem Wintermantel, dem kaputten Riemenschuh.
Ich liebe es, dich nackt zu sehn,
von hinten allermeist.
Lös meiner sehnend Zunge Band
nimm alles eitle Tun aus meiner Hand
zeig deinen Körper mir in Brand
als wäre ich der, den du liebst.
Du bleibst dem bessern Manne treu,
ich fürchte, er ist fort.
So hör mein Urteil über deine Liebschaft hier
in diesem Zimmer an, wo meine Liebe starb.
Nie trag ich diesen welken Lorbeerkranz,
der ihm vom Kopfe glitt.
Ach, lös nur meiner sehnend Zunge Band
nimm alles eitle Tun aus meiner Hand
zeig deinen Körper mir in Brand
als wäre ich der, den du liebst.
Ich habe stets Schwierigkeiten gehabt, etwas, das ein Gespräch auch nur simulierte, mit anderen Leuten als erprobten Freunden aufrechtzuerhalten. Jetzt wurde es vollends beschissen. Eine vernünftige Antwort für jemanden zu finden, der beispielsweise fragte, wie es mir denn zur Zeit so gehe, war, wie in einem dunklen Zimmer nach dem Lichtschalter zu tasten. Ich verwickelte mich in Erklärungen, dementierte mich selbst, je länger ich redete, konstruierte Sätze ohne Kopf und Schwanz, weil die Grammatik selbst plötzlich blind zu enden schien. Und meist zog ich mich so schnell es nur ging wieder in die Stummheit zurück, als wäre ich in einen Sumpf getreten.
Der Reihe nach schienen die zuverlässigen, unbewußten Steuerfunktionen, die erlernten und längst unsichtbar gemachten Navigationssysteme, die Instinkte, die Hilfsmotoren, ihren Platz im Gehirn zu verlieren. Die Erinnerungen wurden ungenau. Die Gedanken lösten sich auf wie in Säure. Es konnte sich anfühlen wie eine schleichende Verblödung. Und je weniger gelenkte Dynamik in der inneren Rede, derjenigen, die dem Reden vorangeht, um so stereotyper und schlafwandlerischer das äußere Verhalten.
Es konnte passieren, daß ich für mich selber einfache Behauptungen formulierte, die sich mir plötzlich als verblüffende Entdeckungen darstellten. Als erinnerte ich mich selber an elementare Sachverhalte, die in einer Art Black-out weggefallen waren und nun mit einem Ruck wieder auf den Füßen standen. Es waren keine bemerkenswerten Sentenzen. Sie waren von der Art, wie man sie aus jedem beliebigen TV-Manuskript herausgekürzt hätte. Doch sie bekamen plötzlich eine illuminierende Kraft.
Sie frappierten mich ungefähr so wie etwas, das man liest, und es sich sofort vor einem ganz bestimmten Menschen zitieren hört.
Der Mensch, dem ich im Geiste bei passender Gelegenheit diese Banalitäten zitierte, war ich selbst.
Doch zehn Minuten darauf hatte ich sie meist wieder vergessen, das Gedächtnis schnappte zu, eine Tür hatte sich lautlos geschlossen, und in meiner Sprache leuchtete unscharf ein neuer leerer Fleck.
Eine dieser Sentenzen war immerhin von so außerordentlicher Belanglosigkeit, daß ich sie wie ein Anti-Maskottchen aufbewahrte. Sie lautete: Das wichtigste ist nicht das, was zu Papier kommt.
Diese Behauptung, diese kitschige Behauptung war ehrlich gesagt ein bißchen erschütternd.
Als ich hörte, wie einfältig das klang, hörte ich auch, auf wieviel Dummheit, wieviel Eitelkeit, wieviel jämmerliche Selbstumnachtung in meinem Dasein es hindeutete. In seiner ganzen Blödheit deutete es doch, deutete blöd und besserwisserisch auf eine Täuschung hin, der mein Leben, wie ich mir eingestehen mußte, zu fast hundert Prozent anheimgefallen war.
Was besagte dieser lächerliche Satz?
Er besagte, daß Arild Andersson sich im Frühjahr 1980 darauf besinnen mußte, daß sein Leben sich nicht in dem Maß verwirklichte, wie es Worte auf Papier absonderte. Er besagte, daß für Arild Andersson eigentlich alles, was er tat und erlebte und dachte, auf unklare Weise, jedoch mit ganz deutlichen praktischen Konsequenzen, als Vorarbeit für geschriebene Worte galt. Er besagte, herzlos, aber vermutlich wahr, daß Arild Andersson sich noch nie so recht mit dem Gedanken befaßt hatte, er selbst sei es, der ein Anrecht auf sein Leben habe, und nicht seine Schreibmaschine.
Er bedeutete so vieles mehr, Dinge, die nicht vor der Schreibmaschine haltmachten.
Ich hatte mich vom öffentlichen Wort an die Kandare nehmen lassen. Alles, was ich in meiner Sprache in Äußerungen verwandelte, waren Entwürfe für schriftliche Mitteilungen. Ich hatte keine privaten Papiere, was ich schrieb, war nicht meine eigene Angelegenheit, die ich dann nach Belieben anderen in die Hand geben konnte, denn auf meiner Schulter saß immer ein Teufelchen und notierte, was ich gerade trieb. Ich stand unter der Bewachung meines eigenen Schreibens. Jedes Wort war als gelesen gedacht, schon bevor es zu Papier gebracht worden war. Jede Idee wurde sofort von einer Vorstellung des gelesenen Worts verschlungen. Alles ging über den Tisch eines Lektors, der sich tief in den Schichten meiner Phantasie eingenistet hatte, wo mir selbst der Einblick fehlte.
Ich hatte mich in einen Belagerungszustand versetzt. Ich war der Leibeigene meiner künftigen schriftstellerischen Erzeugnisse. Man könnte es auf viele andere Arten sagen, beispielsweise so: ich war nicht im Besitz meiner Produktionsmittel.
Und da gerieten meine Schwierigkeiten, in diesem Frühjahr irgend etwas zu schreiben, ins gleiche Licht wie meine Schwierigkeit zu reden, überhaupt irgend etwas mit meiner Person auszudrücken. Ich hatte das Reden dem Fetisch des Geschriebenen geopfert. Eine Weile war es noch möglich, an den Erinnerungen meiner eigenen Rede, den Resonanzen der Rede der anderen, weiterzuschreiben. Doch wenn die Rede zum Schweigen gebracht, wenn sie der Bewachung eines Fetischs unterstellt worden ist, der im voraus einen Besitzanspruch auf alles erhebt, was gesagt werden könnte, dann verdorrt die Sprache an ihrem Skelett, zerreißt und hängt an ihrer Form fest. Und der Tag ist mit der Hypothek unbeschriebener Blätter belastet.
Doch das wichtige war nicht das, was zu Papier kam.