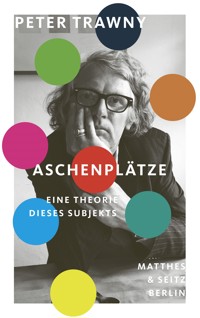
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist unausweichlich mit einem urphilosphischen Auftrag verbunden – mit dem zur Selbsterkenntnis, der auf die Frage abhebt: Wer bin ich? Ihr stellten sich von Augustinus bis Nietzsche seit je die Philosophen, stets im Wissen, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, eine Antwort darauf zu finden: indem das eigene Leben autobiografisch nachgezeichnet wird, und zwar jenseits aller Illusion und Lüge. Denn zu erfahren, wer man ist, geht über eine bloße Reflexion hinaus. Allein in der Schrift vermag das Ich sich eine Sprache zu geben, »die der Grammatik der Seele gehorcht« und in der alle Widersprüche, Wegmarken, Widerfahrnisse zutage liegen: der vom Stahlabstich rot gefärbte Himmel im gesichtslosen Ruhrpott, die ersten sexuellen Erfahrungen, die langsame Entfremdung von Familie und Klasse, die Beschäftigung mit Heidegger und der Kampf um universitäre Anerkennung. Von den Aschenplätzen seiner Biografie ausgehend, zeichnet Peter Trawny ein Selbstporträt, das die Bruchstellen ausstellt. An ihnen finden Handeln und Denken kaum noch zueinander – dort aber entzündet sich das Licht eines neuen Daseins. Wie einem Roman folgen wir gebannt dem menschlichen und intellektuellen Schicksal eines Menschen, der in dieser Zeit mit seinem Leben exemplarisch und doch einzigartig ist. Ein radikales Buch für alle, die wissen wollen, wie ein philosophisches Leben in unserer Zeit aussieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Trawny
Aschenplätze.
Eine Theorie dieses Subjekts
Peter Trawny
Aschenplätze
Eine Theorie dieses Subjekts
ἔρως τὸ ἄπειρον καὶ πέρας ἐστιν.
»Liebe ist Unbegrenztheit und Grenze.«
Heraklit, um 480 v. Chr.
ἄναγε ἐπὶ σαυτὸν καὶ ἴδε.
»Führe dich auf dich selbst zurück und sieh hin.«
Plotin, um 265 n. Chr.
»Alle Asche ist Blüthenstaub – der Kelch ist der Himmel.«
Novalis, Blüthenstaub, 1797
»Holde Landschaft! wo die Straße
Mitten durch sehr eben geht,
Wo der Mond aufsteigt, der blasse,
Wenn der Abendwind entsteht,
Wo die Natur sehr einfältig,
Wo die Berg’ erhaben stehn,
Geh’ ich heim zulezt, haushältig,
Dort nach goldnem Wein zu sehn.«
Friedrich Hölderlin, Das fröhliche Leben, 1811
»So mancher steigt herum,
Der Hochmut bringt ihn um,
Trägt einen schönen Rock,
Ist dumm als wie ein Stock.
Von Stolz ganz aufgebläht,
O Freunderl, das ist öd!
Wie lang steht’s denn noch an,
Bist auch ein Aschenmann!
Ein Aschen! Ein Aschen!«
Ferdinand Raimund, Aschenlied, 1826
»Alles Tun des Geistes ist deshalb nur ein Erfassen seiner selbst, und der Zweck aller wahrhaften Wissenschaft ist nur der, daß der Geist in allem, was im Himmel und auf Erden ist, sich selbst erkenne.«
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischenWissenschaften, 1830
»Das ›Subjekt‹ ist nur eine Fiktion; es giebt das Ego gar nicht, von dem geredet wird, wenn man den Egoismus tadelt.«
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Herbst 1887
»In diesem Punkt liegt irgend etwas so Einfaches, so unendlich Einfaches, daß es dem Philosophen niemals gelungen ist, es auszudrücken. Und darum hat er sein ganzes Leben lang darüber gesprochen.«
Henri Bergson, Die philosophische Intuition, 1911
»Ihr tratet zu dem herde
Wo alle glut verstarb
Licht war nur an der erde
Vom monde leichenfarb
Ihr tauchtet in die aschen
Die bleichen finger ein
Mit suchen tasten haschen –
Wird es noch einmal schein!
Seht was mit trostgeberde
Der Mond euch rät:
Tretet weg vom herde
Es ist worden spät.«
Stefan George, Das Jahr der Seele, 1897
»Die Selbstbiographie gehört ihrem Wesen nach zu den Neubildungen höherer Kulturstufen und ruht doch auf dem natürlichsten Grunde, auf dem Bedürfnis nach Aussprache und dem entgegenkommenden Interesse der anderen Menschen, womit das Bedürfnis nach Selbstbehauptung der Menschen zusammengeht; sie ist selber eine Lebensäußerung, die an keine bestimmte Form gebunden ist.«
Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, 1907
»Sie lasen Gedichte und ich mag das nicht.«
Else Lasker-Schüler an Martin Buber, 1914
»Jammer, Jammer und gleichzeitig nichts anderes als das eigene Wesen, und wäre der Jammer endlich aufgeknotet (solche Arbeit können vielleicht nur Frauen leisten), zerfielen ich und Du.«
Franz Kafka an Max Brod, 14. September 1917
»Der blühende Baum des Lebens streckt der beseelenden Liebe immer nur die aufgegangenen Knospen entgegen.«
Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, 1921
»Er vermag unbewegt im Gebet zu stehn, daß keiner seinen Dienst bemerkt, verborgen aber brennt sein Geist, und er schreit in der Stille.«
Martin Buber, Baal Schem Tow. Unterweisung im Umgang mit Gott, 1927
»(Die Weisheit ist wie kalte, graue Asche, die die Glut verdeckt.)«
Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, 1947
»But to what purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves
I do not know.
Other echoes
Inhabit the garden. Shall we follow?«
T.S. Eliot: Four Quartets, 1943
»Irrnis: Gegend dieses ›Unterwegs‹«
Martin Heidegger, Vermächtnis der Seinsfrage, 1975
»[…] die Erfahrung der Asche, die mit der Erfahrung der Gabe, des Nicht-Bewahrens, der Beziehung zum Anderen als Unterbrechung der Ökonomie verbunden ist, diese Erfahrung der Asche bedeutet auch die Möglichkeit einer Beziehung zum Anderen, der Gabe, der Affirmation, des Segens, des Gebets […]«
Jacques Derrida, »Es gibt nicht den Narzißmus« (Autobiophotographien), 1986
»Der fundamentale philosophische Akt ist nichts, ist Nacktheit, ist wie die Nacktheit des Körpers: Er ist letzte Reduktion, einzige Spur dessen, was ich bin.«
Georges-Arthur Goldschmidt, Der bestrafte Narziß, 1990
»That there
That's not me
I go
Where I please
I walk through walls
I float down the Liffey
I'm not here
This isn't happening
I'm not here
I'm not here
In a little while
I’ll be gone
The moment's already passed
Yeah it's gone
And I'm not here
This isn't happening
I'm not here
I'm not here.«
Radiohead, How to Disappear Completely, 2000
»And the so-called real world will not discourage you from operating on your default settings, because the so-called real world of men and money and power hums merrily along in a pool of fear and anger and frustration and craving and worship of self.«
David Foster Wallace, This Is Water, 2005
»There was no place to find you
Nor you to be found.«
David Sylvian, The Last Days of December, 2011
»I got a bad taste in my mouth out here, aluminum, ash.
Like you can smell the psychosphere.«
Rust Cohle, True Detective, 2014
Inhalt
Erkenne dich selbst – Über Subjektivität und Autobiographie. Eine Einführung in dieses Buch
Luftangriffe
Zur Welt kommen. Der erste Riss
Die Endlichkeit der Geburt
Der Bauernhof. Mehlhaut
Die Matriarchin vorm Grundig-Radio
Der Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Privatheit
Bunkerseelen des Wirtschaftswunders
Recht und Autobiographie
Geschwisterlosigkeit
Theorie ist Selbsterkenntnis
Aschewitze
Subjektivation
Ruhrgebiet
Philosophie und Autobiographie
Familienfotos
Aschenplätze
Zur Erinnerung
Der Lehrer
Die Herkunft aus dem Milieu
Eins
Der Baum des Lebens
Zur Geschichte des Körpers I
Unter Tage
Noch einmal anfangen …
»No Future« und der Zeitgeist
Wir Epigonen
Erste Reisen
Die unbeschreibliche Schönheit der Zeitverschwendung
Schreiben über Sexualität
Zwei Freunde
Dienst am Bürger
Desubjektivierungen (Liebe, Wahn, Alkohol)
Der atemlose Skandal
Der Unphilosophische
Studium. Einmal Bochum–Freiburg und zurück
Das Subjekt der Institution
Wende-Deutschland
Subjekt und Politik
Dekonstruktion
Weimarer Zwischenspiel
Werde, der du bist
Der erste »Dr.« der Familie
Die Komödie von Kyoto
Die Identität des Subjekts
Heidegger herausgeben
Der Totentraum
Vaterschaft
Biographie und Biologie
Moskauer Eskapade
Malerei (Von meinem Narzissmus)
Der Verrat des Begehrens
Subjekt und Bekenntnis
Tiefer in die Welt
Universitäten. Der Abschied der Singularität
Zur Anerkennung des Subjekts
Die Trümmer von New York
Subjektivität und Krieg
Von Buenos Aires über Paris hinunter ins Wuppertal
Philosophie und Lebensform
Das »schöne Leben«
Rettung Shanghai
Das Subjekt des Ressentiments
Stockholmer Untiefen
Die Vergegenständlichung des Körpers
Ostern im Botschaftsviertel
Neuanfang in Düsseldorf-Oberbilk
Die Ethik der Autobiographie
Birkenauer Erkenntnis
Töte dich selbst – Über Subjektivität und Autobiographie
Subjekt und Religion
Geburt und Geschaue
Wenn das Subjekt schläft
In Todesgefahr (am stillen Ort)
Gewaltarten (Fragment)
Die »Schwarzen Hefte«. Ein Lehrstück über Philosophie und Weltanschauung
Vom Eigennamen
Feuer und Wasser
Philosophie und Einsamkeit
Eine Frankfurter Begegnung
Subjekt und Nihilismus. Eine Erzählung
Berliner Elegie I. Hydra
Zur Unmöglichkeit der Autobiographie
Jerusalem
Zwei aus einem
Berliner Elegie II. Der Arapaima
Subjekt und Seele
Ein Buch über die Liebe
Zur Geschichte des Körpers II. Über die Erektion
Rio de Janeiro. Zäsur
Autobiographie ist Autotopographie
Seinlassen
Gerechtigkeit
Die Pandemie
Er hatte keinen Zeugen
Ankunft in der Fremde
Wer ist ein Philosoph?
Das Selbst ist ein Nichts
Lebe im Verborgenen. Stillere Tage in Düsseldorf-Bilk
Philosophie und Realität
Musik
Vom Schweigen zum Verstummen
Schechinima
Die sanfte und wilde Trauer des Lebens
Sommer
Anmerkungen
Erkenne dich selbst – Über Subjektivität und Autobiographie. Eine Einführung in dieses Buch
»Ich bin zum Beispiel durchaus kein Popanz.«
Friedrich Nietzsche, Ecce homo
Ich fange am Anfang an, am Anfang der Philosophie. Die Geschichte geht weit zurück, weit und hoch hinaus, und landet beim Nabel der Welt, dem Orakel von Delphi. Dort stand am Tempel des Apollon der Imperativ Γνῶθι σεαυτόν1: »Erkenne dich selbst!« Es war der Gott, der den Imperativ ausgesprochen hatte. Er meinte nicht sich, den Unsterblichen, sondern den Menschen, dieses Eintagswesen, dessen Leben wie im Flug vergeht. Die Besucher waren gewarnt. Der Gott befahl: Mensch, erkenne dich selbst, finde heraus, was du bist, und meine nicht, du seist wie ich, der Gott des Lichtes! Wie ich, der Immerlebende, der Vernichter, der Eine, der alles weiß!
Der Anfang hatte Folgen. Tief in der Neuzeit, im Jahr 1735, erscheint das Systema Naturæ von Carl von Linné, genannt Linnæus, in Uppsala. Es spannt zum ersten Mal das Mineralien-, Pflanzen- und Tierreich in einem geordneten Zusammenhang auf. Der an den Schöpfer glaubende Wissenschaftler zeichnet die Gattung Homo mit den Worten »nosce te ipsum« aus.2 Der Mensch ist im Unterschied zu allen anderen Lebewesen fähig zur Selbsterkenntnis. Sie ist sein Privileg, setzt ihn an die Spitze der Schöpfung.
Noch später, schon sehr weit entfernt vom Anfang und doch ein Versuch, an ihn anzuknüpfen, schreibt Friedrich Nietzsche, dass das »Erkenne dich selbst« die »ganze Wissenschaft«3 sei. »Erst am Ende der Erkenntniss aller Dinge« werde der Mensch »sich selber erkannt haben«. Denn die Dinge seien »nur die Gränzen des Menschen«. Ein Aphorismus, der lange nachdenken lässt. Nietzsche meint wohl, dass ohne die letzte Erkenntnis, die Selbsterkenntnis, die Erforschung der Dinge sinnlos ist. Zugleich aber ist schon ihre Erforschung nichts anderes als Selbsterkenntnis. Ob ein Ende des Forschens jemals erreicht sein wird? Niemals, Selbsterkenntnis ist ein unendlicher Versuch, ihre Vollendung unmöglich; es gibt kein unbedingtes Leben, stets bleibt noch ein Ding, das erkannt oder vielmehr gelebt werden muss.
*
Wir leben und sterben nicht nur so dahin, wir denken ebenso darüber nach. Das ist der Anfang desjenigen Verhaltens, das wir als menschlich bezeichnen dürfen. Was auch immer der Mensch sein mag, wir setzen voraus, dass er das Vermögen hat, sich selbst zu betrachten, sein Denken und Handeln zu reflektieren. Wir gehen davon aus, dass Menschen sich zu etwas verhalten, indem sie sich zugleich zu sich selbst verhalten. Mehr noch: Wir erkennen, dass etwas nur darum für mich zu existieren vermag, weil oder indem ich für mich selbst existiere. Könnte ich mich nicht in meinem Leben zu mir selbst verhalten, gäbe es kein Verhältnis zu etwas anderem.4
Aus und in einem solchen Verhalten entsteht ein besonderes Wissen; Wissen, das bestimmt, was der Mensch ist. Dieses Wissen bewegt die Philosophie – spätestens seit Platon von einem »Selbst selbst« gesprochen hat.5 Als dieser Philosoph – der erste überhaupt – anfing, in seinen Gesprächen den dialogischen Charakter des mit sich selbst redenden Denkens zu entdecken, war das Staunen noch groß. Dass das Selbst sich mit sich selbst zu verständigen vermag, begeisterte ungemein … Wie wunderbar: eine Seele, die mit sich selbst spricht …6 Und noch wunderbarer: Nur ein Wesen, das sich zu sich selbst zu verhalten vermag, kann überhaupt sprechen. Dieses Staunen hat für Jahrhunderte angehalten. Es nahm geradezu religiöse Formen an.
Das gilt mindestens für einen Philosophen wie Meister Eckhart. Für ihn ist das »Seelenfünklein«7 ein Aufleuchten Gottes und des Selbstbewusstseins zugleich; jedenfalls lässt es sich so interpretieren. Dass der Mensch ein Inneres und Innerstes – eine Intimität – hat, in dem und in der er sich selbst ganz ohne Welt begegnen kann, wurde als göttlich empfunden. Und vollkommen zu Recht: Dass wir uns selbst denken können und dieses Uns-selbst-Denken noch einmal zu bedenken vermögen, ist unbegreifbar. Es geschieht in aller Stille, Zeit und Raum zittern leicht, ich atme, falle in meine Tiefe, einem Licht zu. Ein wahrer Abgrund, ohne Warum, ein Wunden-Wunder, das nicht aufhört, uns zu beeindrucken, zu schrecken. Und es ist ein Nichts … wird ein Nichts gewesen sein …
*
Die Philosophen fanden eine Differenz. Sie leisteten dem göttlichen Imperativ »Erkenne dich selbst« Folge und entdeckten zwei Ebenen, zwei Sphären. Das Selbstdenken vollzieht sich in einer Struktur, die überhistorisch und universal für den Menschen schlechthin gültig ist. Das Selbst kann sich prinzipiell selbst denken, selbst verstehen. Es hat an sich das Vermögen der Reflexion. Will sagen: Jeder Mensch, überall und immer, reflektiert, er kommt denkend auf sein Denken und Handeln zurück. Ohne diese Bewegung im Denken gibt es den Menschen nicht.
Im Selbst tritt noch eine andere Sphäre hinzu. Jeder Mensch ist anders. Er hat ein anderes Leben, er macht andere Erfahrungen, denkt an und erstrebt andere Dinge. Er hat einen anderen Körper, wählt einen anderen Beruf, ist anders glücklich und anders unglücklich. Diese empirische oder psychologische Sphäre des Selbst wird von der universalen Sphäre der Reflexion unterschieden. Ist das »Erkenne dich selbst« eine Forderung, die den Menschen allgemein in alle Ewigkeit begleiten wird, so fällt ihre Umsetzung in die Vergänglichkeit des einzelnen Lebens.
Es war Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der diese beiden Sphären miteinander verband. Das Subjekt verknüpft in seiner Subjektivität sowohl die zeitlose Sphäre der Reflexion als auch die zeitliche Sphäre des endlichen Lebens. Man kann sogar erklären, dass das notwendig so sein muss. Denn zuletzt kann der einzelne Mensch nur in der Verbindung beider Sphären den Imperativ des »Erkenne dich selbst« erfüllen. Der Mensch findet in seinem Leben selbst realisiert, was er ist, seine – die – Wirklichkeit ist er selbst.
Das sagt Hegel an einer Stelle vom Beginn der Phänomenologie des Geistes auf seine unnachahmliche Art und Weise so: Das Subjekt stößt in der Welt auf einen »Gegenstand«, den es verstehen muss. Es stellt fest, dass es sich diesen Gegenstand noch nicht aneignen kann. Daher erscheint er als »das Negative«. Aber indem ich, dieses Subjekt, ihn als das erkenne, hat er sich wie ich mich selber schon verändert. Beide, der Gegenstand und ich, sind »in sich zurückgegangen«. Und dann schließt der Gedanke: »Er [der Gegenstand] ist durch diese Reflexion-in-sich Leben geworden.«8 Das, was gerade stattgefunden hat, dieses Hin und Her zwischen mir und dem Gegenstand, diese wechselseitige Versenkung in mich selbst, im Denken, ist nichts anderes als – der eigentliche Gegenstand: Leben.
*
Der Mensch ist Subjekt. Das ist er nun schon seit ein paar Jahrhunderten. Nicht, dass er schon immer so bezeichnet wurde. Platon kannte das Wort nicht, auch Aristoteles verwendete es – auf Griechisch natürlich – anders. Damals, in der Nähe des Anfangs, lag das Subjekt noch weit in der Zukunft. Vor dem Subjekt-Mensch lagen mindestens tausend Jahre des Gottes-Menschen. Für die Dichter der griechischen Tragödie war der Mensch einfach »der Sterbliche«. Es dauerte also, bis er das Subjekt wurde. Subjekt ist auf Deutsch das Daruntergeworfene, das Zugrundeliegende. Das Zugrundeliegende wofür? Für schlechthin alles.
Der Begriff erscheint irgendwann im Spätmittelalter, gewiss bei Wilhelm von Ockham. Manche meinen aber, dass die Neuzeit mit ihm beginnt, René Descartes, der den Begriff selten verwendet, ihn aber in der Sache ausgearbeitet hat. Viele, die sich auf Descartes bezogen, haben dann vom Subjekt gesprochen. Im Erkennen sagt der Mensch: Ich stelle (mir etwas) vor, also bin ich. Da zeigt sich, dass ein Subjekt ein Objekt braucht, und wenn dieses Objekt auch nur das Subjekt selbst sein sollte.
Etwas ist nur dann gegeben, wenn wir es denken. So gedacht, ist das Subjekt das absolut unerschütterliche Fundament, auf dem sich das ganze Gebäude der Erkenntnis errichtet. Oder sollte daran etwas verdächtig sein? Alles, was existiert, muss doch für mich existieren. Und selbst noch das, was nicht für mich existiert, muss für mich existieren … Inzwischen hat sich aber noch eine andere Bedeutung ergeben, die von jenen Denkern an der Schwelle zur Neuzeit nicht gedacht worden ist. Das Subjekt ist im französischen Sinne auch sujet, Untertan.
An dieser Stelle dreht sich der ursprüngliche Sinn des Wortes scheinbar um: Das Subjekt ist nicht das Fundament des Ganzen, sondern sein Träger in der Hinsicht, dass es das Ganze auch ertragen und aushalten muss. Es existiert nicht nur als die Macht über sich selbst und das Ganze, sondern auch als die Ohnmacht, die an sich geschehen lassen muss, was Staat und Gesellschaft über es entscheiden. Das Subjekt ist sujet dann ebenso, indem es sich verrechtlicht, sich dem Recht unterwirft. Ohne Recht kein Subjekt.
Es ist also dem Subjekt vom Begriff her schon anzusehen, dass es sich um Macht und Ohnmacht, um Recht und Unrecht dreht. Entweder ist es der Herrscher über alles, indem es das begründet, oder es ist das Beherrschte, das tragen und ertragen muss. Zumeist ist es beides, Herrscher über einen Bereich seines Lebens und zugleich Beherrschtes; das gilt noch für die großen Herrscher, auch sie sind nicht ganz befreit von der Ohnmacht, der Machtlosigkeit, sei es gegenüber dem Widerstand oder dem Tod. Diese Macht und diese Ohnmacht sind nicht eigentlich politisch, weil sie dem Subjekt schon vor seiner Politisierung und Verrechtlichung innewohnen. Vielmehr geht es um metapolitische Einschlüsse, von denen sich das Subjekt so lange nicht wird befreien können, als es sich als Subjekt begreift. Die Täter-Opfer-Unterscheidung ist nur eine verdünnte Konsequenz davon. Befreiung wäre immer auch Befreiung des Menschen vom »Subjekt«.9
*
Mit Hegel ist ein Gedanke aufgetaucht, der weit über ihn selbst hinaus und gegen seine eigene Intention gewirkt hat.10 Das »Erkenne dich selbst« hat den Menschen zunächst dazu aufgefordert, zu erkennen, was er ist. Indem aber Hegel das einzelne Leben so stark betonte, indem er zeigte, dass das zeitlose Wesen des Menschen im endlichen Leben der Einzelnen sich verwirklichen muss, wurde es möglich, das »Erkenne dich selbst« noch anders zu verstehen. Ich frage nicht nur oder womöglich gerade nicht, was ich bin, sondern wer.
Hegel wollte darauf hinaus, dass sich das einzelne Denken zu einem »absoluten Wissen« vor- und hocharbeiten könne. Der Mensch sollte erkennen können, dass das Selbstbewusstsein letztlich kein endliches, sondern ein unendliches sei. Hegel meinte, im Denken des Subjekts die Sphäre der Endlichkeit aus sich selbst heraus verewigen und die Sphäre des Ewigen verendlichen zu können. Das sei lediglich eine Frage der »Arbeit des Begriffs«,11 die das Subjekt zu übernehmen habe. Die Objekte konnten sich dem nur fügen. Die Welt wurde für jeden durch und durch menschlich. Ein Traum …
Den haben Schelling, Stirner, Kierkegaard und viele andere nach Hegel nicht mitgemacht. Kierkegaard, der in seiner Schrift Die Krankheit zum Tode eine eigene, sehr steile Auffassung des Selbstbewusstseins präsentiert, nach der das Selbst »das Verhältnis« sei, das »sich zu sich selbst verhält«,12 hat das Leben, wie Hegel es bereits berücksichtigte, aus dem systematischen Großanspruch des Meisters herausgerückt und das einsame, verzweifelte, freie Leben vor Gott thematisiert. Nun erlangte die Frage, wer ich bin, ein Übergewicht über die frühere Frage, was ich bin. Was soll es, dass ich ein Mensch bin wie Du, wenn ich ganz anders bin als Du?
Es war Heidegger, der mit dem Begriff der »Jemeinigkeit«13 daran anknüpfte. Das Leben ist je meines, bedeutet, dass das Leben des Anderen ein anderes ist als meines. Menschliches Leben ist individuell, einzigartig. Wir seien zwar alle Menschen, »aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird«,14 schreibt Hannah Arendt im Anschluss an ihren ersten Lehrer. Jeder hat sein eigenes Leben, und die Frage »Wer bin ich?« wird von jedem anders beantwortet.
*
Ich habe mit dem Anfang angefangen und mich bereits weit von ihm entfernt. Dabei habe ich etwas vergessen, etwas Wesentliches. Ich bin von einem Subjekt und einer Subjektivität des Menschen ausgegangen, als wäre der eine Art von Gespenst. Es ist jedoch unausweichlich, ebenso vom »leibhaftigen Menschen«, vom »wirklich thätigen Menschen« in seinem »wirklichen Lebensprozeß«15 auszugehen. Das hatte Marx gegen Hegel eingewendet: »Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.«16
Das Subjekt hat einen Leib, besser gesagt, einen Körper. Dieser Körper hat Bedürfnisse verschiedenster Art. Darum muss das Subjekt arbeiten, auch das auf verschiedene Art und Weise. Gewiss regeln sich die Bedürfnisse des Körpers nicht immer mit seiner Arbeit. Doch im Großen und Ganzen gibt es einen Zusammenhang: Wir bedürfen, begehren, verleiben ein, verdauen, und das setzt einen Körper voraus, indem es ihn produziert, formt. Und was ist »das«? Das eigentümliche Verhältnis, dass sich das Subjekt zwischen dem Übersinnlichen und Sinnlichen, zwischen seinem Selbstverhältnis und der Natur befindet. Wir leben in der Natur und zugleich auch nicht. Das Problem geht weit über Marx’ Perspektive hinaus.
Der Körper des Subjekts spielt in seinem Selbstverhältnis eine nachgerade unerschöpfliche Rolle. Ich kann mich nicht selber denken, ohne mich selber zu fühlen. Ich befinde mich in einem dermaßen engen Verhältnis zu meinem Körper, dass ich von einem Verhältnis als solchem gar nicht mehr zu sprechen vermag. Mein Leben und sein »Erkenne dich selbst« ist ohne diesen Körper nicht zu erfassen. Er ist nicht nur das Objekt dieser Erfassung, sondern ebenso ihr Subjekt. Nicht umsonst sagen wir: Ich fühle mich gut oder schlecht! Ich affiziere mich eben selbst.
Die Ganzheit meines Lebens und ihre Erkenntnis durch die Frage, wer ich bin, muss daher immer wieder auf die Erfahrungen zurückkommen, die ich als mein Körper oder mein Körper als ich gemacht habe. Wer ich bin, kann nicht nur jenseits meines Körpers nicht geklärt, sondern noch nicht einmal gefragt werden. Oder ist mein Körper sogar meine Frage samt ihrem Frager schlechthin? Das kann nicht sein, denn so wie ich mein Körper bin, bin ich es auch nicht. Sonst wäre der Unterschied, der mir Nähe und Ferne zu meinem Körper freigibt, unmöglich. Der Zirkel zwischen mir als meinem Körper und meinem Körper als mir kann sich nicht schließen. Er bricht notwendig in sich zusammen.
Jene Jemeinigkeit, von der Heidegger spricht, bezieht sich nicht nur auf jemeinigen, sondern ebenso auf jedeinigen Körper; jedeinig, weil ohne Deinen Körper ich meinen nicht hätte. Jeder lebendige Körper ist ein berührter; der Körper, der nicht berührt wird, stirbt. Hätte das Subjekt keinen Körper, würde es sich nicht verkörpern, würde es vermutlich gar keinen Anderen und keine Andersheit geben. Als Individuum braucht das Subjekt einen Körper, mit dem und in dem es dem Anderen begegnet, ihn fühlt. Das meint: Der Körper bildet – Intimität.
Jemeinige und jedeinige Subjektivität zu thematisieren, bedeutet demnach, die Intimität zu berücksichtigen, aufzuspüren; Intimität, die den Körper umfasst. Denn Intimität, diese Innigkeit in sich selbst mit dem Anderen, ist ein anderer Name für das Selbstverhältnis, das Selbstbewusstsein, das sich durch den eigenen und den anderen Körper fühlt. Subjektivität ist immer Intimität. Sollte der Mensch das einzige Lebewesen sein, das sich selbst zu erkennen versucht, dann ist es das einzige Lebewesen, das intim zu sein vermag.
*
Bleibt zu fragen, wie sich der Imperativ des »Erkenne dich selbst« im buchstäblichen, und das heißt eigentlichen Sinne realisiert. Was tue ich, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, wer ich bin? An dieser Stelle beginnt das autobiographische Projekt. Autobiographie – die Selbst-Darstellung im Sinne eines schriftlichen Akts, eines Aufschreibens, das sich in einer spezifischen Handschrift und demnach Sprache äußert. Das Selbst ist Selbst-Schrift, Selbst-Sprache, Besonderung eines Allgemeinen, Individuierung einer Sphäre des Bedeutens, die ohne die Autobiographie nicht erscheinen würde.
Platon hatte alles Recht der Welt, das Denken als ein Gespräch der Seele mit sich selbst zu bezeichnen. Was ich mir selbst war, bin und sein werde, kann ich nur durch und mit Sprache sein. Mein Leben ruft nicht nur nach, sondern auch als Sprache. Menschliches Leben ist Sprach-Leben. Ich habe immer schon gesprochen und werde es weiterhin tun. Nun aber geht es darum, dass sich mein Leben als eine bestimmte Sprache manifestiert. Das Leben, das sich als eine ungeheure Erinnerung unentwegt archiviert, entfaltet sich jetzt als Autobiographie.
Es ist offensichtlich, dass das »Erkenne dich selbst« nach einem spezifischen Sprechen oder einer spezifischen Sprache ruft. Wenn ich wissen will, wer ich bin, muss ich insofern von mir zu sprechen beginnen, als ich bezeuge, wie ich der geworden bin, der jetzt auf diese Weise spricht. Doch auch hier gilt wieder, gilt über Platons Bestimmung der Philosophie hinaus: Das kann ich nicht ohne den Anderen. Er ist nicht nur immer schon Teil meines Lebens, er ist darüber hinaus derjenige, der mein Zeugnis bestätigt oder verwirft. Mit anderen Worten: Ich muss mir und Dir meine Geschichte erzählen. Und das stimmt von Anfang an.
Das Leben verlangt nach einer Erzählung, nach einem Roman vielleicht. Erst mit diesem Roman vermag Selbsterkenntnis stattzufinden, erst mit ihm vermag sie womöglich auch zu scheitern. Novalis schreibt: »Nichts ist romantischer, als was man gewöhnlich Welt und Schicksal nennt. Wir leben in einem kolossalen (im großen und kleinen) Roman.«17 Subjektivität ist romantisch. Sie erscheint jeweils als ein Roman. Kein Zufall, dass die fortgeschrittensten Subjektivitätstheorien am Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Frühromantik zusammenfallen. Hegel mag Novalis abgelehnt haben, eine genauere Lektüre zeigt Ähnlichkeiten, Verbindungen.
Da liegt es nahe, Hegels Meisterwerk Phänomenologie des Geistes als einen Roman der Subjektivität zu lesen. Er nannte seinen Text auch einmal eine »ausführliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins«.18 Hegel konnte auf Goethes Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre von 1795 zurückschauen. Was soll ein Selbst anderes tun in seinem Leben, als sich zu bilden, das heißt, zu entstehen? Novalis wiederum hatte ein gespaltenes Verhältnis zu dem Werk. Zunächst war er begeistert, später abgestoßen.
Die Phänomenologie des Geistes ist eine Art philosophischer Bildungsroman, der in einem großen Schiller-Finale endet: »Aus dem Kelche dieses Geisterreiches / schäumt ihm seine Unendlichkeit.«19 Das ist archaische Festlichkeit der Subjektivität, das Echo seiner langen und großen Geschichte. Doch wir können aus diesem Füllhorn nicht mehr trinken: Das Subjekt ist uns inzwischen mindestens ambivalent geworden. Oder ist es nicht sogar inzwischen verschwunden? – Je höher es gestiegen sein wird, desto tiefer wird es gefallen sein. Sein Verstehen ist immer auch Missverstehen. Das hat autobiographische Konsequenzen …
*
Das »Erkenne dich selbst« ruft nach einer Autobiographie. Nur wenn ich mir und Dir meine Geschichte erzähle, kann ich herausfinden, wer ich bin. Es ist das jemeinige und jedeinige Leben, das sich und Dich erzählt, um mich, dieses Subjekt, erscheinen zu lassen. Meine Geschichte aber ist nicht zu erzählen ohne die Geschichte schlechthin, ohne die Geschichte, wie sie mich und Dich betraf, betrifft und betroffen haben wird.
An diesem Punkt muss ich mir in Bezug auf die Philosophie einen Hinweis erlauben. Nicht nur habe ich als Subjekt eine Geschichte, die zu erzählen sein wird. Das Subjekt, die Subjektivität, diese Bestimmung des Menschen, hat selbst eine Geschichte. Und es ist unvermeidlich, dass sich jedes einzelne Subjekt, jedes einzelne Leben, das sich als selbstbewusstes versteht, in diese Geschichte des Subjekts und der Subjektivität einschreibt. Unmöglich, dieser Inskription zu entkommen.
Man muss vorsichtig sein, wenn man Begriffe wie den des »Subjekts« oder auch des »Objekts« verwendet. Begriffe haben eine Geschichte wie Menschen auch. Sie erscheinen und verschwinden wieder, sie herrschen und werden entmachtet. Vom Subjekt spricht man noch nicht besonders lange. Würde man die Geschichte der Menschheit als Ganze vor Augen haben, müsste man einräumen, dass es erst vor Kurzem aufgetaucht ist. Das Subjekt ist ein Neuling, und manche glauben, dass seine Geschichte schon wieder vorbei ist.
Diese Geschichte erreicht ihre Klimax, wenn die Subjektivität mit dem »Willen zur Macht« identifiziert wird.20 Vor ein paar hundert Jahren hatte Descartes das Subjekt noch als Meister und Besitzer der Natur bezeichnet.21 Seitdem hat es sich monströs aufgepumpt. Waren etwa die totalitären Weltanschauungen des 20. Jahrhunderts kein Ausdruck des modernen Subjekts? Verstehen wir uns nicht als die Beherrscher der Welt? Und wird nicht in dieser Beherrschung der Andere zu einem Konkurrenten, der ebenso beherrscht werden soll wie die Natur? Verpflichten wir uns nicht nachgerade, im universellen Kampf um den Platz an der Sonne den Anderen niederzudrücken und niederzuhalten?
Was ich meine: Als sich am 20. Januar 1942 am Wannsee zu Berlin zwei Hände voll Männer trafen, um die Vernichtung von »rund 11000000 Juden« zu besprechen, verloren sie nicht den Verstand, sondern parlierten im Gegenteil über die »Größe« dieses Plans, wahrscheinlich auch über das Wetter (bedeckt, um –7°): Damals ereignete sich eine Zäsur in der Geschichte der Subjektivität. In Berlin-Wannsee hat sich in einer einzigartigen techno-antisemitischen, in einer gigantischen Machtphantasie ein für alle Mal die Subjektivität gezeigt: Sie findet im Inneren den Willen, alles zu machen, und findet dort alles, um es zu wollen. In uns ist ein Wille, der uns die Macht gibt, die größten Massenmörder werden zu können. So erfuhren sich jene Männer als die Herren der Welt, als einzigartige Architekten des Bösen. Sie hatten ihre Lebensform gefunden, berauscht von sich selbst.22
Das Thema der Subjektivität und seine autobiographische Darstellung lässt sich von der Frage nach konkreten Lebensformen nicht trennen. Diese entfalten sich in Generationen. Bestimmte Männer trauten sich vor 1945, in Dimensionen zu rechnen und zu planen, die räumlich, zeitlich und moralisch keine Grenzen kannten. Das änderte sich. Nach 1945 verkleinerten Männer und Frauen in Kerneuropa ihre Lebensform auf den Erwerb eines NSU Prinz plus Urlaub am Gardasee, wenn es hoch kam. Der Wille zur Macht wurde auf den Bausparvertrag eines Eigenheims reduziert … Die Nachkriegs-Subjektivität stand und steht unter besonderen Voraussetzungen.
Das monumentale Macht-Subjekt wandelte sich in ein funktionales Konsum-Subjekt. Diese Verkleinerung ging mit einer umfassenden Abstoßung der Vergangenheit einher. Die Erinnerung an Techno-Massenmord und Weltkrieg störte die Gartenzwergphantasien. Sie wurde daher gelöscht, nicht ganz zwar, aber doch so, dass man bis heute selbstzufrieden existiert. Sicher, das Konsum-Subjekt kam unter Druck, als man erkannte, dass es der Welt, in der es sich ungebremst bewegt, schadet. Doch die Antwort darauf war lediglich eine Sublimierung des Konsums, keine Unterbrechung. Mittlerweile bröckelt auch dieses Subjekt.
Eine seiner aktuellen Verfassungen ließe sich als die viktimistische auslegen. Dieses Subjekt fühlt sich als Opfer – der Migration, des Rassismus, des sexuellen Missbrauchs, des Klassismus, des Ableismus, des Klimawandels, des Subjekts also. Die Erniedrigung wird zur Erhöhung. Was einst als Härte des Lebens schamhaft verborgen wurde, wird nun nachgerade »performt«. Sicher, es gibt marginalisierte Stimmen, und es soll keine Marginalisierung geben, murmelt man verschämt im Zentrum … Wenn nun diese Stimmen in die Mitte des Konsums streben, um sich als Sieger zu präsentieren, werden andere marginalisiert. Diese Gesellschaft, die das Zentrum feiert, kann es ohne Marginalisierung nicht geben – Verblendung, das nicht zu sehen. Das Subjekt scheint vom Willen zum Wohlstand zum Willen vom Opfer übergegangen zu sein. Aber der Schein trügt.
Die Geschichte der Subjektivität kennt die Selbstviktimisierung spätestens seit Nietzsche darauf hingewiesen hat, dass die Hässlichkeit Hass erzeugt.23 Wer sich als Opfer deklariert, wendet seine Ohnmacht zur Macht. Das Opfer wird so mächtig, dass die vermeintlichen Täter sich zu einer Schuld bekennen, die oft nicht die ihre ist. Wer verdient mehr Aufmerksamkeit als derjenige, der übersehen, missachtet und ausgebeutet wird? Können wir nicht endlich wiedergutmachen, was wir – doch gewiss – sehr schlecht gemacht haben? Wer an sich die Narben der Unterwerfung zu entdecken vermag, schreitet zuweilen mächtiger über die applaudierenden Mächtigen hinweg. Der Wille zum Opfer ist demnach nur eine weitere Form des Willens zur Macht. Es ist das Subjekt, das Opfer fordert und bringt, um Subjekt zu sein. Eine Gesellschaft übrigens, die ihre Opfer feiert, wird es lieben, weitere zu produzieren.
Meine Lebensgeschichte, meine Herkunft beginnt an der Bruchstelle, an welcher der deutsche Herrenmensch sich notwendig auf ein Nachkriegssubjekt verkleinert, das die Erfahrung der Bombardements in Bunkern zum Lebensstil erhebt. Das hat einen Typus des Bunkerbewohners geschaffen, der alles Anspruchsvolle von sich abgespalten hat. Ob die deutsche Gesellschaft sich aus dieser Verbunkerung befreit hat, ist noch heute schwer zu sagen; zumal der Zusammenbruch der DDR eine erneute Verunsicherung bedeutete, die mit einer weiteren Verbunkerung einherging. Nicht unmöglich, dass die Deutschen insgesamt immer noch in unsichtbaren Bunkern leben und denken. Die politische Gegenwart spricht dafür …
*
Die Selbstviktimisierung sogenannter marginalisierter Minderheiten (der technische Jargon spricht Bände), die es zwar auch in Westeuropa gibt, doch niemals als verelendete, sondern als subventionierte Lebensform, macht die Herkunft aus Traumata allgemein verdächtig. Dabei kann es keinen Zweifel geben, dass es eine solche gibt. Das Subjekt ist traumatisierbar oder sogar immer schon traumatisiert. Das ist inzwischen beinahe eine Banalität. Sie entstammt einer Psychisierung des Subjekts, die seit Freud zur Allgemeinbildung gehört, und damit auch zur allgemeinen Herausbildung des Subjekts selbst. So entsteht ein neues, ein anderes Verständnis von Subjektivität.
Während des Ersten Weltkriegs verfasste Freud den kleinen Aufsatz über »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse«. Es geht in ihm, grob gesagt, um einen »Narzißmus«, der immer ein Teil des Ich bleiben wird, selbst wenn es eine »hochentwickelte Objektlibido« gibt,24 bei einem »Ich«, das Freud mit einem »Protoplasmaklümpchen« vergleicht. Selbst wenn es mir gelingen sollte, zu lieben, bleibe ich doch unausweichlich ein Narzisst. Deshalb bin ich kränkbar und gekränkt selbst dort, wo mich niemand kränken will (überall werde ich übergangen …).
Freud geht es vor allem um meine Gekränktheit als Mensch: Ich bin kosmologisch, biologisch und psychoanalytisch gekränkt;25 die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums, ich bin kein Geschöpf Gottes und nicht Herr in meinem Haus, weil ausgesetzt einem unbewussten Triebleben, das hinter meinem Rücken agiert. In der Tat kann es dem Subjekt des 21. Jahrhunderts nicht einfallen, besonders groß und erhaben von sich zu denken. Wir sind nichts anderes als hoch entwickelte Tiere, die, zufällig auf einem unbedeutenden Planeten ausgesetzt, siebzig, wenn es länger dauert, achtzig Jahre ebenso zufälligen Lebenszielen hinterherjagen, die wir uns mit irgendwelchen Glücksvorstellungen schöntrinken.
Gewiss gilt für viele Philosophen nach wie vor die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt der Subjektivität, zwischen der reinen Reflexion und dem, was reflektiert wird oder wer reflektiert. Doch wenn es eine Einheit dieser beiden Sphären gibt, dann bringt die Psychisierung, die Übernahme der Neurosen und immer mehr der Psychosen in das Selbstverhältnis der Subjekte, eine andere Subjektivität hervor; eine Subjektivität, in der das »Erkenne dich selbst« seinen Erkenntnischarakter verliert, um zu einem unerschöpflichen Spiel der Interpretationen zu werden.
Das »Erkenne dich selbst« wird prekär. Es wird vom Verdacht der Sinnlosigkeit befallen. Wenn das Subjekt ein psychisches Schicksal hat, das die innere Organisation der Selbsterkenntnis desorientiert, entsteht ein Selbst, das sich alles Mögliche über sich selbst zu erzählen vermag. Das Subjekt wird von einem Wahn befallen, den es nicht mehr von der Wirklichkeit zu unterscheiden in der Lage ist. Diese Möglichkeit betrifft nicht nur bestimmte, sondern alle Subjekte.
Wäre es möglich, sich in diesem Wahn einzurichten, würden sich Lebensgeschichten bilden können, die einen, wenn auch wahnhaften, Sinn ergeben. Aber das Subjekt merkt, dass in der Beliebigkeit der Erzählungen etwas Schlimmeres als der Wahn droht, nämlich die Sinnlosigkeit oder der Nihilismus. Wenn ich mir alles Mögliche zuschreiben kann, dann schreibe ich mir im Grunde nichts zu. Die Folge ist entweder gähnende Langeweile oder panische Angst oder beides – Moment einer Geschichte des Suizids. Für manch einen Philosophen führt die Erfahrung des Nihilismus direkt in die Psychose.26
Das hat Auswirkungen auf das autobiographische Projekt. Der Zugang zu meiner eigenen Geschichte wird nachgerade wahnhaft. Die Behauptung, meine Wirklichkeit zu erzählen, zeichnet jeder Psychoanalytikerin ein unsichtbares Lächeln ins Gesicht. Wer mit solchen Augen Autobiographien liest, wird auf Erkenntnisse stoßen, zu denen das erzählende Subjekt niemals fähig sein wird und die ihm dennoch hinterrücks entgleiten und entgehen. Ich werde Dinge preisgegeben haben, von denen ich nichts weiß. Trotzdem bleibt das »Erkenne dich selbst« eine Hauptmotivation auch der Psychoanalyse.
Das erhellt noch das Reich der krudesten Selbstlüge. Ich werde mich verirrt haben in die seltsamsten Selbstauslegungen und bleibe doch an der Wahrheit interessiert. Sie bleibt der Kompass, auch wenn sie das von der Sinnlosigkeit versehrte Subjekt nicht mehr in sich selbst zu finden vermag. Vermutlich äußert sich die Wahrheit in dem Leiden, das man beim Erzählen seines eigenen Lebens unvermeidlich erfährt. Die Autobiographie ist keine Passionsgeschichte, weil sie etwa ein Leiden des jemeinigen und jedeinigen Körpers beschreibt, sondern weil das Schreiben selbst im buchstäblichen Sinne peinlich ist.
Die Peinigung der Autobiographie ergibt sich nicht (nur) aus den peinlichen Erzählungen, die etwa idiotische und unbedeutende Geschichten aneinanderreiht. Sie entspringt der Entscheidung zur Erzählung selbst. Es ist peinlich, dass ich mir mein Leben erzählen will, vielleicht muss. Das weite Reich des Narzissmus und seiner Verletzungen kristallisiert im Schreiben seine verstörende Form, und man sucht sich zu retten, indem man eine Sprache zu vernehmen meint, die der Grammatik der Seele gehorcht.
Doch warum dann überhaupt Peinlichkeiten aufschreiben und mitteilen? Weil sie ein Teil meines Lebens sind. Ich frage mich, ob das typisch ist oder nur mir zufällt. Doch selbst als Zufall erschiene eine prinzipielle Idiotie des Lebens, die ich allein mir anrechnen dürfte, schon deshalb, weil das Peinliche jemeinig ist. Da wäre zu überlegen, wie weit ich mit der Mitteilung von Peinlichkeiten gehen dürfte. Müsste ich nicht da und dort Dinge zurückhalten, die nicht nur mich kompromittieren? Alles kommt jedoch zuletzt – und das ist beunruhigend – auf die Frage an, ob ich von einer Wahrheit meines Lebens sprechen kann, ob sich mein Leben in einer Geschichte manifestiert, die nur so und nicht anders erzählt werden kann. Dann gehörten – zumindest in meinem Fall – die Peinlichkeiten nicht nur dazu, sie würden den Charakter dieses Lebens ausmachen.
*
Die neurotische Seite der Subjektivität nuanciert das »Erkenne dich selbst«. Sie berührt die Frage nach der Realität des autobiographisch Festgehaltenen. Ist die Autobiographie nicht vielmehr ein Medium der Fiktion? Stelle ich mir nicht nur vor, was ich für real gehalten habe? Oder überschreite ich geradezu bewusst die Grenze zwischen dem Realen und dem Fiktionalen, wenn ich mein Leben niederschreibe? Vermutlich betrifft dieser Unterschied die Subjektivität selbst in ihrem Innersten.
Nietzsche betont am Beginn von Ecce homo, dass er kein »Popanz« sei. Ein Popanz ist ein Schreckgespenst, also eine nicht ernstzunehmende, etwas kuriose Erscheinung. Ich frage mich, warum Nietzsche das überhaupt feststellt. Mag sein, dass er immerhin den Tod Gottes ausgerufen hat. Er hat sich als ein aus dem bürgerlichen Leben herausgefallener, schrecklicher Protestant erwiesen, der seinen Brüdern und Schwestern den Spiegel vorhielt. Und doch war er kein komisches Gespenst, sondern ein Mann aus Fleisch und Blut.
Das scheint nach einer starren Differenz zwischen dem Realen und dem Fiktionalen auszusehen. Die lässt sich in einer Autobiographie nicht aufrechterhalten. Im »Erkenne dich selbst« zählt letztlich zwar nur die Wahrheit. Doch das ist ein großer Anspruch, der tragische Nebentöne anklingen lässt. Ist Ödipus nicht der eigentliche Held der Selbsterkenntnis? Wurde er sehend, als er sich die Augen ausstach? Wie die Wahrheit des jemeinigen und jedeinigen Lebens aussieht, das erfahren wir womöglich nie. Ob sie dem ontologischen Register des Realen entspricht, können wir kaum wissen. Wir können sogar beinahe nicht wissen, ob das überhaupt nötig ist.
Denn in der Erzählung des Lebens zählt ein Realitätsbegriff, der sich nicht als Alternative, sondern als Kontinuum des Realen und Fiktionalen erweist. Es war Spinoza, der bemerkte: »Je mehr Realität oder Sein ein jedes Ding hat, umso mehr Attribute kommen ihm zu.«27 Demnach hat das Fiktionale selbst Realität, nur nicht so viel wie das Reale. Aschenputtel existiert wie ich, nur dass ich ihr nicht so viele Eigenschaften zusprechen kann wie mir. Die Wahrheit meines Lebens braucht für die Realität keine Bedeutung zu haben, sie bleibt auch dann wahr und gleichsam real, wenn sie nur in einer Erzählung existiert.
Das wird allerdings die Frage nach den Persönlichkeitsrechten, die in jeder Autobiographie berührt werden, nicht beantworten. Das Recht überhaupt setzt ein stabiles und einigermaßen klares Realitätsverständnis voraus. Ob etwas nur eine Erzählung ist oder wirklich geschah, ist im Recht gerade immer zu entscheiden. Danach muss sich eine Autobiographie auch dann richten, wenn das Leben selbst komplizierter ist. Ob die Menschen, die mir begegneten, dieselbe Realität mit mir teilen? Haben sie etwas anderes erfahren? Hier deutet sich ein Kampf um die Realität an, der nur allzu oft das Zentrum zwischenmenschlicher Kabale ausmacht. Dass wir dieselbe Realität teilen, scheint häufig nur ein Vorurteil zu sein.
*
Hannah Arendt, die geheime Königin der politischen Philosophie, hat die Frage »Wer bin ich?« in den politischen Kontext gerückt. Sie hat in Vita activa darauf hingewiesen, dass wir in unseren öffentlichen Beziehungen zum Anderen nicht die Frage stellen, was einer ist, sondern wer: »Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt […].«28 Arendt betont das öffentliche Leben des Einzelnen, der sich mit seinem Handeln und Sprechen in den Zopf der Geschichte verflicht. Es ist erst diese Lebens-Öffentlichkeit, die eine(n) zu einem Wer werden lässt.
Sie stellt zu Recht fest, dass die Philosophie zur Frage, wer einer sei, wenig sagen kann. Sie betont ein »Versagen der Sprache vor dem lebendigen Wesen der Person«.29 Das rührt daher, dass die Erkenntnisintention der Philosophie bis hin zu Hegel dem Orakel von Delphi verpflichtet blieb und das »Erkenne dich selbst« auf das, was der Mensch ist, bezog. Das Jemeinige und Jedeinige galt bis dahin nicht als Thema philosophischer Reflexionen. Man hantierte mit einem »Begriff«, der die Nuancen des Lebens nicht zu berühren vermochte, eine solche Berührung aber auch nicht suchte. Nicht die Philosophen, das dachte die Arendt von Anfang an, sondern die Dichter kannten die Sprache des Lebens.
Das Wer ist nach Arendt ein öffentliches und muss es sein, weil ich selbst nicht ausmachen kann, wer ich bin. Es sei »wahrscheinlicher, daß dies Wer, das für die Mitwelt so unmißverständlich und eindeutig sich zeigt, dem Zeigenden selbst gerade und immer verborgen bleibt, als sei es jener δαίμων der Griechen, der den Menschen zwar sein Leben lang begleitet, ihm aber immer nur von hinten über die Schulter blickt und daher nur denen sichtbar wird, denen der Betreffende begegnet, niemals ihm selbst«.30 Ohne Zweifel ein suggestives Bild – auch wenn der δαίμων, der günstige oder ungünstige Geist, der mich mein Leben lang leitet, ohne dass ich ihn persönlich kennen könnte, sich nicht nur in der Öffentlichkeit zeigt. Gewiss, Du sagst mir, wer ich bin – aber das vor allem in einer Nähe, die niemals öffentlich sein kann. Ja, vermutlich ist die Öffentlichkeit gerade nicht der Ort der nur mit Dir möglichen Selbsterkenntnis.
Arendt zeichnet vom öffentlichen Raum ein beinahe makelloses und ideales Bild. Das Öffentliche ist für sie ein ungegenständliches Zwischen, in dem Menschen sich sprechend begegnen. Was sie besprechen, hat öffentliche Bedeutung, geht in Geschichten, manchmal in die Geschichte ein. Was sich unterhalb dieser Amplitude begibt, fällt nicht weiter auf. Es braucht nicht beachtet zu werden. Es gehört ins Haus, zwischen jene vier Wände, in denen sich die unsäglichsten Farcen des Alltags abspielen. Die Handelnden müssen demnach prinzipiell interessant sein, sie müssen in jenem öffentlichen Zwischensein erscheinen, als wären sie prominent.
Arendt spricht in diesem Sinne sogar von »Größe«.31 Das entspricht dem Modell der Handlungs-Bühne griechischer Tragödien.32 Sicher haben die Handlungen der Elektra, des Ödipus und der Phädra einen Charakter, der uns heute noch dazu bringt, sie immer wieder aufzuführen. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass ein einigermaßen unauffälliges Selbst, wie ich es bin, wie wir es sind, keinen Anspruch darauf hat, bemerkt zu werden. Unser Handeln und Sprechen ist nicht »groß«, nicht »tragisch«. Es bleibt unbemerkt, gehört zum »Kleinmenschlichen«,33 wie Georg Misch in seiner monumentalen Geschichte der Autobiographie betont. Das bedeutet, dass es sich in Arendt’schen Begriffen nicht mehr fassen lässt.
Trotzdem hat sie recht. Das moderne Subjekt ist insofern ein öffentliches, als es in Institutionen und Medien existiert, existieren muss. Das Leben dieses Subjekts zerstreut sich in realen und virtuellen Räumen, in denen es sich zu profilieren und zu zeigen hat, wer es ist. Die Profilierung ist die Wirklichkeit des Wer in der Öffentlichkeit. Das Subjekt muss diese Zerstreuung übernehmen, es kann sich ihr nicht entziehen. Diese Zerstreuung, die nicht als Arbeit, nicht als Herstellen, nicht als Handeln und nicht als Unterhaltung, sondern als Selbstetablierung à tout prix in der Welt zu deuten ist, erzeugt eine Kluft im Subjekt, die sich in seiner Autobiographie niederschlägt. Das Leben spielt in zwei kaum verknüpfbaren Sphären, nämlich denen der Intimität und der Öffentlichkeit, in einem Innen und Außen, die sich in letzter Hinsicht, nämlich im Wissen um meinen Tod, absolut separieren.
*
Das Subjekt bin ich. Ich war es schon die ganze Zeit, bin es und werde es gewesen sein. In diesem Wort steht mein Leben auf dem Spiel. Jeder Diskurs über die Subjektivität, der einer des Subjekts ist, ist einer über mich. Als hätte der philosophische Begriff sich mit seiner eigensten Erinnerung, die meine ist, aufgeladen, als hätten Begriffe Gedächtnis. Die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauernde Geschichte der Subjektivität ist meine. Was sollte sie auch sonst gewesen sein? – Aber sie ist es vermutlich auf eine Weise, die den Begriff des Subjekts zuletzt einer traurigen Erosion zuführen wird.
Denn vorläufig, scheint mir, bist auch Du das Subjekt. Der Diskurs über die Subjektivität ist einer über Dich. Und Du, das wurde schon gesagt, bist wie ich und auch nicht wie ich. Letztlich bist Du nicht wie ich, weil unsere Identität in der Subjektivität lediglich die Möglichkeit dafür ist, dass wir uns unterscheiden. Doch welch eine Möglichkeit ist das … Du wirst mir vielleicht immer fremd geblieben sein.
Es ist wahrscheinlich, dass es noch mehr über Dich und mich zu sagen geben wird. Nämlich über die gesamte Geschichte meiner Autobiographie hin. Diese gibt es nur, weil und indem es Dich gibt. Die Theorie dieses Subjekts ist demnach auch eine des Verhältnisses zwischen Dir und mir. Und vielleicht wird sie an der Frage nach dem Ursprung dieses Verhältnisses zerschellen. Denn hat die Theorie der Subjektivität diese Frage auch nur gestellt?34 Der Ursprung des Verhältnisses von Dir und mir hat nichts mit Moral oder Ethik zu tun. Wenn es ihn gibt, dann liegt er jenseits dieser Disziplinen.
Wenn diese Autobiographie von Dir und mir handelt, dann auch von Deinem und meinem Körper. Das Verhältnis von Dir und mir ist in jeder Hinsicht ein körperliches; in jeder Hinsicht bedeutet: über das Erotische hinaus. So ich Körpern entstamme, so werde ich mit ihnen vergehen. Die Erzählung meiner Geschichte ist darum die eines Körpers unter Körpern. Das Du ist ein Körper, der meinen Körper berührt, ihn enteignet. Und doch gibt es auch ein Du jenseits des Körpers.
Das bedeutet zuletzt, dass das Jemeinige, das es ohne das Jedeinige nicht gibt, übergriffig werden muss. Denn natürlich gibt es hier keine Symmetrie zwischen Dir und mir. Du bist mir nicht gegeben wie ich mir selbst. Du bist mir überhaupt nicht gegeben. Dein Körper ist anders als meiner. Dein Leben ist nicht meines. Deine Liebe ist nicht meine. Meine Sprache ist anders als Deine. Und zuletzt werde ich erkannt haben, dass auch ich selbst mir nicht gegeben bin.
*
Selbsterkenntnis ist nicht nur eine besondere Erkenntnis, sondern auch ein besonderer Erkenntnistyp. Ich erkenne mich selbst nicht so, wie ich erkenne, dass die Klimakatastrophe real ist. Es gibt kein Objekt meiner Erkenntnis, das ich selbst sein könnte. Das Subjekt kann sich nicht selbst, im Sinne eines vergegenständlichten Selbstverhältnisses, zum Objekt machen, auch nicht, indem es »ich bin ein Subjekt« sagt. (Das hat Hegel nur zu dem Preis vordenken können, dass er alles Unvernünftige, das ich bin, zum Unwirklichen erklärte.) Doch wenn das Subjekt niemals Gegenstand seiner Erkenntnis werden kann, wie sonst die Erkenntnis auf Gegenstände bezogen ist – was erkennt es dann überhaupt?
Es erkennt, dass die Rede vom Subjekt (und der sogenannten Subjektivation) immer nur vorläufig ist. Denn in dem Augenblick, in dem ich mich der inkorporierten Geschichte meiner Autobiographie aussetze, sie auf diese spezifische Art und Weise betrachte, verlasse ich sie. Ich steige aus dem Leben und seiner Bewegung, die sich nicht mit der Bewegung des Denkens vereinen lässt, aus, um von einem gleichsam neutralen Ort auf dieses Leben zu blicken. Dieser neutrale Ort scheint ein Versprechen der Philosophie, der Theorie, zu sein. Bereits Heraklit aber hat bemerkt, dass wir niemals zweimal in denselben Fluss steigen können. Und die Flüsse sind die Orte – nur scheinbar fest gefügt. So bekomme ich einzig und allein aus dem Zusammenhang gerissene Bruchstücke meines Lebens zu fassen, niemals den Fluss dieses Lebens, das Leben selbst.
Das Denken findet stets neben dem Leben statt, nicht in ihm. Ist das der Fluch der Reflexion? Fluch und Segen. Denn wären wir in den Fluss der Zeit eingesperrt, würden wir überhaupt nicht denken können. Wir wären die Getriebenen, die Insassen der Zeit, die »denken« müssten, was kommt und vergeht. Mit der Reflexion erscheint die Erinnerung, die Möglichkeit, aus dem Fluss der Zeit auszusteigen (während er natürlich fortfließt), in der Zeit zurückzudenken; Voraussetzung, eine Vergangenheit, eine Zukunft – Geschichte zu haben.
Die harten Brüche zwischen der Reflexion des Lebens und dem Leben selbst sind dann der unausweichliche Ausdruck von philosophischer Selbsterkenntnis. Wir denken mit philosophischen Mitteln über unser eigenes Leben nach, das wir uns vergegenwärtigen. Doch wenn wir übers Leben denken, hält dieses inne. Wenn wir leben, bleibt das Denken fern. Beides zugleich scheint nicht möglich zu sein – welch ein Problem der Philosophie, das meint, das tatsächliche Leben durch ein philosophisches ersetzen zu können. Damit wird der Spalt zwischen Denken und Leben nicht aufgehoben, sondern verstärkt. Eine meiner wichtigsten Fragen ist die, ob dieser Ersatz oder sogar die Überwindung des alltäglichen Lebens durch das Philosophieren glaubwürdig ist.
*
Trotzdem bleibt ein Verhältnis zwischen der Biographie und der Philosophie zurück, das sich in solchen Aporien der Selbstbetrachtung nicht beruhigt. Mag sein, dass die Philosophie kein Leben ist, dass sie in keiner Biographie oder Autobiographie aufgeht. Mag sein, dass Philosophie immer eher eine Autoepistemologie sein kann als das lebendige Durchdenken eines gelebten Lebens, eher die Darstellung der Methode einer Autobiographie als ihre Inszenierung, eine formale Anzeige mehr als die materiale Existenz. Gewiss sperrt sich die Philosophie dagegen, sich autobiographischen Motiven auszusetzen, sich gleichsam bloßzustellen.
Es bleibt jedoch ein unruhiger, beunruhigender Rest, den die Philosophie nicht loswird. Das Interesse an der Theorie hängt stets mit der Geschichte eines bestimmten Lebens zusammen. Auch wenn die Motivation des Theoretisierens nicht aufs Interesse reduziert werden kann, sind Philosophen Menschen mit eigenen Geschichten, mit eigenen Schicksalen. Sie fließen vielleicht nicht unmittelbar ins Denken ein, können ihm jedoch nicht äußerlich bleiben. Selbst wenn das vom Anderen aus nicht zu sehen ist, das Subjekt selbst wird ahnen, warum es in der Philosophie wonach sucht (auch wenn dieses Warum kein Darum erzwungen haben wird), vorausgesetzt, der Ernst seiner Reflexion vermag seine Flucht vor ihm selbst aufzuhalten.
Dass dieser Lebens-Rest, der sich ins philosophische Denken einschmuggelt, nicht auf der Hand liegt und oft nur einer »Hermeneutik des Verdachts«35 zugänglich zu sein scheint, ist den Skeptikern zu schenken. Nichts, was mit Selbsterkenntnis zusammenhängt, kann theoretisch dingfest gemacht werden. Das wird noch durch den allgemeinen Charakter der philosophischen Sprache forciert, die eine des »Begriffs« ist. Wer diese Sprache verwendet, indem er zum Beispiel vom »Subjekt« und nicht einfach vom Menschen spricht, scheint sich einem spezifischen Diskurs zu verschreiben. Doch das ist nur Schein. Ein Mensch vermag nie gänzlich im Diskurs aufzugehen. Der Rest betrifft auch das einzelne Sprechen, das sich vom einzelnen Leben nicht zu trennen vermag (es sei denn, es formalisiert sich in mathematischen Zeichen).
Das Denken spricht stets eine Sprache, die sowohl eine individuelle als auch eine allgemeine Geschichte hat. Diese Geschichten durchdringen sich, bilden einen Charakter, der sich nicht in irgendeiner, sondern stets in einer spezifischen Philosophie darstellt. Dass wir in bestimmten Einsichten meinen, die Ewigkeit zu berühren, um in dieser Berührung die Theorie von aller Endlichkeit befreien zu können, ist demnach ein Phantasma. Von Gott aus gesehen sind wir sehr endliche, sehr fragile Lebewesen, selbst in der Philosophie. Wir sind es auch von uns aus gesehen. Doch wer hat diesen Blick über den Text hinaus?
Dann sind das Leben und das Denken nicht so getrennt, wie es den Anschein hat. Unter der Oberfläche des Seins bilden die Autobiographie und das Leben eine unsichtbare Verbindung aus, als gäbe es ein unterirdisches Wurzelsystem, das kaum denkbare Kanäle wachsen lässt. Eigentlich nehme ich alles persönlich … Und doch bleibt wahr, dass meine Selbsterkenntnis niemals mein Selbst erkennen wird. Vielmehr werde ich erfahren – und habe es schon erfahren –, dass ich in jeder Hinsicht ein endliches Wesen bin, das sich entgeht.
Ich verstehe diese Endlichkeitserfahrung als eine Absage an den Versuch, Herr über mein eigenes Leben zu werden, zu herrschen auch, indem man dieses Leben in eine überschaubare Erzählung verwandelt. Selbsterkenntnis kann es nur als scheiternde geben. Die Erzählung eines Lebens bekommt stets nur Splitter, Fetzen zu fassen. Mit Fingern also, die sich schneiden, die schmerzen. Und doch bedeutet das nicht, kann es nicht bedeuten, mit der Selbsterkenntnis und ihrer Erzählung aufzuhören.
Im Gegenteil – mir scheint immer mehr, dass es Leben ohne den Versuch der Selbsterkenntnis nicht gibt. Sicher kann man sich fragen, ob jeder dieser Versuche so ausfallen muss wie meiner. Aber das braucht im Grunde gar nicht gesagt zu werden. Wie Du Dich Deinem Leben aussetzt, in der Erinnerung, in der Vergegenwärtigung, das obliegt allein Deiner Entscheidung. Meine schreibt sich auf. Nur in ihrer Schriftlichkeit kann ich sehen, was bleibt und ihr entgeht.
Die Kluft zwischen dem Denken und dem Leben, die sowohl ihre Nähe als auch ihre Ferne ermöglicht, kommt in diesem Buch darin zum Ausdruck, dass sich philosophische Kapitel mit autobiographischen übergangslos und demnach hart abwechseln. Das kann den Leser stören, verwirren. Und doch ist es die getreue Darstellung dessen, was ein Philosoph erfährt oder – zumindest und besser – was ich erfahre. Aber – und das ist ein wichtiger Hinweis: So rau gefügt die Kapitel von einem zum andern überspringen, so wesentlich ist es für die Lektüre, sie in der angegebenen Reihenfolge zu lesen. Wer meint, gewisse Kapitel aus dem Kontext herausreißen zu wollen, wird sie missverstehen. Die Philosophie darf zwar nicht auf das Verstehen festgelegt werden – es gibt manches, das wir verstehen, ohne es zu verstehen, und missverstehen, indem wir es verstehen –, doch ich habe ein Interesse daran, dass die Aschenplätze keinen »Popanz« aus mir machen. – Im Übrigen verfechte ich in diesem Buch die Ansicht, dass der Mensch an sich die Philosophie nicht braucht, dass er immer schon ganz gut ohne sie ausgekommen ist und weiterhin auskommen wird, ja, dass ihr Ende eine Morgenröte ankündigt, die wir mit Vorfreude, mit Vorjubel begrüßen dürfen. Und dieses Ende wird auch das des »Erkenne dich selbst« gewesen sein.
*
Ich fange am Anfang an. – Nicht, dass das möglich wäre. Der Anfang ist ein Einschnitt, den wir nachtragen. Wir haben nicht nur schon, wir sind bereits angefangen, wenn wir anfangen. Das alles ist bereits Rückblick, Erinnerung. – Doch damit ist der Anfang nicht erledigt, er bleibt unausweichlich. Sosehr sich der vermeintlich tatsächliche entzieht, so sehr brauchen wir ihn als einen Beginn unserer Erzählung. Meine fängt wie jede vor meiner Geburt an.
Luftangriffe
Gelsenkirchen im Weltkrieg. – Mitte Juni 1944 beginnen die Alliierten in Gestalt von Bombern der Royal Air Force, ihre Angriffe auf die Industriestadt zu verschärfen. Zunächst zerstören sie ein kriegswichtiges Hydrierwerk im Stadtteil Horst, in dem Gefangene eines Außenlagers des KZ Buchenwald arbeiten. Im Werk wird Kohle verflüssigt, um Kraftstoffe und Schmieröle für die Wehrmacht herzustellen. Dasselbe passiert am 19. Juli mit einem Hydrierwerk in Scholven. Im Herbst werden die Anlagen des ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegenen Schalker Vereins, der hier Granaten produziert, zerstört. Gleiches geschieht mit dem Mannesmann-Röhrenwerk Grillo-Funke in Schalke. Die größten Luftangriffe finden am 6. November statt, der erste um 14 Uhr, der zweite um 19.15 Uhr. Die Stadtteile Altstadt, Bulmke, Hüllen und Schalke werden beinahe vollständig vernichtet. Weitere Angriffe folgen vom 9. bis zum 13. November. Ziel ist diesmal die Großschachtanlage Graf Bismarck. Das setzt sich am 19. Februar 1945 fort. Am 5. März trifft ein weiterer Angriff die Stadt. Die letzten Bomben werden am 19. März abgeworfen. Bei Bauarbeiten findet man noch heute Blindgänger im lehmigen Erdreich. – Mein Vater wird zwei Jahre und meine Mutter ein paar Monate vor den Angriffen in Gelsenkirchen geboren. Sie überleben die Bombardements mit ihren Eltern in Bunkern. Meines Vaters Familie wird zwei Mal ausgebombt. Meine Geschichte beginnt also im Bombenkrieg.36
Zur Welt kommen. Der erste Riss
Erinnerungen – was bin ich anderes oder mehr als meine Erinnerungen? Selbst – oder doch eher besonders – meinen Körper erinnere ich, auch wenn er mir vererbt wurde. Aber die Zeit verändert alles. Keine Erinnerung bleibt, wie sie war. In jedem Moment, in dem ich mich erinnere und fühle, taucht sie anders auf. Sie wird immer anders aufgetaucht sein. Die Wahrheit des Lebens ist ein Augenblick. Und der Augenblick – was ist er? Ich bin bereits tot, und noch lebe ich. Indem ich beginne, mein Leben zu erzählen, ändert sich dieses Leben, es wird sich verändert haben; selbst die bloßen Fakten, sie stehen nicht fest, sie brechen aus ihren Rändern heraus. Das sind die Male, um die ich kreise. Migration, Armut, Missbrauch und Rassismus sind die Voraussetzungen einer Geschichte, die auch die meine gewesen sein wird. Ich werde von all dem als Erbschaft nicht nur meiner Generation, sondern ebenso meiner Familie zu erzählen haben; bekannte Merkmale einer allgemeinen Subjektwerdung. Und doch besteht das Leben aus singulären Ereignissen, die zu einer singulären Geschichte zusammenwachsen. Du bist einzigartig und bist es doch nicht nur – wie ich selbst. Diese kritische Masse Leben zwischen uns ruft nach den Geschichten, die wir uns erzählen. Sie erinnern uns daran, wer wir sind.
Mein Vater wurde zu einer Zeit geboren, als dunkelste Ereignisse sich ankündigten. Im Rahmen des Manhattan Project unter der Leitung von Robert Oppenheimer, der sich in der Erforschung zerfallender Sterne einen Namen gemacht hatte, gelang in der Wüste von New Mexico die erste Kettenreaktion im Atomkern. In Polen wurde die logistisch ambitionierte, technisch raffinierte und so bezeichnete »Endlösung der Judenfrage« in neu entstehenden Vernichtungslagern in Angriff genommen. Am Ende des dritten Kriegsjahres dachten die rassisch nicht zu beanstandenden Deutschen noch, alles werde gut. Ihnen schien es so, dass nichts gegen ein Kind sprach: Jürgen, wie mein Vater zeitgemäß nordisch genannt wurde, stammt väterlicherseits aus einer Familie aus dem süd-ostpreußischen Flammberg, das seit 1904 so und vorher Opalenietz hieß. Inzwischen heißt es wieder Opaleniec/Polen. Heute leben dort 239 Einwohner. Mütterlicherseits stammt er aus Malschöwen, heute Małszewko, ebenso klein und unbedeutend wie Flammberg. Beide Orte, beide Flecken, anders als der Rest Polens vorrangig evangelisch, gehörten zu Masuren. Mein Großvater väterlicherseits kam, wie viele aus dem Osten, nach dem Ersten Weltkrieg ins Ruhrgebiet, um im Bergbau zu arbeiten. Großmutter Elfriede, an deren Jähzorn mein Vater sich heute noch irritiert erinnert, starb plötzlich vor meiner Geburt; da war mein Vater noch keine zwanzig. Er erzählte mir oft, wie sie ihn schlug. Jener Großvater arbeitete vierzig Jahre lang unter Tage, mein Vater dreißig, mein Onkel ebenso vierzig, 110 Jahre Bergbau in zwei Generationen. Auch ich arbeitete da um die Zeit meines Abiturs herum und danach.
Ein zu früh an einer tabuisierten Krankheit verstorbener Großcousin erzählte, meine Mutter sei während eines Luftalarms auf Rügen von einem Afrikakorps-Soldaten auf Fronturlaub und meiner zweiundzwanzigjährigen Großmutter Elisabeth aus Gelsenkirchen, die mit dem Bund Deutscher Mädel auf der Insel war und den kleinen Ariernachweis vorweisen konnte (man brauchte ihn zum Beispiel für die Eheschließung), gezeugt worden, im bitteren Jahr des Untergangs der 6. Armee in Stalingrad. Mag sein, dass sie ein Geschenk für den Führer sein sollte. Der langschädelige blonde Großvater sah so germanisch aus, wie man damals aussehen sollte. Er kam aus Krefeld, der Stadt, in der Anfang des Jahrhunderts Gustav Mahlers ungeheuerliche Dritte Symphonie uraufgeführt wurde. Die Großmutter erzählte mir später, dass ihre Zeit beim BDM die schönste ihres Lebens gewesen war; ich besitze ein Photo von ihr in der hakengekreuzten Uniform einer Arbeitsmaid. Dieser Großvater, der nach dem Krieg in Westfalen bei der Kriminalpolizei Karriere machte, spielte in meinem Leben vor allem eine genetische Rolle. Zwar heiratete meine Großmutter ihn, doch die Ehe wurde nach ein paar Jahren geschieden; damals, als vor Gericht noch Gatte oder Gattin am Scheitern der Ehe für schuldig befunden wurden, in diesem Fall beide, wie es heißt, war das ein Skandal. Meine Großmutter zog mit ihrem Kind zu ihrer Mutter zurück, der Vater verblasste in der Erinnerung. Das nordische Aussehen meiner Mutter, dem Geschmack der Zeit entsprechend auf den Namen Ingrid getauft, muss von ihm stammen, was auf mich, meine in der Kindheit ascheblonden Haare und wohl überhaupt auf meinen Körper überging; dieser Körper, der sich mir von Anfang an zweideutig aufdrängte, mit dem ich es bis heute auf meine und seine Art zu tun habe.
Meine Eltern lernten sich im wiederaufgebauten Gelsenkirchen der frühen Sechzigerjahre kennen. Ich wurde, wie meine Mutter, aus Versehen gezeugt, was vielleicht einen guten Buchtitel ergäbe: Aus Versehen gezeugt. Das gilt vermutlich für viele, für sehr viel mehr Menschen, als man denkt, im Grunde sogar für alle …





























