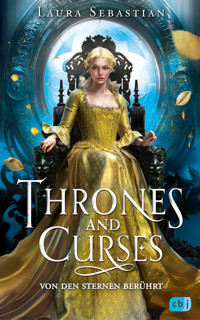9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die ASH PRINCESS-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie kommt aus der Asche und greift nach den Sternen
Theo ist noch ein Kind, als ihre Mutter, die Fire Queen, vor ihren Augen ermordet wird. Der brutale Kaiser raubt dem Mädchen alles: die Familie, das Reich, die Sprache, den Namen. Und er macht aus ihr die Ash Princess, ein Symbol der Schande für ihr Volk. Aber Theo ist stark. Zehn Jahre lang hält die Hoffnung sie am Leben, den Thron irgendwann zurückzuerobern, allem Spott und Hohn zum Trotz. Als der Kaiser Theo eines Nachts zu einer furchtbaren Tat zwingt, wird klar: Um ihren Traum zu erfüllen, muss sie zurückschlagen – und die Achillesferse des Kaisers ist sein Sohn. Doch womit Theo nicht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für den Prinzen ...
Dunkle und brillante Fantasy vom Feinsten, raffiniert geschrieben mit klugen Wendungen - die ASH PRINCESS kommt aus der Asche und greift nach den Sernen… Mitreißender und düster-romantischer Lesestoff für Fans von Sarah J. Maas und Victoria Aveyard.
Alle Bände der ASH PRINCESS-Reihe:
ASH PRINCESS (Band 1)
LADY SMOKE (Band 2)
EMBER QUEEN (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Laura Sebastian
Aus dem amerikanischen Englischvon Dagmar Schmitz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Laura Sebastian
Translated from the English language: ASH PRINCESS
First published as »Ash Princess« in the United States by Delacorte Press,
an imprint of Penguin Random House US
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2018
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Dagmar Schmitz
Redaktion: Heike Brillmann-Ede
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotiv: Shutterstock.com (Azer Merz; Ironika; SayHope; Tithi Luadthong)
Karten: © 2018 by Isaac Stewart
TP · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21407-4V004www.cbj-verlag.de
FÜR JESSE UND EDEN
Möget ihr stets das Richtige tun, auch wenn es schwerfällt.
Prolog
Die Letzte, die mich bei meinem wahren Namen nannte, war meine Mutter – mit ihrem letzten Atemzug. Ich war sechs Jahre alt und meine Hand noch so klein, dass ihre sie vollständig umfasste. Sie drückte sie schmerzhaft fest, dass ich kaum etwas anderes wahrnahm. So fest, dass ich kaum den silbernen Dolch sah, der ihr an den Hals gesetzt wurde oder die Angst in ihren Augen.
»Du weißt, wer du bist«, sagte sie zu mir. Ihre Stimme zitterte nicht, auch nicht, als Blutstropfen hervorquollen, als die Klinge in ihre Haut eindrang. »Du bist die einzige Hoffnung für unser Volk, Theodosia.«
Und dann schnitten sie ihr die Kehle durch und raubten mir meinen Namen.
Thora
Thora!«
Ich drehe mich um und sehe Crescentia den goldenen Palastkorridor entlang auf mich zustürmen, das rosafarbene Seidenkleid im Laufen hochgerafft und ein breites Grinsen auf ihrem hübschen Gesicht.
Ihre beiden Zofen haben Mühe, mit ihr Schritt zu halten, die ausgemergelten Gestalten ertrinken in schlichten Leinenkleidern.
Sieh ihnen nicht ins Gesicht,sieh nicht hin, ermahne ich mich. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, in ihre stumpfen Augen oder auf ihre hungrigen Münder zu schauen. Es kommt nichts Gutes dabei heraus zu sehen, wie ähnlich sie mir sind, mit ihrem olivbraunen Teint und den dunklen Haaren. Das lässt die Stimme in meinem Kopf nur lauter werden. Und wenn die Stimme in meinem Kopf laut genug anschwillt, um über meine Lippen zu dringen, wird der Kaiser zornig.
Wecke nicht den Zorn des Kaisers, dann lässt er dich leben. So lautet die Regel, die zu befolgen ich gelernt habe.
Ich konzentriere mich auf meine Freundin. In Cress’ Gegenwart ist alles leichter. Sie verströmt Lebensfreude wie die Sonne ihre Strahlen und wärmt damit die Herzen ihrer Mitmenschen. Sie weiß, dass ich mehr davon brauche als die meisten, deshalb tritt sie jetzt ohne Zögern neben mich und hakt sich bei mir ein.
Sie geht mit ihrer Zuneigung auf eine so freigiebige Weise um, wie es nur wenige vom Glück gesegnete Menschen können; sie hat noch nie jemanden geliebt und ihn dann verloren. Ihre natürliche, kindliche Schönheit wird ihr auch als alte Frau noch erhalten bleiben – zarte Gesichtszüge und große kristallgraue Augen, die niemals Gräuel erblickt haben. Das hellblonde Haar fällt ihr zu einem langen Zopf geflochten über die Schulter, verziert mit Dutzenden von Magiesteinen, die im durch die Buntglasfenster hereinströmenden Sonnenlicht funkeln.
Auch die Juwelen kann ich nicht ansehen, ihren Zauber spüre ich dennoch: ein sanftes Ziehen unter der Haut, mit dem sie mich locken und mir ihre Kraft schenken wollen, wenn ich sie nur annähme. Aber das werde ich nicht. Ich darf nicht.
Bevor Astrea von den Kalovaxianern erobert wurde, waren Magiesteine heilig.
Sie stammen aus den Höhlen, die unter den vier großen Tempeln unserer bedeutendsten Gottheiten verliefen – der Höhle des Feuers, der Luft, des Wassers und der Erde. Die Höhlen waren das Zentrum ihrer göttlichen Macht und so stark davon durchdrungen, dass sich ihre Magie auf das Gestein übertrug. Vor der Eroberung pflegten Gläubige in der Höhle derjenigen Gottheit, der sie die Treue gelobt hatten, Jahre zu verbringen. Sie huldigten ihrem Gott oder ihrer Göttin, und wenn sie sich schließlich als würdig erwiesen, wurden sie gesegnet und von der magischen Kraft ihrer Gottheit erfüllt. Diese Gabe nutzten sie anschließend, um Astrea und seinem Volk als Hüter zu dienen.
Damals gab es nur wenige, die nicht von den Göttern auserkoren wurden – eine Handvoll im Jahr vielleicht. Diese wenigen wurden wahnsinnig und starben kurz darauf. Es war ein Wagnis, das nur die wahrhaft Gläubigen eingingen. Hüter zu sein war eine Berufung – eine Ehre –, aber jeder wusste, was auf dem Spiel stand.
Das war vor einer Ewigkeit. Vorher.
Nach der Eroberung ließ der Kaiser die Tempel zerstören und schickte Zehntausende Astreaner als Sklaven in die Höhlen, wo sie die Steine bis heute aus den Felsen schlagen müssen. Der Macht der Götter so nah zu sein, ist nun keine Entscheidung mehr, die die Menschen selbst treffen, sondern eine, die für sie getroffen wird. Ohne Berufung und Treuegelöbnis verlieren die meisten, die in die Minen geschickt werden, sehr schnell ihren Verstand und bald darauf ihr Leben.
Und das alles nur, damit die Wohlhabenden ein Vermögen für Juwelen ausgeben und sich mit ihnen schmücken können, ohne den Namen der Götter auch nur auszusprechen. Für uns ist es ein Sakrileg, aber nicht für die Kalovaxianer. Sie teilen unseren Glauben nicht. Und ohne die Segnungen der Götter, ohne eine Zeit der Huldigung tief unter der Erde verbracht zu haben, können sie nur einen Hauch der Kraft eines geweihten Hüters in sich aufnehmen, selbst wenn sie Unmengen von Magiesteinen tragen, wie es die meisten von ihnen tun. Die Wasser-Steine, die in Cress’ Zopf eingeflochten sind, würden einem geschulten Hüter die Fähigkeit verleihen, ein derart starkes Trugbild zu erschaffen, dass ein vollkommen neues Gesicht entstünde, aber Cress verleihen sie nur einen leuchtenden Teint, ihren Lippen und Wangen einen liebreizenden rötlichen Schimmer, ihren blonden Haaren einen goldenen Glanz.
Schönheitssteine nennen sie die Kalovaxianer jetzt.
»Mein Vater hat mir ein Buch mit Gedichten aus Lyria geschickt«, sagt sie. Ihre Stimme klingt angespannt wie stets, wenn sie mit mir über den Theyn spricht. »Lass uns in den Pavillon gehen und sie übersetzen. Die Sonne genießen, solange sie noch scheint.«
»Aber du sprichst doch gar kein Lyrisch«, erwidere ich stirnrunzelnd. Cress hat eine besondere Begabung für Sprachen und Literatur, Dinge, für die ihr Vater nicht die nötige Geduld aufbringt. Als bester Krieger und Feldherr über die Armee des Kaisers versteht der Theyn etwas von Krieg und Waffen, von Kampfkunst und Blutvergießen, weniger von Büchern und Poesie, aber er bemüht sich, ihr zuliebe. Cress’ Mutter starb, als Cress noch ein Baby war, und der Theyn ist alles, was ihr noch an Familie geblieben ist.
»Ich habe hier und da ein paar Sätze aufgeschnappt.« Sie macht eine wegwerfende Handbewegung. »Aber mein Vater hat den Dichter einiges übersetzen lassen, damit ich den Rest selbst enträtseln kann. Du weißt, welchen Gefallen mein Vater an Rätselspielen findet.«
Sie wirft mir verstohlen einen Blick von der Seite zu, um zu sehen, wie ich reagiere, aber ich hüte mich, mir irgendetwas anmerken zu lassen.
Ich hüte mich, mir vorzustellen, wie Cress’ Vater einem über seinem Werk kauernden, armen, ausgezehrten Dichter den Dolch an die Kehle presst, oder wie er diesen Dolch vor langer Zeit meiner Mutter an die Kehle gehalten hat. Ich denke nicht an die Angst in ihren Augen. An ihre Hand, die meine umklammerte. An ihre Stimme, fest und klar, selbst da noch.
Nein, daran denke ich nicht. Sonst verliere ich den Verstand.
»Nun, zu zweit werden wir beide das Rätsel schnell gelöst haben«, versichere ich ihr mit einem Lächeln, das sie hoffentlich überzeugt.
Nicht zum ersten Mal frage ich mich, was wohl geschähe, wenn ich nicht jedes Mal ein Schaudern unterdrücken würde, sobald sie ihren Vater erwähnt. Wenn ich nicht lächeln und so tun würde, als wisse ich nicht, dass er der Mann ist, der meine Mutter getötet hat. Ich würde gern glauben, Cress und ich seien lange genug befreundet, dass sie mich versteht, aber diese Art von Vertrauen ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann.
»Dagmær wird vielleicht dort sein.« Crescentia senkt die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. »Du hast ihre … wagemutige Kleiderwahl zum Mittagessen gestern bei der Komtess nicht gesehen.« In ihren Augen glitzert ein Lächeln.
Es interessiert mich nicht. Der Gedanke kommt plötzlich und stechend wie der Stachel einer Biene. Und wenn Dagmær nackt zum Mittagessen erschienen wäre. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich unterdrücke diesen Gedanken und begrabe ihn tief in meinem Inneren, so wie ich es immer tue. Solche Gedanken gehören nicht zu Thora, sie gehören zu der Stimme. Gewöhnlich ist die nur ein leises Wispern, leicht zu überhören, aber manchmal wird sie lauter und vermischt sich mit meiner eigenen. Dann gerate ich in Schwierigkeiten.
Ich konzentriere mich auf Cress, auf ihr unbeschwertes Wesen, auf ihre harmlosen Freuden.
»Ich glaube nicht, dass irgendetwas die Straußenfedern übertreffen kann, in die sie letzten Monat gehüllt war«, flüstere ich zurück und bringe sie damit zum Kichern.
»Oh, diesmal war es noch viel schlimmer. Ihr Kleid bestand aus schwarzer Spitze. Man konnte praktisch ihre Unterkleidung sehen … oder vielmehr deren Fehlen!«
»Nein!«, kreische ich in gespieltem Entsetzen.
»Doch! Es heißt, sie hoffe, Herzog Clarence zu betören«, sagt Cress. »Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, warum. Er ist alt genug, um ihr Vater zu sein, und er riecht wie fauliges Fleisch.« Sie rümpft die Nase.
»Nun, wenn man bedenkt, wie viele Schulden ihr richtiger Vater hat …« Ich verstumme und ziehe vielsagend eine Braue hoch.
Crescentias Augen weiten sich. »Nein!«, stößt sie hervor. »Woher weißt du das?« Als ich zur Antwort nur still lächele, seufzt sie und stupst mir den Ellbogen in die Seite. »Du kennst immer den besten Klatsch, Thora.«
»Das kommt daher, weil ich zuhöre«, erwidere ich augenzwinkernd.
Ich sage ihr nicht, worauf ich wirklich horche, dass ich jedes noch so geistlose Gerücht in der Hoffnung auf Getuschel über astreanischen Widerstand durchkämme, in der Hoffnung, dass es in der Welt dort draußen noch irgendjemanden gibt, der mich eines Tages vielleicht retten könnte.
In den Jahren nach der Eroberung gab es immer wieder Geschichten über aufständische Astreaner, die sich gegen den Kaiser erhoben. Jede Woche wurde ich auf den großen Platz der Kapitale gezerrt und von einem der Männer des Kaisers ausgepeitscht, um an mir ein Exempel zu statuieren, während auf Speerspitzen hinter mir die abgeschlagenen Köpfe gefallener Rebellen verwesten. Meist kannte ich deren Gesichter, sie gehörten den Hütern, die meiner Mutter gedient hatten – Männer und Frauen, die mir als Kind Süßigkeiten geschenkt und Geschichten erzählt hatten. Ich hasste solche Tage, und die meiste Zeit hasste ich auch die Rebellen, weil es sich anfühlte, als wären sie diejenigen, die mir diese Schmerzen zufügten, weil sie mich dem Zorn des Kaisers aussetzten.
Inzwischen sind die meisten Rebellen allerdings tot, und es wird nur noch selten und nur im Flüsterton über Rebellion gesprochen, flüchtige Erinnerungen, wenn die Höflinge nicht mehr wissen, worüber sie plaudern sollen. Es ist Jahre her, dass der letzte Rebell gefangen genommen wurde. Mir fehlen diese Bestrafungen nicht, die stets brutaler und vor einem immer größeren Publikum vollzogen wurden, aber mir fehlt die Hoffnung, die ich damals noch hatte, das Gefühl, nicht allein zu sein und dass es meinen Leuten eines Tages gelingen würde, mich aus meinem Elend zu befreien.
Hinter uns werden Schritte laut, die zu schwer sind, um Cress’ Sklavinnen zu gehören. »Lady Crescentia, Lady Thora«, ruft eine Männerstimme. Cress’ Griff um meinen Arm wird fester und sie zieht hörbar die Luft ein.
»Euer Hoheit.« Cress dreht sich um und sinkt in einen Hofknicks, mich zieht sie mit sich. Mein Herz rast bei der Anrede, obwohl ich weiß, dass es nicht der Kaiser ist. Dessen Stimme würde ich jederzeit und überall erkennen. Dennoch entspanne ich mich erst, als ich mich aus meinem Hofknicks aufrichte und meine Vermutung bestätigt sehe.
Der Fremde hat die gleichen langen weizenblonden Haare, die gleichen eisblauen Augen und die gleiche markante Kinnpartie wie der Kaiser, nur ist er wesentlich jünger. Im Grunde noch ein Junge, vielleicht ein Jahr älter als ich.
Prinz Søren, stelle ich überrascht fest. Niemand hat etwas über seine Rückkehr an den Hof verlauten lassen, was verwunderlich ist, weil die Kalovaxianer weitaus mehr in ihren Prinzen vernarrt sind als in den Kaiser.
Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, liegt fast fünf Jahre zurück. Damals war er noch ein schmächtiger Zwölfjähriger mit kindlichen Gesichtszügen, der stets ein Holzschwert in der Hand hatte. Der Mann vor mir ist nicht mehr schmächtig, und seine Züge haben alles Kindhafte verloren. Ein Schwert hat er nach wie vor, er trägt es in einer kunstvoll verzierten Scheide um die Hüfte, aber es ist nicht aus Holz. Es ist eine schmiedeeiserne Waffe, an deren Knauf Magiesteine glitzern, die ihm Kraft und Stärke verleihen sollen.
Als Kind habe ich Erdhüter gesehen, die so stark waren, dass sie Felsen vom Dreifachen ihres eigenen Gewichts hoben, als seien sie leicht wie Luft, aber ich glaube kaum, dass die Magiesteine am Schwert des Prinzen sehr viel mehr bewirken, als seinen Hieben eine etwas stärkere Wucht zu verleihen. Nicht, dass es von Belang wäre. Im Lauf von Sørens fünfjähriger Ausbildung unter dem Theyn wird dieses Schwert mehr als seinen gerechten Anteil an blutigen Treffern gelandet haben. Bei Hof rühmt man die Tapferkeit des Prinzen in der Schlacht. Es heißt, sein Heldenmut sei einzigartig, sogar nach kalovaxianischen Maßstäben. Der Kaiser sieht den Prinzen gern als eine Erweiterung seiner selbst, aber Prinz Sørens Verdienste heben die Unzulänglichkeit des Kaisers nur noch mehr hervor. Seit er auf dem Thron sitzt, ist der Kaiser faul und selbstzufrieden geworden. Er ist mehr an Festbanketten und Schlemmereien interessiert als daran, in einer Schlacht zu kämpfen.
Ich frage mich, was den Prinzen nach so vielen Jahren hierherführt, wobei ich vermute, dass seine Lehrzeit beim Theyn beendet sein dürfte. Er ist jetzt erwachsen, und ich kann nur annehmen, dass er schon bald mit seinem eigenen Heer in den Krieg ziehen wird.
Er deutet eine Verbeugung an und verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Seine Miene bleibt ausdruckslos, sie könnte ebenso gut aus Marmor gemeißelt sein. »Wie schön, Euch beide wiederzusehen. Es ist Euch hoffentlich gut ergangen.«
Eigentlich ist es keine Frage, aber Cress antwortet dennoch mit einem verlegen gehauchten Ja. Sie streicht sich eine Haarsträhne hinters Ohr, glättet den Faltenwurf ihres Kleides und ist kaum fähig, seinen Blick zu erwidern. Schon als Kind hat sie für ihn geschwärmt und wie jedes Mädchen in unserem Alter davon geträumt, Prinzessin zu werden. Aber was Cress angeht, ist das nicht bloß ein Hirngespinst. Astrea ist nur eines von vielen Gebieten, die ihr Vater für den Kaiser erobert hat. Es heißt, der Theyn habe mehr Königreiche eingenommen als jeder andere Feldherr vor ihm, und niemand kann bestreiten, dass es nur gerecht wäre, die Tochter des Theyn zum Dank zur Prinzessin zu machen. Seit Cress vor sechs Monaten mündig wurde, ist das Raunen bei Hof über eine solche Partie von geradezu ohrenbetäubender Lautstärke.
Womöglich ein weiterer Grund für Sørens Rückkehr?
Sollte ihm dieses Raunen zu Ohren gekommen sein, so zeigt er es nicht. Seine Blicke gehen durch Cress hindurch, als wäre sie Luft, und landen stattdessen auf mir. Er runzelt die Stirn, wie es sein Vater tut, wenn er mich ansieht, wobei Sørens Stirnrunzeln wenigstens nicht von einem hämischen oder anzüglichen Grinsen gefolgt ist.
»Das freut mich zu hören«, sagt er kühl und knapp zu Cress, aber seine Augen ruhen auf meinen. »Mein Vater verlangt nach Euch, Lady Thora.«
Angst umschlingt meinen Magen wie eine hungrige Python, immer enger, bis ich kaum mehr atmen kann. Der Drang davonzurennen steigt in mir auf, und es gelingt mir nur mit Mühe, meine Beine ruhig zu halten.
Ich habe nichts verbrochen. Ich war so vorsichtig. Andererseits muss ich auch nichts getan haben, um mir den Zorn des Kaisers zuzuziehen. Wann immer es Hinweise auf einen Aufstand im Sklavenviertel gibt oder ein astreanischer Pirat ein kalovaxianisches Schiff versenkt, zahle ich den Preis dafür. Als er mich das letzte Mal zu sich rufen ließ, vor kaum einer Woche, war es, um mich auspeitschen zu lassen, als Antwort auf eine Revolte in einer der Minen.
»Nun.« Meine Stimme zittert trotz aller Anstrengung, sie ruhig zu halten. »Dann sollten wir ihn nicht warten lassen.«
Einen kurzen Moment sieht Prinz Søren aus, als wolle er etwas sagen, stattdessen presst er die Lippen zusammen und bietet mir seinen Arm an.
Verräter
Der Obsidian-Thron steht auf einer Erhöhung in der Mitte des von einer Kuppel überdachten, kreisförmigen Thronsaals. Der wuchtige Koloss ist aus massivem schwarzem Stein gemeißelt – in Form von Flammen, die an demjenigen emporzuzüngeln scheinen, der darauf sitzt. Er ist schlicht, beinahe hässlich inmitten all der goldenen Pracht, die ihn umgibt, aber er wirkt zweifellos gebieterisch, und das ist es, worauf es ankommt.
Die Kalovaxianer glauben, dass der Thron aus dem Vulkangestein Alt-Kalovaxias besteht und von ihren Göttern hier für sie zurückgelassen wurde, damit sie eines Tages nach Astrea kommen und das Land von seinen schwachen und ruchlosen Königinnen befreien.
Ich erinnere mich an eine andere Geschichte: Houzzah, der astreanische Gott des Feuers, hatte sich so sehr in eine Sterbliche verliebt, dass er ihr ein Land schenkte und eine Erbin, in deren Adern sein Blut floss. Diese Geschichte geistert mir jetzt in einem vertrauten Singsang durch den Kopf, doch sobald ich mich darauf konzentrieren will, verblasst sie wie ein ferner Stern, auf den man den Blick zu richten versucht. Sie bleibt ohnehin besser in Vergessenheit. Es ist sicherer, ausschließlich in der Gegenwart zu leben und ein Mädchen ohne eine Vergangenheit zu sein, nach der es sich verzehrt, und ohne eine Zukunft, die man ihm rauben kann.
Die Menge der prachtvoll herausgeputzten Höflinge teilt sich vor Prinz Søren und mir, als wir auf den Kaiser zugehen. Ebenso wie Cress tragen alle Höflinge blaue Wasser-Magiesteine für Schönheit und kristallklare Luft-Steine für Anmut – so viele, dass es einen fast blendet. Es gibt auch noch andere: rote Feuer-Magiesteine für Wärme, goldgelbe Erd-Magiesteine für Stärke und Kraft.
Ich lasse den Blick durch den Saal wandern. Aus dem Meer der blonden hellhäutigen Kalovaxianer sticht ein wenig abseits vom Thron Ion hervor. Außer mir ist er der einzige Astreaner hier, der nicht in Ketten geht, aber er ist kein willkommener Anblick. Nach der Eroberung hat er sich dem Kaiser ergeben und um sein Leben gefleht und ihm seine Dienste als Hüter der Lüfte angeboten. Jetzt behält ihn der Kaiser bei sich, um ihn in der Kapitale als Spion einzusetzen und als Heiler für die Herrscherfamilie. Und für mich. Schließlich macht es keinen großen Spaß, mich auszupeitschen, wenn ich vor Schmerz ohnmächtig bin. Ion, der einst unseren Göttern und meiner Mutter die Treue gelobte, benutzt seine Gabe nun dazu, mich zu heilen, nur damit die Männer des Kaisers wieder und wieder versuchen können, mich zu brechen.
Seine Anwesenheit ist eine unausgesprochene Drohung. Er hat ansonsten keine Funktion bei Hof; gewöhnlich erscheint er nur zu meinen Bestrafungen.
Wenn der Kaiser die Absicht hätte, mich auspeitschen zu lassen, würde er es irgendwo in der Öffentlichkeit vor mehr Publikum tun. Er scheint es allerdings auch nicht gänzlich auszuschließen, weshalb Ion hier ist.
Der Kaiser wirft Søren einen auffordernden Blick zu, der daraufhin meinen Arm loslässt, in der Menge verschwindet und mich unter dem bohrenden Blick seines Vaters allein zurücklässt. Am liebsten würde ich ihm nachlaufen und mich an ihn klammern, oder an sonst irgendjemanden, damit ich nicht allein hier stehen muss.
Doch ich bin immer allein. Ich sollte mich inzwischen daran gewöhnt haben, glaube aber nicht, dass dies etwas ist, woran sich ein Mensch gewöhnen kann.
Der Kaiser lehnt sich auf dem Thron vor, seine kalten Augen glitzern im Sonnenlicht, das durch die Glasmalereien des Kuppeldachs hereinströmt. Er sieht mich an, als betrachte er einen zerquetschten Käfer, der seine Schuhsohle beschmutzt.
Ich richte meinen Blick lieber auf den Thron und die gemeißelten Flammen. Nicht den Zorn des Kaisers zu wecken ist das, was mich am Leben hält. Er hätte mich in den vergangenen zehn Jahren schon tausendmal töten können und hat es nicht getan. Zeugt das nicht von Güte?
»Da bist du ja, Ascheprinzessin.« Für jeden anderen mag die Begrüßung freundlich klingen, aber ich zucke zusammen. Beim Kaiser muss man ständig auf der Hut sein, er liebt es, zu täuschen und Spielchen zu spielen. Es ist stets ein schmaler Grat, auf dem es zu balancieren gilt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn er jetzt freundlich tut, lauert die nächste Grausamkeit nicht weit.
Zu seiner Rechten steht, die Hände vor dem Körper gefaltet und den Kopf gesenkt, Kaiserin Anke, seine Frau. Sie hebt kurz den Blick und sieht mich unter ihren spärlich mit blonden Wimpern bekränzten Lidern hervor aus milchweißen Augen an. Eine Warnung, bei der sich die Pythonschlange in meinem Inneren noch enger um meinen Magen schlingt.
»Ihr habt mich rufen lassen, Euer Hoheit?« Ich sinke in einen so tiefen Hofknicks, dass ich beinahe flach auf dem Boden liege. Noch nach zehn Jahren begehren meine Knochen gegen diese Haltung auf. Mein Körper weiß, dass ich nicht zum Knicksen geboren bin, auch wenn ich es vergessen haben mag.
Bevor der Kaiser etwas erwidern kann, durchbricht ein heiserer Schrei die Stille. Als ich mich erhebe, sehe ich links vom Thron einen Mann stehen, der von zwei Palastwachen festgehalten wird. Um seine ausgemergelten Arme und Beine und um seinen Hals sind rostige Ketten geschlungen, so eng, dass sie ihm in die Haut schneiden. Seine Kleidung ist zerrissen und blutgetränkt und sein schmutziges Gesicht ein Desaster aus gebrochenen Knochen und zerfetzter Haut. Aber unter all dem Blut ist er zweifellos ein Astreaner, mit olivbraunem Teint, schwarzen Haaren und tief eingesunkenen dunkelbraunen Augen. Er scheint viel älter zu sein als ich, auch wenn sich sein Alter bei all den Verletzungen, die man ihm zugefügt hat, unmöglich genau feststellen lässt.
Er ist ein Fremder. Aber seine dunklen Augen suchen meinen Blick, und er sieht mich an, als würde er mich kennen, beschwörend, flehend. Ich stochere im Nebel meiner Erinnerungen – wer könnte das sein und was will er von mir? Ich habe nichts für ihn. Nichts mehr, für niemanden. Plötzlich habe ich das Gefühl, den Boden unter den Füßen verlieren.
Ich kenne diese Augen aus einem anderen Leben. Damals blickten sie mir aus einem sanftmütigen Gesicht entgegen, zehn Jahre jünger und ohne Blut. Erinnerungen stürmen auf mich ein, während ich versuche, sie zurückzudrängen.
Ich sehe ihn an der Seite meiner Mutter stehen und ihr etwas ins Ohr flüstern, das sie zum Lachen bringt. Ich sehe, wie mich seine Arme umfassen und hochheben, damit ich eine Orange von einem Baum pflücken kann, ich sehe, wie er mich anlächelt, als teilten wir ein Geheimnis.
Ich unterdrücke diese Gedanken und konzentriere mich stattdessen auf den gebrochenen Mann, der vor mir steht.
Es gibt einen Mann, der stets in Verbindung mit Rebellion erwähnt wird. Ein Mann, der bei jedem Aufstand gegen den Kaiser seine Hand im Spiel hat. Ein Mann, dessen Name allein schon genügt, den Kaiser derart in Rage zu versetzen, dass er mich so heftig auspeitschen lässt, dass ich anschließend tagelang das Bett hüten muss. Ein Mann, dessen tollkühner Widerstand mir schon oft unsägliche Schmerzen bereitet hat, der aber zugleich mein einziger Hoffnungsschimmer ist, wenn ich mir vorzustellen wage, auf die Jahre der Hölle könne es ein Danach geben.
Kein Wunder, dass der Kaiser in Feierlaune ist. Er hat endlich den letzten der Hüter von Astrea gefasst. Den engsten Vertrauten meiner Mutter. Ampelio.
»Meine Königin«, sagt der Mann. Seine klangvolle Stimme hallt durch die Stille des Thronsaals, sodass jeder der Versammelten den Verrat hört.
Ich erschaudere bei seinen Worten. Nein, nein, nein, will ich ihm zurufen. Ich bin niemandes Königin. Ich bin Lady Thora, Prinzessin aus der Asche. Ich bin ein Nichts.
Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass er Astreanisch gesprochen hat, verbotene Worte, mit denen er früher meine Mutter anzureden pflegte. Meine Mutter. In einem anderen Leben war ich eine andere. Eine andere Art von Prinzessin. Diesem Mädchen sagte man, es würde eines Tages Königin sein, aber sie wollte nicht. Denn schließlich bedeutete Königin sein, in einer Welt zu leben, in der es meine Mutter nicht mehr gab, und das war schlicht unvorstellbar.
Aber dieses Mädchen starb vor einem Jahrzehnt, für sie gibt es keine Rettung mehr.
Der Mann taumelt unter dem Gewicht der Ketten. Er ist zu schwach, um zu fliehen, er würde es nicht einmal bis zur Tür schaffen, aber er versucht es auch gar nicht. Stattdessen stürzt er vor meinen Füßen zu Boden, seine Finger krallen sich in den Saum meines Kleides und färben die zartgelbe Seide blutrot.
Nein.Bitte nicht. Ich möchte ihn wieder auf die Beine zerren und ihm sagen, dass er sich irrt. Zugleich will ich vor ihm zurückweichen, weil es ein so wunderschönes Kleid ist, das er mit Blut besudelt. Und dann wieder würde ich ihn am liebsten anschreien, dass er uns mit seinen Worten beide zugrunde richtet, ihm aber wenigstens die Gnade des Todes gewährt werden wird.
»Er weigerte sich, mit irgendjemandem außer dir zu sprechen«, sagt Kaiser Corbinian in gereiztem Tonfall.
»Mit mir?« Mein Herz hämmert so laut, es wundert mich, dass es nicht der ganze Hof hören kann. Alle Augen im Saal sind auf mich gerichtet; alle warten darauf, dass ich einen Fehler mache, lauern auf den kleinsten Hauch von Aufbegehren, um zuschauen zu können, wie mir der Kaiser die Seele aus dem Leib peitschen lässt. Doch den Gefallen tue ich ihnen nicht.
Wecke nicht den Zorn des Kaisers, dann lässt er dich leben. Ich wiederhole die Worte stumm, gebetsmühlenartig wieder und wieder, aber sie haben ihre Kraft verloren.
Der Kaiser lehnt sich auf dem Thron vor und mustert mich eindringlich. Ich habe diesen Blick schon viel zu oft gesehen, er sucht mich in meinen Albträumen heim. Der Kaiser ist wie ein Hai, der Blut wittert. »Du kennst ihn nicht?«
Das ist die Art von Frage, wie er sie am liebsten stellt. Eine, auf die es keine passende Antwort gibt.
Ich schaue den Mann zu meinen Füßen an, als bemühe ich mich, ihn einzuordnen, obwohl sein Name in meinem Kopf widerhallt wie ein gellender Schrei. Immer mehr Erinnerungen kommen hoch, und ich versuche, sie zurückzudrängen. Der Kaiser beobachtet mich aufmerksam, auf ein Anzeichen von Aufmüpfigkeit wartend. Aber ich kann den Blick nicht von den Augen des Mannes abwenden.
In jenem anderen Leben stand er mir sehr nah.
Er war ein bedeutender Hüter und der engste Vertraute meiner Mutter. Und nach einhelliger Meinung fast aller war er außerdem mein Blutsvater – wenngleich das nicht einmal Mutter mit Sicherheit sagen konnte.
Ich erinnere mich, in seinem Gesicht nach Ähnlichkeiten gesucht zu haben, als mir das Gerücht zum ersten Mal zu Ohren gekommen war, aber ich konnte nichts Eindeutiges entdecken. Seine Nase wölbte sich zwar auf die gleiche Weise wie meine, und seine Locken ringelten sich auf die gleiche Art um die Ohren, wie es bei mir der Fall war, aber ich ähnelte viel zu sehr meiner Mutter, um mir in irgendeiner Hinsicht sicher zu sein. Doch das war damals, als meine Augen noch kindlich rund waren und sich weder dem Gesicht meiner Mutter noch irgendeinem anderen zuordnen ließen. Jetzt ist die Ähnlichkeit derart frappierend, dass es mich wie ein Schlag in den Magen trifft.
Als Hüter war er häufig unterwegs, um mit seiner Feuer-Magie für Sicherheit im Land zu sorgen, aber er kehrte immer mit Süßigkeiten und Spielzeug und spannenden Geschichten für mich zurück. Ich bin oft auf seinem Schoß eingeschlafen, mit einer Hand den Feuer-Magiestein umklammernd, den er um den Hals trug. Dessen Magie summte in meinem Körper wie ein Wiegenlied, das mich in den Schlaf lullte.
Als meine Mutter starb, und die Welt, wie ich sie kannte, zu Staub und Asche zerfiel, wartete ich darauf, dass er kommen und mich retten würde. Diese Hoffnung schwand mit jedem Hüter ein bisschen mehr, dessen Kopf der Kaiser auf dem Platz der Kapitale aufspießen ließ, aber sie schwand niemals ganz. Ich hörte weiterhin Geraune über Ampelios Rebellionen, und das hielt meine Hoffnung am Leben, selbst nachdem die anderen Hüter einer nach dem anderen fielen. Mochten sie auch noch so wenige sein, ich klammerte mich an meine Hoffnung. Solange Ampelio dort draußen war, solange er kämpfte, wusste ich, er würde kommen und mich retten. Nie, nicht in meinen schlimmsten Albträumen, hätte ich mir vorstellen können, ihn jemals so vor mir zu sehen.
Ich versuche, das Denken abzustellen, aber vergeblich. Sogar jetzt glimmt in meinem Herzen ein Funke Hoffnung, dass dieser Tag doch noch ein gutes Ende nimmt, dass wir den nächsten Sonnenaufgang gemeinsam erleben werden, in Freiheit.
Es ist eine dumme, gefährliche Hoffnung, aber sie flackert trotzdem auf.
Tränen brennen mir in den Augen, aber ich muss sie zurückhalten.
Er trägt seinen Magiestein nicht. Ihm den zu entreißen, wird das Erste gewesen sein, was die Männer des Kaisers bei Ampelios Ergreifung getan haben. Einem ungeübten Höfling kann ein einzelner Stein kaum genügend Wärme spenden, um ihm in einer kalten Winternacht Behaglichkeit zu verschaffen, doch Ampelio ist gesegnet. Ein einziger Magiestein würde ihm genügen, um diesen Palast bis auf die Grundmauern niederzubrennen.
»Das ist der berühmte Hüter Ampelio.« Der Kaiser zieht jedes Wort höhnisch in die Länge. »Du musst dich doch an ihn erinnern. Er hat in den Minen Verrat gesät und versucht, die Leute gegen mich aufzuwiegeln. Sogar den Aufruhr in der Luftmine letzte Woche hat er ausgelöst. Der Theyn hat ihn dort ganz in der Nähe aufgegriffen.«
»War es nicht ein Erdbeben, das den Aufruhr ausgelöst hat?« Die Worte sind mir entschlüpft, ehe ich mir auf die Zunge beißen kann. Sie klingen nicht wie meine. Oder vielmehr klingen sie nicht wie Thoras Worte.
Kaiser Corbinians Kiefermuskeln zucken. Ich schrecke innerlich zurück und mache mich auf einen Schlag gefasst, der aber nicht kommt. Noch nicht.
»Von ihm ausgelöst, vermuten wir, um weitere Leute für dein Begehr zusammenzuscharen.«
Auch dazu liegt mir eine scharfe Erwiderung auf der Zunge. Ich verkneife sie mir und setze eine ratlose Miene auf. »Mein Begehr, Euer Hoheit?«, frage ich. »Ich wüsste nicht, welches Begehr ich hätte.«
Sein Lächeln wird hämischer. »Selbstverständlich das Begehr, ›den dir gebührenden Platz als Königin von Astrea wieder einnehmen zu können‹, wie man so schön sagt.«
Ich schlucke. Diese Unterhaltung nimmt eine gänzlich unerwartete Wendung, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich ziehe die Peitsche diesem merkwürdigen neuen Spiel beinahe vor.
Ich senke den Blick. »Ich bin niemandes Königin und es gibt kein Astrea mehr. Dank der Gnade Eurer Hoheit bin ich nun eine Hofdame, Prinzessin in Sack und Asche. Dies ist der einzige Platz, der mir gebührt, und der einzige, den ich begehre.«
Ich kann Ampelio nicht ansehen, während ich den Spruch aufsage, der sich im Lauf der Jahre in mein Herz eingebrannt hat. Ich habe ihn schon so oft heruntergebetet, dass die Worte für mich keine Bedeutung mehr haben, aber sie nun vor ihm auszusprechen, lässt mich vor Scham erröten.
Der Kaiser nickt. »Meine Worte! Aber Astreaner sind störrische alte Mulis.«
Der Thronsaal bricht in Gelächter aus. Ich lache ebenfalls, aber ich muss mich mit aller Macht dazu zwingen.
Der Kaiser wendet sich Ampelio zu, seine höhnisch verzogene Miene drückt geheuchelte Anteilnahme aus. »Komm und verbeuge dich vor mir, Muli. Sag mir, wo ich deine Rebellen finde, und du darfst den Rest deiner Tage in einer der Minen verbringen.« Er grinst den gebrochenen Mann zu meinen Füßen an.
Tu es, möchte ich ihm zurufen. Gelobe ihm Treue. Überlebe. Wecke nicht den Zorn des Kaisers, dann lässt er dich leben. So lauten die Regeln.
»Ich verbeuge mich vor niemandem außer vor meiner Königin«, flüstert Ampelio, über die harten, kantigen Silben der kalovaxianischen Sprache stolpernd. Obwohl er leise spricht, trägt seine volle Stimme die Worte durch den Saal, gefolgt vom entsetzten Aufkeuchen und Gemurmel der Höflinge.
Er erhebt die Stimme. »Lang lebe Königin Theodosia Eirene Houzzara.«
Etwas in meinem Inneren zerbirst, und alles, was ich tief in mir verschlossen gehalten habe, jede Erinnerung, die ich unterdrückt, jeder Moment, den ich zu vergessen versucht habe – all das stürmt nun auf mich ein, und diesmal kann ich es nicht verhindern.
Theodosia. Ein Name, den ich zehn lange Jahre nicht gehört habe.
Theodosia. Ich höre meine Mutter mich so nennen, mir über die Haare streichen und meine Stirn küssen.
Du bist die einzige Hoffnung für unser Volk, Theodosia.
Ampelio hat mich immer Theo genannt, und wenn meine Kinderfrau Birdie ihn noch so sehr dafür gescholten hat. Ich sei seine Prinzessin, sagte sie, und Theo sei ein Name für einen schmutzstarrenden Gassenjungen. Doch Ampelio hörte nicht auf sie. Ich mag seine Prinzessin gewesen sein, aber darüber hinaus war ich auch noch etwas anderes.
Er hätte mich retten sollen, aber er tat es nicht. Zehn Jahre habe ich darauf gewartet, dass jemand kommt und mich befreit, und Ampelio war mein letzter Hoffnungsschimmer.
»Vielleicht antwortet er ja dir, Ascheprinzessin«, sagt der Kaiser.
Mein Schreck ist schwach, er wird vom Klang meines Namens übertönt, der noch wie ein Echo in meinem Kopf widerhallt. »Ich … ich würde mir nicht anmaßen wollen, solche Macht zu haben, Euer Hoheit«, bringe ich mühsam zustande.
Er verzieht den Mund zu einem Ausdruck, den ich nur allzu gut kenne. Dem Kaiser schlägt man keinen Wunsch ab.
»Ist das nicht der Grund, warum ich dich leben lasse? Damit du mir im Umgang mit starrköpfigem astreanischen Gesindel beistehst?«
Der Kaiser ist so gütig, mich zu verschonen, denke ich, aber dann dämmert mir erneut, dass er mich keineswegs aus Güte verschont. Er lässt mich leben, um Einfluss auf mein Volk nehmen zu können.
Meine Gedanken werden immer verwegener, und obwohl ich weiß, dass sie gefährlich sind, kann ich sie nicht länger zum Verstummen bringen. Und zum ersten Mal will ich es auch nicht.
Zehn Jahre warte ich nun schon auf Rettung, und alles was es mir eingebracht hat, ist ein von Narben übersäter Rücken und der Tod unzähliger Rebellen. Nach Ampelios Gefangennahme gibt es nichts mehr, das mir der Kaiser noch nehmen kann.
»Darf ich Astreanisch mit ihm sprechen?«, frage ich den Kaiser. »Vielleicht wird er dann etwas zugänglicher …«
Der Kaiser winkt ab und lässt sich auf dem Thron zurücksinken. »Solange es mir zu Antworten verhilft.«
Ich zögere, bevor ich mich vor Ampelio hinknie und seine zerschmetterten Hände in meine nehme. Obschon die astreanische Sprache verboten ist, werden einige bei Hof sie verstehen. Ich glaube kaum, dass mir der Kaiser sonst gestatten würde, sie zu sprechen.
»Gibt es noch andere?«, frage ich Ampelio. Die Worte klingen fremd aus meinem Mund, dabei war Astreanisch die einzige Sprache, die ich kannte, bevor die Kalovaxianer kamen. Sie haben sie mir genommen, sie per Dekret untersagt. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein astreanisches Wort über meine Lippen kam, aber ich beherrsche die Sprache noch, sie ist tiefer in mir verwurzelt, als ich dachte. Dennoch habe ich Mühe, sie weich und gedehnt klingen zu lassen, so ganz anders als die harte und kehlige Sprechweise der Kalovaxianer.
Er zögert und nickt dann. »Bist du hier sicher?«
Ich muss einen Moment überlegen, bevor ich antworte. »So sicher wie ein Schiff im Sturm.« Das astreanische Wort für Sturm – Signok – ist dem für Hafen – Signak – so ähnlich, dass nur ein geübtes Ohr den Unterschied heraushören kann. Aber möglich wäre es. Der Gedanke ist lähmend, doch ich schiebe ihn beiseite. »Wosinddie anderen?«, frage ich ihn.
Er schüttelt den Kopf und weicht meinem Blick aus. »Nirgendwo«, stößt er hervor, wobei er es auf eine Art ausspricht, dass es klingt wie »überall«.
Aber das ergäbe keinen Sinn. Hier leben sehr viel weniger Astreaner als Kalovaxianer – vor der Eroberung waren es nur hunderttausend. Die meisten sind jetzt Sklaven, auch wenn gemunkelt wird, es gäbe Verbündete in anderen Ländern. Es ist zu lange her, dass ich Astreanisch gesprochen habe, ich muss ihn wohl falsch verstanden haben.
»Wer?«, hake ich nach.
Ampelio heftet den Blick auf meinen Saum und schüttelt den Kopf. »Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Zeit ist reif, dass die Küken flügge werden. Der Morgen naht, bald ist’s so weit, dass die alten Krähen sterben.«
Mein Herz erkennt die Worte, bevor sie mein Verstand erfasst. Sie stammen aus einem alten astreanischen Wiegenlied. Meine Mutter pflegte es mir vorzusingen und ebenso meine Kinderfrau. Hat auch er mich damit in den Schlaf gesungen?
»Gib ihm irgendetwas, dann lässt er dich leben«, sage ich.
Ampelio lacht, aber es wird schnell ein Röcheln daraus. Er hustet und wischt sich mit dem Handrücken den Mund ab. Als er die Hand wieder sinken lässt, ist sie voller Blut.
»Was wäre das für ein Leben in der Gewalt eines Tyrannen?«
Es wäre ein Leichtes gewesen, etwas weniger deutlich zu sprechen und das Wort Tyrannen wie Drachen klingen zu lassen, das Wappenzeichen der kalovaxianischen Herrscherfamilie, aber Ampelio stößt die Silben mit solcher Heftigkeit in Richtung des Kaisers aus, dass selbst diejenigen, die kein Wort Astreanisch sprechen, ihre Bedeutung verstehen.
Der Kaiser beugt sich auf dem Thron vor, seine Finger umklammern die Lehnen so fest, dass die Knöchel weiß hervortreten. Er gibt einem der Männer aus seiner Leibwache ein Zeichen.
Der zieht sein Schwert und tritt an den bäuchlings daliegenden Ampelio heran. Er drückt ihm die Klinge in den Nacken und fügt ihm eine blutende Wunde zu, bevor er das Schwert hebt und zum tödlichen Schlag ausholt. Viel zu oft habe ich schon mitansehen müssen, wie dies anderen Rebellen angetan wurde, oder Sklaven, die ihren Herren nicht gehorcht haben. Der Kopf fällt niemals gleich beim ersten Hieb. Ich balle im Faltenwurf meines Kleides die Fäuste, um nicht unwillkürlich den Arm zu heben in dem Versuch, den Schlag abzuwehren. Für Ampelio gibt es jetzt keine Rettung mehr. Ich weiß es, aber ich kann es nicht fassen. Vor meinem geistigen Auge ziehen Bilder auf, und ich sehe den Dolch die Kehle meiner Mutter durchschneiden. Ich sehe Sklaven, die so lange ausgepeitscht werden, bis das Leben aus ihren Körpern weicht. Ich sehe auf dem Platz der Kapitale die Köpfe der Hüter auf Pfählen aufgespießt, bis sich die Krähen darüber hermachen. Ich habe Leute dafür hängen sehen, dass sie sich dem Kaiser widersetzten, dafür, dass sie den Mut aufbrachten, das zu tun, was ich nie gewagt habe.
Lauf!, will ich Ampelio zurufen. Kämpfe! Flehe! Bettle! Überlebe!
Aber er zuckt nicht vor dem Schwert zurück. Er streckt nur den Arm aus und umklammert meinen Fußknöchel. Seine Handfläche ist rau und vernarbt und klebrig vom Blut.
Bald ist’s so weit, dass die alten Krähen sterben. Aber ich kann nicht zulassen, dass mir der Kaiser noch einen lieben Menschen nimmt. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Ampelio stirbt. Ich kann nicht.
»Nein!« Meine Stimme kämpft sich einen Weg durch mein gespaltenes Ich.
»Nein?« Das sanft gesprochene Wort des Kaisers hallt durch die Stille und jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken.
Mein Mund ist trocken, und als ich etwas sage, klingt es wie ein Krächzen. »Ihr wolltet Euch barmherzig zeigen, wenn er redet, Euer Hoheit. Er hat geredet.«
Der Kaiser lehnt sich vor. »Ach, hat er das? Ich mag zwar kein Astreanisch sprechen, aber er wirkte nicht besonders entgegenkommend.«
Die Worte strömen über meine Lippen, bevor ich sie zurückhalten kann: »Er sagt, nach Euren erfolgreichen Bemühungen, die Rebellen zu vernichten, war ihm nur noch ein halbes Dutzend Mitstreiter geblieben. Er glaubt, diese Männer und Frauen haben bei dem Erdbeben in der Luftmine den Tod gefunden, aber sollte es dennoch Überlebende geben, wollen sie sich südlich der Englmar-Ruinen mit ihm treffen. Dort ist ein Zypressenhain.«
Darin liegt immerhin ein Körnchen Wahrheit. Früher habe ich jeden Sommer in diesem Wäldchen gespielt, während meine Mutter ihre alljährliche Besichtigung der Stadt vornahm, die im Jahr vor meiner Geburt von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden war. Fünfhundert Menschen hatten an jenem Tag ihr Leben lassen müssen, und bis zu der Eroberung durch die Kalovaxianer war dies die schlimmste Tragödie, die Astrea jemals widerfahren war.
Der Kaiser legt den Kopf schräg und schaut mich so forschend an, als könne er meine Gedanken lesen wie ein Buch. Ich möchte seinem Blick ausweichen, zwinge mich aber, ihm standzuhalten und meine eigene Lüge zu glauben.
Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt er der Leibwache neben sich ein Zeichen. »Nimm deine besten Männer. Man kann nie wissen, welche Magie diese Heiden haben.«
Der Mann nickt und eilt aus dem Saal. Ich hüte mich, eine Miene zu verziehen, auch wenn ich am liebsten vor Erleichterung weinen würde. Aber als der Kaiser seine kalten Augen wieder auf mich richtet, verwandelt sich diese Erleichterung in einen harten Klumpen und sinkt mir bleischwer in den Magen.
»Barmherzigkeit«, sagt er leise, »ist eine Tugend der Astreaner. Sie macht einen schwach, allerdings hatte ich gehofft, dich davor bewahrt zu haben. Aber vielleicht siegt am Ende doch immer das Blut, das man in den Adern hat.«
Er schnippt mit den Fingern und einer der Leibwächter zwingt mir den Griff seines Eisenschwertes in die Hände. Es ist so schwer, dass ich Mühe habe, es zu halten. Die Erd-Magiesteine an seinem Knauf funkeln im Licht und ihr starker Zauber löst in meiner Hand ein Kribbeln aus. Es ist das erste Mal seit der Eroberung, dass ich einen Magiestein berühren darf, von einer Waffe ganz zu schweigen. Früher einmal hätte ich mich darüber gefreut – wie über alles, das mir das Gefühl von ein klein wenig Stärke verliehen hätte –, aber nun verkrampfen sich meine Eingeweide, als ich Ampelio zu meinen Füßen liegen sehe und mir klar wird, was der Kaiser von mir erwartet.
Ich hätte nicht das Wort ergreifen dürfen. Ich hätte nicht versuchen dürfen, ihn zu retten. Denn es gibt etwas noch viel Schlimmeres, als das Licht in den Augen des einzigen Menschen erlöschen zu sehen, der mir noch geblieben ist – und das ist, ihm eigenhändig das Schwert in den Körper zu stoßen.
Bei dem Gedanken dreht sich mir der Magen um und Übelkeit steigt in mir auf. Ich umklammere das Schwert, bemühe mich Haltung zu bewahren und Theodosia sogar noch tiefer in mir zu vergraben, bevor ich ebenfalls mit einem Schwert im Nacken ende. Aber diesmal gelingt es mir nicht. Es übersteigt meine Kräfte, der Schmerz ist zu tief, der Hass zu stark, als dass er sich noch länger unterdrücken ließe.
»Vielleicht war es ein Fehler, dein Leben zu verschonen.« Der Tonfall des Kaisers ist gleichmütig, aber das macht die Drohung nur umso deutlicher. »Verräter verdienen keine Gnade, weder von mir noch von den Göttern. Du weißt, was zu tun ist.«
Ich höre ihn kaum. Auch sonst höre ich kaum etwas. Mir rauscht das Blut in den Ohren, meine Gedanken verschwimmen, mein Blickfeld verengt sich, bis ich nur noch Ampelio zu meinen Füßen wahrnehme.
»Ist das wirklich notwendig, Vater?« Prinz Søren tritt vor. Die Besorgnis in seiner Stimme verblüfft mich, aber ebenso die Festigkeit darin. Noch nie hat jemand dem Kaiser widersprochen. Die Höflinge sind ebenso überrascht wie ich, und es setzt ein Flüstern und Raunen ein, das erst abbricht, als der Kaiser laut und vernehmlich mit den Händen auf die Thronlehnen schlägt.
»Ja«, knurrt er gereizt und lehnt sich vor. Sein Gesicht ist hochrot, ob vor Wut über seinen Sohn oder aus Verlegenheit darüber, von ihm infrage gestellt zu werden, ist schwer zu sagen. »Es istnotwendig. Lass es dir ebenfalls eine Lehre sein, Søren. Barmherzigkeit hat die Astreaner ihr Land gekostet, aber wir sind nicht so schwach.«
Aus seinem Mund klingt das Wort schwach wie ein Schimpfwort – für die Kalovaxianer gibt es keine schlimmere Beleidigung. Prinz Søren zuckt zusammen, seine Wangen färben sich nun gleichfalls rot. Er schlägt die Augen nieder und tritt einen Schritt zurück.
Ampelio zu meinen Füßen erschaudert, seine Hand um meinen Knöchel zuckt.
»Bitte, meine Königin«, sagt er auf Astreanisch.
Ich bin nicht deine Königin, will ich schreien. Ich bin deine Prinzessin und du hättest mich retten sollen.
»Bitte«, wiederholt er. Aber es gibt nichts, das ich für ihn tun kann. Ich habe Dutzende Männer vor ihm schon für weitaus weniger sterben sehen. Es war töricht zu glauben, dass er verschont werden würde, selbst wenn meine Worte wahr gewesen wären. Ich könnte den Kaiser anflehen, bis ich heiser wäre, es würde nichts nützen. Ich würde nur ebenfalls mit einer Klinge im Rücken enden.
»Bitte«, sagt Ampelio wieder, bevor er in ein so schnelles Astreanisch verfällt, dass ich Mühe habe, ihm zu folgen. »Oder er wird auch dich töten. Auf mich wartet das Danach. Zeit, deine Mutter wiederzusehen. Aber deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du wirst es tun. Du wirst leben. Du wirst kämpfen.« Und ich verstehe. Ich wünschte beinahe, ich täte es nicht. Sein Segen ist eine eigene Art von Fluch.
Nein. Ich kann es nicht. Ich kann keinen Menschen töten. Ich kann ihn nicht töten. Ich bin nicht der Kaiser, ich bin nicht der Theyn, ich bin nicht Prinz Søren. Ich bin … Etwas tief in meinem Inneren verändert sich. Theodosia hat mich Ampelio genannt. Ein Name, der von Stärke zeugt – es ist der Name, den mir meine Mutter gab. Der Name einer Königin. Ich habe nicht das Gefühl, ihn zu verdienen, aber ich stehe hier allein. Wenn ich überleben will, muss ich die Stärke aufbringen, diesem Namen gerecht zu werden.
Ich muss jetzt Theodosia sein.
Meine Hände beginnen zu zittern, als ich das Schwert hebe. Ampelio hat recht: Irgendjemand wird es tun; entweder ich oder einer der Männer aus der Leibgarde des Kaisers, nur werde ich es so schnell und schmerzlos wie möglich für ihn machen. Ist es besser, von jemandem getötet zu werden, der einen hasst, oder von jemandem, der einen liebt?
Durch das ehemals weiße, nun blutgetränkte dünne zerfetzte Hemd hindurch spüre ich seine Rückenwirbel. Die Klinge passt zwischen die beiden Rippenbögen unter seinen Schulterblättern. Es wird so sein, als schneide ich durch ein Stück Fleisch, sage ich mir, aber ich weiß schon jetzt, dass es keineswegs so sein wird.
Er dreht den Kopf so, dass wir uns in die Augen sehen. Es liegt etwas so Vertrautes in seinem Blick, dass es mir das Herz abschnürt und das Atmen unmöglich macht. Ich habe keinen Zweifel mehr. Dieser Mann ist mein Vater.
»Du bist das Kind deiner Mutter«, flüstert er.
Ich reiße meine Augen von ihm los und richte sie stattdessen auf den Kaiser, seinem Blick standhaltend. »Auf Biegen und Brechen!«, zitiere ich klar und deutlich die Losung der Kalovaxianer, bevor ich Ampelio das Schwert in den Rücken stoße, durch Haut, Muskeln und Knochen hindurch mitten ins Herz hinein. Sein Körper ist so schwach, schon so geschunden, dass es beinahe leicht geht. Blut schießt empor und ergießt sich über mein Kleid.
Ampelio zuckt und stößt einen schwachen Schrei aus, bevor er erschlafft. Seine Hand gleitet von meinem Knöchel ab, doch ich spüre noch den blutigen Abdruck, den sie hinterlässt. Ich ziehe das Schwert aus seinem Körper und gebe es der Leibwache zurück. Innerlich taub. Zwei weitere Wachen treten vor, um den Leichnam fortzuschaffen, eine blutige Spur hinterlassend.
»Bringt den Toten auf den Platz der Kapitale und hängt ihn dort für alle gut sichtbar auf. Jeder, der versucht, ihn herunterzunehmen, wird ihm Gesellschaft leisten.« Nach diesem Befehl wendet sich der Kaiser wieder mir zu. Sein Lächeln bringt mein Inneres zum Sieden wie heißes Öl. »Braves Mädchen.«
Blut durchtränkt mein Kleid und besudelt meine Haut. Ampelios Blut. Das Blut meines Vaters. Ich versinke in einen Hofknicks vor dem Kaiser, mein Körper bewegt sich ganz ohne mein Zutun.
»Säubert Euch, Lady Thora. Heute Abend gibt es ein Bankett, um den Sturz von Astreas bedeutendstem Rebellen zu feiern, und Ihr, meine Liebe, werdet der Ehrengast sein.«
Ich deute einen weiteren Knicks an und neige den Kopf. »Selbstverständlich, Euer Hoheit. Ich freue mich schon darauf.«
Die Worte fühlen sich nicht an wie meine eigenen. Ich bin so aufgewühlt, dass es mich wundert, dass ich überhaupt Worte finde. Ich möchte schreien. Ich möchte weinen. Ich möchte dieses blutige Schwert erneut an mich reißen und es dem Kaiser in die Brust rammen, auch wenn ich dabei sterben sollte.
»Deine Zeit ist noch nicht gekommen«, wispert Ampelios Stimme in meinem Kopf. »Du wirst leben. Du wirst kämpfen.«
Die Worte trösten mich nicht. Ampelio ist tot und mit ihm meine letzte Hoffnung auf Rettung.
Theodosia
Ich bin keine zehn Schritte den Korridor hinunter, als eine Hand meine Schulter umfasst und mich zurückhält. Ich will laufen, laufen, laufen, bis ich alleine bin und endlich schreien und weinen kann, bis wieder nur noch Leere in mir ist. Du wirst leben. Du wirst kämpfen. Ampelios Worte geistern mir durch den Kopf, aber ich bin keine Kämpferin. Ich bin ein ängstlicher Schatten meiner selbst. Ein zitterndes Bündel, gebrochen an Körper und Geist. Ich bin eine Gefangene.
Ich drehe mich um und stehe Prinz Søren gegenüber. Ein Anflug von Sorge durchbricht seine ausdruckslose Miene. Seine Hand, mit der er mich aufgehalten hat, ruht nun leicht auf meiner Schulter, Innenfläche und Fingerspitzen sind verblüffend rau.
»Euer Hoheit.« Ich achte sorgsam darauf, meine Stimme ruhig zu halten, um den Sturm, der in mir tobt, zu verbergen. »Wünscht der Kaiser noch etwas von mir?«
Der Gedanke müsste mich mit Grauen erfüllen, aber ich fühle nichts. Vermutlich, weil ich nichts mehr habe, das er mir noch nehmen kann.
Prinz Søren schüttelt den Kopf. Er nimmt die Hand von meiner Schulter und räuspert sich.
»Seid … seid Ihr wohlauf?« Seine Stimme klingt angespannt, und ich frage mich, wann er wohl zuletzt mit einem Mädchen gesprochen hat.
»Aber natürlich, Euer Hoheit.« Es fühlt sich nicht so an wie etwas, das ich gesagt habe. Denn ich bin nicht wohlauf. In mir tobt ein Orkan.
Meine Hände beginnen zu zittern, und ich verstecke sie im Faltenwurf meines Kleides, damit es der Prinz nicht bemerkt.
»War es das erste Mal, dass Ihr jemanden getötet habt?«, fragt er. Er muss die Panik in meinen Augen aufblitzen sehen, denn er spricht hastig weiter. »Ihr habt es gut gemacht. Es war ein sauberer Tod.«
Wie kann er sauber gewesen sein, wenn es so viel Blut gab? Ich könnte tausendmal ein Bad nehmen und würde das Blut noch immer auf meiner Haut spüren.
Ampelios Stimme echot durch meinen Kopf. Du bist das Kind deiner Mutter.Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Zeit ist reif, dass die Küken flügge werden. Du wirst kämpfen. Meine Königin.
Eine Erinnerung drängt an die Oberfläche, und dieses Mal versuche ich nicht, sie zu unterdrücken: Ich spüre Ampelios Hand um meine, als er mit mir zu den Ställen ging. Ich sehe ihn mich hochheben und auf sein Pferd setzen, sodass ich ihn jauchzend himmelhoch überragte. Die Stute hieß Thalia und fraß gern Honigbonbons. Ich spüre seine schützende Hand auf meinem Rücken – spüre, wie sich das Schwert in seinen Rücken bohrt.
Übelkeit steigt in mir auf, aber ich zwinge sie hinunter. »Es freut mich, dass Ihr es so seht«, bringe ich mühsam zustande.
Einen Moment lang scheint es, als wolle er noch eine Frage stellen, aber er bietet mir lediglich seinen Arm an. »Darf ich Euch zu Eurem Gemach geleiten?«
Ich kann es dem Prinzen nicht verwehren, obwohl ich es möchte. Ich bin innerlich zerrissen und habe keine Ahnung, wie ich lächeln und etwas anderes vorschützen soll. Thora ist von viel schlichterem Gemüt als ich. Sie ist ein geistloses Geschöpf ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Ohne Wünsche. Ohne Zorn. Sie besteht nur aus Angst. Und aus Gehorsam.
»An meinem zehnten Geburtstag«, durchbricht Prinz Søren unvermittelt meine Grübeleien, »brachte mich mein Vater zu den Verliesen und schenkte mir ein neues Schwert. Er ließ zehn Gefangene heraustreten – astreanisches Gesindel – und zeigte mir, wie man ihnen die Kehle durchschneidet. Er erledigte den ersten, um es mir vorzuführen. Ich erledigte die anderen neun.«
Astreanisches Gesindel.
Die Worte nagen an mir, obwohl ich schon schlimmere Beschimpfungen für meine Landsleute gehört habe. Ich habe sie unter den stets wachsamen Augen des Kaisers schon übler beschimpft und so getan, als wäre ich keine von ihnen. Ich habe sie verhöhnt und über die grausamen Scherze des Kaisers gelacht. Ich habe versucht, mich von ihnen zu distanzieren und so getan, als würde ich nicht zu ihnen gehören, obschon wir doch den gleichen olivbraunen Teint und die gleiche dunkle Haarfarbe haben. Sogar sie nur anzusehen, habe ich mich gescheut. Während sie versklavt und geschlagen wurden und wie Tiere abgeschlachtet, nur um einem verwöhnten Prinzen eine Lektion zu erteilen.
Nachdem Ampelio tot ist, gibt es auch für sie keine Rettung mehr.
Wieder spüre ich Übelkeit in mir aufsteigen, aber diesmal kann ich sie nicht hinunterzwingen. Ich bleibe stehen und übergebe mich, mein Mageninhalt ergießt sich in einem Schwall über den Anzug des Prinzen. Er springt unwillkürlich zurück und für einen quälend langen Moment können wir uns nur stumm anstarren. Ich müsste mich bei ihm entschuldigen, ihn um Verzeihung bitten, bevor er seinem Vater erzählt, wie schwach und widerwärtig ich bin. Aber ich kann mir nur die Hand vor den Mund halten und hoffen, dass nicht noch mehr hochkommt.
Die Empörung in seinen Augen schwindet und weicht etwas, das Mitleid sein könnte. Er versucht nicht, mich aufzuhalten, als ich mich umdrehe und den Korridor entlang davoneile.
Sogar allein in meinem Gemach, ausgestreckt auf meinem Bett, darf ich meinen Gefühlen nicht freien Lauf lassen. Ich kann hinter den Mauern meine Bewacher hören, wie sie sich in ihren Kammern niederlassen, die der Kaiser nach der Eroberung errichten ließ: das Klacken ihrer Stiefel auf dem Steinboden, das Rasseln ihrer Schwerter, die sie polternd ablegen. Meine Bewacher sind immer da und beobachten mich durch drei daumenbreite Löcher in den Wänden. Selbst wenn ich schlafe, selbst wenn ich bade oder schreiend aus Albträumen hochschrecke, an die ich mich nur vage erinnere. Sie folgen mir überallhin, aber ich sehe niemals ihre Gesichter, noch höre ich ihre Stimmen. Der Kaiser bezeichnet sie spöttisch als meine Schatten. Der Name hat sich so eingebürgert, dass auch ich sie insgeheim so nenne.
Sie werden sich totlachen über mich. Die kleine Ascheprinzessin erbricht sich wegen ein bisschen Blut, noch dazu über den Prinzen! Wem von ihnen wohl die Ehre gebührt, die Geschichte dem Kaiser zu erzählen? Keinem vermutlich. Der Prinz persönlich wird sie ihm brühwarm auftischen und der Kaiser dürfte sehr bald von meiner Schwäche wissen. Und sich umso mehr anstrengen, sie mir auszutreiben. Diesmal könnte es ihm gelingen und was wird dann noch von mir übrig sein?
Meine Tür öffnet sich und ich setze mich auf. Es ist Hoa, meine Zofe. Sie sieht mich nicht an, sondern konzentriert sich darauf, die Knöpfe am Rücken meines blutbefleckten Kleides aufzuknöpfen. Ich höre sie erleichtert aufatmen, als ihr klar wird, dass das Blut diesmal nicht meins ist. Kühle Luft trifft auf meine Haut, als das Kleid herunterfällt, und ich wappne mich gegen den Schmerz, während mir Hoa die Verbände vom Rücken zieht. Behutsam tastet sie mit ihren zarten Fingern meine Striemen ab, um sich zu vergewissern, dass sie gut verheilen. Nachdem sie zufrieden ist, tupft sie Salbe aus einem Behältnis auf, das ihr Ion gegeben hat, und legt mir frische Verbände an.
Weil man mir keine astreanische Sklavin anvertrauen kann, gab mir der Kaiser stattdessen Hoa. Angesichts ihrer hellen, golden schimmernden Haut und der glatten schwarzen Haare, die ihr bis zur Taille fallen, vermute ich, dass sie aus einem der Länder im Osten stammt, in die Kalovaxianer vor der Eroberung Astreas einfielen, aber sie hat mir nie verraten, welches es ist. Sie könnte es gar nicht, selbst wenn sie wollte, denn der Kaiser hat ihr den Mund zunähen lassen. Dickes dunkles Garn verschließt ihre Lippen in vier Kreuzstichen von einem Mundwinkel zum anderen. Alle paar Tage wird es für eine Mahlzeit herausgenommen, bevor man ihr die Lippen erneut zunäht. Gleich nach der Eroberung hatte ich eine astreanische Zofe. Sie war fünfzehn und hieß Felicie. Für mich war sie wie eine Schwester, und als sie mir erzählte, sie habe einen Fluchtplan ausgeheckt, folgte ich ihr ohne Zögern, fest davon überzeugt, dass nun alle meine Träume von Rettung in Erfüllung gehen würden. Ich glaubte sogar, dass meine Mutter noch am Leben wäre und irgendwo auf mich wartete.
Ich war eine Närrin.
Statt in die Freiheit führte mich Felicie geradewegs zum Kaiser, genau wie er es ihr befohlen hatte.
Er höchstpersönlich verabreichte mir zehn Peitschenhiebe und schnitt Felicie anschließend die Kehle durch, da er nun keine Verwendung mehr für sie habe, wie er mir erklärte. Er sagte, es gehe darum, mir eine Lektion zu erteilen, die meine Striemen überdauern würde, und ich nehme an, das tat sie. Sie hat mich gelehrt, niemandem zu vertrauen. Nicht einmal Cress.
Hoa nimmt mein blutbeflecktes Kleid in ihre Arme und deutet mit dem Kinn zur Waschschüssel, eine stumme Aufforderung, mich zu säubern. Dann verlässt sie den Raum, um das Kleid zu reinigen.
Nachdem sie gegangen ist, setze ich mich an meinen Waschtisch und spüle mir den Mund mit Wasser aus, um den ekligen Geschmack von Erbrochenem loszuwerden. Anschließend tauche ich meine Hände in die Schüssel, um die Blutflecken abzuwaschen. Das Blut meines Vaters. Mein Blut.
Wieder habe ich das Gefühl, mich übergeben zu müssen, aber ich zwinge mich dazu, so lange tief ein- und auszuatmen, bis die Übelkeit vergeht. Die Blicke meiner Schatten lasten auf mir. Sie lauern nur darauf, dass ich zusammenbreche, um es anschließend dem Kaiser berichten zu können.
Im Spiegel über dem Waschtisch sehe ich noch genauso aus wie heute Morgen. Das Haar nach der Mode der Kalovaxianer zu Locken gedreht und hochgesteckt, das Gesicht hell gepudert, die Augen mit Kohle umrahmt und die Lippen rot gefärbt. Alles ist unverändert, nur ich nicht.
Ich nehme das schmale weiße Handtuch, das über dem Schüsselrand hängt, tauche es ins Wasser und reibe mir damit das Gesicht ab. Ich schrubbe, bis all der Puder und die Farben das Handtuch verfärben. Hoa hat heute Morgen fast eine Stunde gebraucht, um mir das Ganze aufzutragen, aber es abzuwaschen, dauert keine Minute.
Das Gesicht meiner Mutter blickt mir aus dem Spiegel entgegen. Ihre Sommersprossen tanzen wie eine unbekannte Sternkonstellation über meine Nase und Wangen. Ihre olivfarben getönte Haut schimmert wie Topas im Kerzenlicht. Ihre Haare glänzen in einem dunklen Mahagonibraun, auch wenn meine Mutter ihre Haare stets offen trug und nie so streng aus dem Gesicht zurückgekämmt wie ich meine. Die Augen sind allerdings nicht ihre. Vielmehr sind es Ampelios dunkle haselnussbraune Augen, die mich anstarren, groß und ausdrucksvoll, unter langen, dichten Wimpern hervor.
Obschon all dies Makel sind, die ich dem kalovaxianischen Schönheitsempfinden gehorchend verberge, erinnere ich mich, wie die Menschen die Schönheit meiner Mutter priesen, ihr zu Ehren Gedichte schrieben und Lieder sangen.
Ich blinzle und sehe das Messer des Theyn an meine Kehle – an die Kehle meiner Mutter gepresst. Ich spüre das Eindringen der Klinge, sehe Blutstropfen hervorquellen. Ich blinzle erneut. Ich bin es nur. Bloß ein gebrochenes Mädchen.
Theodosia Eirene Houzzara. Der Name geistert mir wieder durch den Kopf, gefolgt von den letzten Worten meiner Mutter.
Würde sie mir vergeben, dass ich Ampelio getötet habe? Würde sie verstehen, warum ich es tat? Oder wendet sie sich im Danach von mir ab?
Er ist jetzt bei ihr, ich muss das glauben. Er ist bei ihr, weil er sein Leben gegeben hat, um mich zu retten, auch wenn es ungerecht ist. Er hat für Astrea alles riskiert, während ich nichts getan habe, außer zu versuchen, das Scheusal zu besänftigen, das uns vernichtet hat.
Ich kann das Spiel des Kaisers nicht mehr mitspielen. Ich kann nicht seinen Regeln folgen und ihn bei Laune halten, während mein Volk in Ketten geht. Ich kann nicht mit Crescentia lachen und über Gedichte plaudern. Ich kann nicht länger in ihrer harten grässlichen Sprache reden. Ich kann nicht auf einen Namen hören, der nicht derjenige ist, den mir meine Mutter gab.