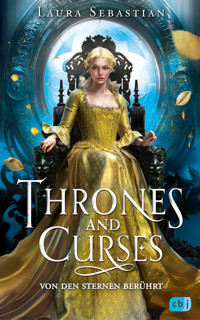9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die ASH PRINCESS-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Ash Princess ist tot. Lang lebe die Fire Queen! Das große Finale der romantischen Fantasy-Trilogie von Laura Sebastian.
Theodosia steht kurz davor, als Königin ihr Volk aus der Sklaverei zu befreien. Doch sie muss sich einer traurigen Wahrheit stellen: Ihre einst engste Freundin Cress ist zur neuen Kaiserin von Astrea aufgestiegen. Um ihren Herrschaftsanspruch zu legitimieren, ist die Kaiserin bereit, alle Konkurrenten zu vernichten, auch Prinz Søren, den sie in ihre Gewalt gebracht hat. Die beiden Rivalinnen ziehen gegeneinander in die Schlacht, und sie kämpfen nicht nur um denselben Thron, sondern auch um denselben Mann. Nur wenn Theo lernt, ihre Feuermagie zu beherrschen, wird sie als Königin über Astrea herrschen …
Die »ASH PRINCESS«-Saga bei Blanvalet:
1. ASH PRINCESS
2. LADY SMOKE
3. EMBER QUEEN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Laura Sebastian
Aus dem amerikanischen Englisch von Dagmar Schmitz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Laura Sebastian
Translated from the English language:
First published as »Ember Queen« in the United States by
Delacorte Press, an imprint of Penguin Random House US
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2020
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Übersetzung: Dagmar Schmitz
Redaktion: Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Covermotiv: Shutterstock.com (Azer Merz; Ironika; SayHope; Tithi Luadthong)
Karte: © 2020 by Isaac Stewart
TP · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21413-5V003www.cbj-verlag.de
FÜR ALL DIE MÄDCHEN,
die sich nie stark genug gefühlt haben, die Heldin ihrer eigenen Geschichte zu sein.
Ihr seid es.
Prolog
Die ersten sechs Jahre meines Lebens hatte ich vor dem Thron meiner Mutter Angst, wie andere Kinder Angst vor Ungeheuern haben, die unter ihrem Bett lauern. Er bot einen furchterregenden Anblick: ein wuchtiger Koloss – groß und schwarz, bedrohlich und scharfkantig, gemeißelt in Form von Flammen, die an demjenigen emporzuzüngeln schienen, der darauf saß. Ich weiß noch, dass ich felsenfest davon überzeugt war, dass man sich verbrennen würde, wenn man ihn berührte.
Tagtäglich sah ich meine Mutter auf diesem Thron sitzen und glaubte, dass er sie dort festhielt, indem er seine Obsidian-Finger in ihr Fleisch krallte. Ich beobachtete, wie er sie in jemand anderen verwandelte, in jemanden, den ich nicht kannte. Verschwunden war die Frau, die der Mittelpunkt meiner Welt war, meine Mutter, die Frau der sanften Töne, die mich auf die Stirn küsste und mich auf den Schoß nahm, die mich allabendlich in den Schlaf sang. Auf dem Thron nahm eine Fremde ihren Körper in Besitz, ihre Stimme hatte einen Donnerhall, ihr Rücken war kerzengerade aufgerichtet. Sie sprach gewählt und gebieterisch ohne den Hauch eines Lächelns in ihrer Stimme. Wenn sie der Thron endlich freigab, war sie erschöpft.
Jetzt, da ich älter bin, ist mir klar, dass der Thron nicht das Ungeheuer war, für das ich ihn hielt. Ich weiß, er hat sie nicht wirklich dort festgehalten. Mir ist bewusst, dass sie immer noch sie selbst war, wenn sie auf dem Thron saß. Aber ich denke auch, dass ich in gewisser Weise recht hatte. Sie war auf diesem Thron nicht ganz derselbe Mensch wie sonst, wenn sie nicht darauf saß.
Sonst gehörte meine Mutter nur mir allein; saß sie auf diesem Thron, gehörte sie allen.
Überlegungen
Die Sonne ist gleißend hell, als ich auf schwachen Beinen aus dem Höhleneingang trete. Ich hebe den Arm, um meine Augen abzuschirmen, aber schon diese kleine Bewegung fällt mir unsagbar schwer und schmerzt so heftig, dass mir schwindelig wird. Meine Knie geben nach, und der Boden kommt mir entgegen, hart und felsig. Es tut weh, aber es fühlt sich unendlich gut an zu liegen, frische Luft einzusaugen, Licht zu haben, auch wenn es alles zu viel auf einmal ist.
Mein Hals ist so trocken, dass mir sogar das Atmen Schmerzen verursacht. An meinen Fingern klebt verkrustetes Blut, ebenso auf meinen Armen, in meinen Haaren. Vage ist mir bewusst, dass es mein Blut ist, aber ich kann nicht sagen, woher es kommt. Meine Erinnerung ist eine Wüste – ich weiß noch, dass ich in die Höhle getreten bin, erinnere mich, die Stimmen meiner Freunde gehört zu haben, die mich anflehten zurückzukommen. Und dann … Nichts.
»Theo«, ruft jemand.
Die Stimme ist mir vertraut, aber sehr weit weg. Tausend Schritte hämmern auf den Boden, jeder einzelne bringt meinen Kopf zum Pochen. Ich versuche, mich vor dem Lärm zu schützen, und rolle mich zusammen. Hände berühren meine Haut, meine Handgelenke, ertasten den Puls hinter meinem Ohr. Die Hände sind so kalt, dass ich Gänsehaut bekomme.
»Ist sie …«, fragt die Stimme.
Es ist Blaise. Ich versuche, seinen Namen auszusprechen, aber es kommt nichts heraus.
»Sie lebt, aber ihr Puls ist schwach, und sie fühlt sich glühend heiß an«, sagt eine andere Stimme. Heron. »Wir müssen sie hineinbringen.«
Arme heben mich hoch und tragen mich. Es sind Herons Arme, glaube ich. Wieder versuche ich zu sprechen, bringe aber keinen Ton hervor.
»Nimm deinen Umhang und bedecke ihren Kopf damit, Art.« Herons Brustkorb an meiner Wange brummt bei jedem Wort. »Ihre Augen sind äußerst lichtempfindlich.«
»Ja, ich erinnere mich noch gut, wie es war«, sagt Art. Stoff raschelt. Ihr Umhang legt sich über meine Augen und hüllt meine Welt wieder in Dunkelheit. Ich lasse mich in die Schwärze hineinfallen. Meine Freunde halten mich, ich bin in Sicherheit.
Als ich das nächste Mal die Augen öffne, liege ich auf einer Pritsche in einem Zelt, das Gleißen der Sonne wird durch das dichte weiße Leinen des Zeltstoffes gedämpft, sodass es einigermaßen erträglich ist. Das Hämmern in meinem Kopf ist zwar noch da, aber es ist nun dumpfer und weiter weg. Mein Hals ist nicht mehr so trocken und rau, und wenn ich mich konzentriere, habe ich eine verschwommene Erinnerung daran, dass Artemisia Wasser in meinen geöffneten Mund fließen lässt. Wo sie ihn verfehlt hat, ist das Kissen unter meinem Kopf noch feucht.
Jetzt bin ich allerdings allein.
Ich zwinge mich dazu, mich aufzusetzen, auch wenn es die Schmerzen verschlimmert, die ich in jeder Faser meines Körpers spüre. Die Kalovaxianer werden früher oder später zurückkehren, und wer weiß, wie lange Cress Søren am Leben lassen wird. Es ist so viel zu tun und nicht annähernd genug Zeit dafür.
Ich stelle die nackten Füße auf den Erdboden und schiebe mich in den Stand hoch. Während ich noch im Begriff bin aufzustehen, wird die Zeltklappe zurückgeschlagen, und Heron tritt ein, er muss sich ducken, damit seine hochgewachsene Gestalt durch die niedrige Öffnung passt. Als er sieht, dass ich wach bin und auf den Beinen, stutzt er und blinzelt ein paarmal, um sich zu vergewissern, dass er nicht träumt.
»Theo.« Er sagt es so langsam, als wolle er sich den Klang meines Namens auf der Zunge zergehen lassen.
»Wie lange ist es her, seit ich in die Mine gegangen bin?«, frage ich leise.
Heron mustert mich einen Moment. »Zwei Wochen.«
Das haut mich so um, dass ich mich wieder auf die Pritsche setzen muss. »Zwei Wochen«, echoe ich. »Es kam mir vor wie Stunden, Tage höchstens.«
Das scheint Heron nicht zu wundern. Wie sollte es auch? Er hat schließlich das Gleiche durchgemacht.
»Erinnerst du dich daran, ob du geschlafen hast?«, erkundigt er sich. »Oder etwas gegessen oder getrunken? Das müsstest du eigentlich irgendwann, sonst wärst du jetzt in weitaus schlimmerer Verfassung.«
Ich schüttele den Kopf und versuche zusammenzubringen, woran ich mich erinnere, aber nur sehr wenig davon verdichtet sich zu etwas Greifbarem, das sich festhalten lässt. Einzelne Fragmente, Gespenstergestalten, die unmöglich echt gewesen sein können, Feuer, das durch meine Adern strömt. Aber mehr auch nicht.
»Ihr hättet mich dort zurücklassen sollen«, sage ich. »Zwei Wochen … Cress’ Armee könnte jeden Tag wieder hier sein und Søren …«
»… lebt, nach allem, was man hört«, fällt mir Heron ins Wort. »Und die Kalovaxianer haben keinen Befehl, hierher zurückzukehren.«
Ich starre ihn an. »Woher willst du das wissen?«
Er zieht seine Schulter zu einem schiefen Achselzucken hoch. »Spione«, sagt er, als läge die Antwort auf der Hand.
»Wir haben keine Spione«, erwidere ich gedehnt.
»Wir hatten keine. Aber dann erreichte uns die Nachricht, dass sich der neue Theyn in seinem Landhaus aufhält, zwei Tagesritte von hier. Wir konnten mehrere seiner Sklaven überreden, ihn für uns zu bespitzeln, bevor sie wieder alle in die Kapitale zurückkehren. Vorhin haben wir unser erstes Schreiben erhalten. Demnach hat der Theyn bisher keine Truppen zurückbeordert. Außerdem ist die Mehrheit unserer Streitkräfte bereits abgezogen. Es sind nur noch Blaise, Artemisia, Erik, Drachenfluch und ich übrig, außerdem eine Gruppe Verletzter, die sich noch von der Schlacht erholen. Aber selbst die werden in ein oder zwei Tagen von Drachenfluchs Flotte in Sicherheit gebracht.«
Ich höre kaum hin, weil ich noch versuche, die Sache mit den Spionen zu verarbeiten. Ich kann an nichts anderes denken als an Elpis und daran, was das letzte Mal geschehen ist, als ich jemanden zum Spitzel gemacht habe.
»Dem Einsatz von Spionen habe ich nicht zugestimmt.«
»Du bist in die Mine gegangen, einen Tag bevor der Plan ausgeheckt wurde«, hält mir Heron in gleichmütigem Tonfall entgegen. »Du warst nicht da, um deine Zustimmung zu geben, und wir hatten keine Zeit abzuwarten, bis du zurückkehrst. Wir wussten ja nicht einmal, ob du überhaupt zurückkehren würdest.«
Mir erstirbt eine scharfe Erwiderung auf der Zunge und ich schlucke sie herunter. »Aber wenn sie dabei ums Leben kommen …«
»… wird es ein unvermeidliches Risiko gewesen sein«, führt Heron den Satz zu Ende. »Das wussten sie, als sie sich dazu bereit erklärt haben. Außerdem heißt es, die Kaiserin würde nicht so stark unter Verfolgungswahn leiden wie der Kaiser. Sie hält dich für tot, in uns sieht sie keine Bedrohung mehr, und sie hat Søren in ihrer Gewalt. Sie denkt, sie hätte gesiegt, und wird nachlässig.«
Die Kaiserin. Ob jemals der Tag kommen wird, an dem ich zuerst an Cress denke und nicht an Kaiserin Anke, wenn ich diesen Titel höre?
»Du hast gesagt, unsere Streitkräfte seien abgezogen«, hake ich nach. »Wohin?«
Heron atmet tief durch. »Dir ist einiges an Gezänk erspart geblieben, während du weg warst. Beinahe beneide ich dich darum. Der Häuptling von Vecturia hat uns seine Tochter Maile mit seinen Truppen zu Hilfe geschickt. Ohne Søren sind Erik und sie diejenigen mit der meisten Kampferfahrung, aber die beiden können sich über nichts einig werden. Erik möchte auf direktem Weg zur Kapitale marschieren, um die Stadt einzunehmen und Søren zu befreien.«
»Das ist töricht.« Ich schüttele den Kopf. »Genau damit werden sie rechnen, und selbst wenn nicht, haben wir nicht genug Leute für diese Art von Belagerung«
»Genau das hat Maile auch gesagt«, erwidert Heron gleichfalls kopfschüttelnd. »Sie meinte, wir sollten uns zur Erd-Mine aufmachen.«
»Aber das können wir nicht, ohne an den am dichtesten besiedelten Ortschaften vorbeizumarschieren, und das ohne jegliche Deckung durch Wälder oder Gebirge«, sage ich. »Wir würden unweigerlich entdeckt werden, und dann wartet Cress mit einer Armee auf, die uns an der Erd-Mine empfängt.«
»Das hat Erik auch gesagt«, erwidert Heron. »Du siehst, die Lage ist verzwickt.«
»Und wer hat sich durchgesetzt?«, frage ich.
»Niemand«, antwortet Heron. »Es wurde beschlossen, dass wir unsere Streitkräfte in die Dörfer entlang des Flusses schicken. Keine von den Ortschaften am Savria ist besonders dicht besiedelt, daher werden wir imstande sein, die dort wohnenden Kalovaxianer zu überwältigen, ihre Sklaven zu befreien und sie unseren Streitkräften hinzuzufügen sowie Waffen und Essensvorräte in Beschlag zu nehmen. Und das Wichtigste ist, unsere Leute sitzen nicht länger untätig und wie auf dem Präsentierteller herum.«
»So wie wir, meinst du.« Ich reibe mir die Schläfen. Die aufblühenden Kopfschmerzen haben diesmal nichts mit der Mine zu tun. »Und ich soll die verzwickte Lage jetzt wohl retten.«
»Später«, sagt er. »Erst wenn du wieder richtig gehen kannst.«
»Ich bin wohlauf«, verkünde ich mit mehr Nachdruck als nötig.
Heron mustert mich skeptisch. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn aber rasch wieder und schüttelt den Kopf.
»Wenn es etwas gibt, das du mich wegen der Mine fragen möchtest, ich kann mich an nichts erinnern«, erkläre ich. »Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich hineingegangen bin – alles, was danach kam, ist verschwommen.«
»Du wirst dich mit der Zeit schon erinnern, ob es dir nun behagt oder nicht. Aber weil ich selbst über meine Erfahrungen in der Mine nie sprechen wollte, nahm ich an, dir würde es genauso gehen.«
Ich schlucke und schiebe den Gedanken beiseite. Das ist ein Problem, mit dem ich mich jetzt nicht befassen will, und nach Lage der Dinge habe ich ohnehin schon genug Probleme zu bewältigen. »Aber dich bedrückt doch etwas«, hake ich nach. »Was ist es?«
Er zögert einen Moment. »Hat es geklappt?«, fragt er schließlich anstelle einer Antwort.
Im ersten Augenblick weiß ich nicht, was er meint, aber dann komme ich darauf. Er meint den Grund, warum ich überhaupt in die Mine gegangen bin. Wegen der geringen Kontrolle, die ich über mein Feuer hatte, der Nachwirkung von Cress’ Gift. Ich bin in die Mine gegangen, um meine Magie zu verstärken, in der Hoffnung, dass ich anschließend genügend Wirkmacht in mir haben werde, um mich gegen Cress behaupten zu können. Hat es geklappt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
Ich hebe meine linke Hand und beschwöre Feuer auf die Handfläche. Noch bevor ich die Finger ganz ausgestreckt habe, spüre ich eine glühende Hitze in ihnen, stärker, als ich sie je zuvor gespürt habe. Das Feuer kommt mühelos, sobald ich es hervorrufe, als würde es zu mir gehören und gleich unter der Oberfläche lauern. Es brennt heller und fühlt sich heißer an als zuvor, aber das ist nicht alles. Um es Heron vorzuführen, werfe ich den Flammenball hoch in die Luft und halte ihn dort in der Schwebe, immer noch hell lodernd. Herons Augen weiten sich, aber er sagt nichts, als ich nun meine Hand hebe und anspanne. Der Ball aus Feuer ahmt mich nach und formt sich ebenfalls zu einer Hand. Wenn ich meine Finger bewege, passt er sich ihren Bewegungen an. Ich balle sie zur Faust, er tut es auch.
»Ich habe das Ausmaß von Ampelios Magie gesehen, als er mich ausgebildet hat, Theo.« Herons Stimme ist ein heiseres Flüstern. »Aber das konnte er nicht.«
Ich schlucke und fange die Flamme wieder ein, ersticke sie in meiner Faust und verwandle das Feuer in Asche.
»Sag mal, Heron«, ich halte den Blick auf die dunklen Flocken gerichtet, die meine Haut beschmieren genau wie die der Aschekrone, »ist Mina noch hier? Sie ist …«
»… die Heilerin«, ergänzt er und nickt. »Ja, sie ist noch da. Sie hilft bei den Verwundeten. Ich gehe sie holen.«
Als er gegangen ist, klopfe ich mir die Asche von den Händen und lasse sie auf den Boden hinunterrieseln.
Zu dem Zeitpunkt, als Mina das Zelt betritt, habe ich mich bereits an das Stehen gewöhnt, auch wenn sich mein Körper noch nicht so recht anfühlt wie meiner. Jede Bewegung, jeder Atemzug kostet mich Mühe und jeder Muskel schmerzt. Mina scheint es zu bemerken, denn sie schaut mich nur kurz an und lächelt wissend.
»Das ist normal«, sagt sie. »Als ich damals aus der Mine kam, sagten die Priesterinnen, dass mich die Götter gebrochen und wieder neu erschaffen hätten. Das schien sehr treffend zusammenzufassen, wie ich mich fühlte.«
Ich nicke und lasse mich vorsichtig wieder auf der Pritsche zum Sitzen nieder. »Wie lange hält dieser Zustand an?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Meine Schmerzen dauerten ein paar Tage, aber das ist bei jedem anders.« Sie stockt und mustert mich. »In die Mine zu gehen, obwohl Ihr schon ein gewisses Maß an Magie besaßt, war unglaublich töricht von Euch. Ihr wart bereits ein halb gefülltes Gefäß und habt die Minenkrankheit damit geradezu herausgefordert. Das ist Euch doch klar, oder?«
Ich senke den Blick. Es ist schon eine Weile her, dass ich von jemandem, der sich um mein Wohlergehen sorgt, derart gescholten wurde. Ich überlege, wer es war; es kann sehr gut meine Mutter gewesen sein. Vermutlich auch Hoa, auf ihre stumme Art.
»Ich wusste um die Gefahr«, erwidere ich.
»Ihr seid die Königin von Astrea«, fährt sie fort, ohne meinen Einwand zu beachten. »Was hätten wir getan ohne Euch?«
»Ihr hättet weitergemacht«, sage ich, lauter diesmal. »Ich bin nur ein einziger Mensch. Wir haben im Gefecht sehr viel mehr Menschen verloren, ebenso damals bei der Eroberung, einschließlich meiner Mutter. Und doch gibt es uns immer noch. Ob nun mit oder ohne mich würde keinen Unterschied machen.«
Mina sieht mich gleichmütig an. »Es war trotzdem töricht«, beharrt sie. »Aber es war auch mutig.«
Ich zucke die Achseln. »Ganz gleich, was es war, es hat funktioniert.«
Ich führe ihr vor, was ich Heron gezeigt habe, dass ich nicht bloß Feuer heraufbeschwören, sondern es zu einer Erweiterung meiner selbst machen kann. Mina beobachtet mich schweigend und mit nachdenklich gespitzten Lippen, bis ich fertig bin und die Asche wieder auf die Erde rieseln lasse.
»Und Ihr könnt schlafen«, sagt sie mehr zu sich selbst als an mich gerichtet.
»Ziemlich tief sogar, würde ich sagen«, erwidere ich trocken.
Sie tritt auf mich zu. »Darf ich Eure Stirn fühlen?«
Ich nicke und sie drückt ihren Handrücken an meine Stirn. »Ihr fühlt Euch nicht heiß an.« Sie streckt die Hand aus, um die einzelne weiße Strähne in meinen kastanienbraunen Locken zu berühren.
»Die war schon vorher da«, erkläre ich. »Unmittelbar nachdem ich das Gift getrunken hatte.«
Sie nickt. »Ich weiß. Anders als das Haar der Kaiserin, das vollkommen weiß ist. Aber das habt Ihr wohl Artemisia zu verdanken. Wenn sie nicht so schnell ihre Wassermagie bei Euch angewandt hätte, um dem Gift entgegenzuwirken, hätte es Euch noch viel mehr geschadet. Und wenn es Euch nicht sofort getötet hätte, dann hätte es spätestens der Aufenthalt in der Mine getan.«
»Du bist Cress … ähm … der Kaiserin nie selbst begegnet«, wechsele ich das Thema. »Aber du wirst inzwischen gehört haben, was man sich über ihre Magie erzählt.«
Mina überlegt. »Mir ist tatsächlich einiges zu Ohren gekommen«, erwidert sie vorsichtig. »Allerdings finde ich solche Geschichten häufig übertrieben.«
Ich denke daran, dass Cress den Kaiser getötet hat, einfach nur, indem sie ihre glühend heißen Hände um seinen Hals legte, und dass sie allein mit ihren Fingerspitzen eine Brandspur aus Asche über den Tisch zog. Sie verströmte eine unbeschreibliche Magie. Ich weiß nicht, wie man etwas übertreiben soll, das man mit eigenen Augen gesehen hat.
»Es ist, als ob … sie ihre Gabe noch nicht einmal heraufbeschwören muss. Nur mit ihren bloßen Händen hat sie den Kaiser innerhalb von Sekunden getötet«, sage ich.
»Und Ihr glaubt nach wie vor nicht, dass Eure Gabe stark genug ist, um ihrer Magie etwas entgegenzusetzen«, vermutet Mina.
»Ich glaube nicht, dass irgendjemandes Gabe so stark ist«, gestehe ich. »Oder hast du schon einmal von einem Hüter gehört, der derart mühelos tötet?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe überhaupt noch nie von Hütern gehört, die töten«, sagt sie. »Das war nicht ihr Weg. Wenn ein Verbrechen so schwer war, dass sich die Hinrichtung des Übeltäters nicht vermeiden ließ, erfolgte sie auf eine weniger spektakuläre Art. Kein Hüter hätte seine von den Göttern gegebene Gabe jemals für Derartiges eingesetzt. Es wäre ein großes Sakrileg gewesen, ein frevlerischer Umgang mit etwas Heiligem.«
Ich denke an Blaise, der aufs Schlachtfeld zog, wohl wissend, dass er sterben könnte, aber fest entschlossen, vorher so viele Kalovaxianer wie möglich zu töten. War das ein frevlerischer Umgang mit seiner Gabe? Oder gelten in Zeiten des Krieges andere Maßstäbe?
»Wie geht es den beiden Kindern, die ich vor Kurzem bei dir gesehen habe? Die beiden, die du unterrichtet und deren Fähigkeiten du erforscht hast«, erkundige ich mich nach dem Jungen und dem Mädchen, die die gleiche überbordende Magie besaßen wie Blaise.
»Laius und Griselda«, sagt sie. »Sie sind wohlauf. So wohlauf, wie man es unter diesen Umständen erwarten kann. Sie sind verängstigt und haben durch die grauenhaften Experimente, die die Kalovaxianer an ihnen durchführten, schwere Verletzungen an Leib und Seele davongetragen, aber sie sind in mehr als nur einer Hinsicht stark.« Sie zögert einen Moment. »Euer ausgedachter Freund war übrigens sehr hilfreich bei ihrer Genesung. Die beiden mögen ihn, auch wenn er unnahbar wirken mag. Es ist wirklich sehr viel wert, wenn man entdeckt, dass man nicht ganz so allein auf der Welt ist, wie man dachte.«
Als ich Mina anfangs von Blaise erzählte, sprach ich immer nur von einem Freund, den ich mir bloß ausgedacht hätte, doch sie durchschaute mich sehr schnell. Inzwischen hat sie ihn offenbar kennengelernt und scheint ihn ebenso wenig zu fürchten, wie sie sich vor Laius und Griselda fürchtet.
»Hast du irgendjemandem von deinen Erkenntnissen erzählt?«, frage ich.
Sie spitzt die Lippen. »Ich habe keine Erkenntnisse, Euer Majestät«, antwortet sie achselzuckend. »Es sind nur Vermutungen meinerseits, und daher sehe ich keinen Grund, die Leute unnötig zu verunsichern. Die Menschen fürchten sich vor dem, was sie nicht verstehen, und in Zeiten wie diesen kann Furcht zu gefährlichen Entschlüssen führen.«
Wenn die Leute wüssten, wie stark und unbeständig Blaises und Laius’ und Griseldas Magie ist, würden sie die drei womöglich umbringen. Das ist nichts, was ich nicht schon gewusst hätte, aber dass es Mina so unverblümt andeutet, verschlägt mir den Atem.
»Alle haben gesehen, was Blaise auf dem Schiff getan hat«, sage ich. »Sie haben gesehen, dass seine überbordende Magie ihn und auch alle anderen in seiner Umgebung beinahe das Leben gekostet hätte. Trotzdem haben sie ihm anschließend nichts zuleide getan.«
»Nein«, pflichtet sie mir bei. »Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man diese Tat in hundert Jahren mit einem Heldenepos besingen wird, aber es kam ja auch niemand dabei zu Schaden. Für die Leute ist er seither ein Held. Zwar einer, der so sehr vor Kraft und Magie strotzte, dass er sich nicht im Zaum halten konnte, aber dennoch ein Held. Vergesst jedoch nicht, dass so etwas von einem Moment auf den anderen ins Gegenteil umschlagen kann.«
Tiefpunkt
Mina meint, ein Spaziergang würde mir guttun, und obgleich sich mein Körper heftig gegen diese Vorstellung wehrt, befolge ich ihren Rat. Ich muss mich schwer auf Heron stützen, und trotzdem ist jeder Schritt eine Tortur, bei der meine Muskeln gequält aufschreien, aber die frische Luft und die Sonne auf meiner Haut wiegen die Schmerzen unbestreitbar auf. Meine Muskeln beginnen sich allmählich zu lockern und die Schmerzen in meinen Gliedmaßen werden etwas erträglicher.
Es ist seltsam, das Minenlager leer stehen zu sehen, eine verwaiste Stadt unbewohnter Baracken, von denen nur einige wenige noch mit Kranken und Verletzten belegt sind. Heron zeigt im Vorbeigehen auf diejenigen, in denen die Verwundeten untergebracht wurden, aber das wäre eigentlich nicht nötig. Man hört es deutlich an den Lauten, die durch die Wände dringen – trockenes Husten, leises Weinen, Schmerzensschreie – und mich in einem Meer aus Schuldgefühlen zu ertränken drohen.
So viel mehr Menschen sind noch am Leben und wohlauf, sage ich mir. So viel mehr sind jetzt wieder frei.
Heron versucht, mich abzulenken, indem er auf weitere Gebäude zeigt, die das Gefecht heil überstanden haben. Er sagt, das Essen sei rationiert und werde in der alten Verpflegungsbaracke zubereitet und ausgegeben. Eine Gruppe von Männern und Frauen, die mit uns hiergeblieben sind, habe sich bereit erklärt, Wild zu jagen und Beeren und Pflanzen zu sammeln, sodass unsere Vorräte nicht zur Neige gehen. Wenn wir aufbrechen, um zu unseren Streitkräften aufzuschließen, werden wir sogar mehr Essensvorräte mitnehmen können.
Selbst von den ehemaligen Sklavenunterkünften wird Gebrauch gemacht, wobei verständlicherweise niemand darauf erpicht ist, darin zu schlafen. Stattdessen hat man alle Möbel und Fußeisen ausgeräumt und die Unterkünfte zu Waffenlagern und Übungsräumlichkeiten umfunktioniert, in denen man geschützt vor der gleißenden Hitze trainieren kann.
»Wer trainiert denn dort?«, frage ich, als mich Heron auf eine der gerade erst entstandenen Übungsstätten hinweist. »Ich dachte, unsere Streitkräfte wären abgezogen.«
»Nicht alle«, antwortet er zögernd. »Die meisten derjenigen, die in den Minen gesegnet wurden, haben rasch Gefallen am Training gefunden, und einige der Ältesten haben eingewilligt, ihnen auch weiterhin dabei zu helfen, aber es gab auch welche, die mehr Unterstützung brauchten.«
Gesegnet. Es waren über ein Dutzend gesegnete Astreaner, die von den Kalovaxianern in diesem Lager gefangen gehalten worden waren, um Versuche an ihnen durchzuführen. Schon der Gedanke lässt mich schaudern. Ich habe die Beweise dafür selbst gesehen: tiefe Schnitte im Körper, abgetrennte Finger und Zehen – einem Mann hatte man sogar ein Auge entfernt.
»Wie konnten sie schon so bald wieder trainieren?«, frage ich überrascht. Als ich in die Höhle ging, war keiner von ihnen auch nur fähig, auf eigenen Beinen durch das Lager zu gehen, geschweige denn zu kämpfen.
»Ich habe bei der Heilung ihrer körperlichen Wunden nachgeholfen«, sagt Heron achselzuckend. »Aber die seelischen Wunden sind eine andere Sache. Viele der Gesegneten sahen das Training als eine Möglichkeit der Heilung an und wollten es unbedingt. Art, Blaise und ich haben sie angeleitet, zusammen mit einigen der astreanischen Ältesten, die darin zwar versiert, allerdings selbst keine Hüter sind. Natürlich sind sie nicht besonders gut ausgebildet, trotzdem haben sie beachtliche Fortschritte erzielt in der kurzen Zeit, die wir dafür hatten. Und sie trainieren weiterhin. Vermutlich auch jetzt in diesem Moment.«
Artemisia hat mir einmal erzählt, was sie empfindet, wenn sie tötet, dass es ihr wohltut, es endlich jemandem heimzuzahlen. Anscheinend ist sie da nicht die Einzige.
»Ich werde wohl auch bald wieder mit dem Training beginnen müssen«, sage ich.
»Erst mal sollten wir uns darauf konzentrieren, dass du wieder eigenständig gehen kannst«, erwidert Heron.
Ich werde aus meinen Grübeleien gerissen, weil mich zwei Arme umschlingen, hochheben und im Kreis herumwirbeln. Bevor ich erschrocken aufschreien kann, begrüßt mich der, zu dem die Arme gehören, und ich erkenne seine Stimme.
»Willkommen zurück in der Welt der Lebenden«, sagt Erik und setzt mich wieder ab.
Ich drehe mich zu ihm um und falle ihm um den Hals. »Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagte, dass du mir gefehlt hast?«, frage ich mit einem Lachen.
»Ich würde dir nicht glauben, wenn du das Gegenteil behaupten würdest.« Er erwidert meine Umarmung und drückt mich fest.
»Geh vorsichtig mit ihr um!«, rügt ihn Heron. »Sie ist im Moment ein bisschen zerbrechlich.«
Erik stößt ein abschätziges Schnauben aus. »Königin Theodosia? Ich habe Felsblöcke gesehen, die zerbrechlicher sind.«
Ich lächele, entwinde mich aber sanft seiner Umarmung. »Das höre ich gern, aber Heron hat nicht ganz unrecht.«
Kaum habe ich es ausgesprochen, tritt Erik einen Schritt zurück und mustert mich von Kopf bis Fuß. »In der Tat siehst du aus, als hättest du ein oder zwei Höllen durchgemacht.«
»Eher drei«, gestehe ich.
»Theo!«, ruft eine andere Stimme.
Ich drehe mich um und sehe Artemisia auf mich zulaufen, mit wehenden himmelblauen Haaren und schimmerndem Dolch an der Hüfte. Anders als Erik kann sie sich nicht dazu durchringen, mich zu umarmen, sondern begrüßt mich unbeholfen mit einem leichten Schulterklopfen.
»Wie geht es dir?«, erkundigt sie sich vorsichtig.
»Ich lebe. Das ist mehr, als wir erwarten konnten«, antworte ich lächelnd. »Und es hat funktioniert.«
Sie strahlt. »Das will ich hoffen. Sonst wäre dein neuer Spitzname nämlich ziemlich unpassend.«
Ich runzle die Stirn und schaue fragend von einem zum anderen. »Mein neuer Spitzname?«
Die drei wechseln vielsagende Blicke, schließlich ist es Artemisia, die theatralisch in einen Hofknicks sinkt, woraufhin Erik und Heron eine tiefe Verbeugung machen.
»Seid gegrüßt, Theodosia«, sagt Art. »Königin der Flammen und des Zorns.«
Die drei richten sich grinsend wieder auf, doch es ist kein Scherz, auch wenn Artemisia versucht, es so darzustellen. Königin der Flammen und des Zorns. Ein schwieriger Titel. Er klingt zwar Ehrfurcht gebietend, deutet aber auch auf Grausamkeit hin. Zum ersten Mal wird mir klar, dass dies mein Vermächtnis sein wird, ob ich nun Erfolg haben werde oder scheitere. Ich denke an all die Gemälde, auf denen meine Mutter in sanften Aquarellfarben und in fließende Seidengewänder gekleidet dargestellt ist. Ich denke an die Gedichte, die ihr zu Ehren verfasst wurden – Oden an ihre Schönheit und Güte und an ihr sanftes Wesen. Königin des Friedens hat man sie genannt. Eine vollkommen andere Art von Königin.
Im hintersten Winkel meines Gedächtnisses glimmt eine Erinnerung auf und kämpft sich durch den Nebel, der nach meinem Aufenthalt in der Mine darin herrscht.
»Ich starb als Königin des Friedens, und der Friede starb mit mir«, sagte meine Mutter zu mir. »Du aber bist die Königin der Flammen und des Zorns und du wirst ihre Welt aus den Angeln heben.«
Ich weiß nicht, ob es der Geist meiner Mutter war, der mir in der Mine begegnet ist, oder nur eine Ausgeburt meiner Fantasie oder etwas vollkommen anderes, aber ich weiß, dass ich diesen neuen Namen schon einmal gehört habe, noch bevor er zustande kam, und bei diesem Gedanken wird mir mulmig.
Wir können unmöglich einen Plan schmieden ohne Blaise, daher schicke ich die anderen los, um die im Lager verbliebenen Ältesten und Wortführer der anderen Länder zusammenzuholen, und ich mache mich derweil auf den Weg zu den Übungsbaracken, wo, wie man mir sagte, Blaise fast seine gesamte Zeit verbringt. Heron wollte nicht, dass ich alleine gehe, als ich ihm aber versicherte, ich würde mich gut fühlen und es über das Gelände schaffen, ohne mich auf ihn stützen zu müssen, nahm er es hin.
Offen gestanden bin ich mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Auch wenn ich mich besser fühle, ist jeder Schritt eine Qual. Aber ich ertrage lieber die Schmerzen, als Heron oder jemand anderen dabeizuhaben, wenn ich Blaise wiedersehe.
»Tu das bitte nicht. Verlass mich nicht«, waren die letzten Worte, die er an mich richtete, bevor ich in die Mine ging. Kurz zuvor hatte ich einen ähnlichen Appell an ihn gerichtet. Keiner von uns hat auf den anderen gehört.
Schuldgefühle überkommen mich, wenn ich daran denke, wie seine Stimme brach und wie verloren er in diesem Moment aussah. Ganz so als hätte ich das letzte Tau gekappt, das ihn noch an dieses Leben bindet. Als sei er nicht bereits fest entschlossen gewesen, dieses Leben hinter sich zu lassen.
Er hat zuerst mich verlassen, rufe ich mir in Erinnerung. Er zog zweimal dem Tod entgegen, obwohl ich ihn bat – ihn geradezu anflehte –, es nicht zu tun. Er kann mir doch nicht böse sein, nur weil ich das Gleiche getan habe wie er.
Und jetzt? Entgegen alle Wahrscheinlichkeit sind wir beide noch hier und nun müssen wir damit umgehen.
Ich finde die Baracke, die mir Heron beschrieben hat. Sie liegt etwas abseits der anderen, ringsum ragen noch die Überreste eines Zauns aus dem Boden. Ich erinnere mich, diesen Zaun während der Schlacht gesehen zu haben, ein hohes schwarzes Eisending mit spitzen Stacheln, die in der Sonne eigentümlich rot-orange schimmerten. Søren hatte mir erklärt, dass man zerstoßene Feuer-Magiesteine in das Eisen eingeschmolzen hatte, aber inzwischen ist der Zaun niedergerissen worden.
Als ich die Barackentür ein wenig aufschiebe, stelle ich fest, dass es im Inneren beinah dunkel ist, lediglich eine große Kerze in der Mitte spendet etwas Licht, gerade hell genug, dass ich Blaise, Laius und Griselda erkennen kann. Laius und Griselda sind immer noch bloß Haut und Knochen, und doch haben ihre Gesichter mittlerweile mehr Fülle bekommen und etwas von ihrer Blässe verloren, was allerdings überwiegend dem Kerzenschein zu verdanken sein mag. Nicht einmal das schummerige Licht hilft, die blauschwarzen Schatten unter ihren Augen zu verbergen, die an Blutergüsse erinnern.
Die gleichen Schatten trägt Blaise unter seinen Augen, ein Anzeichen für fehlenden Schlaf.
Laius und Griselda sind stärker, als sie es bei unserer letzten Begegnung waren. Das wird offensichtlich, als Griselda hochspringt und einen kopfgroßen Flammenball gegen die Steinwand schleudert. Er erlischt beim Aufprall, hinterlässt aber einen dicken Brandfleck. Die Wände sind übersät davon und mehr schwarz als grau.
Einen Wimpernschlag später landet sie wieder vorgebeugt und nach Luft ringend auf dem Boden, mit dem Hauch eines Lächelns auf den Lippen, dünn und grimmig, aber unverkennbar vorhanden.
»Gut gemacht«, sage ich, und die drei schrecken zusammen. Griselda richtet sich ruckartig auf und schaut mich an. Sie kann nicht viel älter sein als fünfzehn, nur wenig jünger als ich. Mich durchzuckt plötzlich der Gedanke, dass ich ja inzwischen schon siebzehn bin, sollten tatsächlich zwei Wochen vergangen sein, seit ich die Mine betrat.
»Euer Majestät.« Griselda sinkt unbeholfen in einen Hofknicks, gleich darauf folgt eine Verbeugung von Laius.
»Lasst, das ist nicht nötig«, sage ich und zwinge mich, Blaise anzublicken.
Im Unterschied zu Laius und Griselda sieht er noch genauso aus wie das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe – müde smaragdgrüne Augen und grimmig angespannte Kiefermuskulatur. Aber es ist die Art und Weise, wie er mich ansieht, die mir einen Schlag in den Magen versetzt. Er sieht mich an, als wäre ich ein Geist und als wisse er nicht, ob er Angst oder Erleichterung empfinden soll.
Hast du Angst vor mir?, fragte er mich einmal, und ich musste zugeben, dass dem so war. Er kann unmöglich Angst vor mir haben – nicht auf die gleiche Art und Weise wie ich vor ihm –, doch vielleicht ist er verunsichert und fürchtet sich vor dem, was ich sagen oder tun und womit ich ihm als Nächstes zusetzen könnte.
Er hat mich zuerst verlassen, rufe ich mir noch einmal in Erinnerung, aber der Gedanke bringt nicht den erhofften Trost.
Blaise räuspert sich und wendet den Blick ab. »Es ist Mittagszeit«, sagt er und schaut zu Laius und Griselda. »Geht etwas essen und seid in einer Stunde wieder zurück.«
»Wie wäre es, wenn ihr euch den ganzen restlichen Nachmittag freinehmt?«, sage ich. »Ich werde mir Blaise für heute ausborgen.«
Blaise schüttelt den Kopf. »Eine Stunde«, beharrt er.
Laius und Griselda schauen mit großen Augen zwischen uns hin und her. Ich mag zwar ihre Königin sein, aber Blaise ist ihr Lehrer. Sie eilen, so schnell sie können, hinaus, bevor ich seinem Einspruch widersprechen kann. Die Tür knallt hinter ihnen zu, das Geräusch wird von den Wänden zurückgeworfen und hallt in der darauf folgenden Stille im Raum wider. Das Schweigen dehnt sich aus, lange nachdem das Echo verklungen ist, schließlich zwinge ich mich, es zu durchbrechen.
»Wir müssen eine Strategie finden«, erkläre ich. »Wir treffen uns mit den anderen Wortführern, um uns zu überlegen, wie wir nun vorgehen wollen. Das wird länger dauern als eine Stunde.«
Er schüttelt den Kopf, ohne mich anzusehen. »Meine Zeit ist hier sinnvoller verbracht.«
»Ich brauche dich dort.« Ärger steigt in mir auf, heiß und dumpf.
»Nein«, sagt er. »Tust du nicht.«
Mir verschlägt es für einen Moment die Sprache. So habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. »Ich dachte, du würdest zumindest froh darüber sein, dass ich nicht tot bin«, erwidere ich.
Er schaut mich an, als hätte ich ihn geohrfeigt. »Natürlich bin ich froh darüber, Theo. Jeden Augenblick, den du dort unten warst, habe ich die Götter angefleht, dich heil zurückkommen zu lassen, und ich werde ihnen den Rest meines Lebens dafür danken, dass du jetzt lebendig vor mir stehst.«
»Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich in die Mine gegangen bin«, erkläre ich. »Ich wusste, was ich tat, und kannte die Gefahr, aber für Astrea war es die Sache wert. Du musst doch ebenso daran gedacht haben, als du in die Schlacht gezogen bist.«
»Ich bin für dich in die Schlacht gezogen«, betont er schneidend. »Versteh mich bitte nicht falsch, ich liebe Astrea, aber als ich am Bug der Smoke stand und mich mit meiner Magie fast an den Rand des Wahnsinns brachte, als ich ins Gefecht zog im Wissen, dass ich vielleicht nicht zurückkehren werde, habe ich es für dich getan.«
Seine Worte sind Ohrfeige und Liebkosung zugleich, doch der Groll darin gießt Öl in das Feuer meines eigenen Zorns. »Wenn es dir wirklich um mich gegangen wäre, hättest du auf mich gehört, als ich dich bat, es nicht zu tun«, wende ich ein.
Er schüttelt den Kopf. »Dein Urteilsvermögen ist eingeschränkt, wenn es um mich geht.« Sein Tonfall ist frostiger, als ich es je bei ihm gehört habe. »Heron und Artemisia und sogar der Prinkiti hätten mir zugeraten. Ich habe getan, worum du mich niemals hättest bitten können, und dafür werde ich mich genauso wenig entschuldigen. Und selbst wenn die ganze Welt kopfsteht und ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, was dich angeht, bin ich mir vollkommen sicher. Gleichgültig, wo wir sind oder gegen wen wir kämpfen, ich kämpfe in erster Linie immer nur für dich. Und du kämpfst in erster Linie immer nur für Astrea.«
Stolpernd weiche ich einen Schritt zurück. »Das kannst du mir nicht zum Vorwurf machen«, sage ich leise. »Was wäre ich für eine Königin, wenn ich dich oder sonst jemanden oder überhaupt irgendetwas über Astrea stellen würde?«
Er schüttelt den Kopf. »Natürlich mache ich es dir nicht zum Vorwurf, Theo«, erwidert er ruhig. »Ich erkläre dir nur meine Sicht der Dinge.«
Es gibt nichts, das ich dazu sagen kann, nichts, das seine Meinung ändern wird, nichts, womit einem von uns wohler wäre. Nach einer Weile ergreift er erneut das Wort.
»Du brauchst mich nicht, um eine neue Strategie auszuarbeiten. Dafür hast du Art und Drachenfluch und die anderen Wortführer. Du willst mich zum Trost dabeihaben, aber du brauchst keinen Trost mehr. Du brauchst mich nicht, Laius und Griselda brauchen mich jedoch sehr wohl.«
Seine Worte schmerzen wie Dornen, die sich unter meine Haut bohren, und ich gehe, bevor ich noch etwas sage, das ich wirklich bereuen werde. Als ich wieder ins Sonnenlicht hinaustrete und die Tür hinter mir schließe, frage ich mich allerdings, ob es die Worte selbst sind, die mir so wehtun, oder die Wahrheit darin.
Konflikt
Das letzte Mal, als ich mich in der ehemaligen Unterkunft des Minenaufsehers aufhielt, war es mit Søren, Cress und dem Kaiser, und obwohl die Baracke inzwischen gesäubert wurde, finden sich noch Überbleibsel des Geschehens. Auf der Schreibtischoberfläche, über die Cress mit ihren Fingern entlanggestrichen war, zieht sich eine Linie aus verkohltem Holz. In der Maserung des Stuhls, auf dem der Kaiser saß, sind noch Rußspuren zu erkennen, und auf dem Läufer am Boden hat sich ein roter Fleck eingebrannt, von dem vergifteten Wein, den ich getrunken habe. Es gibt Dinge, die sich auch durch noch so gründliches Putzen nicht entfernen lassen.
Wir sollten das Gebäude in Schutt und Asche legen, wenn wir von hier verschwinden, denke ich.
Ich wäre heilfroh gewesen, nie wieder einen Fuß in diesen Raum setzen zu müssen, aber die Abgeschiedenheit der Baracke, der Schreibtisch sowie die große Sammlung der Landkarten von Astrea und aller anderen Ländern der Welt machen ihn zum am besten geeigneten Ort, um über unser weiteres Vorgehen zu beraten. Doch es fällt mir schwer, meine Augen von dem Fleck im Teppich loszureißen.
»Es ist ein einfacher Tausch, Thora. Dein Leben gegen das deiner Leute«, hatte Cress gesagt, als sie mir den Wein reichte.
Von Neuem spüre ich das Gift, das sich seinen Weg durch meine Kehle hinunter brennt und alles Denken aus meinem Kopf tilgt, weil dort nur noch Hitze und Schmerz herrschen. Wieder sehe ich Cress über mir aufragen und mit distanziertem, aber wissbegierigem Blick beobachten, wie ich mich im Todeskampf winde; eine ähnliche Miene pflegte sie aufzusetzen, wenn sie auf ein Gedicht schaute, dessen Übersetzung ihr Mühe bereitete.
Sie glaubt, ich sei tot. Was wird sie tun, wenn sie erfährt, dass ich noch lebe? Möglicherweise sind wir uns inzwischen auf gewisse Weise ebenbürtig, aber eines hat sich nicht geändert: Sie zögerte nicht, mir das Gift eigenhändig zu verabreichen, etwas, das ich nicht fertigbrachte, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Das allein genügt, mir Angst einzujagen.
»Theo«, reißt mich eine Stimme aus meinen Grübeleien. Ich löse die Augen von dem Weinfleck und blicke auf. Drachenfluch steht an die Schreibtischkante gelehnt, die Beine auf eine Weise gekreuzt, dass es albern wirken würde, wenn sie jemand anders wäre. Ich hüte mich, große Wiedersehensfreude von ihr zu erwarten, aber immerhin bedenkt sie mich mit einem knappen Nicken. Ich deute es so, dass sie froh ist, mich am Leben zu sehen.
Erik und Sandrin, der Astreaner aus dem Rat der Ältesten im Flüchtlingslager von Sta’Crivero, sind ebenfalls anwesend, außerdem ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren, das man mir als Maile von Vecturia vorstellt. Sie ist Häuptling Kapils jüngste Tochter und scheint trotz einer gewissen Ähnlichkeit das genaue Gegenteil ihres ehrwürdigen, friedlich gesonnenen Vaters zu sein. Maile hat zwar die gleiche kupferfarben gebräunte Haut wie er, schiebt aber auf viel grimmigere Weise das Kinn vor und schaut immerfort wütend drein. Es wirkt, als sei sie ständig kurz davor, jemandem einen Kinnhaken zu verpassen.
Ich reiße meinen Blick von ihr los und sehe Sandrin an. In den nächsten Tagen werden er und Drachenfluch in See stechen, um die Astreaner, die nicht kämpfen möchten oder es nicht können, in Sicherheit zu bringen. Das scheint alles zu sein, worüber man sich bis jetzt geeinigt hat.
»Wir können hier nicht mehr sehr viel länger bleiben«, verkünde ich, als ich mich wieder gefasst habe. »Die Kaiserin wird bald eine Armee herschicken, sofern nicht schon eine unterwegs ist.«
Maile lacht und wendet sich den anderen zu. »Sie verbringt zwei Wochen damit, im Dunkeln herumzuspazieren, nur um uns anschließend vor etwas derart Offenkundigem zu warnen, das jedes Kind durchschauen würde.« Sie guckt mich an. »Was hast du dir eigentlich vorgestellt, das wir tun würden, derweil du in der Mine verrückt wirst?«
»Ich bin nicht verrückt geworden«, erwidere ich scharf. »Und nach allem, was ich höre, habt ihr während meiner Abwesenheit kaum etwas anderes getan, als euch miteinander zu streiten.«
»Der Großteil unserer Truppen ist losgezogen, um die Ortschaften entlang des Savria zurückzuerobern. Aber sobald wir uns auf einen Plan geeinigt haben, wie wir die Kapitale einnehmen, werden sie wieder zu uns stoßen«, sagt Erik, der an der Wand neben der Tür lehnt. Er scheint keinem von uns besondere Beachtung zu schenken, sondern ist ganz darauf konzentriert, mit einem daumengroßen Messer einen Apfel zu schälen.
»Die Kapitale.« Maile stößt ein spöttisches Schnauben aus und verdreht die Augen. »Denkst du immer noch über dieses törichte Vorhaben nach?«
Es ist ein törichtes Vorhaben. Ich weiß es, und ich könnte mir vorstellen, tief im Inneren weiß es auch Erik. Aber nachdem ihm erst vor Kurzem seine Mutter genommen wurde und sein Leben vollkommen aus den Angeln gehoben ist, bleibt ihm nur noch Søren als sein einziger Vertrauter und nahestehender Mensch in einer fremden, angsteinflößenden Welt. Ich kann ihm seine Torheit nicht zum Vorwurf machen – ich kann nur hoffen, dass er sie einsehen wird.
»Die Erd-Mine einnehmen zu wollen, ist ein ebenso törichter Plan. Das war deine Idee, stimmt’s?«, sage ich an Maile gewandt und zeichne mit dem Finger die Route nach, die wir nehmen müssten, um dorthin zu gelangen, die einzige, die an mehreren größeren Ortschaften und Siedlungen vorbeiführt, von denen jede einzelne Cress eine Nachricht zukommen lassen würde, sobald man uns ausgemacht hätte. Genauso gut könnten wir ihr auch eigenhändig einen Brief schreiben und unser Vorhaben ankündigen.
Maile grummelt leise vor sich hin, schweigt aber. Ich schaue Drachenfluch an. »Was meinst du dazu, Tante? Es fällt mir schwer zu glauben, dass du dir nicht eigene Gedanken darüber machst. Lass uns bitte daran teilhaben.«
Drachenfluch spitzt die Lippen. »Maile hat in gewisser Hinsicht recht«, sagt sie nach einer Weile. »Jeder Hüter verfügt natürlich über unterschiedliche Stärken, aber was die Schlacht angeht … Wenn wir die Erd-Mine befreien könnten, würde jeder zusätzliche Hüter, den wir dort unseren Streitkräften hinzufügen könnten, zwanzig ungeübte Krieger aufwiegen.« Sie legt nachdenklich den Kopf schräg. »Und du hast ebenfalls recht, Theo. Man würde die Kaiserin zweifellos vor uns warnen und sie würde uns dort mit ihrer Armee empfangen. Wir hätten keine Chance.«
»Das sind unsere Gedanken«, sage ich. »Wie lauten deine?«
Drachenfluch fährt mit dem Zeigefinger über die Karte, von der Feuer-Mine bis nach Doraz. »Imperatrice Giosetta schuldet mir noch einen ziemlich großen Gefallen. Sie hat bereits eingewilligt, die astreanischen Flüchtlinge aufzunehmen, bis der Krieg gewonnen ist. Womöglich lässt sie sich ja auch dazu überreden, uns mit ein paar ihrer Truppen auszuhelfen. Und womöglich könnte ich diese Truppen hier entlangführen.« Sie zieht den Finger von Doraz hinüber zur Ostküste von Astrea, wo sich die Erd-Mine befindet. »Es ist zwar immer noch ein Tagesmarsch landeinwärts, aber die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, ist beträchtlich geringer. Erst recht, wenn man der Kaiserin anderswo Schwierigkeiten bereiten würde.«
Ich nicke. »Und kannst du Giosetta dazu überreden?« Ich kenne die Imperatrice von Doraz aus Sta’Crivero. Von den Brautwerbern, denen ich dort begegnet bin, gehörte sie zu denjenigen, die am ehesten infrage kamen, trotz allem ist sie auch eine Herrscherin, die ihre eigenen Interessen verfolgt. Ich bezweifle, dass sie uns aus reiner Gutherzigkeit ihre Truppen zur Verfügung stellen wird.
Drachenfluch denkt kurz nach. »Nach der Rückeroberung der Feuer-Mine ist es für andere Herrscher nun nicht mehr ganz so riskant, auf dich zu setzen, und es gibt viele, die froh wären, die Kalovaxianer endlich erledigt zu sehen – zu ihnen zählt Giosetta. Sie ist nahe der Grenze zu Goraki aufgewachsen, musst du wissen. Sie hat gesehen, wie die Kalovaxianer dieses Land verwüstet haben, und sie hat auch die Folgen gesehen. Natürlich wird sie eine Entschädigung erwarten, aber es ist keine Unmöglichkeit.«
»Welche Art von Entschädigung?«, frage ich schneidend. Ich habe nicht vergessen, dass Drachenfluch den Sta’Criverianern ohne meine Einwilligung die Wasser-Mine versprochen hatte. Ich hege nicht die Absicht, sie ein weiteres Mal zu unterschätzen.
Drachenfluch scheint meinen Argwohn herauszuhören, denn sie grinst breit und zeigt dabei mehr Zähne als ein Haifisch. »Giosetta versucht, mich dazu zu überreden, mein Piratendasein aufzugeben und stattdessen als Freibeuterin für Doraz über die Meere zu segeln. Vielleicht lasse ich mich ja darauf ein. Denn wenn der Krieg erst einmal vorbei ist, wird es wohl keine kalovaxianischen Drachen mehr geben, deren Fluch ich sein muss.«
Drachenfluch ist so schwer zu durchschauen wie eh und je, aber ich denke, ihr Angebot könnte durchaus als eine Entschuldigung für ihr Vorgehen in Sta’Crivero gedacht sein. Was es auch ist, ich werde es annehmen.
»Na schön«, sage ich und schaue wieder auf die Landkarte. »Während du das tust, wohin geht dann der Rest von uns? Die Luft-Mine liegt am nächsten –«
»Wenn man nur die räumliche Entfernung betrachtet, schon«, sagt Drachenfluch. »Aber wir würden unsere gesamten Streitkräfte über das Dalzia-Gebirge bringen müssen und anschließend entweder den Savria überqueren oder sie um den Fluss herumführen müssen. Ganz zu schweigen davon, dass dort mehrere dieser besagten größeren Ortschaften liegen, an denen wir vorbeimüssten, noch dazu durch eine Ebene hindurch, in der man sich nirgendwo verstecken kann.«
Ich schaue auf die Karte und betrachte den breiten Landstrich im Herzen Astreas. Drachenfluch hat recht. Wir hätten es möglicherweise unentdeckt von hier bis zur Luft-Mine schaffen können, bevor wir die Feuer-Mine befreit haben, inzwischen sind wir jedoch zu viele. Wir müssten uns schon glücklich schätzen, wenn wir überhaupt bis zum Savria kämen, ehe die Kaiserin von unserem Tun erfährt.
»Was ist mit der Wasser-Mine?«, frage ich nach einer Weile. »Sie liegt zwar am weitesten entfernt, aber wir würden den Küstenstrich halten können, mit den Bergen als Deckung. Es gibt zwar ein paar kleinere Ortschaften, auf die wir vielleicht dort stoßen, aber wir könnten sie entweder meiden oder einnehmen, ohne dass sie eine große Bedrohung darstellen. Ein Hüter des Wassers mag vielleicht nicht über die körperliche Kraft eines Erd-Hüters verfügen, doch Artemisia kämpft wahrhaft erbittert genug, und ich wüsste da noch die ein oder andere Kriegslist, bei der Trugbilder eine Rolle spielen.«
Niemand erwidert sofort etwas, aber alle tauschen Blicke.
»Wir haben Nachricht von unseren Spitzeln im Haushalt des neuen Theyn erhalten«, ergreift Sandrin schließlich das Wort. »Es geht wohl das Gerücht, König Etristo sei mehr als nur ein wenig ungehalten darüber, dass Ihr aus Sta’Crivero geflohen seid und ihm sein Eigentum gestohlen habt.«
»Ihr wart Flüchtlinge«, betone ich, »nicht sein Eigentum.« Doch ich erinnere mich sehr gut, dass die Flüchtlinge, denen ich begegnet bin, für einen Hungerlohn die härtesten und niedersten Arbeiten verrichten mussten, Arbeiten, die niemand sonst ausführen wollte. In den Augen der Sta’Criverianer waren sie kaum mehr als Sklaven.
»Nein, wir waren nicht sein Eigentum«, sagt Sandrin. »Aber die Schiffe, die Ihr ihm gestohlen habt, waren es. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass ihn der Verlust des Flüchtlingslagers nicht weniger hart trifft.«
»Stimmt«, sage ich. »Das mit den Schiffen hatte ich vergessen. Wie wütend ist er?«
»Wütend genug, um sich mit der Kaiserin zu verbünden –noch enger als ohnehin schon. Es heißt, die sta’criverianischen und die kalovaxianischen Gesandten wollen in fünf Tagen ein Abkommen schließen.«
»Ein Abkommen?«, sage ich gedehnt. »Worüber?«
»Über den Einsatz sta’criverianischer Truppen höchstwahrscheinlich«, antwortet Drachenfluch. »Aber ganz gleich, worum es bei diesem Abkommen gehen mag, Etristos Sohn Prinz Avaric höchstpersönlich wird herkommen, um es zu besiegeln, wir können also davon ausgehen, dass es von großer Bedeutung ist. Es soll bei der Wasser-Mine geschlossen werden. Unsere Leute sagen, dass die Sta’Criverianer bereits unterwegs sind und in fünf Tagen um die Mittagszeit dort eintreffen werden. Das Abkommen soll dann bei Sonnenuntergang besiegelt werden. Wenn wir uns dorthin begeben, würden wir ihnen geradewegs in die Arme laufen.«
Irgendetwas daran kommt mir merkwürdig vor, aber es dauert einen Moment, bis mir aufgeht, was es ist. »Um Truppen zu entsenden, würden sie nicht Avaric den weiten Weg hierherschicken. Er ist weder ein General noch kampferprobt. Und die sta’criverianische Armee ist bestenfalls unterdurchschnittlich. Du hast selbst gesagt, dass Sta’Crivero noch nie einen Krieg führen musste. Wozu also überhaupt ein Abkommen?«
Maile zuckt mit den Schultern. »Truppen sind Truppen und wir sind bereits zahlenmäßig unterlegen.«
Ich schüttele den Kopf. »Das will mir nicht einleuchten. Es muss mehr dahinterstecken. Und welchen Nutzen hat eigentlich König Etristo von diesem Handel?«
»Die Wasser-Mine«, sagt Drachenfluch. »Meine Vereinbarung mit ihm mag zwar geplatzt sein, aber er ist entschlossener denn je, die Mine in seinen Besitz zu bringen.«
Da Sta’Crivero eine große Dürre bevorsteht, ganz bestimmt. Trotzdem, irgendwie leuchtet mir diese Erklärung noch weniger ein.
»König Etristo schickt also seinen Thronerben den ganzen weiten Weg hierher, in ein kriegsgeschundenes Land, in der Erwartung, dass er mit leeren Händen zurückkehrt, mit nichts als einem Versprechen? Es gibt keinen Grund für den Prinzen, persönlich zu erscheinen.«
Sandrin legt den Kopf schräg. »Ihr denkt also, hinter diesem Abkommen steckt noch etwas anderes?«
»Ja«, sage ich. »Ich habe zwar keine Ahnung, was das sein könnte, aber wenn es sowohl die Sta’Criverianer als auch die Kalovaxianer darauf abgesehen haben, dann will ich es auch haben.«
Ich halte inne und starre auf die Landkarte, als ließen sich dort Antworten finden anstelle von Linien, Namen und Wegen.
»Wir könnten in eine Falle laufen«, überlege ich. »Oder wir könnten ihnen eine Falle stellen.«
»Wie?«, fragt Drachenfluch.
»Mit Trugbildern. Der Magie der Wasser-Mine. Die Sta’Criverianer werden also gegen Mittag ankommen, und wann werden die Kalovaxianer sie empfangen?«
Drachenfluch und Maile wechseln einen Blick. »Von der Kapitale ist es nicht so weit dorthin wie von hier«, sagt Drachenfluch nach einer Weile. »Die Kalovaxianer werden vermutlich eine kleine Gruppe zu Pferd sein. Ich denke, sie werden versuchen, etwa zur gleichen Zeit einzutreffen.«
Ich nicke langsam. »Könnten wir sie unterwegs aufhalten, sodass die Sta’Criverianer ein paar Stunden vor ihnen da sind?«
Drachenfluch überlegt. »Ja, das müsste zu schaffen sein. Wir könnten ein paar von unseren Leuten dorthin aussenden, wo die Kalovaxianer Rast machen werden. Sie könnten ihre Pferde losbinden, ein paar Sattelgurte lösen, ihnen etwas ins Essen streuen, woran sie sich den Magen verderben. Aber warum?«
»Wenn wir imstande wären, die sta’criverianischen Streitkräfte außer Gefecht zu setzen, bevor die Kalovaxianer eintreffen, könnten wir anstelle der Sta’Criverianer Artemisia und einige der anderen Wasser-Hüter getarnt zu dem Treffen schicken, um herauszufinden, welchen Tauschhandel sie vorhaben. Wir müssten möglichst rasch aufbrechen, um dort zu sein, bevor die anderen Parteien eintreffen, aber –«
»Und was ist mit Søren?«, fragt Erik leise. Es ist seit einer geraumen Weile das erste Mal, dass er das Wort ergreift. Ich hatte fast schon vergessen, dass er überhaupt da ist. »Du hast versprochen, dass wir alles tun werden, was wir können, Theo.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Insgeheim würde ich nichts lieber tun, als geradewegs zur Kapitale zu marschieren und mit flammenden Fingerspitzen alles und jeden niederzubrennen, der sich zwischen mich und Søren stellt. Aber wäre Søren jetzt hier, würde er mich eine Törin schelten, weil ich es überhaupt in Erwägung ziehe.
»Der Prinz ist unsere geringste Sorge«, sagt Sandrin, bevor ich etwas erwidern kann.
»Er ist vermutlich bereits tot«, fügt Drachenfluch hinzu. »Du würdest einen Rettungsversuch für einen Leichnam wagen.«
»Und ein Glück, dass wir ihn los sind, wenn ihr mich fragt«, knurrt Maile.
Wut und Enttäuschung stehen Erik ins Gesicht geschrieben, und er muss sich bestimmt auf die Zunge beißen, um niemanden anzuschreien. Verübeln kann ich es ihm nicht. Ich habe keine Ahnung, was Søren gerade durchmacht, angenehm wird es bestimmt nicht sein. Trotzdem sind die Einwände der anderen berechtigt. Es gilt, das Leben eines Einzigen gegen das Leben Tausender abzuwägen.
»Ich weiß, was ich versprochen habe, aber Søren zu befreien, hat im Augenblick keine Dringlichkeit«, sage ich und schaue Erik in die Augen. »Er ist mit Cress gegangen, um uns zu schützen, und es war ein edelmütiges Opfer von ihm. Wenn wir jetzt versuchen, ihn zu retten, wie du es vorschlägst, wäre sein Opfer vergeblich gewesen. Und ich bin mir sicher, wenn wir ihn fragen könnten, was wir tun sollen, würde er dasselbe sagen.«
Ich beobachte den Schmerz und die Empörung, die sich auf Eriks Gesicht abzeichnen, ehe sie hinter einer steinernen Maske verschwinden, die ihn auf erschreckende Weise seinem Vater, dem Kaiser, ähnlich sehen lässt. Ohne ein Wort stürmt er hinaus und knallt die Tür so heftig hinter sich zu, dass ich fürchte, sie könnte zersplittern.
Unbehagliches Schweigen breitet sich aus, das ich schließlich breche. »Hat jemand einen besseren Plan als den mit der Wasser-Mine?«
»Du hast keinen Plan, was die Wasser-Mine angeht«, stellt Drachenfluch milde klar. »Was du hast, ist eine Idee.«
»Eine, die wir rasch in die Tat umsetzen müssen, wenn sie funktionieren soll«, entgegne ich. »Wir werden bei Tagesanbruch aufbrechen und den Rest des Plans unterwegs ausarbeiten. Oder hat jemand eine bessere Idee?«
Ich lasse den Blick von einem zum anderen wandern, aber alle schweigen, auch Maile.
»Also schön«, sage ich. »Schickt Nachricht an unsere Truppen. Sie sollen so schnell wie möglich im Pereawald zu uns stoßen. Wir werden uns neu formieren und von dort aus angreifen.«
Vor der Baracke treffe ich auf Erik, der auf mich gewartet hat.
»Du hast gesagt, wir würden Søren befreien«, sagt er, sobald er mich sieht. »Du hast es mir versprochen.«
Ich halte seinem Blick stand und nicke. »Ich weiß. Aber sie haben recht, Erik.« Ich schaue zu Boden. »Wenn wir jetzt Søren befreien, geschähe es auf Kosten aller anderen. Außerdem gibt es keinen Weg zur Kapitale, der nicht mit unserem sicheren Tod enden würde. Das muss dir doch klar sein.«
Erik schließt die Augen und schüttelt den Kopf. »Er ist mein Bruder, Theo.« Ihm bricht die Stimme. »Wir können ihn doch nicht einfach dort sterben lassen.«
»Wir wissen nicht, ob er sterben wird«, erwidere ich, und es klingt sogar in meinen Ohren einfältig. »Cress hätte ihn nicht den ganzen Weg zur Kapitale zurückgebracht, nur um ihn zu töten. Das hätte sie auch gleich hier tun können. Wenn sie ihn am Leben lässt, hat das einen Grund.«
»Eine öffentliche Hinrichtung für einen Verräter-Prinzen ist Grund genug.«
Ich schüttele den Kopf. »Ihre Anwartschaft auf den Thron steht auf wackeligen Füßen. Denn es gibt sehr viele in der Kapitale, die Søren für den rechtmäßigen Thronerben halten. Ihre beste Chance, den Thron zu halten, besteht darin, Søren zu heiraten.«
»Du stellst Vermutungen an«, sagt er.
Ich zucke mit den Schultern. »Du doch auch«, wende ich ein. »Aber ich kenne Cress. Sie ist viel zu klug, um ihn zu töten. Zumindest wird sie vorher noch versuchen, ihren Vorteil aus ihm zu ziehen.«
»Selbst wenn du recht hast, Søren wird dabei nicht mitmachen«, gibt er leise zu bedenken.
Mir schnürt sich der Magen zu. Cress ist nicht so grausam wie der Kaiser, rede ich mir ein, bin mir allerdings nicht sicher, ob das stimmt. Sie ist zutiefst verletzt, und ich weiß nicht, wozu sie noch fähig ist.
»Er wird der Folter standhalten«, erkläre ich und versuche, nicht darüber nachzudenken.
Folter. Das Wort steht zwischen uns, scharf und hässlich, alles überdeckend. Mir wird schlecht bei der Vorstellung, dass Søren gefoltert wird – meinetwegen gefoltert wird. Weil ich Cress’ Bedingungen zugestimmt und ihr Gift getrunken habe, obwohl mich Søren angefleht hat, es nicht zu tun.
»Du hast es versprochen«, wiederholt Erik, und es fühlt sich an wie ein Dolchstich ins Herz.
»Welchen Eindruck würde es auf die anderen machen, Erik?« Bitterkeit durchtränkt meine Stimme. »Ich war die Jüngste im Raum. Sie sollen mich als ebenbürtig betrachten, nicht als eine Siebzehnjährige, die aus Liebeskummer einen Jungen zu retten versucht. Wir werden einen Weg finden, Søren zu befreien. Ich habe vor, dieses Versprechen zu halten, aber wir müssen klug vorgehen. Ich bitte dich, mir zu vertrauen.«
Erik zögert, und einen Moment lang fürchte ich, er wird Nein sagen. Stattdessen lächelt er grimmig.
»Schon komisch«, sagt er. »Ich glaube, Søren hat sich noch kein einziges Mal derart in Geduld geübt, wenn es um dich ging.«
Ich empfinde es als schallende Ohrfeige, wobei ich tief im Inneren nagende Schuldgefühle verspüre. »Vielleicht nicht«, sage ich. »Aber sieh doch nur, wohin es ihn gebracht hat. Es sind zu viele Menschen auf mich angewiesen, ich darf nicht die gleichen Fehler machen wie er.«
Kampftraining
Eine alte astreanische Ballade besingt den Sonnenuntergang über dem Calodischen Meer, allerdings ist meine Erinnerung daran so diffus und verschwommen, dass ich nur noch Bruchstücke davon weiß. Trotzdem geht mir jetzt der Anflug einer Melodie durch den Kopf, als ich die Sonne in einem hellroten Leuchten hinter dem Horizont versinken sehe. Sie zaubert ein warmes orangefarbenes Glühen um die zerklüfteten Spitzen des Gebirges, das über uns aufragt, und malt veilchenblaue, lachsrote und türkisfarbene Pinselstriche in den Himmel, der an seinen dunkelsten Stellen den Schimmer von Sternen erahnen lässt.
Ich bin zu Hause, denke ich, und mein Brustkorb schnürt sich zusammen, als wolle er die Worte nie wieder loslassen.
Dieses jähe Gefühl der Rührung bestürzt mich. Seit ich vor Wochen das erste Mal den Fuß an Land gesetzt habe, weiß ich, dass ich in Astrea bin, aber ich glaube nicht, dass ich es bis zu diesem Moment wahrhaft erfasst habe. Ich bin zu Hause, und wenn es nach mir geht, werde ich diese Gefilde nie wieder verlassen.
»Wenn du damit fertig bist, beim Anblick eines Sonnenuntergangs feuchte Augen zu bekommen, können wir aufbrechen«, sagt Artemisia, wobei auch sie nicht ganz unberührt klingt.
Ich wende mich vom Sonnenuntergang ab und drehe mich zu ihr und Heron um. Artemisia mag ihre Erschöpfung zwar deutlicher zur Schau tragen – in Verdrießlichkeit gehüllt –, aber ich nehme sie auch bei Heron wahr. Ich erkenne es daran, wie er die Schultern hängen lässt und an der Niedergeschlagenheit in seinem Blick. Wenn es nach den beiden gegangen wäre, würden sie jetzt gemütlich in der Verpflegungsbaracke sitzen, sich Essen auf den Teller häufen, plaudern und sich dann später für eine erholsame Nachtruhe schlafen legen. Stattdessen sind sie mir tief ins Gebirge hinein gefolgt, mit nichts als zwei Stücken Schiffszwieback und etwas Trockenfleisch als Proviant, um notdürftig ihren Hunger zu stillen.
Sie begleiten mich, weil ich sie darum gebeten habe. Nicht als ihre Königin. Das hätte vielleicht bei Heron verfangen, aber ich bin mir sicher, Art hätte mir in den schillerndsten Farben geschildert, was ich mit meiner Krone alles anstellen kann, wenn ich ihr den Befehl erteilt hätte mitzukommen. Nein, sie sind als meine Freunde hier, und ich bin ihnen dankbar dafür.
Es ist noch nicht allzu lange her, dass ich glaubte, niemals wieder imstande zu sein, jemandem zu vertrauen, aber inzwischen würde ich den beiden alles anvertrauen.
Das ist auch der Grund, warum ich sie hierher in die Berge hinaus verschleppt habe, fernab von neugierigen Blicken.
Ich atme tief durch, gucke auf meine Hände und bringe Flammenbälle auf den Innenflächen hervor. Heron hat es mich schon einmal tun sehen, doch Artemisia schaut aufmerksam zu.
»Ganz nett«, sagt sie. »Aber das konntest du schon, bevor du in die Mine gegangen bist. Sogar schon, bevor du das Gift getrunken hast.«
Heron starrt sie ungläubig an, ihm steht der Mund offen, und mir wird klar, dass ich es ihm gegenüber nie zur Sprache gebracht habe. »Wie bitte? Siekonnte was?« Er wendet den Blick wieder mir zu. »Du konntest was?«