
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ben, ein Mathe-Freak und Comic-Fan, träumt von Superkräften und Heldentaten. Doch seine Fettleibigkeit und sein asoziales Umfeld halten ihn in der tristen Realität. Als er im Krankenhaus behandelt wird, lernt er eine neue Welt kennen. Eine Welt, in der niemand der Norm entspricht, aber in der auch nichts echt ist, weder Leben, Licht noch Luft. Ben teilt das Patientenzimmer mit dem durch Brandwunden entstellten Tobias und dem Flüchtlingsjungen Asmarom aus Eritrea. Für Aufregung sorgt eine neuartige Gentherapie, die an der schwerkranken Elena angewendet wird und sie zum Forschungsobjekt macht. Die Jugendlichen werden vermessen und auf Norm getrimmt. Als bei Asmarom mysteriöse Symptome auftauchen, wollen die anderen drei helfen. Aus einem Versteck heraus beobachtet Asmaroms Schwester Noemi die Station. Und hat eine verwegene Idee. Überraschende Unterstützung bekommen die fünf Jugendlichen von einer polnischen Putzfrau und einem afrikanischen Arzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Susanne Ospelkaus Asmarom und die Superhelden
Für alle, die noch nicht wissen, dass sie Superhelden sind. Für meine Söhne
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2018 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Umschlagbilder: Collage aus Bildmaterial von shutterstock.com (Tithi Luadthong, Denis Cristo, Maxim Maksutov) E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-514-8
Inhalt
1 Licht im Fenster
2 Die Mirpzahl
3 Schatten
4 Kalkulierbar
5 Kaltes Licht
6 250 Zeichen
7 Im Strudel
8 Aufleuchten
9 Vollkommene Zahl
10 Erhellt
11 Gemeinsamer Nenner
12 Gezeitenwechsel
13 Dämmerung
14 Im Aquarium
15 Wetterleuchten
16 Trübes Gewässer
17 Gleichung mit Unbekannten
18 Morgenlicht
19 Sturmflut
20 Fibonacci-Zahl
21 Horizont
22 780 Nanometer
23 Lichtbogen
Danksagung
Ein vertiefendes Interview mit der Autorin
Kapitel 1
Licht im Fenster
Es ist schwer für afrikanische Mädchen, nicht weiblich zu wirken. Ich hülle mich in weite Pullover und mache meinen Rücken rund, gehe steif und sage nichts. Sie denken, wir sind Brüder, und nennen uns «Die-da». Wir sind immer zusammen, so nah, dass ich seine Wärme spüre. Jetzt strahlt er Hitze aus, und ich fürchte, dass sie uns trennen.
Drei Monate sind vergangen, seit Mama uns einen Abschiedskuss gab. Dazwischen liegen Fußmärsche, Hunger, Verstecken, Kälte und das offene Meer. Ich fühle mich wie eine Hundertjährige, obwohl ich erst sechzehn Jahre alt bin.
Ich bin Noemi, und mein jüngerer Bruder heißt Asmarom.
Sie kommen auf uns zu, sie reden schnell.
Ich verstehe nur: «Klinik! Teenager! Sofort!» Sie reden viel zu schnell für das wenige Deutsch, das ich mittlerweile gelernt habe.
Die Wachleute packen meinen Bruder unter den Armen und schleppen ihn wie ein Bündel Reisig durch das Lager. Seine Plastikschlappen schleifen über den Boden, und zwischen seinen Fingern klemmt die weiße Tüte. Da ist alles drin, was wir noch haben.
Ich renne hinterher: «No! Nein! Nicht!»
Doch ein Sicherheitsmann stellt sich mir breitbeinig in den Weg. Seine Daumen hakt er in den Gürtel, daneben hängen Taschenlampe und Schlagstock. Er tut so, als würde er einen gefährlichen Verbrecher aufhalten.
Ich dränge mich an ihm vorbei, seine Hände packen zu, und die Handschuhe machen ein schmatzendes Geräusch, als sie sich um meinen Arm legen. Unter dem Gummi sammeln sich Schweißtropfen. Er zieht mich nahe zu sich.
Ich sehe die großen Poren seiner Haut, Augenbrauen zu einer Linie zusammengewachsen, seine wulstige Zunge. Er bleckt die gelben Zähne. Ich drehe mich weg, doch seinem Gestank aus Zigaretten, Knoblauch und Schweiß kann ich nicht entgehen.
«Nur den Jungen, die Schwester bleibt hier!», ruft ein weiterer Wachmann, und die Gummihand schraubt sich fester um meinen Arm. Asmarom dreht sich um und sucht mich zwischen Sanitätern, Flüchtlingen, Helfern, Polizisten und Sicherheitsleuten.
«Ich finde dich!», kreische ich über die Absperrung, «ich finde dich!»
Meine Muttersprache kratzt in meinem Hals. Sie fühlt sich fremd und falsch an, wie alles hier.
Die Gummihand löst sich, tatscht mir über den Rücken, drückt in mein Kreuz und schubst mich in die Halle zurück.
Ich stolpere und falle auf meine Knie. Es tut nicht weh, der Boden ist seltsamerweise irgendwie weich. Er fängt Stürze ab. Ich bleibe trotzdem liegen, mein Herz schmerzt am meisten, doch dafür gibt es kein Krankenhaus.
Eine Frau mit feiner Frisur und duftender Haut hilft mir auf und streicht unbeholfen über meine Kleidung. Sie spricht ganz langsam und deutlich, als wäre ich dumm oder schwerhörig.
«Er kommt in Kli-nik. Ich kann dich hin-fah-ren. Okay? Aber nicht heute. Morgen. Mooooorgen.»
Ich nicke und reibe über meinen schmerzenden Oberarm.
Ihre Hand liegt immer noch auf meinen Rücken. Jetzt streichelt sie nicht mehr, sondern schiebt mich durch die Halle. Vor einem Irrgarten aus übereinanderstehenden Betten stellt sie mich ab. Sie kennt das System nicht, und sie weiß nichts von den Gesetzen in der Notunterkunft.
Es gibt eine Hierarchie. Ganz oben stehen die Männer aus Afghanistan, Pakistan und Syrien, dann die moslemischen Afrikaner, dann die Christen und irgendwann die Frauen.
Als afrikanische Christin stehe ich ganz unten. Ich habe das schlechteste Bett, neben Klo und Ausgang. Ich krabble auf die oberste Matratze und rolle mich in meine und Asmaroms Decke ein.
Nicht weinen, bloß nicht weinen. Weinen raubt dir deine Kraft. Du bekommst Kopfweh und kannst nicht denken. Wenn ich blinzeln würde, würden sich Tränen lösen. Ich will das nicht. Also starre ich an die Decke, mein Blick verfängt sich in den Seilen und Ringen. Wären wir nicht in der Halle, würden Kinder daran turnen.
Es ist lange her, dass ich mich aus Spaß bewegt habe. Fangen spielen statt wegrennen, sich verstecken und dann zu juchzen, wenn man gefunden wurde. In den letzten Wochen haben Asmarom und ich uns immer versteckt in der Hoffnung, nicht gefunden zu werden. Wir waren gut, haben es bis nach Deutschland geschafft, aber es fühlt sich nicht nach Freiheit an.
Ich strecke meinen Hals und rücke so lange im Bett herum, bis ich durch die schmalen Fenster an der Hallendecke schauen kann. Ein Stück Himmel leuchtet zwischen hohen, eckigen Häusern auf.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen übereinander wohnen. Platten, Fenster, Balkone sind ordentlich zu einem Haus gestapelt worden. Abends leuchten die Fenster in unterschiedlichen Gelbtönen. Es sieht warm und gemütlich aus. Wahrscheinlich kochen Mütter das Abendessen, Kinder lernen, Väter lesen in der Zeitung und heben nur kurz den Kopf, um zu fragen, wann das Essen fertig ist.
Meine Mama kocht nicht für uns, sie ist noch in Eritrea. Papa wurde vor Jahren verhaftet, keiner weiß, ob er noch lebt, und mein Bruder ist krank. Zum ersten Mal seit unserer Flucht sind wir getrennt.
Mamas Worte pochen in meinen Schläfen: «Pass auf deinen kleinen Bruder auf.» Sie flüsterte es mir ins Ohr, als wir uns zum Abschied umarmten, und ihre Tränen liefen meinen Hals entlang. Asmarom hörte es und motzte, schließlich sei er auch alt genug, um zum Militär zu gehen.
«Eben», sagte Mutter und drückte ihn an sich. Ein letztes Mal malten ihre Fingerspitzen ein unsichtbares Kreuz auf unsere Stirn. Wir wussten, dass es ein Abschied für lange Zeit war.
Die Lichter im Wohnturm springen von einem Fenster zum nächsten, mal dämpft ein Vorhang das Licht, mal flackern sie, dann erlischt eins, und ein anderes leuchtet auf.
Ich wünschte, wir wären eine Familie aus diesem Wohnturm mit den hellen Fenstern.
Kapitel 2
Die Mirpzahl
Kein Sonnenstrahl dringt in das Wohnzimmer, und kein Windzug könnte die dicken Vorhänge in Bewegung setzen. Sie sind immer zugezogen, die einzige Lichtquelle ist der Fernseher. Die Wohnung im fünfzehnten Stock des Plattenbaus kennt keine Jahreszeiten. Die Tage verstreichen in Eintönigkeit.
Zum dritten Mal schaut Ben in die IKEA-Tüte, ob er an alles gedacht hat: Klamotten, Schreibzeug, Comics. Die Unterwäsche hat er extra letzte Nacht gewaschen und zum Trocknen in den Backofen gelegt. Nun riecht sie nach Pizza.
Die Tasche rutscht durch seine verschwitzten Hände. Er packt fest zu und zerknüllt dabei den rosafarbenen Schein der Hausärztin. Die Krankenhauseinweisung ist inzwischen so fettig wie ein Butterbrotpapier.
«Ich gehe jetzt … Mom … Dad … hört ihr?»
Doch Ben geht nicht.
Er steht wartend zwischen Wohnzimmer und Flur und schaut auf die grauen Vorhänge. Er ist so dick, dass sein Körper den Türrahmen komplett ausfüllt. Nicht einmal die Katze könnte sich an ihm vorbeizwängen, wenn er auf der Türschwelle sitzen würde.
«Mutter? Vater?»
Seine Eltern sitzen wie festgeschraubt vor dem Fernseher. Sie verschmelzen mit dem Sofa, ob Schulter, Wampe, Kissen oder Polster, alles sieht abgenutzt und speckig aus. Nur die Muster auf Mutters Nylonschürze leuchten wie neu, und das, seit Ben sich erinnern kann.
Ab und zu schält Mutter sich aus dem Sofa, trägt den überfüllten Aschenbecher und leere Bierdosen hinaus, doch statt im Müll landet die Hälfte des Zeugs irgendwo im Flur, im Bad oder im Schlafzimmer.
Ben stupst gegen eine Bierdose, leise rollt sie unter eine Kommode. Er schaut ihr kopfschüttelnd hinterher.
Es ist ein Paradoxon: Je mehr sich seine Mutter bemüht, Ordnung zu machen, umso chaotischer wird es. Sein Vater ist zu einem fernsehguckenden Schornstein mutiert. Wie wird es seinen Eltern ergehen, wenn er für einige Zeit weg ist?
Ben räuspert sich: «Also … ich gehe jetzt.»
Vater grunzt aus dem Dämmerlicht: «Vergiss die Pizza nicht.»
Langsam und bedächtig wiederholt Ben: «Ich … komme … aber … nicht … wieder.»
«Wat? Und wer holt Pizza?»
Ratlos öffnet der Vater eine weitere Bierdose und wirft die leere neben das Sofa, dumpf landet sie im Katzenklo.
Ben verlagert sein Gewicht von einem Bein auf das andere, deutet eine Bewegung an und hält dann doch inne.
«So, jetzt muss ich aber los.»
Mutter versucht aufzustehen, ihr Hintern klemmt zwischen den Polstern, und die Katze räkelt sich auf ihrem Schoß. Ratlos hebt sie die Hände und deutet auf das Tier. «Du schaffst das schon, mein Großer. Ach, warum bist du nur so dick? Magersüchtige fallen nicht so auf …»
Sie bricht ab, beugt sich zur Katze und stammelt: «Ist alles meine Schuld.»
Ben will widersprechen, aber dann schweigt er, denn sie hat Recht. Es ist ihre Schuld.
Ohne ein weiteres Wort verlässt er die zugemüllte Wohnung. Wenn er wiederkommt, wird auch sein kleines Zimmer verdreckt sein und Vater runzliger, Mutter langsamer und die Katze fetter. Ob er wiederkommt? Er weiß es nicht.
Ben nimmt die Stufen und wälzt sich die fünfzehn Stockwerke nach unten. Der Aufzug ist schon lange defekt. Auf jedem Treppenabsatz bleibt er stehen und versucht, seinen galoppierenden Herzschlag zu beruhigen.
Im dreizehnten Stock lehnt er sich an die Wand und betrachtet die Zahl, die gegenüber des Aufzuges an der Wand klebt: 13. Bens Atem beruhigt sich.
Dreizehn ist die sechste Primzahl und rückwärts gelesen die erste Mirpzahl im Dezimalsystem.1 Er freut sich an dem mathematischen Zusammenhang.
Im zehnten Stock geht er in die Hocke. Kindergeschrei dringt durch die Tür der Müllers. Ben mag den Kleinsten.
Wenn sie sich sehen, bleibt der Bengel stehen und schaut Ben wie ein Denkmal an, legt den Kopf schief und fragt: «Kannst du Steine zerdrücken? Hast du Superkräfte?»
«Vielleicht», sagt Ben und tippt sich an die Stirn.
Der Abstieg ist mühsam. Seit siebzehn Jahren kennt Ben das Treppenhaus. Es war sein Spielplatz. Er rutschte in Pappkartons die Treppe runter, hangelte sich am Geländer hoch und wurde von der Feuerwehr aus den Gitterstäben gesägt. Er spielte, nein, er war Supermann, und mit dem Badetuch um die Schultern fuhr er im Aufzug hoch und runter, sprang dabei in die Luft und flog. Er war glücklich, bis die alte Schulze rief:
«Welcher Idiot blockiert den Aufzug?»
Dann musste er draußen spielen, in Grünanlagen, die mit Steinen und Hundekacke bedeckt waren.
Als kleiner Junge überzog er seinen Alltag mit flirrenden Comicfantasien. Dann wurde aus Frau Schulze eine Heilerin, und Herr Kowalski konnte aus den Händen Feuer sprühen lassen. Er selbst trainierte seine mentalen Fähigkeiten, indem er die Menschen genau beobachtete, in ihren Gesichtern las und ihre Gestik erfasste und die Zukunft errechnete.
Lange träumte Ben, dass seine Eltern nur so täten, als wären sie faul und dumm – eine Tarnung für eine außergewöhnliche Mission. Von Hartz IV zu leben, sei ein geniales Täuschungsmanöver zweier Agenten.
Er erdachte sich Kräfte, mit denen er seine Umwelt veränderte. Manchmal kämpfte er nachts mit einem kalten Wesen ohne Gesicht, das seine Eltern als Geiseln hielt. Es setzte sich auf Bens Brust, hüpfte und drückte jede Empfindung hinaus wie bei einer Luftmatratze, wenn man sie wieder zusammenlegt.
Er zwang sich, das Wesen anzuschauen, und bündelte seine mentale Kraft in dem Satz: «Du hast keine Macht über mich!»
Als er älter wurde, verblassten seine Comicträume, und das kalte Wesen war nichts weiter als das Versagen seiner Eltern. Doch noch immer liebt Ben die Geschichten über Helden, Kämpfer und Rächer.
Jeden Montag besorgt er sich die neuste Ausgabe von «Fantastic Fighter» am Kiosk. Dann zwängt er sich durch die Biertrinker und legt dem alten Atze das abgezählte Geld auf den Teller. Ben ist froh, dass die Hefte eingeschweißt sind. Durch Atzes Finger wandern Tabak, Butterstullen und Bierdosen, und jedes Mal, wenn er Münzen abzählt oder Lottoscheine ausgibt, befeuchtet er seine Finger mit seiner dicken Zunge.
Ben streicht mit seinem Ärmel über das Cellophan und verwischt die Abdrücke. Erst wenn er zu Hause ist, schneidet er die Verpackung auf, legt das Heft auf seinen Schreibtisch und schaut die Bilder so lange an, bis sie lebendig werden. Das klappt auch umgekehrt, er schaut sich seinen Alltag so lange an, bis es unwirklich wird. BAMM – und Vaters Nackenklatscher trifft ihn. MAMPF – und Ben findet ein gutes Gefühl beim Essen. FOOOP – und er beamt sich für ein paar Minuten in eine andere Realität.
Bei Bens Größe baumelt die IKEA-Tüte wie eine Handtasche in seiner Armbeuge. Unbeirrt läuft er durch die Plattenbauten zur Tramhaltestelle. Wenn er sein Tempo und seine Schrittlänge nicht verändert, sind es 496 Schritte. Er hat es einmal gezählt, seitdem freut er sich an dieser Zahl. 496. Sie ist eine vollkommene Zahl. 496. Sie lässt sich sogar berechnen mit 2(p – 1) × (2p – 1).
Das Versagen seiner Eltern ist aus seiner Sicht ebenfalls berechenbar: (Fernsehen + Bier) × (2Sozialhilfe – Katze).
Trotzdem hatte Ben gehofft, seine Mutter würde ihn in die Klinik begleiten und fragen, wie man ihrem Sohn helfen könne.
Ben stellt sich an das verbogene Haltestellenschild. Er würde sich gerne setzen, doch an der Bank fehlen die Querbalken. Die Bemerkung seiner Mutter über Magersucht statt Fresssucht schlägt eine Scharte in seine Gedanken.
Schämen sie sich für ihn? Er ist ein guter Schüler und verdient Geld. Er ist zwar fett, aber gepflegt. Seine Eltern verdienen weder Geld, noch sind sie gepflegt.
Eisen reibt auf Eisen. Quietschend kommt die Bahn zum Stehen. Ben steigt ein und scannt dabei den Wagen nach Kontrolleuren. Obwohl in seinem Viertel die meisten ohne Fahrschein unterwegs sind, wird selten kontrolliert. Hier gibt es nichts zu holen, die Menschen haben kein Geld für Fahrscheine und erst recht nicht für Bußgelder. In die Betonwüste verirren sich nur selten Beamte, und wenn doch, dann sind sie nicht freiwillig da, wie der Sozialarbeiter oder die Frau vom Jugendamt.
Die Trambahn schlingert um die Kurve. Ben kennt jedes Ruckeln. Täglich fährt er die Strecke in die Innenstadt, um anderen Kindern Nachhilfe in Mathematik zu geben. Sie leben in kleinen, sauberen Häusern, besitzen Hamster und müssen ein Instrument spielen. Sie haben Eltern, denen Bildung wichtig ist und die ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie dem sozialschwachen Ben einen Job geben.
Ben ist deren Motivation egal. Sollen sie doch ein gutes Gefühl bekommen. Er geht gerne in die Familien, freut sich über einen frischen Saft aus einem sauberen Glas, bedankt sich für geschenktes Obst und strahlt über ausrangierte Klamotten. Nur selten passt ein Oberteil, Zirkuszelte nennt sie sein Vater, wenn Ben die Wäsche zum Trocknen aufhängt.
«Plus Size Fashion», erwidert er, und Vater brubbelt: «Quatsch deutsch.»
Aus dem Lautsprecher dröhnt: «Nächster Halt, Klinikum Mitte.»
Ben hievt sich aus dem Sitz, greift mit der einen Hand die Tasche, und mit der anderen klammert er sich an den Haltegriff. Wie ein Stehaufmännchen pendelt er, bis die Bahn zum Stehen kommt. Die Türen öffnen sich, und eine bunte Menschenmasse quillt hinaus. Ben inspiziert und klassifiziert sie. Die Schnellgeher, sie kümmern sich um die Patienten. Die Sorgenvollen, sie erwarten eine Diagnose. Die Teilnahmslosen, die machen nur ihren Job in der Verwaltung. Die Erwartungsvollen, sie eilen zu ihrem Neugeborenen. Die Niedergeschlagenen, sie holen die persönlichen Dinge eines verstorbenen Familienmitgliedes ab.
Wie ein Tourist schlendert er durch das Eingangstor, er freut sich an den Blumenkübeln und wehenden Fahnen mit Stadtwappen.
Obwohl die Klinik ein grauer Würfel ist, zwischen die Gassen der Altstadt und Neubauviertel gepresst, und obwohl sie eher einer Fabrik ähnelt als einer Heilanstalt, findet Ben sie großartig. Alles hat seine Ordnung und ist beschriftet. Blumenkübel enthalten Blumen, und auf die blauen Bänke kann man sich setzen.
Ben erfasst jeden Buchstaben. Er kann nicht anders, für ihn sind Wörter Bilder, die betrachtet werden wollen. Die Hinweisschilder auf dem Gelände drängen sich ihm auf: Notaufnahme, Sprinkleranlage, Dialyse, Parkticket hier entwerten, Achtung Rettungsstellenausfahrt, Bärbels Bistro, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.
Er folgt dem letzten Wegweiser und bleibt vor einer Glastür stehen, die sich automatisch öffnet, als sein Bauch in den Bewegungsmelder ragt. Micky Maus winkt von der Wand und streckt seinen weißen Zeigefinger zum Anmeldeautomaten. Dort zieht Ben eine Nummer.
Er geht gemächlich durch die Wartezone, an Spielkisten und Aquarien vorbei, und fühlt die Blicke der Eltern und Kinder. Er sieht ihre Gedanken, die wie Sprechblasen über ihren Köpfen aufploppen:
«Japs, was der wohl hat?»
«Oh Gott, ist der fett.»
«Wow, ein Riese.»
«GIGGLE, watschelt wie meine Oma.»
«Der Ärmste.»
«UFF, der macht sicher jede Waage kaputt.»
Die Wartenummer verschwindet in seinen verschwitzten Händen, und der Plastiksitz verschwindet unter seinem Hintern. Er hat Zeit, auf der Anzeige leuchtet die 25, er hat die 73. Was für eine wunderbare Zahl, denkt Ben. Er schließt die Augen und gibt sich der Faszination dieser Zahl hin. Es ist die 21. Primzahl, und 21 ist das Produkt aus 7 und 3.
Ben grinst. Die Spiegelzahl von 73 ist 37, und 37 ist die 12. Primzahl, und die wiederum ist die Spiegelzahl von 21.
Ben öffnet die Augen und strahlt. 73 ist auch eine Mirpzahl. Er ballt die Fäuste und ruft: «Zahlenpalindrom in Binärschreibweise!»2
Die wartenden Kinder schauen von ihrem Spielzeug oder Bilderbuch auf und starren Ben an.
Er lächelt zurück, beugt sich zu ihnen vor und sagt zärtlich: «Zahlen-pa-lin-drom. Coole Sache.»
Eine Mutter, die neben Ben sitzt, erhebt sich, um sich einen neuen Platz zu suchen. Dabei schaut sie, als hätte Ben etwas Unanständiges gesagt. Er ist es gewohnt, dass sich Leute von ihm entfernen, sobald sie die Gelegenheit dazu haben.
Ben zuckt mit den Schultern und gleitet tiefer in seinen Sitz. Er konzentriert sich auf die Fische in dem großen Aquarium, sucht sich einen kleinen Scheibenputzer aus und verfolgt ihn mit den Augen, bis er sich zwischen Wasserpflanzen verliert.
Der Signalton der wechselnden Wartenummer lenkt ihn ab. Der Ton ist nicht so schrill wie das Klingeln der Trambahn, eher wie ein Gong auf dem Bahnhof. Ein Signal, das auffordert, in den Zug zu steigen.
Ben ist bereit für eine Reise, nur das Ziel kennt er nicht. Auf keinen Fall zurück in den Plattenbau.
Die Krankenhauseinweisung ist für ihn ein Start in ein anderes Leben mit weniger Körperfülle, mit besseren Blutwerten und mehr Fitness. Noch ist er ein Wartender, eingeklemmt in einen grünen Plastikschalensitz, aber bereit aufzustehen, wenn sein Gong ertönt. 73. Zahlenpalindrom. 73. Mirpzahl. 73. Neuanfang.
«Hallo, ich bin Schwester Kim und zeige dir dein Zimmer.» Türen surren auf und geben den Blick auf einen langen Gang frei. Bunte Streifen an den Wänden navigieren ihn durch die Station. Ein blauer Streifen führt zur Teeküche, ein grüner zum Gruppenraum und ein gelber Streifen zum Stationszimmer.
Schwester Kim dreht sich zu ihm, wartet, bis er angeschnauft kommt, breitet ihre Arme aus und trällert: «Willkommen …»
«… in Keimfrei City», röchelt Ben.
«Auf der KJ2.»
Schwester Kim tänzelt zu einem Patientenzimmer und ähnelt dabei den Fernsehmädchen, die in Spielshows Türen öffnen, Vorhänge lüften oder Buchstaben umdrehen. Sie stößt die Tür eines Patientenzimmers auf, und fast hätte Ben erwartet, dass sie ruft: «Und das ist Ihr Preis, ein Aufenthalt von unbekannter Dauer in einem Dreibettzimmer.»
Das sagt sie nicht, doch ihr nächster Satz ist ebenso hohl: «Das ist Technik-Tobi. Na, ihr zwei werdet bestimmt gute Freunde werden. Nicht wahr, Tooooobiiiiie?»
Ben sieht keinen Tobi, nur ein Bett voller Kissen und Polster, dazwischen ein Bündel Mull, das sich hebt und senkt.
Schwester Kim flitzt durch das Zimmer, erklärt die Hygienevorschriften, teilt Ben einen Spind zu. Immer wenn er etwas fragen will, hastet sie weiter. Sie führt ihn ins Badezimmer, dort ist der Spiegel abgehängt. Sie macht eine verschwörerische Geste auf den Spiegel und zu Tobias. Ihr lackierter Zeigefinger wackelt unter Bens Nase: «Und dass du ja nichts veränderst.»
«Was ist mit ihm?»
«Du darfst nichts verändern. Hast du das verstanden?»
«Jaja, aber wieso Technik-Tobi?»
«Und nachher kommst du ins Stationszimmer.»
Schwester Kim ignoriert die Fragen und schwebt davon.
Hat die von den Psychopharmaka genascht?
Die Mitte des Mullbündels hebt und senkt sich weiter. Keine Reaktion. Ben fixiert das atmende Etwas aus Verbänden, Laken und Decken.
«Hey, ich bin Ben, und du bist Tooooobiiiiie, oder soll ich besser Tobias sagen?»
Keine Reaktion. Das Display eines Handys schimmert zwischen den Kissen, und dumpf klingt der Bass eines Songs.
«Tja», Ben schraubt seine Stimme in die Höhe wie Schwester Kim, «dann lass uns mal gute Freunde werden.»
Keine Reaktion.
«Stehst eher auf die nonverbale Kommunikation, was?»
Eine blecherne Stimme antwortet: «KB auf la-bern.»
«Ah, verstehe, Technik-Tobi lässt seine kleinen Geräte sprechen.»
Ben beißt sich auf die Lippen, und verlegen kramt er in seinen Sachen. Kann Tobi tatsächlich nicht sprechen? Muss er einen Sprachcomputer verwenden?
Den Inhalt seines Plastikbeutels räumt er in den Spind, sortiert Schreibzeug in den Nachttisch und legt die Comics obenauf. Er fummelt an der Fernbedienung seines Bettes herum, lässt es hoch- und runterfahren. Versonnen streicht er über das weiße Laken und die Bügelfalten des Kopfkissens. Er könnte schwören, dass er noch nie so weiße Wäsche gesehen hat, zumindest nicht gebrauchte.
Wie in einem Hotel, staunt er, als er die Toilette benutzt und dem blau blubbernden Wasser in der Kloschüssel hinterherschaut.
Dabei hat er noch nie in einem Hotel übernachtet, aber so stellt er es sich vor.
Zur Aufnahme muss er sich im Stationszimmer melden und stolpert über die Gehhilfen, die dort an der Wand lehnen. Krachend landet er auf einem Stuhl.
«Huppala», quäkt es neben ihm. Der schmächtige Junge sortiert seine Gehstöcke. Ben schaut einmal hin, schaut ein zweites Mal hin, um sich zu vergewissern, dass neben ihm ein Kind und nicht ein Greis hockt. Er hat Beine wie Spaghetti, aber Schuhe wie ein Elefant.
«Alles okay?», fiepst er zu Ben.
«Jaja, passt schon. Auf was warten wir hier?»
Der Junge wackelt gelangweilt mit dem Kopf.
«Datenabgleich.»
Ben nickt und versteht doch nicht.
«Messen und Blutabnehmen. Doch meine Daten werden sich wohl nicht der Norm genähert haben.»
Ben will etwas sagen, doch er formt seine Lippen nur zu einem «Oh».
Der Kleine spricht weiter: «Ich bin defekt … irreparabel … lädiert … kaputt … im Eimer.»
«Oh … hör mal. Da wird sich doch noch was machen lassen.»
Ben knufft dem Jungen in die Seite und erschrickt, wie zerbrechlich er sich anfühlt.
«Schlechtes Ausgangsmaterial. Selbst nach acht OPs entspreche ich nicht der Norm.»
Die Stationsschwester erscheint und grüßt die Jungens. Sie reicht jedem die Hand und hält sie länger fest als nötig, dabei schaut sie einem in die Augen und lächelt. Schwester Helga, steht auf ihrem Namensschild, und sie ist fürsorglich, wie es Mütter sein sollten.
Unendlich langsam steht der Kleine auf und hangelt sich auf seinen Gehstöcken voran. Bei jedem Schritt droht er zu fallen, doch Schwester Helga geht nahe neben ihm.
Ben sieht, dass der Kleine keine Hilfe will, aber am liebsten würde er ihn auf den Arm nehmen und reintragen. Er schaut dem Jungen in Greisengestalt nach und wartet, bis er vermessen wird. Grübelnd lehnt er sich zurück, und rauer Putz kratzt an seinem Hinterkopf.
«Ich erfülle auch kein Standardmaß», nuschelt er, «verkackte Normalität!»
Bens Umfang und Höhe werden in Zentimetern und sein Blutdruck in Millimeter-Quecksilbersäule gemessen.
«Der Bahnhof ist gleich um die Ecke», sagt Schwester Kim und malt kleine Striche in die Akte. Ben betrachtet die Krankenschwester mit ihren Modelmaßen, der makellosen Haut und den schwarzen Haaren. Hätte er sie in der Straßenbahn gesehen und vor allem gehört, würde er denken, sie ist …
Nein, er verbietet sich das letzte Wort. Er hasst es auch, wenn Menschen ihn nach seiner Körpermasse beurteilen.
Ihre Stimme bohrt sich in sein Ohr.
«Da gehst du nachher hin.»
Für einen Moment überlegt er, ob ihre Stimme Superkräfte hat, um Gegenstände zu verrücken oder Materie zu zersprengen.
«Hörst du?»
«Ich verstehe nur Bahnhof.»
«Dann kann ich dein Gewicht eintragen.»
«Auf dem Bahnhof?»
Ben ist verwirrt und fragt sich erneut, ob Schwester Kim Drogen nimmt. Kim streckt ihren Rücken, legt den Stift beiseite, klimpert mit ihren Augenlidern und erklärt wie eine Kindergartentante:
«Du gehst zum Bahnhof, ja? Dort sind die ganz großen Waagen, ja? Die für Gepäck und so. Da stellst du dich drauf, ja? Guckst auf die Anzeige, ja?»
Ben nickt und fragt: «Nackt, ja?»
«Hier geht keiner nackt zum Bahnhof. Kim, was soll der Quatsch? Hol die Spezialwaage von der anderen Station.» Schwester Helga findet das gar nicht witzig.
Kim geht, und Ben grinst.
«Wir brauchen noch eine Unterschrift von deinen Eltern.»
Bens Mundwinkel rutschen abwärts.
«Ich kann Ihnen eine Erklärung geben. Meine Eltern sind mit allem einverstanden.»
Ben holt einen zerknüllten Zettel mit einer unleserlichen Unterschrift heraus.
Die Schwester schaut ihm in die Augen und nimmt das Papier aus seiner Hand.
Ben mag es nicht, wenn man ihn so anschaut. Als würde sie ihn durchleuchten und selbst die Gedanken hinter den Gedanken erkennen.
«Gut, dann gib mir noch die Telefonnummer von deinen Eltern.»
Schwester Helga sitzt ruhig da, hebt weder die Augenbrauen, noch verzieht sie ihren Mund. Sie lächelt ihn an, ein ehrliches und herzliches Lächeln. Ben schwitzt und spürt, wie die Verlegenheit sein Gesicht rot anlaufen lässt.
«Also … wissen Sie … mit meinen Eltern … das ist so …»
«Die sind beschäftigt?»
«Hm … verhindert … unabkömmlich … immer.»
Die Schwester reicht Ben einen Wochenplan.

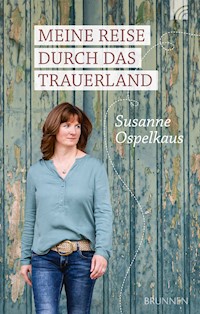

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









