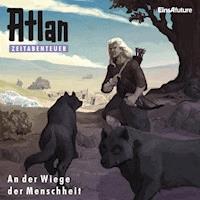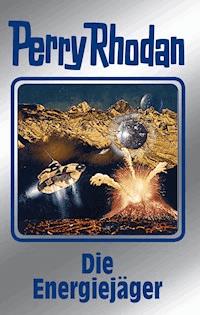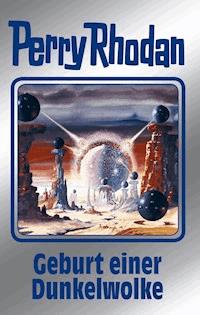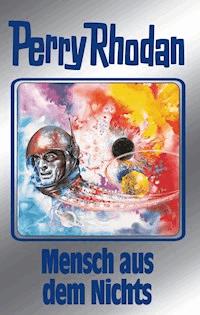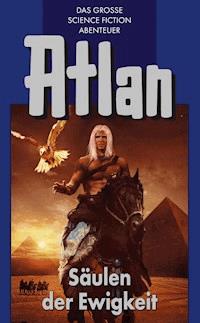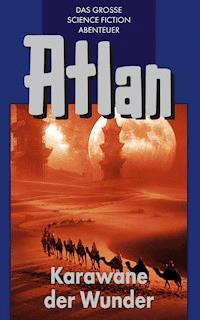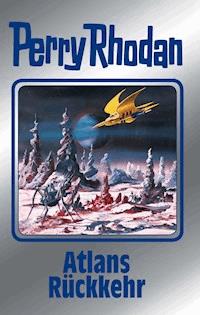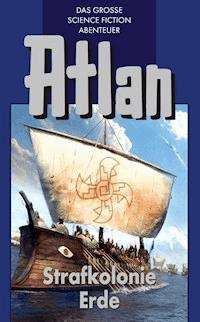
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlan-Blauband
- Sprache: Deutsch
Rund 10.000 Jahre lang lenkt der unsterbliche Arkonide Atlan, später der beste Freund Perry Rhodans, die Entwicklung der Menschheit. In der Antike wirkt Atlan mehrfach als Hüter des Planeten: Er kämpft gegen außerirdische Sklavenhalter, die Menschen jagen, und er hilft den Herrschern Ägyptens gegen übermächtige Bedrohungen. Sogar bei der Belagerung Trojas ist der Unsterbliche dabei: Als er entdeckt, dass abenteuerlustige Außerirdische an den Kämpfen beteiligt sind, wittert er seine Chance, ein Raumschiff zu kapern und in seine Heimat zu fliehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 5
Strafkolonie Erde
Vorwort
Der gewissenhafte Chronist der ersten zehn Jahrtausende von Atlans Leben sieht sich verwirrt angesichts der vielen Verbindungen von Atlans Zeitabenteuern mit dem Perry-Rhodan-Kosmos und der 850bändigen Atlan-Heftserie, er findet Widersprüche, noch mehr Beweise von Atlans Wirken, mehr Informationen und auch Hinweise darauf, dass nicht nur ES und Atlan das Schicksal der jungen Menschheit beeinflussten. Im fünften Band der Atlan-Zeitabenteuer-Erzählungen beginnt sich in der Überzeugung und im Verhalten des »Gefangenen der Zeit« eine Veränderung abzuzeichnen – immer weniger denkt er daran, dass ihn doch noch Schiffe von Arkon finden und zurückbringen würden in seine Heimat. Seine Gedanken beschäftigen sich nunmehr damit, dass er die Barbaren von Larsaf III in qualvoller Langsamkeit dazu bringen muss, am Ende eines langen Entwicklungsprozesses ein Raumschiff bauen zu können: ein Schiff, das er nach Arkon steuert.
Noch immer schwebt der Arkonide, einst Paladin der Menschheit, auf Antigravgittern in der Nähr- und Heilflüssigkeit des Überlebenstanks. Im Planetaren Hospital von Sol City auf Gäa scharen sich die besten Mediziner um den bewusstlosen Statthalter des Neuen Einsteinschen Imperiums. Noch immer sind alle, die von seinem Zustand wissen, mehr als besorgt. Die Laren beherrschen das Solsystem, Terra ist verschwunden, und vor den Invasoren hat Atlan aus 5814 terranischen Planetensystemen rund acht Milliarden Individuen vor dem Hetos der Sieben gerettet.
Als tödlich Verletzter der Karthago-II-Katastrophe berichtet er während seines Kampfes ums Weiterleben über die Hintergründe dreier wichtiger Episoden der irdischen Geschichte: als Die Parasiten (Taschenbuch 199, von 1979) im klassischen Ägypten einfielen, von der ES-Welt Wanderer entkommen, als im frühen Griechenland Das Mittelmeer-Inferno (Taschenbuch 217, 1981 veröffentlicht) stattfand und die Griechen Ilion (oder Troja) belagerten, als der dritte Planet von Larsafs Sonne zur Strafkolonie Erde (Taschenbuch 74, von 1970) wurde. Noch immer verbirgt sich zwischen den Jahren 1696 und 1589 vor der Zeitwende der arkonidische Thronfolger und Kristallprinz im Tiefschlaf in der Überlebensstation nahe São Miguel, 2852 Meter tief, und noch immer kreist der Planet Wanderer nahe dem Endpunkt seiner kosmischen Bahnellipse in der Nachbarschaft des Sonnensystems; angeblich zum Wohl der Barbaren auf dem dritten Planeten von Larsafs Stern. Mit dem Höchstleistungsroboter Rico und seinen wenigen Freunden, von ES manipuliert, versucht der Einsame der Zeit beharrlich, den Weg der Menschheit zur Zivilisation und Kultur zu erleichtern.
Die Welt des frühen Griechenlands, das uns später als das klassische Land der Aufklärung und der Demokratie erscheinen wird, ist im fünften Band der gesammelten Abenteuer Atlans der Hauptschauplatz. Nicht alles, was in Sagen und Legenden der Menschen einen festen Platz fand, ist naturwissenschaftlich überzeugend zu erklären; vieles bleibt unaufgeklärt und geheimnisvoll, auch etliche Geschehnisse aus Atlans Jugend. W. Winkler und R. Castor halfen dankenswerterweise, Dutzende solcher Hinweise aufzuspüren und in »geschichtlich« klaren Zusammenhang zu bringen, und die Karten sollen die Kenntnis der Schauplätze erleichtern.
Prolog
Atlans Sterben war völlig unbemerkt geblieben. Das Entsetzen, das Cyr Aescunnar gepackt hatte, wirbelte ihn durch eine lange Reihe schrecklicher Szenen, Erlebnisse und Geräusche und schockte ihn mit der kalten Lähmung und einem Kreischen, das den Alptraum beendete und Cyr weckte. Schweißgebadet stemmte er sich in die Höhe, blinzelte, sah sich um und tastete nach dem Kontakt der Raumbeleuchtung. Lautlos und langsam verwandelte sich das Schreckensgemälde, in dessen Mittelpunkt er sich hineingeträumt hatte, in die vertraute Umgebung seines Apartments zurück. Sein eigener Schrei hatte ihn geweckt. Er taumelte ins Bad, riss sich den schweißfeuchten Schlafanzug vom Körper und stellte sich unter die eisige Dusche. Noch immer stand er im Bann des Horrortraums. Es würde schwer sein, die atemlose Kälte der letzten Bilder zu vergessen. Seine Augen schmerzten, er blinzelte, und die winzige Automatik aus dem Stirnpflaster blies einen kühlenden Nebel in die Augäpfel. Die Wirklichkeit verschwamm in schlierenartigen Formen und Farben. Aescunnar drehte die Tube mit der Bartentfernungscreme halb ratlos in den Fingern und brummte:
»Die Rasur ist das Abzeichen der Zivilisation, wie einst Schopenhauer schrieb. Es ist ein sehr ungutes Aufwachen heute, Cyr.«
Aescunnar blinzelte einige Sekunden lang, bis die Dinge wieder die vertrauten Formen angenommen hatten. Er schaltete den Mokkahalbautomaten ein und zog das Klebepflaster von der Stirn. Nach der Augenoperation sprühten winzige Dosiergeräte eine kühlende, nährende und keimtötende Flüssigkeit; sie schien ähnlich zusammengesetzt zu sein wie das Heil-Liquid in Atlans Überlebenstank. Aescunnar rasierte sich, trank kalten Fruchtsaft, knotete den Gürtel des Bademantels enger und tappte in das dunkle Büro hinüber, zur externen Forschungsstelle der Chmorl-Universität des Planeten Gäa. Ein einziger Blick genügte, ihn zu überzeugen: Atlan lag im Tiefschlaf, am anderen Ende der Übertragungsstrecke, in der Nährlösung des durchsichtigen Überlebenstanks der Intensivstation. Die goldfarbene SERT-Haube hatte sich von Atlans Kopf und Brust gehoben und schwebte zwischen Sonden und Schläuchen. Es war kurz vor Mitternacht; nur zwei Holoprojektionen arbeiteten und zeigten, dass Atlan lebte.
»Irgendeine Bedeutung hat dieser Traum gehabt«, murmelte der Historiker. »Ausdruck meiner Furcht. Aber … wovor fürchte ich mich?«
Er hob die Schultern und stützte sich mit den Ellbogen auf die Arbeitsplatte. Sämtliche Notizen, die auf dem ungewöhnlich großen Schreibtisch lagen, beschäftigten sich mit der Vergangenheit; mit Terras Mesopotamien, dem Land zwischen Buranun-Euphrat und Idiglat-Tigris, mit Babylon und dessen Herrscher Hammurabi. Aescunnar öffnete eine Schublade, wählte eine Brille mit getönten Gläsern und fühlte, wie er die feuerroten Schrecken des Traums zu vergessen begann. Seit der Landung der KHAMSIN, die vor rund zwei Monaten den schwerstverletzten Arkoniden aus dem vernichtenden Chaos des Planeten Karthago II gerettet hatte, berichtete Atlan aus der irdischen Vergangenheit. Cyr Aescunnar und sein wissenschaftliches Team, unterstützt durch Studenten der Geschichte und Mitarbeiter aller offiziellen Stellen, dokumentierten in den ANNALEN Atlans einzigartige Erlebnisse, zuletzt aus den Jahren um 1698 vor der Zeitwende.
»Atlan lebt!«, sagte Aescunnar und gähnte. »Und schläft. Im Gegensatz zu mir. Keine Panik! Nichts deutet darauf hin, dass er bald aufwacht und das nächste Abenteuer schildert. Welches Jahr, welcher Ort, welche Kultur?«
Im buchstäblich letzten Augenblick war der halbtote Arkonide von Bord der KHAMSIN ins Planetare Krankenhaus eingeliefert und mit beispiellosem Aufwand behandelt worden. Die postoperativen Schocks schienen vorbei zu sein; der verantwortliche Ara-Arzt Ghoum-Ardebil, Atlans Freund, zeigte vorsichtigen Optimismus. Aber noch immer stand Atlans Leben auf des Messers Schneide. Aescunnar lehnte sich im schweren Drehsessel zurück, ließ seinen Blick über das Halbrund aus Bildschirmen, Monitoren und Holoprojektionen gleiten und sagte sich, dass an weiteren Schlaf nicht mehr zu denken war; er schaltete Lampen ein, aktivierte Computer, schwenkte Tastaturen und Terminals in Griffweite und rief die letzten Texte Atlans auf die leuchtendweiße Fläche der Printplatte. Ein weiteres Kapitel der ANNALEN DER MENSCHHEIT war von Atlan beendet worden und wurde von Cyr sowie der Historischen Fakultät mühevoll und sorgfältig bearbeitet und verifiziert.
Aescunnar bereitete in der Pantry des Apartments einen großen Becher Mokka, zählte pedantisch sechsunddreißig Tropfen starken Alkohol in das rußschwarze Gebräu und stellte das Tablett zwischen Notizen und vielfarbige Folien, die auf Lesechips klebten. In den Regalen der zwölfeinhalb Meter langen Büro-Längswand, in der sich Bücher, Lesespulen, Buchchips und Bildkassetten reihten, stapelten sich im indirekten Licht Artefakte, Kopien uralter Karten, vergilbte Fotos und kleine Hologramme neben tausend anderen Zeichen aus der Vergangenheit des Heimatplaneten. Das Jahr 3561 auf Gäa, dem Fluchtplaneten in der Dunkelwolke Provcon-Faust, endete in zwei Monaten, und Cyr bezweifelte, dass innerhalb dieser Zeit die letzten Kapitel von Atlans Geschichte der Menschheit fertiggestellt werden konnten, schon gar nicht sein ehrgeiziger Versuch, die ANNALEN neu zu schreiben oder zum letzten Mal zu überarbeiten.
Langsam aktivierte er seine Geräte, ließ Textfragmente auf die Monitoren schreiben, blickte immer wieder auf die großen Hologramme, die Atlans reglosen Körper im transparenten Überlebenssarg zeigten; ein Verdacht, eine Überlegung, die seinen Verstand in atemloser Kälte erstarren ließ, suchte ihn heim: War es denkbar, dass der Arkonide Atlan – ohne bewussten Wunsch – gar nicht geheilt werden wollte? Dass er sich in diesem Schwebezustand zwischen Tod und Leben, Bewusstsein und Ausgeliefertsein an seine Erinnerungen gänzlich unbewusst wohl fühlte und diesen Zustand so lange wie möglich aufrechterhalten wollte? Cyr glaubte sich abermals mitten in Bildern von Hieronymus Bosch, Gustave Moreau oder Breughels visionären Untergangsschilderungen gefangen, in einer entrückten Kunstwelt, die ihre Wurzeln in Terras langer Geschichte der Mythen, Legenden und Wahrheiten hatte. Aescunnar blies auf die Oberfläche des Mokkas und schüttelte langsam den Kopf, die Brille beschlug, und die Umgebung veränderte sich abermals zu phantastischen Formen.
»Undenkbar.« Aescunnar nahm einen Schluck und dachte an Atlans Freunde: Julian Tifflor, Ronald Tekener, den Robotkaiser Anson Argyris alias Vario-500 oder den Provcon-Laren Roctin Par, an Roger Chavasse oder den abwesenden Perry Rhodan. »Sein Überlebenspotential ist mindestens so groß wie sein Überlebenswille. Er hat beides in rund elf Jahrtausenden immer wieder, zahllose Male, bewiesen.«
Der Historiker nahm die dunkle Brille ab, rieb die Augen und hörte abrupt auf, als ihm die Operation einfiel. Atlan war es zu verdanken, dass aus 5814 terranischen Sonnensystemen acht Milliarden Menschen unter ständiger Todesgefahr gerettet und nach Gäa gebracht worden waren, trotz der Verfolgung durch Hotrenor-Taak, das Hetos der Sieben und die Überschweren unter Leticron; eine einzigartige, nicht wiederholbare Leistung des Arkoniden. Diese Menschen waren zuvor auf Mars, Venus, Titan und Mimas und anderen bewohnbaren Welten des Solsystems zurückgeblieben. Der Statthalter von Gäa, Provcon III, dem Neuen Einsteinschen Imperium, gab sich nicht selbst auf. Nicht einmal in diesem Zustand.
Die verwunderliche Impression verging. Plötzlich sah der Historiker, dass Atlans Finger zu zittern schienen. Ein Muskel im Oberarm zuckte. Der Zellschwingungsaktivator bewegte sich auf der bleichen, von Biomolpflastern bedeckten Brust und reflektierte das Licht der Lampen und der farbigen Anzeigen der Überwachungsmonitoren. Atlan schien zusammenzuzucken; langsam kippte die SERT-Haube im komplizierten Hydraulikgestänge nach vorn, senkte sich ebenso langsam und stülpte sich über Atlans Kopf, der von einem Netz unsichtbarer Antigravstrahlen oberhalb der Nährflüssigkeit gehalten wurde. Aescunnar war allein; er aktivierte die Lautsprecher und wartete. Er hörte Atlans tiefe, regelmäßige Atemzüge, schaltete mit einem einzigen Druck sämtliche Aufzeichnungsgeräte und die Umsetzer ein und warf einen raschen Blick auf das Chronometer: 22. Oktober 3561, 4.17 Uhr.
1.
Noch war ich nicht in der Lage, zu sprechen oder meine Blicke auf einen bestimmten Punkt zu heften und genau zu erkennen, was ich sah. Über einem schier endlosen Ozean, zwischen weißen Wolken, trieb in einem spiraligen Wirbel eine rötlichgelbe Struktur zwischen der Westküste des riesigen Wüstenkontinents nach Nordwest und senkte sich über die Kronen des Regenwaldes, der die Strommündungen an der Ostküste des Doppelkontinents bedeckte. Zäh wanderten meine Gedanken; es schien, als hafteten sie in klebrigem Öl, und ich ahnte mehr, als ich wusste, dass ein Staubsturm Wüstensand aufgewirbelt und in einer Höhenströmung transportiert hatte. Der Sand aus der Wüste düngte die Regenwälder eines der längsten Ströme dieses Barbarenplaneten. Mein Körper fühlte Vibrationen und Wärme, mein Magen verarbeitete halbflüssige Nahrung, und eine schlanke, braune Gestalt mit schulterlangem schwarzem Haar näherte sich mir und sonderte halbverständliche Worte ab.
»Du musst ruhen und schlafen, Gebieter Atlan. Vieles, was du noch nicht begreifen kannst, ist in den hundertsieben Jahren geschehen, in denen du und deine Freunde wieder in meiner Obhut wart. In einigen Tagen wirst du mehr verstehen.«
Ich war sicher, dass Rico zu mir sprach, schloss die Augen und fühlte, wie ich aus dem Bereich farbiger Bilder hinausschwebte in eine lange Phase tiefen, gesunden Schlafes. Unbestimmte Zeit später – Geräte und Maschinen manipulierten an meinem schwachen Körper, ich empfand Hunger und Durst, Kälte und Wärme, Wasser und Schwingungen und konnte zusammenhängend denken – saß ich halb aufgerichtet in einem Schwebesessel vor einer riesigen Wand voller Bildzeichen. Ich brauchte viel zu lange, um sie erkennen zu können: Götterworte, wie die Rômet, die Bewohner des Hapilandes, ihre schöne Schrift nannten.
Nach langem Starren und Nachdenken stellten sich Begriffe ein. Schreibrollen, Shafadu genannt, aus dem Mark der Bitj-Binse gefertigt, das Schriftmaterial aus dem Land am Hapistrom, sorgsam in Schwarz und Rot von rechts nach links beschrieben. Ricos Stimme erklärte:
»Eine Botschaft, Atlan-Anhetes oder Atlan-Horus, ohne die du viele wichtige Ereignisse nicht verstehen kannst. Vermagst du sie schon zu lesen?«
Ich wollte antworten, aber Kehlkopf und Lippen gehorchten mir nicht. Ich nickte mühsam. Mittlerweile vermochte ich zu begreifen, dass meine vagen Erinnerungen an Hammurabis Stadt Babyla mit der Gegenwart nicht mehr viel zu tun hatten, aber noch immer befand ich mich im Stadium eines hilflosen Kindes mit geringer Erkenntnisfähigkeit. Immerhin konnte ich die Schriftzeichen lesen, wenn auch in quälender Langsamkeit. Ein Unbekannter, der überaus sorgfältig zeichnete, hatte geschrieben:
VON PEREMWAH, DEM TATJI DER GRENZTRUPPEN DES OSTENS, DESSEN SOLDATEN DIE TÜRME UND MAUERN DES KÖNIGSWALLS SCHÜTZEN, NAHE DJANET AM ÖSTLICHEN MÜNDUNGSARM.
AN UNSERE HERRIN IM PER-AO, SIE LEBE EWIG UND EWIGLICH, AN SEBEKNEFERU, AM 15. TAG DES MONDES MECHIR IN DER JAHRESZEIT PERET:
Siehe, göttliche Herrin, wir kämpfen an der Grenze gen Sonnenaufgang. Fremde mit Wagen, die gezogen werden von den schnellen »Eseln der Berge«, bedrängen wütend die Grenze und den Wall der Fürsten. Stets haben wir viele von ihnen mit blutigen Waffen zurückgewiesen, und wir waren ohne Gnade, wie du es befohlen hast. Wir nahmen den Besitz und das Leben der Männer; die Mädchen und Frauen führten wir als Sklavinnen in unsere Lehmhütten und sandten die schönsten in Booten nach Itch-Taui zu dir. Aber die Fremden sind zahlreich wie Sandkörner im Frühabendwind. Sie werden das Rômet-Land verwüsten wie Heuschrecken.
Auch andere Grenzwächter schreien nach Hilfe und Waffen. Sie sagen, dass die Fremden Handel treiben, das Land bestellen und dem Kampf ausweichen. Sie kommen aus der östlichen Wüste und aus dem Land der Sumerer, aus den Stämmen der Amu, Setetiu und Retenu. Wir verbrennen ihre Leinenhütten und nehmen ihnen alles, was sie haben, aber sie bleiben, werden kühner, und ständig kommen mehr, Chaosu-Nomaden aus der Wüste des Asmach, des Ostens. Wir kämpfen nachts wie die Schakale, weil ihre Kampfwagen zu schnell sind. Herrin! Es steht schlimm um unsere Grenzfesten. Schicke uns ausgeruhte, gut bewaffnete Männer, Ersatz für unsere zerbrochenen Waffen. Sonst können wir uns jener, die man »Heka Chasut« nennt, nicht länger erwehren!
GESCHRIEBEN IM DRITTEN JAHR DER REGIERUNG UNSERER GROSSEN HERRIN, DER GOTTKÖNIGIN SEBEKNEFERU. DREI ABSCHRIFTEN, DURCH LAUFENDE BOTEN UND SOLCHE IN BINSENBOOTEN.
Meine Ohren identifizierten die zögerlichen Laute als meine Worte. Ich versuchte zu verstehen, was ich gelesen hatte. Wieder überfiel mich eine geradezu krankhafte Sucht nach Kühle, Ruhe und Schlaf, und als ich nach vielen Stunden wieder im Zentrum riesiger holographischer Projektionen schwebte, während meine ölglänzende Haut vom Licht der Solarlampen juckte und Rico, der schönste künstliche Rômet – »Menschen«, so nannten sich die fernen Nachfahren meines Freundes Meni-Narmer und der unvergesslichen Nefer-meryt –, sich wie eine besorgte Amme um mich kümmerte, erkannte ich eine seiner zahlreichen Einspielungen. Ich stöhnte innerlich. Was hatte er in den zurückliegenden mehr als hundert Jahren gesehen, aufgezeichnet und berechnet, und wo hatte er eingegriffen und selbständig zwischen den Barbaren von Larsaf III gehandelt?
Ich erkannte eine Art Karawane von Fremden, die sich augenscheinlich den sorgsam gehüteten Grenzen des Landes näherten, jenes Landes am Strom, das sich aus Kême, dem Schwarzen Land, und Deshret, dem Roten Land, zusammensetzte.
Als sie das erste Grün jenseits der endlosen Weite des Sandes sahen, erhob sich in ihrem Rücken die Sonne über die Dünenkämme und die Spuren der Räder. Die Pferde witterten Wasser, Schatten und saftige Weiden.
»Dort hört die Wüste auf, Temosaran!«, rief die junge Frau. Temosaran stellte sich auf die Zehenspitzen, schwang die lange Rute und drehte sich auf dem Sitzbrett des Gefährts um. Durch das malmende Knirschen, das die Kupferfelgen der Räder im Sand erzeugten, gab er über die Schulter zurück:
»Bei den Bäumen beginnt unser neues Land, Amtara.«
Temosaran war der vierte Sohn eines Nomadenhäuptlings; ihm waren weder Vieh noch Land, noch eine andere Aufgabe geblieben. Er hatte lange gebraucht, um begreifen zu können, dass es überall bessere Lebensbedingungen gab – überall, nur nicht in den kargen Tälern und Hängen des Asmach. Er fing sechs Pferde ein, hämmerte und schnitzte lange an einem Wagen und nahm die junge Frau mit, die seine Söhne gebären sollte. Heute schienen sie endlich am Ende einer langen Fahrt durch glühende Hitze, Durst und weißgelben Sand zu sein. Amtara hob langsam den Arm und winkte; sie war hungrig, schmutzig und müde, voller Schürfwunden und blutunterlaufener Stellen vom stoßenden und schwankenden Wagen. Aber als sie antwortete, lachte sie.
»Auch wenn wir nur das Land durchziehen« – ihre helle Stimme schallte in der Ruhe des kühlen Morgens weit über den Sand – »dort ist Wasser. Wir stinken wie die Ziegenböcke.«
»Nicht mehr lange. Ich werde deine Haut mit Zedernöl glänzen lassen.« Er ruckte mit den Zügeln. Die Tiere gehorchten willig und griffen kräftiger aus; er selbst hatte sie ans Geschirr und die Zügel gewöhnt. Der Stamm besaß viel Erfahrung in der Aufzucht dieser schnellen, starken Tiere. Amtara war eine erfahrene Hirtin – sie waren ein Paar, das in der Fremde überleben konnte.
Hinter dem fast weißen, vom Wind geriffelten Sand tauchten die sattgrünen Wedel großer Palmen auf, zwischen Tamarisken und Schilf; Temosaran glaubte, das Plätschern von Wasser zu hören. Der Sand gab die nächtliche Kälte an die Umgebung ab, die Sonne überschüttete mit heißen Strahlen das Land. Die endlos langen Schatten der Wagen berührten die Gräser und Baumwurzeln des grünen Streifens. Als die Pferde das Gefährt über die Kuppe der niedrigen Düne gezogen hatten, erkannte der schwarzhaarige Fremde, dass sie das Gebiet des fruchtbaren Mündungsdreiecks erreicht hatten. Das Land vor ihnen war keine Oase, sondern erstreckte sich vom linken zum rechten Rand des Horizonts und verschmolz mit der Meeresküste, die zur rechten Hand zu ahnen war. Bald würden sie auf einen träge fließenden Mündungsarm stoßen. Temosaran hob den Arm und rief:
»Das ist das Land, von dem die Händler berichten! Dort, rechts im Dunst, liegt das Meer, das sie das ›Große Grüne‹ nennen. Vor uns ist das Fruchtland.«
Die Pferde stemmten sich ins Joch, ihre Hufe wühlten durch den Sand, dann rannten die Tiere den langen Hang hinunter. Das Wasser zog sie an. Hinter dem braunhäutigen Mann, dessen schulterlanges Haar im Wind flatterte, knirschten und rumpelten die Scheibenräder des zweiten Wagens; er trug, hoch beladen, die gesamte Habe. Erst als die Pferdehufe das Gras berührten, zog der Häuptlingssohn an den Zügeln. Er wandte den Kopf, blickte um sich und glaubte, den Rauch erloschener Feuer zu riechen. Es war viel zu still. Links am Horizont, mit der Farbe der Dünen verschmelzend, erhob sich ein kantiges Bauwerk. Temosaran sagte leise:
»Vielleicht sind wir auf die Reste der Königsmauer gestoßen? Die Rômet haben mit diesen Stützpunkten und Türmen einst ihre Grenze geschützt – sagen die Händler.«
Er hob die Schultern. Nichts deutete darauf hin. Die Bronzelager ächzten, als Amtaras Wagen neben ihm hielt. Die Pferde senkten die Köpfe und zupften gierig an den fetten Halmen. Die junge Frau strich das Haar aus der Stirn.
»Du wirkst unruhig. Witterst du Gefahren?«
»Wir haben schon zu lange Zeit niemanden gesehen.« Seine Stimme wurde rau, auf den Unterarmen richteten sich die Härchen auf. »Wir sind in einem fremden Land. Ich denke, wir sind nicht allein hier.«
Er riss an den Zügeln und schlug mit der pfeifenden Rute zu. Die beiden Pferde wieherten grell, rissen die Köpfe in die Höhe und zogen den Wagen nach links. Als sie wild stolpernd galoppierten, rollte die linke Felge über einen Stein, der Wagen sprang hoch und fiel schwer zurück auf die krachende Achse. Vor beiden Gespannen tauchten zwischen Stämmen und Büschen viele Männer auf und starrten die Fremden schweigend an, aus großen, dunklen Augen. Wie eine bronzene Faust packte die Vorahnung von Gefahr und Tod den jungen Mann; vor ihm standen Schwerbewaffnete.
»Nein! Nicht das«, murmelte Temosaran. Er dachte daran, dass er weder ein Krieger war noch Waffen besaß. Die Gesichter der Männer trugen einen harten, hungrigen Ausdruck. Ihre Blicke, die sich auf Amtara richteten, waren ohne jedes Mitleid. Temosaran sah das Blitzen der Sonnenstrahlen auf den Blättern der Wurfspeere. Der Stich eisiger Furcht hielt seinen Herzschlag an. Die Krieger trugen Bronzebeile und große, fellbezogene Schilde, auf denen Tautropfen wie wertvolle Steine funkelten und glitzerten; es waren Soldaten des Rômetlandes. Temosaran hob die rechte Hand und lächelte unsicher, die leere Handfläche den Soldaten zugekehrt. Er rief mit unsicherer, dünner Stimme:
»Wir sind aus dem Osten, Herr!«
Er hielt den Wagen an, wickelte die Zügel ums Sitzbrett und blickte nach hinten. Amtara sprang ins Gras und kam auf ihn zu, ihr herzförmiges Gesicht trug den Ausdruck nackter Furcht. Temosaran sagte:
»Wir suchen Land, das wir bebauen dürfen. Wir haben uns offen und in Frieden genähert.«
Einer der Soldaten, der an den Oberarmen breite, golden blitzende Reifen trug, sagte mit halblauter Stimme einige kurze Sätze, die wie Befehle klangen. Temosaran verstand nicht ein Wort, aber der Sinn entging ihm nicht; der Tonfall sagte ihm alles. Er lehnte sich an den Wagenkorb und griff hinter sich, packte den Griff der kleinen Wurfaxt. Amtaras ängstliche Blicke gingen zwischen Temosaran und den Soldaten hin und her. Plötzlich schrie sie auf.
»Bitte! Nicht …«
Temosaran zog sie zu sich hinauf aufs Sitzbrett. Die Soldaten, ungefähr vierzig Männer mit sonnengegerbten Gesichtern, schlossen schnell einen Kreis um die Gespanne. Der Anführer deutete auf die Pferde, dann auf Amtara und zuletzt auf den Fremden. Durch die Stille des kühlen Morgens hallten einige Sätze der unverständlichen Sprache. Temosaran und Amtara sprangen vom Wagen. Der Häuptlingssohn legte den Arm um die Schultern der Frau und hob die Axt. Er hatte begriffen: Sie waren unerwünschte Fremde, die Grenze blieb undurchdringlich, und die Soldaten zwischen dem Mündungsdreieck und der Wüste handelten, wie es ihnen gefiel, wie sie es gewohnt waren. Fremde waren Feinde, Feinde wurden ohne Erbarmen getötet – es war hoffnungslos, Gnade erwarten zu wollen. Temosaran zwang sich dazu, trotz seiner Furcht langsam zu sprechen. Vielleicht verstand jemand ein paar seiner Worte.
»Keinen Kampf. Wir sind arm. Wir sind keine Feinde. Wir fahren zurück, wir …«
Hinter ihm glitt ein hochgewachsener Mann zwischen den Stämmen der bienenumsummten Dattelpalmen hervor, suchte mit seinen Augen den Blick des Anführers, und als der Mann mit den goldenen Oberarmreifen den Blick senkte, zog der Bogenschütze die Sehne bis zum Ohr aus. Temosaran hörte ein gellendes Sausen und spürte einen harten Schlag zwischen den Schulterblättern, einen glühenden Schmerz, der alle Gedanken auslöschte. Er sah, wie sich die blutige Pfeilspitze über seinem Herzen wieder aus der Brust bohrte, und brach mit ausgebreiteten Armen auf dem Gras zusammen. Seine Gedanken verwirrten sich, seine Beine zuckten, die Axt rutschte aus den kraftlosen Fingern, schlitterte über das taufeuchte Gras und bohrte sich in den Knöchel eines Soldaten. Temosaran drehte wimmernd den Kopf und hörte Amtaras ersten Schrei.
Die Soldaten griffen in die Zügel der Pferde und führten sie zur Seite. Die Rädernaben knarzten. Zwei Soldaten packten Amtara an den Armen, ein dritter riss das Kleid von ihren Schultern und presste die Hand auf ihren Mund. Man warf sie ins Gras. In den langen Augenblicken, in denen das Leben seinen Körper verließ, erfasste der Häuptlingssohn das Geschehen um sich herum in schmerzhafter Klarheit; alle Einsichten erhielten eine kalte Bedeutung, die sich auf die Frau richtete, der die Soldaten Gewalt antaten, und auf den Luftzug des Bronzebeils, das seinen Schädel bis zum Schulterknochen spaltete. Wirbelnde Gedanken, Trauer und Wut, lautlose Schreie und Schmerzen, die den Körper in ein glühendes, zuckendes Bündel verwandelt hatten – die Sonne wurde ausgelöscht. Temosaran starb, und der letzte bewusste Gedanke war wie grenzenlose Erleichterung.
Neun Schritte neben ihm, auf einigen fettigen Decken und muffigen Mänteln, lag Amtara auf dem Rücken, richtete die Augen in den wolkenlosen Himmel und wimmerte; Schmerz, Ekel und Scham überwältigten sie.
Schmerzen pochten unter meiner Schädeldecke, und die wenigen Bewegungen ließen die Muskeln zittern. Mein Verstand arbeitete schon ein wenig schneller, und ich begriff immerhin, dass sämtliche Einspielungen, Geräusche ebenso wie Bilder und Sprache, mein auftauendes Denkvermögen vor dem Wahnsinnigwerden bewahrten, vor dem Schock, nach langem Schlaf an der Wirklichkeit zu zerbrechen. Aber über meinem Erinnerungsvermögen schien eine dunkle Wolke zu liegen. Die lange Prozedur zwischen Aufgewecktwerden und voller Leistungsfähigkeit war jedesmal die gleiche Qual. Rico sprach langsam und gebrauchte eine Sprache, die ich verstand, aber erst nach langem Nachdenken als Sumerisch erkannte; es lag nahe, dass ich sie zuletzt gesprochen hatte. Zuletzt? Wann? Ich verstand mühsam:
»ES scheint dich geweckt zu haben, Atlan. Nach hundertsieben Jahren Schlaf. 6411 Larsafjahre nach Untergang von Atlantis. Du siehst Ereignisse, die sich seither östlich der Stadt Djanet ereigneten. In der ›Ostmark‹, im Hinteren Königsknabengau und im Östlichen Harpunengau.«
Ich brummte und murmelte etwas und zwinkerte. Rico verstand augenblicklich, hob die Hand und schaltete lautlos und unsichtbar. Auf den riesigen Monitoren erschien eine weitere Shafadu-Botschaft.
AN PEREMWAH, DEN TATJI DER GRENZTRUPPEN IM ASMACH, AN DER FÜRSTENMAUER, AUS DEM PALAST IN MENNEFER:
Seit fünfzehn Jahren, mein Freund, ist die Herrschaft unserer Gottkönigin Sebekneferu in andere Hände gelegt worden. Hunderte und Tausende der Eindringlinge aus dem Osten, die wir Heka Chasut, Herren der Fremdländer, nennen, wohnen nun in Amenti, unserem Land, in den Weiten des fruchtbaren Dreiecks, in Djanet regieren die Fürsten der Fremden. Lasse ab, gegen sie zu kämpfen, denn nunmehr sind sie unsere Herren im Mündungsdreieck. Zieh dich mit deinen Männern zurück von der Grenze, von den zerfallenen Türmen des Fürstenwalls. Und wenn du Befehle entgegennehmen musst von den Nomadenfürsten, so gehorche ihnen. Ein kleiner Teil des Reiches ist in ihren Händen; unsere Götter werden uns das Jahr und den Tag schenken, an dem wir sie machtvoll vertreiben. Dies schreibt dein Freund Aakenen. Verbrenne die Shafadurolle und versuche zu überleben, so, wie wir es tun.
VON AAKENEN-RE, DEINEM BEFEHLSHABER UND FREUND, AM 8. TAG DES MONDES THOT DER JAHRESZEIT ACHET, VOR DER HAPI-ÜBERSCHWEMMUNG.
Der alte Peremwah bewegte in einer herrischen Geste die Hand. Die Binsenmarkrolle fiel ins Feuer und verbrannte augenblicklich. Ein trockenes Lachen schüttelte den Körper des Mannes, der sehnig und mager wie sechzig Jahre aussah, aber nur vierzigmal die Überschwemmung erlebt hatte. Er lehnte sich auf dem Hocker aus Riedgeflecht zurück und blickte unter dem schmutzigen Leinenvordach der Laubhütte in die Wüste hinaus. Seine Stimme klang trocken wie Sand.
»Zu spät, Freund Aakenen, zu spät. Wärst du hier, dann würdest du sehen, dass wir den letzten Kampf vor uns haben.«
Die alte, heilige Ordnung des Hapireiches zerbröselte ebenso wie die Mauern und Türme der Befestigungen. Überall waren sie hereingesickert wie Sandflöhe, jene Fremden. Wenn diese Stelle des Fürstenwalls, bisher ein zuverlässiger Wall nahe Djanet, aufgegeben werden würde – er selbst würde es nicht mehr erleben, da er ins Heck der Sonnenbarke getragen wurde –, nähmen die Hirten der Fremdländer die Stadt und ihr fruchtbares Umland endgültig in Besitz. Peremwah befehligte knapp drei Hundertschaften Soldaten, alte, kampferfahrene Wüstensoldaten, zäh, von vielen Narben gezeichnet, nicht besonders gut bewaffnet und sorgenvoll, was den bevorstehenden Kampf betraf.
Das Knirschen von Räderfelgen ertönte durch den löchrigen Stoff der Seitenwand. Peremwah stand ächzend auf und ging hinaus. Der Späher lenkte die Tiere, Beute der vorletzten Kämpfe, auf ihn zu. Sie waren satt, gestriegelt und ausgeruht; man schonte sie bis zum Ende des Kampfes. Mit rauer Stimme sagte der Späher:
»Herr Peremwah. Sie sind da. Sie haben sich in Reihe hinter dem Hügel aufgestellt; ich habe zehn mal sieben Kampfwagen gesehen und das Blitzen vieler Waffen.«
»Wann werden sie angreifen, Metchetchi? Was denkst du?«
Seit Tagen herrschte in den Türmen und in deren Schatten die fast unerträgliche Spannung der Vorbereitungen. Pfeilspitzen, Speerblätter und die Klingen der Kampfbeile wurden geschliffen, bis sie wie Gold glänzten. Die Waffen glichen den Männern, die sie handhabten: seit Jahrzehnten benutzt, immer wieder ausgebessert, tödliche Werkzeuge, die auf ihre Träger abgestimmt waren. Vielleicht überlebten morgen einige Männer, die geschärften Waffen aber würden zerbrochen sein.
»Am Vormittag, Herr. Hast du besondere Befehle?«
»Nein. Sag’s auch Meresankh.« Peremwah schüttelte den kahlen Schädel. Alles war längst besprochen und gesagt. »Keine Befehle. Nur, zum letzten Mal, meine Frage: Wollt ihr kämpfen und sterben? Oder sollen wir uns, wie Aakenen riet, zurückziehen? Wenn die Kampfwagen der Heka Chasut auftauchen, ist es zu spät.«
»Ich habe alle Soldaten gefragt«, antwortete der Späher, der sich seit zwei mal zehn Jahren am Fürstenwall befand. »Sie werden kämpfen wie die Rasenden.«
»Nun, bei Sachmets Zorn. Dann werden wir alle sterben.« Peremwah legte die Hand auf den Brustgurt. »Es ist beschlossen. Mit uns stirbt der letzte Widerstand. Es dauert nicht mehr lange, dann werden sie über das ganze Hapiland herrschen, bis hinauf zur ersten Stromschnelle.«
Der Anführer und der Späher blickten sich schweigend an; mit Blicken, schwerer als die Äxte in ihren Händen. Sie hatten sich entschlossen, es gab kein Zurück, und sie waren die letzten Verteidiger, die mit Pferden und Wagen aus der Beute einiger Jahre kämpften. Peremwah hob den Arm. Der Unterarm war von einer Ledermanschette geschützt, die mit Bronzeschnallen und Kupfernieten verstärkt war. Metall und Leder zeigten lange Kratzer und tiefe Narben.
»Sag meinen Männern, dass wir den Angriff erwarten. Wir nehmen die Fremden mit ins Totenreich.«
Der Späher schlug die flache Hand gegen die lederne Brustplatte. Er lachte kurz.
»Beim großen Ptah! Einige der unzähligen Heka Chasut werden wohl überleben, denke ich.«
Die düstere Stimmung schien auch die Tiere ergriffen zu haben; mit hängenden Köpfen zogen sie den Wagen langsam an Peremwah vorbei in den Schatten eines Überdaches aus zerbröckelnden Lehmziegeln, mürbem Palmholz und splitterndem Binsengeflecht. Der Wachturm zwischen Fruchtland und Wüste war halb zerfallen, und die ersten Risse und Spalten waren seit fünfzig Jahren nicht ausgebessert worden. Nur Mut und Kampfgeist der Soldaten verfielen nicht. Peremwah hatte alles vorbereitet, was ihm den Weg ins Totenreich sicherte und eine Wiedergeburt im Glanz von Rê-Harachte: alle Gebete und ein Grab, in dem engbeschriebene Rollen voller Beschwörungen lagen. Er wusste, dass sein Tod unentrinnbar war, und überprüfte mit langsamen, bewussten Bewegungen seine Ausrüstung. Er knotete sorgfältig die Riemen der Sandalen, schnallte den Gürtel enger und prüfte die Pfeile im Köcher. Aus den Lederscheiden zog er nadelfein zugeschliffene Dolche und schob sie zurück, befestigte am linken Unterarm einen ledernen, mit Bronze beschlagenen Armschutz und spannte den abgegriffenen Bogen. Zwei Ersatzsehnen wickelte er ums obere Ende und legte die lange Kampfaxt mit dem halbkreisförmigen Blatt und dem langen Dorn vor sich auf das Tischchen. Schweigend starrte Peremwah in die Wüste, über deren Sand die Hitze flirrende Scheinbilder erzeugte.
Von seinen Männern kamen halblaute, knappe Rufe und Kommandos. Auf einem dreihundert Schritt langen Mauerstück standen Säulen aus Lehmziegeln; die meisten Querbalken waren heruntergebrochen. Aus den Bruchstücken hatten die Soldaten eine Art Brustwehr aufgeschichtet, am Ende der Mauer war vom Wind Sand bis zur Kante angehäuft worden. In Fugen und Rissen der Mauer steckten die alten, sorgfältig polierten Feldzeichen der drei Hundertschaften und funkelten hinüber zu den Angreifern.
Aus einem Krug, der von Wasserperlen beschlagen war, trank Peremwah einen langen Schluck kaltes Bier. Das letzte Henket. Der alte Soldat nahm seine Waffen auf, sah sich noch einmal um und ging zu seinen Männern. Sie waren bereit; der Kampf konnte beginnen.
Die Wagen waren handwerkliche Meisterwerke. Jede Handbreit war immer wieder geprüft und nachgesehen worden. Für Fahrten über den Sand hatten die Handwerker breitere Felgen gehämmert. Holz, Flechtwerk und die Lederverbindungen der Wagenkörbe waren vor einer halben Stunde mit Wasser übergossen worden und federten jetzt wie neues Material. Die Pferde waren auf Kämpfe abgerichtet; mit Befehlen, die man seit langer Zeit kannte. Mit Schreien und Flammen, stinkendem Rauch und einem listigen Vielerlei aus Belohnung, Schmerz, Strafe und guter Behandlung hatte man sie abgehärtet. Selbst wenn sie verwundet waren, würden sie jedem Befehl des Wagenlenkers gehorchen. Sie standen ruhig da, nur ab und zu zuckten Muskeln und ließen erkennen, dass auch die Zugtiere wie Bogensaiten gespannt waren. Hundertfünfzig Tiere vor fünfundsiebzig Wagen und zwei Mann in jedem Wagenkorb warteten auf das Signal. Männer und Tiere waren ebenso schnell und tödlich wie die Raubfalken der Berge in Retenu, woher sie gekommen waren. Am Ende einer langen Reise, die in vielen kleinen Abschnitten verlaufen war und nun endete, stand der entscheidende Kampf. Für diesen Teil des Landes war es der letzte Todesstoß; die Heka Chasut aus den Fremdländern wussten es ebensogut wie ihre Gegner.
In den Wagenkörben standen mittelgroße, braunhäutige und sehnige Männer mit dichtem, gekräuseltem Haar und dunkelbraunen Augen. Einige trugen kurze Bärte. In jedem Gesicht hatten sich die Falten der Anspannung eingegraben; die Münder zitterten, und Schweiß sickerte unter den ledernen Stirnbändern in die schwarzen Brauen. Die Heka Chasut wirkten, obwohl sie zumeist jüngere Männer waren, viel älter und erfahrener; sie trugen meist die gleiche Art der Bewaffnung wie die Soldaten des Hapilandes. Die Fremden wussten: Sie waren jung und hungrig, voller Eroberungsdrang, und die Verteidiger waren alt und wussten, dass sie verlieren würden.
Einige Anführer zitterten vor Ungeduld. Innere Dämonen schienen sie vorwärts zu treiben. Scharek, der die Truppe ausgebildet hatte und befehligte, war sicher, dass er der nächste Herrscher der Stadt Djanet sein würde; er oder Apophis, sein wildester Krieger, der Meister der Wurfaxt. Hinter der Reihe der Gespanne warteten noch mehr ausgeruhte Krieger mit neuen Waffen, frischen Pferden und Binden für die Wunden. In der Mitte der weit auseinandergezogenen Wagenreihe hoben einige Männer geschwungene Hörner an die Lippen. Scharek senkte das Kampfbeil. Ein schauerlicher Laut, der auf- und abschwoll, fuhr über die Reihe dahin. Die Pferde zuckten mit den Ohren, rissen die Köpfe in die Höhe und keilten aus, mühsam von den Zügeln gehalten, die an die Haltegriffe geknotet waren. Die Krieger banden ihre Gürtel an die Schlaufen in den Wagenkörben, bronzene Waffen blitzten, der letzte Ton verhallte gleichzeitig mit dem grellen Wiehern. Nach einigen Atemzügen dröhnten die Hörner ein zweites Mal auf. Die Wagenlenker stießen gellende Schreie aus und gaben die Zügel frei.
Die erste Gruppe, ungefähr vierzig Gespanne, löste sich aus der Reihe. Unter wirbelnden Pferdehufen staubten Sandwolken hoch. Die Männer bogen ihre Körper nach hinten, Peitschen knallten und streiften Kruppen und Hälse der Tiere. Felgen schnitten parallele Linien in den Sand. Zuerst bildeten die Hufschläge ein leise donnerndes Geräusch, dann, als sie schneller wurden, schien der Boden zu zittern. Das dumpfe Trommeln war der Laut, der die Angriffslust aufs äußerste anstachelte. Als die Kanten des Turms und die bröckelnden Säulen hinter den Dünen auftauchten, vollführten die Wagen hinter Scharek eine halbe Wendung und zogen sich zu einer langen Reihe auseinander.
Die Bogenschützen, links von den Wagenlenkern angeschnallt, griffen über die Ränder der Wagenkörbe, zogen Pfeile aus den Köchern und legten sie auf die Sehnen. Ihre Bewegungen erfolgten fast gleichzeitig. Die Lenker hoben die Schilde und schirmten die Oberkörper ab. Wieder änderten die Wagen die Angriffsrichtung: Sie fuhren schräg aus der Reihe heraus und auf die Rômetsoldaten zu, die Pferde gingen im schärfsten Galopp, und der Trommelwirbel der Hufe ließ Sand und verdorrte Pflanzen aus den Quaderfugen rutschen.
Hinter den Steinen standen Rômetsoldaten auf, spannten ihre großen Bögen und drehten sich halb, um die Ziele zu verfolgen. Hundert Heka Chasut schossen fast gleichzeitig; es war eine fast rituelle Eröffnung des Kampfes. Die Sehnen hämmerten gegen bronzene und lederne Armschutze, die Pfeile heulten durch die Luft, und fast jeder zweite Pfeil traf. Wenige Atemzüge lang verwandelte sich der Raum hinter der Mauer in ein wildes Durcheinander. Pferde, in deren Haut, in Hälsen oder Augen Pfeile zitterten, kreischten auf, keilten nach allen Seiten und zerschlugen Deichseln oder zerrissen das Zuggeschirr. Pfeile steckten in Schilden und Wagenkörben; einige Heka Chasut waren von Geschossen ans Flechtwerk genagelt worden. Pfeile steckten in Mauerfugen, in den Schultern der Rômet-Bogenschützen und in Schilden. Einige Soldaten waren verwundet, andere starben im Sand und auf Ziegelquadern, andere hingen vornüber auf der Brustwehr. Am rechten Ende der Rampe hatten Soldaten die Vorderfüße zweier Pferde zertrümmert und die Lenker angegriffen, gerade in der Zeitspanne, als diese nach dem nächsten Pfeil gegriffen hatten. Die erschlagenen Fremden lagen neben den röchelnd wiehernden Pferden im Sand. Wieder erkannten die Rômetsoldaten, dass die Waffen der Heka Chasut aus besserer oder besser bearbeiteter Bronze bestanden als ihre eigenen Waffen.
Die Streitwagen bogen ab, tote Pferde wurden aus dem Geschirr geschnitten. Die Fremden, die sich an den Wagen zu schaffen machten, wurden von Peremwahs besten Bogenschützen aus hundertzehn Schritt Entfernung in den Hals getroffen und getötet. Von vierzig Gespannen kamen vierunddreißig zurück zur Angriffslinie hinter dem Hügel. In den Wagenkörben standen, von Gurten gehalten und vom zweiten Mann gestützt, zehn tote Angreifer; jeder von einem meisterlichen Pfeilschuss getroffen. Wieder heulten und dröhnten die Hörner. Einige Schützen der Rômet tauchten die Pfeilspitzen, um die Lumpen gewickelt waren, in Ölkrüge und hielten sie an Glutkörbe. Mit wenigen Schüssen wurden die liegengebliebenen Wagen in Brand gesetzt. Fünfzehn Gespanne ratterten auf den Turm zu.
Peremwah wusste, dass dieser Teil des Kampfes nicht mehr als ein unbedeutendes Geplänkel darstellte. Jene Männer, die ein schneller Pfeil getötet hatte, zählten auf beiden Seiten zu den Glücklichen dieses Tages. Peremwah winkte seinen Späher Meresankh heran.
»Es sind zu viele für uns.« Meresankh schüttelte seinen Köcher. »Wir können sie aufhalten, aber nicht besiegen.«
»Also ein langer Kampf.«
Peremwah legte ruhig neun Pfeile vor sich auf die Barriere. Jenseits der Rauchsäulen aus den brennenden Gespannen erhob sich, wie der Vorbote eines Sandsturms, eine Wolke aus feinem Staub, aus der blitzender Widerschein von Waffen schoss, von wirbelnden Läufen galoppierender Pferde und metallbeschlagenen Rundschilden. Peremwah machte seine Soldaten mit knappen Armbewegungen auf die Angreifer und die Verteidigung an beiden Seiten der Anlage aufmerksam.
»Wenn die Nacht beginnt, werden es weniger von ihnen sein.«
»Aber dann ist von uns keiner mehr übrig.« Meresankh sprang hinter eine Säule und schoss schweigend und mit kaltem, verschlossenem Gesicht einen Pfeil nach dem anderen ab. Mit jedem Pfeil traf und tötete er einen Fremden. Neben ihm jagte Peremwah seine Geschosse über die Brustwehr. Er versuchte, Männer zu treffen, nicht die Tiere. Ein Pfeilhagel prasselte rings um ihn in die bröckelnden Mauerteile. Eine Pfeilspitze schnitt eine blutende Spur in seinen Schultermuskel, eine andere prallte vom Armschutz ab, der Pfeil heulte davon.
Als die letzten Wagen heranknirschten und unterhalb der Mauer entlangrasten, riss Peremwah einen Wurfspeer aus dem Binsenkorb, schwang ihn und schleuderte ihn schräg abwärts. Ein Gespannlenker fuhr in das Geschoss hinein, das lange Blatt bohrte sich in den Magen des Fremden. Ein grauenhafter Schrei war zu hören, als der Wagen vorbeifuhr. Brandpfeile schlugen ins Geflecht des Wagenkorbes und setzten es in Flammen. Pferde, deren Mähnen und Schweife brannten, zerrten Wagen richtungslos in die Wüste. Gespanne kippten in Sandwolken um, Räder wirbelten durch die Luft wie Schleudersteine; eines sprang bis zur Mauerkrone und köpfte einen Bogenschützen. Die Fremden, von den eigenen Zugtieren zu Tode geschleift, brüllten, bis sie das Bewusstsein verloren. Der zweite Angriff war vorbei, die dritte Welle flutete heran wie die Brandung am Strand.
Der Kampf wurde erbitterter. Es gab kaum noch Pausen. Peremwah rannte umher, schrie anfeuernde Befehle, schleuderte Speere und wirbelte herum, als er sah, dass zwei fremde Streitwagen den Turm halb umfahren hatten und von hinten anzugreifen versuchten. Er schrie:
»Meresankh! Hinter dem Wall!«
Der hagere Soldat mit der Narbe auf der Wange begriff. Sie liefen zum eigenen Gespann, schwangen sich in die Körbe und knoteten die Zügel los. Schläge mit den Lanzenschäften und Stiche mit Bronzeblättern ließen die Tiere erschreckt aufwiehern und fast aus dem Stand in Galopp fallen. Rad an Rad schleuderten die Wagen über die halb versunkene Straße am Fuß des Turms auf die Eindringlinge zu und wurden schneller. Meresankh und Peremwah hoben Wurflanzen und holten mit dem rechten Arm weit aus. Die Linke hielt die Zügel. Mit gellenden Kriegsschreien feuerten sie sich gegenseitig an und machten die Pferde halb rasend. Die Fremden blickten überrascht um sich, fingen sich schnell und hoben die Bögen. Die ersten Pfeile summten über die Köpfe der Soldaten, die beiden nächsten bohrten sich in die Wagenkörbe, dann war die Entfernung für einen Lanzenwurf erreicht. Die Lanzen warfen die Bogenschützen rückwärts aus dem Wagen. Sie überschlugen sich im Sand; als die Körper liegenblieben, hatte sie das Leben schon verlassen.
Mit einem harten Ruck warfen Peremwah und Meresankh die Gespanne herum, aus der Geraden in voller Geschwindigkeit auf die feindlichen Wagen zu. Peremwahs Stimme schwoll an.
»Jetzt, Meresankh!«
Beide Männer schnellten sich rückwärts aus den Wagenkörben, umklammerten die Knie und zogen die Köpfe ein. Sie rollten im aufstäubenden Sand ab, richteten sich auf und fassten die Griffe der Kampfäxte. Die Schneiden blitzten, als sie Halbkreise über den Köpfen der Rômet beschrieben und die Schädel der Wagenlenker trafen, die in einem unentwirrbaren Knäuel schreiender, um sich schlagender Tiere sowie den Trümmern der vier Wagen verkeilt waren. Meresankh und der Anführer rissen Waffen und gefüllte Köcher der Fremden aus dem Geflecht und rannten zurück an ihre Plätze am Turmstumpf. Als sie die Deckung erreichten, ratterten und polterten die Wagen des vierten oder fünften Angriffs in einer Sandwolke heran.
Ich wusste es, sagte sich Peremwah, während er versuchte, gleichzeitig zu erkennen, was an verschiedenen Stellen vor sich ging. Die Fremden sind genauso mutig wie wir, ebenso gute Krieger, und sie gehorchen ihrem Anführer. Das ist es, was sie zu Siegern macht. Das und ihr Machthunger.
Er rammte einem Angreifer, der am Griff eines Wurfankers hing und sich über die bröckelige Mauerkante schwingen wollte, den Stachel der Axt zwischen die Augen. Der Schrei des Fremden riss ab, als er im Sand aufschlug und von einem Gespann zertrampelt wurde. Neben der Gürtelschnalle hämmerte ein Pfeil in Peremwahs Gürtel und riss eine dreieckige Wunde über der Leber. Eine breite Bahn Blut sickerte durch den Schutz über den Schenkel. Peremwah brach den Pfeil ab und kämpfte weiter.
Neben ihm kippte ein Soldat einen Glutkorb in ein Gespann, das hart unter der Mauer wendete. Aufgewirbelter Sand biss in den Augen, in den Nüstern und zwischen den Zähnen. Die ebenen Flächen vor den Dünen hatten sich in einem weiten Halbkreis um den Turm in eine Zone des Todes verwandelt. Reste von Wagen schwelten und rauchten. Sterbende Männer und tote Pferde lagen im Sand oder versuchten sich wegzuschleppen. Überall lagen und steckten zerbrochene Waffen. Die Brustwehr starrte von Pfeilen. Über ihren lockeren Blöcken lagen etwa hundert tote Rômet. Schon näherten sich neue Krieger mit ausgeruhten Pferden und unversehrten Wagen. Die Zeit verging in trostloser Langsamkeit; der Kampf ging weiter, und auf beiden Seiten starben mehr Männer.
Die Gruppe der Rômet war zusammengeschmolzen und hatte sich um den inneren Bezirk rund um den Turmstumpf versammelt. Auf dem Dach des Tempelchens knieten Bogenschützen und schossen, scheinbar ungerührt vom Geschrei der Verwundeten und den Rauchwolken, auf die Angreifer. Die meisten Pfeile trafen. Über der Kampfstätte lag eine Wolke aus Rauch, Staub, Sand und Gestank, aus der süßlicher Blutgeruch und Schweiß der Männer wehten. Es roch nach Erbrochenem und dem Inhalt der Pferdedärme, die sich in Radspeichen verfangen hatten. Blut trocknete im Sand. Herrenlose Pferde rannten mit nachschleifenden Zügeln zwischen den Kämpfenden hin und her und schrien; ihre Hufe klapperten gegen Schilde und Köpfe von Sterbenden und Toten.
Kurz nach Mittag: Die Sonne stach fast senkrecht herunter und spießte die Männer auf dem Boden und den glühendheißen Steinen fest. Schweiß floss in Strömen. Ab und zu rettete sich ein Soldat ins dunkle Innere des Tempelchens. Dort standen im Schutz wuchtiger Lehmziegelmauern große Krüge voll Brunnenwasser. Halbwegs erfrischt stürmten die Männer wieder in die Grelle, um sich in den Kampf zu stürzen. Noch kämpften vielleicht zehn Dutzend der Rômet.
Die Heka Chasut hatten mit all ihren Gespannen und den wenigen Fußkämpfern einen Kreis um die Reste der Festung geschlossen. Die verletzten Tiere wurden fortgeschafft, die verwundeten Männer trugen die fremden Krieger in den Schatten. Zwischen zu Asche verschwelenden Wagen und toten Pferden humpelten alte Männer mit Keulen und erschlugen die Sterbenden mit Steinkeulen – ohne Unterschiede zwischen eigenen Männern und denen des Gegners zu machen. Hoch über dem Rand der Fruchtzone schwebten die ersten Geier. Rabenvögel, die das Fleisch der Leichen witterten, kreisten am Rand der Dünen und krächzten schauerlich. Ihre Schwärme wurden größer und dichter, aber noch wagte sich kein Vogel zur Stätte des Todes hinunter. Einige Frauen liefen zwischen den Gespannen umher und reichten den Männern Krüge und tropfende Tücher. Ein Schrei; eine dichte Wolke von mehr als hundert Pfeilen fegte die letzten Bogenschützen vom Tempeldach. Peremwah schloss betäubt die Augen; kaltes Grauen packte manche Soldaten, als ihnen die zuckenden Körper der Freunde vor die Füße fielen. Die Männer sahen aus wie die pfeilgespickten Zielscheiben, an denen sie einst lange geübt hatten.
Ein doppeltes Kreischen ertönte. Zwei Soldaten, deren Beherrschung sich auflöste wie ein Trugbild, sprangen mit Schaum auf den Lippen aus der Deckung zwischen den Säulenstümpfen und rannten auf die Fremden zu. Sie waren mit Schilden, Dolchen und Kampfäxten bewaffnet. Tief aus ihren Kehlen kamen seltsame Schreie, als sie zuschlugen. Sie bewegten sich so schnell, dass Peremwah Mühe hatte, zu erkennen, was sie anrichteten. Die Schneiden der Kampfbeile spiegelten Sonnenstrahlen in alle Richtungen, als sie herunterfuhren, schnitten, Wunden rissen und Knochen spalteten. Dumpf dröhnten die Schläge auf den Schilden. Als die Klingen brachen, warfen die Soldaten, noch immer kreischend und heulend wie Tiere, die zerbrochenen Waffen und die Schilde auf die Gegner, die vor Schrecken starr standen. Die Rômet packten mit beiden Händen die Dolchgriffe und sprangen die Gespanne an – nun töteten sie in kalter, stummer Raserei. Einige Atemzüge lang herrschte die Stille des Entsetzens. Mit seltsamem Klatschen schlugen Pfeile in die Körper der Rasenden. Die Verwundungen hielten sie nicht einen Herzschlag lang auf. Sie bluteten aus Dutzenden Wunden, sprangen aber noch immer hin und her und stachen zu. Ein Mann sprang in einen Wagenkorb, erdolchte von hinten den Lenker, wurde von einem Speer gegen den Korb gepresst und biss sich im Hals des Bogenschützen fest, dessen Dolch – während das durchgehende Gespann die Rampe hochfegte, halb auf der Krone der Mauer entlangratterte und geradeaus über die künstliche Schanze flog – sich immer wieder in den zusammensackenden Körper des Soldaten bohrte. Mit unbeschreiblichem Krachen überschlugen sich die Tiere mitsamt dem Wagen und den blutigen Körpern in dessen Korb. Peremwah erkannte, dass der Wahnsinn nach seinen Kameraden gegriffen hatte. Er starrte in Meresankhs Augen und deutete auf das blutgetränkte, rauchende Trümmerfeld.
»Der Kampf ist es nicht, den ich hasse«, sagte er tonlos. »Ich habe schon immer das Aufräumen danach verflucht.«
Der Freund starrte ihn fassungslos an, versuchte ein Lächeln und schüttelte stumm den Kopf. Zur linken Hand trieb ein Kämpfer eine Lanze zwischen die Schulterblätter eines Fremden, und der Sterbende schleuderte in einer letzten Anstrengung den Dolch in die Kehle eines Mannes, der auf ihn zurannte, das Beil in Schlaghaltung. Peremwah schloss die Augen; kaltes Entsetzen schüttelte ihn trotz des Bewusstseins, ein Todgeweihter zu sein. Als eine Handbreit neben seinem Gesicht eine Speerspitze kreischend am Stein entlangratschte, griff er nach dem Bogen und suchte den nächsten Gegner. Der Kreis der Angreifer schloss sich enger und undurchdringlicher. Wieder starben Fremde und Soldaten; die Rômet nahmen mehr Fremde ins Schattenreich mit, als sie es sich hatten vorstellen können. Langsam beschrieb die Sonne, Rê-Harachtes sengendes Gestirn, ihren Weg über den durchdringend blauen, wolkenlosen Himmel. Neben Peremwah starb Meresankh, den gleichzeitig zwei Pfeile durch den Hals trafen. Irgendwann, nach einer schauerlichen kleinen Ewigkeit, unter den Strahlen der Frühabendsonne, wurde es so still, dass jedes Keuchen auffiel. Peremwah blickte um sich und trank einen Rest Bier, wischte Blut und salzigen Schweiß aus den Augen.
»Beim Horus des letzten Horizonts.« Er krächzte; seine Stimme begann zu versagen. »Mir ist, als sei ich allein.«
Er sah sich um. Zwischen den Säulenresten und Wänden des Inneren Turms gab es nur noch tote und schwerverletzte Soldaten. Peremwah dachte an das schöne Leben, das er nach der Fahrt mit der Sonnenbarke führen würde. Er zog den Dolch und murmelte:
»Das furchtbare Dunkel der Fremdherrschaft senkt sich jetzt über unser Land. O ihr Götter! Keiner kämpfte tapferer als ich und meine Soldaten. Was ist es, das die Fremden so antreibt?«
2.
Ich hatte begriffen, was ich gesehen hatte, aber ich erkannte die Bedeutung hinter diesem erbittert rasenden Kampf nicht, der nur Teil einer gewaltigen Auseinandersetzung sein konnte. Wieder senkte sich Mattigkeit über meinen Körper, und mein Verstand weigerte sich, tiefer ins Geschehen einzudringen und eine Analyse zu versuchen. Ich merkte, dass andere Maschinen und Geräte sich um mich kümmerten, ehe ich einschlief: Das Gefühl, neu geboren worden zu sein, hatte ich nach so vielen Weck- und Reanimationsphasen nicht mehr. Bevor sich meine Gedanken verloren, blitzten zwei Begriffe oder Namen durch den dunkelgrauen Nebel: Zakanza-Upuaut und Ptah-Sokar.
Projektionen der Planetenoberfläche, Ziffern und Zahlen, ein halbes Hundert kurzer und langer Berichte über Naturkatastrophen, Inseln und kleine Reiche, die aufblühten oder verschwanden, eine Dokumentation Ricos über das letzte Jahrhundert des Hapireiches und die Folge seiner göttlichen Herrscher, über Kupfer und Bronze, Gubla und die Insel Kefti, über das Schicksal meiner früheren Gefährtinnen, die längst zu Asche zerfallen waren, über Ricos erfolgreiche Versuche, seinen Robotkörper und seinen positronischen Verstand nicht nur menschenähnlicher, sondern auch leistungsfähiger, »klüger« und autarker zu gestalten, einige Erklärungen über mein Erwachen aus dem langen, totenähnlichen Schlaf; ich fühlte mich von Tag zu Tag stärker, vermochte Fragen zu stellen und die Antworten zu verstehen, erkannte klar, dass mit einiger Verzögerung meine zwei menschlichen Freunde der gleichen Wiederbelebungsprozedur unterworfen wurden und im stählernen Gefängnis am Meeresgrund von mir und Rico erfahren wollten, was die Vergangenheit verbarg und die nahe Zukunft für uns bereithielt. Und … warum wir geweckt worden waren.
Zum ersten Mal meldete sich ruhig, fast beschwichtigend mein Extrahirn: Die Versuche, den achten Mond zu vernichten, hast du bewusst erlebt. Ebenso die Kämpfe um die Große Stadt Babyla. Auch in der folgenden Zeit wird euch ES als willfährige, gut funktionierende Werkzeuge behandeln. Gib acht, Arkonide!
Ich entsann mit, dass ES meine Erinnerungen ausradierte, wie es ihm gefiel. Irgend etwas fing wieder von vorn an. Die Namen meiner Freunde hatte ES nicht gelöscht; durchs Halbdunkel der Monitorenebene erkannte ich drei Puppen, an denen Kleidung und Ausrüstung hingen. Auf den ersten Blick sahen sie aus, als würden wir uns im Hapiland bewegen müssen. Totale Desorientierung! Tausend Fragen! Keine Antwort. Ich zwang mich zum Warten, Schlafen, an Kraftmaschinen unter Solarlampen zu arbeiten und zu versuchen, die Gegenwart, wie immer, schrittweise zu begreifen. Ich bedeutete Rico, mich wieder unter den Einfluss der Reanimationsbatterien zurückzubringen.
Sieben Tage und Nächte später, als ich mich richtig bewegen und überlegt handeln konnte, überfiel mich, mitten in den Versuchen, die Veränderungen an der Oberfläche von Larsaf Drei in ein gedankliches System zu zwängen, das Gelächter von ES, das meinen Schädel zu sprengen schien. Ich kannte jene dröhnenden Laute meines makabren Befehlsgebers, meines schrecklichen Herrschers. Dass ES uns geweckt hatte, wusste ich vom treuen Rico, und jetzt sprach, lautlos und mit seltsamem Nachhall, ES zu mir – auch zu Zakanza-Upuaut und Ptah-Sokar? Ich wusste es nicht.
Ich habe euch lange schlafen lassen. Deine Barbarenwelt, Arkonide, war nach meiner Meinung ruhig und ohne aufregende Zwischenfälle. Die üblichen Kleinkriege, die üblichen Machtkämpfe kleiner Fürsten, die meist vergeblichen Versuche der Barbaren, die, ohne wirklich zu wissen, was sie tun, sich zu einer besseren Zukunft entwickeln. Und ihre zahllosen bluttriefenden Irrtümer auf diesem überaus langen Weg zu diesem kaum erreichbaren Ziel.
Mein Kehlkopf, der Gaumen und die Lippen waren inzwischen fähig, klare Worte zu formulieren. Ich stellte die erste Frage.
»Und warum sind wir geweckt worden?«
Ich leckte über meine Lippen. Sie fühlten sich nicht mehr trocken und spröde an. Die Antwort ertönte in meinem Verstand augenblicklich.
Weil mir auf Wanderer, dem Kunstplaneten, derzeit nicht unweit einer herrlichen Barbarenwelt, ein bedauerliches Missgeschick unterlaufen ist. Ich weiß, dass du nicht nur in der Lage bist, diese Fehlentwicklung zu beseitigen, sondern dies auch, weil du auf dem Planeten umherreisen kannst, gern und mit persönlichem Einsatz betreibst. Dass dir deine Freunde helfen, ist ein vorteilhafter Nebennutzen.
Ich lehnte mich zurück und umspannte die Knie mit meinen Händen. Ich sagte laut, fast protestierend:
»Wenn du von ›bedauerlichem Missgeschick‹ sprichst, bedeutet es für deine halb willenlosen Geschöpfe eine mittlere, existenzbedrohende Katastrophe!«
Das ist zutreffend, Wächter des Planeten! Vor etwa zwei Jahrhunderten in der Berechnung der Barbarenwelt verselbständigte sich ein Spiel, das sich zwei meiner Androiden ausgedacht hatten. Es war, um deinen Zeitbegriff zu präzisieren, gegen Ende der Herrschaft einer weiblichen Gottkönigin aus der Sippe Amenemhets und Senwosrets. Sie hieß Sebekneferu. Du weißt, dass das Land am Hapistrom schon immer das Ziel einzelner Menschen, von Familien, Horden, Gruppen und Stämmen war. Vielen wurde die Erlaubnis erteilt zu bleiben; sie wurden als Bauern, Handwerker oder Sklaven gebraucht und erreichten ein Leben in bescheidenem Glück niedriger Stände. Das änderte sich, als die Barbaren aus Osten eindrangen, mit Pferden und leichten Kampfwagen. Hast du begriffen, was ich berichtete?
Ich nickte und versuchte mich erfolgreich an meine eigenen Erfahrungen und an Ricos Berichte über das Land der Rômet zu erinnern. Die Stimme, die in meinem Schädel zu hallen schien wie in einer riesigen Höhle, sprach weiter:
Seit etwa dieser Zeit verstärkt sich der Druck fremder Einwanderer auf das Land. Sie kommen ebenfalls aus dem Osten, aus dem Asmach. Das Gebiet südlich der Lagunen und das fruchtbare Mündungsdreieck sind die letzte Station einer langen Wanderung. Nur nahe der Stadt Djanet können die Einwanderer vordringen, denn weiter südlich versperren die Gebirgsausläufer den Wagen jeden Weg. Die Rômet nennen die Fremden »Heka Chasut«; du übersetzt es zutreffend mit »Fürsten der Fremdländer«. Sie verachten Ackerbestellung und Viehzucht und haben schnell viele, aber nicht alle wichtigen Stellen im Unteren Hapiland besetzt. Sie haben das Pferd und den leichten Wagen endgültig ins Land gebracht. Die Zivilisation, die Bräuche und die hohe Kultur des Landes haben sie korrumpiert; einige Kampfwagenfürsten wurden zu Herrschern. Rico kennt ihre Namen: Scharek, Sekenen-Rê, Apophis, Seworen-Rê-Chian oder Nebshepesh-Rê-Apophis. Diese Umstände waren aber nicht der Grund, euch aufzuwecken.
»Sondern?« Ich gähnte wieder. Ich verarbeitete die Information, von der die Bedeutung von Ricos Einspielung klarer wurde. Der Schock würde für Ptah und Zakanza größer sein als für mich. ES schien zu zögern.
Das Spiel, von dem ich sprach, machte sich selbständig. Auf Wanderer wurden einzellige Molekülverbände entwickelt, mit der Wirkung programmierbarer Parasiten. Zunächst dienten sie zur Ermittlung statistischer Daten; auf Wanderer laufen bevölkerungspolitische Untersuchungen. Es wurden zwei Gruppen getestet; mit sämtlichen Fähigkeiten für die Sicherung eines interessanten Versuchs. Die Zielsetzung war: Wie kann in kürzester Zeit und mit geringstem Aufwand ein Weltreich gegründet werden? Zwei Spieler dirigierten je bis zu zwölf Figuren.
»Der Versuch hat Ähnlichkeiten mit der Beziehung zwischen dir und mir«, sagte ich nicht ohne Bitterkeit.
Du hast recht. Unterschiedliche Probleme erfordern oft identische Lösungen. Das Spiel lief. Vierundzwanzig Parasiten sammelten bei ihren Wirten eine gewaltige Datenmenge und lernten deren Verhaltensweisen. Sie nahmen Anweisungen für Spielzüge an. Während des langen Spiels entwickelten sie Eigenleben und Selbstinitiative, blieben aber steuerbar.
Zum ersten Mal meldete sich in meinen Überlegungen der Logiksektor: Du ahnst, was folgt? Was ES dir befehlen wird?
Beide Spieler flüchteten in einem unkontrollierten Augenblick von Wanderer, und ich bin sicher, dass der dritte Planet von Larsafs Stern ihr Ziel war. Ich weiß nicht, ob sie noch leben und wo sie sich befinden. Aber ich muss als sicher annehmen, dass sich vierundzwanzig Parasiten auf deiner Welt befinden. Ebenso sicher scheint mir zu sein, dass sicheine große Zahl auf Angehörigen der Heka Chasut niedergelassen hat. Sie überleben ohne Wirt nur kurze Zeit.
Der Logiksektor hatte recht behalten. Ich erkannte das Problem, das ES hatte – bald war es auch mein Problem. Ich fragte laut:
»Was bewirkt ein Wanderer-Parasit bei seinem Träger? Wie erkennen wir, ob ein Mensch von einem deiner Spiel-Sukkuben besessen ist? Wie erkenne ich einen Parasiten? Denn dein Befehl wird sicher lauten: Suche und zerstöre die Parasiten!«
Rico drehte sich halb zu mir herum; ich wusste nicht, ob er die ES-Stimme ebenfalls hörte.
Wieder ist deine Annahme richtig. Wenn die Spieler tot sein sollten, bekommen die Parasiten keine Befehle mehr. Leben die Spieler noch, erhalten die Geschehnisse eine ganz andere Bedeutung. Aus einem unwichtigen lokalen Prozess wird eine geplante Einmischung, in der sich Spiel in bitteren Ernst verwandelt. Ihr kennt das Land am Hapi, du und deine Freunde. Ich versprach dir zuverlässige, langlebige Helfer. Nun hast du sie. Sie sind einige Tage nach dir voll einsatzfähig.
Die Aufgabe erschien mir schwer zu lösen. Ich hatte Hunderte von Fragen. Einige würden sich an der Planetenoberfläche klären, andere erforderten jetzt und hier klare Antworten.
»Das Spiel probte und lehrte, wie ein Weltreich zu errichten sei. Wie übermitteln die Spieler die Befehle an die Parasiten?«
Durch eine Kombination von Funk und speziellem Bildfunk mit gedanklichen Symbolen und Primärempfindungen.
»Wozu sind Befallene in der Lage? Haben sie besondere Fähigkeiten?«
Intelligenz, Einfallsreichtum, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen sind drastisch heraufgesetzt.
»Fähigkeiten, die aus großer Entfernung leicht festzustellen sind.« Ich lachte sarkastisch. »Wir werden es wohl höllisch schwer haben, Spieler und Parasiten zu finden. Wenn der Wirt stirbt oder zu alt wird, wechselt der Parasit den Wirt, nicht wahr?«
Die Körperkräfte des Wirts wachsen nicht notwendigerweise. Parasiten liegen flach an der Haut an und sind nur zu erkennen, wenn sie sich in höchster Erregung färben, wenn sie sich ablösen oder sterben. Sie verwandeln sich dann in handflächengroße Flecken, kleben über dem Herzen, unter den Achseln, über dem Magen oder zwischen den Schulterblättern oder Schenkeln. Innerhalb von etwa fünfzig Stunden müssen sie den Wirt gewechselt haben, wenn sie überleben wollen.
»Ich glaube nicht, dass wir die Parasiten finden.« Ich hob die Hand und winkte Zakanza zu, der sich auf seinem Lager aufrichtete; ich sah ihn auf dem Monitor.
Ihr werdet von mir mit gesteigerter Aufmerksamkeit, entsprechenden Geräten und gehorsamen Mitarbeitern ausgestattet.
»Wenigstens ein Lichtblick! Was tun wir, wenn wir Spieler oder Parasiten finden?«
Sie sind augenblicklich zu vernichten. Ihr Wirken kann die Geschichte des Planeten, auf dem du lebst, in einem Maß beeinflussen, das unkorrigierbar ist.
»Töten also. Wir sind wieder einmal deine Henker?«
Wie ich bist du ein Hüter des Planeten. Erinnere dich, dass du einen feierlichen Schwur abgelegt hast. Diese deine Erinnerung habe ich nie angetastet.
»Ich entsinne mich genau.« Der zweite Monitor zeigte mir Ptah auf seiner Liege, umgeben von der Batterie der Wiederbelebungsgeräte. ES sprach weiter:
Du entsinnst dich also. Gut. Ich helfe euch, wie ich es stets getan habe: Informationen, Ausrüstung sind von Rico gewohnt perfekt vorbereitet. Deine und eure Masken werden nicht mehr als eine veränderte Identität sein. Vielleicht wird eure schwierige Mission länger dauern, als ich es jetzt überschauen kann, vielleicht dauert sie eine Generation lang. Ich werde euch beobachten und wieder mit euch sprechen, wenn ihr euren Einsatzort erreicht habt. Nehmt es nicht allzu schwer, Arkonide; ihr werdet es überleben, wie so vieles. Für gewisse zusätzliche Reize, Belohnungen und Überraschungen trage ich Sorge.
ES verabschiedete sich mit seinem furchtbaren Gelächter. Rico kam auf ledernen Sandalen quer durch den Raum und legte seine braune Hand auf meine Schulter.
»Es wird eine Mission, bei der du all deinen Einfallsreichtum und viel Kraft brauchen wirst, Atlan.«
»Mehr als das.« Ich zuckte mit den Achseln. »Ehe wir uns an die Oberfläche wagen, müssen wir uns informieren und erholen. Hol alle deine Spionsonden-Aufnahmen aus den Speichern und zeig uns die jüngste Vergangenheit des Hapilandes.«
»Du wirst auch Aufnahmen von Städten und Gebäuden sehen, die nach deinen Vorstellungen aufgebaut worden sind.«
»Das höre ich gern, Rico«, sagte ich und krempelte die weiten Ärmel hoch. »Bring Zakanza und Ptah ihre Bademäntel. Ich muss in Ruhe nachdenken. Ich kann die wahren Schwierigkeiten unserer Aufgabe noch nicht übersehen.«