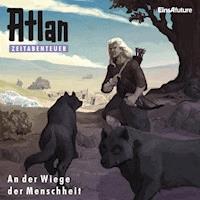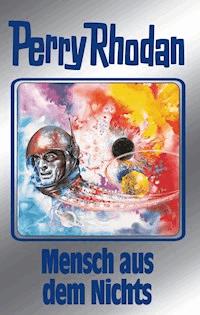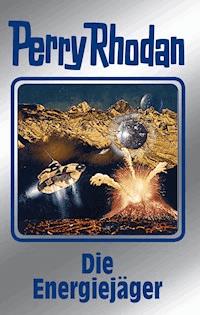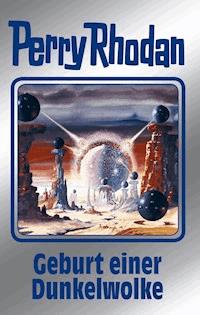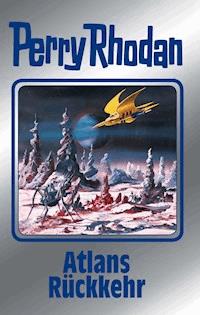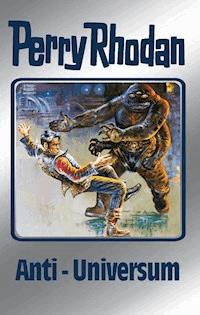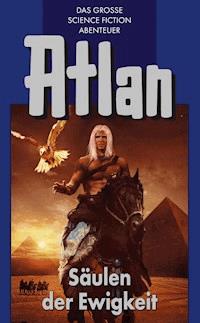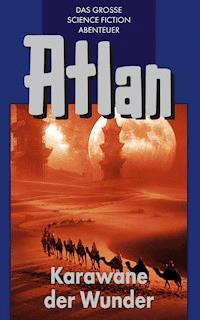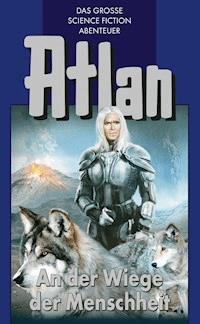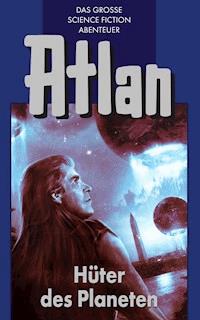Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ATLAN X
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mitte des 17. Jahrhunderts: Der Arkonide Atlan, der seit Jahrtausenden auf der Erde weilt und sich als "Paladin der Menschheit" versteht, wird in seiner Tiefseekuppel geweckt. Seltsame Ereignisse erschüttern das westliche Europa – aufgrund eines Hinweises der Superintelligenz ES muss Atlan aktiv werden. Mithilfe seines Roboters Rico rüstet er sich zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Seinen Weg kreuzen der englische Heerführer und Revolutionär Oliver Cromwell sowie der französische Musketier D'Artagnan. Darüber hinaus trifft Atlan auf zahlreiche wichtige Persönlichkeiten der Jahre 1648 bis 1652. Er muss sich sogar mit Schwarzen Messen und unheilvollen Entführungen auseinandersetzen. Die wichtigste Person aber, auf die er trifft, ist eine Art Pandora, eine schöne Frau mit unheilvollem Erbe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kristallprinz in Not
von Hans Kneifel
Cover
Rückentext
1. Die Zelle
2. Der Caballero
3. Leben und sterben
4. Liebe und Tod
5. Signale: Ciron de Beauvallon
6. Tod im Herbst
7. Der schlafende Arkonide
8. Gracianas Weg
9. Gefahr für Atlan?
10. Die Botschaft
11. Frühlingsritte
12. Lilith
13. Carundel Mills
14. Die Duelle
15. Oliver Cromwell
16. Das Kloster in der Extremadura
Mitte des 17. Jahrhunderts: Der Arkonide Atlan, der seit Jahrtausenden auf der Erde weilt und sich als »Paladin der Menschheit« versteht, wird in seiner Tiefseekuppel geweckt. Seltsame Ereignisse erschüttern das westliche Europa – aufgrund eines Hinweises der Superintelligenz ES muss Atlan aktiv werden. Mithilfe seines Roboters Rico rüstet er sich zu einem ungewöhnlichen Einsatz.
Seinen Weg kreuzen der englische Heerführer und Revolutionär Oliver Cromwell sowie der französische Musketier D'Artagnan. Darüber hinaus trifft Atlan auf zahlreiche wichtige Persönlichkeiten der Jahre 1648 bis 1652. Er muss sich sogar mit Schwarzen Messen und unheilvollen Entführungen auseinandersetzen. Die wichtigste Person aber, auf die er trifft, ist eine Art Pandora, eine schöne Frau mit unheilvollem Erbe ...
1.
Die Zelle
Zur Mittagsstunde, als der letzte Nachhall der Glocke sich in der reglos glühenden Weite des Hügellandes verloren hatte, setzte sich Sor Graciana de Carvajal y Lopez an den steinernen Tisch. Die Stille, wie an jedem Tag bisher, war betäubend, wie in der Mitte eines abgeernteten Kornfelds in den Hügeln der Extremadura. Im schütteren Schatten der Eiche, auf dem Tisch neben der Mauer, strich Graciana das Schreibblatt glatt und tauchte den Federkiel ins Tintenfass. Der Tropfen schien zu gerinnen, wie Blut in der Hitze. Das Gesicht der Frau, schmal und großäugig zwischen der isabellfarbenen Habbe, trug einen Ausdruck zwischen Hoffnungslosigkeit und ungebärdigem Willen. Die Stille zerriss; im Eichbaum begann eine Zikade zu lärmen. Graciana löste die Blicke von den Quadern ihres Gefängnisses und betrachtete das Gras des Gärtchens, das vier zu sechs Schritte maß. Außerhalb des Schattens waren die Halme längst welk geworden, so wie manche Blätter der Eiche.
Jetzt, da ich weiß, dass ich niemals wieder mit einem Menschen außerhalb dieser Klostermauern reden werde, niemals wieder in ein anderes Gesicht außer dem einer Monja, einer Mitschwester, blicken werde, bewundere ich meinen Entschluss. Aber gleichzeitig hasse ich mich, meinen Körper, dieses Gefäß der Unreinheit, wie die Superiora sagte. So wie ich Halme, heruntergefallene Eicheln und Quader zähle, so wie ich die Anzahl der Steine in der Mauer und meiner Zelle kenne, weiß ich, dass ich vierzig, vielleicht fünfzig oder sechzig Jahre lang allein – schlimmer:einsam – sein werde. Danach werden alle Bedürfnisse des Körpers und des Verstandes erloschen sein, werden sein wie Asche, die von wildem Feuer übrigblieb, und die der kalte Winterwind davonwehen wird in grauen Schleiern.
Gracianas gequälte Gedanken hatten im vergangenen Monat, in jeder einzelnen Stunde, in den Erinnerungen gegraben und sich zwischen die dicken Schichten des beginnenden Vergessens geschoben, die sich wie verrottende Laubschichten eines Waldes übereinander legten. Ein Dutzend oder mehr Jahreszahlen hatte Graciana entdeckt, die zutreffend oder ungenau sein mochten, die ihr ferner waren als der Ring des Saturn. An Namen und Geschichten, die ihr diese Zahlen zuwisperten, erinnerte sie sich, an Bedeutungsvolles und Sinnleeres, an das Entsetzen über sich selbst und alles, was wenige Schuldige und viele Unschuldige ihretwegen erlitten hatten. Graciana konnte über alle Zeit dieser Welt ebenso verfügen wie über ihre Gedanken und, in ausreichendem Maß, über sich selbst. Sie würde nicht vor der Zeit sterben; ihre Gesundheit glich der des Eichbaum, dessen Stamm die Wunde der fehlenden Korkrinde trug, und unter dessen Geäst sie weiterschrieb.
Der Raum, den ich für den Rest meines Lebens ausgesucht und mit Gold bezahlt habe, ist ein Vielfaches des Platzes, den die Sklavenverkäufer meiner Großmutter gaben. Zusammen mit 359 männlichen und weiblichen Sklaven, von falkengesichtigen Askaris geraubt, war sie unter Deck des Schiffes Virgen de Montserrat angekettet.
Es war im Jahr des Herrn 1609, wahrscheinlich, als das Schiff von África zum südlichen América segelte; und als die Virgen im Hafen festmachte, lebten nur noch 219 Sklaven. Drei Dutzend Mädchen und Frauen waren von den Seeleuten vergewaltigt und geschwängert worden. Großmutter Mdanbai hatteÜbelkeit, Kot, Wassermangel und dürftiges Essen überlebt, und trotz allem hatte sie ihre dunkle, jungfräuliche Schönheit behalten.
2.
Der Caballero
Die Zikade schwieg. Gracianas Feder kratzte über das Papier; die Tinte trocknete viel zu rasch. Die Sklavenkäufer nahmen nur junge Männer ohne Bart und junge Mädchen mit stehenden Brüsten. Aus den Kellern der weißen Festungen am Meer führten nur schmale Schlitze in den dicken Mauern ins Freie. Es war ein Weg ohne Rückkehr, wenn die Gefangenen im harten Sonnenlicht das Meer vor der Küste ihres Landes und die dümpelnden Schiffe sahen. Auch Mdanbai, die klirrend zusammengekettet mit den anderen Opfern in die Festung – von denen es ein halbes Hundert an jenen Küsten gibt! – verschleppt worden war, ging diesen hoffnungslosen Weg. Ihre Schönheit und die Größe ihres Körpers hatten sie davor geschützt, vergewaltigt und geschwängert zu werden; man wusste, dass im Generalcapitanat Cuba und überall im Vizekönigreich Nueva España viele Maravedis für künftige Konkubinen gezahlt wurden. Señor Rodríguez de Yuste, der Herr der Gold- und Silberschmiedezunft Noble Arte de la Platería, kaufte Mdanbai für eine große Anzahl Pesos, deren Menge ich nicht kenne.
Er behandelte sie gut, wie alle Neger und Negerinnen; für ihn und seine Leute galten geprügelte, halbverhungerte Sklaven als Zeichen schlechter Haushaltsführung. Mdanbai erhielt reichliches Essen, angemessene Kleidung und, aus Rodríguez' Laune heraus, einen neuen Namen: Albadolores. Sie verstand, dass ihr altes Leben vor siebzig Schiffstagen unwiderruflich von einem Tag zum anderen geendet hatte, schickte sich darein und passte sich den Wünschen des Herrn – den jedermann »Señor Caballero« oder »Señor Hidalgo« nannte –, dem Haushalt und denGebräuchen an, lernte die Sprache, sog jeden Funken, jedes Gran Wissen in sich auf und befolgte mit scheinbar unerschütterlichem Gleichmut jeden Befehl.
Sie flocht ihr starres schwarzes Haar zu dünnen Zöpfchen und hörte zu, wenn der Herr Caballero von Diego de Avarra erzählte, oder dessen Sohn Federico, und von dessen Capitán, dem weitgereisten Atlan de Gonozal y Arcón, einem Mann von einzigartigem Mut, Können und Wissen, mit einem großen Herzen und einem fröhlichen Lachen, das ihn als Freund begehrenswert machte.
Öfter und länger ruhten die Blicke des verwitweten Señor auf Albadolores, oft und lange schob er seine Hände in die schwellende Fülle unter ihrem weißen Wams, zunächst zögernd, dann begierig, und in einer Sturmnacht machte er sie, die sich lächelnd weder zierte noch sträubte, zu seiner Geliebten. Vier Monate danach war Albadolores geschwängert; sie begann den alternden Mann, wenn nicht zu lieben, so doch zu achten, und brachte ein Mädchen zur Welt, das den Namen Ysabel erhielt, und das, ein Jahr später, der Señor Caballero anerkannte.
Nach mehr als zwölf Jahren wollte Rodríguez de Yuste, alt, krank und reich geworden, nach Spanien zurückkehren. Bevor er, Albadolores und Ysabel an Bord der Santa Angela de Zaragoza gingen, starben Albadolores und Ysabels Halbbruder, der älteste Sohn, binnen einer langen Woche an einer unheilbaren Blutkrankheit, einer seltsamen Art von weißglühendem Wechselfieber, das weder die Spanier noch die Sklaven oder die Eingeborenen kannten.
Die kleine Ysabel hatte von ihrer Mutter erfahren, dass das Schiff viele Tage lang auf einem Kurs dorthin segelte, woher einst das Sklavenschiff gekommen war, auf dem gleichen Ozean, nach Sanlucar, Santander oder Gijón in Spanien; auch den Namen des Hafens, in dem sie anlegten, weiß ich nicht mehr.
Als armer Mann hatte Señor Rodríguez einst das verfallendeSchlösschen verlassen, das unter Korkeichen auf einem Hügel stand, von dem man an klaren Tagen in der Ferne Kloster Yuste sehen konnte. Im Lauf vieler Jahre hatte sein unregelmäßig geschicktes Geld geholfen, die Gebäude wiederherzustellen. Auf den Ländereien arbeiteten Dutzende Bauern für den Herrn des Dörfchens. Trotz seiner Greisenkrankheit, schweigend um Albadolores trauernd, vom König mit einigen Gerechtsamen und bedeutungslosen Titeln ausgezeichnet, ordnete, verschönerte und vergrößerte der Señor seinen Familienbesitz, auf dem Ysabel mutterlos aufwuchs, aber ebenso unbeschwert wie andere Mädchen – zwischen Kornfeldern, kleinen Herden schwarzer Schweine, Schafherden, Eichenwäldchen und hitzestarrenden Gebäuden, die in den Mittagsstunden ausgestorben waren wie tausendjährige Ruinen von Burgen, wie sie auf einigen Hügeln ringsum zu sehen waren; abgeschieden im Läuten der Glocken, deren Klänge sich über das Land legten wie Fetzen eines nassen Rahsegels. Die erstarrten Formen spanischer Erziehung und höfischen Benehmens lernten sie, aber weder der Schatten von Kloster Yuste noch der des Königshauses reichte bis ins verschlafene Städtchen oder gar durch die Mauern von Casa de Yuste. Hauslehrer, die für Essen und ein Bett arbeiteten, und eine Gouvernante unterrichteten sie und den jüngeren Bruder. Seltsame Bücher lasen sie, aus der Bibliothek des Caballero; abergläubische Bauern, alte Frauen und Schäfer sagten, dass sie an beiden Kindern viele Zeichen zu erkennen vermochten, die vom fernen, feuchtheißen América sprachen, in dessen Ländern alles oder wenigstens vieles, das in Spanien gewöhnlich war, wunderbar und unverständlich blieb.
Als Ysabel de Yuste fünfzehn war, starb ihr Bruder, vom Huftritt eines scheuenden Pferdes neun Schritte weit durch die Luft und an eine Mauer gewirbelt. Als sie sechzehn war – eine großbrüstige Schönheit, mit blauschimmerndem schwarzem Haar und schwellenden Lippen, lachend und wild wie eine nicht eingerittene Stute, klüger als der eigene Vater, wagte nur Andrés de Carvajal y Lopez, der Sohn des benachbarten Großgrundherrn, um sie zu werben.
Mit ihm und seinen Altersgenossen hatte Ysabel außerhalb der Mauern des Dorfs gespielt, sich geprügelt, versteckt und wieder vertragen, als sie noch Kinder waren. Das Haus de Carvajal, größer und reicher als die Besitztümer der de Yuste, galt viel im kargen Land der Extremadura, dem Land der Klöster, Eichen und Burgen.
Andrés de Carvajal nahm Ysabel zur Frau.
Es war eine schöne Hochzeit beider Häuser, denn Andrés und Ysabel liebten einander. Nach zwei Jahren wurde Ysabel, meine schöne Mutter, von Andrés schwanger und gebar mich, Graciana de Yuste y Carvajal y Lopez. Vier Jahre danach kam mein Bruder zur Welt. Und während ich aufwuchs, geborgen im Schoß der Eltern, reifend im heißen Licht der Extremadura, von allen geliebt wegen meiner Schönheit, erzählte mir Vater von seinem ungefähr gleichalten Freund Gaspard de Rochemont, einem glänzend ausgebildeten, aber verarmten Herzog und Offizier des französischen Kardinals Richelieu, und von Atlan (oder Adlon), Graf von Le Sagittaire de Beauvallon, dem Sohn oder Enkel des Weltumsegler-Capitáns, dessen Freund Gaspard wurde. Rochemont war lange Gast im Schlösschen Sagittaire im Land der Franzosen gewesen, einem schlichten Gemäuer voller Seltsamkeiten, und ich lauschte, auf seinen Knien geschaukelt, jedem Wort von Vaters glühenden Schilderungen.
Wir wuchsen auf wie alle Kinder reicher Familien: sittsam und bildungshungrig, wild und frei. Die Freiheiten, die wir uns auf den Hügeln und in den Tälern des Landes nahmen, über dem Adler und Geier kreisten, hatte kein anderes Kind im Dörfchen. Es war leichter, sich zwischen eineinhalb Dutzend Mägden und Knechten in einem Schlösschen zu verstecken als in der Enge eines Bauernhauses. Und welcher Bauernjunge würde je mit einem einarmigen Fechtmeister üben dürfen so wie mein Bruder und ich?
Der Tod, das grausige Sterben um mich herum begann, als ich vom Kind zur Frau reifte, in der verstörenden Blutzeit nach meinem vierzehnten Lebensjahr.
Zuerst starb mein Vater.
Mutter Ysabels gelocktes, blauschwarzes Haar färbte sich binnen dreier Monde grau. Ich habe, anders weiß ich es nicht, an nichts anderes erinnere ich mich, keinen Menschen mehr geliebt, keinem mehr vertraut als Vater. Ein solches Glück widerfuhr mir erst viel später – unter einzigartigen Umständen.
3.
Leben und sterben
Pilar de Baeza zügelte ihren Schimmel, als wir den Schatten der Eichen auf dem Hügel erreicht hatten. Vor uns, auf einer riesigen weißgelben Fläche, brachten Bauern die Kornernte ein. Jeder heiße Windhauch wehte Schleier aus Staub und Spelzen über die Felder; Vogelschwärme pickten nach den gelben Körnern. Pilar stützte sich auf den Sattelknauf, sah mich mit müden Augen an und hob die Schultern, als ob sie fröre.
»Ich bin müde. Mein Hals tut weh.« Sie legte die Hand an die Stirn. »Und hier drinnen bohrt und klopft es.«
»Dann reiten wir nicht weiter«, sagte ich und winkte dem Reitknecht Pablo, der uns als Wächter folgte. »Ich bring dich zu euch, ins Haus; lege dich in ein dunkles, kühles Zimmer.«
»Das ist wohl das Beste«, sagte Pilar und kicherte dünn. Sie flüsterte: »Vielleicht waren wir auch etwas zu stürmisch, Enrique und ich, in den letzten Nächten.«
»Komm mit!« Ich ritt an, wendete und trabte neben ihr zu Pablo. Die Pferde trabten ins grelle Sonnenlicht, den Hang hinunter und unter den Alleebäumen zur Mauer, die den Besitz von Pilars Eltern umgab. Enrique und Pilar!, dachte ich und lächelte in mich hinein. Ich hatte ihn mindestens ein halbes Jahr früher als sie verführt, trotz Hunderter wachsamer Augen, alles, was er konnte, gelernt und seine ausdauernde Leidenschaft genossen. Ich führte die Schwankende in die Halle des Hauses, fühlte ihren Puls und legte die Hand auf ihre Stirn.
»Fieber, liebste Freundin«, sagte ich leise. »Schick nach mir, wenn du dich erholt hast.«
»Ich versprech es. Schon bald.« Sie nickte schläfrig. Ihre Mutter und eine Dueña trugen sie halb ins dämmerige Innere des Hauses. Ich ging zu Pablo, der die Zügel hielt.
»Die junge Herrin ist bald wieder gesund«, sagte ich. Er half mir in den Sattel. »Du musst mich nicht nach Hause begleiten, Pablo.«
»Ich hab' meine Befehle.« Er verbeugte sich und rückte den Hut in die Stirn. »Eure Mutter sorgt sich, Graciana.«
»Nun, sie soll sich nicht sorgen.« Ich kitzelte den Rappen mit den Sporen. Wir ritten zur Casa Carvajal; ich ließ mir die Reitstiefel ausziehen, öffnete ein Fenster der Bibliothek und suchte ein Buch aus, in dem ich bis zur Dunkelheit und der abendlichen Mahlzeit las. Die Erschöpfung, die während der Erntenächte die Menschen befiel, war ebenso wie die weitabgewandte Stille und die Burgruinen Teil dieses Landes. Unsere Welt endete, als läge sie zwischen Mauern oder breiten Flüssen, drei oder vier Reittage rund ums Dörfchen; was jenseits der Landesgrenzen um das Jahr 1640 geschah, erfuhren wir viel später, und unendlich wenig davon veränderte unser Leben.
Das Volk Lusitaniens – oder Portugals – stand gegen Spanien auf und krönte schließlich Herzog Johann von Bragança zum König Portugals; plötzlich teilte wieder jene alte Grenze unser Land. In England herrschte Bürgerkrieg: Gegen den rechtmäßigen König Karl den Ersten kämpfte der Bürgerliche Oliver Cromwell. Der Dreizehnte Ludwig, Frankreichs König, so hörte man, war ebenso krank wie Richelieu, der Kardinal Frankreichs. In Deutschland tobte seit langem ein Krieg, in dem alle Länder gegeneinander zu kämpfen schienen, und während sich die Katalanen gegen unseren König erhoben, kämpften Frankreichs Heere auch gegen Spanien, nicht nur gegen den Kaiser, den Dritten Ferdinand. So viele Kriege, so viele Verwundete, so viel Zerstörung! Im Dörfchen Yuste arbeiteten lediglich eine Handvoll Handwerker für den Krieg, und wir erfuhren nur von wenigen Bauernburschen, die sich als Soldaten anwerben ließen und aus dem abendlichen Paseo am Marktplatz verschwanden. Herzog Oliváres regierte unser Land, in dem die Armut auch wegen der Kosten der Kriege gegen die Niederlande zunahm; in den großen Landgütern, auch in Casa Carvajal, die sich gegen die Verarmung stemmten, gab es für Mensch und Getier genügend zu essen, denn wir hatten keine großen Ansprüche.
Drei Tage nach unserem kurzen Ausritt besuchte ich Pilar. Der große, kühle Raum, in dem ihr Bett stand, roch nach Krankheit und Fäulnis. Obwohl nur wenig Licht durch die Sprossenfenster einsickerte, sah ich, wie elend sie war: Ihre ältere Schwester und Mutter Baeza flüsterten, dass das Fieber gestiegen sei, und dass keine Medizin die Halsschmerzen und die Kopfschmerzen lindern konnte, und dass Pilar nichts im Magen behielt. Der Médico war ratlos.
Anfälle von blutigem Durchfall marterten ihren Körper. Die Stellen, wo Niere und Leber saßen, waren geschwollen und schmerzten. Im Fieberschlaf röchelte Pilar halb verständliche Fetzen ihrer Albträume hervor. Mein Herz blutete, als ich meine Hand auf ihre Brust legte; ihr Körper unter der trockenen Haut schien innerlich zu verbrennen.
»Der Médico kann weder helfen noch lindern«, murmelte Pilars Mutter. »Er ist ebenso verzweifelt wie wir. Wir beten und zittern um sie – sie ist doch noch so jung!«
Als sie anfingen, die blutigen Laken zu wechseln, ging ich. Pilar lag besinnungslos da und hatte niemanden erkannt. Sie sah wie eine Sterbende aus; in vielen Büchern meines Vaters fand ich viele Zeilen über die furchtbare Pest, aber nichts über diese Krankheit.
Zwölf Tage, nachdem ich Pilar nach Hause gebracht hatte, starb sie. Rasendes Fieber schüttelt und verbrannte ihren Körper. Aus allen seinen Öffnungen trat Blut aus, das zuletzt nicht mehr gerann. Aus Pilars Mund kamen Worte, die von Vorstellungen der Hölle und den Martern furchtbarer Träume sprachen. Pilar war nicht mehr ansprechbar, und nur ihr Durst, der ebenso raste wie das Fieber, zeigte den Angehörigen und dem Médico, dass sie noch einen Funken Leben besaß.
Ich sah aus den blutigen Leichentüchern nur einen Teil ihres Gesichts, als wir sie ins Grab senkten. Die Haut war weiß wie eine Sommerwolke, das Gesicht glich einem Totenschädel, und überall war Blut.
Zwei Tage nach ihr – wir hörten es vom Médico und vom Schmied, der in unserem Stall Pferde beschlug – starb der Schmiedegesell Enrique, der Meister feinrankender Hoftore und Türbeschläge, auf die gleiche, furchtbare Weise. Als ich es erfuhr, wurde mein Körper zuerst eisig kalt und erstarrte, dann schien auch mein Blut zu kochen. Hatte Pilar ihre rätselhafte Krankheit auf Enrique übertragen? Oder hatte er sie angesteckt?
Ich rannte verwirrt weg, schloss mich in der Bibliothek ein und lauschte in mich hinein: Ich empfand mich als gesund.
Zwei Dienerinnen im Haus Baeza starben fünfzehn Tage nach Pilars grausigem Ende. Ihr Tod war ebenso qualvoll wie das lange Sterben Pilars und Enriques. Die Knechte und Mägde tuschelten und wisperten angstvoll: Ihre Hände hatten Pilar berührt, hatten die blutigen Tücher, Hemden und Laken fortgetragen und das Blut, das nicht gerinnen wollte, am Dorfbach und in den Zubern herausgewaschen. Die Strafe des Himmels für mangelnde Frömmigkeit und Gottesfurcht, rief der Pfarrer im Dorfkirchlein, und jeder, der davon hörte, bekreuzigte sich. Meine Mutter bekam es mit der Angst zu tun und schickte mich und Bruder Modesto ins Haus der Yuste, wo ich zwei Jahre im Haushalt meiner Großeltern blieb, ohne dass der blutige Tod wieder seine Sense schwang.
Anno Domini 1645, als ich achtzehn Sommer jung war, stellten mir nicht weniger als ein Dutzend junger Männer nach. Es waren Söhne der reicheren Familien, ein paar Studiosi und der kurzsichtige Sohn des Apothekers, der mir zuflüsterte, er kenne einige Geheimnisse der Alchimisten. Vielleicht glaubte er es sogar selbst. Ich war verwirrt, obwohl es mir gefiel, angestarrt und besungen zu werden.
Meine Jungfräulichkeit hatte ich Enrique geschenkt. Ich wusste, dass ich in den Augen vieler Männer eine Verworfene war, oder Schlimmeres, aber keiner würde es je erfahren.
Meine Mutter schob mich eines Abends vor den Spiegel des Ankleidezimmers, der aus vier übereinander haftenden Glasplatten bestand und unsere Körper dreiteilte. Mutter Ysabel lächelte; ihr Atem roch nach Wein.
»Sieh dich an, Liebes«, sagte sie. »Du und ich, wir und unsere Blutlinie, wir stammen von einer Negerin ab, von der schwarzen Albadolores aus África, die eigentlich Mdanbai hieß. Wir haben die großen, goldfarbenen Augen und das feine Bräunliche unserer Haut. Und die schönen Brüste, die alle Männer loco machen, die langen Beine.« Sie seufzte und wickelte eine graue Strähne ihres hüftlangen Haars um den Finger. »Allen Männern fallen die Augen aus den Köpfen. Aber was sie nicht sehen, ist hier drinnen.«
Sie legte die Spitzen der Zeigefinger an unsere Stirnen und an die Brust. Ich bemühte mich zu verstehen, was sie meinte; schlief etwa ein Raubtier tief in uns? Ihr Blick schien den Spiegel durchbohren zu wollen. »Du wirst es verstehen, wenn du alt genug bist, Graciana. Wir erkennen die Welt mit den Augen, mit allen Sinnen und in der Art von Tieren, die handeln müssen, weil sie nicht denken. Schnelle, schlanke Raubtiere. Das Erbe der dunklen Wälder und der Wüsten. Vieles werden wir nie wissen, aber wir spüren mehr als andere Menschen.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich spüre vieles, aber nicht so wie ein Tier.«
Sie streichelte meine Arme und wandte sich ab.
»Du bist noch zu jung. Eines Tages wirst du sagen: Meine Mutter hat recht gehabt.«
»Das mag sein.« Ich sehnte mich nach einen atemlos schnellen Ritt, nach Hitze, Wind und Leidenschaft in den Armen eines kräftigen jungen Mannes. »Eines Tages werde ich die Extremadura verlassen und selbst erleben, was in der Fremde geschieht.«
Wir wechselten einen langen Blick voller Verständnis im Spiegel. Ich wusste nicht, wie es in der Welt außerhalb Spaniens aussah. Alles, was wir erfuhren, war einen langen Weg über viele Boten gegangen, und jeder, der zuhörte und weitererzählte, mochte etwas weggelassen oder hinzugefügt haben. Meine Mutter starrte mich an; es war wie ein vorweggenommener Abschied. Ich wandte mich vom Spiegel ab.
»Der Tag ist noch nicht gekommen, Mutter«, sagte ich leise. »Ich glaube, dass ich noch nicht reif genug bin, um mich in einem anderen Land durchzuschlagen. Es muss etwas Gewaltiges geschehen, bevor ich Casa Carvajal verlasse.«
Mutter nickte nur. Es schien, als habe sie alles verstanden und weit in die Zukunft hineingesehen. An der Art, in der wir in der Abgeschiedenheit des Hügellandes weiterlebten, änderte sich nichts. Der Einfluss des Klosters San Jerónimo de Yuste, in dem König Karl der Fünfte vor einem knappen Jahrhundert sein Leben beendet hatte, fiel weit ins Land, aber er reichte nicht in die Verschwiegenheit unserer Kammern.
Seit jenen Blicken in den Spiegel trug ich die Gewissheit in mir, mehr zu sein – oder anders zu sein als andere junge Frauen: In mir verbarg sich das ferne, wilde Erbe aus der Geschichte eines Landes, das ich nicht kannte. In der Tiefe meiner Selbstbetrachtung war África ein Land wunderbarer, lockender Begebenheiten.
Zwei Jahre lang warb Guillermo Sarás, der Apothekersohn, um mich. In dieser Zeit las ich begierig jedes Buch, das ich in die Hände bekam, lernte vom Dorflehrer einige Brocken der französischen Sprache und von einem Deserteur, der sich bei uns versteckte, einigermaßen gut den Umgang mit der Sprache der Engländer. Ich ritt, focht mit meinem Bruder Modesto und übte das Schießen mit der alten, rostigen Reiterpistole unseres Vaters, ließ mich von Guillermo betasten und entzog mich seinen Griffen, und während ich ihn quälte, ohne mir dessen bewusst zu sein, lernte ich von ihm die Kunst, aus den Wurzeln, Pflanzen, Blüten und Rinden verschiedene Arzneien zu machen; ich kannte bald jede Medizin, die einschläferte, die Sinne verwirrte, Schmerzen vergessen machte oder rasch tötete. Vielleicht von einer Dienerin, der es Großmutter Albadolores gelehrt hatte, kannte Mutter Pilar einen Kräutersud, in dem eine Frau Leinenstreifen eintauchte und auf kundige Weise vermied, schwanger zu werden.
Dies lernte Guillermo von mir, und als er begann, den Frauen des Dörfchens, den Mägden und Dienerinnen damit zu helfen, verdiente er gutes Geld; erst als sein Selbstbewusstsein gefestigt war, verführte ich ihn inmitten seiner dampfenden und rauchenden Kräuterküche.
Eines Nachts, Ende Anno Domini 1647, im strömenden Regen, schleppte sich ein dürrer, entkräfteter Klepper stolpernd in unseren Hof, brach zusammen und zuckte, bis ein Knecht dem Rappen die wild pochende Kehle durchtrennte, mit den Läufen. Den Reiter, der nicht viel weniger erbärmlich aussah, führten die Diener in die Wohnhalle. Er stand da, triefend und schlammverdreckt, ausgezehrt, hungrig und durstig, aber seine Stimme war kräftig, als er sich nicht ohne Stolz verbeugte und sagte:
»Ich habe lange nach Casa Carvajal gesucht. Andrés de Carvajal mag von mir erzählt haben – Gaspard de Rochemont ist mein Name. Mir scheint, ich bin am Ende, und bevor mich mein Stolz verkommen lässt, nahm ich seine Einladung an.«
Mutter Ysabel, einen Becher heißen Würzwein in den Händen, ging auf ihn zu. Gaspard stand mit dampfender Kleidung vor dem Feuer. Er blickte unsere Mutter an, als erscheine sie ihm wie ein Wunder.
»Mein Mann Andrés ist seit Jahren tot. Ich bin Ysabel de Carvajal, die Herrin des Hauses«, sagte sie leise. »Willkommen auf dem Gutshof der Carvajal. Wir haben hundert verwegene Geschichten von Euch und über Euch gehört.«
Sie reichte ihm den Becher. Er leerte ihn in kleinen Schlucken und ließ sich den nassen Mantel abnehmen.
»Kaum die Hälfte davon ist wahr, Edle Herrin«, sagte er und schwankte. »Danke für das Willkommen. Darf ich Euch um ein trockenes Strohlager bitten – ich glaube, dass ein Mundvoll guter Schlaf mich vor vielem retten kann?«
»Andrés würde es missbilligen«, jetzt lächelte meine Mutter so herzlich, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen hatten, »wenn wir Euch nicht das weichste Bett bereiten würden. Setzt Euch zu uns; an gutem Essen mangelt es nicht.«
»Dass Andrés tot ist, betrübt mich zutiefst.« Er senkte den Kopf. Ich blickte ihn unverwandt und schweigend an. Er war aus einer der fremden Welten zu uns gekommen, die jenseits der Grenzen mit ihren Wundern und Wunderlichkeiten auf mich warteten. »Ich war sicher, dass wir noch etliche fröhliche Abende miteinander ...«
Er schwankte, ließ den Becher fallen und sackte zusammen. Mit grässlichem Klirren zerbarst das leere Tongefäß auf den Bodenfliesen. Wir kümmerten uns um Monsieur de Rochemont, und eine halbe Stunde später schlief er im breiten Bett einer warmen Kammer, zwar halb besinnungslos, aber mit einem zufriedenen Lächeln im Bartgestrüpp seines hageren Gesichts.
Heute weiß ich nicht mehr, auf welchem Schlachtfeld, in welchem Krieg und in welchem Land sich mein Vater Andrés und Gaspard de Rochemont getroffen hatten; in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich oder Spanien. Ich hab's vergessen, obwohl es mein Vater berichtet hatte. Gaspard war zu stolz, darüber zu reden, aber es schien, als habe jeder dem anderen einige Male das Leben gerettet. Gaspard schlief mit kurzen Unterbrechungen zwei Tage lang, verschwand im Waschzuber, ließ sich Bart und Haar scheren und zog einige Kleider an, die Mutter von den Dienern und meinem Bruder lieh oder in der Hinterlassenschaft ihres Gatten fand. Die Schwäche und der lange Schlaf zitterten noch in Gaspard, als er sich zum späten Frühstück zu uns setzte. Fahles Licht der Wintersonne ließ Rußflocken und Staub in der Luft tanzen.
»Der Krieg«, sagte Gaspard, trank einen Becher honigsüße Milch und sah sich um, »den man wohl den Krieg der dreißig Jahre nennen wird, ist zu Ende. Unzählige sind gestorben, noch mehr verstümmelt, und Deutschland ist von einer Grenze zur anderen verwüstet. In Frankreich, woher ich komme, begehrt der Adel gegen die absolute Herrschaft des Königs auf. Das Land ist kaum weniger arm dran als das unselige Deutschland; Kardinal Mazarin, Vorsitzender des Kronrats und Richelieus Nachfolger, vermag gerade die Armeen zu bezahlen, nicht aber andere Rechnungen, die Renten und die Gehälter. Jeder, der Steuern zahlen muss, wimmert und flucht über deren Höhe. Bald wird es auch deswegen im InnerenFrankreichs große Unruhe geben, wenn nicht gar den Bürgerkrieg.«
Gaspard aß, als müsse er drei Verhungerte satt machen. Er zählte vielleicht vierzig, fünfundvierzig Sommer; ein großer, fast dürrer Mann mit grauem Haar und grauen Augen, flinken Bewegungen und einer zwingenden Stimme. Seine Hände, mit ausgebrochenen Fingernägeln und schlanken Fingern, waren ungewöhnlich schön und zugleich kraftvoll. Er trank Kräutersud, mit Wein vermischt, betupfte die Lippen mit dem weißen Tuch und redete weiter, zu Mutter gewandt:
»Der einzige Ort, an dem es friedlich zugeht, ist offensichtlich ein Tausendseelenkaff, tief in den französischen Bergen des Südens, an einem Nebenflüsschen des Allier. Atlan de Beauvallon, mit dem ich im Krieg dreimal zusammentraf, hatte mich eingeladen, aber ich fand im Schlösschen – Le Sagittaire – nur seinen Milchbruder an, Ciron de Beauvallon.«
Wir baten ihn zu bleiben, und er blieb gern. Gaspard de Rochemont, ein hochbezahlter Söldner und Geschützführer, hatte in vielen Schlachten meist für sein Land, Frankreich, gekämpft und gesiegt. Er sprach ein Spanisch, um das ihn Hernando de Herrera beneidet hätte, ebenso gut Englisch wie seine Heimatsprache, er kannte sogar ein paar deutsche Redewendungen. Ich fragte ihn, und er bestätigte, als ob er sich dafür entschuldigen wollte, dass er in allen wichtigen Kriegskünsten und im Gebrauch einer jeden Waffe nur noch wenig dazulernen konnte. Bruder Modesto war ebenso von Gaspard hingerissen wie ich – wenn auch aus anderen Gründen: Er versprach sich einen erwachsenen Spielkameraden.
»Ihr wart nicht zum ersten Mal dort?«, sagte mein Bruder.
»Zum zweiten Mal. Deswegen fand ich ohne Schwierigkeiten den Weg. Beauvallon liegt weit abseits aller wichtigen Straßen, daher lässt der Krieg seine fleißigen Bewohner meist ungeschoren.«
Gaspard warf mir scheue Blicke zu, während er zu Mutter und meinem Bruder sprach. Ich sah in ihm einen Boten aus Teilen der Welt, die ich nur aus Büchern und Erzählungen kannte. Ich tat nichts, um ihn durch Blicke in mein Mieder oder in meine Augen unsicher zu machen, sondern hörte nur zu.
»Nur wenige Menschen, Männer und Kriegskameraden zumeist, kennen Le Sagittaire. Graf Atlan oder Adlon, wie er sich mitunter nennt, der Sohn des alten Grafen, der wahrlich uralt wurde, lädt selten jemanden ein«, sagte Gaspard. »Ich hatte das Glück und durfte – dies erlaubte mir Ciron – auf Graf Atlan warten. Als er dann kam, erzählte er von den eisengepanzerten Reitern Oliver Cromwells, den Schönheiten Carundel Courts, der Schlacht des Parlamentsheers gegen die Schotten, die wohl unausweichlich war, und, bei vielen Gläsern erstklassigen Ardèche-Weines, von vielen seiner Reisen. Von einigen seltsamen Erlebnissen, die ich in Le Sagittaire hatte, erzähl ich Euch, Herrin, beim abendlichen Kaminfeuer.« Er deutete eine Verbeugung an. »Zum Holzhacken, Schreinern von Wagenrädern, Einreiten von Pferden und zum Schutz gegen Räuber bin ich ausgebildet – wie kann ich die Wohltaten Eurer Gastfreundschaft ein wenig ausgleichen?«
»Es wird sich etwas finden, Monsieur«, sagte Mutter. »Bisweilen begnügt Euch damit, im Regen und Sturm, bei Nässe und Kälte, unter einem festen Dach zu sein.«
»Mit dem jungen Herrn Modesto werde ich Fechten üben«, sagte Gaspard. Ich hob die Hand.
»Und mir dürft Ihr den Kampf mit dem schweren Säbel lehren.« Ich lächelte auffordernd; Gaspard warf mir einen Blick von verzweifelter Unschlüssigkeit zu.
Der Winter bestand aus einer grauen Folge regnerischer Tage und Nächte und wenigen Tagen, in denen sich wolkenloser Himmel über dem Land spannte. Wir übten, lauschten Gaspards Erzählungen, ritten bisweilen aus, und unter seiner Aufsicht begann in allen Gebäuden, Scheunen und Werkstätten ein großes, lärmendes Instandsetzen von Spinnrocken, Webstühlen, Räderpflügen, Wagen und Karren, vom Innengestänge des Taubenturms bis zum Dachstuhl des Stalls. Ich schlich nachts zu Guillermo und tat so, als ließe ich mich verführen; er beschenkte mich mit giftfarbenen Heilsalben, stechend riechenden, aber wirksamen Kräutermischungen, Lebenstränklein und den Erinnerungen an seine verzweifelten Versuche, aus zerstoßenen Fledermäusen Silber herzustellen. So kam ich durch den Winter und wurde, ohne dass sich viel änderte, einundzwanzig Jahre alt.
Im Frühling, in der dreizehnten Woche, starb Guillermo an der gleichen grausigen Blutkrankheit wie Pilár de Baeza. Zwei Wochen nach ihm starb Julia, die Magd, die bei ihm lag, wenn ich nicht da war. Abermals elf Tage nach Julia verblutete Guillermos Vater, der Julia in sein Bett gezerrt hatte, wenn sein Sohn inmitten schwefliger Dämpfe die alchimistischen Formeln murmelte und seltsame zermahlene Substanzen mit Krötenblut mischte. Mich hatte Guillermo nicht angesteckt. Der Leichenwäscher und sein stumpfsinniger Gehilfe starben auf die gleiche Weise, dann wurde der Tod von den warmen, aber heftigen Frühlingsstürmen in einen anderen Teil des Landes fortgeblasen, oder er verhungerte über den Hügeln des grünenden Landes. Als im Schilf am Rand der Pferdeschwemme die Frösche quakten und in den Eichen die Nachtigallen sangen, wagte ich bewusst den mutigen Schritt, der aus meinem Traum in die Wirklichkeit hineinführte.
Gaspard mit den grauen Augen und den geschickten Fingern war für jeden, der in Casa Carvajal lebte, wie ein Sonnentag im stürmischen Regenmonat. Mutter Ysabel und er hatten besprochen, dass er so lange bleiben durfte, wie es ihm beliebte – unter seiner behutsamen, fröhlichen Führung gediehen Haus und Hof, als läge göttlicher Segen auf uns. Gaspard sagte uns, dass er abwarten würde, was sich in Frankreich während der Regierung des Vierzehnten Ludwig änderte; unser Gast glaubte nicht an das Wunder menschlicher Vernunft, die Kriege zu verhindern wusste.
In dieser Nacht schien es, als treibe der Vollmond durch die Lücken nächtlicher Frühsommerwolken. Der Wind atmete die sinnverwirrenden Gerüche blühender Pflanzen und feuchter, warmer Erde aus, und die Holzstufen, die feucht geworden waren, knarrten nicht, als ich zu Gaspards Dachkammer hinaufstieg.