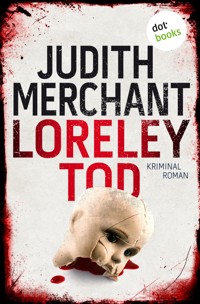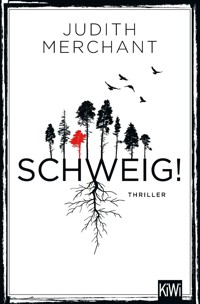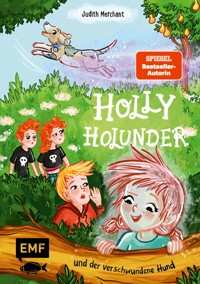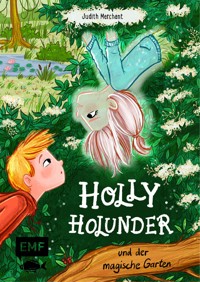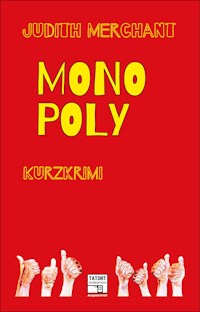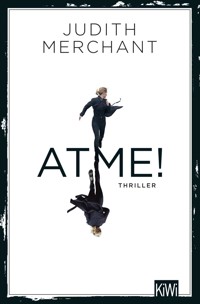
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du traust mir. Sie traut dir. Ich traue niemandem. Nile hat endlich ihre große Liebe gefunden: Ben. Doch plötzlich verschwindet Ben spurlos. Und niemand will Nile bei der Suche helfen. Bis auf eine – seine Frau. Ihre ärgste Feindin. Judith Merchant inszeniert in diesem hochkarätigen Thriller ein so packendes wie raffiniertes psychologisches Vexierspiel voller doppelter Böden und verblüffender Wendungen. Eben noch war Ben in der Boutique, in der Nile ein Kleid anprobierte, doch als sie aus der Umkleidekabine kommt, ist er verschwunden. Nile ist sich sicher: Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Aber niemand will ihr glauben. Noch nicht mal seine engsten Freunde, die Nile sowieso für zu anhänglich halten. Also muss sie ausgerechnet ihre größte Feindin um Hilfe bitten: Flo, die Frau, mit der Ben noch verheiratet ist. Zu Niles Erstaunen ist diese sehr kooperativ. Doch dann entdecken die beiden Frauen immer mehr Ungereimtheiten in Bens Leben. Und die gemeinsam begonnene Suche entwickelt sich zu einer atemlosen Jagd, denn Nile realisiert: In diesem perfiden Spiel kann sie niemandem trauen. Schon gar nicht Flo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Judith Merchant
Atme!
Thriller
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Judith Merchant
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Judith Merchant
Judith Merchant studierte Literaturwissenschaft und unterrichtet heute Creative Writing an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Für ihre Kurzgeschichten wurde sie zweimal mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Nach der Veröffentlichung ihrer Rheinkrimi-Serie (darunter »Nibelungenmord« und »Loreley singt nicht mehr«) zog Judith Merchant von der Idylle in die Großstadt. »ATME!« erschien 2019 bei Kiepenheuer & Witsch und wurde zum Bestseller, 2021 folgte ihr neuer großer Thriller »SCHWEIG!«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eben noch war Ben in der Boutique, in der Nile ein Kleid anprobierte, doch als sie aus der Umkleidekabine kommt, ist er verschwunden. Nile ist sich sicher: Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Sie stürmt los, um ihn zu suchen, aber niemand will ihr glauben. Noch nicht mal seine engsten Freunde, die Nile sowieso für zu anhänglich halten. Also muss sie ausgerechnet ihre größte Feindin um Hilfe bitten: Flo, die Frau, mit der Ben noch verheiratet ist. Zu Niles Erstaunen ist diese sehr kooperativ. Doch dann entdecken die beiden Frauen immer mehr Ungereimtheiten in Bens Leben. Und die gemeinsam begonnene Suche entwickelt sich zu einer atemlosen Jagd, denn Nile realisiert: In diesem perfiden Spiel kann sie niemandem trauen. Schon gar nicht Flo.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © plainpicture/Mark Owen; © Milan M/shutterstock.com
ISBN978-3-462-32016-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Alle Menschen suchen Liebe
So wie ich
Nichts von allem ist geplant
Mein Name ist ein Fluch
Zuerst begreife ich gar nicht ...
Den Lotospalast betraten wir, weil ...
Ich ringe nach Atem ...
Ben geht immer an sein Handy
Ich erwache um sechs
Sie ist bestimmt zu Hause
Ich hasse das Wort Verantwortung
Das muss etwa zwei Monate ...
Als ich das blaue Haus das erste Mal sah ...
Wir sitzen in ihrer Küche
Das blaue Haus zu verlassen fühlt sich an ...
Ich habe mich in die hinterste Sitzecke ...
Markus besitzt einen Fahrradladen
Du bist ein Reh ...
Er heißt Jäger ...
Selbstverständlich ist Ben nicht auf Dienstreise ...
Als Kind war ich sehr verschlossen
Immerhin eins hat das Gespräch mit Hanno mir verraten ...
Seit einer Stunde sitze ich ...
Ich mag keine Monster
Der Geruch von Ben ist eine Keule ...
Was habe ich getan?
Ich würde alles für dich tun, Ben
Ich gehe an der zusammengekauerten Gestalt ...
Das Tolle an Selbstverteidigung ist ...
Flo redet wie aufgezogen
Es war eine relativ brutale Vergewaltigung
Ich bin mir in der ...
Ich vertraue Ben
Ich gehe zu Flo in die Küche
Flo sitzt mir gegenüber ...
Sie sieht es ein
Ich habe meine Turnschuhe angezogen ...
Claus
Atme, Nile!
Ich versuche, in die Küche zu gehen ...
Eine Panikattacke hört auf
Ich liege auf meinem Kissen ...
Ben ist niemand, der Dinge ...
»Oh, Nile«, sagt Flo ...
Claus ist tot
Ich muss mich sortieren
Es führen sehr breite Treppenstufen ...
Ich bin eine Spezialistin im Warten
Maren
Ich fliege zu ihr
Ich weiß, wo sie wohnt
Auch oben ist es hell
Das kann nicht sein
Zuerst fällt mir das Messer aus der Hand ...
Claus steht am Fenster und lehnt sich hinaus
Ich bekomme so wenig Luft
Durch das Garagentor höre ich Marens hysterische Stimme ...
Monster
Willst du wissen, wie Monster ...
Jetzt weiß ich, was geschehen ist
Atme, Nile
Es funktioniert
Die Stimme von Ben vertreibt das Monster ...
Ich atme
Ich öffne die Augen
Ich renne fort
El sueño de la razón produce monstruos.
Francisco de Goya
Alle Menschen suchen Liebe.
Alle.
Und dabei ist Liebe so schwer zu finden.
Manche denken, dass man Liebe lernen kann. Dass man sie berechnen kann. Oder bestellen. Dass man an sich selber arbeiten muss. Oder am anderen. Dass man dafür sehr besonders sein muss. Oder so wie alle.
All das ist falsch. Das weiß ich. Denn das Einzige, was man wirklich braucht dafür, das ist der passende Andere. Es darf eben nicht der Andere sein. Es muss der Eine sein.
Der, der genau zu dir passt. Der, bei dem sie funktionieren, die ganzen verdammten Zaubersprüche. Der dich in den Arm nimmt und sagt: Hab keine Angst. Der zu dir unter die Decke schlüpft und sagt: Mach die Augen zu. Der nach deiner Hand greift und sagt: Wir schaffen das. Oder: Du bist schön. Oder: Alles wird gut.
Und alles stimmt, weil er es sagt.
Wenn du diesen Menschen gefunden hast, dann – hör zu, was ich dir sage! – dann musst du mit ihm zusammenbleiben.
Bleib bei ihm. Lass nicht zu, dass man euch trennt. Sei wachsam. Pass auf. Hüte dich vor einer zu abrupten Ampelschaltung, vor sperrigen Arbeitszeiten, hüte dich vor allem vor seiner Exfrau, am allermeisten aber vor dem Vorhang einer Umkleidekabine.
Halt ihn einfach fest, jede Sekunde.
Sonst kann es sein, dass du eines Tages auf der Straße stehst und begreifst, dass etwas Schreckliches geschehen ist.
So wie ich.
Vor mir lärmen Autos von links nach rechts, hupen, quietschen, stoßen stinkende Wolken aus. Eine Fußgängerampel blinkt hektisch, ich stehe auf dem Bürgersteig, Menschen laufen an mir vorbei. Hinter den Autos eine Buchhandlung, ein Friseur, zwei Cafés. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen, und der Schweiß läuft mir über das Gesicht, ich recke den Kopf. Nach links. Nach rechts. Wieder nach links.
Alles voller Menschen. Aber nicht er. Nur andere. Sie starren auf ihre Handys, schleppen volle Einkaufstüten, schwenken schlanke Handtaschen, sie ziehen Hunde, schieben Kinderwagen.
»Ben!«, rufe ich, so laut ich kann. »Ben!«
Niemand beachtet mich.
Ein Mensch ist verschwunden. Ein anderer sucht ihn. Eine Straße. Zwei Richtungen.
Finde den Fehler!
Man kann in die eine Richtung rennen oder in die andere. Nicht in beide gleichzeitig. Und wenn man sich falsch entscheidet, wenn man in die falsche Richtung läuft, dann entfernt sich der andere immer weiter.
Entscheidungen.
Entscheidungen zu treffen ist so schwer.
Nichts von allem ist geplant gewesen an diesem Dienstag.
Nicht, dass Ben spontan Überstunden abfeiert und deswegen schon mittags freimacht.
Nicht, dass ich die langweilige Übersetzung eines Geschäftsberichts liegen lasse und ihn von der Arbeit abhole, auch wenn das natürlich naheliegt.
Nicht, dass wir in die Stadt fahren und in einer Pizzeria das Mittagsmenü bestellen, dass wir danach auf dem Marktplatz ein Eis essen, er Malaga und Haselnuss, ich Schokolade.
Nicht, dass wir danach durch diese Straße gehen und im Schaufenster dieses viel zu teuren Ladens dieses viel zu teure Kleid entdecken.
Nichts davon ist geplant gewesen.
Es ist alles einfach so passiert.
Und darum trete ich in diesem viel zu teuren Laden aus der Umkleidekabine und starre ungläubig in den Spiegel.
Das Kleid hat ganz kleine angeschnittene Ärmel und geht bis zum Schlüsselbein – entzückende Schlüsselbeine, sagt er immer, wenn ich dich mal identifizieren müsste, ich würde dich an deinen Schlüsselbeinen erkennen. Oder: Wenn es »Wetten, dass..?« noch gäbe, könnten wir uns anmelden, ich würde dich unter Tausenden herausfinden –, aber weil der graue Spitzenstoff ganz leicht durchbrochen ist, kann man durchgucken, zumindest bis auf das Unterkleid. Himmel, ein Unterkleid! Das gibt es doch nur in Filmen, oder?
Ich bin eigentlich nicht so der Typ für Kleider. Um ehrlich zu sein, das ist mein erstes Kleid seit zehn Jahren. Und es ist perfekt. Einfach perfekt.
Die Verkäuferin tritt zu mir und nickt anerkennend. »Steht Ihnen wunderbar«, sagt sie, »wirklich, Sie können das tragen mit Ihrer Taille. Am besten mit Pumps, klassische würde ich nehmen, dann sieht das noch mal ganz anders aus.« Ihr Blick streift die Turnschuhe, in denen meine sonnenverbrannten Beine stecken.
Ich gebe nichts auf ihr Urteil. Der einzige Mensch, an dessen Meinung mir etwas liegt, sitzt um die Ecke auf dem Sessel und blättert vermutlich in einer Zeitschrift. Umso besser, denn wenn er mich jetzt noch nicht sieht in dem Kleid, dann kann ich ihn später damit überraschen. Ben mag Überraschungen. Ganz anders als ich, ich hasse sie. Da sind wir sehr verschieden, wie bei manchem.
Soll ich es schnell ausziehen und einfach kaufen? Oder Ben doch rufen?
Die Verkäuferin interpretiert mein Zögern falsch. »Wir haben das auch noch in Mitternachtsblau. Soll ich Ihnen das mal holen? Das ist dann etwas edler. Ich weiß ja nicht, für welchen Anlass suchen Sie denn?«
Darauf muss ich jetzt wohl antworten. Ich sage: »Es ist für eine Hochzeit.«
»Ach, wie schön«, sagt die Verkäuferin. »Dann muss man natürlich bedenken, welcher Dresscode gewünscht ist.«
»Es gibt keinen Dresscode«, sage ich und gehe zurück in die Kabine.
Die Verkäuferin ruft. »Wissen Sie denn, was die Braut trägt? Lang oder kurz? Man sollte ja immer das Gegenteil wählen.«
»Die Braut trägt dieses Kleid hier«, sage ich, aber das hört die Verkäuferin nicht mehr, also betrachte ich mich noch einmal im Spiegel.
Das Unterkleid schimmert durch den Spitzenstoff. Ich habe wirklich eine ganz schmale Taille in dem Kleid, meine Arme sind stark und sonnenverbrannt, und meine Nase pellt sich, auf der Stirn habe ich einen winzigen Pickel, im linken Mundwinkel Reste von Schokoladeneis. In meine Augen malt das Licht der Umkleidekabine einen weißen Fleck, und plötzlich verzieht sich mein ganzes Gesicht und ich strahle.
Vermutlich ist es ein Prinzessinnenmoment wie im Film. Ich fand Prinzessinnenmomente bisher immer armselig, aber sie waren auch immer für andere, nicht für mich.
Ich stehe da und strahle mein eigenes Spiegelbild an, das Spiegelbild strahlt zurück. Und weiß noch nicht, was in wenigen Minuten passieren wird. Ich habe keine Ahnung, nicht mal ein unbehagliches Gefühl, dafür bin ich viel zu glücklich und viel zu sicher und viel zu verliebt.
Dann rufe ich doch nach ihm.
»Ben«, rufe ich.
Aber er kommt nicht, und die Verkäuferin kommt auch nicht. Stattdessen wird der Vorhang der Kabine beiseitegerissen, und eine Frau steht vor mir. »Oh, Entschuldigung!«, ruft sie erschrocken und starrt mich an. Und dann erst realisiere ich, dass sie das gleiche Kleid trägt wie ich. Aber sonst sieht sie ganz anders aus, sie ist schmal und blond und elegant, eins ihrer schlanken glänzenden Beine ist kunstvoll mit einem pinken Tape verziert, vermutlich eine Sportverletzung. Und sie trägt Pumps, die zum Kleid passen.
Ich starre sie an, sie starrt mich an, und wir brechen beide in Gelächter aus, ein Gelächter, das sagt: So gleich! Und so verschieden! Dann verschwindet sie so schnell, wie sie gekommen ist, und zieht dabei den Vorhang wieder zu.
Ich lache immer noch und möchte gar nicht aufhören, mich im Spiegel zu betrachten, weil ich so glücklich bin, weil alles so gut ist.
Und ich denke: Wir sollten viel öfter auswärts zu Mittag essen. Wir sollten viel öfter zusammen Schaufenster angucken. Vielleicht sollte ich sogar viel öfter Kleider tragen.
Jetzt können wir das ja machen. Denn jetzt ist endlich alles gut. Jetzt ist endlich Zeit für unser Happy End!
Ein bisschen wundere ich mich, dass Ben noch nicht gekommen ist, um zu sehen, wie ich in dem Kleid aussehe. Das passt eigentlich nicht zu ihm.
Ich ziehe den Vorhang zur Seite und dränge mich aus der Kabine.
Weil ich keine Angst habe.
Weil ich nicht weiß, was mich erwartet.
Mein Name ist ein Fluch.
»Ich heiße Nile.«
»Freut mich, Nele!«
»Nein, Nile.«
»Nele?«
»NIIILE.«
»Sag ich doch. NELE.«
Mein Name ist so etwas wie eine Allegorie auf mich. Jeder versteht mich falsch. Jeder glaubt zu wissen, wer ich bin, aber sie alle täuschen sich.
Mit Ben war das anders.
»Ich bin Nile«, sagte ich zu ihm und sah ihn an, ohne ihn zu sehen. Und er sagte: »Nile. Ich heiße Ben.« Und dann sah ich ihn.
Später sprachen wir darüber.
Das war drei Wochen nach unserem Kennenlernen. Also drei Wochen, nachdem wir das erste Mal miteinander geschlafen hatten. Denn darum war es zuerst gegangen, zumindest taten wir so, als ob es darum ginge, aber eigentlich war da schon klar, dass es um etwas ganz anderes geht. Dass es um alles geht.
Drei Wochen danach also sagte ich es ihm.
»Du warst der Erste«, sagte ich, als ich bäuchlings neben ihm lag, die Augen geschlossen.
»Ja klar«, sagte er.
»Nein, im Ernst.«
Er pustete vorsichtig auf meinen Oberarm. »Du denkst jetzt nicht echt, dass ich dir das abnehme, oder?«
»Doch, du warst der Erste«, sagte ich schläfrig.
Das Laken roch nach uns. Ich hätte die Bettwäsche dringend mal waschen müssen, aber immer, wenn ich das vorhatte, stieg mir dieser Geruch in die Nase, und ich zögerte. Zögerte deswegen, weil ich ihn behalten wollte. Zögerte, weil ich damit einen faktischen Beweis für das hatte, was sich in den letzten drei Wochen zwischen uns abgespielt hatte. Zögerte vielleicht auch, weil ich Angst hatte, dass er möglicherweise nicht mehr wiederkommen würde, um dieses Zimmer mit seinem Geruch zu füllen.
»Erzähl«, sagte er.
Das sagt er immer. Egal, worüber wir sprechen, er hat eine ganz eigenartige Art, unkonkret nachzufragen. Die meisten Menschen fragen gezielt, sie fragen entweder Details ab, oder sie fragen nach dem Motiv. Andere sind stumpf oder schüchtern und fragen gar nicht. Und Ben sagt immer: »Erzähl.« Und wenn er das sagt, hole ich Luft und rede. Ich habe noch nie zuvor so viel geredet wie mit ihm. Ich rede sonst eigentlich sehr wenig.
»Mein Name«, sagte ich. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals erlebt, dass jemand auf Anhieb meinen Namen richtig verstanden hat, noch nie. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist. Jeder versteht ihn falsch, einfach jeder. Ich sage: ›Niiile‹, mit drei ›i‹. Und die Leute verstehen ›Nele‹. Und dann sage ich: ›Nein, Nile, nicht Nele‹, und sie fragen: ›Wie? Wie heißt du?‹ Es kann ja niemand etwas dafür. Aber es ist einfach so. Wie ein Stolperstein direkt vor meiner Haustür. Ein holpriger Einstieg, immer und überall. Und wenn die Menschen meinen Namen nicht hören, sondern geschrieben sehen, dann halten sie ihn meistens für einen Tippfehler. Manche korrigieren eigenmächtig, einige fragen nach. Manchmal kommt es vor, dass Kunden mich richtig ansprechen, weil wir vorher Mailkontakt hatten. Aber dass jemand meinen Namen sofort richtig ausspricht, ohne ihn vorher gelesen zu haben, das hat es echt noch nie gegeben. Bis zu dem Tag, als du kamst.«
Ich machte eine Pause.
»Erzähl weiter«, sagte er. Seine Augen waren auf mich gerichtet, und ich wusste, dass er jede Regung an mir wahrnahm, dass seine ganze Aufmerksamkeit mir galt, jedem Wort, jedem Zögern, jeder Bewegung.
Ich drehte mich vom Bauch auf die Seite, damit ich ihn besser betrachten konnte. »Es ist schon komisch, dass ausgerechnet du es warst, der meinen Namen verstanden hat. Und jetzt liegen wir hier. Das ist so … so kitschig.«
Er pustete noch einmal auf meinen Oberarm, aber langsamer diesmal, ein warmer Luftstrom, so warm wie seine Mundhöhle. »Na und?«, sagte er. Und pustete noch einmal.
Ich schloss die Augen. »So, als ob du mich sofort verstanden hättest. Es ist wie in einem Märchen, in dem die arme Prinzessin wartet, dass ein Königssohn kommt und ihr den richtigen Namen gibt, damit der böse Fluch gebannt ist und sie endlich frei und glücklich sein kann.« Ich drückte mein Gesicht tiefer ins Kissen. Ben sollte nicht sehen, dass meine Augen nass wurden. Er wusste nicht, wie sehr ich auf ihn gewartet hatte. Und wie schlimm es vorher gewesen war.
Ben strich mir über den Rücken, ganz langsam, als überlegte er, wohin er als Nächstes fassen solle. »Rumpelstilzchen«, sagte er. »Das passende Märchen in Sachen Namensgebung wäre Rumpelstilzchen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Kompliment für dich ist, wie Rumpelstilzchen siehst du Gott sei Dank nicht aus. Die Version mit der Prinzessin passt besser zu dir.«
Ich sprach ins Kissen, leise und verwaschen, aber ich wusste, dass er mich hört. »Mir macht es nichts aus, wie Rumpelstilzchen auszusehen, solange du den Part mit dem Namen richtig machst und mich erlöst.«
»Aber Rumpelstilzchen wollte gar nicht, dass man seinen Namen kennt, oder?«
»Keine Ahnung«, sagte ich.
»Ich bin mir sicher, Rumpelstilzchen wollte das nicht. Außerdem war Rumpelstilzchen böse. Wir sind also unsere eigene Version vom Namensmärchen.«
»Das ist gut«, sagte ich. »Wobei ich eigentlich ganz gern wie Rumpelstilzchen aussehen würde, irgendwie stelle ich mir das sehr entlastend vor.«
»Rumpelstilzchen«, flüsterte Ben in mein Ohr und küsste mich knapp darunter.
»Mh.«
»Darf ich dich jetzt ganz doll enttäuschen, Rumpelstilzchen?«
»Oh.« Ich blickte in Richtung Uhr, aber ich sah nur Ben und die Decke. »Musst du etwa schon los?«
»Nein. Aber ich muss die Sache mit dem Namen aufklären, bevor du unser Märchenschloss auf ein falsches Fundament baust und nachher schrecklich wütend auf mich bist, wenn du die fiese Wahrheit erfährst.«
»Die fiese Wahrheit«, sagte ich, drehte mich auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, seine Augen folgten jeder Bewegung. »Raus mit der fiesen Wahrheit. Du kanntest meinen Namen schon?« Bei dem Gedanken breitete sich die Enttäuschung in mir aus wie eine Lache. Das war total albern. Noch während ich sie spürte, schalt ich mich dafür.
»Nein.«
»Nicht?«
»Nein.«
»Puh. Dann kannst du mich gar nicht enttäuschen.«
»Warte mal ab.« Er rieb sich die Nasenwurzel, als müsste er die Worte von dort hervorlocken. Das macht er oft. »Die Wahrheit ist: Ich mache seit zwölf Jahren Vertrieb. Das heißt nichts anderes, als dass ich bei allen potenziellen Kunden in der ersten Sekunde schon einen guten Eindruck machen muss. Sie müssen sich sofort wohlfühlen. Und darum ist mein wichtigster Trumpf der Name. Nicht, wie er geschrieben wird, sondern, wie er ausgesprochen wird. Während ich jemanden das erste Mal begrüße, läuft bei mir unter höchstem Stress ein akustisches Silbenerkennungsprogramm ab. Ich speichere das Gehörte und spreche es nach, wie ein Papagei. Und dann sind die Leute total glücklich und dankbar. Und schon hab ich sie gewonnen.«
»Das reicht?«
»Im Grunde schon. Ich lächle dazu wie irre. Und damit ist eigentlich die Hälfte meines Jobs schon getan, zumindest bei den Leuten, die nicht Stefanie oder Michael heißen. Der Rest ist dann Kür.«
»Und ich war eine potenzielle Kundin?«
»Sozusagen, ja.«
»Oh mein Gott«, sagte ich und barg mein Gesicht an seiner Schulter. Sie roch nach mir. Sie roch mehr nach mir als nach ihm. »Das ist eine furchtbar billige Erklärung für etwas, was mir wie ein ganz besonders kostbares Wunder vorkam.«
»Ich find’s auch schrecklich«, sagte Ben und küsste mich sehr langsam und sehr nass. »Weil, wenn dich diese simple Sache so beeindruckt hat, bedeutet das ja, dass dich jeder x-beliebige andere Kerl, der so arbeitet wie ich und einen zweisilbigen Namen fehlerfrei ausspricht, auch hätte abgreifen können. Bin ich froh, dass es nicht so gekommen ist!«
»Das liegt wohl daran, dass es in meiner Welt normalerweise keine durchtriebenen Vertriebler gibt. Meine Welt ist sehr, sehr klein. Da kommen nicht viele rein.«
Ben nahm vorsichtig mein Gesicht in die Hände, um seinen linken Mundwinkel zuckte etwas, das er nicht unterdrücken konnte, es breitete sich auf seinen rechten Mundwinkel aus, dann explodierten beide Mundwinkel gemeinsam zu einem Lächeln, zu dem schönsten Lächeln, das es gab auf der ganzen Welt. Er sagte sehr leise: »Was für ein Glück, Nile. Oder?«
»Ja«, sagte ich. »Was für ein Glück, Ben.«
Und weil wir im Bett lagen und weil wir dumm waren, klopften wir nicht auf Holz.
Zuerst begreife ich gar nicht, dass er weg ist.
Nur, dass ich ihn nicht sehe.
Es ist ein kleiner Laden, L-förmig. Auf der rechten Seite ist die Eingangstür, gegenüber die Kasse. Links zieht sich der Raum lang nach hinten, dort befinden sich die Umkleidekabinen. An den Wänden hängen Kleider, Blusen, Oberteile auf Bügeln, sehr wenige Sachen. Es ist eben ein teurer Laden.
Zwischen Eingang und Tür steht ein hellgrauer Ledersessel. Vermutlich steht er dort, damit die Begleitungen der aufgeregten Kundinnen träge und friedlich darin versinken und sich nicht mehr rühren.
Dort hat Ben gesessen.
Oder denke ich das nur, weil da ein Sessel steht und er mir nicht zur Umkleidekabine gefolgt ist?
Der Raum ist leer. Mein Blick geht nach links und rechts. »Ben?«, rufe ich, dann gehe ich zurück zu den zwei Umkleidekabinen, beide mit geöffneten Vorhängen, in der einen meine Klamotten, ein schlaffer Haufen in Jeansblau und Schwarz, die andere ist leer. Anscheinend ist die Kundin mit meinem Kleid schon wieder weg.
»Ben?«, rufe ich noch einmal.
Die Verkäuferin schaut durch die Türöffnung hinter der Ladentheke, sie hat ein Telefon am Ohr.
»Ben?«
Dann gehe ich mit drei großen Schritten zur Tür, es bimmelt, als ich sie öffne und hinaustrete, ich gucke, ob er vielleicht vor der Tür steht und raucht, dabei raucht er gar nicht. Kein Ben. Nur Autos, die vorbeirauschen.
»Ist etwas?«, sagt mit leisem Erstaunen die Verkäuferin, als sie zu mir auf die Straße tritt.
»Wo ist mein Mann?«, frage ich.
»Ihr Mann?« Sie scheint etwas begriffsstutzig zu sein.
»Er hat hier auf mich gewartet.« Ich deute ins Innere des Ladens, Richtung Sessel.
Sie sieht mich fragend an.
»Der, mit dem ich hier reingekommen bin«, präzisiere ich, dann renne ich zur Umkleidekabine und wühle in der Jeans nach meinem Handy. Ich wähle seine Nummer und reiße es ans Ohr. Fast erwarte ich, das Klingeln von Bens Handy zu hören, weil er doch direkt hier sein muss, in Hörweite. Aber ich höre nur das Freizeichen, es tutet. Und tutet. Und tutet. Keine Mailbox, er benutzt keine.
Er geht nicht ran.
Das kann nicht sein. Ich werfe einen Blick aufs Display, um mich zu vergewissern, dass ich die richtige Nummer gewählt habe.
Die Nummer stimmt. Aber der Rest stimmt nicht.
Gar nichts stimmt.
Absolut gar nichts.
Ich wende mich der Verkäuferin zu, die mir gefolgt ist. »Mein Mann? Mit dem ich eben reingekommen bin. Größer als ich, schwarze Haare und Brille.«
»Sie sind allein hereingekommen«, sagt sie. »Oder?«
Im ersten Moment bin ich sprachlos, dann zwinge ich mich zur Ruhe. Ich bin vorangegangen, ja, hineingestürzt bin ich, so begeistert war ich von dem Kleid, von diesem Tag, von allem. Aufgekratzt war ich von unserem spontanen Mittagessen und all dem Schönen, das vor uns lag. Davon, dass die schlimmen Zeiten endgültig vorbei waren. Aber Ben war direkt hinter mir in den Laden gekommen. Ich hatte noch einen Blick zurückgeworfen, ehe ich in die Umkleide verschwand.
»Er ist direkt hinter mir reingekommen«, sagte ich. »Er hat sich dann hier auf den Sessel gesetzt.«
»Ach so, natürlich.«
»Sie erinnern sich an ihn?«
»Im Anzug?«
Stimmt, er hat noch seinen Anzug an, weil er ja direkt von der Arbeit gekommen ist. »Ja.«
»Der muss wieder rausgegangen sein.« Sie zeigt hinter die Ladentheke. »Ich habe ja telefoniert.«
»Und die andere Kundin? Vielleicht hat sie ihn gesehen.«
»Ist eben raus«, sagt die Verkäuferin achselzuckend.
Ich hole tief Luft.
Und atme. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich muss ruhig bleiben, sage ich mir. Einfach atmen.
Und das tue ich.
Ich verstehe jetzt, was hier passiert.
Das Unglück passiert.
Und ich ziehe die Ladentür auf und renne die Straße hinunter, um es aufzuhalten.
Den Lotospalast betraten wir, weil wir vor einem Platzregen flohen. Da fing es an. Ich übersetzte schon seit längerem für seine Firma, aber wir hatten niemals Kontakt. Das hätte sich auch nie geändert, wenn ich nicht ein Problem mit dem Automaten am Firmenparkplatz gehabt hätte. Er stieg aus seinem Wagen aus und half mir. Wir kamen ins Gespräch. Wir ließen unsere Autos stehen und gingen spazieren. Draußen regnete es in Strömen, und aus irgendwelchen mysteriösen Gründen hat das alles besiegelt. Wir gingen durch den Regen, als ob er nicht existiert, Schritt für Schritt nebeneinander, während wir immer nasser wurden. Und irgendwann sahen wir einander an, sahen den anderen, völlig durchweicht, und dann war klar, dass hier etwas geschah.
Wir beschlossen, etwas zu essen, im Chinarestaurant.
Lachend und patschnass taumelten wir hinein und hatten Mühe, uns an dem freien Tisch zu beruhigen, wir rangen nach Atem und versuchten, das Lachen im Mund einzusperren, pressten die Lippen fest aufeinander, bis sich unsere Blicke trafen und wir erneut losprusteten. Warum haben wir eigentlich so gelacht? Es gab überhaupt keinen Grund. Wir waren nass geworden. Wir waren bereits verliebt, aber das wussten wir noch nicht, nicht so richtig zumindest. Wir wussten nur, dass gerade etwas mit uns passierte und dass an diesem Abend noch mehr passieren würde. War das ein Grund zum Lachen?
Unsere nassen Sachen hingen schief auf den Stuhllehnen neben uns, tropften von dort auf den roten Chinarestaurantteppich, bis sich kleine Pfützen bildeten. Die dauerlächelnde chinesische Kellnerin wollte sie an die Garderobe hängen. »Nein, schon gut«, sagte Ben, und dann sah er wieder mich an und wir explodierten erneut, was vollkommen idiotisch war.
Eine glitschige scharfe Pekingsuppe wärmte uns auf, danach tranken wir grünen Tee, bis wir uns in der Lage sahen, uns erneut in den Regen zu stürzen, um ein Hotelzimmer zu suchen. Erst dort hörten wir auf zu lachen. Erst dort wurde es ernst.
Das war das erste Mal, dass wir gemeinsam dort waren. Sonst trafen wir uns bei mir. Aber wenn Ben nur kurz Zeit hatte, eine Mittagspause, dann gingen wir in unser Chinarestaurant, weil es nah bei seiner Firma lag. Natürlich hätten wir auch mal ein anderes Restaurant nehmen können, aber das taten wir nicht. Warum? Vielleicht war es so, dass Ben wenigstens dieser ersten Pekingsuppe treu bleiben wollte, wenn er schon seine Ehefrau betrog.
Ich weiß es nicht.
El adulterio. Der Ehebruch.
Ob ich an dem Abend schon wusste, dass er eine Ehefrau hat? Ja. Er hat es mir gesagt. Geahnt hatte ich es ohnehin, nicht nur der Ring an seinem Finger verriet es mir. Es war seine ganze Ausstrahlung.
Aber ja, er erzählte mir von Flo an diesem Abend. Wohl, damit ich wusste, worauf ich mich da einließ.
Es war also alles klar zwischen uns, als wir in den Regen stürzten, um ein Hotel zu suchen.
Ich ringe nach Atem, in meinem Kopf sirrt es. Die Straße ist zu lang und wird gekreuzt von zu vielen anderen Straßen.
Ich habe keine Ahnung, wohin ich laufen muss. Bringt mich jeder Meter, den ich laufe, näher zu Ben? Oder weiter von ihm weg?
»Entschuldigung«, sage ich zu einer Frau, die ihren Rollkoffer an mir vorbei über den Gehweg holpern lässt, »haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist einen Kopf größer als ich. Er trägt eine Brille und einen grauen Anzug. Seine Haare sind schwarz. Er ist frisch rasiert.« Während ich das sage, spüren meine Lippen, wie sich das anfühlt, wenn Ben frisch rasiert ist.
»Bitte? Ist er hier lang oder was?«
»Haben Sie ihn gesehen?«, dränge ich.
Sie weiß nichts. Sie guckt. Und schüttelt den Kopf, und dann zieht sie ihren Rollkoffer von mir weg, als hätte sie Angst, dass ich ihn stehle. »Vielleicht ist er einfach schon mal vorgegangen«, sagt sie.
Ich starre sie an, und dann macht etwas klick, und mein Puls jagt auf wie ein Schwarm schwarzer Vögel, sie stoßen aneinander, als sie plötzlich auseinanderstieben und mit grausamem Platschen und Knacken an der Fensterscheibe zerplatzen. Ich kann nichts mehr sehen, weil alles voll ist mit verschmierter Scheibe und Rot und schwarzen Federn.
Das ist Panik.
Panik im Anflug.
Nile, beruhige dich!
Beruhige dich!
Atme!
Natürlich ist Ben weder in die eine noch in die andere Richtung gelaufen. Warum hätte er das tun sollen? Vor wem hätte er weglaufen sollen? Allein der Gedanke ist absurd. Aber irgendetwas muss geschehen sein. Irgendetwas muss der Grund dafür sein, dass er nicht im Laden sitzt und auf mich wartet. Dafür, dass er rausgegangen ist, ohne mir Bescheid zu sagen. Und auch dafür, dass er nicht an sein Handy geht.
Ein Unfall.
Es muss ein Unfall passiert sein. Vielleicht ist er angefahren worden.
Ich trete auf die Bäckereifiliale zu, die einen zur Straße hin offenen Verkaufstresen hat. »Entschuldigen Sie«, sage ich, »der Unfall. Haben Sie den Unfall gesehen?«
Die Verkäuferin mit der Brötchenzange in der Hand blinzelt mich überrascht an. Sie hat bunt gesträhnte Haare und blasse Augen hinter einer dicken Brille. »Welcher Unfall?«
»Hier auf der Straße. Eben. Ein Unfall.«
»Wo denn?« Sie legt die Zange beiseite und wischt sich die Hände an einem Geschirrtuch ab.
»Na hier.«
Sie schüttelt den Kopf. »Hab ich nicht gesehen.«
Ich atme scharf ein, dann trete ich so hastig zurück, dass ich gegen einen anderen Kunden stoße. »Tschuldigung«, stammle ich und wiederhole: »Tschuldigung«, als böse Blicke mich treffen, Blicke, mit denen ich mich jetzt nicht auseinandersetzen kann.
Ein Kiosk.
»Haben Sie den Unfall gesehen?«, frage ich. »Hier muss ein Unfall gewesen sein.«
Der Mann schüttelt den Kopf.
Vielleicht ist ihm gar nichts passiert. Vielleicht war er gar nicht beteiligt. Vielleicht war der Unfall gar nicht schlimm. Zwei Autos sind kollidiert, Ben war Zeuge, und er ist mit auf die Polizeistation gefahren, um seine Aussage abzugeben.
Denkfehler.
Dann würde er an sein Handy gehen.
Ben ist angefahren worden. Er wurde leicht verletzt, nichts Schlimmes, aber der besorgte Fahrer hat sofort einen Krankenwagen und die Polizei gerufen und darauf bestanden, ihn ins Krankenhaus zu fahren.
Wieder falsch.
Auch dann würde er an sein Handy gehen.
Ben ist angefahren worden, nicht schlimm, aber er ist ohnmächtig geworden. Er ist immer noch ohnmächtig. Das Handy steckt wie immer in seiner Hosentasche, es klingelt und klingelt, aber es geht niemand ran, weil das Klingeln vom Tatütata des Krankenwagens übertönt wird. Die Sirene ist laut, sie ist schrecklich laut, niemand hört ein Handyklingeln, nicht Ben, der ohnehin ohnmächtig ist, aber auch die Sanitäter nicht, die ja rangehen würden, falls Angehörige anrufen, aber über ihren Köpfen schrillt die Sirene ohrenbetäubend, darum hören sie das Klingeln nicht.
Denkfehler. Wäre hier ein Krankenwagen langgefahren, dann hätte das jemand mitbekommen.
Ich tippe erneut auf anrufen. Höre das Klingeln durch den Hörer. Es klingelt und klingelt. »Ben«, sage ich in das Klingeln hinein. Und dann noch einmal: »Ben!«
Und dann versuche ich mich zusammenzureißen. Es gibt sicher eine ganz normale Erklärung. Vielleicht ist sie nicht schön, aber sie würde bedeuten, dass alles nicht so schlimm ist wie das, wonach es sich gerade anfühlt in meiner Brust. Dort nämlich fährt ein Aufzug mit Rekordgeschwindigkeit abwärts, so, als hätte eine Axt das Tragseil durchtrennt, und jetzt stürzt er ungeschützt tausend Meter in die Tiefe und noch tiefer und immer tiefer.
Aber das ist nur meine Angst, es ist nicht die Realität.
In der Realität liegt er mit einem sauberen weißen Verband in einem sauberen weißen Bett in einem sauberen weißen Krankenhaus.
Oder, in einer anderen Realität ist er möglicherweise wieder aufgetaucht. Da sitzt er möglicherweise in dem hellgrauen Ledersessel und erklärt der kopfschüttelnden Verkäuferin, wo er gewesen ist.
Es bimmelt, als ich den Laden betrete. Ich sehe sofort, dass Ben nicht da ist, ich sehe es nicht nur an der Haltung der beiläufig telefonierenden Verkäuferin, ich kann es gleichzeitig hören und riechen und schmecken und fühlen. Alles ist so schmerzhaft auf das Fehlen von Ben konzentriert, dass ich jedes Molekül von ihm sofort wahrnehmen würde.
Der Laden sieht aus wie zuvor, die Verkäuferin telefoniert hinter der Theke, sie scheint die Ruhe selbst. Wie kann sie so ruhig sein? Dann beendet sie ihr Gespräch und dreht sich um. Als sie mich sieht, verdüstert sich ihre Miene.
»Da sind Sie!«, sagt sie, die erste Silbe betont sie seltsam, den Zeigefinger in meine Richtung gereckt.
»Es muss einen Unfall gegeben haben«, sage ich, »hier in der Straße. Jemand hat meinen Mann ins Krankenhaus gebracht. Aber wo ist das nächste Krankenhaus?«
Sie starrt mich an, als ob ich verrückt wäre.
»Das Kleid«, sagt sie, sie lässt es klingen wie eine schlimme Anklage.
Ich sehe an mir runter und begreife, was sie meint, ich trage noch immer das Kleid, und jetzt ist es verschwitzt, der Saum ist unten aufgerissen, wie ist das passiert?
»Ich muss ins Krankenhaus«, sage ich.
»Was ist mit dem Kleid?«, kontert sie.
»Ich muss dringend sofort ins nächste Krankenhaus«, wiederhole ich.
»Sie haben das Kleid kaputtgemacht«, sagt die Verkäuferin. Sie wird mich nicht gehen lassen, kurz sehe ich mich in einen Zweikampf verwickelt, mich, wie ich versuche, aus dem Laden zu entkommen, sie, wie sie hinter mir herhechtet und versucht, mich an der Flucht zu hindern, wir rollen über den Boden, ineinander verkeilt wie zwei tollwütige Welpen, bis sie mir das Kleid vom Leib reißt und ich splitternackt mit einer Rolle vorwärts aus dem Laden entwische.
Ich greife in meinen Nacken, um den Reißverschluss aufzuziehen, den sie mir eben noch liebevoll zugezogen hat, als sie mich für eine gute Braut und Kundin hielt, wie lange ist das her, zehn Minuten? Zwanzig? Vierzig?
Sie schüttelt fassungslos den Kopf. »Es ist kaputt und schmutzig, das kann ich doch jetzt nicht mehr zurückhängen!«
»Ich kaufe es«, sage ich hastig. »Vergessen Sie das Kleid. Wo ist das nächste Krankenhaus?«
»Sie müssen es bezahlen«, sagt sie.
»Mein Portemonnaie ist noch in der Umkleide, ich hole es sofort. Aber sagen Sie mir erst, wo das nächste Krankenhaus ist.«
Sie starrt mich an. Was sieht sie?
»Versprochen«, sage ich. Und dann sage ich auch noch, diesmal leiser: »Bitte.«
»Elisabeth«, sagt sie. »Das ist das Elisabeth-Krankenhaus. Zwei Stationen weiter.«
»Rufen Sie da an«, sage ich. »Schnell. Und fragen Sie nach dem Unfall.« Ich sehe ihren Blick und setze noch ein »Bitte!« hinzu, dann stürze ich in Richtung Umkleide, um mein Portemonnaie zu suchen, eins von beidem überzeugt sie anscheinend, denn sie greift nach dem Telefon. Während ich mit fliegenden Fingern in meinen Klamotten wühle, rufe ich erneut Ben an, höre, wie es läutet, und erst, als ich das Läuten nicht mehr aushalte, lege ich auf. Mein Portemonnaie kann ich zuerst nicht finden, es hat sich ganz unten in meiner Handtasche versteckt.
Ich gehe mit der Karte in der Hand und meinen zusammengerollten Klamotten unter dem Arm zurück zu der Verkäuferin und reiche ihr die Karte über den Tresen. »Und?«, frage ich ängstlich, als ich erkenne, dass sie das Telefonat offenbar schon beendet hat.
»Da war kein Unfall«, sagt sie und mustert mich, in ihrem Gesicht ist jetzt etwas Neues, Mitleid, vielleicht Verständnis. Trotzdem steckt sie langsam meine Karte in das Lesegerät und sagt auffordernd: »Die Geheimzahl bitte!«
»Kein Unfall?«, frage ich fassungslos.
Sie schüttelt den Kopf.
In meinem Kopf hämmert es. »Dann muss er einfach so umgefallen sein. Ein Herzinfarkt.«
»Ist er denn krank?«, fragt die Verkäuferin. Sie schiebt das Lesegerät demonstrativ noch etwas mehr in meine Richtung.
»Nein«, sage ich. »Nein, eigentlich nicht.« Für einen Moment ist es still, totenstill, sodass ich das Sirren in meinen Ohren höre, das nur da ist, wenn ich ganz allein bin.
»Wenn Sie dann bitte«, sagt die Verkäuferin und deutet noch einmal auf das Lesegerät, und ich nicke besiegt, während ich meine Geheimzahl eintippe. Ich brauche ihre Kooperation.
Sie zieht befriedigt den langen Papierstreifen aus dem Gerät und reißt ihn ab, ein Abschnitt für sie, einer für mich. Dann sagt sie: »Ich habe nicht nach einem Autounfall gefragt, sondern überhaupt. Sie hätten ja gesagt, wenn da was gewesen wäre.«
»Was?«, frage ich.
»Eben, im Krankenhaus. Ich habe gefragt, ob jemand eingeliefert wurde. Und sie haben gesagt, in der letzten Stunde sei überhaupt niemand gekommen.«
Ich nicke langsam.
»Haben Sie ihn denn auf seinem Handy angerufen? Vielleicht ist etwas ganz Harmloses passiert«, sagt die Verkäuferin. Vor dem Wort »Harmloses« macht sie eine komische Pause.
»Ich rufe ihn die ganze Zeit an.«
Ich merke, was da geschieht, eben noch war sie meine Verbündete, jetzt beginnt sie sich zu wundern.
»Wir müssen die Polizei rufen«, sage ich. »Bitte, machen Sie das.«
»Was soll ich denen denn sagen?«, sagt die Verkäuferin. »Nein, das geht nicht. Ich habe ja nur Ihr Wort dafür, dass …« Sie zögert.
»Bitte«, sage ich.
Mir ist klar, wenn ich selbst anrufe, werden sie nicht kommen. Niemand schickt einen Streifenwagen, weil eine erwachsene Frau ihren Freund in der Stadt aus den Augen verloren hat. Aber ich brauche die Polizei hier. Ich weiß ja, dass etwas nicht stimmt. Und ich ahne auch, was.
Die Verkäuferin schüttelt nach kurzem Zögern den Kopf. »Hören Sie, es tut mir wirklich leid, ich sehe ja, wie besorgt Sie sind, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich kann doch nicht einfach die Polizei anlügen!«
»Nein, offenbar können Sie das nicht«, sage ich langsam, und dann verlasse ich mit meinen Sachen unterm Arm den Laden, ohne mich zu verabschieden.
Ben geht immer an sein Handy. Er sagt »Ich ruf dich zurück!« und legt auf, wenn er keine Zeit hat. Ganz selten macht er es aus. Aber dann sagt er mir das vorher. Oder er schreibt mir eine Nachricht. Vor allem aber: Nie, wirklich nie nie nie würde er nicht an sein Handy gehen, wenn es eingeschaltet ist.
Es ist überflüssig, aber ich habe ihm eine Nachricht geschrieben. Ich habe sie abgesendet und beobachtet, wie diese Nachricht – Wo bist du? Ist etwas passiert? Melde dich!!! – irgendwo im elektronischen Weltall verschwand und dort stecken blieb, weil niemand sie abgerufen hat.
Ich wähle die 110.
»Mein Mann ist verschwunden«, sage ich. Und im selben Augenblick weiß ich schon, dass dieser Anruf keinen Sinn macht. Trotzdem erkläre ich. Dass Ben mit mir in den Laden gegangen ist, ganz sicher. Dass ich höchstens zehn Minuten in der Umkleide war. Dass …
»Sie haben die 110 gewählt«, sagt die Stimme.
»Ja, natürlich«, sage ich.
Die Stimme am anderen Ende bittet mich, die Leitung freizugeben. Sagt, dass sie nicht zuständig sind für Männer, die beim Einkaufsbummel verschwinden. Sagt, dass ich nach Hause gehen soll. Dass ich Bens Freunde und seine Familie anrufen soll. Dass die meisten Vermissten binnen 48 Stunden wieder auftauchen. Und dass Ben noch nicht mal ein Vermisster ist. Nur, weil er mal für eine Stunde nicht erreichbar ist. Dann wird die Stimme ungeduldig, und ich lege auf.
Es sind mittlerweile drei Stunden. Aber ich versuche, vernünftig zu sein. Erst bin ich panisch hin und her gerannt, die Straße hinauf und hinunter, habe Leute angehalten und Ladenbesitzer gefragt, dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt, und da sitze ich noch und versuche nachzudenken.
Ich soll alle Freunde anrufen, hat man mir gesagt, und seine Familie. Bens Freunde und Familie anrufen … Die wissen ja gar nicht, was sie da vorschlagen. Dass das so nicht geht.
Der Kontakt zu Bens Freunden und Familie ist nicht eng, eher im Gegenteil.
Das hat verschiedene Gründe.
Wir wollen alleine sein, Ben und ich. Wir brauchen das. Man kann manche Dinge nicht mit anderen teilen.
Diesen Sonntag im August zum Beispiel.
Ich weiß noch, wie die Sonne brannte und wie es nach Sommer roch, nach vertrocknetem Gras und Wildblumen. Wir lagen bäuchlings auf einer Wiese und dösten. Ben hatte einen Grashalm genommen und ritzte damit weiße Striche auf meine braunen Arme, einen nach dem anderen.
»Was machst du da?«, fragte ich.
Und er sagte sehr leise: »Ich male Striche.«
»Wie ein Knacki an die Wand? Einen für jeden Tag?«
La cárcel.
Er schnaubte ein bisschen, das war wohl ein Lachen. Und sagte: »Wenn das hier ein Gefängnis ist, dann will ich drinbleiben.«
Wenn zwei glücklich sind, dann ist alles gut und schön, wenn sie zusammen sind. Es reicht, auf der Wiese zu liegen und zu spüren, wie die Sonne dich langsam verbrennt und wie ein Grashalm dich berührt. Ben ist trotz seiner schwarzen Haare so hell und empfindlich, und ich rieb ihn mit Sonnencreme ein, auch im Nacken, auch hinter den Ohren, auch an den Stellen, die Menschen, die nicht so sehr lieben, vermutlich vergessen. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob Flo ihn auch so gut eingecremt hat. Aber es war zu schön und zu heiß, um an Flo zu denken, und ich war kurz eingedöst. Als ich erwachte, spürte ich Bens Grashalm auf meinem nackten Rücken.
Er sah, dass ich die Augen aufgeschlagen hatte, und murmelte: »Es ist gut, dass du so braun bist.«
»Warum?«, fragte ich schläfrig.
»Weil ich sonst nicht so gut auf dir schreiben könnte. Falls ich mal eilig eine Nummer notieren muss und ich habe keinen Stift, dann brauche ich nur einen Halm oder einen Stock und ganz viel nackte Haut von dir.«
»Kannst du haben. Da hab ich ganz viel von.«
»Hmmm.« Seine Hand umschloss meine Pobacke.
»Und welche Nummer hast du gerade aufgeschrieben?«
»Gar keine. Deinen Namen. Der ist viel besser zu schreiben. Weil er nur aus geraden Strichen besteht. Gut, dass du nicht anders heißt.«
Ich weiß noch, was ich dachte in diesem Moment. Dass es besser wäre, wenn ich meinen Namen auf Ben schreiben würde. Damit er markiert ist.
Und dann hörte ich auf zu denken, weil ich die Sonne spürte, die brannte, und den Grashalm, der mich ritzte, sehr vorsichtig, sehr schön, irgendwie.
Ich werde alles genau so machen, wie die Polizei es mir gesagt hat, damit ich nachher, wenn ich wieder anrufe, sagen kann, dass ich alles richtig gemacht habe. Dann müssen sie mich ernst nehmen.
Aus Sicht der Polizei ist es ja vernünftig, dass sie nicht sofort allem nachgehen. Schließlich haben sie Erfahrung. Die wissen, dass meistens etwas anderes dahintersteckt, wenn ein Mann beim Einkaufen verschwindet. Dass ein spontaner Kneipenbesuch dahintersteckt oder ein Streit. So ist das ja auch bei den meisten Menschen.
Die von der Polizei können ja nicht wissen, dass es bei Ben anders ist. Sie kennen ihn ja nicht. Kennen uns nicht.
Ich drücke auf anrufen und lausche.
»Ja?«, sagt die Stimme. Sie klingt kühl und knapp.
Es ist die Stimme von Markus. Ich habe mich entschieden, mit Markus anzufangen, Bens bestem und ältestem Freund.
»Ich bin’s, Nile«, sage ich.
Er wartet.
»Weißt du, wo Ben ist?«
»Bitte was?«
»Ben ist weg.«
Zwischen uns schwingt die Stille, dann sagt Markus: »Das ist jetzt nicht dein Ernst!«, und schon hat er aufgelegt.
»Markus, ich –«, sage ich noch, aber aus dem Hörer dringt nur Tuten.
Die Nummer von Bens Schwester habe ich auch eingespeichert.
Sie heißt Ute.
Leider geht nur der Anrufbeantworter ran, eine fröhliche Stimme verrät, dass Mila, Leon, Ute und Hans gerade nicht da sind. Es ist eine Kinderstimme, ob sie Mila oder Leon gehört, kann ich nicht identifizieren. Ich kenne die beiden nicht. Auch Ute kenne ich nur aus Erzählungen.
»Hier ist Nile, die Freundin von Ben«, sage ich. »Bitte melde dich, sobald es geht.« Dafür hinterlasse ich meine Nummer.
Ich rufe Bens Eltern an.
»Godak?«, sagt seine Mutter. Ich stelle mir vor, wie sie in ihrem großen Flur an der Truhe lehnt, auf der neben einer cremefarbenen Vase mit riesigem Bouquet aus künstlichen Blumen das Telefon steht. Wie ihre erstaunlich runzligen Hände mit den lackierten Nägeln das Telefon umklammert halten.
Ich war erst einmal dort, aber ich habe nichts vergessen von diesem Nachmittag. Auch nicht Ben, wie er sagte, dass sie ihn mal kreuzweise können. Dass er nichts mehr mit ihnen zu tun haben will, wenn sie sich so benehmen. Wenn sie mich so behandeln.
Ich habe auch das Geräusch nicht vergessen, mit dem die Tür ins Schloss gefallen ist, als wir gegangen sind.
»Hier ist Nile«, sage ich, und da legt sie auf.
Mein Herz hämmert.
Es sind seine Eltern. Er ist verschwunden. Das hier hat nichts mit mir zu tun.
Ich wähle noch einmal.
Es wird abgehoben, aber sie sagt nichts.
»Es geht um Ben«, sage ich. »Nur deswegen rufe ich an. Weil –«
Da schreit sie los. »Wenn Ben ein Problem hat, dann soll er mich anrufen!«
»Darum geht es ja. Das kann er nicht. Er ist verschwunden.«
Für einen Moment ist sie still. Dann sagt sie: »Wenn, dann bespreche ich das mit seiner Frau. Nicht mit Ihnen. Guten Tag.«
Und dann legt sie auf.
Sie hassen mich. Alle hassen mich. Sie hassen mich, weil Ben mich liebt.
Was hat die Polizei gesagt? Ich soll nach Hause gehen. Weil es sein kann, dass er dort auftaucht. Dass jemand anruft. Dass dort ein Hinweis auf mich wartet.
Deswegen bin ich jetzt hier. Und hier ist kein Ben, kein Anruf, kein Hinweis.
Nur unsere Wohnung, drei riesige Zimmer in einem halbwegs renovierten Altbau mit Stuck und zerschrammtem Parkett und einem niedlichen Erkerfenster, von dem man auf die dicht befahrene Straße sehen kann und auf den schönen grünen Baum, der ungerührt zwischen den Parkbuchten steht.
Eine Steinlinde, sagt Ben.
Ben weiß so was.
Als Erstes ziehe ich das Kleid aus, das ziemlich ramponiert aussieht. Mein Brautkleid. Ich hänge es an einem Bügel in den Flur. In Unterwäsche gehe ich in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken.
Ich habe mein Handy mehrmals aus- und wieder angestellt. Sogar beim Netzbetreiber habe ich mich erkundigt, ob mit dem Anschluss alles in Ordnung ist. Ja, ist es.
Ich habe Ben zahllose Nachrichten geschickt. Ich habe ihn angerufen, wieder und wieder. Inzwischen kommt nicht mal mehr ein Freizeichen. Sein Handy ist anscheinend aus, vielleicht ist der Akku leer. Er würde doch sein Handy nicht ausschalten? Niemals würde er das.
Es ist ein Uhr nachts, und Ben ist etwas Entsetzliches zugestoßen. Ich weiß das. Aber niemand sonst weiß es. Und niemand glaubt mir.
Vorhin habe ich nachgesehen, ob Bens Dienstwagen im Hof steht, und natürlich steht er dort, unbewegt. Mein Auto steht daneben. Mein Auto, das ich eigentlich gar nicht brauche, eigentlich wollte ich es längst abschaffen.
Auch die Wohnung ist unberührt. Aufgerissene Umschläge auf dem Sideboard im Flur, Krümel und Kaffeeränder auf dem Küchentisch, unser Bett zerwühlt und ungemacht, das Laken kalt. Alles wirkt genau so, wie ich es verlassen habe, um ihn von der Arbeit abzuholen.
Trotzdem schiebe ich die Türen unseres Kleiderschranks auf, sie gleiten geräuschlos beiseite, und ich denke daran, wie wir ihn zusammen aufgebaut haben, diesen Riesen von Schrank. Ein Zweipersonenschrank. Ein Pärchenschrank.
Bens Sachen hängen sauber auf ihren Bügeln. Hemden, Shirts, Jacken. Die Hosen liegen oben im Fach. Ich streiche mit dem Finger über die glatte Baumwolle seiner Hemdkragen. Nichts fehlt. Natürlich nicht.
Unsere Wohnung.
Nuestra casa.
Dass wir sie gefunden haben, grenzt an ein Wunder. Der Wohnungsmarkt ist eigentlich eine Katastrophe, und noch dazu wollten wir unbedingt mitten in der Stadt wohnen. Aber zum Glück haben wir diesen Zettel in zittriger Schrift im Supermarkt gesehen, an der Pinnwand, an der Leute ihre ungenutzten Fitnessgeräte oder Nachhilfestunden anbieten.