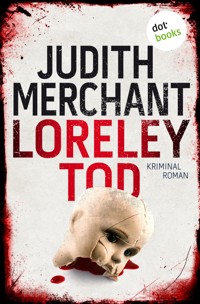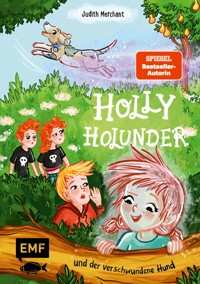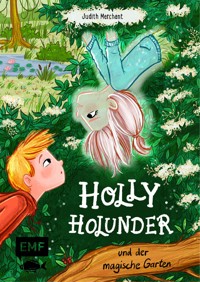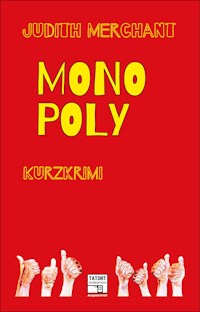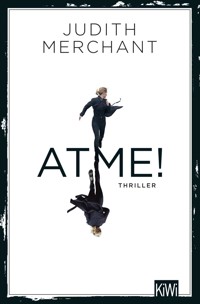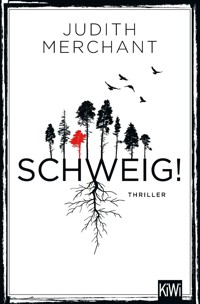
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was würdest du tun, um deine Schwester zu retten? Und was, um sie loszuwerden? Eigentlich muss Esther ihr Weihnachtsfest mit Ehemann und Kindern in der Stadt vorbereiten: einkaufen, Tanne besorgen – es wäre genug zu tun. Doch ihre Schwester Sue, die seit ihrer Scheidung völlig allein in einem riesigen Haus tief im Wald lebt, geht ihr nicht aus dem Kopf. Und so setzt sie sich ins Auto und fährt los. Aber nur um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist und ob Sue zumindest ihre Tabletten nimmt. In die Stadt einladen kann sie sie nicht. Denn was, wenn sie wieder durchdreht – wie letztes Jahr? Am Haus im Wald angekommen, stellt Esther fest, dass Sue sie loswerden will. Was hat sie zu verbergen? Ein Schneesturm setzt ein. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit kommen die Schwestern ins Gespräch, und kein Stein bleibt auf dem anderen – bis eine der beiden zum Messer greift. Während der Schnee alles verdeckt und jedes Geräusch erstickt ... Judith Merchant lässt in ihrem neuen psychologischen Spannungsroman zwei unzuverlässige Erzählerinnen gegeneinander antreten – in einem unheimlich intensiven Kammerspiel um eine toxische Beziehung, in der nichts so ist, wie es scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Judith Merchant
SCHWEIG!
Thriller
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Judith Merchant
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Judith Merchant
Judith Merchant studierte Literaturwissenschaft und unterrichtet heute Creative Writing an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Für ihre Kurzgeschichten wurde sie zweimal mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. Nach der Veröffentlichung ihrer Rheinkrimi-Serie (darunter »Nibelungenmord« und »Loreley singt nicht mehr«) zog Judith Merchant von der Idylle in die Großstadt. 2019 erschien ihr Thriller »ATME!« bei Kiepenheuer & Witsch und wurde zum Bestseller. »SCHWEIG!« folgte 2021.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eigentlich muss Esther ihr Weihnachtsfest mit Ehemann und Kindern in der Stadt vorbereiten: einkaufen, Tanne besorgen – es wäre genug zu tun. Doch ihre Schwester Sue, die seit ihrer Scheidung völlig allein in einem riesigen Haus tief im Wald lebt, geht ihr nicht aus dem Kopf. Und so setzt sie sich ins Auto und fährt los. Aber nur um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist und ob Sue zumindest ihre Tabletten nimmt. In die Stadt einladen kann sie sie nicht. Denn was, wenn sie wieder durchdreht – wie letztes Jahr? Am Haus im Wald angekommen, stellt Esther fest, dass Sue sie loswerden will. Was hat sie zu verbergen? Ein Schneesturm setzt ein. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit kommen die Schwestern ins Gespräch, und kein Stein bleibt auf dem anderen – bis eine der beiden zum Messer greift. Während der Schnee alles verdeckt und jedes Geräusch erstickt …
»Die Autorin weiß ihre Leser virtuos aufs Glatteis zu führen.«
Kölner Stadt-Anzeiger
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © shutterstock.com / Potapov Alexander; © shutterstock.com / CarpathianPrince; © shutterstock.com / Oleksandr Khoma
Illustration: Oliver Wetterauer, Stuttgart
ISBN978-3-462-30299-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Textbeginn
Esther
Esther
Sue
Esther
Sue
Esther
Sue
Esther
Sue
Esther
Sue, letztes Jahr
Esther
Esther
Esther, letztes Jahr
Sue, Kindheit
Esther
Esther, Kindheit
Sue
Esther
Sue
Esther
Esther
Sue
Esther
Martin
Esther
Esther
Esther
Sue
Martin
Esther
Sue
Martin
Sue
Das Mädchen
Esther
Sue
Esther
Sue, letztes Jahr
Esther
Das Mädchen
Sue
Esther
Martin
Esther
Martin
Esther
Martin
Martin, letztes Jahr
Sue
Esther
Sue
Esther
Martin
Sue
Martin
Sue
Das Mädchen
Esther
Martin
Sue
Martin
Esther
Martin
Esther
Sue, letztes Jahr
Esther
Martin
Esther
Sue
Sue
Martin
Sue
Sue
Sue
Esther
Sue
Esther
Sue
Sue, Kindheit
Sue
Sue
Esther
Esther
Sue
Esther
Sue, Kindheit
Sue, ein Jahr später
Illustration
Esther, ein Jahr später
Leseprobe »Gezeitenmord«
Ich bin ein freier Mensch.
Ich kann essen und trinken, was ich will und wann ich will, oder ich kann es lassen. Ich kann schlafen, wann ich will, oder ich kann wach bleiben. Ich kann entscheiden, ob ich arbeite und was ich arbeite. Ich kann mich bewegen, wohin ich will, oder ich kann hierbleiben. Ich kann allein bleiben, wenn ich will, oder ich kann mir einen Partner suchen oder eine Partnerin oder beides. Ich kann heiraten oder in wilder Ehe leben, ich kann mich trennen oder scheiden lassen. Ich bin ein freier Mensch.
Ich bin kein freier Mensch, denn ich habe eine Schwester. Ich kann sie ignorieren. Dann habe ich immer noch eine Schwester, aber eine, die ich ignoriere. Ich kann den Kontakt abbrechen. Dann habe ich immer noch eine Schwester, aber eine, zu der ich den Kontakt abgebrochen habe. Ich kann sterben. Dann habe ich immer noch eine Schwester, aber eine, die heftig um mich trauert. Sie kann sterben. Auch dann habe ich noch immer eine Schwester, aber eine tote.
Ich bin kein freier Mensch, obwohl meine Schwester mir nichts Böses will. Aber sie ist meine Schwester. Und das bleibt sie für immer und ewig.
Esther
Dinge, die ich an diesem 23. Dezember um 7.22 Uhr schon weiß:
Dass Jonas trotz mehrfacher Ermahnungen nachher ohne seinen Turnbeutel aus der Schule kommen wird.
Dass deswegen seine Sportsachen während der gesamten Weihnachtsferien am Haken gären und dabei einen Gestank entwickeln werden, den kein Mensch bei 40 Grad herausbekommt.
Dass mehr als 40 Grad seinen heiß geliebten Sportanzug zerstören werden und dass Jonas niemals verstehen wird, dass ich nicht daran schuld bin.
Dass ich den vorbestellten Christbaum bis 14 Uhr abholen muss.
Ich reiße einen Klebestreifen von der Rolle und fluche, weil er ausfranst. Ein langer, immer dünner werdender Zipfel wickelt sich um die Plastikrolle, es wird eine endlose Knibbelei werden, den Anfang zu finden. Ich greife zur Kaffeekanne.
Kaffee. Erst einmal mehr Kaffee.
»Für wen ist das?«, will Ella wissen und starrt gebannt auf das steife Glitzerpapier.
»Für deine Tante Schnecke. Abmarsch zum Zähneputzen, du musst in die Schule!«
Reglos bleibt sie neben mir stehen und bettelt: »Darf ich helfen?« Sie liebt es, Geschenke einzupacken. Und Basteln. Und Glitzer.
»Nein«, sage ich. »Und jetzt los, Zähneputzen! Du willst doch am letzten Schultag nicht zu spät kommen!«
»Mama! Das ist so unfair!«
Ihre riesigen blauen Augen blinken mich an, und ich werfe einen Blick auf die Uhr und denke: Morgen ist Weihnachten. Und: Einmal nachgeben schadet nicht. Und auch: Dann muss ich dieses verdammte Tesa nicht selbst knibbeln.
»Okay«, sage ich. »Aber nimm es mit ins Wohnzimmer, ja?«
Sie nickt, packt Buch, Papier, Tesafilm und Schere und verschwindet damit, ehe ich es mir anders überlegen kann. Und ich frage mich, wie sie diese vier Gegenstände mühelos jonglieren kann, während sie sonst grundsätzlich alles fallen lässt.
Martin steckt seinen Kopf in die Küche, die Krawatte schief um den Hals. »Hast du meinen Schlüssel gesehen? Ich hab schon überall gesucht!« Seine Stimme ist anklagend, in seinem Mundwinkel klebt Zahnpasta.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie er jeden Morgen aufs Neue die Metamorphose von einem wehleidigen, zerstreuten Studenten zum korrekten Büromenschen vollzieht. In einer halben Stunde wird er konzentriert und picobello gekleidet das Haus verlassen und pfeifend in sein Auto steigen. Er hat noch einen Termin in der Firma. Einen ganz kurzen, hat er versprochen.
»Neben dem Telefon«, sage ich, ohne nachzudenken. Da liegt er immer.
Er seufzt, setzt sich neben mich und greift nach meiner Kaffeetasse. »Leer!«, sagt er beinahe empört. Dann zupft er an meinem Kragen. »Schönes Kleid!«
Ich zucke die Achseln, er greift nach der Kanne. Zu den absonderlicheren unserer Paarrituale gehört, dass wir ständig aus denselben Tassen trinken.
Ich merke, wie unruhig ich bin, es gibt noch so viel zu tun. Schon hier auf dem Frühstückstisch stapeln sich die Aufgaben: die Christbaumkugel aus Plexiglas, die geklebt werden muss. Der Schwung Verlegenheits-Karten, die wir gestern Abend noch geschrieben haben – als Reaktion auf all die Leute, die uns mit Weihnachtspost bedacht haben. Himmel, wie schaffen die das, und dann auch noch pünktlich? Ich bin kurz davor aufzustehen, um die Liste in meinem Kopf abzuarbeiten: Wäsche in den Trockner. Baum abholen. Jonas an Turnsachen erinnern. Stattdessen sage ich halblaut zu Martin: »Ich muss dann gleich losfahren.«
Er drückt kurz mein Knie und sagt: »Wird schon. Vielleicht ist sie ja ganz …« Er zögert und verstummt.
Draußen braust der Verkehr, Autos hupen empört, Straßenbahnen bremsen unter warnendem Gebimmel. Es ist der 23. Dezember, erwartungsgemäß ist auf den Straßen die Hölle los, weil alle gleichzeitig in die Innenstadt drängen, um letzte Dinge zu erledigen.
So wie wir es normalerweise auch immer tun. Und auch in diesem Jahr steht uns dieser Wahnsinn noch bevor. Aber heute werde ich mich daraus erst mal für einige Stunden ausklinken, um in den Wald zu fahren.
»Ganz was?«, frage ich.
Er seufzt. »Ganz stabil.«
»Du redest von meiner Schwester.«
»Ich weiß. Ach, ich find das nicht gut. Ausgerechnet heute«, sagt er, dabei weiß er, dass das Blödsinn ist. Nicht »ausgerechnet heute«, sondern »gerade heute«. Gerade am Tag vor Heiligabend will ich meiner Schwester zeigen, dass ich an sie denke. Weil sie allein in ihrem Haus im Wald sitzt und keine Gesellschaft hat außer den zehn leeren Zimmern um sich herum. Meine Schwester, die sich in der Trauer über ihre zerbrochene Ehe suhlt, kinderlos, halb verrückt, so zugänglich wie ein Kaktus.
»Es wäre für euch beide besser, wenn du hierbleibst.«
»Vielleicht. Aber es ist Weihnachten. Und sie ist meine Schwester. So ist das eben. Immer schon.«
»Es muss aber nicht für immer so bleiben, wenn es keinem guttut.«
»Ich bringe ihr doch nur das Geschenk vorbei«, sage ich, um uns beide zu beruhigen.
»Du hättest es ihr auch schicken können.«
Nein, das hätte ich nicht. Er weiß doch, dass es um etwas anderes geht. Nicht um irgendein Buch, das sie ohnehin nicht lesen wird.
Es geht bei Geschenken nie um das, was sich unter dem Geschenkpapier verbirgt. Zumindest nicht dort, wo komplizierte Beziehungen herrschen.
Zwischen Martin und mir ist es anders. Da ist alles kristallklar und handfest: Er bekommt diesen absurd gefederten Fahrradsitz, ich den eigentlich zu teuren Lampenschirm für die Flurleuchte. Das sind Dinge, die wir uns wünschen und die eigentlich das Familienbudget sprengen. Zu Weihnachten gestatten wir das einander. Ein fairer Warentausch. Wobei ein Tausch streng genommen nicht das Gleiche ist wie ein Geschenk. Bedeutet das, wir schenken einander in Wahrheit gar nichts? Und überhaupt: Wie kann man einander etwas schenken, wenn alles vom gemeinsamen Konto bezahlt wird?
»Ist noch was von Günnis Gutsriesling da?«
»Willst du ihr den etwa auch mitbringen?«
»Martin. Sie ist meine Schwester. Das Mindeste, was ich für sie tun kann, ist, ihr eine schöne Flasche Wein für den Heiligabend vorbeizubringen.« Ich muss an Rotkäppchen denken, als ich das sage. An Rotkäppchen, das durch den Wald geht, um der Großmutter eine Flasche Wein und Kuchen und ein Taschenbuch zu bringen. Und dann kommt der Wolf. »Wir haben doch vor einigen Wochen noch drei Kisten bestellt. Holst du eine Flasche hoch?«
»Mach ich gleich. Aber bist du sicher, dass du ihr Wein schenken willst?«
Statt einer Antwort brülle ich: »Jonas! Zähneputzen!«
Ich stehe auf und sage etwas zusammenhanglos: »Ich will eh bis zwei Uhr zurück sein, weil ich bis dahin den Baum bei Momo’s abgeholt haben muss.«
Martin trinkt Kaffee, er schielt in die Tasse. »Sagst du das so deutlich, um mir mitzuteilen, dass ich ihn abholen muss, falls du zu spät kommst?«
»Ich komme nicht zu spät.«
»Sicher?«
Ich seufze. Sein Zweifel ist berechtigt. Wie oft haben wir wegen meiner Schwester schon Pläne über den Haufen werfen müssen, wie oft habe ich ihretwegen Termine nicht eingehalten?
»Nein, keine Angst, ich schaffe das ganz sicher«, behaupte ich und hoffe, dass es so ist. »Ich hab einen vorbestellt. Kaum zu glauben, dass man Bäume vorbestellen muss, wenn sie bio sind.«
»Sag mir kurz, warum der Baum bio sein muss, ich hab’s möglicherweise vergessen«, murmelt Martin und zieht an seinem Krawattenknoten, als wollte er sich strangulieren.
»Weil Pimki seit letztem Jahr gern Tannenzweige mag.« Pimki ist unser Kater, und er hat den perversesten Geschmack der Welt. Er liebt alles, was kratzt, zum Beispiel Zahnbürsten und Stahlwolle. Die Klobürste verstecken wir im Besenschrank, weil wir Angst davor haben, was er mit ihr anstellen würde.
»Aber –«, will Martin widersprechen, doch ich hebe warnend die Augenbrauen und zeige durch die Küchenwand in Richtung Badezimmer, wo Jonas sich die Zähne putzt. Jonas ist das ökologische Gewissen der Familie. Wenn er hört, dass wir Pimki zu Weihnachten mit einem gespritzten Baum vergiften, dreht er durch, und wir haben heute keine Zeit für Grundsatzdiskussionen.
»Sehr gut, dass wir dieses Jahr einen Bio-Baum haben!«, sagt Martin extra laut und leert den Kaffee. Sein Gesicht hat sich verändert, er sieht jetzt wach aus und erwachsen, gedankenverloren hat er sich ins Gesicht gegriffen und dabei die Zahnpastaspuren entfernt. Er steht auf und geht zu Jonas ins Badezimmer.
Ich weiß, dass er sich jetzt mit Deo einsprüht. Er darf das nicht vor dem Frühstück machen, weil die Kinder behaupten, dass dann die Milch nach Deo schmeckt. Wir haben es aufgegeben, über solchen Kram mit ihnen zu diskutieren. Es ist das kleinere Übel, wenn man die Alternative bedenkt: dass sie aus Protest morgens das Haus verlassen, ohne was getrunken zu haben.
Ach ja, die Kinder! Ich finde Ella im Wohnzimmer, wo sie stolz das Geschenk betrachtet. Es ist rautenförmig, man würde nicht vermuten, dass ein Buch darin steckt. Es sieht trotzdem gut aus, das tolle Geschenkpapier reißt es raus – glitzernde Schneeflocken, geprägt auf dickem hellblauem Papier. Anscheinend hat Ella es ganz ohne Tesafilm geschafft, sie hat Geschenkband darum gewickelt, als wollte sie es fesseln. Schleifen kann oder will sie nicht binden, kein Wunder, wo doch die meisten Kinderschuhe heutzutage Klettverschlüsse haben. Das ist schlecht für die Gehirnentwicklung, habe ich gelesen, darum habe ich ihr beigebracht, wie man Schleifen bindet, Ehrenwort, aber dann waren die Klettverschluss-Schuhe trotzdem überall, und irgendwie hat sie es wieder verlernt.
Ich nehme ihr das Geschenk ab, flüstere noch einmal: »Zähneputzen!«, dann rufe ich in Martins Richtung: »Der Wein!«, und gehe zurück in die Küche. Ich kräusle das Geschenkband mit dem Brotmesser, stecke das Päckchen in meine Umhängetasche. Jetzt fehlt nur noch die Weinflasche.
Martin kommt zurück in die Küche, frisch duftend, und legt die Weinflasche in meine Tasche. Ich überlege, ihm den Baumauftrag aufzudrücken. Für den Fall, dass es doch länger dauert bei meiner Schwester. Irgendwie passiert das meistens. Das ist umso seltsamer, als wir einander eigentlich immer möglichst schnell wieder loswerden wollen.
Martins Mund streift meine Wange. »Du guckst schon wieder so kompliziert. Sobald es um sie geht, wird immer alles kompliziert. Willst du nicht doch lieber …«
Er hat recht, ich weiß genau, dass er recht hat. Trotzdem sage ich »Quatsch!« und erhebe mich. »Ich muss los. Jonas!« Ich brülle, damit er mich auch im Badezimmer hören kann. »Denk daran, den Turnbeutel nachher mitzubringen!«
Ein hohler Laut aus dem Badezimmer. Schwer zu sagen, ob das jetzt präpubertäres Protestgestöhne war oder ein Geräusch, das besagt, dass er gerade Zähne putzt und deswegen nicht sprechen kann. Ich hoffe auf Letzteres.
»Erinnere du ihn auch noch mal«, sage ich zu Martin.
»Wo ist Ella?«, fragt der. Seine Hand greift an den Knoten und zieht den Schlips zurecht. Jetzt sitzt er perfekt. Die Metamorphose ist vollendet.
Aus dem Wohnzimmer kommen kieksende Cartoon-Stimmen. Sie hat einfach den Fernseher angemacht. »Ella!« Das brüllen wir wie aus einem Mund. Ich nehme die Tasche und frage beinahe zaghaft: »Kuss?« Das ist unser Code.
»Kuss.«
Wir küssen uns.
»Ich bin bald zurück!«, verspreche ich, und für einen Moment halten wir uns mit Blicken fest, umklammern uns förmlich, weil wir wissen, dass das ein schwerer Tag wird. Weil wir hoffen, dass ich wirklich bald zurück bin.
Weil wir hoffen, dass wir die gefährliche Schwestern-Klippe diesmal unbeschadet umschiffen und Weihnachten heil erreichen können.
Weil die Hoffnung immer zuletzt stirbt.
Dinge, die ich an diesem 23. Dezember um 7.51 Uhr noch nicht weiß:
Dass das Geschenk, das Ella gerade in hellblaues Geschenkpapier gewickelt hat, nicht ausgepackt werden wird.
Dass der Wein der falsche Wein ist.
Dass er heute trotzdem noch geleert werden wird.
Dass dieses Weihnachten nicht alle überleben werden.
Esther
Laut Navi liegen nur 107 Kilometer zwischen unserer Wohnung und dem Haus im Wald. Trotzdem braucht man für die Strecke eine Ewigkeit, weil sich das letzte Drittel durch Felder und Dörfer und Wälder windet. Seit ich die Autobahn verlassen habe, schneit es, und je näher ich meiner Schwester komme, desto langsamer geht es voran, desto weißer und einsamer wird die Landschaft.
»Soll ich mitkommen?«, hat Martin gefragt, aber das war eine rhetorische Frage. Martin ist der Begegnung mit meiner Schwester nicht gewachsen, das hat die bisherige Erfahrung ganz klar gezeigt. Es könnte mich sauer machen, dass mein Mann, dem ich bei allem unter die Arme greife und ansonsten den Rücken frei halte, mir ausgerechnet bei der größten Baustelle in meinem Leben nicht helfen kann. Aber so ist es nicht.
Ich akzeptiere diese spezielle Baustelle. Die größte. Familie ist eine Herausforderung. Vor allem, wenn es in dieser Familie ein schwarzes Schaf gibt. Wobei »schwarz« nicht so recht zu meiner aschblonden, blassen Schwester passen will. Und »Schaf« klingt verharmlosend.
Sie ist nicht direkt gefährlich, aber sie zieht die Menschen um sie herum in einen Strudel aus Chaos und Manipulation und Verwirrung. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst überhaupt klar ist. Aber ich weiß, dass es so ist. Spätestens seit dem letzten Jahr. Seit dem Weihnachtsfest, bei dem sie ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Und wir erkannt haben, wie labil sie wirklich ist.
»Route wird neu berechnet«, plärrt das Navi. Es ist schon das dritte Mal, dass sich unerwartete Hindernisse auftun, ein umgestürzter Baum hat die eine Straße unpassierbar gemacht, auf einer anderen hat ein Laster Ladung verloren.
Vor drei Jahren ist sie mit Robert hierhergezogen, ein mehr oder weniger glückliches Paar, das plötzlich mit der überraschenden Nachricht von einem Zehn-Zimmer-Haus im Wald um die Ecke kam. Für Martin und mich war das seltsam, weil wir selber seit Jahren darüber sprechen, warum wir uns eigentlich nicht zumindest eine Eigentumswohnung leisten können.
Meine Schwester und mein Schwager mussten sich diese Frage ganz offensichtlich nicht stellen. Ohne dass von Krediten, Tilgung oder Bankgesprächen die Rede war, kauften sie das Haus.
»Sie hat sich in den Wald verliebt, und dann haben wir einfach zugeschlagen. Es ist natürlich ziemlich ab vom Schuss, so weit außerhalb will ja kaum jemand wohnen. Darum war das Haus auch so günstig«, sagte mein Schwager, entschuldigend beinahe. Er ließ es so klingen, als hätten sie auf dem Flohmarkt eine verrückte kleine Teekanne gekauft, die sonst niemand wollte.
Es wirkte auf mich aber immer auch so, als wollte er sagen: »Ihr würdet so ein Haus doch nicht einmal geschenkt haben wollen, so tief im Wald. Ihr wollt ja unbedingt eine Stadtwohnung mitten im Trubel.«
Nun, wir müssen im Trubel wohnen, weil wir beide berufstätig sind. Und wir haben zwar ein doppeltes Einkommen, aber in der Stadt gibt es selbst ein schmales Reihenhaus mit Garten nur für die, die reiche Eltern haben. Damit sind Martin und ich raus. Meine Schwester wäre auch raus, aber sie hat ja Robert. Und Robert kann sich nicht nur die Reihenhäuser in der Stadt leisten, sondern eben auch einen solchen Palast im Wald.
Trotzdem tut meine Schwester so, als wäre das ein riesiges Opfer, das sie bringt. Sie sagt das nicht direkt, aber sie lässt es durchklingen. Dass sie in einem Haus lebt, das für die meisten Menschen nicht attraktiv ist, weil es in der Nähe weder Kinos noch Restaurants gibt. Deswegen hat sie sich schweren Herzens erbarmt, und wegen des instabilen Netzes kann sie leider auch nicht arbeiten, so ein Mist!
In Wahrheit ist es natürlich genau umgekehrt: Nur Reiche können es sich erlauben, so zu wohnen. Aber es geht nicht nur darum, dass die wenigsten Menschen das nötige Kleingeld haben für so ein modernes Architektenhaus mit dreihundert Quadratmetern Wohnfläche, nagelneuer Küche und einigen Hektar Wald. Sondern auch darum, dass normale Menschen in der Nähe von Schule und Arbeitsstätte leben müssen.
Die angebliche Bescheidenheit dieser modernen Wald-Villa ist es, was sie in Martins und meinen Augen so dekadent macht.
Auch wenn es meinem Schwager – oder eher: meinem Ex-Schwager – geradezu unangenehm zu sein schien, konnte er nie verbergen, auf wie viel Geld er hockt. Geld, das er in den Neunzigern mit seiner Beraterfirmer verdient hat und von dem Martin und ich nur träumen können, obwohl wir natürlich viel mehr arbeiten.
Warum Robert meine Schwester so gut versorgt hinterlässt, ist mir schleierhaft. Ich meine, nach vier Jahren kinderloser Ehe, in denen es keine Firma mehr gab und deshalb auch kein gemeinsames Einkommen, hätte er ihr eigentlich gar nichts zahlen müssen. »Halt dich da raus«, sagt Martin immer, »du weißt nichts Genaues.«
Das stimmt natürlich. Ich weiß nichts Genaues. Ich weiß nur, dass meine Schwester in der Villa ihres Ex-Mannes sitzt, mitten in dem Wald, in den sie sich »verliebt« hat, dass sie nicht arbeitet und keinen Stress hat und dass sie trotzdem unglücklich ist. Und statt sich ein neues Leben aufzubauen, vergräbt sie sich noch tiefer in der Isolation, indem sie auf Technik weitgehend verzichtet, weil diese sie »unruhig« macht, wie sie sagt. Darum hat sie nach ihrem Nervenzusammenbruch letztes Jahr auch ihr Smartphone abgeschafft. Ach, und wegen der gefährlichen Strahlung, natürlich. Seitdem erreicht man sie nur noch über ihr Festnetztelefon, und selbst das fällt manchmal aus.
Das kann man schon komisch finden.
»Warum fährst du da wirklich hin?«, fragt Martin immer, aber er versteht das nicht, weil er keine Geschwister hat. Er versteht nicht, dass man sich Sorgen macht. Und auch nicht, dass es da etwas gibt, das einen zwingt, Nähe zur eigenen Familie auszuhalten, auch wenn es einem schlecht danach geht. Dass das sein muss, gerade zu Weihnachten. Dass man diese Nähe sogar selbst herbeiführt. Dass man widerwillig hinfährt, um dann zu sagen: Schön, dich zu sehen! Und: Gut siehst du aus! Und: Wir müssen unbedingt im Sommer mal, es wäre so schön, wenn wir das schaffen würden!
Auch wenn jeder einzelne Satz davon eine Lüge ist.
Sue
Es schneit da draußen.
Manchmal hört es auf damit, aber dann fängt es wieder an. Und die Tannen werden weiß und immer weißer, alles wird weiß, der ganze Wald, eiskalt und wunderschön ist es da draußen, ein Bild, das ich trinken möchte in großen, durstigen Zügen.
Der Blick aus dem Fenster ist der pure Frieden. Und hier drinnen ist es warm und gemütlich und auch wunderschön, und genauso soll es sein, denn morgen ist Weihnachten.
Ich weiß das alles deshalb so sehr zu schätzen, weil es früher anders war. Früher habe ich mich von Weihnachten packen und durch die Stresshölle und die Konsumarena schleifen lassen.
Dabei ist es so leicht. Man muss nur in die richtige Richtung blicken. In die Natur, zum Beispiel. Und in den Schnee.
Dieses Glücksgefühl, wenn ich die Tür öffne und die Kälte mir den Atem verschlägt. Dieses Glücksgefühl, mit den Stiefeln durch den harschigen Schnee zu stapfen und zu hören, wie er bricht. Dieses Glücksgefühl, danach ins warme Haus zurückzukommen und zu spüren, wie das Leben in die kalten Hände und Füße zurückkehrt.
Zu den vielen guten Dingen gehört auch die Höhenlage. Dreihundert Meter höher als vorher, in der Stadt. Jetzt spüre ich die Jahreszeiten. Im Sommer ist es warm, und im Winter liegt Schnee. So fühlt sich die Welt gleich viel richtiger an. Einem ist stets bewusst, dass die Natur bestimmte Regeln setzt, an die man sich halten muss. Dass man nicht alles selbst entscheiden kann.
Das klingt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber es sind ja gerade die kleinen Dinge, die wichtig sind. Oder große wie die Nadelbäume vor meinem bodentiefen Wohnzimmerfenster. Es sind überwiegend Fichten. Auf meinem Grundstück, das nahtlos in den Wald übergeht, hat der Vorbesitzer auch einige Edeltannen gepflanzt. Über solche Unterschiede habe ich mir früher gar keine Gedanken gemacht. Das hat sich verändert. Ich sehe jetzt mehr Nadelbäume als Menschen, darum denke ich mehr über Bäume als über Menschen nach.
Ich mochte Nadelbäume schon immer, aber ich wusste nie, warum.
Inzwischen weiß ich es. Tannen und Fichten sind fest und grün und ruhig. Andere Bäume sind immerfort in Bewegung, sie biegen sich im Wind, ihre Blätter flattern und rascheln ängstlich herum, und dann verändern sie sich plötzlich, geben die Blätter auf, wechseln Farbe und Form, werden trocken und hinterlassen nur diese kahlen Baumgerippe, vor denen einem gruseln könnte, wenn man ein ängstlicher Mensch wäre.
So etwas kann einem mit Nadelbäumen nicht passieren. Die sind stark und bleiben bei sich. Sie bleiben immer gleich, sie passen sich nicht an, sie bleiben stehen oder gehen unter, aber meistens bleiben sie stehen. Und sie tragen ihre duftenden grünen Nadeln mit Stolz, das ganze Jahr hindurch. Darum sehen sie auch immer gleich aus. Nur der Schnee macht einen Unterschied.
Wenn der Schnee kommt, hört man gar nichts mehr im Wald. Alle Geräusche verschluckt der Schnee, und das finde ich so schön und beruhigend.
Gestern habe ich eine Tanne von draußen ins Haus geholt. Ich habe mir Zeit gelassen, die richtige auszusuchen. Sie sollte Deckenhöhe haben, gleichmäßig gewachsen sein und schön gedrungen, das ist bei frei wachsenden Bäumen ja nicht selbstverständlich.
Ich trete in die Küche. Meine Küche ist groß und leer. Es war eine solche Erleichterung, all den Mist auszusortieren. Mein Leben war immer randvoll mit Zeug, das ich nicht brauchte, obwohl ich dachte, dass ich es brauchte. Das hätte ich eigentlich schon viel früher durchschauen müssen. Den Mechanismus kenne ich ja. Schließlich war das als Werberin jahrelang mein Beruf: Menschen dazu zu bringen, dass sie Dinge, die sie nicht brauchen, unbedingt haben wollen. Darin war ich richtig gut.
Offenbar bin ich in dieselbe Falle getappt und habe es nicht gemerkt. Geschirr für Besucher, die ich nie wirklich empfangen wollte. Milchaufschäumer und Mikrowelle, Dampfgarer und Reiskocher, obwohl ein einfacher Topf eigentlich reicht. Klamotten für die absurdesten Gelegenheiten. Handtaschen und Schuhe, die für genau die eine Kombination genau dieser Klamotten passten, für die es dann wiederum passende Ohrringe gab. All diesen überflüssigen Mist, der nur Platz wegnimmt und Staub fängt, habe ich der Caritas gegeben.
Ich will nichts Altes mehr. Ich will etwas Neues. Ich weiß nur noch nicht, was.
Es gilt ja als große Tugend, wenn man Ziele hat und sie benennen kann. Bei jedem Bewerbungs- und Mitarbeitergespräch wurde ich gefragt: Wo sehen Sie sich in einem Jahr? In fünf Jahren? In zehn? Ich habe immer gut geantwortet, weil ich wusste, was ich wollte. Immer. Ganz genau. Das war mein Kompass.
Jetzt könnte ich eine solche Antwort nicht mehr geben. Weil ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, wo und vor allem wer ich in einem Jahr sein will. Und ich finde es gut, dass ich das nicht weiß. Dafür weiß ich nämlich ganz genau, wo und wer ich nicht sein will.
Und das ist viel wert, finde ich. Deshalb mache ich jetzt erst einmal nur das, was mir wirklich Freude bereitet.
Ich trete an die Arbeitsfläche, meine drei verbliebenen Messer kleben am Magnetstreifen. Ich wähle das lange, dünne aus, es löst sich mit einem Schnappen.
Esther
Dicke weiße Flocken wehen durch die Luft, als ich den winzigen Ort erreiche, in dem sie wohnt. Nicht nur die Landschaft, auch der Himmel hat sich verändert. Nach dem wochenlangen Nieselregen in der Stadt kommt mir die Fahrt durch die schneebedeckten glitzernden Hügel und Wälder geradezu unwirklich vor.
Ich fahre wie in Zeitlupe durch das Dorf, in dem der Schnee offenbar nicht geräumt wird, und folge der Straße, die sich kreuz und quer durch den dunklen Nadelwald windet. Alles voller Bäume, kein Haus, kein Mensch. Wie immer verfehle ich fast die Zufahrt zum Haus meiner Schwester.
Vor einer gewaltigen Doppelgarage befindet sich ein gepflasterter Parkplatz, auf dem ein Dutzend Autos und eine Pommesbude Platz hätten. Dieses Haus hat Dimensionen, die mich immer wieder fassungslos machen. Hier könnten vier Familien leben. Oder eine Familie mit zehn Kindern und einigen Großeltern. Stattdessen lebt hier eine einzige geschiedene Frau, die inzwischen vermutlich nur noch die Hälfte ihrer selbst ist.
Ich parke und reiße die Wagentür auf. Sofort wirbeln mir die Schneeflocken entgegen. Während ich zum Haus stapfe, schlage ich meinen Mantelkragen hoch, um mich vor dem eiskalten Wind zu schützen, er ist stark geworden.
Ich klingle und lege den Kopf in den Nacken. Das Haus ist falsch hier, ein Fremdkörper. So ein quadratischer Architektenbau mit viel Glas und Beton, der vor wenigen Jahrzehnten vermutlich total modern war, aber natürlich auch damals schon nicht hierhin gepasst hat.
Meine Schwester öffnet nicht.
Ich stapfe durch den Schnee am Haus entlang und versuche, durch eines der Fenster zu spähen. Es ist ein karges Fenster, keine Sprossen, keine Gardinen, keine Lichterkette. Ich denke daran, wie es bei uns zu Hause gerade aussieht – die krummen Schneemänner, die Ella gebastelt und an Wollfäden aufgehängt hat. Zwischen den Fenstersprossen dieser künstliche Dekoschnee aus der Sprühdose, gegen dessen Verwendung Jonas lautstark protestierte, worauf wir versichern mussten, dass wir nur noch diese eine Dose leeren, weil es der Umwelt nichts nutzt, wenn wir die volle Dose entsorgen. Bei uns herrscht überall liebevolles Chaos. Für einen Augenblick überkommt mich Heimweh. Ich muss das hier schnell durchziehen. Ich muss schnell wieder nach Hause.
Ich kann durchs Fenster nichts erkennen und gehe zurück zur Haustür. Eine Windbö fegt Schnee von den Ästen einer Tanne, er landet in meinem Nacken, ich versuche, ihn mit der Hand wegzuwedeln, ehe er schmilzt. Ich drücke noch einmal auf den Klingelknopf, lange diesmal, und dann wird die Tür von innen aufgerissen, und da steht sie und starrt mich an, als wäre ich ein Geist.
Ein Jahr ist vergangen, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ein Jahr, fast auf den Tag genau. Ihr aschblondes Haar ist im Nacken zusammengebunden und sieht aus, als wäre es seit Tagen nicht gewaschen worden. Die Schatten um die Augen zeugen von zu wenig Schlaf, natürlich ist sie ungeschminkt, und trotz des dicken Strickpullovers, den sie trägt, kann ich erkennen, wie dünn sie ist. Meine Schöne und meine Schlaue, hat Papa immer gesagt. Sie war die Schlaue.
»Hallo, Schnecke«, sage ich und trete auf sie zu. Sie lässt die Schultern unter meiner Umarmung fallen und erwidert den Druck nicht, ihre Arme hängen schlaff herab. »Ich hab dir was mitgebracht.« In meinem Nacken ist es immer noch nass und kalt, darum ziehe ich mir sofort den Mantel aus, noch ehe ich in ihrem Flur stehe. »Soll ich die Schuhe auch ausziehen?«
»Nein, lass an«, sagt sie, vermutlich nur weil sie hofft, dass ich dann schnell wieder gehe. Jetzt erst sehe ich, dass sie ein Messer in der Hand hält. Warum? Der Blick, mit dem sie mich mustert, ist gleichgültig, fast apathisch. Und dazu dieses Messer. Etwas an dem Messer macht mir Angst. Und etwas an ihr.
Ich trete an ihr vorbei ins Innere und versuche, mir mein Erschrecken nicht anmerken zu lassen. Es ist warm und stickig hier drinnen, sie muss alle Heizungen aufgedreht haben. Mit dem Mantel auf dem Arm sehe ich mich suchend um, sie macht keine Anstalten, ihn mir abzunehmen.
Ohne erkennbare Regung sieht sie mir zu, wie ich in ihre Küche trete.
Es ist eine Angeberküche, anthrazitfarbener Naturstein und Beton, um den Esstisch irgendwelche Bauhaus-Klassiker, die als Küchenmöbel wirklich nicht passen, dazu ein gewaltiger Gasherd. Alle Flächen sind gähnend leer.
Sie wirkt noch unbewohnter als eine Musterküche, denn bei der hätte ein gnädiger Dekorateur immerhin ein paar Blumentöpfe, Bücher und Bonbongläser verteilt. Hier dagegen sind keine Bilder und Adventskalender an den Wänden, es gibt keinen Alltagskram und keine Zeitungen, die herumliegen, keine vollgekritzelten Zettel, die Einkäufe und Erledigungen anmahnen, keine Pullover, die zerdrückt auf Stühlen liegen, wo sie eben noch jemand platt gesessen hat. Nichts, das zeigt, dass jemand hier lebt.
Ich muss an unsere Küche denken, die Zeichnungen der Kinder am Kühlschrank, die Fotos von Neugeborenen, die Einladungskarten und Schulbriefe. Ich muss nachher dringend aufräumen, wie immer haben sich Bücher, Zeitschriften und Schulsachen auf den Stühlen gestapelt. Ans Fenster hat Ella Schneemänner aus Tonpapier geklebt, die sie in der Schule gebastelt hat. Bei dem Gedanken daran zieht sich etwas in mir schmerzhaft zusammen, wie gern würde ich sie jetzt umarmen und mein Gesicht in ihren Wuschelhaaren vergraben, um dort den Kleinkindgeruch zu suchen, den sie längst verloren hat und den ich doch nicht aufhören kann zu vermissen. Warum liebe ich meine Kinder immer besonders, wenn ich weg bin? Ich nehme mir vor, ganz viel mit ihr zu kuscheln, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber vorher muss ich die Küche aufräumen. Und den Tannenbaum holen. Falls Martin das nicht schafft.
Meine Schwester steht im Türrahmen und starrt mich an, als wagte sie nicht, ihre eigene Küche zu betreten. In der Hand hält sie immer noch das Messer.
Ich frage: »Hast du gerade gekocht?«
»Nein«, sagt sie.
Ich blicke mich um in der Hoffnung, dass auf dem leeren, sauberen Küchentisch urplötzlich etwas erscheint. Aber ich sehe nichts. Dabei würde es mich so erleichtern, wenn hier Gurken oder Pute oder sonst etwas auf einem Holzbrett liegen würden.
Denn das würde das Messer erklären. Aber da sie mir die Antwort verwehrt, muss ich die ganze Zeit daran denken, dass sie beim Öffnen der Haustür ein Messer in der Hand gehalten hat.
Ich frage mich, wen sie eigentlich erwartet hat.
Und was sie mit ihm gemacht hätte.
Sue
Gerade eben hielt ich es noch für ruhig und friedlich hier. Damit ist es jetzt vorbei. Von dem Augenblick an, in dem meine Schwester das Haus betritt, geht es nur noch darum, sie wieder loszuwerden.
»Hallo«, sagt sie und stürmt geschäftig herein. Wie immer hat sie doppelt Rouge im Gesicht, damit sie frisch und fröhlich aussieht. Die Schuhe lässt sie einfach an. Sie streift ihren Mantel ab, darunter trägt sie blickdichte Strumpfhosen und ein farbenfrohes, locker gegürtetes Wollkleid, das etwas spannt. Meist verbergen sich im Muster ihrer Kleider neckische Details, je nach Saison sind das Pinguine, Fliegenpilze, süße Füchse.
Ich gucke extra nicht hin. Die Kleider meiner Schwester sollen vorgaukeln, dass sie eine Menschenfreundin ist, dabei ist das Gegenteil der Fall. Das weiß niemand besser als ich.
Sie sieht sich stirnrunzelnd im Flur um und legt den Mantel, auf dem der Schnee zu schmelzen beginnt, einfach auf die Eichentruhe im Flur. Ich atme tief durch und folge ihr. In einem schwesterntypischen Akt der feindlichen Übernahme ist sie sofort in meine Küche eingedrungen und sieht sich dort um. Das macht mich nervös.
Ich verschränke die Arme. »Ich wusste gar nicht, dass du vorbeikommen willst. Hättest du doch vorher was gesagt.«
Was dann?, überlege ich im selben Moment. Hätte ich Kuchen gebacken? Aufgeräumt? Nein. Dann hätte ich mich ins Bett gelegt und mir die Finger in die Ohren gesteckt.
Wäre ich vorbereitet gewesen, hätte ich diesen Besuch vielleicht verhindern können. Und das ist auch der Grund, warum sie sich nicht angekündigt, sondern mich überrumpelt hat.
Denn natürlich habe ich sie in reflexhaftem Gehorsam ins Haus gelassen. Weil sie meine Schwester ist. Weil es sehr aggressiv rüberkäme, wenn ich meine einzige Schwester einfach draußen im Schnee stehen lassen würde. Warum eigentlich? Wäre das aggressiver als ihr ungebetener Besuch und ihr Einmarsch in meine Küche?
»Kochst du gerade?«, fragt sie und sieht mich merkwürdig an.
»Nein«, sage ich.
»Pute? Gurke? Hast du Gurke geschnitten?«
Jetzt geht das wieder los. Sie kann sich nicht mit mir unterhalten, ohne mir diese kleinteiligen Fragen zu stellen, Fragen, die so sinnlos sind, dass man die Antwort darauf verweigern möchte. Und wenn man das tut, wird sie aggressiv und stellt noch mehr Fragen. »Nein.«
»Ich dachte, du hättest vielleicht gerade gekocht.«
»Nein, hab ich nicht.«
»Kochst du denn?«
»Wie meinst du das?«
Sie wendet den Kopf wie eine Taube, es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn um 180 Grad nach hinten dreht, um meine Küche besser durchsuchen zu können. »Überhaupt, meine ich. Kochst du sonst?«
Ach, das Thema wieder! Seit sie selbst zugenommen hat, also seit der Geburt von Ella, beharrt sie darauf, dass ich zu mager bin. Wenn ich jetzt sage, dass ich nicht koche, fängt sie wieder an, über mein Gewicht zu sprechen. Wenn ich sage, dass ich koche, stellt sie mir Fangfragen, weil sie mir nicht glaubt, und dann muss ich in einem irrwitzigen Quiz über Küchensachen und Zutaten gegen sie bestehen. Ich frage schnell: »Wie geht es den Kindern?«
»Gut«, sagt sie und sieht beinahe verblüfft aus, als wäre ihr ein sicher im Käscher geglaubter Fisch entwischt. »Sie freuen sich auf Weihnachten, natürlich. Aber es ist ziemlich viel Trubel mit ihnen, und dann die ganzen Vorbereitungen. Du glaubst nicht, was bei uns los ist!«
Und dann fängt sie an. Sie lässt dieses ganze belanglose Zeug heraus, von dem Menschen mit Kindern und Jobs immer zum Platzen voll sind. Krankheiten, Stress im Büro, Stress mit Einkaufen, Stress mit dem Wagen. Etwas Furchtbares mit einer Quartalsabrechnung, das Geschenk für Jonas ist nicht richtig angekommen, weil der DHL-Bote nicht geklingelt hat und es deshalb zur Hauptpost ging, aber da war es nicht, sondern woanders, im Badezimmer ist Schimmel, der Vermieter will einen Handwerker vorbeischicken, aber, und bei der Musikschulaufführung musste Ella brechen, weil …
Es ist unfassbar, was für langweiliges Zeug Familienmenschen von sich geben und wie begierig sie sind, es loszuwerden. Sie sind total wild darauf, einen unter ihrem fröhlich-bunten Alltagsschlamm zu begraben. Ich sinke auf den Küchenstuhl und lasse das alles über mich ergehen.
Hauptsache, ich sage nichts. Ich muss ganz ruhig bleiben, die Worte meiner Schwester einfach an mir vorbeiziehen lassen. Dann und wann eine nichtssagende Anwesenheitsbestätigung, damit sie mir nicht ins Gesicht patscht, um zu überprüfen, ob ich noch bei Bewusstsein bin. Genau so etwas würde sie nämlich tun. Ich muss einerseits so freundlich wirken, dass sie kein Problemgespräch eröffnet, andererseits vorsichtig sein, damit sie keine Informationen erhält, aus denen sie irgendetwas aufbauschen kann.
Als meine Schwester das nächste Mal Luft holt, sage ich »Wirklich?« und schüttle kurz belustigt den Kopf, um zu bestätigen, wie absolut irre das ist, was sie mir über ihre neurotische Katze erzählt.
Das war gut. »Ernsthaft!«, ruft sie. Jetzt erst sehe ich, dass an ihren Ohren kleine Christbaumkugeln baumeln. »Ich wollte es auch nicht glauben. Natürlich ist es für eine reine Wohnungskatze …«
»Wirklich?«, frage ich gleich noch einmal.
Ich muss das einfach noch ein bisschen aushalten. Das ist ja keine unerfüllbare Aufgabe. Zehn Minuten mit meiner Schwester in der Küche sitzen, dreimal lächeln, dreimal nicken, dreimal »Wirklich?« sagen. Und dann ist es überstanden, optimistisch gedacht habe ich dann ein Jahr Ruhe vor ihr.
Solange sie nichts fragt, kann ich nichts falsch machen. Also lasse ich sie reden. Ich schließe ganz kurz die Augen.
Das geht natürlich nicht, sie unterbricht ihren Redeschwall. Wenn ich meiner Schwester nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit zuhöre, wird das sanktioniert. Sofort.
»Du sieht gar nicht gut aus, fühlst du dich wohl?«, fragt sie und betrachtet mein Gesicht so forschend wie davor die Küche.
»Doch«, antworte ich und versuche, möglichst interessiert und normal zu gucken. Ich hätte mich gar nicht erst setzen sollen, das war der Fehler, ich begreife es zu spät. Damit habe ich signalisiert, dass wir jetzt gemeinsam in dieser Küche bleiben. Ich hätte stehen bleiben müssen, damit sie versteht, dass sie verschwinden soll. Ich will aufstehen, aber das kommt mir jetzt auch komisch vor. Wovon hat sie gerade gesprochen? Etwas über die Handwerker? Die durchgedrehte Katze?
Wenn mir jetzt eine treffende Frage einfällt, etwas, das sie gedanklich geradewegs zurückschickt zu ihrer Musikschulaufführung oder in die Postfiliale, dann lässt sie mich vielleicht in Ruhe.
Aber mir fällt nichts ein.
Mir fällt nie etwas ein.
Esther
Ich brauche einen Kaffee. Mein letzter ist zwei Stunden her, das merke ich inzwischen. Ich brauche bis zum Mittag jede Stunde einen, aber in dieser Küche ist weit und breit keine Kaffeemaschine zu sehen oder zu riechen. Dabei sieht meine Schwester aus, als könnte ihr ein Kaffee auch nicht schaden.
Sie kauert auf dem Stuhl und wirkt fast wie unter Drogen. Vielleicht sind das ihre Beruhigungsmittel. Es ist ein verstörender Anblick. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn sie ihre Tabletten nimmt.
Jedenfalls ist sie nicht normal. Alles, was sie mühsam hervorbringt, ist »Wirklich?«. Mehr nicht.
Vielleicht tut ihr auch weh, was ich erzähle. Wenn sie von unserem Leben hört, muss sie sich noch einsamer fühlen als eh schon. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sie hier Weihnachten verbringt. Ihre einzige Gesellschaft die Erinnerungen daran, wie es mal war, als sie Robert noch hatte. Die Ahnung, wie es hätte sein können, wenn sie mit ihm eine Familie gegründet hätte. Die Selbstvorwürfe, dass sie alles hatte und es dann zerstört hat, für nichts und wieder nichts. Und ich kann nichts für sie tun, im Gegenteil, ich muss Abstand wahren und daran denken, was meine Aufgabe ist: rechtzeitig zurück sein, um den Baum zu holen. Und dann mit meiner eigenen Familie feiern. Wenn ich sicher sein kann, dass hier alles in Ordnung ist. Und das ist es.
Oder?
Kann ich davon ausgehen, dass es ihr gut geht, wenn sie nichts anderes von sich gibt als »Wirklich«?
Ich hatte vor, ihr das Geschenk zu geben, einige Worte zu wechseln und dann schnell wieder zu fahren. Aber wenn ich sie so vor mir sehe, werde ich unruhig.
Etwas stimmt nicht mit ihr.
Sie ist komisch. Noch mehr als sonst.
Als ich spreche, ist meine Stimme etwas heiser. »Soll ich uns Tee machen?«
Sie zuckt erst unschlüssig die Achseln und nickt dann. Für einen Moment kann ich wieder das kleine Mädchen in ihr sehen. Sie sieht so zerbrechlich und verloren aus, wie sie da unschlüssig den Rücken durchdrückt und wieder rund macht, als wüsste sie nicht, ob sie aufstehen soll oder nicht. Dies ist ihre eigene Küche! Ich würde sie am liebsten anschreien: Du wohnst hier! Sag mir, dass ich mich setzen soll, und dann koch Kaffee, wie sich das gehört, damit wir die Sache hier schnell hinter uns bringen können! Damit ich nicht befürchten muss, dass du gleich umkippst oder in Tränen ausbrichst! So ein winziges bisschen Stabilität wirst du doch wohl hinkriegen, zehn Minuten nur, dann verabschiede ich mich und kann beruhigt wieder fahren!
Aber sie sitzt weiter nur da und guckt in die Luft.
Genau mit diesem Gesichtsausdruck stand sie damals auf dem Schulhof. Unsere Grundschule war ein grauer Kasten, der in irgendeiner Projektwoche mit bunten Kindern bemalt worden war, die einander an den Händen hielten. In der Nische neben den Toiletten drückte sich immer meine Schwester herum und bemühte sich, das Kichern und Tuscheln der anderen zu ignorieren. Ihre schmalen Füße kippelten in diesen Plastiksandalen, die wir damals so cool fanden. Sie wagte kaum, ihre neuen Mitschüler anzusehen, die in einer bunten Gruppe herumalberten und Lachsalven in die Luft feuerten.
Ich ging zu ihr. »Alles okay, Schnecke?«, habe ich gefragt.
»Na klar«, antwortete sie, aber ihr Blick sagte das Gegenteil.
Wenn ich an das kleine Mädchen von früher denke, überschwemmt mich sofort wieder dieses Mitleid. Sie hat den ganzen Mist mit unseren Eltern schon damals nicht so gut weggesteckt wie ich, obwohl ich mich so sehr bemüht habe, sie zu beschützen. Kein Wunder, dass sie auch jetzt nicht gut funktioniert, wo ihr Leben schon wieder vom normalen Weg abgeknickt ist.
Und auch kein Wunder, dass sie die Rolle der Gastgeberin nicht beherrscht. Ob sie es überhaupt schafft, sich selbst Tee zu kochen? Es sieht nicht so aus. Ich seufze. »Welchen möchtest du denn trinken?«
Sie antwortet nicht, und ich trete an den Küchenschrank. Er ist nur halb voll und penibel sortiert, ich verdränge den Gedanken an meinen eigenen: Wenn ich da die Schranktür öffne, fällt mir manchmal sogar etwas entgegen, eine Schachtel, die ich auf die angebrochenen Zuckertüten gestapelt habe, oder der Süßstoffspender, den ich morgens im Halbkoma zurück in den Schrank stopfe, damit Ella ihn später nicht zerlegt, wie sie es schon mehrfach getan hat. Der Warnhinweis, dass der übermäßige Verzehr von Süßstoff abführend wirkt, sollte übrigens ernst genommen werden. Schon zweimal hatte Ella schlimmen Durchfall, nachdem sie sich heimlich mit dem Süßstoffspender unter den Küchentisch verzogen und dort Tablette um Tablette hinuntergeschlungen hatte. Es ist mir schleierhaft, wie sie das geschafft hat, ohne würgen zu müssen, es gibt nichts Ekligeres als Süßstofftabletten pur – Martin und ich haben sie damals sogar probiert, kopfschüttelnd, weil wir nicht glauben konnten, dass unsere Tochter diese Dinger wirklich gegessen hatte.
Im Schrank meiner Schwester gibt es natürlich keinen Süßstoff. In Reih und Glied stehen da saubere Schraubgläser mit Zucker, Salz, Reis und Mehlsorten in verschiedenen Schattierungen. Der Kontrast zu unseren vielen bunten Schachteln und Tüten mit Fertiggerichten, Süßigkeiten, Müsliriegeln und asiatischen Gewürzmischungen könnte nicht größer sein. Man könnte meinen, hier lebt ein gesundheitsbewusster Mensch, der sich Zeit nimmt, für sich selbst ausgewogen zu kochen. Leider sieht meine Schwester danach nicht aus. Ich öffne die andere Schranktür und finde immerhin eine stattliche Anzahl Pappschachteln mit Tee. »Melisse? Lavendel? Roibusch?«, frage ich so munter wie möglich. Dann fülle ich Wasser in den Kocher und stelle ihn an.
Meine Schwester reibt sich die Augen. »Roibusch.«
»Mit Milch?« Ich öffne den Kühlschrank. Er ist fast leer, in der Tür steht eine einsame Tüte Hafermilch.
»Nein«, sagt sie scharf.
Ich setze mich zu ihr an den viel zu großen Küchentisch. Er ist sauber und leer, ebenso wie die vier Freischwinger, die um ihn platziert sind. Ich denke an unseren Küchentisch, an dem wir essen, trinken, Zeitung lesen, spielen. Ich merke, wie die Leere hier mich deprimiert.
Ich sage: »Ich musste gerade daran denken, wie das an der Schule war. Erinnerst du dich noch an diese gelben Plastiksandalen?«
»Hm?«
»Wir hatten sie im Urlaub in Rimini bekommen und fanden sie total cool. Du wolltest sie danach gar nicht mehr ausziehen.«
»Keine Ahnung.«
»Doch, wirklich. Im Herbst hast du sogar Strümpfe dazu angezogen, damit du sie weiter tragen kannst.«
Der Wasserkocher gibt ein dunkles Brausen von sich, das langsam lauter wird. Sie nickt zögernd. Ich sehe das kleine Mädchen vor mir, wie sie kippelt mit den gelben Sandalen. Sie hat rosa Nagellack auf den Zehen, den ich ihr aufgetragen habe. Den Nagellack habe ich unserer Mutter stibitzt und dann nicht gewagt, ihn selbst zu benutzen, weil ich nicht auffliegen wollte. Aber meine Schwester war ganz aufgeregt, als ich mit dem schmalen Pinsel vorsichtig ihre Zehennägel angemalt habe, mit angehaltenem Atem hat sie gewartet, bis er ganz trocken war.
Und jetzt sitzt sie mir gegenüber und hält schon wieder den Atem an, aber diesmal ohne Nagellack und ohne freudige Erregung. Da ist nur Angst, merke ich. Meine Schwester hat Angst.
Wovor?