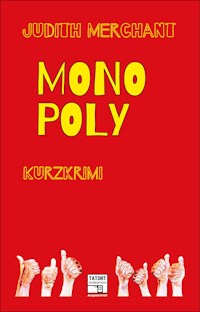4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rheinkrimi-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Rheinkrimi-Trilogie von Glauser-Preisträgerin Judith Merchant jetzt wieder lieferbar! Ein Märchen-Mord! Das ist Kriminalhauptkommissar Jan Seidels erster Gedanke, als er zum Tatort nach Rheinbach gerufen wird. Am Fuße des verwunschenen Hexenturms liegt eine Frauenleiche mit langen blonden Zöpfen. Bald stellt sich heraus, dass das Opfer an einer rätselhaften Krankheit litt: dem Rapunzel-Syndrom. Die Ermittlungen führen zu einem Zirkel von Schriftstellern, die einiges zu verbergen haben. Und zu einem Roman, der besser nie geschrieben worden wäre. »Judith Merchant portraitiert die Branche der Buchmacher und Buchleser mit liebevollem Sarkasmus. Wenn es da nicht einen Mörder unter ihnen gäbe ...« WDR 5, Die telefonische Mordberatung Die Rheinkrimi-Serie von Judith Merchant ist in folgender Reihenfolge erschienen: Nibelungenmord Loreley singt nicht mehr Rapunzelgrab
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Judith Merchant
Rapunzelgrab
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Märchen-Mord! Das ist Kriminalhauptkommissar Jan Seidels erster Gedanke, als er zum Tatort nach Rheinbach gerufen wird. Am Fuße des verwunschenen Hexenturms liegt eine Frauenleiche mit langen blonden Zöpfen. Bald stellt sich heraus, dass das Opfer an einer rätselhaften Krankheit litt: dem Rapunzel-Syndrom. Die Ermittlungen führen zu einem Zirkel von Schriftstellern, die einiges zu verbergen haben. Und zu einem Roman, der besser nie geschrieben worden wäre.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Um ihn herum war [...]
* * *
* * *
Tag 1
Jan legte den Kopf [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Tag 2
Dass er mindestens ein [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Tag 3
Elena hatte keine Ahnung, [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Tag 4
Lesen, dachte Elena, Lesen [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Tag 5
Während er darauf wartete, [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Tag 6
Jan wachte auf, weil [...]
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
Epilog
Es war einmal ein [...]
Dank
Für alle Romanschreiber – und solche, die es werden wollen.
Prolog
Um ihn herum war es totenstill im Wald, die Vögel schwiegen, kein Ast knackte oder ächzte, und selbst die Blätter wagten nicht zu rascheln. Es war, als wäre er ganz allein, doch er wusste, dass dieser Eindruck trog. Vorsichtig verlagerte er seine Position, darauf bedacht, nicht vom Baum zu fallen. Er war in Gefahr. Sein Atem ging vor Angst schnell, obwohl er versuchte, ihn zu zügeln. Er musste sich konzentrieren. Er musste die Ohren spitzen, damit er hörte, wenn sie kam. Schon der Gedanke daran ließ erneut Angst in ihm aufsteigen. Sein Körper mahnte ihn zur Flucht, aber er würde ihm nicht gehorchen. Er würde nicht fliehen. Es ging hier nicht nur um ihn. Es ging auch um das Mädchen.
Das Mädchen hoch oben im Turm.
Der Königssohn duckte sich erneut, um unter den Blättern hindurchzuspähen, aber sein Platz im Baum war schlecht, um den Überblick zu behalten, nicht deswegen hatte er ihn gewählt, sondern nur, weil er ihn zuverlässig vor fremden Blicken verbarg. Ob er ihn auch vor den Blicken der Alten schützen konnte, würde sich zeigen, wenn sie endlich kam. Dass sie kommen würde, das wusste der Königssohn. Doch wann?
Seit zwei Wochen war sie nicht erschienen. So lange schon harrte er hier aus. Er hatte sein normales Leben ganz und gar aufgeben müssen, gegen seinen Willen fast, unweigerlich führten ihn seine Schritte immer wieder in die Mitte dieses Waldes an den Turm, in dem, wie er wusste, das Mädchen hauste, und unweigerlich hefteten sich seine Blicke jedes Mal auf das winzige Fenster, in dem er sie ab und an sah, schemenhaft nur. Der Königssohn war in dieser Zeit des Wartens und Lauerns hager geworden, Bartstoppeln überwucherten längst sein einst jugendlich glattes Gesicht. Er aß Nüsse und Beeren, die er fand, und trank den Morgentau von den Blättern. Längst schon gehorchten seine Schritte seinem Verstand nicht mehr, alles in ihm war einzig darauf konzentriert, an das Mädchen zu gelangen.
Doch dafür musste er erst das Geheimnis des Turms lösen.
Und deswegen wartete er hier auf die Alte, tagein, tagaus.
Manchmal drang ein lieblicher Gesang aus dem hohen Turm, und dann hatte der Königssohn immerhin die Gewissheit, dass das Mädchen noch da und am Leben war. Er wusste nicht, was er mehr fürchtete: dass sie, die offensichtlich gefangen war, dort oben verhungerte? Dass sie, des Wartens auf Rettung überdrüssig, ihr Schicksal in die Hand nahm und sich aus dem Fenster stürzte? Oder dass jemand anders erschien, ein Ritter, der tapferer war als er, oder ein schönerer Königssohn und ihm zuvorkam? Ein Klügerer, einer, der wusste, was zu tun war?
Er wäre gern schnell und mutig gewesen, hätte ein Pferd gezäumt, ein Schwert gezückt und wäre für das Mädchen in die Bresche gesprungen, ganz so, wie es sich für einen tapferen Retter gehörte. Doch leider war da nichts, wogegen er kämpfen konnte, nur ein Turm, dreißig Fuß hoch, ein Turm aus rauhem grauem Stein, sauber verfugt, ohne Treppe, ohne Tor. Vermutlich gab es eine Geheimtür, die hinauf in den Turm führte, doch sosehr der Prinz jeden Zentimeter des glatten grauen Baus abgesucht hatte, er konnte keine Öffnung, keine Spalte, keinen verborgenen Knauf entdecken.
Es gab nur eine Erklärung, und die ließ den Prinzen erzittern.
Magie.
Es musste Magie sein.
Und das machte ihm Angst. Dagegen war er machtlos.
Magie musste es auch sein, die das Mädchen mit Lebenswichtigem versorgte und am Leben hielt. Der Königssohn kannte sich mit Mädchen nicht aus, aber auch ein Mädchen musste doch essen und trinken. Oder?
Der Königssohn seufzte erstickt auf, als ein Geräusch ihn zusammenfahren ließ. Direkt unter ihm knackte es, und er erstarrte.
Sie war es.
Die Hexe.
Sie befand sich direkt unter dem Ast, auf dem er saß.
Der Königssohn kniff die Augen zusammen und hielt den Atem an. Vielleicht hätte er hinunterspringen und um sein Leben und das des Mädchens kämpfen müssen, doch er war wie gelähmt, einzig seine Ohren waren gespitzt.
Vorsichtig öffnete er die Augen, darauf gefasst, dass die Hexe direkt vor ihm auf dem Ast sitzen und ihm höhnisch entgegengrinsen würde, da hörte er erneut das Knacken von Ästen, und vor Erleichterung entfuhr ihm der Atem wie ein Wimmern. Die Schritte entfernten sich.
Tief schnappte der Königssohn nach Luft, unfähig zu begreifen, was das zu bedeuten hatte.
Konnte es sein, dass die Alte ihn nicht gesehen hatte? Was sagte das über ihre magischen Kräfte aus?
Oder war es ein besonders perfides Spiel von ihr, ihn in falscher Sicherheit zu wiegen?
Vorsichtig spähte der Königssohn zwischen den Blättern hindurch, als er ihre Stimme hörte.
»Rapunzel!«, rief sie.
Er sah, wie sie vor dem hohen grauen Turm stand und zum Fenster hinaufrief. Rapunzel? War das der Name des Mädchens? »Rapunzel«, flüsterte der Königssohn verzückt.
Da hörte er die Alte wieder. »Rapunzel, lass dein Haar herunter!«
Durch das dichte Blätterdach sah der Königssohn, wie das Mädchen im Fenster erschien und etwas hinunterwarf. Eine Leiter?
Er beugte sich vor, um etwas zu erkennen, aber zu weit, der Ast unter ihm neigte sich bedenklich, dann brach er. Noch im Fall sah er, wie die Hexe sich umdrehte. Der Blick ihrer grünen Augen traf den Königssohn mitten ins Herz wie ein giftiger Dolch. Es ist aus, dachte er noch, dann erst prallte er unsanft auf dem weichen Waldboden auf. In Todesangst rappelte er sich auf, konnte kaum glauben, dass die Schmerzen das zuließen, dass seine Beine ihm gehorchten. Und dann lief der Königssohn, lief um sein Leben. Keinen einzigen Blick wagte er zurückzuwerfen, jederzeit erwartete er den eisigen Griff der Hexe im Nacken, er rannte und rannte, wie er noch nie zuvor gerannt war. Erst als er den Wald hinter sich gelassen hatte, wurde ihm klar, dass die Hexe ihm nicht gefolgt und dass er am Leben war.
Vorläufig.
Erschöpft legte er sich am Waldesrand in die Büsche und schlief. Und schon am nächsten Tag bei Sonnenaufgang ging er wieder in den Wald. Er hatte keine Wahl gehabt. Bei jedem Schritt hatte er sich gefragt, ob ihn die Hexe bereits erwartete. Und was sie mit ihm machen würde.
Doch als er jetzt am Fuße des grauen Turms stand, war weit und breit niemand zu sehen. Auch das Mädchen sang nicht. War sie vielleicht tot? Hatte er sie mit seinem Sturz in Gefahr gebracht?
»Rapunzel!«, rief er ängstlich und fixierte in banger Erwartung das Fenster. Doch nichts geschah.
Er dachte an das, was die Alte gerufen hatte, und obwohl er fürchtete, dass dies ein böser Zauberspruch sein mochte, der sein Schicksal endgültig besiegeln würde, nahm er all seinen Mut zusammen und rief, so laut er konnte: »Rapunzel, lass dein Haar herunter!«
Sein Atem stockte, als etwas geschah, was er kaum zu hoffen gewagt hatte. Im Fenster erschien der Schatten des Mädchens. Sie sah zu ihm hinunter, und dann warf sie etwas aus dem Fenster, die helle, schimmernde Leiter. Erst als sie wenige Zentimeter vor seinen Augen baumelte, erkannte er, dass es gar keine Leiter war. Es war ein Zopf. Ein seidiger, goldblonder Zopf. Das Haar von Rapunzel. Ungläubig griff der Königssohn zu, berührte es mit zitternden Fingern, es war glatt und kühl wie eine goldene Schlange. Ein Beben durchfuhr den Prinzen. Jetzt kannte er kein Halten mehr. Er griff nach dem Zopf und kletterte hinauf, Zoll um Zoll griffen seine Hände das seltsame Seil ab, während seine Füße Halt in dem rauhen Mauerwerk suchten. Vergessen war die Hexe und ihr böser Blick, vergessen alle Gefahr. Das goldene Haar rann durch seine Hände, als liebkose es ihn, ein seidiges Versprechen dessen, was ihn oben erwartete. Endlich erreichte er die Fensteröffnung, zog sich mit letzter Kraft hindurch und stand dann schwer atmend in der winzigen steinernen Kammer. Ungläubig sah er sich um, und da war sie.
Ihm gegenüber auf einer schmalen Pritsche saß das Mädchen und schaute ihn an. In ihrem Blick war kein Erkennen. Nächtelang hatte der Königssohn sich ausgemalt, wie er endlich in die Turmkammer dringen, wie das Mädchen dann ihm, seinem Retter, um den Hals fallen, ihm unter Tränen danken würde, doch nichts davon tat sie, stattdessen wandte sie sich ab. Vornübergebeugt hockte sie, die Hände in Bewegung, und auch ihre Schultern zuckten. Was tat sie da?
Der Königssohn trat näher und sah, wie ihre Kiefer sich bewegten, als ob sie äße.
Dann erst erkannte er, was sie tat.
Und er stürzte zum Fenster und machte, dass er wieder hinunterkam.
* * *
Schreck saß im Großraumwagen auf einem Innenplatz, was natürlich ärgerlich war. Er hatte seinen reservierten Platz fluchtartig verlassen müssen, als er begriffen hatte, dass die Frau ihm gegenüber ihn interessiert musterte. Sie hatte ihn erkannt, und er wollte nicht erkannt werden. Nicht jetzt. Vor Lesungen war er empfindlich.
Lesungen gehörten zum Schriftstellerjob einfach dazu. Es war sinnlos, sich dagegen aufzulehnen. Ebenso sinnlos, wie sich über die vielen Verspätungen der Deutschen Bundesbahn aufzuregen. Verspätungen gehörten zur Bahn, und Bahnfahren gehörte zu Lesungen. Zumindest wenn man wie Schreck auf sie angewiesen war, weil man wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein mehr besaß.
»Einen Kaffee für Sie?«
»Gern.« Er nahm dem Bahnmitarbeiter, der in seiner schlechtsitzenden dunkelblauen Uniform erbärmlich schwitzte, den Kaffee ab. Kaffee gehörte zum Service der ersten Klasse, und Schreck wollte nicht auf dieses Privileg verzichten, nur weil es eigentlich zu heiß für Kaffee war. Außerdem brauchte er den Kaffee wegen des Bechers. Hätte er direkt aus der Flasche getrunken, hätte er ausgesehen wie ein Penner. Oder wie bei einem Junggesellenabschied, was eigentlich noch schlimmer war. Den Inhalt der Fläschchen in Kaffeebecher zu füllen war stilvoller, auch wenn es im Großraumwagen nicht ganz so diskret zu bewerkstelligen war wie sonst.
Erneut griff Schreck in das vorderste Fach seines Koffers, in dem die Fläschchen aus der Minibar klimperten. Aus jeder Minibar in jedem Hotel nahm er grundsätzlich alles mit, was mehr Prozent als Sekt hatte. Bezahlt hatte er noch nie dafür, denn die Hotelrechnungen übernahmen die Veranstalter, die ihn buchten, damit er aus seinem Buch vorlas.
Schreck hatte kein Alkoholproblem. Aber er hatte ein Problem damit, all die schönen Fläschchen, die er sich früher hatte verkneifen müssen, ungetrunken zurückzulassen.
Er klappte sein MacBook auf und rief die Seite von Amazon auf, um sich durch seine Rezensionen zu klicken. Fast alles waren euphorische Fünf-Sterne-Rezensionen. Und die wenigen anderen waren von Neidern. Zumindest hatte Walli das gesagt, als er ihn angerufen und sich deswegen beschwert hatte. Walli war sein Agent.
Eine Stimme verkündete durch den Lautsprecher, dass man in wenigen Minuten Bonn Hauptbahnhof erreichen werde.
Schreck trank den Becher leer, knüllte ihn zusammen und sah sich nach einem Papierkorb um. Da er keinen fand, ließ er das Pappknäuel auf dem Tisch liegen, griff seinen Koffer und zog ihn in Richtung Tür. Der Zug hielt. Er stieg aus. Der Bonner Hauptbahnhof erschien ihm klein und bedeutungslos dafür, dass dies einmal die Bundeshauptstadt gewesen war.
Auf dem Bahnsteig war es voll. Es war also kein Wunder, dass die Dame, die ihn abholen sollte, auf sich warten ließ. Schreck spazierte ein wenig auf und ab, umrundete den Süßigkeitenautomaten und betrachtete die Tauben, die gierig zwischen den Gleisen herumflatterten und erfolglos nach allem stießen, was essbar aussah. Die schwüle heiße Luft ärgerte ihn, seine Haare würden sich kringeln, und leider konnte er vor der Lesung nicht noch ins Hotel fahren und duschen, dafür hatte er seine Zeit zu knapp bemessen. Außerdem war das Hotel nicht am Lesungsort, sondern in Königswinter, wenn er das richtig im Kopf hatte, denn dort fand seine morgige Signierstunde statt.
Der Bahnsteig war jetzt leer bis auf eine Traube Teenager, die aus unerfindlichen Gründen kichernd den Schaukasten mit dem Wagenstandsanzeiger umrundeten.
Schreck drehte sich um, halb erwartete er, dass eine dickliche ältere Dame die Rolltreppe heraufhasten und sich ihm unter gemurmelten Entschuldigungen nähern würde. Oder eine magere mit grauem Pagenkopf, die als Erkennungszeichen sein Buch in die Höhe reckte. Aber nichts geschah, er blieb allein, ein gutaussehender erfolgreicher Autor, der eben noch vor einem mutmaßlichen Fan ins Großraumabteil hatte flüchten müssen, jetzt aber verloren auf dem Bahnsteig stand wie bestellt und nicht abgeholt. Was sollte er tun? Und wo war dieses Kaff, in dem er lesen sollte, überhaupt?
Schreck stellte den Koffer ab und holte sein Smartphone heraus. Die Nummer seines Berliner Agenten war inzwischen die, die er am häufigsten wählte.
»Ich stehe hier in Bonn am Hauptbahnhof, und niemand holt mich ab«, sagte er und bemühte sich nicht, seine Entrüstung zu dämpfen.
»Sicher steckt sie im Stau.«
»Aber der Zug hatte Verspätung. Ich hätte schon vor einer Viertelstunde ankommen müssen. Und die Verspätung ist angeschlagen, also … Wahrscheinlich hat die Buchhändlerin mich vergessen.« Er sagte es beinahe scherzhaft, denn es war in der Tat ein Witz – als ob eine Buchhändlerin ihn, Schreck, vergessen könnte!
»Das ist keine Buchhändlerin, sondern die Vorsitzende eines Literaturclubs. Ruth Grosche. Warte, ich rufe Ruth Grosche kurz an, ich habe ihre Handynummer. Ich melde mich bei dir, wenn ich Frau Grosche erreicht habe.«
Walli legte auf, und Schreck wartete, das Telefon in der Hand. Er wusste, dass sein Agent den Namen der Frau extra wiederholt hatte in der Hoffnung, dass er ihn sich merkte. Schreck war völlig außerstande, sich Namen zu merken, auch wenn das unhöflich war.
»Du kannst es dir leisten, unhöflich zu sein, also stress dich nicht«, hatte Walli ihm auf der Buchmesse gesagt, als er hartnäckig alle Verlagsmenschen falsch angesprochen hatte. Aber Schreck war sehr wohl aufgefallen, dass Walli seitdem jeden Namen mehrfach nannte.
Es klingelte. »Ja?«
»Ruth Grosche geht leider nicht an ihr Handy. Ihre Vertretung auch nicht. Vermutlich haben sie mit der Vorbereitung der Lesung zu tun, oder die Presse hält sie auf Trab. Sie kommt bestimmt gleich, aber es ist trotzdem besser, du nimmst dir ein Taxi und fährst selbst zum Veranstaltungsort. Ich habe Ruth Grosche auf die Mailbox gesprochen, dass wir es so machen.«
»Ich sehe hier aber kein Taxi«, sagte Schreck und blickte den Bahnsteig hinunter.
»Geh zum Haupteingang des Bahnhofs, da ist ein Taxistand. Und dann lässt du dich nach Rheinbach fahren, zum Hexenturm. Da findet die Lesung statt. Frau Grosche ist sicher schon dort. Und später hast du dann dieses Interview mit der Journalistin, die das Porträt über dich schreiben will.«
»Rheinbach. Hexenturm«, wiederholte Schreck folgsam. Den Namen der Veranstalterin zu wiederholen, sträubte er sich, auch wenn er wusste, dass das Walli beruhigt hätte. Er verstaute das Handy, nahm seinen Koffer und ließ sich von der Rolltreppe abwärtsbringen.
Lesungen, dachte er, während der Bahnsteig vor seinen Augen erst immer höher stieg und dann verschwand. Lesungen sind wirklich die Pest.
* * *
Der Taxifahrer sprach fast kein Deutsch, und das war Schreck recht so. Er presste sein Gesicht an die Scheibe, während er im Geiste durchging, was er seinem Publikum sagen wollte.
»Hexenturm«, nuschelte der Fahrer mürrisch.
Schreck blickte ungläubig aus dem Fenster. Er sah Reste einer Stadtmauer, schmucke Fachwerkhäuser und einen hohen Turm. Mittelalterlich, vielleicht, Schreck kannte sich da nicht so aus. Allerdings kannte er sich mit Lesungen aus, und ein großer, erfolgversprechender Veranstaltungsort sah anders aus. »Sind Sie sicher?«
Der Fahrer schaute ihn stur an und hielt die Hand auf. Schreck zahlte und stieg aus. Mit dem Koffer in der Hand ging er langsam auf den Turm zu und ließ dabei misstrauisch den Blick umherwandern. Nein, hier sah es wahrlich nicht so aus, als sollte in wenigen Stunden der Bestsellerautor Schreck lesen. Kein Schild wies auf die Veranstaltung hin.
Wobei – das war möglicherweise auch ein gutes Zeichen, vermutlich war die Veranstaltung ausverkauft. Oder ohnehin nur für geladene Gäste, Lokalprominenz und Presse. Eine exklusive, kleine Lesung, anders als die Massenveranstaltungen in den Filialbuchhandlungen. So war es, ganz bestimmt. Es musste einfach so sein.
Schreck fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn. Es war heiß, ein richtiger Sommertag, aber es lag nicht allein daran, dass er schwitzte. Er merkte, dass etwas nicht stimmte. Inzwischen hatte er ein ausgeprägtes Gespür dafür entwickelt, was für eine Art Lesung ihn erwartete. Und hier war etwas seltsam. Aber was? Er sah sich schon mit zwei Handvoll Gästen und einem aufgeregten Volontär vom Lokalradio in einem kleinen Raum ohne Mikrofon. Das war unmöglich. Er würde sofort Walli anrufen. Oder Kopfschmerzen vortäuschen und in sein Hotel flüchten, wo eine warme Dusche und eine wohlgefüllte Minibar auf ihn warteten.
Die Tür des Turms knarrte leise, als er sie öffnete. Rechts an der roh verputzten Wand spürte er einen Schalter. Etwas stimmte nicht. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Er spürte Angst in sich, kalt und hart. Angst vor dem, was ihn dort oben erwartete.
»Herr Schreck! Da sind Sie ja!« Als eine Frau mit ausgestreckter Hand durch den runden Raum auf ihn zukam, überlegte Schreck kurz, ob er sich ihren Namen gemerkt hatte. Frau Kosche? Kusche? Er wusste es nicht mehr.
Die Veranstalterin sah genau so aus wie die meisten ihrer Art. Eine Kulturtussi, die ihn routiniert begrüßte, nach seinen Wünschen fragte – kaltes Wasser oder lauwarm? Mit Sprudel oder ohne? – und der man eine gewisse Aufregung anmerkte. Sie geleitete ihn durch einen engen Gang im rauhen Gemäuer bis hoch unters Dach, bis in den obersten Raum des Turms, er war ebenso rund wie die anderen. »Ich hole Sie dann ab, wenn es Zeit ist«, sagte sie. »Die Lesung findet in dem Raum unter uns statt. Brauchen Sie noch etwas?«
Schreck ließ den Blick über den Tisch wandern, auf den er sein Buch neben einen Stapel Werbezettel, ein sauberes Wasserglas und eine Auswahl an alkoholfreien Getränken gelegt hatte. »Nein.«
»Dann bis gleich.« Sie machte eine Pause. »Wir freuen uns schon!«
Er lächelte höflich und wartete, bis sie draußen war, ehe er seine Tasche öffnete und die Miniaturflaschen aus der Minibar herausholte, um die erste davon in das Wasserglas zu leeren.
Nach etwa einer halben Stunde hatte sich seine Aufregung etwas gelegt, was nicht zuletzt an den jetzt leeren Flaschen lag. Er hörte, wie die Veranstalterin – Bosche? Busche? – die Treppe hochkam.
»Wir wären dann so weit, Herr Schreck.«
»Okay.« Er nahm sein Buch und folgte ihr. Etwas war komisch an ihr. Es war nicht nur der Lesungsort, sondern auch diese Frau. Etwas in ihm prickelte wie eine leise Warnung. Aber wovor?
»Dann also …«, sagte sie und drehte sich zu ihm um, ehe sie die Tür öffnete. Der runde Raum dahinter war vollgestopft mit Zuhörern, die auf groben hölzernen Stühlen saßen und die Köpfe nach ihm reckten wie gierige Möwen. »Bitte, nehmen Sie Platz«, sagte die Veranstalterin leise, und als sie ihm ins Gesicht sah, wusste Schreck, was ihn irritierte. Ihr Blick war anders als die Blicke der Veranstalterinnen, die er bisher kennengelernt hatte. Es fehlte etwas darin.
»Ich würde sagen, wir fangen dann gleich an«, flüsterte sie, und da erkannte Schreck schlagartig, was fehlte. Bewunderung. Und Neugierde. Die Dinge, die jeder Frau und jedem Mann normalerweise ins Gesicht geschrieben standen, mit denen er zu tun hatte. Stattdessen witterte er etwas anderes.
Gefahr.
Die Frau, deren Namen er sich nicht merken konnte, lächelte. Ihr Lächeln war nicht echt, das spürte er jetzt ganz deutlich. »Ich stelle Sie dann vor, sage etwas zu Ihren bisherigen Preisen, dann ein bisschen was zu Ihrem Werdegang. Geburt und Studium in Greifswald, längerer Aufenthalt in Brasilien, London, München und Ahrweiler. Und Sie erzählen dann etwas zu Ihrer Arbeit an Ihrem nächsten Roman.«
Etwas in ihm erstarrte. »Was?«
»Oh, da ist schon die Dame vom General-Anzeiger.«
In ihm blinkte es rot, während er der jungen Frau die Hand reichte und mechanisch ihre Fragen beantwortete. Zum Glück waren es Fragen, die er schon in- und auswendig kannte, so dass er nur den Mund öffnen musste, um die Antworten herausfließen zu lassen.
Und während die Worte aus seinem Mund drangen, arbeitete es hinter seiner Stirn fieberhaft.
Das, was die Veranstalterin da eben gesagt hatte, konnte nicht sein, es konnte nicht sein, weil es unmöglich war, aber auch, weil es einfach nicht sein durfte. Er hatte diese Frau noch nie zuvor gesehen. Wenn sie das gesagt hatte, was er gehört hatte, dann bedeutete das …
Schreck schluckte. Es war egal, was es bedeutete. Er würde abhauen. Sofort.
Schreck erhob sich, sein Buch fiel zu Boden. Instinktiv bückte er sich danach, und dabei traf sein Blick den eines Mannes, der in der ersten Reihe saß. Die beiden sahen sich an, einen Moment nur. Dann lächelte der andere, höflich, erfreut vielleicht, es war das Lächeln eines Lesers. Er hob die Hände und begann zu klatschen, und die Leute um ihn herum fielen ein, alle Augen richteten sich auf ihn, ein Applaus brandete auf und begrüßte den Bestsellerautor Niklas Schreck in Rheinbach. Und dieser begriff, dass Flucht jetzt unmöglich war.
Sein Puls jagte hoch, er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach.
Der Applaus des Publikums klang in seinen Ohren, als galoppiere eine Herde wilder Tiere vorbei. Er nahm den Lichtkegel wahr, der auf ihn gerichtet war, hörte durch die Lautsprecher sein eigenes hastiges Atmen, das leichte Keuchen, wenn er die Luft einsog, und er begriff, dass jemand das Mikrofon eingeschaltet hatte und dass alle ihn hörten. Und sahen. Und vermutlich seinen Angstschweiß rochen.
Und er begriff, was los war.
Und auch, dass er nicht würde entkommen können.
Also öffnete er sein Buch und begann zu lesen.
Tag 1
Jan legte den Kopf in den Nacken. Gegen den blitzblauen Sommerhimmel ragte der Rheinbacher Hexenturm drohend auf, das einzige von hier aus sichtbare Fenster stand offen, ringsum konnte Jan Schießscharten erkennen, oder waren es Lüftungsschlitze?
Egal, dachte Jan. Jedenfalls war die Frau weder aus dem Fenster gesprungen noch gestoßen worden. Dafür war der Körper, der am Fuße des Turms lag, zu unversehrt.
»Liane Riefers, 25 Jahre, wohnt in Rheinbach«, sagte Metzel, der blonde Kollege von der Schutzpolizei, der als Erster am Tatort eingetroffen war. Er war etwa so alt wie Jan, trug aber einen Vollbart, der ihn deutlich älter aussehen ließ. »Personalausweis und Handy trug sie in der Hosentasche bei sich. Merkwürdig, dass man sie ausgerechnet hier abgelegt hat. Das ist ja eine geradezu öffentliche Stelle.«
»Er sieht nicht gerade bewohnt aus«, sagte Jan und warf erneut einen Blick auf den Turm.
»Das ist er auch nicht«, sagte Metzel, »aber man kann ihn mieten. Für Veranstaltungen. Meine Nichte hat dort ihren Kindergeburtstag gefeiert. Der Turm gehört der Stadt Rheinbach.«
»Kindergeburtstag?« Jan runzelte die Stirn. Für einen Kindergeburtstag konnte er sich etwas Stimmungsvolleres vorstellen als ein Gemäuer, in dem im 17. Jahrhundert Hunderte von Hexen eingekerkert waren und unter dem rostigen Gitter auf ihren qualvollen Tod gewartet hatten. Das zumindest waren so ungefähr die einzigen Informationen über Rheinbach, die sein Gedächtnis auf der Fahrt hierher hatte zutage fördern können. »Und? Ist er zurzeit vermietet?«
»Ich bin dran. Der Kerl vom Stadtarchiv ist informiert, er müsste jeden Moment eintreffen.«
»Das ist gut.«
Zwischen den Resten der alten Stadtmauer und dem Turm wucherte Unkraut. Die Leiche lag zwischen blühenden Ackerwinden, Hirtentäschel und Löwenzahn. Dem Gesicht der jungen Frau, ein Mädchen beinahe noch, hatte der Tod nicht nur die Farbe, sondern auch jeden Ausdruck geraubt. Bekleidet war sie mit einem hellen Shirt und Jeans, die Füße steckten in rosafarbenen Ballerinas, die ihr etwas Kindliches gaben. In erster Linie aber kam dieser Eindruck von den Haaren. Lange blonde Zöpfe lagen links und rechts über ihre Schulter gebreitet, als habe man sie arrangiert. Die Wirkung war verblüffend, Jan fühlte sich an irgendeine Szene erinnert, die er kannte, aber ihm wollte nicht einfallen, woher. Ein Film vielleicht? Die eine Hand lag locker auf dem Bauch der Toten, die andere hielt sie zur Faust geballt an die Brust gezogen.
Jan beugte sich nieder. Dort, wo die Arme auflagen, waren bereits dunkel schattierte Totenflecken zu erkennen, auch an den Unterschenkeln erkannte er das charakteristische Muster. Die Frau war sicher schon über zwölf Stunden tot, für die präzisere zeitliche Bestimmung des Todeszeitpunkts würde man auf den Rechtsmediziner warten müssen. Vorerst reichte es ihm, den kritischen Zeitpunkt grob einzuordnen. Ein smaragdgrüner Käfer wanderte über die blasse Wange der Toten, verharrte für einen Moment an ihrem Nasenflügel. Jan hielt den Atem an. Am liebsten hätte er ihn verscheucht. Der Käfer setzte seinen Weg fort, um dann im Unkraut zu verschwinden.
Ein Ruf von der anderen Seite des Turms riss ihn aus seiner Betrachtung. »Jan?« Es war seine Kollegin Elena Vogt. »Der Kerl vom Stadtarchiv ist da.« Sie trat hinzu und sah zu ihm herunter. Elena war riesengroß. Nun ja, zumindest neben ihm. Wegen der Hitze hatte sie ihre dicken dunkelblonden Pferdehaare hochgebunden.
»Wir sind hier!« Jan trat die wenigen Schritte zur Seite und sah einen Mann die Stufen zum Turm hochsteigen. Er war vielleicht fünfzig Jahre alt, aber die wehenden weißen Locken und die halbmondförmige Brille ließen ihn wesentlich älter erscheinen. Er streckte schon von weitem die Hand aus, und als Jan sie ergriff, spürte er einen Händedruck, der nicht enden wollte. Offenbar war der Archivar einigermaßen aufgewühlt. »Manfred Hohl ist mein Name, Stadtarchiv Rheinbach, ich sollte sofort kommen.« Der Mann wirkte verwirrt, er blieb wie angewurzelt stehen, schüttelte dann Elenas Hand und verrenkte den Kopf, um das rot-weiße Flatterband zu betrachten.
»Sie sind zuständig?«
»Gewissermaßen, ja. Der Turm ist seit langem im Stadtbesitz.«
»Die Tür ist verschlossen.«
Der Mann hatte Elena endlich losgelassen und griff jetzt nach seiner Brille. »Das ist sie immer. Wir geben den Schlüssel nur den Mietern heraus. Also, der aktuelle Mieter hat einen, aber natürlich habe ich einen Ersatzschlüssel.«
»Haben Sie den dabei?«
»Den müsste ich holen. Aber das Archiv ist direkt hier in der Polligstraße.«
»Was war denn gestern hier los?«
»Gestern?« Hohl sah von einem zum andern, als warte er auf das richtige Stichwort, dann hellte sich sein Gesicht auf, so, als begriffe er jetzt erst, worum es ging. »Gestern war der Turm vermietet, für eine Abendveranstaltung. Eine Lesung. Dafür eignet er sich wunderbar, wegen des ganz besonderen Ambientes.«
»Eine Lesung«, wiederholte Jan. »Was für eine Lesung? Von wem?«
Der Archivar hob die Schultern und ließ sie dann urplötzlich wieder fallen. »Dieser Bestseller-Autor.«
»Ich brauche Namen und Anschrift der Veranstalter«, sagte Jan. »Am besten sofort.«
»Ruth Grosche. Sie gehört zum Lesezirkel des Rhein-Sieg-Kreises. Ich kopiere einfach den Mietvertrag für Sie. Gleich, wenn ich den Schlüssel hole.«
»Machen Sie das.«
Hohl nickte. Dann sah er zu Boden. »Ich … Darf ich das sagen? Die Tote sieht so aus wie eine Frau auf der Lesung gestern«, sagte Hohl und wies auf die Leiche. Sein Gesicht war blass, der Blick ausweichend. »Also, ob sie auf der Lesung selbst war, weiß ich nicht, aber sie hat den Schlüssel dafür abgeholt. Im Auftrag von Frau Grosche. Diese Schuhe in Rosa … Die sind mir aufgefallen. Aber ihre Haare waren anders.«
»Anders?«, fragte Jan. »Inwiefern anders?«
»Braun.«
»Sie war nicht blond?«
»Nein, und sie trug auch keine Zöpfe. Die Haare waren irgendwie kürzer. Und eher wellig.« Der Mann sah verlegen aus, ganz so, als befürchte er, aufgrund seines Wissens über die Frisur der Toten zu den Verdächtigen zu zählen.
»Wenn Sie dann den Schlüssel holen könnten – das wäre hilfreich«, sagte Jan.
Der Archivar nickte so heftig, dass seine weißen Locken flogen, dann eilte er zu den Treppenstufen. Elena sah ihm nach. »Komischer Kauz«, murmelte sie.
Jan zuckte die Achseln. »Vor seinem Turm wurde eine Leiche gefunden, das gefällt ihm möglicherweise nicht.«
»Hast ja recht.«
Erst als der Archivar nicht mehr zu sehen war, hockte Jan sich neben die Tote. Jetzt, aus der Nähe, sah er, dass die blonden Zöpfe etwas zu blond waren. Gefärbt? Jan kniff die Augen zusammen. Sie erschienen ihm übertrieben dick und strohig. »Haben wir das?«, vergewisserte er sich bei dem Mann der Spurensicherung, der die Fotos machte.
Dieser nickte. Jan streifte einen durchsichtigen Einmalhandschuh über und fasste vorsichtig nach dem Zopf. Er fühlte knisterige, strohige Textur. Künstliches Haar. Eine Perücke. Und keine besonders gute. Elena neben ihm pfiff durch die Zähne.
Jan zog, und das leuchtende Blond glitt vom Kopf der Toten und gab einen glänzenden kahlen Schädel frei. Verblüfft starrte Jan auf die Perücke in seiner Hand, dann auf den nackten Kopf des Mädchens.
»Sie wurde rasiert«, sagte Elena leise.
Jan ging in die Knie. Kurz musste er einen Schauder unterdrücken, dann zwang er sich zu professioneller Distanz und musterte die blicklosen blauen Augen, die gerade Nase, den Schwung der Wangenknochen. Etwas sah seltsam aus.
»Der Täter hat ihr die braunen Haare abrasiert und stattdessen diese Perücke aufgesetzt«, sagte Elena, aber es klang wie eine Frage, so, als wolle sie sich von Jan bestätigen lassen, dass das unsinnig war. »Kann das sein?«
»Mehr noch«, sagte Jan und deutete auf das Gesicht der Toten. »Ihre Augenbrauen sind nur aufgemalt, und sie hat keine Wimpern mehr. Sie ist komplett kahl.«
»Vielleicht eine Chemotherapie?«, sagte Elena, und in ihrer Stimme klang beinahe Hoffnung mit, so, als sei Chemotherapie weniger schlimm als das, was sie beide längst befürchteten, ohne es auszusprechen.
Jan schüttelte den Kopf. »Nein, eher rasiert.«
»Scheiße«, sagte Elena. »Dann ist diese Zopffrisur für den Mörder Teil der Inszenierung. Ein Fetischist. Ein sexuelles Motiv.«
»Schlimmstenfalls.«
Sie sahen sich an. Täter mit einem fetischistischen Motiv waren häufig Serientäter.
»Es ist zu früh für solche Spekulationen«, warnte Jan. »Warten wie erst einmal, was Frenze sagt.«
»Vielleicht ist alles ganz anders«, stimmte Elena zu, aber sie sah ihn dabei nicht an.
»Anders als was?« Jan hockte sich wieder neben die Tote. Die Faust auf ihrer Brust, fest geballt, schien ihm etwas zu versprechen. »Ihre Hand«, sagte er. »Es sieht fast aus, als hielte sie etwas umklammert.«
»Meinst du?«
Jan nahm einen Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und schob ihn vorsichtig zwischen die Finger der Leiche. »Die Leichenstarre hat schon eingesetzt«, sagte er. »Wir müssen wohl auf Frenze warten.« Er hasste den Gedanken an Frenze. Das lag an Jans Ex-Freundin Nicoletta, die durch eine seltsame Verkettung unglücklicher Umstände und irregeleiteten Geschmacksempfindens ihr Herz an den Rechtsmediziner verloren hatte. Damit hatte Jan gewaltig zu kämpfen. Nicht, weil er der Sache mit Nicoletta noch eine Chance gegeben hätte, sondern weil die Wahl eines neuen Partners immer automatisch ein Licht auf den alten Partner warf, und das war in diesem Fall er. Und wie er im Schein dieses Lichtes aussah, das wusste er nicht. Was vielleicht ein Glück war.
»Frenze kann erst am frühen Nachmittag«, sagte Elena, das Handy am Ohr. »Er sagt, die Leiche soll sofort in die Rechtsmedizin, wegen der Kühlung. Bei dem Wetter ist sie sonst in Windeseile – du weißt schon.«
Jan kniff die Augen zusammen und blinzelte in die Sonne. Dann zuckte er die Achseln und griff vorsichtig nach der Hand der Toten. Sie fühlte sich kühl an, und für einen Moment schauderte ihm, als ob diese Kühle die Temperatur des heißen Augusttages um einige Grad gesenkt hätte.
»Eigentlich muss das Frenze machen«, sagte Elena leise.
Jan schüttelte den Kopf. »Aber wir müssen wissen, was sie in der Hand hält. Was, wenn es ein direkter Hinweis auf den Täter ist? Dann ist Eile geboten.«
Elena zögerte, dann nickte sie. »Du hast recht.«
Jan hielt den Atem an, bog mit Gewalt die Finger der Toten auf und ließ das, was darin war, hinausgleiten.
Elena stieß einen erstaunten Ausruf hervor und beugte sich vor.
»Das glaub ich jetzt nicht!«, rief sie.
* * *
In der Nacht waren sie zu betrunken gewesen für anständigen Sex oder überhaupt für etwas, das den Namen Sex verdiente. Darum war Schreck erfreut, dass er, als er erwachte, erstens einen warmen Körper neben sich und zweitens keinen Hauch eines Katers in sich spürte. Das war eine erfolgversprechende Kombination. Es hätte auch sein können, dass sie längst weg war. Oder dass er die Kopfschmerzen hatte, die er eigentlich verdiente.
Sie war Journalistin, wenn er sich richtig erinnerte. Er griff nach ihr und strich ihr über die Hüfte, dann rückte er näher und ließ sie seine Morgenlatte spüren.
»Hi«, murmelte er.
»Hi!«, kam ihre Antwort.
Er biss ein wenig in ihre Schulter und stieß auf gut Glück zwischen ihre runden Pobacken.
Sie drehte sich um, rollte sich praktisch augenblicklich auf ihn und begann ihn zu küssen. Das war kein schlechter Anfang.
Der Geschmack auf seiner Zunge hatte vermutlich gleichzeitig etwas von Verwesung, kalter Asche und Chemie des Todes – während ihm das durch den Kopf ging, beglückwünschte er sich zu diesem kreativen Vergleich und nahm sich vor, ihn nachher, wenn diese Karla gegangen war, zu notieren.
Oder hieß sie Karina? Jedenfalls ließ sie sich von seinem Aroma nicht abschrecken.
Schreck mochte es ohnehin, mit ungeputzten Zähnen zu küssen. Das kommunizierte in gewisser Weise seinen Status, noch ehe es richtig zur Sache ging, es sagte, was er sich leisten konnte, dass er sich um derlei Maßnahmen keinerlei Gedanken machen musste, und es versprach gleichzeitig auf männlich dominante Weise, dass ihr in wenigen Minuten ohnehin sämtliche Gedanken an Zähneputzen aus dem Kopf fliegen würden.
Sie seufzte über ihm, die Augen geschlossen, und richtete sich auf, vielleicht auch, um seinem Kuss zu entgehen. Ihre Brüste konnten sich selbst in dieser Position sehen lassen, das war eine Seltenheit bei Frauen ihres Alters. Ob sie überhaupt echt waren?
»Stopp«, flüsterte er.
Sie öffnete die Augen und schaute ihn fragend an.
»Ich muss dir noch etwas sagen«, begann er.
»Dann sag es.« Sie sah etwas verwirrt aus.
Er griff nach ihrem weichen Oberschenkel und kniff sanft hinein. »Es ist nur, damit … Ich möchte nicht, dass du dich nachher irgendwie ausgenutzt fühlst.«
»Oh«, sagte sie. Sie runzelte die Stirn, offensichtlich war es ihm gelungen, sie zu überraschen. »Nein, natürlich nicht.«
»Sicher?«, fragte er.
»Ich habe einen Freund.« Jetzt errötete sie sogar ein winziges bisschen, das stand ihr gut.
»Es wäre ein Wunder, wenn du keinen hättest, Karla. Du bist … heiß.«
»Ich heiße Kristina«, sagte sie. Es klang verärgert, und so sah sie jetzt auch aus.
»Natürlich heißt du Kristina«, beeilte er sich zu sagen und griff nach ihrer Brust. Wow! Sie war ganz unzweifelbar echt. »Aber deswegen erkläre ich dir das ja.«
»Hä?«, sagte sie.
Er legte eine kleine Spannungspause ein. »Du weißt ja, dass ich Schriftsteller bin.«
»Klar.« Sie sah ihn verständnislos an, ihre Schultern sanken vor, und aus ihrem Körper wich die Spannung.
»Und du erinnerst mich an die … Karla. Die Protagonistin aus meinem nächsten Roman.«
Die Frau, die offensichtlich Kristina hieß, riss die Augen auf. »Echt?«, fragte sie. Und wiederholte gleich noch einmal: »Echt?«
Er nickte ernst. »Und darum sage ich dir das vorher. Ich weiß nie, welche von den vielen Dingen, die mir so passieren, in meinen nächsten Roman einfließen. Und falls du dich dadrin wiederfindest, eines Tages, wenn er in den Buchläden liegt, dann möchte ich nicht, dass du dich ausgenutzt fühlst, Karla. Oh, jetzt hab ich euch schon wieder verwechselt!« Er klatschte sich an die Stirn.
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Quatsch! Schreib einfach, was du willst!«
Er sah, wie es in ihr arbeitete. Er nickte wieder. »Ja, das muss ich eh. Ich kann gar nicht anders. Leben und Schreiben, das ist bei mir dasselbe, es fließt alles ineinander, verstehst du.«
Karla-Kristina war von ihm heruntergerutscht und schien auf weitere Erklärungen zu warten, vielleicht auch auf Anweisungen. Er streichelte ihre Wange, zog ein bisschen an ihren langen dunklen Haaren und schob ihren Kopf dann mit sanftem Druck abwärts. Sie schien ohnehin zu verstehen, was sie tun sollte.
»Du bist so was von heiß«, flüsterte er und schloss die Augen, als sie endlich anfing.
Wieder eine Leserin fürs Leben gewonnen, dachte er zufrieden.
Und diese Leserin würde sich jetzt ganz gewaltige Mühe geben, um ihre einmalige Chance auf ein literarisches Denkmal zu nutzen.
* * *
Der Archivar war einer der Männer, die sich neben großen Frauen aufblasen mussten, das merkte Elena sofort. Eben, neben der Leiche, war er ein verschüchterter, beinahe vertrottelter Bücherwurm gewesen, aber jetzt, in seinem Turm, wuchs er mit jedem Schritt.
Er lächelte Elena stolz an, als er den Schlüssel im Schloss der alten Holztür umdrehte, und ließ ihr dann galant den Vortritt. Direkt links hinter dem Eingang befand sich ein steinernes Podest zweifelhaften Zweckes, auf das der Archivar mit ausgestrecktem Arm wies. »Wenn Sie mal müssen«, sagte er und genoss Elenas irritierten Gesichtsausdruck. »Das war hier früher das Plumpsklo.«
Offenbar sagte er das an der Stelle immer. Wortlos folgte ihm Elena in den runden Raum.
»Dort unten ist das Verlies«, fuhr der Archivar fort und deutete auf eine Luke im Boden. »Durch diese Luke warf man den Gefangenen, die dort schmorten, jeden Tag ihr Brot. Aber keine Sorge, wir haben schon lange keine Touristen mehr eingesperrt.«
»Sie scheinen das hier ja total witzig zu finden«, sagte Elena, ohne das Gesicht zu verziehen.
Das Lachen des Archivars erlosch augenblicklich, und Elena tat ihre Schroffheit beinahe leid. Offenbar war er angesichts des vertrauten Ortes in einen automatischen Touristenführer-Modus verfallen, den er nicht abstellen konnte.
Hastig schob sie hinterher: »Ich möchte in das Zimmer, in dem die Lesung stattgefunden hat.«
Der Archivar nickte knapp und ging voran. »Da müssen wir durch den Wehrgang. Folgen Sie mir einfach.«
Der Wehrgang, der in die oberen Räume führte, war eng. Nur wenige Schießscharten ließen Licht hindurch. Es schien Elena, als ob die rauhen Steine sie von allen Seiten bedrängten. Undenkbar, dass jemand eine Leiche hier hochgeschleppt hatte. Und wenn doch, dann hätte er sicher beim Passieren des Weges massenhaft Spuren an den Wänden hinterlassen.
»Gibt es hier kein Licht?«, fragte Elena.
»Doch«, entgegnete der Archivar.
»Aber?«
»Vorsicht, achten Sie auf Ihren Kopf«, sagte der Archivar. Zu spät, denn in diesem Moment stieß Elena schmerzhaft an die Decke, und für einen Augenblick sah sie Sternchen. Sie rieb sich die Stirn und fluchte.
»Hier wären wir.«
Die Lesung hatte im Kaminzimmer stattgefunden. Ein riesiger offener Kamin dominierte den kreisrunden Raum, in Reihen davor standen Stühle aus rohem Holz. Eine Leselampe und ein niedriger Tisch verrieten, wo der Autor gesessen hatte. Linker Hand befand sich ein bodentiefes Sprossenfenster, kreuz und quer im Raum verteilt lagen Flyer.
Elena hob einen auf. Der Literaturkreis Rhein-Sieg bat um Spenden und informierte über seine Homepage und den Newsletter. Sie steckte den Zettel ein.
Der Archivar hatte bereits begonnen, das herumliegende Papier aufzusammeln. »Die hätten längst aufräumen sollen, der Raum sollte schließlich besenrein übergeben werden. Und das Fenster haben sie auch offen gelassen. Typisch, oder?«
Elena antwortete nicht. Sie trat an das Fenster und blickte hinaus. Sah Kastanienbäume, die alte Rheinbacher Stadtmauer, einen Schulhof und direkt unter sich Jan. Von hier oben sah er noch kleiner und schmaler aus als sonst. Er hockte neben der Leiche. Das Sonnenlicht ließ die blonden Zöpfe aufleuchten.
»Das Anbringen von Plakaten war nicht abgesprochen«, brummte der Archivar und machte sich daran, ein großformatiges Poster von der Wand zu reißen.
»Was haben Sie da?«, rief Elena.
»Ich?« Verdutzt sah der Archivar auf das Plakat. Darauf blinzelte ein gutaussehender Schriftsteller durch eine markante Brille, doch nicht das war es, was Elenas Aufmerksamkeit gefangen nahm. Unter dem Bild prangte ein Schriftzug. »Schreck liest aus seinem Bestseller Rapunzelmord.«
Elena starrte das Plakat sekundenlang an, dann riss sie es ab. Eine Leiche mit Zopfperücke vor einem Turm. Eine Lesung und ein Buch über Rapunzel. Erneut sah sie aus dem Fenster und erkannte Jan, der neben der Leiche kniete.
»Rapunzel, lass dein Haar herunter«, flüsterte Elena. Dann zwängte sie sich wieder durch den Wehrgang. Aber diesmal achtete sie sehr genau auf ihren Kopf.
* * *
Es war gefährlich im Steinbruch. Zwei andere Männer waren in den letzten beiden Tagen von plötzlich herabfallenden Steinen zerquetscht worden, und der feine Staub, der in der Luft hing, brannte in den Lungen und legte eine helle Puderschicht auf die schweißnassen nackten Oberkörper.
Gerade wollte Johannes nach einem geeigneten Fluch suchen – es fiel ihm nur schwer, weil in seinem Wörterbuch keine Flüche des zwölften Jahrhunderts standen und er diese erst einmal recherchieren musste –, als ihn das Klingeln der Haustür aus seiner Geschichte herausriss. Post, vermutlich. Warum kam die immer dienstags?
Er verharrte. Von Gundel war nichts zu hören, also stand er verärgert auf, trat in den Flur und öffnete. Vor ihm stand ein Paketbote und strahlte ihn an.
Johannes ließ ihn den schweren Karton im Flur abstellen und quittierte den Empfang. Der Paketmann allerdings machte keine Anstalten zu gehen.
»Ich habe Sie bestimmt beim Arbeiten gestört«, sagte er und strahlte weiter.
»Oh, kein Problem!«
»Ihre Frau hat gesagt, Sie schreiben Romane.«
»Ja.« Johannes räusperte sich. »Aber nur nebenbei.«
»Nebenbei?« Der Paketmann starrte ihn so ungläubig an, als habe er etwas ganz und gar Ungeheuerliches gesagt. »Also, Schreiben stelle ich mir schwierig vor.«
»Nun ja, es gibt bestimmt Leichteres.« Zum Beispiel Pakete austragen, schoss es Johannes durch den Kopf, aber das hätte respektlos geklungen, und außerdem wusste er nicht einmal, ob es stimmte.
»Was haben Sie denn da in der Hand?«, fragte der Paketmann neugierig. Sein rotes Gesicht glänzte. Er sah zufrieden aus. Doch, dachte Johannes, auf jeden Fall war sein Job einfacher.
»Bitte was?«
»Was Sie da in der Hand halten, hab ich gefragt. Sieht gefährlich aus.«
Johannes sah auf seine Hand. Sie hielt einen Steinbrocken. »Das ist nichts. Nur ein Stein.«
Endlich war der Paketmann bereit zu gehen. Zurück im Arbeitszimmer, nahm Johannes als Erstes sein Handy. Keine Nachricht. Er seufzte. Dann legte er den Stein vor sich hin. Dies war keineswegs nur ein einfacher Stein. Er war ein Trachyt, und ein wunderschöner dazu. Aus der hellgrauen feinkörnigen Oberfläche wuchsen ungewöhnlich große gelbliche Feldspatkristalle, deren Flächen im Licht glänzten.
Nachdenklich betrachtete Johannes den Trachyt, der einen Stapel jungfräulich weißen Papiers beschwerte. Er hatte ihn voriges Jahr bei einem Spaziergang gefunden und mitgenommen. Ein Talisman sollte er werden. Trachyt. Keineswegs war Trachyt nur ein Stein, nicht hier, im Siebengebirge, und genau darum ging es in seinem Roman. Trachyt hatte die Drachenfelsgrafen damals reich gemacht.
Es war einmal ein Burggraf, der lud seine Freunde zu einem großen Fest. Sie erschienen allesamt, denn die Festmahle des Grafen waren berühmt und sein Weinkeller stets voll.
Als alle beisammensaßen, hob der Burggraf seine Hand. Daran war ein schlichter Ring mit einem noch schlichteren Stein. »Mein Ring«, sagte der Burggraf, »hat einen ganz besonderen Stein. Es ist Trachyt vom Drachenfels. Er ist mehr wert als all Euer Schmuck zusammen!«
Alle, die versammelt waren, brachen in Raunen und Flüstern aus und dachten, dass der Burggraf irre sprach. Sah er denn nicht, dass sein Stein nur grau und unscheinbar war, während es an allen anderen Händen und Hälsen glitzerte und funkelte?
Endlich sprach der Burggraf: »Eure Steine haben Euch Geld gekostet und nur die Händler reich gemacht. Mein Trachyt aber wird mich reich machen und die sieben Berge um mich herum dazu.«
Und so geschah es. Der Stein vom Drachenfels machte den Drachenfelsgrafen nicht nur reich, er brachte der Region Arbeit und Geld und Berühmtheit, während auf seinen Hängen der Wein wuchs und Jahr um Jahr die Keller füllte, und so lebten er und seine Nachkommen glücklich und zufrieden bis – ja, bis jetzt.
Im neuen Jahrtausend hatte sich das Blatt gewendet. Trachyt brachte keinen Segen mehr, längst schon wurde er nicht mehr abgebaut, dort, wo er ehemals gewesen war, klafften jetzt riesige offene Wunden inmitten der Landschaft. Königswinter war einst bekannt gewesen für seinen Wein, doch nun war ausgerechnet der Trachyt im Begriff, diese Tradition zu zerstören. Der Siegfriedfelsen spie Steine auf den Weinberg, und deswegen durfte der Wein dort nicht mehr abgebaut werden. Dabei hatte die Sonne in diesem Sommer überreich geschienen. Die Trauben hingen prall an den Reben, doch die Winzer durften keine Reben schneiden, und jeder Spaziergänger heftete den Blick ängstlich auf den Siegfriedfelsen in Erwartung der tödlichen Brocken, mit denen er um sich warf. Der Fels hatte sich in ein feindliches Katapult, der ehemals glückbringende Trachyt in ein bösartiges Wurfgeschoss verwandelt.
Und was früher Reichtum gebracht hatte, brachte jetzt nur noch Unglück.
Johannes verspürte Hunger, aber er unterdrückte den Drang, zum Kühlschrank zu gehen. Dort war ohnehin nicht mehr viel zu finden, seit Gundel und er mit der Basendiät begonnen hatten.
Er runzelte die Stirn und klickte in seinen wenigen Seiten herum. Trachyt war ein gutes Thema. Und regional dazu. Regional war wichtig, sagte Nessi, und die kannte sich aus.
Nessi.
Er wollte nicht an Nessi denken, zu nah lag dann der Gedanke an gestern. Und an gestern konnte er nicht denken. Durfte er nicht. Nicht, wenn er sich konzentrieren wollte. Und das musste er.
Es war schließlich Dienstag.
* * *
Das Haus lag am Ende eines Wendehammers am Ende einer Häuserreihe am Ende einer Siedlung. »Ende von allem«, sagte Elena.
»Was?« Verständnislos sah Jan sie an.
»Ach, nichts. Ich hasse diesen Teil.«
Jan nickte. Einer Mutter die Botschaft vom Tod ihrer Tochter zu überbringen, war so ziemlich das Schlimmste, was ihr Beruf mit sich brachte. Für Christine Riefers würde nach ihrem Besuch nichts mehr so sein wie zuvor. Jan war beinahe froh, dass die näheren Umstände des Todes von Frenze noch nicht geklärt waren. Der Verdacht, der im Raum stand – ein Sexualdelikt, vielleicht ein Serienmörder –, war etwas, was man guten Gewissens verschweigen konnte, ja, musste, solange er nicht bestätigt war.
»Ja, bitte?«
Christine Riefers’ Mund war rosa, auf dem Kopf zitterten schwarze, exakt gedrehte Löckchen, die sehr künstlich aussahen. Die Farben Rosa und Schwarz wiederholten sich auf ihrer geblümten Bluse.
»Seidel ist mein Name, Kriminalpolizei, und das ist meine Kollegin Vogt. Können wir reinkommen?«
Christine Riefers’ Blick ging von einem zum anderen, sie schien ungläubig. Offenbar fand sie nicht, dass Jan wie ein Polizist aussah. Er war zu klein, zu schmal und zu schick, behauptete Elena immer, um dann gern hinzuzufügen, er sehe aus wie ein Kellner. Ein italienischer, wohlgemerkt.
Wortlos zückte Jan seinen Ausweis und hielt ihn der Frau entgegen. Sie musterte ihn ausdruckslos, das Lächeln auf ihrem Gesicht wollte nicht weichen. »Reinkommen? Warum?«
»Es geht um Ihre Tochter.«
»Liane.« Mehr sagte sie nicht, nur den Namen. Dann trat sie beiseite und machte eine einladende Geste. »Bitte, kommen Sie herein. Hier entlang. Ins Wohnzimmer, ja? Sie möchten bestimmt etwas trinken«, sagte sie und lächelte starr. »Kaffee? Tee? Wasser?«
»Wasser ist gut«, sagte Elena und nahm auf dem hellen Sofa zwischen zwei gelben, exakt gekniffenen Dekokissen Platz. Um sie herum wuchs ein Dschungel aus grünen Topfpflanzen. Hydrokultur. Dazwischen standen zahlreiche von diesen Sprühflaschen aus Plastik, deren Namen Elena nicht wusste. Offenbar machte Riefers eifrig davon Gebrauch, denn die Luft war feucht wie in den Tropen.
Als sie sich ihnen gegenüber hingesetzt hatte, lächelte Riefers immer noch. Wusste sie, was auf sie zukam? War dieses Lächeln ein hilfloser Versuch, die entsetzliche Nachricht abzuwehren?
»Wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen«, sagte Jan. »Man hat Ihre Tochter Liane heute Morgen tot in Rheinbach aufgefunden. So, wie es aussieht, ist sie Opfer eines Verbrechens geworden.«
Riefers ruckelte mit dem Kopf wie eine Taube. »Ja?«, fragte sie und fuhr fort zu lächeln.
»Es tut uns sehr leid«, sagte Jan. »Das ist eine schreckliche Nachricht für Sie. Möchten Sie jemanden anrufen?«
Riefers lächelte. »Wen sollte ich anrufen wollen?«
Jan und Elena wechselten einen Blick. »Jemanden, der Ihnen beisteht.«
Riefers’ Lächeln wirkte auf Jan inzwischen wie eine Grimasse. »Ich bin alleinstehend. Ich muss alles allein schaffen, immer.«
Jan schaute zu Elena. Seine Lippen formten die Worte »ambulanter Notdienst«, und sie nickte, offenbar war ihr derselbe Gedanke gekommen. Diskret erhob sie sich und trat in den Flur, um die Nummer zu wählen.
»Frau Riefers«, sagte Jan langsam und deutlich. »Gleich kommt jemand und kümmert sich um Sie. Aber zuvor müssen Sie uns noch einige Fragen beantworten, auch wenn es Ihnen schwerfällt.«
Keine Tränen, nichts, nur der starre Blick. »Wo ist meine Tochter jetzt?«, fragte sie dann unvermittelt.
»In der Rechtsmedizin.«
»Natürlich«, murmelte Riefers. Dann griff sie neben den gelben Sessel, es war eine merkwürdige Bewegung, für einen Moment befürchtete Jan, sie würde eine Waffe ziehen, aber stattdessen zog sie eine Sprühflasche hervor und gab einige Stöße Wasser auf die Blätter einer wachsig aussehenden Grünpflanze ab. Das schien sie zu beruhigen.
Elena trat zurück ins Wohnzimmer und nickte Jan zu.
Riefers sah zu ihr hoch. »Liane ist mein einziges Kind. Und jetzt liegt sie in der Rechtsmedizin, sagt Ihr Kollege.«
Elena beugte sich vor und berührte die Frau sanft am Arm. »Möchten Sie Ihre Tochter sehen?«, fragte sie dann leise.
Riefers ließ sich Zeit mit der Antwort. Sie drehte am Verschluss der Sprühflasche herum, dann richtete sie ihre starren Augen auf Elena und schüttelte kurz den Kopf. »Meine Tochter war nicht mehr sie selbst«, sagte sie dann. »Nicht mehr mein kleines Mädchen, nein. Dafür hat er gesorgt.«
»Er?«, fragte Jan. »Wen meinen Sie?«
»Er«, wiederholte Riefers und lächelte. Dann sprühte sie noch einmal in die Luft.
»Wer?«, wiederholte Jan.
Wieder ruckelte Riefers’ Kopf wie der einer Taube. »Können Sie jetzt bitte gehen?«
Jan warf Elena einen warnenden Blick zu. Die Frau wirkte psychisch deutlich angeschlagen, war dies ein Schock infolge der Nachricht – oder war sie vorher schon so seltsam gewesen? Jedenfalls wäre es fatal, wenn sie zu diesem Zeitpunkt auf die Befragung verzichten müssten.
Elena beugte sich vor, als wolle sie erneut den Arm der Frau berühren, aber dann unterließ sie es. »Es ist wirklich wichtig, dass Sie uns weiterhelfen«, sagte sie behutsam.
Riefers schüttelte den Kopf, die steifen Löckchen zitterten. Dann griff sie mit mageren Fingern in den grünen Dschungel, bis sie ein Blatt zu fassen bekam.
»Nicht jetzt«, murmelte sie. »Nein, nicht jetzt. Jetzt kann ich wirklich nicht.«
* * *
»War da gerade jemand an der Tür?«, fragte Gundel. Sie trug ihren Bademantel und hatte ein Handtuch wie einen Turban um den Kopf gewickelt, ihre Haut glänzte fettig von der Hautcreme, die sie offenbar reichlich aufgetragen hatte.
»Nur der Paketmann.«
»Bist du weitergekommen?«
»Die Klausuren sind durch.«
»Ich rede nicht von den Klausuren.«
Johannes spürte ihren Blick, wohlwollend, liebevoll, und er fragte sich, woher ihr grenzenloser Optimismus kam. »Es geht so«, sagte er. »Die Geschichte klemmt ein bisschen.«
Sie schob sich zwischen ihn und den Schreibtisch und ließ sich auf seinen Schoß sinken, dann setzte sie ihre Lesebrille auf und las. Er sah an der Bewegung ihrer Augäpfel, wie sie den Text durchpflügte. Die Geschwindigkeit deprimierte ihn. Wie lange hatte er gebraucht, um das zu schreiben, was sie jetzt hinunterstürzte wie ein Glas Wasser an einem heißen Tag? Drei Dienstage, vier? Auf jeden Fall stand es in einem krassen Missverhältnis.
Als sie fertig war, setzte sie die Lesebrille wieder ab, die leuchtend rot mit kecken weißen Punkten war. Seit einiger Zeit trug sie sie an einer Kette um den Hals, so dass sie auf ihrem Busen schaukelte, während sie sprach. Das verlieh ihr eine Betulichkeit, die ihn nervte. Die Kombination mit dem Bademantel war besonders unvorteilhaft, aber das schien Gundel nicht bewusst zu sein, oder es war ihr egal.
»Ich finde es toll«, sagte sie. »Überhaupt finde ich die Idee großartig, die Geschichte Königswinters anhand dieser Familie zu erzählen.«
So hatte er es ihr erklärt. Die Geschichte des Siebengebirges aus der Sicht des Trachyts, gewissermaßen. Wie der Stein zur Zeit des Dombaus erst Reichtum und Arbeitsplätze schafft, dann beinahe in Vergessenheit gerät und schließlich durch Steinschlag den Weinbau ausrottet und das Siebengebirge damit um den letzten Rest dessen bringt, was es irgendwie relevant machte. Natürlich war das etwas übertrieben, aber nur so bekam er den erzählerischen Bogen hin, der ihm vorschwebte.
»Guck doch nicht so, Johannes! Dein Roman gefällt mir wirklich!«
»Aber es ist kein Roman. Es ist nicht einmal ein echtes Kapitel oder eine Szene, es ist einfach nur ein Text.« Entschlossen klappte er das Laptop zu. Am liebsten hätte er sie auch von seinem Schoß geschüttelt. Sie war zu schwer, seine Beine taten bereits weh, vor allem das rechte. Aber das konnte er nicht sagen, ohne dass es Streit gab, so lange, bis er ihr versicherte, dass sie keinesfalls schwerer geworden war, sondern er lediglich nicht mehr so kräftig war wie vor dreißig Jahren, als er sie liebend gern auf den Schoß genommen hatte, ständig.
»Aber es wird ein Roman! Der Anfang ist gemacht.«
»Manchmal glaube ich nicht daran.«
»Das musst du.«
»Warum?«
»Weil ich es tue. Ich glaube fest daran!«
»Ich weiß nicht.« Er starrte auf den Bildschirm, auf die Buchstaben, die ihm plötzlich keinen Roman mehr versprachen, ganz anders als letzte Woche noch.
»Gestern warst du noch ganz überzeugt. Was ist denn plötzlich los mit dir?« Sie stupste ihn an. »Du bist heute ganz komisch, weißt du das?«
»Ich bin gar nicht komisch«, wehrte er ab. »Es ist die Geschichte. Schwierig zu schreiben, weil die Handlung sich über fast neunhundert Jahre erstreckt. Darin besteht der Denkfehler.«
Gundel runzelte die Stirn und richtete sich auf. »Ich dachte, das wäre gerade das Gute daran!«
»Ja und nein. Überleg doch mal! Da tragen die nur noch denselben Namen. Es lebt nicht einmal eine Oma oder so, die damals schon auf der Welt war. Und wenn ich den verwandtschaftlichen Bezug herstelle, dann geht es um die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur …« Er kam ganz durcheinander, weil er vergessen hatte zu zählen.
»Du schaffst das schon.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange, der nach Hautcreme roch, und er spürte, wie sich Ärger in ihm regte.
Du schaffst das schon.
Das sagte sich immer sehr leicht für die, die es nicht schaffen mussten. Für die, die dachten, er müsse sich nur vor den PC setzen, eine Idee haben und dann die Finger über die Tastatur flitzen lassen. »Ich glaube nicht.«
»Natürlich schaffst du das!«
»Es ist nicht so leicht, wie es klingt.«
»Aber deine Idee ist gut.« In ihrer Stimme lag Optimismus, es war der gespielte Optimismus einer Krankenschwester, dachte er. »Sonst frag eben deine Kollegin um Hilfe.«
»Nessi?«
»Ja. Die kennt sich doch aus mit so was. Überhaupt, wie geht es ihr eigentlich? Du hast noch gar nichts von gestern erzählt.«
Ihr Blick wurde forschend, wachsam. Er kannte diesen Blick. Gleich würde sie seine morgendliche Schweigsamkeit beim Frühstück kritisieren. »Erzähle ich später«, sagte er ausweichend.
»Hmmm. Du warst beim Frühstück schon so abwesend.«
»Das lag nur daran, dass Obst und Mandelmilch am Morgen irgendwie nicht so meins ist.«
»Du musst dich nur daran gewöhnen. Dann wird es dir wunderbar gehen, so wie mir. Es ist ein Großputz für den Körper, danach fühlen wir uns beide wie neu!« Ihre Stimme war umgehend ganz eifrig geworden, wie immer, wenn sie auf ihre gemeinsame Ernährungsumstellung zu sprechen kam.
»Hm«, machte er.
»Es fällt dir schwer, weil dein Körper von all diesen Säuren vergiftet ist. Wenn dir Obst morgens nicht reicht, solltest du einen basischen Riegel essen, ich habe extra welche gemacht. Aus Datteln und Mandeln. Sie sind im Kühlschrank, im Türfach, in Alufolie gewickelt.«
»Ach so«, sagte er. Jetzt ging ihm ein Licht auf. Naiv, wie er war, hatte er das Alufoliepäckchen für eine Frikadelle gehalten und mit in die Schule genommen, nur um dann im Lehrerzimmer festzustellen, dass es sich um eine faserige, pappsüße Masse handelte, die er im Papierkorb entsorgt hatte. Danach hatte alles um ihn herum geklebt, weil er in den Unterricht geeilt war, ohne sich die Hände zu waschen. Plötzlich war ihm, als müsse er augenblicklich schreien, wenn sie noch ein einziges Wort über Basendiät verlor.
»Ich bin nur müde«, sagte er, obwohl er wusste, dass das eine Provokation bedeutete. »Von gestern.«
Sofort sah sie ihn scharf an. »War denn gestern etwas Besonderes?«
Da!, dachte er. Und sagte: »Warum, was meinst du mit gestern?«
»Auf der Lesung.« Sie beobachtete ihn genau, das spürte er, obwohl er sich abgewandt hatte, um den Stapel Manuskriptseiten zurechtzurücken. Ihre Blicke brannten förmlich Löcher in seinen Rücken.
»Es war okay«, sagte er und drehte sich zu ihr um. Sie krümmte ihre Oberlippe leicht nach unten und atmete durch die Nase aus, stoßweise. Er kannte die Zeichen, es waren Zeichen des Einlenkens. Sie würde nicht weiter nachfragen.
Sie sagte: »Wie ärgerlich, dass es nicht läuft, heute. Ausgerechnet am Dienstag.« Dann warf sie einen Blick auf die Armbanduhr. »Oh, ich sollte mich fertig machen, ich muss bald los!«
Ich kenne sie in- und auswendig, dachte er. Es ist nicht zum Aushalten.
»Sei fleißig!«, mahnte sie zum Abschied, und er spürte, wie sich in ihm erneut Widerwillen gegen sie regte. Auch gegen ihren Bademantel und diese kindische Lesebrille und ihr cremeglänzendes Gesicht.
»Natürlich«, sagte er und wartete, dass sie ging. Aber das tat sie nicht. Prüfend betrachtete sie seinen Schreibtisch, die sauber gestapelten Manuskriptseiten, die er schon ausgedruckt und mit handschriftlichen Korrekturen versehen hatte, den Stapel weißes Papier, die Notizbücher und Post-its. Wonach suchte sie? Dachte sie, er verberge unter diesen Insignien ernsthafter Arbeit Disneys Lustige Taschenbücher?