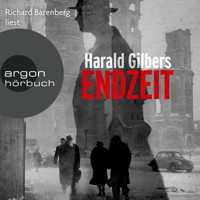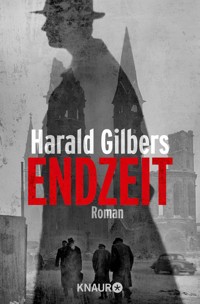9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kommissar Oppenheimer
- Sprache: Deutsch
Politisch hoch brisant und menschlich herausfordernd: Kommissar Oppenheimer muss zwischen Ex-Nazis und Israelis vermitteln »Attentat« ist der 9. Band von Harald Gilbers' preisgekrönter historischer Krimi-Reihe aus dem Berlin der letzten Kriegsjahre und der Nachkriegszeit. Frühsommer 1952: Auf den westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer wird ein Briefbomben-Attentat verübt, das zum Glück vereitelt werden kann. Hartnäckig hält sich das Gerücht, hinter dem Anschlag würden radikale Kräfte aus Israel stecken. Denn Adenauer steht kurz davor, ein Wiedergutmachungsabkommen mit Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion zu unterzeichnen. Und das stößt in beiden Ländern auf Widerstand. Weil es Hinweise gibt, dass Adenauers Leben nach wie vor in Gefahr ist, schickt Ben-Gurion israelische Agenten nach Deutschland – das Abkommen soll um jeden Preis geschützt werden. Doch die Zusammenarbeit zwischen Israelis und dem deutschen Geheimdienst gestaltet sich mehr als schwierig: Schließlich arbeiten etliche Ex-Nazis für die Organisation Gehlen. Kann der Berliner Kommissar Oppenheimer als jüdischer Deutscher die Wogen glätten – und ein weiteres Attentat verhindern? Historische Hochspannung mit aktuellen Bezügen Der Historiker und Krimi-Autor Harald Gilbers hat auch den 9. Fall für seinen Kommissar Oppenheimer akribisch recherchiert. Wer sich für das komplexe Verhältnis zwischenDeutschland und Israel interessiert, bekommt hier historische Hintergründe hoch unterhaltsam aufbereitet. Für alle Fans von »Babylon Berlin« oder »Bonn« bietet auch der 9. Krimi der historischen Reihe atmosphärische Spannung, die die Nachkriegszeit in allen Facetten zum Leben erweckt. Die Krimi-Reihe um den jüdischen Kommissar Oppenheimer ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Germania (1944) - Odins Söhne (1945) - Endzeit (1945) - Totenliste (1946) - Hungerwinter (1947) - Luftbrücke (1948) - Trümmertote (1949) - Tanzpalast (1950) - Attentat (1952)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Harald Gilbers
Attentat
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Frühsommer 1952: Auf den westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer wird ein Briefbomben-Attentat verübt, das zum Glück vereitelt werden kann. Hartnäckig hält sich das Gerücht, hinter dem Anschlag würden radikale Kräfte aus Israel stecken. Denn Adenauer steht kurz davor, ein Wiedergutmachungsabkommen mit Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion zu unterzeichnen. Und das stößt in beiden Ländern auf Widerstand.
Weil es Hinweise gibt, dass Adenauers Leben nach wie vor in Gefahr ist, schickt Ben-Gurion israelische Agenten nach Deutschland – das Abkommen soll um jeden Preis geschützt werden. Doch die Zusammenarbeit zwischen Israelis und dem deutschen Geheimdienst gestaltet sich mehr als schwierig: Schließlich arbeiten etliche Ex-Nazis für die Organisation Gehlen.
Kann der Berliner Kommissar Oppenheimer als jüdischer Deutscher die Wogen glätten – und ein weiteres Attentat verhindern?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Literaturhinweise
Leseprobe »Tanzpalast«
Prolog
Samstag, 22. März 1952
Die viermotorige Propellermaschine mit dem Kennzeichen PH-TPJ setzte zum Sinkflug an. Als ihr glänzender Metallkörper in die dunkelgraue Decke der Regenwolken eintauchte, befanden sich siebenundvierzig Seelen an Bord. Die Douglas DC6 der niederländischen Airline KLM war auf dem Rückflug von Johannesburg zum Heimatflughafen Schiphol bei Amsterdam. Es sollte ein gewöhnlicher Linienflug werden. Doch später stellte sich heraus, dass nichts an diesem Tag Routine war.
Den größten Teil der Flugroute hatte die Crew bereits hinter sich gebracht. Nach kurzen Aufenthalten in Französisch-Kongo und Rom steuerte Kapitän Lykle Poutsma nun den letzten Zwischenstopp in Frankfurt am Main an. Voller Vorfreude malte sich der junge Pilot bereits aus, wie er in einigen Stunden in seinen Wohnort Krommenie zurückkehren und seine Frau und die zwei Kinder in die Arme schließen würde.
»Gear down!« Auf Poutsmas Befehl hin betätigte der Co-Pilot den Fahrwerkshebel. Unter ihnen begann es zu rumoren, als die Hydraulik ansprang und das Fahrwerk ausgefahren wurde. Es waren die üblichen Geräusche, die ahnungslosen Passagieren einen Schrecken einjagen konnten, obwohl sie zu einer reibungslosen Landung gehörten.
Unten am Boden verlief auch für Willibald Hofmann der Morgen in geregelten Bahnen. Wenn der Fuhrunternehmer nicht gerade damit beschäftigt war, den Motor seines Lieferwagens zu warten oder Transportgut auf der Ladefläche zu verstauen, war er die meiste Zeit unterwegs. Auch an diesem Tag hatte er eine Lieferung zu erledigen. Hofmann fuhr mit seinem Gefährt auf einer schmalen Landstraße zwischen Frankfurt und der Nachbarstadt Neu-Isenburg. Sein Beruf brachte es mit sich, dass er die Hessenmetropole wie seine Westentasche kannte. Das Straßenband führte nach einer sanften Kurve schnurgerade durch den Stadtwald. Auf der kilometerlangen Strecke gab es außer dichtem Wald nicht viel zu sehen, und Hofmann hatte ausreichend Zeit, um den Gedanken nachzuhängen. Auch wenn seine Tagträume ihn noch so sehr beschäftigten, wäre er niemals auf die Idee gekommen, dass er an diesem trüben Morgen über sich selbst hinauswachsen und eine heldenhafte Tat vollbringen würde.
Die Landung der KLM-Maschine dauerte länger als erwartet. Das Flugzeug musste zwanzig Minuten über dem Flughafen kreisen, ehe es die Landeerlaubnis erhielt. Bei der Flugverkehrskontrolle traf um zehn Uhr fünfundvierzig eine Positionsmeldung ein. Das Flugzeug befand sich in diesem Moment auf siebenhundertfünfzig Metern im Sinkflug. Die Landung war eingeleitet. Der zweite Offizier Gart war ein erfahrener Pilot, der sogar auf mehr Flugstunden kam als Kapitän Poutsma, außerdem hatte er den Rhein-Main-Flughafen schon mehrmals angeflogen. Bei der eingeschränkten Sicht an diesem Regentag konnte das nützlich sein, also überließ Poutsma dem Kollegen den Anflug. Gart nahm Kurs auf die Einflugschneise. Die Entfernung zum Flughafen betrug zu diesem Zeitpunkt etwa zwanzig Kilometer. Die nächste planmäßige Positionsmeldung beim Überflug des Funkfeuers Offenbach wurde von den Fluglotsen jedoch nicht mehr empfangen. Im Äther blieb es still.
Anne Gautier liebte die Arbeit als Stewardess. Wenn sie in ihrer grau-blauen Uniform durch fremde Flughäfen schlenderte, spürte sie die neidischen Blicke der anderen Frauen. Ihr Beruf war begehrt, denn er versprach Freiheit und einen Hauch von Glamour. Doch es gab auch gewisse Nachteile, wie zum Beispiel angegurtet auf einem Sitz die Landung abzuwarten.
Plötzlich schlug Metall auf Metall. Genau wie die anderen Passagiere schrak Anne zusammen. Das hier gehörte nicht zu einem planmäßigen Sinkflug bei der Landung. Noch ehe sie eine Erklärung für den Lärm fand, begann das Flugzeug zu vibrieren. Die Passagiere wurden zur Seite geschleudert. Instinktiv krallte Anne sich an den Armlehnen des Sitzes fest. Ohrenbetäubender Lärm ertönte. Fast augenblicklich geriet die Maschine ins Taumeln. Zischend entwich Druck aus der Kabine. Ein Luftsog zerrte an ihr. Chaotisch wirbelten Gegenstände durch die Kabine. Anne wurde durchgeschüttelt. Schließlich verlor sie die Orientierung. Nur eine letzte Gewissheit blieb ihr. Das Flugzeug raste auf den Boden zu.
Dort unten zuckte auch Hofmann zusammen. Ganz in der Nähe ertönte ein gewaltiges Beben. Sofort trat er auf die Bremse und lenkte seinen Transporter an den Straßenrand. Suchend blickte er sich um, fand jedoch kein Anzeichen für einen Autounfall. Weit und breit war kein anderes Auto zu sehen. Er zog den Schirm seiner Mütze etwas tiefer in die Stirn und trat in den Regen hinaus. Hofmann glaubte, dass das Krachen aus dem benachbarten Wald gekommen war, eilte dorthin und lief suchend zwischen den Bäumen umher.
Nach wenigen Metern sah Hofmann die Bescherung. Eine meterbreite Schneise klaffte in dem Waldstück. Alarmiert hastete er vorwärts. In der Nähe der Lichtung lagen Gegenstände herum. Ein blauer Schal hatte sich an einem Zweig verfangen. Der Boden war übersät mit Koffern, Kleidungsstücken, Büchern. Dann erkannte Hofmann größere Metallteile. Inmitten der Zerstörung lehnte die abgerissene Heckflosse an einem Baumstamm. Daneben befand sich der Rest des Flugzeugs.
Beim Näherkommen drangen plötzlich Geräusche an Hofmanns Ohr. Abrupt blieb er stehen. In seinem Nacken bildete sich eine Gänsehaut. Gedämpfte Schmerzensschreie kamen aus den Trümmerteilen vor ihm. Hastig stolperte er über Äste auf die Fragmente der Flugzeugkabine zu. Der Riss in der Außenhülle war nicht breit genug, um sich hindurchzuzwängen, also trat er mit voller Kraft gegen das Aluminium, bis der Spalt groß genug war, um hindurchzuklettern.
Um Anne herum war es dunkel. Die einzige Sinneswahrnehmung war der Schmerz ihres zerschundenen Körpers. Sie hatte keine Kraft, um den Gurt zu lösen. Obwohl noch halb benommen, nahm sie wahr, dass sich ihr jemand näherte. Die Klinge eines Taschenmessers blitzte auf, dann spürte sie, wie an ihrem Gurt gezerrt wurde und das Band schließlich zerriss. Augenblicklich fiel sie zur Seite. Als der Schmerz durch ihren Körper brandete, stöhnte sie auf. Hände griffen nach Anne und zogen sie zum Licht.
Der Flugzeugabsturz war nicht unbemerkt geblieben. Hofmann war gerade dabei, einen zweiten Schwerverletzten zu bergen, als weitere Helfer eintrafen. Mit weit aufgerissenen Augen näherte sich von der Straße ein Mann im Regenmantel. Weiter hinten eilte ein Arbeiter im Blaumann heran.
»Was können wir tun?«
Auf die Frage hin gestikulierte Hofmann in Richtung des umliegenden Waldes. Atemlos antwortete er: »Weg von hier.«
Die Fremden verstanden seinen Hinweis und brachten die geborgenen Passagiere in Sicherheit.
Als Hofmann schließlich eine vierte Person durch die Öffnung in der Außenhaut des Flugzeugs ins Freie hievte, packte ihn der Arbeiter von draußen am Armgelenk und ließ nicht mehr los. Hofmann hielt inne. Weitere Passagiere befanden sich im Wrack. Er war noch lange nicht fertig.
»Schnell, raus hier!«, schrie der Helfer mit überschlagender Stimme.
Jetzt nahm auch Hofmann wahr, dass irgendwo ein Feuer prasselte. Mühsam quetschte er sich durch den Spalt ins Freie. Er hatte sich erst wenige Schritte vom Flugzeug entfernt, als hinter ihm eine ohrenbetäubende Detonation ertönte. Die Druckwelle erfasste ihn und schleuderte ihn ein Stück nach vorn. Er rappelte sich wieder auf, und der Blick zurück bestätigte ihm, dass er knapp einer Flammenhölle entkommen war.
Die weiteren Notmaßnahmen wurden an diesem Tag von Oberförster Röder eingeleitet. Die Hilfskräfte der Polizei fanden neben dem lichterloh brennenden Wrack insgesamt sechs Schwerverletzte vor. Neben Hofmanns zwei Helfern hatte sich noch ein weiterer Autofahrer an der Rettung beteiligt. Der Feuerwehr gelang es erst gegen dreizehn Uhr, den Brand zu löschen.
Nur zwei der sechs geborgenen Passagiere sollten die Katastrophe überleben, die Stewardess Anne Gautier und Ruth Horn, eine Frankfurterin, die unmittelbar in der Sitzreihe vor ihr gesessen hatte. Schnell war offensichtlich, dass der Absturz der KLM-Maschine Koningin Juliana das bislang schwerste Flugzeugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war. Während in den folgenden Wochen noch über die Unfallursache gerätselt wurde, berichtete die Presse über das Schicksal der überlebenden Ruth Horn, die erst drei Tage vor dem Unglück in Rom geheiratet hatte und deren Bräutigam nicht mehr gerettet werden konnte. Besonderes Aufsehen erregte der Umstand, dass das Flugzeug mit fünfhundert Kilo Goldbarren beladen war, von denen neun Kilo zunächst vermisst wurden. Erst bei der Überprüfung der Passagierliste stellte sich heraus, dass sich unter den Opfern auch zwei ganz besondere Reisende befanden. Es handelte sich um die Berater einer israelischen Reparationskommission, die im niederländischen Den Haag an den Wiedergutmachungsverhandlungen mit Westdeutschland teilnehmen sollten.
1
Montag, 31. März 1952
Na, Herr Kommissar?« Der Kioskbesitzer zwinkerte Oppenheimer amüsiert zu. Die Schirmmütze mit den Ohrenklappen und das wettergegerbte Gesicht verliehen ihm an diesem frostigen Morgen das Aussehen eines Polarforschers. »Wolln Se die neuesten Meldungen über dit Flugzeugunjlück?«
Der Mann kannte seine Kunden. Und er wusste genau, dass Oppenheimer ein neues Nachrichtenthema gefunden hatte, über das er alles wissen musste, wenn er in den frühen Morgenstunden an der S-Bahn-Station Papestraße auftauchte und sich gleich mehrere Tageszeitungen griff. Und heute musste ihm das Thema besonders wichtig sein, da er sogar den Wintertemperaturen und Schneeböen trotzte.
Oppenheimer legte den schweren Papierstapel auf die Theke und zückte die Geldbörse.
»Sie meinen die Sache in Frankfurt? Das hatte ich nicht mehr im Blick. Ich war eher an der Adenauer-Bombe interessiert.«
Der Kioskinhaber nahm das Kleingeld entgegen. Ehe er die Groschen zählte, winkte er ab.
»I wo. Is doch nix dahinta. Die Bombe is ihm doch nie jefährlich jeworden. Dit Paket wurd in München abjefangen, und unser Konrad, der sitzt doch in Bonn! Ick weeß nich, warum die so’n Aufstand deswegen machen. Da sind doch bestimmt noch viel mehr Briefbomben unterwegs, von denen wir sonst nix wissen. Sie von der Kripo ham doch bestimmt ’ne Ahnung, oder?«
Der Mann blickte ihn fragend an. Doch Oppenheimer zuckte nur mit den Schultern und antwortete: »Weiß nicht, das fällt nicht in mein Ressort. Ich bin nur für Mörder zuständig.« Er klemmte die zentimeterdicken Presseerzeugnisse unter den Arm. »Ich muss wieder mehr Zeitung lesen. In der letzten Zeit ist so viel in der Welt geschehen, dass ich kaum noch einen Überblick habe.«
»Ja, et stimmt schon.« Der Kioskinhaber nickte und rieb sich die klammen Hände. »Manchmal passiert jahrelang nix, und dann braucht et nur ’n paar Wochen, und die janze Weltjeschichte spielt sich ab. Wissen Se noch damals, als die Russen hier in Berlin einjefallen sind?«
»Jaja, die schlechte alte Zeit«, sagte Oppenheimer leichtherzig. Er tippte zum Abschied an seine Hutkrempe und stieg dann die Treppe zur Ringbahn hinauf.
Erst als er an der nächsten Station in die U-Bahn umgestiegen war, kam er dazu, sich den Zeitungen zu widmen. Eingekeilt zwischen anderen Pendlern lockerte Oppenheimer den Schal, schob sich den Hut in den Nacken und faltete die erste Zeitung auseinander.
Soweit er verstand, hatte am vergangenen Donnerstag ein unbekannter Mann vor dem Hauptbahnhof München zwei Jungen für ein geringes Trinkgeld damit beauftragt, ein merkwürdiges Päckchen zur nächsten Poststelle zu bringen und dort für ihn abzuschicken. Die Sendung war an Bundeskanzler Adenauer in Bonn adressiert. Doch den Buben kam die Situation merkwürdig vor, denn der Mann war ihnen die ganze Zeit über auf den Fersen geblieben. Schließlich wandten sie sich an einen Polizisten, woraufhin der Fremde sofort die Flucht ergriff und in der Menge verschwand.
Angesichts der verdächtigen Umstände wurde das Päckchen zum Münchner Polizeipräsidium gebracht. Bei der Untersuchung im ehemaligen Luftschutzkeller stellte sich heraus, dass es sich um einen Sprengsatz handelte. Während der Entschärfung war die Bombe detoniert und der Sprengmeister tragischerweise ums Leben gekommen.
Enttäuscht runzelte Oppenheimer beim Überfliegen der neuen Artikel die Stirn. Es wurde die altbekannte Meldung wiederholt, dass die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen hatte und die bayerischen Kriminalbeamten mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiteten. Die einzige neue Information war eine nach den Angaben der Jungen erstellte Phantomzeichnung. Interessiert hob Oppenheimer die Zeitung höher, um das Bild zu studieren. Es zeigte das Halbprofil eines Mannes mit dichten Augenbrauen unter der Hutkrempe, ausgeprägten Wangenknochen und einem länglichen Kinn. Das sanfte Lächeln auf der Zeichnung fand Oppenheimer das vielleicht am meisten irritierende Detail. Eine Großfahndung war längst angelaufen. Dass in den fast vier Tagen seit dem Vorfall noch keine Festnahmen gemeldet wurden, sprach allerdings dafür, dass die Aufklärung des Attentatsversuchs nicht so rasch wie erhofft über die Bühne ging.
Ungeachtet des fehlenden Fahndungserfolgs war die an den Kanzler adressierte Höllenmaschine immer noch eine Sensationsstory, die von den Gazetten mit viel Druckerschwärze, Papier und Erfindungsgabe weiter am Kochen gehalten wurde. Der Kanzler war zum Glück niemals ernsthaft in Gefahr gewesen, also versuchten die Reporter jetzt, die eher heiteren Aspekte dieses beunruhigenden Vorfalls hervorzuheben. Ausführlich berichteten sie über den am Freitag anberaumten Lokaltermin vor dem Münchner Hauptbahnhof, bei dem die beiden Detektivbuben inmitten einer Schar neugieriger Passanten die Paketübergabe nachgestellt hatten. Für den nächsten Nachmittag hatte Adenauer die Buben sogar nach Bonn eingeladen, um sich im Bundeskanzleramt persönlich bei ihnen zu bedanken.
»Eine verrückte Welt.« Oppenheimer seufzte und faltete die Zeitungen wieder zusammen.
Acht Stunden später traf in der Passstelle der westdeutschen Botschaft in Den Haag eine ganz besondere Postlieferung ein. Im Nachbarort Wassenaar hatten am vergangenen Wochenende die Reparationsverhandlungen zwischen Israel und Westdeutschland begonnen. Und deshalb waren die Mitarbeiter der Botschaft im Vorfeld fast rund um die Uhr beschäftigt gewesen, um für die von Bonn entsandten Delegationsteilnehmer eine standesgemäße Unterkunft zu organisieren. Weder Mühen noch Kosten wurden dabei gescheut, und so war die Wahl schließlich auf das idyllisch gelegene Kasteel de Wittenburg gefallen. Mit dem Turm und der weitläufigen Parkanlage ähnelte der um die Jahrhundertwende erbaute Landgasthof allerdings eher einem Schloss, und praktischerweise lag er nur knapp zwei Kilometer von dem Tagungsort Kasteel Oud-Wassenaar entfernt, einer opulent gestalteten Burg aus nahezu derselben Epoche.
Die Reparationsverhandlungen würden mit Sicherheit mehrere Wochen in Anspruch nehmen, denn zwischen den Vertretern beider Staaten gab es eine Menge zu klären. Das NS-Regime hatte einen Massenmord an europäischen Juden begangen, daran herrschten nur unter völlig verbohrten Ewiggestrigen noch Zweifel. Eine kontrovers diskutierte Frage war dagegen, ob die deutschen Nachfolgestaaten rein rechtlich dafür aufkommen mussten. Andere stellten infrage, ob ein Geldbetrag – egal, wie hoch er ausfallen mochte – für diese unvorstellbaren Gräueltaten überhaupt angemessen war. Die Knesset, das Parlament des Staates Israel, hatte bei seiner Entscheidung für die Aufnahme der Verhandlungen eine Entschädigung von 6,3 Milliarden D-Mark in den Raum gestellt. Beobachter gingen davon aus, dass hinter verschlossenen Türen ausgelotet wurde, unter welchen Bedingungen die israelische Regierung bereit war, diese Forderung zu reduzieren.
Da die Verhandlungen seit dem Morgen in vollem Gang waren, konnten die Mitarbeiter der Botschaft wieder zu ihrer Routine zurückkehren. Dies galt auch für die Angestellten der Passstelle in der Nieuwe Parklaan, zu deren Aufgaben es gehörte, die täglich eingehende Post zu öffnen und dann ordentlich sortiert an die Empfänger im Haus weiterzuleiten. Mehrmals am Tag kamen neue Lieferungen herein, die Spätzustellung erfolgte üblicherweise gegen sechzehn Uhr. Auch bei der letzten Lieferung an diesem Tag spie der Postsack wieder eine wahre Flut von Kuverts auf den Schreibtisch. Der Rest gehörte zur Routine. Die Leute in der Passstelle teilten sich die Briefe untereinander auf, setzten sich an ihre Schreibtische und zückten die Brieföffner.
Einer der Mitarbeiter griff nach einem großen Kuvert aus starkem braunem Papier. Die Sendung war etwas dicker als gewöhnlich, möglicherweise hatte jemand einen Hefter verschickt. Ahnungslos schob der Angestellte die Spitze des Brieföffners unter die zugeklebte Lasche. Eine Bewegung, die er bereits so oft wiederholt hatte, dass sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen war. Er begann, den Metallspatel durch den Falz zu ziehen. In dem Moment, als die Ecke des Kuverts zerriss, fiel sein Blick zufällig auf die Adresse. In einem eigentümlichen Gemisch aus Niederländisch und Deutsch stand dort zu lesen, dass die Sendung an die AMBASSADE DER BUNDESREPUBLIEK DUITSLAND adressiert war und von dort an die Deutsche Delegation für Wiedergutmachung (Deutschland – Israel) weitergeleitet werden sollte.
Der Mann starrte mit gerunzelter Stirn auf die Beschriftung. Dieser Brief gehörte nicht hierher! Er musste sofort zu den richtigen Empfängern überstellt werden. Zwar war das Kuvert jetzt halb geöffnet, doch das ließ sich nicht mehr ungeschehen machen.
Wenig später traf im Kasteel de Wittenburg ein Bote mit dem Brief für die deutsche Delegation ein. Fräulein Unkel vom Auswärtigen Amt war gerade an der Rezeption zugegen und nahm arglos die Sendung in Empfang. Kurz musterte sie die Beschriftung, doch nichts verriet, an welchen der Delegationsteilnehmer das Schreiben gerichtet war. Fräulein Unkel stutzte, als sie erkannte, dass die Lasche seitlich halb aufgerissen war. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie ein verräterisches Stück Draht, das aus der Öffnung ragte. Die junge Frau rang nach Luft. Ein einziger Gedanke jagte ihr durch den Kopf. Hielt sie etwa eine Bombe in den Händen?
Es erschien ihr angeraten, ihren Vorgesetzten zu verständigen. Mit schnellen Schritten stieg Fräulein Unkel die breite Holztreppe hinauf, eilte den schmalen Korridor entlang und klopfte an die Tür des Zimmers, in das sich ihr Chef zurückgezogen hatte. »Herr Frowein?« Dann klopfte sie ein zweites Mal an, diesmal dringender.
Die Tür wurde geöffnet, und Frowein blinzelte sie an. Er hatte den Knoten der Krawatte gelockert, trug aber immer noch sein graues Jackett. Mit einem leichten Tadel in der Stimme fragte er: »Was gibt es denn, Fräulein Unkel?«
Die Sekretärin streckte ihm den Brief entgegen und wies auf die angerissene Lasche.
»Der hier ist gerade angekommen. Das ist kein normaler Brief. Hier ist ein Stück Draht!«
Frowein stutzte. Sofort hatte er den Ernst der Lage erfasst. Wie üblich tat er sein Bestes, sich die Aufregung nicht anmerken zu lassen. Schließlich gehörte es zu seiner Position, sich keine Blöße zu geben.
»Sehen wir uns das mal genauer an«, murmelte er. Vorsichtig nahm er das Kuvert entgegen und trat in seine Suite. Fräulein Unkel folgte ihm einige Schritte, blieb in der kleinen Diele stehen und beobachtete, wie Frowein den Brief am großen Fenster gegen das Licht hielt. Vorsichtig hob er die Lasche hoch und spähte mit zusammengekniffenen Augen hinein.
Nach einigen Sekunden sagte er mit gesenkter Stimme: »Fräulein Unkel, wären Sie so gütig, die Polizei zu rufen?« Wie in Zeitlupe trug er den Brief zum Schreibtisch, um ihn dort behutsam abzulegen.
»Wenn man bedenkt, dass sie uns heute früh erst vor einem Anschlag gewarnt haben«, sinnierte Frowein, ein wenig bleich um die Nase. Dann atmete er tief durch und blickte Fräulein Unkel direkt ins Gesicht. »Die Polizei soll Leute herschicken, um eine Bombe zu entschärfen.«
2
Montag, 31. März 1952 – Dienstag, 1. April 1952
Isaak Rosen vom Mossad bremste ab und riss den Lenker herum. Inmitten der beschaulichen Wohngegend mit den weitläufigen Vorgärten konnte man die Einfahrt zum Kasteel de Wittenburg leicht verpassen. Und besonders dann, wenn man sich in großer Eile befand.
Kaum dass Rosen sein Auto zwischen den weiß gestrichenen Steinpfeilern hindurchgelenkt hatte, trat er bereits wieder auf das Gaspedal und ließ die Kupplung kommen. Ohne Rücksicht auf Verluste donnerte er über den schmalen Waldweg zum Landgut.
Schon seit Tagen nagte an ihm die stete Sorge, dass alles schieflaufen würde und die Sicherheitsvorkehrungen umsonst gewesen waren. Nachdem Rosen die deutschen Kollegen der Organisation Gehlen mehrmals eindringlich darauf hingewiesen hatte, dass dem Mossad glaubhafte Hinweise für ein Attentat auf die deutsche Delegation vorlagen, nahmen sie ihn endlich ernst. Ursprünglich sollten die Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen Westdeutschland und Israel in Brüssel stattfinden. Doch Rosen hielt die belgische Hauptstadt als Verhandlungsort nicht für sicher genug. Erst als der britische Geheimdienst dieselbe Warnung wie Rosen ausgesprochen hatte, waren sich die Geheimdienstler einig geworden, die Verhandlungen nach Den Haag zu verlegen.
Diese Genugtuung, auf der richtigen Spur gewesen zu sein, besaß allerdings einen bitteren Beigeschmack, denn es waren neue Informationen aufgetaucht, denen zufolge selbst das idyllische Örtchen Wassenaar den Diplomaten keine vollständige Sicherheit bot. Seit gestern Nachmittag lag klar auf der Hand, dass sich etwas anbahnte. Seine Kollegen vom Mossad hatten die Warnung zum Glück noch rechtzeitig an Rosen weitergetragen. Seitdem war er nicht mehr zum Schlafen gekommen.
Sein Auto schoss durch ein weiteres Steinportal. Der kurvenreiche Weg wurde schmaler und endete unvermittelt auf einem weitläufigen Platz. Rosen bog nach rechts ab und fuhr über den prasselnden Kies. Am Kopfende des Platzes ragte vor ihm das Landhaus auf. Für das pittoreske Backsteingebäude mit seinem Turm, den Stufengiebeln und den schwarz-weiß gemusterten Fensterläden hatte er jetzt allerdings keinen Blick. Die Verhandlungen im nahe gelegenen Kasteel Oud-Wassenaar waren für diesen Tag so gut wie beendet, und die deutsche Verhandlungsdelegation würde bald in ihr Quartier zurückkehren. Doch vorher wollte Rosen die Lage lieber noch einmal klären.
Er hielt direkt vor dem Eingang und sprang aus dem Auto. Der Hotelpförtner in der weinroten Uniform trat aus dem Haus, blieb bei Rosens Anblick jedoch sofort stehen. Er wusste, dass es keine Koffer für ihn zu tragen gab, wenn der Mossad-Agent zu seinen regelmäßigen Inspektionen aufkreuzte. Zur Begrüßung lüftete der Portier seinen Zylinder und fragte schmunzelnd: »Eine neue Runde durch das Haus, Mijnheer?«
Trotz seines inneren Aufruhrs rang sich Rosen ein Lächeln ab und nickte dem älteren Herrn zu. Über das schwarz-weiße Schachbrettmuster des Bodens trat er zur Rezeption und betätigte die Glocke. Noch ehe ein Hotelangestellter auftauchte, hörte er eilige Schritte auf der Treppe. Eine junge Dame mit hochrotem Kopf erschien und hielt direkt auf die Rezeption zu.
»Ausgerechnet jetzt ist niemand hier«, schimpfte sie und rang die Hände.
Rosen erstarrte. »Was ist geschehen?«
Zwischen hastigen Atemzügen antwortete das Fräulein: »Eine Briefbombe. Oben bei Herrn Frowein. Die Polizei muss sofort kommen!«
Ohne zu zögern, beugte sich Rosen über den Tresen und griff nach dem Telefon. Die Nummer der örtlichen Polizei kannte er auswendig. Der Sprengsatz war noch nicht detoniert, also forderte er zur Polizeistreife gleich einen Sprengmeister an.
Unterdessen war der Pförtner zu ihnen getreten. Die Aufregung hatte den ruhigen Herrn in Erstaunen versetzt.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Rosen wandte sich ihm zu. »Die Gäste müssen evakuiert werden. Holen Sie jeden zur Hilfe heran. Pagen, Kellner, ganz egal. Das Haus gehört komplett geräumt!«
Der Pförtner schluckte hart und nickte dann. Während er geschäftig forteilte, sagte Rosen zu der jungen Frau: »Und Sie zeigen mir jetzt die Bombe.«
Die meisten Gäste waren zum Glück noch unterwegs, und so war das Hotel schnell geräumt. In dem menschenleeren Gebäude stand Rosen schließlich im Zimmer von Herrn Frowein und starrte auf die Briefbombe. Von draußen drangen aufgeregte Stimmen der Gäste herein, die sich auf dem Vorplatz in Sicherheit gebracht hatten.
Viel mehr gab es für Rosen nicht zu tun. Alles war gesichert. Nachdem er sich ein letztes Mal vergewissert hatte, dass sich niemand in den Zimmern befand, zog er die Tür hinter sich zu und lief zur Treppe, um dort auf die Polizei zu warten. Die nächsten Minuten waren eine Geduldsprobe. Es fiel Rosen schwer, still zu stehen. Das Schlimmste war eingetroffen, und er musste sich darauf einstellen. Die Bombe hatte es sehr nahe an ihren Bestimmungsort geschafft. Das nächste Mal würde es vielleicht nicht mehr so glimpflich ausgehen. Rosen ahnte, dass ein weiterer Attentatsversuch nur eine Frage der Zeit war.
Er überlegte, was diese Situation für Konsequenzen nach sich ziehen würde. Die Sicherheitsmaßnahmen für die Delegation mussten erhöht werden, aber der Mossad mit seinen paar Agenten vor Ort konnte das unmöglich allein bewerkstelligen. Und zur Polizei hatte Rosen kein allzu großes Vertrauen.
Die beste Lösung war wohl, sich an die Organisation Gehlen zu wenden, selbst wenn Rosen sich ein wenig scheute, mit ihnen in Kontakt zu treten. Diese überheblichen deutschen Geheimdienstler hatten ihn wie einen dummen Jungen abgekanzelt. Lag diese Reaktion vielleicht daran, dass er Jude war? Bestimmt war bei der Organisation Gehlen – genauso wie in anderen westdeutschen Behörden – ein Großteil der Stellen mit ehemaligen Nazis besetzt. Und dass sie weiterhin ihre alten rassistischen Vorurteile pflegten, erschien da nicht verwunderlich. Nur ein einziger Gehlen-Mann hatte ihm Glauben geschenkt. Sein Name war Dorn.
Rosen fasste den Entschluss, diesen Dorn heute noch anzurufen und ihm so lange auf die Nerven zu gehen, bis er die Sicherheitsmaßnahmen im Hotel verstärkte.
Oppenheimer und sein Assistent Kubelik gingen an diesem Tag alte Einsatzprotokolle durch. Die zusammengeschobenen Tische der Assistenten waren mit Aktenordnern und Heftern übersät. Kubeliks Anzug raschelte, als er sich vorbeugte, um nach weiteren Papieren zu greifen. Mit seinen durchtrainierten Armen und einer Rückenpartie, die jedem Profischwimmer zu Ehren gereicht hätte, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu seinen Hosen extragroße Jacken zu kaufen und diese vom Schneider umarbeiten zu lassen.
Oppenheimer konnte Kubeliks Probleme nachvollziehen. Lange Zeit über hatte auch ihm Kleidung von der Stange nicht gepasst. Seine Schulterpartie war schon immer recht ausladend gewesen, sodass die Anzugjacken meistens um die Hüfte schlackerten, während sie um die Brust stramm saßen. Jetzt war der Unterschied nicht mehr ganz so auffällig, denn seitdem in Berlin wieder alle Lebensmittel frei verfügbar waren, hatte er eine verhängnisvolle Vorliebe für Kuchenbrot entwickelt, was seine Körpermitte in die Breite gehen ließ.
Auch heute hatte Oppenheimer wieder Gebäck organisiert und eine Kanne echten Bohnenkaffee aufgesetzt, um während der eintönigen Arbeit seine grauen Zellen zu stimulieren.
Es würde noch lange dauern, bis sie alle Protokolle durchgeforstet hatten. Sie ermittelten gerade in einem Mord an einem Buchmacher für illegale Wetten. An Verdächtigen herrschte kein Mangel. In der Vergangenheit war die Polizei mehrmals auf den selbst ernannten Wettkönig aufmerksam geworden, und Oppenheimer hoffte, in den alten Aufzeichnungen auf handfeste Mordmotive zu stoßen.
Beim Blättern durch die Schnellhefter hielt er plötzlich inne. Verblüfft starrte er auf das Papier. »Was, in aller Welt, ist denn das?«
Gespannt richtete Kubelik sich auf und fragte: »Haben wir einen Verdächtigen?«
Oppenheimer schüttelte den Kopf. »Das nicht, aber … Jetzt hör dir das mal an.« Er las aus dem Protokoll vor. »Hier steht: Es wurden Exkremente beschworen.« Er ließ den Hefter wieder sinken. »Wer schreibt denn so was? In einem offiziellen Dokument?«
Breit grinsend antwortete Kubelik: »Vielleicht ist der Kollege ein verhinderter Schriftsteller?«
»Der ist dann aber schon sehr verhindert«, grummelte Oppenheimer und blätterte kopfschüttelnd weiter.
Kurz vor Feierabend klopfte es an der Bürotür. Oppenheimer wandte sich auf seinem Stuhl um und sah, wie sich Seeßlen durch den Türspalt beugte. Er wirkte seltsam bedrückt. Nach einem raschen Seitenblick auf Kubelik schob ihr Dienststellenleiter seine kreisrunde Brille auf der Nase zurecht – eine Verlegenheitsgeste, die mittlerweile alle Mitarbeiter kannten. Um zu überspielen, dass er nach Worten suchte, räusperte er sich und sagte dann schließlich: »Oppenheimer, ich muss mit Ihnen reden. In meiner Schreibstube.«
Oppenheimer nickte. »Wir sind gleich fertig.«
Nach dieser Bestätigung verschwand Seeßlen wieder und zog sanft die Tür hinter sich zu.
»Was hat er denn?«, raunte Kubelik.
»Das werde ich gleich erfahren.« Oppenheimer seufzte und griff reflexartig nach der letzten Scheibe Kuchenbrot.
In Seeßlens Büro wurde Oppenheimer nicht wie sonst von dem üblichen Durcheinander empfangen. Zugegeben, der Schreibtisch war immer noch mit Aktenordnern und losen Papieren überhäuft, doch Oppenheimers Chef hatte sich an diesem Tag die Mühe gemacht, wenigstens einen Besucherstuhl frei zu räumen.
Diese Vorzugsbehandlung gefiel Oppenheimer nicht. Misstrauisch geworden trat er ein und setzte sich vor das Bogenfenster. Für Seeßlen war Kollegialität normalerweise ein Fremdwort, doch jetzt wagte er sich hinter seinem Schreibtisch hervor und zog einen zweiten Stuhl heran, um sich neben Oppenheimer niederzulassen. Vertraulich senkte er die Stimme.
»Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir Sie noch im Kripodienst behalten können.«
Oppenheimer holte tief Luft. Also daher wehte der Wind.
»Wharton macht also wieder Ärger«, stellte er mit tonloser Stimme fest.
Seeßlen nickte zur Bestätigung. Bei der Aufklärung der letzten großen Mordserie war Oppenheimer dem US-Colonel in die Quere gekommen. Whartons damalige deutsche Mätresse war das erste bekannte Opfer gewesen. Obwohl der Colonel darauf pochte, dass nur Russen dahinterstecken könnten und die US-amerikanische Militärpolizei eingeschaltet hatte, war Oppenheimer unbeirrt den Spuren gefolgt. Besonders peinlich für Wharton war, dass der tatsächliche Mörder ausgerechnet ein Soldat seiner eigenen Truppen gewesen war. Die Schmach versuchte er nun zu kompensieren, indem er völlig aus der Luft gegriffene Vorwürfe gegen Oppenheimer richtete. Wharton hatte sich sogar dazu verstiegen, ihn als verkappten Kommunisten anzuschwärzen, eine geradezu absurde Behauptung, die rasch entkräftet werden konnte.
»Ich dachte, er würde sich früher oder später wieder abregen«, gab Seeßlen zu. »Aber nein, Wharton gefällt sich wohl in der Rolle als Ihre Nemesis. Er hat in den letzten Wochen weiter nachgeforscht. Jetzt steht die Behauptung im Raum, dass Sie die Tötung des Mörders nicht verhindert hätten, obwohl Sie dazu imstande gewesen wären. Und dann wirft er Ihnen vor, dass Sie sich einfach aus dem Staub gemacht haben, anstatt zu der Aufklärung des Vorfalls beizutragen.«
»Dieses Arschloch hat doch keine Ahnung«, platzte es aus Oppenheimer heraus. »Eine weitere Frau befand sich in unmittelbarer Lebensgefahr. Wir konnten sie retten, aber nur, weil ich vor Ort keine Zeit verplempert habe!«
Seeßlen machte eine beschwichtigende Geste. »Ich stehe völlig auf Ihrer Seite. Aber jetzt hat sich Wharton direkt an die Polizeidirektion gewandt. Das ist kein Sturm im Wasserglas mehr. Ich kann die Situation nicht länger entschärfen, das spielt sich fortan über unseren Köpfen ab. Diese leidige Angelegenheit war in der obersten Führungsriege wiederholt ein Thema. Sogar Dr. Stumm hat davon Notiz genommen.«
Bei der Erwähnung des Polizeipräsidenten horchte Oppenheimer auf.
»Und was ist Stumms Meinung dazu?«
Auf diese Frage hin lachte Seeßlen kurz auf. »Unser Präsident würde sich natürlich lieber mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigen. Soviel ich gehört habe, ist er nicht erfreut darüber, dass ihm die Amerikaner vorschreiben wollen, wie er seinen Laden zu organisieren hat. Nur weiß ich nicht, wie lange er sie hinhalten kann.«
Das war für Oppenheimer immerhin ein Lichtblick. Sofort überlegte er, welche Chancen sich ihm dadurch eröffneten.
»Die Kripo braucht Mitarbeiter wie mich, mit jahrzehntelanger Erfahrung. Der Stumm muss das doch sehen.«
»Ja, und Ihre hohe Aufklärungsrate lässt sich nicht so einfach ignorieren«, stimmte Seeßlen zu. »Als, nun ja, als Angehöriger der jüdischen Religion sind Sie in der NS-Zeit nachweislich unbescholten geblieben, das darf man auch nicht übersehen. Diese Argumente sprechen alle für Sie.« Um den nächsten Satz zu unterstreichen, beugte sich Seeßlen zu Oppenheimer hinüber. »Aber wir dürfen diesem Wharton ab jetzt keine Angriffsfläche mehr bieten!«
Oppenheimer reagierte mit einem Schulterzucken. »Und wie sollen wir das machen? Ich habe ja keine Ahnung, womit er als Nächstes ankommt.«
Für Seeßlen war die Angelegenheit dagegen ganz einfach. »Alles muss streng nach Vorschrift ablaufen. Bei Ihren Ermittlungen … keine Sperenzchen mehr! Und, Oppenheimer, reißen Sie sich bitte ein wenig zusammen und nehmen Sie ein bisschen ab. Ich möchte nicht, dass Wharton behauptet, dass Sie es nicht mehr schaffen, einen Verdächtigen zu verfolgen!«
Bei diesem Kommentar ruhte Seeßlens missbilligender Blick auf der gespannten Knopfleiste von Oppenheimers Hemd. Unwillkürlich zog Oppenheimer den Bauch ein wenig ein, allerdings ohne erkennbaren Unterschied.
»Sind wir schon so weit?« Oppenheimer wusste, dass Seeßlen nicht unrecht hatte, also fiel sein Protest nur verhalten aus. »Ist heutzutage selbst das Körpergewicht ein Politikum?«
Seeßlen stand auf. Er hatte alles gesagt, das Gespräch war für ihn damit abgehakt. Um zum Schluss zu kommen, winkte er ab und erwiderte: »Bei uns in Berlin hat einfach alles politische Implikationen. Das müssten Sie doch mitbekommen haben, Oppenheimer.«
Rosen spürte, wie ihn die Müdigkeit übermannte. Zusammengesunken saß er im Frühstückszimmer des Kasteel de Wittenburg auf einem Stuhl und goss aus dem silbernen Kännchen die letzten Tropfen Kaffee in seine Tasse. Lediglich das Koffein hielt ihn noch wach. Nach dem Bombenfund hatte er in der Nacht nur wenige Stunden geschlafen und war bereits um vier Uhr in der Früh wieder auf den Beinen gewesen.
Mittlerweile stand fest, dass die abgefangene Bombe beim Herausziehen des Briefs durch einen Faden ausgelöst werden sollte. Darüber hinaus fanden die Sprengmeister eine flach gedrückte Miniaturbatterie, einen Zünder mitsamt Zündpille und dreißig Gramm TNT. Die Ladung war ausreichend, um den ahnungslosen Empfänger und weitere anwesende Personen schwer zu verletzen. Die Attentäter hatten sich sogar die Mühe gemacht, ein Bekennerschreiben aufzusetzen. Dank des Umstands, dass der Sprengsatz rechtzeitig entschärft werden konnte, lag der genaue Wortlaut des Briefs jetzt vor. Gemäß Poststempel war die Sendung in Amsterdam aufgegeben worden. Der angebliche Absender existierte natürlich nicht.
Der Landgasthof war inzwischen menschenleer. Die deutsche Delegation war vor ein paar Stunden zum Kasteel Oud-Wassenaar aufgebrochen. Rosen wollte die Zimmer der Diplomaten sicherheitshalber einer weiteren Inspektion unterziehen. Bei seiner Ankunft war die Polizeiunterstützung noch nicht eingetroffen, und so hatte er die Gelegenheit wahrgenommen, ein wenig zu essen, obwohl er keinen großen Appetit verspürte. Doch selbst mit einem Kännchen Kaffee im Magen wurden seine Augenlider allmählich schwer.
Rosens Blick fiel auf den halb hohen Kaminsims aus rotem Marmor, im Spiegel darüber blitzten Zierteller aus Delfter Blau auf. Der Gedanke schien absurd, dass finstere Mächte in diese Idylle vordrangen. Er rieb sich die brennenden Augen und schloss sie dann für einige Sekunden. Nach der Aufregung der letzten Tage war es eine Wohltat, einfach nur still dazusitzen.
»Möchten Sie noch ein Kännchen Kaffee?«
Rosen zuckte zusammen. Eine Bedienung stand an der Seite des Tisches. Die junge Frau, die Haare unter dem Häubchen zusammengesteckt, lächelte ihn an. Ihr Blick war ein wenig spöttisch, da sie ihn beim Dösen überrascht hatte. Es war mehr als die übliche Freundlichkeit gegenüber einem Gast, das spürte Rosen sofort. Obwohl er selbst kaum in den Spiegel schaute, war er sich bewusst, dass er mit den dichten schwarzen Haaren und dem markanten Kinn auf die Damenwelt attraktiv wirkte. Aber im Moment stand ihm nicht der Sinn nach Frauenbekanntschaften.
»Vielen Dank, das wäre sehr freundlich«, antwortete er. »Ein Kännchen, wäre das möglich?«
»Natürlich, Mijnheer«, sagte sie und beugte sich nach vorn, um das Geschirr abzuräumen.
Rosen sog den Duft ihres Parfums ein und warf ihr einen langen Blick nach. Der weiblichen Bedienung nachzugaffen und Vermutungen darüber anzustellen, welche Verlockungen sich unter dem schwarzen Kleid verbargen, das war immer noch besser als einzuschlafen.
Rosen griff nach der Tasse und stürzte den Rest des kalten Kaffees hinunter. Mit etwas Glück könnte er sich entspannen, sobald die Unterstützung von der Organisation Gehlen eingetroffen war. Gestern Abend war es ihm erfreulicherweise gelungen, seinen Gegenpart vom deutschen Geheimdienst an die Strippe zu bekommen. Auch Dorn war alarmiert über den Bombenfund gewesen und hatte zugesagt, am Mittwoch persönlich in Wassenaar zu erscheinen. Bis dahin lag die Verantwortung für die Sicherheit der Diplomaten wohl oder übel bei Rosen.
Die Bedienung erschien wieder, blieb jedoch in der Tür stehen, und frischen Kaffee hatte sie auch nicht dabei.
»Die Polizei ist jetzt da«, sagte sie.
Rosen sprang erleichtert auf, ohne sich um seine Bestellung zu kümmern, und lief schnurstracks zur Rezeption. Vier Uniformierte erwarteten ihn dort. Rosen gab ihnen gerade letzte Anweisungen, als er aus dem Augenwinkel wahrnahm, dass der Rezeptionist die Post sortierte.
Mitten im Satz hielt Rosen inne. Unter den fragenden Blicken der Polizisten wandte er sich dem Mitarbeiter des Hotels zu.
»Wann sind diese Briefe eingetroffen?«
Der Rezeptionist war ein mittelalter Herr mit grau meliertem Haar. Noch ehe er den Mund öffnete, antwortete einer der Polizisten: »Die haben wir mitgebracht. Wurden schon alle überprüft.«
Misstrauisch beäugte Rosen die Sendungen. Der Rezeptionist hatte bereits die ersten Briefe in die Fächer der Hotelgäste einsortiert.
»Alles wieder ausräumen und hier auf den Tresen damit«, befahl Rosen.
Der Mann stutzte. Um eine Bestätigung zu bekommen, warf er den Polizisten an Rosens Seite einen fragenden Blick zu.
»Das ist nicht nötig«, beharrte der vorlaute Polizist gestikulierend.
Rosen betrachtete ihn zum ersten Mal genauer. Er war ein junger Kerl mit hellem Flaum auf dem Kinn, vielleicht gerade mal zwanzig Jahre alt. Um weitere Diskussionen im Keim zu ersticken, beschloss Rosen, seine Autorität in die Waagschale zu werfen. Er stellte sich vor die Polizisten und stemmte die Arme in die Hüften.
»Hier hat der Mossad das Sagen. Ihr seid nur zur Unterstützung abgestellt.«
Der Rezeptionist fügte sich schließlich und legte alle neu eingetroffenen Briefe auf den Tresen. Vorsichtig untersuchte Rosen die Sendungen.
Bis er schließlich innehielt.
Ein Briefumschlag war etwas dicker als die übrigen und erinnerte an die Bombe vom Vortag. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Brief direkt an Franz Böhm adressiert war, den Leiter der deutschen Delegation.
Rosen legte ihn zur Seite. »Der hier muss wieder zurück zur Polizei und von einem Sprengmeister geöffnet werden.«
Einige der Polizisten raunten unzufrieden.
»Unsere Spezialisten haben doch alles überprüft«, beharrte der renitente junge Polizist. »Ihr vom Mossad haltet uns wohl für Idioten?«
Rosen wollte ihm bereits eine geharnischte Antwort geben, als Avi Weiss die Rezeption betrat und freundlich grüßte. Rosen hatte seinen Kollegen angefordert, damit sie den Verhandlungsort und die Unterkunft der Diplomaten lückenlos überwachen konnten. Weiss war zweiunddreißig Jahre alt und damit drei Jahre jünger als er. Seine beachtliche Körpergröße und die hellblonden Haare waren ein Geschenk der Eltern, die bereits vor seiner Geburt aus Osteuropa nach Palästina ausgewandert waren. Auf den ersten Blick ähnelte Weiss eher Jung-Siegfried als dem Klischeebild eines Mossad-Agenten.
»Habe ich was verpasst?« Weiss blickte lächelnd von Rosen zu den Polizisten.
»Ein verdächtiger Brief ist eingetroffen, Avi«, fasste Rosen zusammen, der sich nicht so recht an Avis sonniges Gemüt gewöhnen konnte. »Und die Kollegen von der Polizei wollen ihn nicht überprüfen lassen.«
Sofort begann der Polizist wieder zu maulen. »Aber die Briefe wurden bereits kontrolliert!«
Weiss machte eine beschwichtigende Geste, trat zur Rezeption und warf einen Blick auf den Tresen.
»Das ist er?«
Rosen nickte zur Bestätigung.
»Da haben wir ja Glück, dass ich mich mit Briefbomben ein wenig auskenne«, sagte Weiss. Methodisch nahm er den Umschlag in Augenschein. Dabei beugte er sich vor und achtete darauf, ihn nicht zu berühren. Als Weiss sich wieder aufrichtete, runzelte er die Stirn.
»Verdammt«, zischte er. »Wir haben hier ein Problem. Dieser rechteckige Abdruck auf dem Umschlag, siehst du ihn?«
Auf seinen Fingerzeig hin nickte Rosen.
»Das könnte von einer Batterie stammen. Oder vom Sprengsatz. Egal, auf jeden Fall muss das Ding geöffnet werden. Ich würde den Brief nicht mehr zur Polizei zurückschicken. Es ist weniger gefährlich, wenn ich das selbst erledige.«
Die Polizisten wurden unruhig. Kreidebleich starrten sie auf den Brief.
»Das … das geht nicht so einfach«, stotterte der junge Polizist, auf dessen Stirn Schweißperlen glitzerten. Dann riss er sich zusammen und fügte hinzu: »Das ist nicht die vorgeschriebene Vorgehensweise!«
Weiss seufzte und wandte sich ihm zu. »Herr Wachtmeister, machen wir es so. Ich öffne den Brief, und falls sich keine Bombe hier drin befindet, dürfen Sie mich gern wegen Missachtung des Briefgeheimnisses verhaften. Haben wir uns verstanden?«
Statt einer Antwort wich der Polizist einige Schritte zurück und hielt den Mund.
Jetzt, wo das geklärt war, übernahm Rosen wieder die Führung und fragte den Rezeptionisten: »Wo können wir den geringsten Schaden verursachen?«
Der Mann wies aufgeregt zum Eingang. »Raus. Einfach raus damit.«
Weiss übernahm das Tragen des Briefkuverts. Rosen lief ihm voraus, damit er nicht auf der Treppe stolperte. Unten auf dem Vorplatz angelangt, ging Weiss in die Hocke und legte den Brief sanft auf der Kiesfläche ab. Dann murmelte er: »Geh besser in Deckung, Isaak.«
Rosen zog sich zurück, achtete jedoch dabei, in Rufweite zu bleiben. Angespannt beobachtete er, wie Weiss sich vor dem Kuvert hinkniete und es vorsichtig an den Seiten einriss. Dann hielt er inne und nickte.
»Ja, das hier ist ein Sprengzünder. Einfache Bauart. An die Verdrahtung komme ich heran.« Er schaute zu Rosen hoch. »Wenn du mir vom Hausmeister ein paar Werkzeuge besorgst, haben wir das schnell erledigt.«
Rosen sprintete ins Hotel, um den Rezeptionisten zu unterrichten. Während sie auf den Hausmeister warteten, nahm er die Gelegenheit wahr, einen Blick auf die teilweise freigelegte Bombe zu werfen. Jetzt konnte Rosen den Aufbau der wenigen Einzelelemente erkennen. Es wirkte wie der Versuch eines technikbegeisterten Schuljungen. Doch diese Bastelarbeit barg eine tödliche Überraschung.
Weiss murmelte: »Die zweite Bombe innerhalb von vierundzwanzig Stunden.«
3
Dienstag, 1. April 1952
Der Taxifahrer trat auf das Gaspedal. Oppenheimer spürte, wie er sanft in den Rücksitz gedrückt wurde. Das Auto hatte irgendwie den Krieg überstanden, und seine Polster waren bereits so durchgesessen, dass jede einzelne der Federn ihm in den Rücken stach. Unterdessen betrachtete Lisa aus dem Seitenfenster die Straße. Als sie sich der aufragenden Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche näherten, wurde sie unruhig. Gleich war das Ziel ihrer Fahrt erreicht, der Bahnhof Zoo.
»Na, dann wollen wir mal«, sagte Oppenheimer. Der Versuch, diesen Satz aufmunternd klingen zu lassen, ging kläglich schief. Lisa warf ihm einen unsicheren Blick zu und nickte dann. Mit dem nächsten Interzonenzug aus Köln würde die Mutter ihres Pflegesohns Theo eintreffen. Und damit stand ihnen ein ernstes Gespräch bevor, das darüber entscheiden würde, ob die Tage ihrer kleinen Ersatzfamilie gezählt waren.
Oppenheimer fand, dass es genau der falsche Zeitpunkt für eine Entscheidung war. Er hatte bereits genügend andere Probleme. Whartons Versuche, ihm das Leben schwer zu machen, waren in den letzten Monaten eine ständige Irritation gewesen, die er zwar meistens mit einem Schulterzucken sofort ad acta legen konnte, doch die neue Anschuldigung war von einem ganz anderen Kaliber. Oppenheimer war die Geschehnisse bereits mehrmals in Gedanken durchgegangen, denn auch er fühlte sich schuldig, weil der Mörder vor seinen Augen getötet worden war. Er hatte einfach zu spät reagiert. Um es noch schlimmer zu machen, war er dann auch noch davongestürmt, um seine gute Freundin Rita vor dem sicheren Tod zu retten. Whartons Behauptung, dass Oppenheimer bewusst nicht verhindert habe, dass der Mörder vom Chauffeur der Familie Leary brutal hingerichtet wurde, ließ sich kaum belegen. Doch der reine Verdacht reichte bereits aus, um seine berufliche Existenz zu bedrohen. Schlussendlich kam es wohl darauf an, ob die Vorgesetzten Oppenheimer auch weiterhin das Vertrauen schenkten.
Besorgt rieb er sich die Stirn. Er spürte, dass sein Blutdruck viel zu hoch war. Unterdessen glitt das Taxi an den Straßenrand und kam zum Stillstand. Normalerweise gönnte sich Oppenheimer selten den Luxus einer Taxifahrt, aber an diesem Tag hatten er und Lisa keine andere Wahl gehabt, um es noch rechtzeitig zum Bahnhof zu schaffen. Erst auf dem Rückweg von der Arbeit war ihm bewusst geworden, dass es auch noch ein Leben jenseits des Polizeipräsidiums gab und an diesem Tag Theos Mutter eintreffen würde.
Lisa öffnete die Autotür und stieg aus, während Oppenheimer sich nach vorn beugte, um zu bezahlen. Sie wartete vor dem grauen Kasten des Bahnhofsgebäudes. Obwohl die Bahnverwaltung in den letzten Jahren bereits die nötigsten Sanierungsarbeiten durchgeführt hatte, war die Dachkonstruktion immer noch ein stählernes Gerippe, in dem die Verglasung fehlte. Als Oppenheimer sich zu Lisa gesellte, nickte sie zur großen Uhr an der Hochbahnbrücke. »Wir haben noch etwas Zeit.«
»Das ist ja schlimmer, als auf den Zahnarzt zu warten«, sagte Oppenheimer unzufrieden, woraufhin Lisa ihm ein Lächeln zuwarf.
»Das kommt ganz auf den Zahnarzt an. Ist der Bangemann denn wirklich so schlimm?«
Auf seinen letzten Zahnarztbesuch angesprochen, blies Oppenheimer die Wangen auf. »Dieser Kerl ist eine öffentliche Gefahr! Der Bangemann könnte genauso gut als Metzger Arbeit finden. Wenn er nicht der Angebetete von Hilde wäre, würde ich einen großen Bogen um ihn machen.«
Als ein Passant im Vorbeilaufen gegen ihn stieß, nahm er Lisa kurz entschlossen am Arm und führte sie zum Bahnhof. »Gehen wir rein. Wir können genauso gut auf dem Bahnsteig warten. Da ist bestimmt weniger Betrieb.«
Der Interzonenzug traf mit zwanzig Minuten Verspätung ein. Dies war sein einziger Halt in der westlichen Stadtzone von Berlin. Nach einem kurzen Stopp würde er zur Endstation Berlin Friedrichstraße weiterfahren, die sich im Ostteil befand. Doch die meisten Passagiere stiegen bereits hier aus.
Gespannt musterten Oppenheimer und Lisa den Strom der Reisenden.
»Hast du eine Ahnung, wie Frau Kallinich aussieht?«
»Frau Götz heißt sie jetzt«, korrigierte Lisa ihn. »Ich hatte sie bislang nur am Telefon, das weißt du doch.«
»Die hat wirklich Nerven! Erst lässt sie Theo hier in Berlin zurück, und jetzt kommt sie plötzlich wieder an.«
Lisa war es unangenehm, dass er vor sich hin meckerte, und sie gab ihm ein Zeichen, still zu sein. Oppenheimer klappte den Mund zu. Er wusste selbst, dass seine Vorwürfe übertrieben waren, denn viele ähnliche Schicksale hatten sich damals in Berlin und anderswo abgespielt. Als die Rote Armee im Januar 1945 ihre große Offensive auf Ostpreußen gestartet hatte, die das Ende des Naziregimes einläuten sollte, war Frau Kallinich mit ihrem Sohn Theo und seiner Schwester in Richtung Westen geflohen. Die Familie wurde am Anhalter Bahnhof getrennt, und Theo hatte sich in den folgenden Monaten recht erfolgreich als Stadtvagabund durchgeschlagen, bis er schließlich Oppenheimer über den Weg gelaufen war.
Oppenheimer blickte in die Gesichter der Passagiere und hielt Ausschau nach einer Frau, in deren Miene diese Geschichte vielleicht Spuren hinterlassen hatte. Die kleine Familie, die suchend am Bahnsteig stand und sich schließlich auf ihn zubewegte, nahm er dabei gar nicht so richtig wahr.
Die Frau trat an Oppenheimer und Lisa heran.
»Sie haben so einen suchenden Blick«, begann sie. »Sind Sie zufällig die Oppenheimers?«
Oppenheimer stutzte. Die Frau war Mitte bis Ende dreißig und in einen unförmigen schwarzen Wollmantel gehüllt. Sie führte ein etwa zehnjähriges Mädchen mit hellblonden Zöpfen an der Hand. An ihrer Seite schritt ein fade aussehender Herr mit dunklem Schnauzbart und Anzug. Sein Mund wirkte seltsam verkniffen.
Noch ehe Oppenheimer antworten konnte, sagte Lisa: »Sie sind dann wohl Frau Götz?«
Frau Götz nickte und zeigte auf ihre Tochter. »Und das hier ist Gisela.«
Der Mann an ihrer Seite richtete seine blassgrauen Augen auf Oppenheimer und drückte ihm förmlich die Hand. »Götz«, stellte er sich vor. Dasselbe wiederholte er bei Lisa.
Nach der Begrüßung standen sie zunächst unschlüssig beieinander.
»Ich hatte nach Theo Ausschau gehalten«, beendete Frau Götz das Schweigen. »Ich dachte, er kommt auch mit.«
»Er ist gerade unterwegs«, erklärte Oppenheimer. »Theo verdient sich Taschengeld am Potsdamer Platz. Aber gleich erwartet er Sie in unserer Wohnung.«
Frau Götz warf ihrem Gatten einen flehentlichen Blick zu. Doch auf der Stelle wiegelte dieser ab: »Das werden wir nicht mehr schaffen. Ich bleibe nicht länger als nötig.«
Er blickte auf die Deckenkonstruktion des Bahnhofs, in die von der Seite der Wind pfiff.
»Ein einziger Schrotthaufen, dieses Kaff.« Herr Götz schüttelte demonstrativ den Kopf.
Augenblicklich wurde er Oppenheimer unsympathisch.
»Ganz so schlimm ist es nicht«, widersprach er. »Immerhin, Berlin steht noch.«
»Tja, und dafür dürfen wir Steuerzahler auch ordentlich Geld berappen!« Herr Götz spielte auf das Berlinförderungsgesetz an, das in Westdeutschland vor etwas mehr als zwei Jahren in Kraft getreten war und eine Reihe von Steuervergünstigungen und Subventionen für die isolierte Metropole reglementierte. »Und dann noch die Schikanen bei der Durchreise durch den Sowjetsektor«, setzte Herr Götz seine Klagen fort. »Zwei geschlagene Stunden haben die roten Kontrolleure den Zug an der Grenze stehen lassen. Alles wurde durchsucht, als würden wir Atombomben schmuggeln! Und ich glaube, die waren extra langsam. Wenn ich gewusst hätte, wie kompliziert es ist, diese Interzonenpässe zu bekommen, hätte ich es gleich sein lassen. Eigentlich wollte ich mit dem Auto fahren, aber da ist jetzt eine Maut fällig, habe ich gehört. Also sind wir mit dem Zug rüber. Aber das war noch schlimmer!«
Oppenheimer runzelte die Stirn und seufzte. »Leider haben Sie keine günstige Zeit erwischt. Es ist gut möglich, dass die Kontrollen momentan gründlicher als gewöhnlich sind. Die DDR-Behörden machen Schwierigkeiten, wo sie nur können. Aber das kennen wir ja schon von der Sowjetadministration.«
Herr Götz war an den weiteren Details nicht interessiert. Nur mit einem halben Ohr hörte er zu, als Oppenheimer zu erklären versuchte, dass die DDR Anfang März die Stromlieferungen nach Westberlin unterbrochen hatte. Natürlich wurden als Grund dafür wieder angebliche technische Probleme angeführt, die alte Lieblingsausrede, wenn Abmachungen nicht eingehalten wurden. Mit dem Stromboykott hatte Ostdeutschland nun auch den letzten Teil des Interzonenhandelsabkommens außer Kraft gesetzt.
Das Karnevalslied Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien hatte Westdeutschland vor ein paar Jahren umbenannt und war mittlerweile so etwas wie eine inoffizielle Nationalhymne. Für die meisten war der Gassenhauer nur eine Bestätigung, dass der rheinische Frohsinn vor nichts haltmachte, doch die Bewohner von Berlin empfanden es als besonders passend, ihrer Stadt einen exotisch klingenden Namen zu verpassen, der an die Südsee erinnerte. Denn auch Westberlin erschien jetzt immer mehr wie eine Insel, die von ihrem Umland völlig abgeschnitten war.
»Sollen die Russen sich Berlin doch komplett unter den Nagel reißen, wär nicht schade drum«, brummte Herr Götz ungeduldig. »Also, bringen wir die Sache über die Bühne. Wo gibt es hier Billetts? Ich sehe zu, dass wir den nächsten Zug erwischen.«
Lisa konnte nicht glauben, was sie da hörte. »Aber dann können Sie ja Theo nicht mehr sehen«, protestierte sie. »Ich dachte, Sie bleiben eine Weile.«
Frau Götz stand mit eingezogenem Kopf neben ihrem Ehemann und schwieg.
»Fahrkarten gibt es unten«, beantwortete Oppenheimer schließlich Götz’ Frage und wies zur Treppe. Dann wandte er sich der Frau und ihrer Tochter zu. »Vielleicht suchen wir uns in der Nähe ein Café, während Ihr Gatte die Tickets besorgt? Der Ku’damm ist gleich um die Ecke.«
Herr Götz brummelte eine unverständliche Antwort, die Oppenheimer als Zustimmung interpretierte, und setzte sich in Bewegung.
Nachdem sich Herr Götz in der langen Schlange vor dem Fahrkartenschalter eingereiht hatte, war Oppenheimer froh, dem Trubel am Bahnhof entfliehen zu können. Sie verabredeten sich mit ihm in anderthalb Stunden auf dem Bahnsteig, das erschien rechtzeitig, um den nächsten Interzonenzug zurück nach Köln zu erwischen. Frau Götz gab einen erleichterten Seufzer von sich, als sie und ihre Tochter vor dem Bahnhof auf die Straße traten. Ohne die Anwesenheit ihres herrischen Gatten war sie deutlich gesprächiger. Während Oppenheimer auf dem Weg zum Ku’damm nach einem leeren Cafétisch Ausschau hielt, erklärte sie, wie es zu ihrer Vermählung gekommen war.
Oppenheimer hatte Theos Vater vor fast zwei Jahren kennengelernt. Gerade aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, war er auf dem Weg ins Ruhrgebiet gewesen, wo er seine Frau aufgespürt hatte. Von seinem ursprünglichen Plan, den Sohn Theo auf diese Reise ins Ungewisse mitzunehmen, hatte Herr Kallinich nach einigem Zureden glücklicherweise Abstand genommen. Frau Götz bestätigte Oppenheimer und Lisa nun, dass es eine gute Entscheidung gewesen war, Theo aus alldem herauszuhalten. Als Kallinich nach monatelangem Suchen endlich seine Gattin und seine Tochter Gisela aufgespürt hatte, war sie zu seiner Überraschung längst wieder verheiratet. Ihre Ehe mit Kallinich war bereits annulliert, weil er offiziell als verschollen galt. Das Wiedersehen hatte er sich anders vorgestellt. Das Ziel, endlich ein normales Leben mit seiner Familie zu führen, war zerstört.
Auf dem Weg zum Café hörte Oppenheimer Frau Götz’ Schilderungen mit einer gewissen Beklemmung zu. Und auch die tiefen Sorgenfalten in Lisas Gesicht sprachen Bände. Obwohl sie Kallinich damals in erster Linie als einen Konkurrenten um die Gunst von Theo gesehen hatte und er ihr mit seiner Besserwisserei gehörig auf die Nerven gegangen war, hatte er solch harte Prüfungen nicht verdient. Und eben dieser weitere Schicksalsschlag sollte sich nun als einer zu viel erweisen. Kallinichs Weltbild war völlig aus den Fugen geraten. Wollte man Frau Götz Glauben schenken, war ihr ehemaliger Mann jetzt ein heilloser Trinker, der weder für sich selbst noch für seine Kinder sorgen konnte.
Bereits nach wenigen Hundert Metern entdeckte Oppenheimer auf ihrem Weg ein Café mit einem freien Tisch. Kaum dass sie eingetreten waren und Platz genommen hatten, bestellte er für sie eine Kanne Kaffee und eine Tasse Kakao für Gisela.
Frau Götz nickte zu ihrer Tochter hinüber. »Kaffee trinkt sie aber auch gern.«
»Ah, ich sehe, wir verstehen uns«, sagte Oppenheimer und zwinkerte Gisela zu. Das Mädchen antwortete mit einem Lächeln. Einen Augenblick später war es bereits wieder verschwunden, und Gisela senkte den Blick. Es konnte Schüchternheit gegenüber Erwachsenen sein. Oder gab es etwa einen anderen Grund? Oppenheimer schob diesen Gedanken beiseite.
Während sie auf den Kaffee warteten, starrte Frau Götz ehrfurchtsvoll auf das feine Interieur. Stuckdecken und Wandverkleidungen aus Marmor sah sie wohl nicht alle Tage. In dem Café herrschte eine bullernde Hitze, und schon bald nahm Frau Götz ihren Hut ab und enthüllte die aschblonden Haare.
»Und wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?«, fragte Oppenheimer, um Konversation zu machen.
Frau Götz wandte sich ihm wieder zu. »Den Egon? Ach, Berlin war für uns nur eine Durchgangsstation. Die Russen standen hier doch schon vor der Tür. Wir wollten einfach so weit wie möglich nach Westen. Es war unglaublich hektisch. Das halbe Land war auf der Flucht. Und alle drängten auf einen einzigen Bahnsteig, so kam es mir vor.«
Der Kaffee wurde serviert, und nachdem Oppenheimer Frau Götz eingeschenkt hatte, nahm sie einen herzhaften Schluck. »Dieses Durcheinander können Sie sich nicht vorstellen«, fuhr sie fort. »Jedenfalls hatten wir Glück. Das dachte ich wenigstens. Wir erwischten in letzter Sekunde einen Zug aus Berlin hinaus. Wir durften nicht zögern. Kaum waren wir aufgesprungen, da fuhr er auch schon los. Die Leute standen in den Abteilen dicht gedrängt, wir kamen uns vor wie Sardinen in einer Dose. Erst nach einer Weile habe ich gemerkt, dass Theo nicht da war. Aber was konnte ich da noch tun? Ich kam aus dem Zug nicht mehr raus. Und als er dann stoppte, gab es nach Berlin keinen Weg mehr zurück. Der ganze Verkehr fuhr in die andere Richtung. Alle flohen sie vor der Front.« Mit beiden Händen umfasste sie die Tasse. »Theo ist ein fixer Bursche. Ich hoffte einfach, dass er es schafft und irgendwann nachkommt.« Frau Götz atmete tief durch. »Aber er tauchte nicht mehr auf.«
Ihr Blick fixierte Oppenheimer und Lisa. »Zum Glück weiß ich jetzt, dass Theo bei anständigen Leuten untergekommen ist. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, was Sie für ihn alles getan haben. Es lässt sich nicht in Worte fassen.«
Ihre Augen röteten sich. Frau Götz machte den Eindruck, als ob ihr diese wortreiche Rechtfertigung schon länger auf der Zunge gelegen hatte. Bestimmt hatte sie diese Geschichte schon oft wiederholt – gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst.
Die Zurschaustellung ihrer Emotionen berührte Oppenheimer peinlich. Er nickte kurz, um das Thema abzuschließen, und murmelte: »Das ist doch selbstverständlich.«
»Aber nein, das ist es nicht«, beharrte Frau Götz. Sie holte ein Taschentuch hervor, um die Tränen abzutupfen.
»Jedenfalls konnte ich an unserer Endstation auf Dauer nicht bleiben. Da erinnerte ich mich daran, dass mein Vetter in der Nähe wohnte, und habe mich auf die Suche nach ihm gemacht. Es dauerte nicht lange, ihn zu finden. Und Egon, mein jetziger Mann, er war der Vorgesetzte meines Vetters. Eine Respektsperson, ein guter Verdiener. Egon wurde im Krieg verletzt und war die letzten Monate in der Heimat eingesetzt. Und mein Mann war an der Ostfront geblieben, es gab keine Nachrichten von ihm.« Sie zuckte mit den Schultern. »Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sein Leben weiterführt. Man kann nicht ständig zurückblicken. Ich musste mir eine neue Zukunft suchen.«
Frau Götz und Lisa tauschten einen raschen Blick. Oppenheimer registrierte ihn, konnte ihn aber nicht einordnen. Nachdenklich sprach Frau Götz weiter.
»Das Leben mit Egon ist kein Zuckerschlecken«, sagte sie, während sie das Taschentuch ordentlich zusammenfaltete. »Nun ja, er hat seine Marotten wie andere Männer auch. Letztendlich muss ich froh sein, dass ich überhaupt noch einen abbekommen habe. Jedenfalls will Egon eine Familie gründen. Eine eigene Familie, wie er betont.«
Frau Götz fixierte Oppenheimer mit ihren großen Augen. Sie wartete auf eine Reaktion. Als nichts kam, beugte sich Lisa zu Oppenheimer hinüber und murmelte gerade so laut, dass Gisela es nicht verstehen konnte: »Für Theos Schwester ist da kein Platz.«
Oppenheimer hatte am Bahnsteig mitbekommen, dass Herr Götz irgendeine Sache in Berlin schnell über die Bühne bringen wollte. Jetzt dämmerte ihm, was damit gemeint war.
Konfrontiert mit der Kaltherzigkeit von Herrn Götz, blieb ihm für einen Moment die Spucke weg. Fahrig griff er nach seiner Tasse und trank einen Schluck Kaffee. Der bittere Geschmack half Oppenheimer, seine Fassung wiederzuerlangen. Es lag auf der Hand, dass Frau Götz nun auch Theos Schwester bei ihnen unterbringen wollte.
Völlig überrumpelt starrte Oppenheimer vor sich hin. Statt einer Zusage entfuhr es ihm: »So’n Arschloch …«
Auch Lisa sah ihren Mann jetzt erwartungsvoll an. Doch für Oppenheimer kam das alles viel zu schnell. Gedankenversunken betrachtete er Gisela, die ihm gegenüber still vor ihrer Tasse Kakao saß. Um sich etwas Bedenkzeit zu verschaffen, fragte er Frau Götz: »Darf ich Sie zu einem Stück Kuchen einladen? Sie und die Kleine.« Er zeigte zur gläsernen Theke neben dem Eingang, in der sich die verlockend angerichteten Kalorienbomben türmten. »Suchen Sie sich etwas aus.«
Frau Götz wandte sich erfreut ihrer Tochter zu. »Komm Gisela, der Onkel kauft uns Kuchen!«
Als die beiden aufgestanden waren und mit glänzenden Augen vor der Kuchentheke standen, konnte Oppenheimer endlich ungestört mit Lisa sprechen.
»Also, was habt ihr beide da am Telefon ausgeheckt?«
Wenn Lisa ein schlechtes Gewissen hatte, ihn die ganze Zeit über im Dunkeln gelassen zu haben, so zeigte sie es nicht. Ungerührt erwiderte sie: »Du hast doch gehört, was für ein Scheusal ihr Mann ist. Sie hat sich einen miesen kleinen Haustyrannen geangelt.«
»Vom Regen in die Traufe«, sinnierte Oppenheimer. Er kannte solche rechthaberischen Geschlechtsgenossen. Man konnte bei ihnen niemals wissen, worauf sich ihre Aggression richten würde. »Warum lässt die sich nicht scheiden?«
»Ich denke, das macht sie irgendwann«, erklärte Lisa auf Oppenheimers Frage hin. »Aber dazu müsste sie erst einen neuen Mann kennenlernen. Momentan hat sie nur die Wahl zwischen einem Rechthaber und einem Alkoholiker.«
In Oppenheimer regte sich Widerspruch. »Trotzdem, was hat das mit uns zu tun? Allein schon diese Dreistigkeit. Diese Leute kommen einfach mir nichts, dir nichts vorbei, um ihre Kinder bei uns abzuladen.«
»Du hast doch gehört. Für Gisela gibt es keinen Platz mehr.«
Etwas patzig reagierte Oppenheimer: »Dann könnte ich auch gleich Frau Götz zur Zweitfrau nehmen, um sie vor ihrem Mann zu retten.«
Lisa schnappte nach Luft, und Oppenheimer begriff, dass er zu weit gegangen war. Damit seine Äußerung weniger wie ein Vorwurf klang, lachte er demonstrativ in sich hinein und trank einen weiteren Schluck Kaffee. »Andererseits wollten wir sowieso zwei Kinder haben. Jetzt ist es so gekommen, über Umwege halt.«
Während Oppenheimer beobachtete, wie Frau Götz und ihre Tochter den Kuchen bestellten, überlegte er, dass er sich vor ein paar Wochen wesentlich leichter mit der Entscheidung getan hätte. Aber ausgerechnet jetzt, wo er um seine Anstellung bei der Kripo bangen musste, sollte er auch noch die Verantwortung für ein weiteres Kind übernehmen. Doch gab es überhaupt jemals einen idealen Zeitpunkt, um Nachwuchs in der Familie zu begrüßen? Oppenheimer erinnerte sich daran, wie aufgeregt sie gewesen waren, als sie ihre Tochter erwartet hatten. Emilia, deren späterer Tod eine klaffende Wunde in ihre kleine Familie gerissen hatte. Auch damals war es ein Risiko gewesen, weil Oppenheimer bei der Kripo nicht genügend Geld verdiente, um eine komplette Familie zu ernähren. Letztendlich lief es immer darauf hinaus, sich irgendwie mit den veränderten Lebensumständen zu arrangieren. So auch in diesem Fall.
»Aber zwei Kinder. Hast du dir das auch gut überlegt? Schaffst du das?«
Lisa ahnte, dass Oppenheimers anfänglicher Widerstand bröckelte. Natürlich wusste sie, worauf er anspielte. Sie arbeitete als Angestellte der britischen Fluglinie BEA. Das zweite Einkommen würde es finanziell erleichtern, Gisela bei ihnen aufzunehmen. Aber gleichzeitig war Lisa selten zu Hause. Theo konnte gut auf sich selbst aufpassen, das hatte er bereits bewiesen. Aber wie sah das mit der jüngeren Schwester aus?
»Die Zivilflüge sind doch alle von Gatow nach Tempelhof umgezogen«, argumentierte Lisa. »Das spart mir täglich mindestens zwei Stunden Fahrtzeit. Und wenn wir nicht da sind, kann jemand von den Nachbarn auf sie aufpassen. Wenn Gisela schon zu Zieheltern muss, ist es auf jeden Fall besser, wenn sie bei ihrem Bruder bleiben kann.«
In diesem Moment setzten sich Frau Götz und Gisela an der Kuchentheke wieder in Bewegung und bahnten sich zwischen den Tischen hindurch einen Weg zurück. Unwillkürlich richteten sich Lisa und Oppenheimer auf ihren Stühlen auf. Nachdem dies zwischen ihnen geklärt war, musste nur noch die betroffene Hauptperson ihre Zustimmung geben.
Gisela biss in ihre gefüllte Schillerlocke und ließ sich selig die Sahne im Mund zergehen.