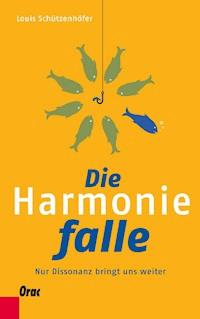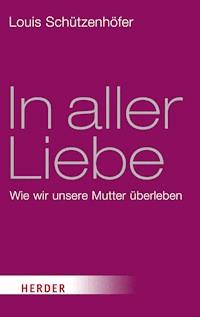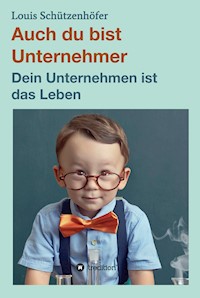
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sind wir alle Unternehmer - unser Unternehmen ist das eigene Leben. Welche Eigenschaften braucht man, um das Leben unternehmerisch gestalten zu können? Der Autor geht davon aus, dass die Eigenschaften, die wichtig für Unternehmer sind, jedem Menschen helfen können, sein Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Die Fähigkeiten, die sich aufgrund empirischer Studien als wesentlich für unternehmerischen Erfolg erwiesen haben, werden ausführlich dargestellt, und es gibt auch Hinweise darauf, wie man sich diese aneignen kann, sofern man das wünscht. Ein wichtiges Ergebnis vorweg: Unternehmerische Fähigkeiten helfen nicht nur, selbstgesteckte Ziele zu erreichen, sie steigern auch die Lebenszufriedenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Bouchra Laktir
إهداءالى بشرى لكثير
Louis Schützenhöfer
Auch du bist ein Unternehmer
Dein Unternehmen ist das Leben
© 2019 Louis Schützenhöfer
Umschlagfoto: iStock by Getty Images
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Hardcover:
978-3-7482-8900-5
e-Book:
978-3-7482-8901-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Einleitung
Zum Beginn zwei Thesen
Sind Unternehmer glücklichere Menschen?
Gibt es die Unternehmerpersönlichkeit?
Auf der Suche nach der Unternehmerpersönlichkeit
Schumpeters „dynamischer Unternehmer“
Schumpeter versus Kirzner
Unternehmerforschung in Deutschland
Unternehmer und die „Big Five“
Die Metaanalyse von Rauch und Frese
Unternehmeraufgaben und Persönlichkeitszüge
Sind wir Herr/Frau im eigenen Haus? Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen?
Das Erleben des freien Willens
Was sagt die Wissenschaft?
Ist der freie Wille eine Illusion?
Der Zufall. Freund oder Feind des Unternehmers?
Wir sind Sinnsucher
Der Zufall mischt mit
Schafe oder Böcke?
Der Zufall eröffnet Chancen
Vom richtigen Umgang mit Glück und Pech
Wie halten es Unternehmer mit dem Zufall?
Das Leistungsmotiv
Leistungsfreude – eine frühe Eigenschaft
Leistungsmotivation und Zeitgeist
Erfolgsmotivierte und Misserfolgsmeider
Der Erfolg beginnt mit der Zielsetzung
Misserfolg. Und nun?
Schutz des Selbstwertes oder Selbstkritik?
Durchhalten oder aufgeben?
Der Schutz des Selbstwertes hat Vorrang
Verantwortung für Misserfolge
Selbstwertdienliche Bescheidenheit
Sind Sie lageorientiert oder handlungsorientiert?
Frauen als Unternehmerinnen
Der Selbstwert – ein überschätztes Gefühl?
Wie es wirkt
Woher es kommt
Haben Sie Lust auf einen Selbsttest?
Soll man verminderten Selbstwert stärken?
Alltagsnarzissten
Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle
Internale und externale Kontrollüberzeugung
Besser eine Kontrollillusion als keine Kontrolle
„Das hat ja so kommen müssen“
„Ich habe es immer schon gewusst“
Voraussagbarkeit ist besser als Nichtvoraussagbarkeit
Wie man mit Illusionen lebt
Hilflosigkeit – nur das nicht
Unkontrollierbarkeit macht hilflos
Hilflosigkeit lähmt die Eigeninitiative
„Jetzt erst recht“
Das Wundermittel Selbstwirksamkeitserwartung
Kein starres Persönlichkeitsmerkmal
Wie ist es um Ihre Selbstwirksamkeitserwartung bestellt?
Wie man die Selbstwirksamkeitserwartung steigert
Mut zu innerer Dissonanz
Zur Überwindung innerer Widerstände
Willkommen in der „Echokammer“
Tausche sozialen Anschluss gegen Selbstbestimmtheit
Wie verträglich sind Unternehmer?
Die fatale Wirkung des Gruppendrucks
Wie weit geht die Manipulation durch die Mehrheit?
Die Isolationsfurcht
Die zwei Gesichter der Konformität
Sind Sie ein Lebens-Unternehmer?
Charakteristika unternehmerischen Handelns
Mehr Lebenszufriedenheit
Lust auf Veränderung?
Auf die Ziele kommt es an
Danke
Literaturverzeichnis
Einleitung
Zum Beginn zwei Thesen
Im Frühjahr 2016 las ich die überaus interessante Dissertation von Dr. Rainer Zitelmann zum Thema „Persönlichkeit und Verhaltensmuster der Vermögenselite in Deutschland“. Im darauffolgenden Jahr wurde der Text unter dem Titel. „Psychologie der Superreichen“ publiziert und stürmte die Bestsellerlisten. In 45 Interviews mit Hochvermögenden versuchte Zitelmann mit Erfolg, „das verborgene Wissen der Vermögenselite“, so der Untertitel seines Buches, ans Licht zu bringen. Mich als Psychologen interessierte besonders die Beschreibung der Unternehmerpersönlichkeit. Was ist es, das Menschen antreibt, das risikoreiche Leben eines Entrepreneurs der relativen Sicherheit einer Laufbahn als Angestellter oder Beamter vorzuziehen? Bei diesen Überlegungen wurde ein Gedanke immer klarer: Sind wir nicht in Wahrheit alle Unternehmer? Unser Unternehmen ist das Leben. Aus dieser Vorstellung ergibt sich eine Reihe von Fragen: Wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Fühlen wir uns tatsächlich als Unternehmer, die das Leben aktiv gestalten oder eher als Passagiere in einem dahintreibenden Boot? Haben wir überhaupt die Chance, das Leben unternehmerisch anzupacken? Über welche Eigenschaften und Fähigkeiten muss man verfügen, um das Leben aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können?
Der Unternehmer will Erfolg, und der lässt sich an konkreten Fakten festmachen: Umsatz, Gewinn, Anzahl der Mitarbeiter etc. Doch worin besteht der Erfolg des Unternehmens Leben? Diesen zu bestimmen ist wesentlich schwieriger, hängt er doch von den individuellen Zielsetzungen und Wertvorstellungen ab. Oft muss man erst in sich gehen, um auszuloten, welche impliziten Ziele vorhanden sind, die man sich noch nicht bewusst gemacht hat. Außerdem können sich diese im Laufe des Lebens ändern und sie tun es meist auch. Der Mensch im fortgeschrittenen Alter hat andere Ziele als der aufstrebende Mittdreißiger. Manche Ziele, die mir als Jugendlichem vorschwebten, ringen mir im Rückblick bestenfalls ein Lächeln ab, und von anderen musste ich mich mit Wehmut verabschieden.
Apropos Erfolg: In diesem Buch wird häufig davon die Rede sein. Damit ist nicht das gemeint, was man sich gemeinhin unter einem erfolgreichen Menschen oder einem erfolgreichen Leben vorstellt: einflussreiche Positionen, hohes Einkommen, Vermögenswerte u. ä. Unter Erfolg oder erfolgreichem Handeln verstehe ich das Erreichen eines angestrebten Zieles. Das kann eine der obigen Erfolgskriterien erfüllen oder auch ganz andere Aspekte betreffen, wie zum Beispiel die Persönlichkeit zu entfalten, die eigenen Talente auszuschöpfen, wertvolle Freundschaften zu pflegen, einen gesunden Körper zu entwickeln, eine befriedigende Partnerschaft und eine glückliche Familie zu schaffen, Spuren in dieser Welt zu hinterlassen etc.
Eine überraschende Bestätigung für dieses Buchprojekt gab mir Jochen Schweizer, Eventvermarkter und damals als Investor einer der Löwen in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. In einer Diskussionssendung mit Anne Will drückte er genau den Gedanken aus, der mich umtrieb, dass wir alle Unternehmer seien und unser Unternehmen das Leben sei. Das war der letzte Anstoß, dieses Buch in Angriff zu nehmen.
Natürlich stellt sich die Frage, ob ein unternehmerischer Zugang eher ein gelungenes Leben zur Folge hat oder ob es letztlich nicht besser ist, sich treiben zu lassen und demütig anzunehmen, was kommt. Immerhin wird das von den meisten Religionen und vielen Weltanschauungen empfohlen. Ich kann diese Frage nicht beantworten, doch ich möchte mit diesem Buch eine Lanze dafür brechen, das Leben als Unternehmen und sich selbst als Unternehmer zu betrachten, auch wenn ich keine Garantie dafür geben kann, dass es dann erfolgreicher verläuft, was immer man sich darunter vorstellt. Zwei Thesen stelle ich an den Anfang meiner weiteren Überlegungen und Recherchen.
These Nr. 1: Die Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensmuster, die die Unternehmerpersönlichkeit ausmachen, sind auch günstige Voraussetzungen dafür, das eigene Leben unternehmerisch zu gestalten. Damit ist gemeint, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, die Dinge nicht laufen zu lassen, sondern aktiv einzugreifen, Ziele zu setzen, planvoll vorzugehen, sich gegen Widerstände durchzusetzen etc.
These Nr. 2: Das Bewusstsein, vielleicht auch die Illusion, das Leben wenigstens zum Teil selbst gestalten zu können, stellt einen Wert für sich dar. Darüber hinaus erleichtert diese Einstellung das Erreichen von Zielen, die dem psychischen Wohlbefinden dienen.
Sind Unternehmer glücklichere Menschen?
Müsste daraus nicht folgen, dass Unternehmer aufgrund ihrer Eigenschaften besonders glückliche und zufriedene Menschen sind? Leider nein. Ich kenne keine Untersuchung, die diese Annahme bestätigen würde, und sie widerspricht auch meiner Lebenserfahrung, denn mir fallen spontan viele Gegenbeispiele von Menschen ein, die als Unternehmer erfolgreich sind, das Unternehmen Leben jedoch in die Krise gesteuert haben. Der Grund liegt, meiner Einschätzung nach, häufig darin, dass sie ihre unternehmerischen Fähigkeiten einseitig dafür einsetzen, dass es in der Firma gut läuft, dabei jedoch die eigenen Lebensziele den Unternehmenszielen opfern. Die Formel: „Geht es dem Unternehmen gut, geht es auch mir und meiner Familie gut“, hat, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt Gültigkeit. Das Leben soll aus meiner Sicht immer eine höhere Wertigkeit haben als jedes Unternehmen, jeder Job und jedes Projekt. Beruflicher Erfolg, sei es als Angestellter, Selbständiger oder Unternehmer, ist eine wesentliche Säule persönlicher Zufriedenheit, doch es sollte nicht die einzige sein, mit der alles steht oder fällt. Engagement und Identifikation mit dem Unternehmen sind sicherlich wesentliche Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere bei Gründern, doch es kommt auf die Balance zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen an. Sigrun Göbel, Organisations- und Personalentwicklerin in Gießen, kommt aufgrund ihrer Forschungen zu dem Schluss: „Unternehmerinnen und Unternehmer, bei denen Arbeit die zentrale Rolle im Wertesystem spielt, haben nicht zwingend Erfolg. Ein zufriedener Unternehmer arbeitet zwar sehr viel (die Arbeitsstunden, die von den Kleinunternehmern geleistet werden, sind enorm), aber er lebt nicht für die Arbeit, sondern auch für die Gesamtorganisation, die eigene berufliche Professionalität und seine Privatwelt“ (Göbel 1998, S. 117).
Mit der Bereitschaft, für den Erfolg alles zu geben und große Risiken auf sich zu nehmen, gleichen Unternehmer den Hochleistungssportlern. Auch die ordnen dem Gewinnen alles unter, Gesundheit, Familie, Freunde und private Interessen. Sie haben aber einen großen Vorteil: Sie beenden ihre Karriere in aller Regel vor dem 40. Lebensjahr, in vielen Sportarten sogar wesentlich früher. Es bleibt ihnen daher meist noch ausreichend Zeit, sich um das Unternehmen Leben zu kümmern. Unternehmer sind in diesem Alter meist noch weit von ihrem Karrierehöhepunkt entfernt. Und auch später tun sie sich mit dem Aufhören schwer. Am ehesten gelingt es noch, wenn ein Familienmitglied den „Laden“ übernimmt, doch zu diesem Zeitpunkt ist der „Seniorchef“ meist schon in einem Alter, in dem ein Umkrempeln des Lebens kaum mehr möglich ist. Nur Wenigen gelingt es, nach einer Unternehmerlaufbahn eine neue Phase zu starten, in der Interessen ausgelebt werden, die zuvor zu kurz gekommen sind.
Es ist mir bewusst, dass die Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens auf unserem Planeten sehr ungleich verteilt sind. In vielen Gegenden der Erde sind die Menschen trotz Begabung und Leistungsmotivation chancenlos. Doch gerade diese Chancenlosigkeit treibt sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge dazu, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und einen risikoreichen Weg einzuschlagen, um ihrer Misere zu entkommen. Das ist eine extreme Form unternehmerischen Handelns, genährt von der meist trügerischen Hoffnung auf ein besseres Leben. Wir können uns glücklich schätzen, in einer Region und in einer Zeit zu leben, in der für die meisten Menschen Spielraum für eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens besteht, ohne dieses aufs Spiel setzen zu müssen. Ich habe jedoch den Eindruck, dass übertriebenes Sicherheitsdenken, Passivität und Resignation vielfach dazu führen, dass Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Lebensgestaltung ungenützt bleiben.
Gibt es die Unternehmerpersönlichkeit?
Der erste Schritt in diesem Buch besteht darin, zu recherchieren, ob es die Unternehmerpersönlichkeit überhaupt gibt und wenn ja, wie sie zu charakterisieren ist. Erfreulicherweise gibt es mittlerweile eine Reihe empirischer Studien zu diesem Thema. Dabei kann ich mich auf die umfangreichen Recherchen von Rainer Zitelmann stützen, der in seinem Buch „Psychologie der Superreichen. Das verborgene Wissen der Vermögenselite“ die Ergebnisse der Entrepreneurforschung in den USA, wo es diese seit den 1960er Jahren gibt, und in Deutschland aufgearbeitet hat. Im nächsten Schritt werden Eigenschaften, die in einem statistisch gesicherten Zusammenhang mit Unternehmensgründung und Unternehmenserfolg stehen, beschrieben, analysiert und im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Unternehmen Leben unter die Lupe genommen.
Wenn hier von Unternehmern und Unternehmerpersönlichkeit die Rede ist, habe ich nicht oder nicht nur die Eigentümer großer Firmen im Auge. Im Unterschied zu Rainer Zitelmann, dessen Zielgruppe die Superreichen waren, konzentriere ich mich ganz allgemein auf Personen, die sich mit einer Idee, einer Dienstleistung oder einem Produkt auf den Markt wagen, sich dessen Chancen und Gefahren aussetzen und sich damit von solchen Menschen unterscheiden, die die relative Sicherheit eines Angestelltenlebens vorziehen. Ob dieses wirklich so sicher ist, hängt unter anderem von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Auch Angestellte haben Risiko zu tragen. Sie können bei der Wahl der Ausbildung oder des Arbeitgebers auf das falsche Pferd setzen. Wirtschaftliche Flauten gehen auch an Angestellten nicht spurlos vorüber und können den Arbeitsplatz kosten. Allerdings haben sie bei einer Kündigung die Chance, ihre Arbeitskraft einer anderen Firma anzubieten. Außerdem gibt es, zumindest in den meisten Industrieländern, soziale Auffangnetze für Arbeitslose. Wenn hingegen Unternehmer scheitern, verlieren sie in der Regel nicht nur ihre Einkommensquelle, sondern auch ihre finanziellen Investitionen oder steigen sogar mit Schulden aus ihrem Projekt aus. Dann sind ihre Chancen für einen Neubeginn meist verdorben.
Hinzu kommt, dass es in Europa, zum Unterschied von anglo-amerikanischen Ländern, keine Kultur des Scheiterns gibt. Wer in unseren Breiten mit einem Unternehmen Schiffbruch erleidet, muss zusätzlich zum wirtschaftlichen Schaden mit gesellschaftlicher Ächtung rechnen. In den USA ist das anders. Dort wird es gewürdigt, dass jemand ein Unternehmen startet, auch wenn der Erfolg ausbleibt. Dabei hätte die Gesellschaft auch hierzulande allen Grund, solchen Entrepreneurs dankbar zu sein, die mit ihrem Unternehmen gescheitert sind, denn diese haben ihr Kapital und ihr Engagement in die Waagschale geworfen. Und sie haben möglicherweise gezeigt, wie man es in Zukunft anders machen muss.
So, wie der einzelne Mensch um das Scheitern nicht herumkommt, sind Pleiten auch für Wirtschaftsräume ein unvermeidbarer und sogar notwendiger Bestandteil. Es wäre gar nicht wünschenswert, wenn die Pleitenstatistik eines Landes einen sehr geringen Wert ausweisen würde. Eine niedrige Quote bei Konkursen kann zwar Ausdruck einer positiven wirtschaftlichen Situation sein, in der sich auch Unternehmen mit schwachen Bilanzen und Managementfehlern über Wasser halten können, doch sie kann auch darauf zurückzuführen sein, dass nur wenige Menschen das Risiko auf sich nehmen, mit einer Produktidee auf den Markt zu gehen. Und damit würden die nötigen Innovationen für die Zukunft fehlen.
Es ist mir klar, dass auch Manager großer Firmen weitreichende unternehmerische Entscheidungen zu treffen haben, doch sie tun es als Angestellte mit beschränktem Risiko. Sie setzen dabei in der Regel nicht ihre Existenz aufs Spiel und riskieren höchstens ihren Job oder die Reputation. Gerade die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass mitunter sogar schwerste Managementfehler, die zu Milliardenverlusten geführt haben, für die Verursacher ohne wirtschaftliche und strafrechtliche Folgen bleiben. Ganz anders sieht es für die Betreiberin eines Frisiersalons, den Besitzer einer Landwirtschaft, den Gründer eines Start-ups oder andere Selbständige, Kleinunternehmer und Freiberufler aus. Sie haben aus meiner Sicht mehr Unternehmerblut in ihren Adern als die Manager auch noch so großer Unternehmen. Außerdem ist bei diesem Personenkreis der Einfluss der Unternehmerpersönlichkeit auf den Unternehmenserfolg wesentlich bedeutsamer als bei Chefs großer Firmen.
Auf der Suche nach der Unternehmerpersönlichkeit
Schumpeters „dynamischer Unternehmer“
Wir stehen nun vor der entscheidenden Frage: Gibt es die Unternehmerpersönlichkeit und wenn ja, wie kann sie beschrieben werden? Eine erste Antwort suche ich beim österreichischen Nationalökonomen Joseph Alois Schumpeter (siehe Kasten). Er zeichnete in seiner 1912 erschienenen „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ ein Bild des Unternehmers, und es fiel recht heroisch und sehr männlich aus.
Joseph A. Schumpeter (1883 – 1950) gilt als einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Bereits in seinem Frühwerk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ setzte er sich als einer der Ersten mit der Unternehmerpersönlichkeit auseinander. Mit 24 Jahren wurde er Ordinarius für Politische Ökonomie an der Karl-Franzens-Universität in Graz und war damit der jüngste Universitätsprofessor der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Obwohl er parteiunabhängig war, übernahm er 1919 das Amt des Staatssekretärs für Finanzen. Nach diesem kurzen Ausflug in die Politik wurde er Präsident eines Bankhauses in Wien. 1932 folgte er dem Ruf an die Harvard University und widmete sich fortan seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit.
Unternehmer sind für Schumpeter Männer – und zwar ganze Männer. „Die Männer, die die moderne Industrie geschaffen haben, waren ‚ganze Kerle‘ und keine Jammergestalten, die sich fortwährend ängstlich fragten, ob jede Anstrengung, der sie sich zu unterziehen hatten, auch einen ausreichenden Genussüberschuss verspreche. Wenig haben sie sich um die hedonischen Früchte ihrer Taten gekümmert. Von Anfang an bestand für sie keine Absicht, sich des Erworbenen müßig zu erfreuen, nicht dazu haben sie gelebt. Solche Männer schaffen, weil sie nicht anders können“ (Schumpeter 2006, Nachdruck der 1. Auflage von 1912, S. 137 ff).
Der Unternehmertyp, den Schumpeter im Auge hat, ist dynamisch, energisch und ahedonisch, im Gegensatz zum statischen, hedonischen Typus, dessen wirtschaftliche Tätigkeit an Lebensfreude und psychischem Wohlbefinden orientiert ist (siehe Kasten).
Kurz erklärt: Hedonismus
Der Begriff Hedonismus bezeichnet eine Lebenseinstellung, bei der körperliche und geistige Lust im Mittelpunkt stehen. Bereits Epikur vertrat ein Leben voll Freude und Lust, das durch Bescheidenheit und vernünftigen Verzicht zu erreichen sei. Heute wird der Begriff Hedonismus meist abwertend für eine einseitig an materiellen Genüssen orientierte Lebensweise verwendet.
Der dynamische Unternehmer Schumpeter’scher Prägung wählt diesen beruflichen Weg nicht, um sich ein besseres Leben zu gönnen und um Güter des Genusses wegen anzuhäufen, er erfährt vielmehr seine Befriedigung im Unternehmertum selbst. Abseits davon hat er keine Ziele. Daher lässt er in seinen Bemühungen auch nicht nach, wenn sich wirtschaftlicher Erfolg eingestellt hat. Auch die Tatsache, dass viele Unternehmer luxuriös leben, lässt Schumpeter nicht als Beweis dafür gelten, dass diese nach Genuss streben. Er meint vielmehr, dass sie es tun, „… weil sie die Mittel dazu haben und nicht, dass sie die Mittel zu dem Zwecke erwerben, um luxuriös zu leben“ (Schumpeter 2006, S. 137).
Als Beispiel für solche Unternehmer führt Schumpeter den Kunstmaler an. Der verfolgt zwar mit seiner Arbeit auch wirtschaftliche Ziele, doch dieses Motiv allein würde dem Wesen der künstlerischen Tätigkeit nicht gerecht, denn dann müsste ja der Antrieb zum Handeln nachlassen, wenn kein weiterer Genusszuwachs zu erwarten wäre. Um in diesem Bild zu bleiben: Ich könnte mir nicht vorstellen, Pablo Picasso hätte gesagt: „Ich habe mit meiner Kunst schon genug Geld verdient, ich höre auf zu malen und zu zeichnen und genieße das Leben“. Bei solchen Menschen nimmt die Motivation, ihre Neigung auszuleben, mit dem wirtschaftlichen Erfolg nicht ab. Vielleicht ist Picasso ein schlechtes Beispiel, denn er verstand es offensichtlich, ein Leben für die Kunst mit Lebensgenuss zu vereinen. Ein Kunststück, das vielen Unternehmern nicht gelingt.
Was aber treibt den dynamischen Unternehmer an, wenn es nicht der Genuss und das Anhäufen von Gütern ist? Nach Schumpeter ist es die Freude an sozialer Machtstellung und am schöpferischen Gestalten. Der dynamische Unternehmer zieht nicht bloß passiv Konsequenzen aus einer Datenlage, er nützt vielmehr den Interpretationsspielraum der Fakten, um daraus Neues zu schaffen. Damit entzieht er sich der vermeintlichen Zwangsläufigkeit der Daten. In Zeiten von Fake News und „alternativen Fakten“, in denen Tatsachen als Lügen und Unwahrheiten als Realität dargestellt werden, könnte die obige Beschreibung des schöpferischen Gestaltens Anlass zu Missverständnissen geben. Daher scheint mir eine Klarstellung notwendig zu sein: Der kreative Prozess bedeutet eine Neuordnung von Fakten und nicht deren bewusste Verfälschung.
Als wesentlichste Voraussetzung für den Entrepreneur betrachtet Schumpeter die Fähigkeit, aus bestehenden Verhältnissen auszubrechen, sich gegen soziale Normen und Mehrheitsmeinungen durchzusetzen und neue Wege zu gehen. Widerstände oder neue, bisher nicht gekannte Herausforderungen, sind seiner Ansicht nach für den dynamischen Unternehmertyp nicht Abschreckung sondern Anreiz. „Die Tatsache, dass etwas noch nicht getan wurde, wird von ihm nicht als Gegengrund empfunden. Jene Hemmungen, die für die Wirtschaftssubjekte sonst feste Schranken ihres Verhaltens bilden, fühlt er nicht“ (Schumpeter 2006, S. 132). Schumpeters Biograph Richard Swedberg bemerkt dazu: „Der Unternehmer müsse eine aussergewöhnliche Persönlichkeit sein, konstatiert Schumpeter, denn er habe die Widerstände gegen Veränderungen zu überwinden, die es in jeder Gesellschaft gebe. Die meisten Menschen seien dazu nicht in der Lage; sie könnten nur mit dem umgehen, was ihnen vertraut ist. Der Unternehmer dagegen besitzt die Stärke und den Mut, die gewohnten Bahnen zu verlassen und die Kräfte der Tradition zurückzudrängen“ (Swedberg 1994, S. 56 ff).
Schumpeter beschreibt als Ideal einen asketischen und geradezu lebensabgewandten Unternehmertyp, der keine Ziele außerhalb des Unternehmens hat und die Früchte seiner Arbeit nicht genießt sondern wieder in das Unternehmen investiert. Dabei hatte er offensichtlich Unternehmer im Range von Wirtschaftsführern im Auge. Dennoch wage ich die Behauptung, dass seine Charakterisierung mit Abstrichen auch auf den „kleinen“ Unternehmer zutrifft. Übersetzt man die Beschreibung von Schumpeter in heute gebräuchliche psychologische Termini, könnte man das von ihm beschriebene Unternehmerprofil so definieren:
• ausgeprägtes Dominanzstreben (Freude an sozialer Machtstellung)
• hohe Kreativität (schöpferisches Gestalten)
• hohe Leistungsmotivation (geringes Interesse an Genuss)
• geringe Verträglichkeit bzw. hohe Konfliktbereitschaft.
Wie wir noch sehen werden, deckt sich diese Charakterisierung weitgehend mit neueren empirischen Befunden.
War Schumpeter ahedonisch?
Im Gegensatz zur eher asketischen Charakterisierung seines idealen Unternehmertyps war Schumpeters eigene Lebensphilosophie nicht unbedingt ahedonistisch. Um seine Person rankten sich schon zu dessen Lebzeiten Legenden. Eine davon besagt, er habe drei Lebensziele gehabt: der größte Ökonom der Welt, der beste Liebhaber von Wien und der erste Reiter von Österreich zu werden; das mit den Pferden, so seine Bilanz, habe nicht so gut geklappt (siehe McCraw 2008, S. 16). Die Persönlichkeit von Schumpeter hat jedoch auch eine andere Seite. Er fiel in späteren Lebensjahren immer mehr in eine Depression. Den Tod seiner Mutter, seiner zweiten Frau Annie und seines Kindes hat er wohl nie verwunden.
Schumpeter versus Kirzner
Eine interessante Kontroverse über die Persönlichkeit des Unternehmers gibt es zwischen Joseph A. Schumpeter und Israel Kirzner, beide Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Für Schumpeter zeichnet sich der Unternehmer, wie bereits dargestellt, u. a. dadurch aus, dass dieser sich über soziale Normen hinwegsetzt, die Einschätzungen seiner Genossen ignoriert, gegen den Strom schwimmt und sich über bestehende Verhältnisse und äußere Hindernisse hinwegsetzt, auch wenn diese unüberwindlich erscheinen. Der dynamische Unternehmer passt sich nicht gegebenen Marktverhältnissen an, sondern trachtet, hinderliche Strukturen zu überwinden und Neues an ihre Stelle zu setzen. „Unser Mann der Tat folgt nicht einfach gegebener oder unmittelbar zu erwartender Nachfrage. Er nötigt seine Produkte dem Markte auf“ (Schumpeter 2006, S. 133). Ein legendäres Beispiel für einen Unternehmer, der sich nicht an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden, sondern an seinen eigenen Vorstellungen orientierte, ist Henry Ford, von dem der Ausspruch überliefert ist: „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde“. Er hat sich glücklicherweise nicht auf die Pferdezucht verlegt.
Schumpeter prägte für die Überwindung hinderlicher Strukturen den Begriff „schöpferische Zerstörung“. Wir werden vermutlich in den nächsten Jahrzehnten einen solchen Prozess durch die digitale Revolution erleben. Diese Entwicklung, man denke nur an Robotik und künstliche Intelligenz, wird Arbeitsplätze vernichten, die bisher Menschen innehatten, künftig aber von Maschinen ausgefüllt werden. Allerdings werden dadurch, sofern sich die Prognosen erfüllen, neue Arbeitsplätze geschaffen.
Auch in der Psyche des Menschen spielen sich Prozesse schöpferischer Zerstörung ab – und zwar bei jedem Entwicklungsschritt. Damit neue Erkenntnisse gewonnen und neue Verhaltensweisen angeeignet werden können, müssen alte Denk- und Handlungsstrukturen zerstört oder, wie man in der Lernpsychologie sagt, gelöscht werden. Das Löschen eingeschliffener Denk-und Verhaltensweisen, die auf neue Situationen nicht mehr anwendbar sind und die man daher gerne loswerden würde, ist meist schwieriger als das Aneignen neuer.
Wie bereits erwähnt, entsprechen Künstler, wie zum Beispiel Maler, weitgehend der Schumpeter’schen Auffassung von unternehmerischen Persönlichkeiten, da das Motiv ihrer Tätigkeit nicht im Lebensgenuss und in der Anhäufung von Gütern liegt. Mit einer weiteren Eigenart entsprechen sie dem dynamischen Unternehmer: Sie setzen ihr künstlerisches Credo gegen alle Widerstände durch und orientieren sich nicht am Publikumsgeschmack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Markus Lüpertz oder ein Georg Baselitz in Deutschland oder ein Arnulf Rainer oder ein Hermann Nitsch in Österreich überlegt haben, mit welcher Art von Malerei sie Erfolg haben könnten. Die Idee, die Inspiration stand für sie wohl im Vordergrund. Auf sie konzentrierten sie alle Energie und alles Durchsetzungsvermögen. Sie hätten, so vermute ich, ihren Malstil auch nicht geändert, wenn er erfolglos geblieben wäre. Bei Künstlern auf niedrigem Level mag das anders sein. Schumpeter betrachtet den Künstler als eine Person, die eine Entwicklung unterbricht und einen Neuanfang wagt. „Seine Bedeutung für uns liegt darin, dass es die Kontinuität der Entwicklung auf dem betreffenden Gebiet unterbricht, dass die bisherige Entwicklung ein Ende findet und eine neue beginnt, und dass der Übergang von der einen zur andern nicht lediglich durch eindeutig bestimmte Anpassung an Datenänderungen erfolgt“ (Schumpeter 2006, S. 127).
Ganz anders sieht Kirzner die Persönlichkeit des Unternehmers. Für ihn besteht die Herausforderung des Entrepreneurs nicht in der Zerstörung bestehender Ordnungen und Besitzverhältnisse, sondern vielmehr darin, Mängel und Lücken im Bestehenden zu erkennen, die anderen verborgen geblieben sind und diese für eigene Marktchancen zu nützen. „For me the important feature of entrepreneurship is not so much the ability to break away from routine as the ability to perceive new opportunities which others have not yet noticed“ (Kirzner, zit. nach Zitelmann 2017, S.51).
Die Ansicht von Kirzner wurde von Qing Miao und Ling Liu empirisch bestätigt. Sie bildeten auf der Grundlage von Fragebogenergebnissen, die sie an 327 Entrepreneurs gewonnen haben, ein Modell zur unternehmerischen Entscheidungsfindung. Dabei fanden sie, dass die unternehmerische Wachheit (entrepreneural alertness) – ein Schlüsselbegriff bei Kirzner - und die Vorkenntnisse (prior knowledge) die Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Chancen bilden und die unternehmerische Entscheidungstätigkeit beeinflussen (Miao & Liu, 2010).
Ein Beispiel für Unternehmer Kirzner’scher Prägung: In Südosteuropa gibt es gegenwärtig ein Überangebot an ausgebildeten Pflegekräften, in Deutschland und Österreich hingegen einen Mangel an Pflegepersonal. Für einen Pflegebedürftigen und dessen Angehörige ist es nahezu unmöglich, eine geeignete Pflegekraft im Ausland zu finden, die komplizierten Formalitäten zu erledigen, die Qualifikationen zu überprüfen etc. Findige Unternehmer erkannten diese Lücke, gründeten Vermittlungsagenturen und stellten im Sinne Kirzners das Marktgleichgewicht her. Bei ihnen steht nicht die Innovation im Mittelpunkt, sondern die Wachheit, auf Marktchancen, die sich eröffnen, zu reagieren. „I view the entrepreneur not as a source of innovative ideas ex nihilo, but as being alert to the opportunities that exist already and are waiting to be noticed“ (Kirzner, zit. nach Zitelmann 2017, S. 52).
Schumpeter und Kirzner beschreiben zwei Typen von Unternehmerpersönlichkeiten, die meines Erachtens nebeneinander bestehen und auf ihre Art Erfolg haben können. Die Strategie, ein Produkt zu kreieren und es gegen alle Widerstände auf dem Markt durchzusetzen, kann ebenso erfolgreich sein wie eine gründliche Marktanalyse und die Abstimmung der weiteren Schritte auf die gegebene Situation. Schumpeters dynamischer Unternehmer ist darauf fokussiert, Widerstände zu überwinden, notfalls Regeln zu brechen und bestehende Strukturen zu zerstören, während der Entrepreneur Kirzner’scher Prägung die bestehenden Verhältnisse nicht zu ändern, sondern zu seinem Vorteil zu nützen trachtet.