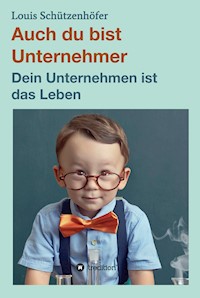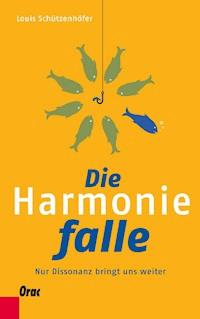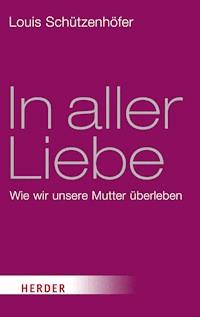
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Mütter lieben ihre Kinder. Das scheint ein ewiges Gesetz. Auf viele Mütter trifft es auch zu. Gleichzeitig leiden aber mehr als 40 Prozent aller Kinder - egal welchen Alters - unter einer belastenden Mutterbeziehung, die bis in ihre Partnerschaften, ihre Berufsziele und ihre Rolle als Eltern nachwirkt. Der Psychologe Louis Schützenhöfer hat auf der Basis von 50 Tiefeninterviews mit Töchtern und Söhnen im Alter von 18 bis 84 Jahren vier belastende Muttertypen herausgearbeitet: Machtmutter, Opfermutter, narzisstische Mutter und lieblose Mutter. Entstanden ist kein Buch gegen Mütter, sondern eines für Töchter und Söhne. Damit sie den Mechanismus der eigenen problematischen Mutterbeziehung begreifen - und sich davon lösen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Louis Schützenhöfer
In aller Liebe
Wie wir unsere Mutter überleben
Impressum
Bearbeitete Neuausgabe des gleichnamigen Buches von 2004
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80086-3
ISBN (Buch): 978-3-451-06679-5
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Drei Anliegen
Muttertypen
Tiefeninterviews als empirische Basis
Der Muttermythos
Zur Geschichte des Muttermythos
Der Muttermythos heute
Wiedergutmachung und Abstandszahlung
Rolle der Frau und Muttermythos
Weg mit dem Muttermythos
Die Machtmutter
Exkurs über Macht und Machtbedürfnis
Die »Spielwiese« der Machtmutter
Notfalls mit Gewalt
Keine Intimsphäre
Kein Lob
Kein (Selbst-)Vertrauen
Keine Selbstdurchsetzung
Keine Selbstbehauptung
Machtmutter und Transaktionsanalyse; das Machtspiel
Die Opfermutter
Kränkeln und Leiden
Androhen des Verlassens
Aufopfern
Warum sie ist, wie sie ist
Stütze der Mutter
Warum gerade ich?
Verlorene Kindheit
Regulierung der »Nähe«
Verlassensängste in der Partnerschaft
Die Mechanik der Opfermutter
Der verdammte AA-Konflikt
Die narzisstische Mutter
Psychoanalytische Erklärung
Das »innere Bild«
Mit allen Mitteln
Ausbruchsversuche
Beziehungsprobleme
Auf der Suche nach dem Selbst
Und das Selbst der Mutter?
Exkurs über »Delegation«
Die lieblose Mutter
Exkurs über Mutterliebe
Keine Zärtlichkeit
Keine Gefühle
Kein Lob
Kein Interesse
Die selektive Mutterliebe
Mutterliebe: Gefühl oder Verhalten?
Gestörte Beziehung zu Kindern
Kein Vertrauen in Gefühle
Beruflicher Erfolg
Ich muss mich noch mehr anstrengen
Der Zwang zur Wiederholung
Exkurs über das Bindungsverhalten
Muss man Liebe lernen?
Nur noch Wunschkinder?
Kann man Liebe lernen?
Die späte Beziehung zur lieblosen Mutter
Die Rolle der Väter
Abwesend, schwach, versagend
Exkurs über die Partnerwahl
Der Partner der Machtmutter
Der Partner der Opfermutter
Der Partner der narzisstischen Mutter
Der Partner der lieblosen Mutter
Teil des Problems, nicht der Lösung
Die »neuen Väter«
Lösungen. Die Aufarbeitung der Mutterbeziehung
Frühe Ahnung, späte Erkenntnis
Begreifen des Mechanismus
Heraus aus dem Teufelskreis
Nicht nur mit dem Kopf
Lösung von der Machtmutter
Trennung ohne Lösung
Zum Rollenwechsel in der Mutter-Kind-Beziehung
Machtmutter ohne Macht
Strukturanalyse
Änderung der Perspektive und der Kommunikation
Lösung von der Opfermutter
Entkoppeln von Schuldgefühlen und Verhalten
Vom Schuldgefühl zur Dankbarkeit
Lösung von der narzisstischen Mutter
Die »Mutter im Kopf«
Abschied vom eigenen Selbst oder von der Mutter
Lösung von der lieblosen Mutter
Die Hoffnungsfalle
Ich bin liebenswert
Dank
Literaturliste
Ich freue mich, dass Sie mein Buch in die Hand genommen haben, aber ich möchte nicht, dass Sie es mit falschen Erwartungen lesen. Daher ein paar Hinweise:
Lesen Sie dieses Buch nicht,
wenn Sie eine glückliche und zufrieden stellende Mutterbeziehung haben, es sei denn, Sie haben Interesse an dem Thema,wenn Sie Ihre schlechte Mutterbeziehung in Ruhe verdrängen wollen,wenn Sie wissen, dass Ihre schlechte Mutterbeziehung Ihre eigene Schuld ist, und Sie darunter leiden wollen,wenn Sie davon überzeugt sind, dass eine Mutter nichts falsch machen kann.
Lesen sie dieses Buch,
wenn Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter klären wollen, um zu erkennen, wer Sie wirklich sind,wenn Sie Ihre Mutterbeziehung aufarbeiten wollen, um freier zu werden in der Partnerschaft und im Umgang mit Kindern, wenn Sie Ihre Aggressionen, Ihre Ohnmachtsgefühle oder Ihre Schuldgefühle auflösen wollen,wenn Sie Ihre Mutter besser verstehen wollen,wenn Sie sich selbst liebevoller annehmen wollen.
Vorwort
Als »In aller Liebe« im Jahre 2004 erschien, war noch vieles anders. So war es gar nicht leicht, einen Verlag für dieses Thema zu interessieren, denn eine kritische Auseinandersetzung mit dem Muttermythos war in der öffentlichen Meinung so etwas wie »Sünde«. Die erfreuliche Tatsache, dass der Herder-Verlag nun den Text als Taschenbuch herausbringt, beweist aus meiner Sicht zweierlei: Zum einen, dass dieses Thema nichts von seiner Aktualität verloren hat. Und zum anderen, dass ein kritischer Umgang mit der eigenen Mutterbeziehung so etwas wie Normalität geworden ist.
Das zeigt sich auch in der literarischen Bearbeitung dieses Themas. Noch vor einigen Jahrzehnten bildeten problematische Mutterbeziehungen in erster Linie Stoff für Romane, wie zum Beispiel »Die Klavierspielerin« von Elfriede Jelinek oder »Weißer Oleander« von Janet Fitch, die vom Odium des Sensationellen, Abartigen umweht sind. Heute finden wir Bücher zu diesem Thema bevorzugt in den Sachbuchregalen. Und das ist gut so. Denn dadurch können betroffene Töchter und Söhne die Rolle der vermeintlichen Außenseiter leichter abstreifen. Und das hilft ihnen, offen und ohne Schuldgefühle mit diesem Thema umzugehen, darüber zu sprechen und sich aus einer problematischen Mutterbeziehung zu lösen. Dafür ist es nie zu spät.
Ich habe mir seit dem Erscheinen dieses Buches, das ich nicht gegen Mütter, sondern für Töchter und Söhne geschrieben habe, einiges anhören müssen. Meist von Leserinnen, die es mir nicht verzeihen konnten, am Muttermythos gekratzt zu haben. Ich traf aber auch viele Mütter, die mir gegenüber die Sorge ausdrückten, ob sie in der Erziehung ihrer Kinder wohl alles richtig gemacht haben. Ich konnte sie beruhigen, denn es ist weder möglich noch notwendig, alles richtig zu machen. Und Mütter, die ihr Handeln hinterfragen, können so schlecht nicht sein, denn sie haben den Sockel des Muttermythos freiwillig verlassen und sind für ihre Kinder in einem positiven Sinn »angreifbar« geworden.
Louis SchützenhöferSeptember 2013
Einleitung
Drei Anliegen
»Wie kommst du auf die Idee, ausgerechnet ein Buch über Mütter zu schreiben?« Das war die häufigste Reaktion meiner Freunde und Bekannten, wenn ich ihnen von meinen Plänen erzählte. Ich bin zwar Psychologe, habe mich aber ein Berufsleben lang mit anderen Bereichen des menschlichen Verhaltens beschäftigt. Ich bin auch keine Mutter, um für dieses Thema kompetent zu sein, nicht einmal Vater. Mein einziger unmittelbarer Zugang ist der, dass ich Sohn bin. Die eigene Mutterbeziehung ist sicherlich ein Grund für mein Interesse an diesem Thema, aber mein bewusster Auslöser für das Schreiben dieses Buches ist ein anderer: Es ist meine Erfahrung, dass sehr viele Menschen eine problematische Mutterbeziehung haben, die sie ein Leben lang nicht loslässt. Und im Gegensatz dazu, gewissermaßen als Kontrastprogramm, besteht in der Öffentlichkeit nach wie vor ein Muttermythos, der an Heiligenverehrung erinnert.
Mein erstes Anliegen ist es daher, an diesem Mythos1 zu rütteln, denn er stellt eine gewaltige Hürde für die betroffenen Töchter und Söhne dar, sich sachlich und ohne Angst und Schuldgefühle mit der eigenen Mutterbeziehung auseinander zu setzen. Denn Kritik zu üben an der Mutter, sich selbst einzugestehen, dass sie diesem hehren Bild nicht entspricht, ist so etwas wie Sünde. Und es tut weh, denn jedes Kind möchte eine Mutter, die es lieben kann.
Susanne, die als Tochter einer »lieblosen Mutter« noch zu Wort kommen wird, bringt diese Sehnsucht zum Ausdruck:
»Ich wollte ja auch eine Mutter haben, die ich lieben kann. Ich wollte sie ja immer lieben, und ich möchte sie, nachdem sie jetzt nicht mehr lebt, in einer liebevollen Erinnerung haben.«
Die Konfrontation der betroffenen Kinder mit dem Muttermythos führt zunächst zu einer Verzerrung oder Verleugnung der Wahrnehmung, denn: Es kann nicht sein, was diesem Mythos widerspricht. Und in weiterer Folge entstehen Schuldgefühle, denn wenn alle Mütter gut sind und ich Probleme mit meiner habe, so kann es ja nur an mir liegen. Ich bin ein schlechtes Kind. Ich muss mich noch mehr anstrengen, damit meine Mutter mich liebt.
Mein zweites Anliegen ist es, den Betroffenen zu sagen, dass sie mit ihren Problemen keine Außenseiter sind und dass es mehr Leidensgenossinnen und -genossen gibt, als sie bisher angenommen haben. Ich schätze den Anteil der Kinder mit einer problematischen Mutterbeziehung auf 40 bis 60 Prozent. Dennoch finden solche Menschen in der Regel keine Gesprächspartner, denen sie ihr Herz ausschütten könnten. Die Kinder mit einer befriedigenden Mutterbeziehung würden sie nicht verstehen und die vermeintliche Außenseiterposition der Betroffenen noch verstärken. Und die mit ähnlichen Problemen würden wegen der Angst, sich zu »versündigen« und Schuld auf sich zu laden, lieber weiter schweigen.
So nehmen viele dieser Kinder erst sehr spät bewusst wahr, dass ihre Mutter »anders« ist. Und dies auch erst dann, wenn sie positive Beispiele kennenlernen. Fehlt der Vergleich mit anderen Müttern, so ist eben die eigene der nicht hinterfragte Maßstab. Es war für mich immer wieder erstaunlich, wie lange es dauert, bis den Kindern die Augen aufgehen, selbst wenn das Verhalten der Mutter mehr als auffällig ist. Petra, die wir im Kapitel über »lieblose Mütter« noch kennenlernen werden, erinnert sich zum Beispiel:
»Als kleines Kind habe ich es nicht so gesehen. Mit 16, 17 Jahren habe ich erst erkannt, wie streng sie im Vergleich zu anderen Müttern ist.«
Und es dauerte dann noch einmal sehr lange, bis sie die »Sprachlosigkeit« überwinden und mit ihrer Mutter darüber reden konnte:
»An meinem 37. Geburtstag war es, dass ich mit meiner Mutter zum ersten Mal geredet habe. Da ist viel aufs Tableau gekommen. Da habe ich einfach einmal gefragt: ›Mama, hast du mich einmal gefragt, wie es mir geht?‹«
»Meine Mutter liebt mich nicht so, wie ich bin«, »Meine Mutter liebt mich überhaupt nicht« – bis solche Wahrheiten erkannt und akzeptiert werden können, vergeht meist ein halbes Menschenleben. Wenn es reicht. Bei Helga, die uns ebenfalls als Tochter einer »lieblosen Mutter« einiges zu erzählen hat und die selbst Psychologin und Psychotherapeutin ist, dauerte es bis zum 47. Lebensjahr, dass sie befreit sagen konnte:
»Ich habe dann erst für mich selber den Mut gehabt, es so zu benennen, dass meine Mutter andere sehr wohl lieben konnte, aber mich nicht geliebt hat.«
Aber zu dieser Zeit sind die Male, die diese Kinder von ihren Müttern erhalten haben, die »Muttermale«, schon längst weitergegeben an die nächste Generation. Denn es stellte sich in meinen Interviews klar heraus und entspricht auch den Ergebnissen der Beziehungsforschung: Schäden in der Mutter-Kind-Beziehung wirken sich äußerst ungünstig auf den eigenen Erziehungsstil und den Bindungsstil aus. Und so reproduzieren sich problematische Mutter-Kind-Beziehungen immer weiter. Es sei denn, die Tochter oder der Sohn unterbricht diese unheilvolle Kette und arbeitet die bitteren Erfahrungen auf.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Das Buch ist nicht gegen Mütter geschrieben, sondern für Töchter und Söhne. Sie sollen einen Anstoß bekommen, ihre problematische Mutterbeziehung zu hinterfragen und aufzuarbeiten. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die eine besonders befriedigende oder auch nur eine »normale« Mutterbeziehung haben, seien Sie zufrieden und legen Sie das Buch wieder zur Seite. Es ist nicht für Sie geschrieben.
Den anderen aber – und das ist mein drittes Anliegen – möchte ich Mut machen, die gestörte Mutterbeziehung aufzuarbeiten und dafür, wenn es nötig sein sollte, auch den Weg zum Therapeuten/zur Therapeutin nicht zu scheuen. Einige Hinweise für eine Aufarbeitung finden Sie am Ende des Buches. Besonders hilfreich wäre es, und das möchte ich an dieser Stelle anregen, wenn sich Selbsthilfegruppen bilden würden. In diesen können die Betroffenen über die Therapie hinaus Möglichkeiten für das Gespräch und den Erfahrungsaustausch finden.
Muttertypen
Subjektiv mögen die meisten Töchter und Söhne den Eindruck haben: »Meine Mutter ist einzig und unvergleichlich«, egal, ob es sich um eine befriedigende oder eine problematische Beziehung handelt. In der Realität ist es dann doch etwas anders. Da lassen sich Häufungen von Eigenschaften und Verhaltensweisen bei Müttern und Kindern und Zusammenhänge zwischen ihnen feststellen. Letztlich konnte ich aufgrund der Interviews, die ich mit Töchtern und Söhnen führte, eine begrenzte Anzahl von »Muttertypen« herausfiltern, die sich recht gut voneinander abgrenzen lassen.
Genau genommen handelt es sich dabei nicht um Muttertypen, sondern um Typen von Mutter-Kind-Beziehungen. Ein und dieselbe Mutter kann sich ihren Kindern gegenüber durchaus unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Beziehungen herstellen. Es kommt eben auch auf die Eigenart des Kindes und die Familienkonstellation an. Wenn also im Folgenden der Einfachheit halber von Muttertypen die Rede ist, so sind damit immer Typen von Mutter-Kind-Beziehungen gemeint.
Was ist eigentlich ein Typ? In der Psychologie und in den angrenzenden Wissenschaften hat die Suche nach Typen eine lange Tradition. Sie kennen vermutlich die Temperamentstypen, die auf Hippokrates zurückgehen, den »Sanguiniker«, den »Melancholiker«, den »Choleriker« und den »Phlegmatiker«.
Eine weitere Typologie stammt von Ernst Kretschmer; sie definiert Körperbautypen und ihre Zusammenhänge mit psychischen Eigenschaften bzw. Krankheiten. Der Vorteil der Kretschmer-Typologie besteht darin: Ich brauche den Körperbau eines Menschen nicht im Detail zu beschreiben, es genügt, ihn einem Typ zuzuordnen. Wenn sich z. B. in einem Partnerinserat jemand als »typischer Pykniker« bezeichnet, so weiß man gleich (sofern man die Kretschmerschen Typen kennt), dass es sich um einen Mann mit eher rundlichen Formen und einer Neigung zum Fettansatz handelt und dass man einen aufgeschlossenen und geselligen Menschen erwarten kann, dessen Stimmungslage von Heiterkeit bis Traurigkeit variiert.
Doch zurück zu unserem Thema: Ich fand in den Interviews vier Typen von Müttern und deren problematische Beziehungen zu ihren Kindern. Es sind dies
die Machtmutter,
die Opfermutter,
die narzisstische Mutter und
die lieblose Mutter.
Mit diesen vier Typen sollen möglichst alle Arten von problematischen Mutter-Kind-Beziehungen erfasst sein und im Idealfall treten diese Typen in reiner Form auf, sodass jede Beziehung ohne Schwierigkeiten einem dieser Typen zugeordnet werden kann. Aber so einfach spielt es das Leben leider nicht. Wie in allen Typologien treten auch bei den Muttertypen häufig Mischformen auf, bei denen eine klare Zuordnung erschwert oder unmöglich ist.
Ein Muttertyp bzw. ein Typ von Mutter-Kind-Beziehung ist definiert durch charakteristische Verhaltensweisen der Mütter und der Kinder und die Wechselwirkungen zwischen ihnen. Neben den Formen problematischer Mutter-Kind-Beziehungen gibt es selbstverständlich völlig unauffällige und besonders befriedigende, doch die sind nicht Thema dieses Buches.
Was ist eigentlich eine »problematische« Mutter-Kind-Beziehung? Man könnte etwa sagen, dass eine solche dann vorliegt, wenn die für den jeweiligen Muttertyp charakteristischen Verhaltensweisen besonders gehäuft oder in besonderer Ausprägung auftreten. Das ist aber nur die eine Seite. So richtig problematisch wird es erst dann, wenn das Kind »mitspielt«. Aber hat es überhaupt eine andere Chance, als mitzuspielen, da es doch in den ersten Lebensjahren weitgehend auf die Mutter angewiesen ist und von ihr geprägt wird? Überraschenderweise ja. Ich fand durchaus Fälle, in denen sich das Kind dem »Spiel« entziehen konnte, obwohl seitens der Mutter die »Einladung« dazu bestand. Am ehesten ist dies möglich, wenn sich das Kind aufgrund seiner Eigenart für die vorgesehene Rolle nicht eignet. Die Mutter kann sich das Kind, zum Unterschied vom Partner nicht aussuchen. Und obwohl sie alle Möglichkeiten der Beeinflussung hat, ist das Kind doch nicht beliebig formbar. Es ist kein unbeschriebenes Blatt, das die Eltern als Wunschzettel für ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse benutzen können. Aber es ist für das Kind in der Regel sehr schwer, sich den Anforderungen der Mutter zu entziehen. Etwas leichter ist es dann, wenn ein anderes Kind diese Rolle bereits übernommen hat.
Tiefeninterviews als empirische Basis
Die Basis für die Definition und Darstellung der Typen von Mutter-Kind-Beziehungen bilden 50 Tiefeninterviews, die ich mit Töchtern und Söhnen geführt habe. Die Interviews wurden schriftlich protokolliert oder auf Tonband aufgezeichnet und später transkribiert. Ein Interview dauerte ein bis vier Stunden, wobei manche in mehreren Sitzungen durchgeführt wurden. Die Stichprobe kann selbstverständlich keinerlei Anspruch auf Repräsentativität erheben, da sie zahlenmäßig zu klein ist und keine Zufallsauswahl darstellt. Ich achtete lediglich darauf, eine gute altersmäßige Streuung zu erreichen, um nicht zu einseitige zeitgeistige Einflüsse zu erhalten.
Das Durchschnittsalter der Interviewten beträgt 43 Jahre, die jüngste Interviewpartnerin war 18, die älteste 84 Jahre alt. Die ersten Interviews führte ich im eigenen Bekanntenkreis durch, und ich wurde dann an weitere GesprächspartnerInnen »weitergereicht«.
Damit gerät man natürlich meist an Personen mit einer problematischen Mutterbeziehung, um die es mir ja in erster Linie ging. Es war mir aber auch wichtig, ein Gefühl für die Unterschiede zwischen unauffällig verlaufenden und problematischen Fällen zu bekommen und ich achtete daher darauf, Personen mit »normaler« Mutterbeziehung in ausreichender Zahl zu befragen.
Natürlich wäre es wünschenswert, eine repräsentative Untersuchung mit einer genügend großen Anzahl von Interviews zu haben, um damit auch statistisch gesicherte Aussagen machen zu können. Dies ist aus dem Grund kaum möglich, da es sich bei den Tiefeninterviews um eine sehr aufwändige Methode handelt. Die Interviews dauern sehr lange und es muss zuvor eine Vertrauenssituation hergestellt werden, damit dieses emotionale Thema überhaupt besprochen werden kann. Darüber hinaus muss man in mehr als 10 Prozent der Fälle Absagen hinnehmen, wenn Interviewpartnerinnen oder -partner, aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit sind, über ihre Mutterbeziehung zu sprechen. Es lässt sich denken, dass dies vornehmlich dann zutrifft, wenn eine sehr problematische und belastende Beziehung vorliegt. Charakteristisch war die Aussage einer potentiellen Interviewpartnerin, die bereits zugesagt hatte, dann aber ungefähr mit den Worten absagte: »Jetzt habe ich endlich mühsam meinen Frieden mit der Mutter hergestellt. Ich möchte ihn nicht gefährden.« Andere waren für das Gespräch durchaus dankbar, da es zur Klärung der Beziehung beitragen konnte oder sogar so etwas wie therapeutischen Charakter für sie hatte.
Richard, Sohn einer »Machtmutter«, der sich nach eigenen Angaben vor dem Interview mit seiner Mutterbeziehung noch nicht auseinander gesetzt hatte, drückt sein Gefühl nach dem Gespräch so aus:
»Es ist alles so, wie ich es gesagt habe, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, dass ich schlecht über sie gesprochen habe. Ich habe fast ein Schuldgefühl und einen bitteren Nachgeschmack. Ich fühle mich jetzt unbehaglich und kann es nicht genau beschreiben. Es ist kein Triumphgefühl. Sie tut mir Leid.«
Die Gespräche gehen in der Regel sehr tief und müssen das wohl auch. Mit einer der üblichen Haushalts-, Straßen- oder gar Telefonumfragen könnte man an dieses sensible Thema nicht herangehen. Oder wie würden Sie reagieren, wenn jemand auf der Straße auf Sie zukäme und Sie mit einem Fragebogen in der Hand überfallen würde: »Beschreiben Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter.« Man kann nicht erwarten, dass sich in einer solchen Situation jemand öffnen und wahrheitsgemäß antworten würde. Außerdem werden manche Erlebnisse erst im Laufe eines langen Gespräches ins Bewusstsein gehoben.
Um die Muttertypen und die Beziehungen zwischen Mutter und Kind nicht nur zu beschreiben, sondern auch lebendig werden zu lassen, kommen die betroffenen Töchter und Söhne selbst zu Wort. Es wurden dafür solche Personen auserwählt, deren Mutterbeziehung möglichst klar einem Typ zugeordnet werden kann. Die Zitate, die für mich das Herzstück dieses Buches darstellen, sind wörtlich aus den Interviews übernommen und wurden nur an einigen Stellen zur besseren Lesbarkeit geringfügig verändert. Sie sprechen meist für sich und bedürfen kaum der Interpretation. Es mag manchmal schwierig sein, die Aussagen den Personen, die sie gemacht haben, zuzuordnen, da die Zitate nicht in einem Stück ablaufen, sondern nach Themen zusammengefasst sind. Es war aber meine Absicht, Zusammenhänge darzustellen, und nicht, Lebensgeschichten zu erzählen.
Die Interviewpartnerinnen und -partner, die in diesem Buch zitiert werden, stellen keineswegs Extremfälle dar. Ich stieß bei den Recherchen auf Schicksale von Kindern, deren Mütter sich auf eine nur schwer nachvollziehbare Art verhielten, Fälle, in denen es zum Beispiel zu sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie mit Duldung der Mutter gekommen war. Ich habe diese Interviews nicht berücksichtigt, denn es geht mir nicht darum, sensationelle Einzelschicksale darzustellen, sondern zu zeigen, dass die Tragödien problematischer Mutter-Kind-Beziehungen gerade in ihrer Alltäglichkeit bestehen. Es sind das auch durchwegs Menschen, die ihr Leben im beruflichen und im privaten Bereich meistern. Die Male, die sie tragen, sind nicht gleich sichtbar. Sie können sicher sein, dass sich Menschen mit solchen oder ähnlichen Schicksalen, wie ich sie beschrieben habe, in Ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Vielleicht haben Sie mit ihnen darüber gesprochen, vielleicht auch nicht. Vielleicht erkennen Sie sich selbst in einem der Kinder oder in einer der geschilderten Mütter wieder.
Ich stelle kein Panoptikum vor, sondern alltägliche Lebensgeschichten und Situationen. Ich habe lediglich genauer hingehört und Zusammenhänge herausgefiltert.
Die Vornamen der zitierten Töchter und Söhne wurden zum Teil auf deren Wunsch geändert, um die Anonymität zu wahren. Dabei befanden sich die meisten Betroffenen in einem Dilemma: Einerseits spürten sie den Wunsch, auch mit ihrem Namen zur eigenen Geschichte zu stehen, andererseits war da das berechtigte Bedürfnis nach Selbstschutz.
Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des jeweiligen Interviews.
Der Muttermythos
Zur Geschichte des Muttermythos
Der Mythos der Mutter, so mächtig und unveränderbar er uns auch erscheinen mag, ist weder gottgewollt noch naturhaft gegeben. Er ist vielmehr das Ergebnis wirtschaftlicher Bedingungen und gesellschaftlicher Prozesse. Das konnte Elisabeth Badinter (1984), die das »Muttergefühl« vom 17. Jahrhundert bis in die jüngere Gegenwart untersuchte, eindrucksvoll nachweisen.2 Der Muttermythos, wie wir ihn heute kennen, entstand erst im 19. Jahrhundert. Während man vorher Mutterschaft eher nüchtern betrachtete, entwickelte sich nun das Bild der »guten Mutter«, die selbstlos liebend sich für die Kinder aufopfert. Es galt als das höchste Ziel jeder Frau, Mutter zu werden. Das erfüllte sie voll und ganz. Es war unvorstellbar, dass sie Mutter und gleichzeitig etwas anderes ist. Eine zusätzliche Verklärung erhielt dieses Bild dadurch, dass die Mutter mit der Jungfrau Maria assoziiert wurde.
»Die Mutter wird jetzt mit einer Heiligen verglichen, und es kommt die Denkgewohnheit auf, dass eine gute Mutter nur eine ›heilige Frau‹ sein könne. Die naturgegebene Schutzpatronin dieser neuen Mutter ist die Jungfrau Maria, deren ganzes Leben von ihrer Hingabe für das Kind zeugt.« (Badinter, S. 178)
Die Kunst stellt sich ebenfalls in den Dienst dieser Mutterverehrung und wir verdanken dieser Epoche rührende biedermeierliche Mutterdarstellungen und Gedichte, die noch heute so manchen Muttertag »verschönern«.
Im letzten Jahrhundert machte der Muttermythos eine interessante Entwicklung durch. Den Auftakt bildete Sigmund Freud, der die Bedeutung der Mütter weiter steigerte, indem er ihre Wichtigkeit für die frühkindliche Entwicklung hervorhob. Die Kehrseite dieser Aufwertung war aber, dass die Mutter zum Sündenbock für alle Fehlentwicklungen des Kindes gestempelt wurde. Da er ferner annahm, dass den Frauen das richtige Verhalten als Mütter instinkthaft gegeben sei, musste er alle diejenigen, die dieser Rolle nicht gerecht wurden, als krank und abnorm bezeichnen. Nach Donald W. Winnicott, einem Kinderpsychologen in der Tradition Freuds, ergibt sich richtiges Bemuttern einfach dadurch, dass man Mutter ist. Die schlechte Mutter ist also nicht moralisch verwerflich, sondern krank. Dazu bemerkt Badinter: »Die Psychoanalyse hat also nicht nur die der Mutter zugeschriebene Bedeutung gesteigert, sie hat auch das Problem der schlechten Mutter zu einem medizinischen gemacht, ohne dass es ihr gelungen wäre, die moralischen Auffassungen des vorigen Jahrhunderts zunichte zu machen.« (S. 282)
Außerdem zementierte Freud die Frauen in der Rolle der Mütter ein, indem er postulierte, dass sie aufgrund ihrer Eigenschaften (ihrer Leidensfähigkeit und ihrer Passivität) dazu ausersehen seien. Winnicott richtete an die Mütter die aufmunternde und nicht etwa ironisch gemeinte Botschaft: »Freuen Sie sich darüber, dass Sie ernst genommen werden. Lassen Sie andere sich um die Welt sorgen, während Sie damit beschäftigt sind, ihr einen neuen Bürger zu schenken.« (Zit. nach Badinter, S. 251)
Unter dem Strich bleibt, dass die Mütter eine weitere Aufwertung erfuhren und gleichzeitig der Druck auf sie gesteigert wurde. Die Väter hingegen wurden entlastet. Es wurde ihnen von kompetenter Stelle attestiert, dass sie für diesen Job weniger bis gar nicht geeignet seien.
Im Nationalsozialismus war der Muttermythos ein wichtiges strategisches Instrument. Die Aufwertung der Mütter ergab sich allein dadurch, dass das Regime an Nachwuchs, insbesondere an männlichem, interessiert war. Bei der Mütterlichkeit nationalsozialistischer Prägung ging es mehr um Quantität als um Qualität: Je mehr Kinder, desto besser. Zur Motivation führte man das Mutterkreuz ein. Frauen mit mehr als vier Kindern erhielten ein solches aus Bronze, bei mehr als sechs Kindern gab es das Silberne und bei mehr als acht Kindern das Goldene Mutterkreuz.
Der nächste größere Eingriff erfolgte durch Simone de Beauvoir, die große Theoretikerin des Feminismus. Ihr Anliegen war es, den Muttermythos zu zerschlagen, um die Frau zu befreien. Sie sah in der Körperlichkeit der Frau, in ihrer Eigenschaft, Kinder gebären zu können, den Grund für ihre Zweitrangigkeit. Dadurch müsse sie sich mit häuslichen und alltäglichen Dingen beschäftigen und könne nicht am öffentlichen Leben teilnehmen.
Der Befund ist zweifellos richtig. Dennoch wollten ihrer radikalen Forderung nach künstlicher Befruchtung, um damit Sexualität und Fortpflanzung zu trennen, nicht einmal die Feministinnen mehrheitlich folgen. Mit den heutigen Reproduktionstechnologien könnte man dieser Forderung ohne weiteres nachkommen und sogar Zeugung und Reifung des Fötus außerhalb des Mutterleibes bewerkstelligen. Aber wer will das schon?
Die Feministinnen folgten dem Schritt von Simone de Beauvoir, die Eigenart der Frau abzulehnen, aus einem sehr einleuchtenden Grund nicht: Er würde dem Männlichen erst recht zum absoluten Sieg über das Weibliche verhelfen. Von Frauenrechtlerinnen wird seit den achtziger Jahren immer stärker betont, dass Frau sein eben nicht nur Mütterlichkeit, sondern einen besonderen Zugang zum Leben bedeute und Frauen somit für soziale Aufgaben nicht nur im privaten, sondern auch im gesellschaftlichen und politischen Leben prädestiniert seien. Die Frau habe keinen Grund für Minderwertigkeitsgefühle, sondern könne vielmehr stolz auf ihre Besonderheit sein, die sich zwar auf mütterliche Eigenschaften gründet, aber nicht auf Mutterschaft beschränkt. Eine Frau ist eben auch dann eine Frau, wenn sie kein Kind geboren hat.
Diese Betonung der Eigenart der Frau löst den lange vertretenen Standpunkt ab, dass Männlein und Weiblein von Natur aus gleich seien und das unterschiedliche Geschlechterverhalten nur darauf zurückzuführen sei, dass Buben und Mädchen unterschiedliche soziale Rollen lernen. Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte belegen, dass es den gar nicht so kleinen Unterschied zwischen Frauen und Männern eben doch gibt und dass er schon in die Wiege gelegt ist. Bereits im Kleinkindalter zeigen Buben und Mädchen unterschiedliche Verhaltensweisen: Buben lösen Konflikte aggressiver, Mädchen stecken eher zurück und verhalten sich ängstlicher und abhängiger. Diese Verhaltensunterschiede erwiesen sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen in alternativen Kindergärten in Deutschland (den sog. Kinderläden), in denen besonderer Wert auf geschlechtsneutrale Erziehung gelegt wurde, sogar als noch ausgeprägter als in traditionellen Einrichtungen. (Vgl. Bischof-Köhler, 2002, S. 18ff)
Der Muttermythos heute
Und wie steht es heute mit dem Muttermythos? Einige Autorinnen sehen die Position der Mutter bereits angegriffen und den Mythos abbröckeln. Ich kann mich dieser Einschätzung nicht anschließen. Ich finde es vielmehr erstaunlich, dass sich in der heutigen Zeit, in der Mythen durchleuchtet und Tabus gebrochen werden und die man mit einiger Berechtigung als respektlos bezeichnen kann, gerade die Mütter behaupten konnten. Die Spitzen der Gesellschaft, Staatsmänner, gekrönte Häupter, sogar der Papst, alle können angegriffen werden, können in Talkshows und Kabarettprogrammen durch den Kakao gezogen werden, die Mütter aber nicht. Die haben ihre Stellung auf dem Podest behalten. Frauen, insbesondere wenn sie blond sind, werden häufig zur Zielscheibe von Witzen, auch Schwiegermütter werden nicht verschont. Aber Mütter?
Eine originelle Ausnahme bildet der »Bulle von Tölz«, Ottfried Fischer. Was sich der seiner Mutter zu sagen getraut, bzw. was ihn der Drehbuchautor sagen lässt, ist überaus bemerkenswert. Die Rolle der sich aufopfernden und überall einmischenden Mutter wird mit viel Witz und Charme dargestellt. Der polternden und verzweifelten Abwehr des Sohnes merkt man die bereitwillige Resignation und das Ergeben in das vermeintliche Schicksal an, denn auf die Fürsorge der Mutter in Form von liebevoll und reichlich zubereitetem Essen und bereitgelegter Kleidung mag er nicht verzichten. Und so würde er wohl weiterhin im »Hotel Mama« logieren und dafür die Einmischung der Mutter in die Lösung von Kriminalfällen erdulden, hätte nicht der Tod der großartigen Schauspielerin Ruth Drexel die Fortsetzung dieser amüsanten und intelligenten TV-Mutter-Sohn-Beziehung verhindert.
Das Rollenverhalten der beiden Hauptfigueren in dieser Serie entspricht auch in dem Punkt der häufig anzutreffenden Realität, dass es nicht auf die Lösung des Konflikts ausgerichtet ist. Es ist auch bemerkenswert, dass das Publikum Ottfried Fischer die Grobheiten gegen die Mutter durchgehen lässt, ohne dass seine Sympathiewerte darunter leiden. Es ist dies darauf zurückzuführen, dass er zwar einen gewichtigen, aber auch »gemütlichen« Körperbau aufweist, der keine Aggressivität signalisiert. Die Dialektfärbung tut ein Übriges. Würde es sich dabei um einen hageren Mann mit scharf akzentuierter Sprache handeln, er dürfte sich dieses Verhalten wohl nicht ungestraft erlauben.
Auch die Tatsache, dass es vermehrt Romane von Frauen über »böse Mütter« gibt, wie zum Beispiel »Die Eisheiligen« von Helga M. Novak (1979), »Die Klavierspielerin« von Elfriede Jelinek (1983), »Die Züchtigung« von Waltraud Anna Mitgutsch (1985) und »Weißer Oleander« von Janet Fitch (1999), ändert nichts an meiner Einschätzung, dass der Muttermythos intakt ist. Diese Werke zeigen meiner Meinung nach nur, dass Mütter, die nicht dem Idealbild entsprechen, zu Romanfiguren inspirieren und nicht als Normalität gelten. Durch die überzeichnete Darstellung bzw. die Auswahl extremer Beispiele vermitteln die Autorinnen den Eindruck, dass böse Mütter etwas Krankhaftes und Abnormes seien und keine Bedeutung für das »normale« Leben haben. Im Leser wird die Reaktion »Sachen gibt’s« ausgelöst und er legt das Buch mit Abscheu oder wohligem Schauer und dem Bewusstsein aus der Hand: »Wie gut geht es mir als Tochter (oder Sohn)«, oder: »Was bin ich doch für eine gute Mutter.« Und die Folge davon ist, dass sich die Opfer einer problematischen Mutterbeziehung noch mehr in die Ecke des Abartigen gedrängt fühlen und noch weniger den Weg zum Öffnen und zur Aussprache finden.
Wiedergutmachung und Abstandszahlung
Ich bleibe dabei: Der Muttermythos ist unversehrt. Mag sein, dass gelegentlich am Sockel gekratzt wurde, aber selbst der kräftige Tritt, den Simone de Beauvoir dem Denkmal versetzte, konnte ihm letztlich nichts anhaben.
Für die Mütter ist er ein verdientes Dankeschön der Gesellschaft für die Leistungen, die sie für die Kinder und die gesamte Familie erbringen. Diese Verneigung ist nicht nur vor den »guten Müttern« berechtigt, sondern wohl vor jeder. Auch die nicht so gute Mutter hat das Kind ausgetragen und unter Schmerzen geboren, hat Entbehrungen und Enttäuschungen auf sich genommen. Sie hat möglicherweise ihre Lebensziele geopfert oder zumindest aus ihrer Sicht in aller Liebe das Beste gewollt. Der Mythos ist so etwas wie eine notwendige Wiedergutmachung. Denn würde die Mutter aus ihrem Muttersein so viel Freude, Glück und Zufriedenheit beziehen, wie es in Sonntagsreden häufig behauptet wird, wozu sie dann auch noch auf das Podest stellen?
Dies ist aber nur die eine Seite des Mythos. Da muss noch mehr dahinter sein. Es ist wenig wahrscheinlich, dass sich ein so mächtiges Phänomen wie der Muttermythos in einer männerdominierten Gesellschaft jetzt schon über zwei Jahrhunderte hält, nur aus Dankbarkeit gegenüber den Müttern. Da müssen schon handfeste Vorteile für die Männer den Ausschlag geben. Und so ist es auch.
Der Muttermythos ist die Abstandszahlung dafür, dass die Frau diese Rolle übernimmt und es dem Mann überlässt, sich im öffentlichen Leben zu verwirklichen. Zwar können die Männer den Frauen das Gebären nicht abnehmen, wohl aber das Versorgen und Aufziehen der Kinder. Der Muttermythos ist ein geringer Preis dafür, dass die Männer von diesen Aufgaben befreit sind und weitgehend unbehelligt von lästigen Konkurrentinnen im öffentlichen Leben wirken können.
Und die Frauen? Warum sollten sie die geschützte Position auf dem Sockel verlassen? Das eine, die angenehmen Auswirkungen des Muttermythos, haben sie sicher. Ob sie das andere, die Anerkennung und Befriedigung durch ihre Tätigkeit im öffentlichen Leben, tatsächlich erreichen, ist fraglich. Denn Männer sind in diesem Metier geübter und sie können sich häufig auf eingespielte »Seilschaften« verlassen. Und möglicherweise kommt ihnen auch die Evolutionsbiologie zustatten.
Frauen und Männer unterscheiden sich nach den Theorien dieser Wissenschaft hinsichtlich ihrer Fortpflanzungsstrategien: Frauen versuchen, dem Nachwuchs durch Fürsorge und Erziehung gute Startbedingungen im Daseinskampf zu verschaffen und so für die Weitergabe ihrer Gene zu sorgen. Männer müssen sich gegenüber Konkurrenten behaupten, um sich fortpflanzen zu können. Durch diesen Rivalitätsdruck wurden bei ihnen in der Evolution Verhaltensweisen gefördert wie Imponiergehabe und Selbstdarstellung bis zur Selbstüberschätzung, Freude am Wettbewerb und Resistenz gegenüber Misserfolg. Folgt man dieser These, so haben sich Männer in einem Jahrtausende langen Selektionsprozess Eigenschaften angeeignet, die ihnen Fortpflanzungspartnerinnen bescherten und die sie nun im Kampf um Positionen, auch gegenüber Frauen, gut gebrauchen können. Denn wer seine Ellbogen einzusetzen versteht, eher zu Selbstüberschätzung als zu Selbstzweifeln tendiert, sich imposant präsentieren kann und sich auch durch Misserfolge nicht entmutigen lässt, hat entscheidende Vorteile im Gerangel auf der Karriereleiter.
Um nicht missverstanden zu werden: Damit ist nicht gesagt, dass Frauen weniger Kompetenz haben, Spitzenpositionen auszufüllen, sondern lediglich, dass sie aufgrund ihrer Eigenart weniger geeignet sind, diese auch zu erlangen.
So kommt es, dass viele Frauen den Schritt in eine angemessene berufliche Karriere erst gar nicht wagen. Oder sie versuchen es, treten aber wegen mangelnder Unterstützung durch den Partner, die Kollegen und die Gesellschaft oder wegen ihrer Neigung, sich bei Misserfolg rasch entmutigen zu lassen, den Rückzug auf den Sockel des Mutterdenkmals an.
Das Ergebnis ist, dass der Muttermythos sowohl von Männern als auch von Frauen genährt wird. Von Männern, weil dadurch die Frauen von Positionen ferngehalten werden, die sie selbst anstreben, und von Frauen, weil sie fürchten, sonst zwischen zwei Sesseln zu sitzen zu kommen.
Rolle der Frau und Muttermythos
Brauchen die Frauen heute den Muttermythos überhaupt noch, um sich zu bestätigen? Haben sie nicht längst Einzug gehalten in das öffentliche Leben und dort bewiesen, dass sie ihre »Frau« stehen? Zweifellos ist ein Schritt in diese Richtung getan, aber wir sollten uns nicht darüber hinweg täuschen, dass viele Frauen die Definition über die Mutterrolle sehr wohl noch brauchen bzw. aufgrund der Umstände darauf reduziert werden.
Die Erfolge der Frauen schauen trotz Ministerinnen, Bankdirektorinnen und Firmenchefinnen quantitativ noch immer dürftig aus. Den Zugang zu den Bildungswegen haben sie sich erkämpft. Das ist unbestritten. Der Anteil der Frauen an den AbsolventInnen von Universitäten und hochschulverwandten Lehranstalten ist in Deutschland und Österreich in den letzten 50 Jahren von 15 Prozent auf rund 50 Prozent gestiegen. Das liest sich gut. Allerdings konnten die mit der höheren Bildung verbunden Positionen und Gehälter mit dieser Entwicklung bei weitem nicht Schritt halten. Unter den hauptberuflichen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an Universitäten sind nur 25 bis 30 Prozent weiblichen Geschlechts und unter den ProfessorInnen sinkt der Frauenanteil sogar unter die 10-Prozent-Marke.
Und ganz ähnlich sieht es mit den Gehältern aus: Frauen verdienen bei gleicher Arbeitszeit und gleicher Ausbildung nach wie vor deutlich weniger als Männer.
Leicht wird es den Frauen jedenfalls nicht gemacht, sich am Muttermythos vorbei im beruflichen Leben zu beweisen. Immerhin haben sie heute in einem bisher nicht gekannten Ausmaß die Möglichkeit, sich zwischen Mutterschaft und Kinderlosigkeit zu entscheiden. Die Frau, die keine Mutter ist, muss nicht mehr, wie noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, mit gesellschaftlicher Geringschätzung oder sogar Ächtung rechnen.
Aber das, was viele Frauen möchten, ist nicht die Wahlmöglichkeit, sondern die Freiheit, beides zu verwirklichen: Mutterschaft und berufliche Befriedigung. Und genau das wird ihnen sehr schwer gemacht. In diesem Fall kennt die Gesellschaft nach wie vor keinen Pardon. Auch die »Nicht-nur-Mutter« unterliegt voll den Anforderungen, die sich aus dem Muttermythos ergeben. Sie erhält keinen Rabatt und keinen Bonus für die Doppelbelastung. Herrad Schenk (1996) sieht in der Wahlmöglichkeit kein Ende des Muttermythos: »Sie darf neuerdings (…) auch andere Interessen haben, sie darf sogar einen Beruf ausüben – aber alle anderen Aktivitäten müssen gegenüber ihrem Engagement für die Familie von nachrangiger Bedeutung sein.« (S. 185)