
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Im September 2013, 100 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes der »Recherche«, begann bei Reclam mit »Auf dem Weg zu Swann« eine neue Übersetzung von Marcel Prousts Meisterwerk zu erscheinen, die erste komplett aus einer Hand, die erste auch, die von dem erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts edierten endgültigen französischen Text ausgeht. »Der Weg nach Guermantes« ist der dritte Band des insgesamt siebenbändigen Romanwerks. Die Ausgabe bietet in jedem Band einen ausführlichen Anmerkungsapparat, der jene historischen und kulturhistorischen Informationen enthält, die der moderne Leser erwartet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1517
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marcel Proust
Auf der Suchenach der verlorenen Zeit
Band 3Der Weg nach GuermantesÜbersetzung und Anmerkungenvon Bernd-Jürgen Fischer
Reclam
2014 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll und Friedrich Forsman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960608-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-010902-1
www.reclam.de
[5]Inhalt
Der Weg nach Guermantes
Erster Teil
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Anhang
Zum dritten Band der Ausgabe
Anmerkungen
Literaturhinweise
Inhaltsübersicht
Namenverzeichnis
Hinweise zur E-Book-Ausgabe
[7] FÜR LÉONDAUDET*
Dem Autor
DER REISE SHAKESPEARES,
DER ABREISE DES KINDES,
DES SCHWARZEN STERNS,
DER GEISTER UND LEBENDEN,
DER WELT DER BILDER,
SO VIELER MEISTERWERKE,
Dem unvergleichlichen Freund
ALS ZEUGNIS
DER DANKBARKEIT UND BEWUNDERUNG
M. P.
[9]ERSTER TEIL
Das morgendliche Tschilpen der Vögel erschien Françoise nur abgeschmackt. Jedes Wort der »bonnes« ließ sie zusammenfahren; von jedem ihrer Schritte belästigt, fragte sie sich, wofür sie denn gut sein sollten; wir waren nämlich umgezogen*. Sicher, die Dienstboten hatten sich im »Sechsten« unseres früheren Wohnhauses auch nicht weniger bewegt; die aber kannte sie; ihr Kommen und Gehen war für sie zur vertrauten Angelegenheit geworden. Nun jedoch brachte sie sogar der Stille eine leiderfüllte Aufmerksamkeit entgegen. Und da unser neues Viertel ebenso ruhig zu sein schien, wie der Boulevard, an dem wir bisher gewohnt hatten, laut war, trieb der Gesang (deutlich selbst von fern, wenn er so leise erklingt wie ein Orchester-Motiv) eines vorübergehenden Mannes der exilierten Françoise Tränen in die Augen. Aber wenn ich mich einerseits über sie lustig gemacht hatte, die untröstlich darüber war, eine Wohnung verlassen zu müssen, in der man »von allen so hoch geachtet« wurde, wo sie, den Riten von Combray getreu, weinend ihre Koffer gepackt und beteuert hatte, dass unsere bisherige allen anderen denkbaren Wohnungen weit überlegen gewesen sei, kam ich andererseits, der ich mich mit ebenso großer Schwierigkeit an neue Dinge gewöhnte, wie ich alte mit Leichtigkeit aufgab, unserer alten Dienerin wieder näher, als ich sah, wie sie von dem Einzug in ein Haus, wo sie vom Concierge, der uns noch nicht kannte, die für ihr seelisches Wohlbefinden unabdingbaren Bezeugungen der Wertschätzung noch nicht empfangen hatte, in einen dem Siechtum nicht unähnlichen Zustand versetzt worden war. Sie allein konnte mich verstehen; ihr junger Laufbursche hätte das gewiss nicht getan; für ihn, den so wenig mit Combray verband wie nur möglich, war umziehen, in einem anderen Viertel wohnen, wie Urlaub, wobei die Neuheit der Dinge so viel Erholung schenkte, [10] wie es eine Reise getan hätte; er kam sich vor wie auf dem Land; und ein Schnupfen vermittelte ihm, wie ein »Windstoß« durch das schlecht schließende Fenster eines Eisenbahnwagens, das köstliche Gefühl, weit herumgekommen zu sein; bei jedem Niesen freute er sich, eine so schicke Stelle gefunden zu haben, wo er sich doch schon immer Herrschaften gewünscht hatte, die viel reisen würden. Also wandte ich mich direkt an Françoise, ohne weiter an ihn zu denken; so wie ich über ihre Tränen bei einem Abschied gelacht hatte, der mich kaltließ, zeigte sie sich eisig angesichts meiner Traurigkeit, da sie diese teilte. Mit der angeblichen »Sensibilität« der Nervösen wächst ihr Egoismus; sie können bei anderen die Zurschaustellung von Beschwerden nicht ertragen, denen sie bei sich selbst zunehmende Aufmerksamkeit widmen. Françoise, die auch die geringfügigste Unpässlichkeit nicht unbemerkt vorübergehen ließ, wenn sie selbst sie verspürte, wandte den Kopf ab, wenn ich litt, damit ich nicht das Vergnügen hätte, mein Leiden beklagt, ja, nur bemerkt zu sehen. Genauso machte sie es, sobald ich mit ihr über unsere neue Wohnung sprechen wollte. Im übrigen, als sie nach zwei Tagen aus der, die wir gerade verlassen hatten, einige zurückgebliebene Kleidungsstücke holen musste, während ich infolge des Umzugs noch »Temperatur« hatte und mich wie eine Boa, die einen Bullen verschluckt hat, von einem langen Buffet schmerzlich gebläht fühlte, das mein Blick erst noch zu »verdauen« hatte, kam Françoise zurück und erklärte mit der Treulosigkeit der Frauen, dass sie auf unserem alten Boulevard zu ersticken gemeint habe, dass sie sich auf dem Weg dorthin »völlig aus dem Gleis« gefühlt, dass sie noch niemals derart unbequeme Treppen zu Gesicht bekommen habe, dass sie »nicht für ein Königreich« dort wieder wohnen wollen würde, gäbe man ihr auch Millionen – eine müßige Annahme –, und dass alles (das heißt, alles was Küche und Korridore anbetraf) in unserer neuen Wohnung viel besser »gerichtet« [11] sei. Nun, es ist an der Zeit zu sagen, dass es sich bei dieser Wohnung, in die wir gezogen waren, weil es meiner Großmutter nicht sehr gut ging und sie bessere Luft brauchte, wobei wir uns gehütet hatten, ihr diesen Grund zu nennen, um ein Appartement handelte, das zum Stadtpalais der Guermantes gehörte.
In dem Alter, in dem die Namen, da sie uns das Bild des nicht Erkennbaren bieten, das wir selbst in sie hineingelegt haben, und uns dadurch in dem Augenblick, in dem sie auch für uns einen wirklichen Ort bezeichnen, zwingen, das eine mit dem anderen so sehr gleichzusetzen, dass wir uns aufmachen, in einer Stadt eine Seele zu suchen, die sie nicht enthalten kann und die wir doch nicht mehr aus ihrem Namen vertreiben können, sind es nicht nur die Städte und Flüsse, denen sie eine Individualität verleihen wie allegorische Gemälde, ist es nicht nur das physikalische Universum, das sie in unterschiedlichen Farben schillern lassen und mit Wunderbarem erfüllen, sondern auch das gesellschaftliche Universum: Nun hat jedes Schloss, jedes berühmte Stadthaus oder Palais seine Dame oder seine Fee, wie die Wälder ihre Geister und die Gewässer ihre Gottheiten. Manchmal verwandelt sich die Fee, verborgen in der Tiefe ihres Namens, je nach den Wechselfällen im Leben unserer Phantasie, von der sie genährt wird; und so begann auch die Atmosphäre, in der Madame de Guermantes in mir existierte, ihre Farben, nachdem sie über Jahre der bloße Widerschein eines Glases der Laterna magica oder eines Kirchenfensters gewesen war, zu verblassen, als ganz andere Träume sie mit schäumenden Schwällen von Nässe schwängerten.
Indes, die Fee geht zugrunde, wenn wir uns der wirklichen Person nähern, der ihr Name entspricht, denn nun beginnt der Name diese Person widerzuspiegeln, und sie enthält nichts von der Fee; die Fee kann wiederauferstehen, wenn wir uns von der Person entfernen; doch wenn wir in ihrer Nähe verharren, stirbt die Fee [12] endgültig, und mit ihr der Name, wie die Familie der Lusignans, die an dem Tag erlöschen sollte, an dem die Fee Melusine endgültig verschwinden würde.* Von nun an ist der Name, unter dessen verschiedenen Übermalungen wir schließlich am Ursprung das schöne Porträt einer Fremden finden könnten, die wir niemals gekannt haben, nur noch das schlichte Ausweisfoto, auf das wir zurückgreifen, wenn wir wissen wollen, ob wir eine vorübergehende Person kennen, ob wir sie grüßen müssen oder nicht. Doch wenn eine Empfindung aus einem früheren Jahr – wie diese Geräte zur Musikaufzeichnung, die den Klang und den Stil der verschiedenen Künstler bewahren, die darauf einspielten – unserem Gedächtnis erlaubt, uns diesen Namen in jener besonderen Färbung hören zu lassen, die er damals für unser Ohr hatte, diesen dem Anschein nach unveränderten Namen, dann spüren wir den Abstand der Träume voneinander, die seine gleichgebliebenen Silben einen um den anderen für uns bezeichneten. Für einen Augenblick können wir aus der erneut gehörten Koloratur, die er in irgendeinem vergangenen Frühjahr aufgewiesen hatte, die treffenden, vergessenen, geheimnisvollen und frischen Abstufungen der Tage, an die wir geglaubt hatten uns zu erinnern, herausziehen wie kleine Tuben von jener Art, die man zum Malen benutzt, während wir doch wie schlechte Maler unserer ganzen, auf einer einzigen Leinwand hingestreckten Vergangenheit die konventionellen, allesamt gleichen Töne des bewussten Sich-Erinnerns verliehen hatten. Nun, ganz im Gegenteil, jeder der Augenblicke, aus denen sie sich zusammensetzte, verwendete für eine eigenständige Schöpfung, in einem einzigartigen Zusammenklang, die damaligen Farben, die wir nicht mehr erkennen und die mich, zum Beispiel, ganz unvermittelt wieder hinreißen, wenn dank irgendeines Zufalls der Name der Guermantes für einen Augenblick nach so vielen Jahren wieder den von seinem heutigen Klang so verschiedenen annimmt, den er [13] am Tag der Hochzeit von Mademoiselle Percepied für mich hatte, und er mir diese so sanfte, zu gleißende, zu neue Farbe von Malven wiederbringt, mit der sich das bauschige Halstuch der jungen Herzogin samten überzog, und ihre wie ein unpflückbares und wiedererblühtes Vergissmeinnicht von einem blauen Lächeln durchsonnten Augen. Und der Name der Guermantes von damals ist auch wie einer dieser kleinen Ballons, die man mit Sauerstoff oder einem anderen Gas gefüllt hat: Wenn es mir gelingt, ihn zum Platzen zu bringen, das heraustreten zu lassen, was er enthält, atme ich die Luft von Combray in jenem Jahr, an jenem Tage ein, untermischt mit einem Geruch nach Weißdorn, aufgerührt vom Wind aus der Ecke am Marktplatz, Vorbote des Regens, der abwechselnd die Sonne verschleierte und dann ihr wieder erlaubte, sich auf dem rotwollenen Teppich der Sakristei auszubreiten und sie mit dem leuchtenden, fast rosa Fleischrot von Geranien und mit dieser sozusagen Wagnerschen Milde im Jubel, die dem Fest so viel Adel bewahrt, zu überkleiden. Aber selbst wenn außerhalb der seltenen Augenblicke wie diesem, in denen wir plötzlich spüren, wie das ursprüngliche Wesen erschauert und seine Gestalt und Zier inmitten der inzwischen so toten Silben wieder annimmt, die Namen im schwindelerregenden Strudel des täglichen Lebens, in dem sie nur noch einem ganz und gar praktischen Gebrauch dienen, alle Farbe verloren haben wie ein regenbogenfarbener Kreisel, der sich zu schnell dreht und grau erscheint, so sehen wir doch auch umgekehrt, wenn wir in Träumereien befangen nachdenken und, um in die Vergangenheit zurückzukehren, versuchen, die beständige Bewegung, von der wir mitgerissen worden sind, zu bremsen, sie aufzuheben, wieder nach und nach, in Überlagerung, doch jede gänzlich verschieden von den anderen, die Farbtöne erscheinen, die uns ein und derselbe Name im Laufe unseres Daseins nacheinander darbot.
[14]Welche Gestalt sich vor meinen Augen bei diesem Namen Guermantes abzeichnete, als mich meine Amme – die zweifellos genauso wenig wie ich heute wusste, zu wessen Ehren es komponiert worden war – zu diesem alten Lied wiegte: Lobpreiset die Marquise von Guermantes, oder als einige Jahre später der alte Marschall von Guermantes mein Kindermädchen mit Stolz erfüllte, weil er in den Champs-Élysées stehenblieb, ausrief: »Was für ein schönes Kind!« und aus einer Bonbonschachtel ein Schokoladenplätzchen nahm, das weiß ich natürlich nicht. Diese Jahre meiner frühen Kindheit sind nicht mehr in mir, sie liegen außerhalb von mir, ich kann darüber, wie auch über das, was vor unserer Geburt geschehen ist, ausschließlich durch die Berichte anderer erfahren. Doch später finde ich in der Fortdauer dieses einen Namens in mir sieben oder acht verschiedene, einander ablösende Gesichter; die ersten waren die schönsten: Von der Wirklichkeit gezwungen, eine unhaltbare Stellung aufzugeben, verschanzte sich mein Traum von neuem ein bisschen weiter hinten, bis er abermals gezwungen wurde, zurückzuweichen. Und änderte zugleich mit Madame de Guermantes sein Domizil, das ebenfalls aus diesem Namen hervorgegangen war, den Jahr für Jahr dieses oder jenes aufgeschnappte Wort befruchtete, das meinen Träumereien neue Wendungen gab; dieses Domizil spiegelte sie sogar in seinen Steinen wider, die reflektierend geworden waren wie die Oberfläche einer Wolke oder eines Sees. Ein schwereloser Bergfried, der nur aus einem Streifen orangefarbenen Lichts bestand und von dessen Höhe herab der Lehnsherr und seine Dame über Leben und Tod ihrer Vasallen entschieden, hatte – ganz am Ende dieser »Seite von Guermantes«, auf der ich an so vielen schönen Nachmittagen mit meinen Eltern zusammen dem Lauf der Vivonne gefolgt bin – einer von Wildbächen durchströmten Landschaft Platz gemacht, in der die Herzogin mir das Forellenfischen und die Namen der violetten und rötlichen [15] Blütentrauben beibrachte, die die niedrigen Mauern der umliegenden Einfriedungen schmückten; dann war es das Erbland gewesen, das poetische Landgut, auf dem dieses hochmögende Geschlecht der Guermantes sich schon damals, gleich einem güldenen, kreuzblumengezierten Turm, der die Zeitalter durchquert, über Frankreich erhob, als der Himmel noch leer war an jenen Stellen, wo später Notre Dame de Paris und Notre Dame de Chartres aufragen sollten; damals, als sich noch nicht auf dem Kamm des Hügels von Laon das Schiff der Kathedrale niedergelassen hatte wie die Arche der Sintflut auf dem Gipfel des Berges Ararat, angefüllt mit Erzvätern und Gerechten, die sich angstvoll aus den Fenstern lehnen, um zu sehen, ob der Zorn Gottes sich gelegt hat, befrachtet mit allerlei Gewächs, das sich vermehren soll auf Erden, überquellend von Getier, das sich sogar bis in die Türme verteilt, auf deren Dächern Rinder* sich friedlich ergehen und von oben die Ebenen der Champagne betrachten; damals, als der Reisende, der Beauvais am frühen Abend verließ, noch nicht, wenn er sich umwandte, die schwarzen, verästelten, auf dem goldenen Fächer des Sonnenuntergangs entfalteten Flügel der Kathedrale ihm folgen sah*. Dieses Guermantes war wie der Entwurf eines Romans, wie eine imaginäre Landschaft, die ich mir nur mit Mühe vorstellen konnte und also erst recht zu entdecken begehrte, eine Enklave inmitten wirklicher Ländereien und Straßen, die sich zwei Meilen vor einem Bahnhof unverhofft mit heraldischen Eigentümlichkeiten sättigen würde; ich entsann mich der Namen benachbarter Ortschaften, als ob sie am Fuße des Parnass gelegen hätten oder des Helikon*, und sie erschienen mir von besonderem Wert als die materiellen Voraussetzungen – in einer topographischen Wissenschaft – für die Herbeiführung einer geheimnisvollen Naturerscheinung. Ich sah wieder die gemalten Wappenschilde auf den Sockeln der Kirchenfenster von Combray, deren Felder sich Jahrhundert um Jahrhundert mit all den Lehen [16] gefüllt hatten, die dieses illustre Haus durch Heirat oder Kauf aus allen Ecken Deutschlands, Italiens und Frankreichs auf sich versammelt hatte: Riesige Ländereien im Norden und mächtige Städte im Süden hatten sich zusammengeschart und unter dem Namen Guermantes vereinigt, um unter Aufgabe ihrer Dinglichkeit ihren grünen Bergfried oder ihr silbernes Kastell allegorisch in sein blaues Feld einzutragen. Ich hatte von den berühmten Wandteppichen von Guermantes gehört, und ich sah, wie sie sich mittelalterlich, blau und ein wenig grob wie eine Wolke vor dem amarantfarbenen legendären Namen am Rande des uralten Waldes abhoben, in dem Childebert so häufig jagte, und mir schien, ich könnte in die Geheimnisse des tiefen, rätselhaften Inneren dieser Ländereien, die Ferne dieser Jahrhunderte wie auf einer Reise schon allein dadurch eindringen, dass ich mich in Paris für einen Augenblick Madame de Guermantes näherte, der Herrin der Fluren und Dame vom See*, als müssten ihr Antlitz und ihre Worte den örtlichen Zauber der Hochwälder und der Ufersäume enthalten und die gleichen jahrhundertealten Besonderheiten aufweisen wie die alten Urteilssammlungen in ihren Archiven. Aber dann hatte ich Saint-Loup kennengelernt; er hatte mir erklärt, dass das Schloss erst seit dem 17. Jahrhundert Guermantes heiße, nachdem seine Familie es gekauft hatte. Sie hatte bis dahin zwar in der Nähe gewohnt, aber ihr Titel stammte nicht aus der Gegend. Das Dorf Guermantes hatte seinen Namen nach dem Schloss erhalten, es war erst nach diesem angelegt worden, und damit es nicht den Ausblick verschandelte, lastete eine noch immer wirksame Dienstbarkeit darauf, die den Verlauf der Straßen festlegte und die Traufhöhen begrenzte. Und die Wandteppiche von Boucher* waren von einem Liebhaber unter den Guermantes im 19. Jahrhundert erworben und Seite an Seite mit herzlich schlechten, von ihm selbst gemalten Jagdszenen in einem ausgesprochen hässlichen, mit falscher Seide und Plüsch [17] drapierten Salon aufgehängt worden*. Durch diese Eröffnungen hatte Saint-Loup in das Schloss Elemente eingeführt, die dem Namen gänzlich fremd waren und die es mir fortan verwehrten, allein aus dem Wohlklang der Silben das Mauerwerk der Gebäude abzuleiten. Damit war das Schloss, das sich am Grunde dieses Namens in seinem See spiegelte, ausgelöscht worden, und was mir von da an als Wohnung vor Augen trat, die Madame de Guermantes umgab, war ihr Stadtpalais in Paris, das Hôtel de Guermantes, rein und lauter wie ihr Name, denn kein materieller, undurchsichtiger Fremdkörper drohte seine Klarheit zu stören und zu trüben. So wie die Kirche nicht nur das Gotteshaus bezeichnet, sondern auch die Gemeinschaft der Gläubigen, so umfasste das Hôtel de Guermantes auch alle diejenigen, die am Leben der Herzogin teilhatten, doch diese Vertrauten, die ich niemals gesehen hatte, waren für mich nur berühmte und poetische Namen, und da sie ihrerseits ausschließlich Leute kannten, die ebenfalls nichts weiter als Namen waren, trugen sie nur noch dazu bei, das Mysterium der Herzogin zu erhöhen und zu beschützen und einen weiten Lichthof um sie zu breiten, der nur ganz allmählich schwächer wurde.
Da ich mir bei den Festen, die sie gab, zu den Geladenen keinen Körper, keinen Bart, keinen Stiefel vorstellte, keine Bemerkung, die banal oder auch nur auf eine menschliche, nachvollziehbare Weise originell gewesen wäre, bewahrte dieser Strudel von Namen, der weniger Substanz mit sich führte, als es ein Geistermahl oder ein Gespensterball um diese Meißner Porzellanfigur von einer Madame de Guermantes getan hätte, ihrem gläsernen Palais die Transparenz einer Vitrine. Als mir dann Saint-Loup Anekdoten über den Kaplan und über die Gärtner seiner Cousine erzählt hatte, war das Hôtel de Guermantes zu einer Art Schloss geworden, das – wie es einstmals vielleicht irgendein Louvre* gewesen sein mochte – mitten in Paris aufgrund eines uralten Rechts, das [18] seltsamerweise überlebt hatte, von seinen Erblanden umgeben war, auf denen sie noch feudale Privilegien genoss. Aber dieses letzte Domizil hatte sich von selbst in Luft aufgelöst, nachdem wir in der Nachbarschaft von Madame de Villeparisis in eines der Appartements neben dem von Madame de Guermantes in einem Flügel ihres Palais eingezogen waren. Es war eines dieser alten Gebäude, wie es sie vielleicht immer noch gibt und deren Ehrenhof – ob nun als Anschwemmungen, die die steigende Flut der Demokratie herantrug, oder ob als Erbe früherer Zeiten, in denen sich die Handwerke rund um den Lehnsherren ansiedelten – an seinen Seiten Läden und Werkstätten aufwies, sogar irgendwelche Schuhmacher- oder Schneiderbuden von der Art jener, die man sich an die Außenmauern der Kathedralen lehnen sieht, sofern der Schönheitssinn der Bauingenieure diese nicht freigeräumt hat, einen flickschusternden Hausmeister, der Hühner hielt und Blumen zog; und im Hintergrund, im »Wohnflügel« des Palais, eine »Gräfin«, die, wenn sie in ihrem alten Zweispänner ausfuhr, mit einigen Kapuziner-Blumen auf ihrem Hut, die dem Gärtchen der Pförtnerloge entsprungen zu sein schienen (und die neben dem Kutscher einen Lakaien hatte, der bei jedem hochherrschaftlichen Palais des Viertels abstieg und Karten knickte*), unterschiedslos ein Lächeln und ein grüßendes Winken den Kindern des Pförtners und den bürgerlichen Mietern des Anwesens zusandte, die in diesem Augenblick vorüberkamen und die sie in ihrer herablassenden Liebenswürdigkeit und ihrem egalitären Hochmut miteinander verwechselte.
In dem Haus, in das wir gerade eingezogen waren, war die große Dame am Ende des Hofes eine elegante und noch junge Herzogin. Es war Madame de Guermantes, und dank Françoise wusste ich sehr bald über das Palais Bescheid. Denn mit den Guermantes (die Françoise oft mit den Worten »da unten« oder »da hinten« bezeichnete) beschäftigte sie sich unablässig, vom Morgen an, wenn [19] sie einen verbotenen, unwiderstehlichen, verstohlenen Blick in den Hof warf, während sie Maman frisierte, und sagte: »Sieh an, zwei Ordensschwestern, das geht bestimmt nach da unten«, oder: »Oh!, die schönen Fasanen am Küchenfenster, da braucht man gar nicht erst zu fragen, von wo die kommen, der Herzog wird auf der Jagd gewesen sein«, bis zum Abend, wenn sie, während sie mir meine Sachen für die Nacht zurechtlegte, Klavierspiel hörte oder den Widerhall eines Liedchens und folgerte: »Die haben Besuch da hinten, da ist Stimmung«; in ihrem ebenmäßigen Gesicht, unter ihren mittlerweile weißen Haaren rückte ein lebensvolles, zurückhaltendes Jugendlächeln für einen Augenblick jeden ihrer Züge an seinen Platz und richtete sie hübsch in Reih und Glied aus wie zu einem Kontertanz.
Aber der Augenblick im Leben der Guermantes, der Françoises Interesse am heftigsten erregte, ihr die größte Befriedigung schenkte und sie zugleich am tiefsten bekümmerte, war genau der, in dem das Zufahrtstor seine beiden Flügel öffnete und die Herzogin ihre Kutsche bestieg. Das geschah für gewöhnlich kurz nachdem unsere Dienstboten damit fertig waren, jene Art von feierlichem Passah-Mahl zu zelebrieren, das niemand unterbrechen darf, ihr Mittagbrot genannt, und während dessen sie so gänzlich »tabu« waren, dass sich selbst mein Vater nicht erlaubte, nach ihnen zu klingeln, wohl wissend übrigens, dass sich auch beim fünften Mal niemand eher bequemen würde als beim ersten und er also diese Ungehörigkeit völlig vergeblich begangen haben würde, freilich nicht ohne selbst Schaden zu nehmen. Denn Françoise (die, seit sie eine alte Frau geworden war, zu allem und jedem das machte, was man eine »den Umständen entsprechende Miene« nennt) hätte es nicht verabsäumt, ihm den ganzen Tag über ein mit kleinen keilschriftlichen, roten Malen bedecktes Gesicht zu präsentieren, die nach außen hin in einer freilich kaum zu entziffernden Weise das [20] umfangreiche Memorandum ihrer Beschwernisse und die tiefinnersten Gründe ihrer Unzufriedenheit kundtaten. Sie erläuterte sie zudem auch gern noch näher, jedoch nur ins Abseits, so dass wir die Worte nicht recht verstehen konnten. Sie nannte das – wovon sie übrigens glaubte, dass es uns zur Verzweiflung bringen würde, dass es »beschämend« und »peinlich« für uns sei – den lieben Tag lang »stille Messen« lesen.
Waren die letzten Riten vollzogen, goss sich Françoise, die wie in der Urkirche Zelebrant und Gläubige zugleich war, ein letztes Glas Wein ein, nahm ihre Serviette vom Hals, faltete sie zusammen, wobei sie noch einen Rest rote Flüssigkeit oder Kaffee von ihren Lippen wischte, schob sie in einen Ring, dankte mit einem leidenden Augenaufschlag »ihrem« jungen Laufburschen, der, um seinen Eifer zu beweisen, zu ihr sagte: »Aber, Madame, noch ein paar Trauben; sie sind äquisit*«, und öffnete dann stracks das Fenster unter dem Vorwand, dass es einfach zu heiß sei »in dieser elenden Küche«. Während sie den Fensterknauf drehte und Luft schöpfte, warf sie zugleich geschickt einen völlig desinteressierten Blick auf das andere Ende des Hofes, bezog von dort ganz beiläufig die Gewissheit, dass die Herzogin noch nicht fertig war, ließ ihre verächtlichen und leidenschaftlichen Blicke einen Augenblick lang auf dem angespannten Wagen ruhen und erhob ihre Augen, nachdem sie ihnen diesen kurzen Moment der Aufmerksamkeit für irdische Dinge vergönnt hatte, zum Himmel, dessen Reinheit sie schon zuvor erraten hatte, als sie die Weichheit der Luft und die Wärme der Sonne spürte; und sie betrachtete an der Ecke des Daches die Stelle, wo jedes Frühjahr direkt oberhalb des Schornsteins meines Zimmers Tauben nisteten ähnlich denen, die in Combray in ihrer Küche gegurrt hatten.
»Ah! Combray, Combray«, rief sie aus. (Und der fast gesungene Tonfall, in dem sie diese Beschwörung vortrug, hätte ebenso wie [21] die arlesinische* Reinheit ihrer Gesichtszüge eine mediterrane Herkunft Françoises vermuten lassen und dass die verlorene Heimat, die sie beweinte, nur eine Wahlheimat war. Aber vielleicht würde man sich da täuschen, denn es scheint, dass es keine Provinz gibt, die nicht ihren »Süden« hätte, und wie oft begegnet man nicht Savoyarden oder Bretonen, bei denen sich all diese sanften Verschiebungen der Längen und Kürzen vorfinden, die den mediterranen Dialekt kennzeichnen!) »Ah! Combray, wann werd’ ich dich wiedersehn, teure Heimaterde! Wann werde ich den lieben langen Tag unter deinem Weißdorn und unserem schönen Flieder wandeln können und dabei den Finken und der Vivonne lauschen, deren Gemurmel klingt, als flüstere jemand, statt diese elende Klingel von unserem jungen Herrn zu hören, der keine halbe Stunde vergehen lässt, ohne mich diesen vermaledeiten Flur entlangzuscheuchen. Und dann findet er auch noch, dass ich nicht schnell genug sei, man soll ihn wohl hören, noch bevor er geklingelt hat, und wenn man nur eine Minute zu spät kommt, dann ›verdrückt‹* er gleich die schrecklichsten Wutausbrüche. Ach!, mein liebes Combray!, vielleicht werde ich dich nur tot wiedersehen, wenn man mich wie einen Stein in die Grube meines Grabes werfen wird. Doch dann werde ich ihn nicht mehr riechen, deinen schönen leuchtendweißen Dorn. Aber auch im Todesschlaf werde ich wohl noch diese drei Klingelzeichen hören, die mich schon zu Lebzeiten verdammt haben.«
Doch sie wurde von den Rufen des Westenschneiders im Hof unterbrochen, jenes Mannes, der damals, als sie Madame de Villeparisis besuchte, meiner Großmutter so gut gefallen hatte und der einen nicht minderen Rang in der Wertschätzung Françoises einnahm. Er hatte gleich, als er hörte, wie sich unser Fenster öffnete, den Kopf gehoben und versuchte schon seit einem Weilchen, die Aufmerksamkeit seiner Nachbarin auf sich zu ziehen, um ihr einen [22] guten Tag zu wünschen. Die Koketterie des jungen Mädchens, das Françoise einmal gewesen war, läuterte dann für Monsieur Jupien* das mürrische Gesicht unserer betagten, von Alter, schlechter Laune und Ofenhitze träge gewordenen Köchin, und mit einer bezaubernden Mischung aus Zurückhaltung, Vertraulichkeit und Schamhaftigkeit sandte sie dem Westenschneider einen anmutigen Gruß, doch ohne ihm laut zu antworten, denn wenn sie auch die Anweisungen von Maman insoweit missachtete, als sie in den Hof schaute, so hätte sie ihnen doch nicht so weit getrotzt, dass sie einen Schwatz durchs Fenster gewagt hätte, was ihr, in den Worten von Françoise, »eine Gardinenpredigt« von Maman eingebracht hätte. Sie wies ihn auf die bespannte Kutsche hin, als wollte sie sagen: »Schöne Pferde, das!«, und murmelte dabei: »So eine alte Schapracke*!«, und zwar vor allem weil sie wusste, dass er ihr, mit der Hand am Mund, damit sie ihn verstünde, auch wenn er nur halblaut sprach, antworten würde: »Ihr könntet auch welche haben, wenn ihr wolltet, und vielleicht sogar noch mehr als die, aber ihr wollt das alles ja nicht.«
Und Françoise schloss nach einer bescheidenen, ausweichenden und entzückten Gebärde, die in etwa bedeutete: »Jeder nach seiner Fasson; hier macht man auf schlicht«, das Fenster, aus Angst, dass Maman kommen könnte. Dieses »ihr«, das mehr Pferde haben könnte als die Guermantes, das waren wir, aber Jupien sagte aus gutem Grund »ihr«, denn, abgesehen von gewissen, rein persönlichen Freuden der Eigenliebe (wie etwa der, mit einem entnervenden Lachen zu behaupten, sie sei gar nicht erkältet, wenn sie ohne Unterlass herumhustete und der ganze Haushalt fürchtete, sich an ihrer Erkältung anzustecken), lebte Françoise ähnlich jenen Pflanzen, die ein Tier, mit dem sie gänzlich eins geworden sind, mit dem Futter, das es erbeutet, ernährt, es für sie kaut, verdaut und ihnen in einem direkt assimilierbaren Endzustand anbietet, mit uns in [23] Symbiose; es waren wir mit unseren Tugenden, unserem Vermögen, unserem Lebensstil, unserer Stellung, die sich darum zu kümmern hatten, die kleinen Befriedigungen der Eigenliebe zu erwirtschaften, die – wobei noch das anerkannte Recht hinzukam, den Kult des Mittagsmahles gemäß den überkommenen Gebräuchen in Freiheit auszuüben, inklusive dem kleinen Luftschöpfen am Fenster danach sowie diversen Schlendereien durch die Straßen, wenn sie ihre Einkäufe machte, und ferner Ausgang am Sonntag, um ihre Nichte zu besuchen – den unverzichtbaren Beitrag zur Zufriedenheit in ihrem Leben ausmachten. Damit versteht man auch, dass Françoise an den ersten Tagen in den Fängen – in einem Haus, in dem die Ehrentitel meines Vaters noch nicht bekannt waren – eines Übels, das sie selbst als Misslichkeit* bezeichnete, so hatte verkümmern können, einer Misslichkeit in dem starken Sinne, den das Wort bei Corneille hat oder unter der Feder von Soldaten, die Selbstmord begehen, weil sie ihre Braut, ihr Dorf zu sehr »missen«. Die Misslichkeit von Françoise war nämlich gerade von Jupien bald behoben worden, denn er verschaffte ihr umgehend ein ebenso lebhaftes und noch erleseneres Vergnügen als das, das sie empfunden hätte, wenn wir uns entschlossen hätten, einen Wagen zu halten. »Vom Allerbesten, diese Juliens (Françoise passte gern neue Wörter an die an, die sie schon kannte)*, anständige Leute, und es steht ihnen ins Gesicht geschrieben.« Jupien hatte in der Tat begriffen und sagte das auch allen, dass wir, wenn wir keine Kutsche hielten, eben keine wollten. Dieser Freund von Françoise war selten zu Hause, da er eine Stelle in einem Ministerium bekommen hatte. Nachdem er zuvor mit dem »Wildfang«, den meine Großmutter für seine Tochter gehalten hatte, als Westenschneider tätig gewesen war, hatte er alles Interesse an der Ausübung dieses Berufs verloren, nachdem sich die Kleine, die damals schon, fast noch ein Kind, eine Rocknaht zu nähen verstand, als meine Großmutter [24] einen Besuch bei Madame de Villeparisis machte, der Damenschneiderei zugewandt hatte und Rocknäherin geworden war. Zunächst als »Nähmädchen« bei einer Schneiderin angestellt, um hier einen Stich zu machen, da einen Volant umzunähen, einen Knopf oder einen »Knipser« anzubringen oder ein Taillenband mit Nadeln abzustecken, war sie bald zur zweiten, schließlich ersten Kraft geworden, und da sie sich einen Kundenkreis von Damen aus der besten Gesellschaft herangezogen hatte, arbeitete sie zu Hause, das heißt in unserem Hof, meistens mit einer oder zwei ihrer jungen Kolleginnen aus der Werkstatt, die sie als Lehrlinge beschäftigte. Seitdem war Jupiens Anwesenheit weniger wichtig geworden. Zweifellos hatte die Kleine, die groß geworden war, noch oft Westen zu schneidern. Aber dank der Hilfe ihrer Freundinnen brauchte sie sonst niemanden. So hatte also Jupien, ihr Onkel, eine Stelle gesucht. Anfangs hatte er noch zu Mittag nach Hause kommen können, dann aber, nachdem er endgültig denjenigen ersetzt hatte, für den er eingesprungen war, erst zur Abendbrotzeit. Seine »Verbeamtung« vollzog sich glücklicherweise erst einige Wochen nach unserem Umzug, so dass die Freundlichkeit Jupiens lange genug ihre Wirkung ausüben konnte, um Françoise über die ersten schwierigen Tage ohne allzu großes Leid hinwegzuhelfen. Im übrigen muss ich, ohne den Nutzen leugnen zu wollen, den er für Françoise gewissermaßen als »Übergangsmedizin« hatte, bekennen, dass mir Jupien beim ersten Anblick nicht besonders gefallen hatte. Aus einigen Schritten Entfernung zerstörten seine Augen, die von einem teilnahmsvollen, untröstlichen und verträumten Blick überquollen, die Wirkung, die sonst seine vollen Wangen und seine blühende Gesichtsfarbe hervorgerufen hätten, und erweckten den Eindruck, er sei sehr krank oder gerade von einem schweren Trauerfall heimgesucht worden. Nicht nur war da nichts dergleichen, er erwies sich vielmehr, sobald er sprach, tadellos übrigens, als kalt [25] und spöttisch. Aus diesem Missklang zwischen seinem Blick und seinen Worten entsprang etwas Falsches, das nicht sympathisch war und durch das er wirkte, als fühle er selbst sich so peinlich befangen wie ein Gast in Alltagskleidung bei einem Empfang, auf dem alle im Frack sind, oder wie jemand, der einer Hoheit antworten muss und nicht recht weiß, wie man mit ihr spricht und, um diese Schwierigkeit zu umgehen, seine Sätze fast auf ein Nichts reduziert. Die von Jupien dagegen – denn das ist nur ein Vergleich – waren bezaubernd. Tatsächlich entdeckte ich recht schnell in ihm, womöglich in Entsprechung zu dieser Überflutung des Gesichts durch die Augen (auf die man nicht mehr achtgab, sobald man ihn erst einmal kannte), eine ungewöhnliche Intelligenz, eine der natürlichsten literarischen, die kennenzulernen mir je vergönnt war, und zwar in dem Sinne, dass er, wahrscheinlich ohne weitere Bildung, die kunstfertigsten Konstruktionen der Sprache beherrschte oder sie allein mit Hilfe einiger hastig überflogener Bücher in sich aufgenommen hatte. Die begabtesten Leute, die ich gekannt hatte, waren früh gestorben. So war ich überzeugt, dass auch das Leben von Jupien schnell enden würde. Er kannte Güte, Mitgefühl, die zartesten, großherzigsten Gefühle. Seine Rolle im Leben von Françoise war schon bald nicht mehr unverzichtbar. Sie hatte gelernt, ihn zu ersetzen.
Selbst wenn ein Lieferant oder Bediensteter uns irgendein Paket brachte und sie sich den Anschein gab, als nähme sie ihn gar nicht weiter zur Kenntnis, und ihm, während sie mit ihrer Arbeit fortfuhr, nur mit einer geistesabwesenden Miene einen Stuhl anbot, verstand Françoise die wenigen Augenblicke, die er in der Küche verbrachte, um auf Mamans Antwort zu warten, so geschickt zu nutzen, dass nur selten einer wieder ging, ohne die Gewissheit unauslöschlich in sein Gedächtnis eingeprägt mitzunehmen, dass wir, »wenn wir keine haben, keine haben, weil wir keine wollen«. [26] Wenn sie übrigens so großen Wert darauf legte, dass man wisse, dass wir »d’argent« hatten (denn sie wusste nichts vom Gebrauch dessen, was Saint-Loup als Teilungsartikel bezeichnete, und sagte: »avoir d’argent«, »apporter d’eau«)*, dass man wisse, dass wir reich waren, dann nicht, weil bloßer Reichtum, Reichtum ohne Tugend, in Françoises Augen das höchste Gut wäre, sondern weil Tugend ohne Reichtum ebenso wenig ihr Ideal war. Reichtum war für sie so etwas wie eine notwendige Bedingung für die Tugend, ohne die die Tugend ohne Verdienst wäre und ohne Reiz. Sie unterschied da so wenig, dass sie schließlich dem einen die Eigenschaften des anderen zuschrieb und Annehmlichkeit von der Tugend verlangte und Erbauliches im Reichtum erkannte.
Nachdem sie das Fenster, und zwar ziemlich schnell (sonst hätte Maman sie anscheinend »mit allen nur möglichen Beschimpfungen überhäuft«), wieder geschlossen hatte, begann Françoise seufzend, den Küchentisch aufzuräumen.
»Es gibt von den Guermantes auch welche, die wohnen Rue de la Chaise«, sagte der Kammerdiener, »ich hatte einen Freund, der da gearbeitet hat; er war der zweite Kutscher bei ihnen. Und ich kannte einen, aber nicht mein Kumpel von damals, sondern sein Schwager, der hat seine Zeit im Regiment mit einem Stallmeister vom Baron von Guermantes abgerissen. ›Aber was wollen Sie, schließlich ist das nicht mein Vater!‹*« fügte der Kammerdiener hinzu, der neben der Gewohnheit, die Schlager der Saison vor sich hin zu trällern, auch jene hatte, seine Rede mit den neuesten Witzchen zu spicken.
Françoise erkannte mit ihren müden Augen einer schon älteren Frau, die übrigens alles von Combray aus, in einer undeutlichen Ferne sahen, den Witz nicht, der in diesen Worten lag, wohl aber, dass da einer sein musste, denn sie hatten nichts mit dem Rest des Gesagten zu tun und waren mit Nachdruck von jemandem [27] vorgebracht, den sie als Spaßvogel kannte. Sie lächelte also mit einer wohlwollenden und begeisterten Miene, als wollte sie sagen: »Immer noch der alte, dieser Victor!« Außerdem war sie glücklich, denn sie wusste, dass Geistesblitzen dieser Gattung zuzuhören auf entfernte Weise mit diesen ehrsamen gesellschaftlichen Vergnügungen zu tun hatte, für die alle Welt sich fein macht und die Gefahr in Kauf nimmt, sich zu erkälten. Schließlich auch glaubte sie, dass der Kammerdiener ihr Freund sei, da er ihr gegenüber pausenlos und mit Entrüstung die schrecklichen Maßnahmen anprangerte, die die Republik gegen den Klerus ergreifen würde. Françoise hatte noch nicht begriffen, dass die schlimmsten unserer Gegner nicht diejenigen sind, die uns widersprechen und uns zu überzeugen suchen, sondern jene, die Nachrichten aufbauschen oder erfinden, die uns Sorgen bereiten können, wobei sie sich hüten, ihnen auch nur einen Anflug von Rechtfertigung mitzugeben, die unseren Schmerz lindern und uns vielleicht eine gewisse Achtung für eine Partei einflößen würde, die sie uns unbeirrt, zur Vervollkommnung unserer Qualen, als zugleich grauenerregend und siegreich frohlockend vor Augen führen.
»Die Herzogin muss mit denen allen verbandelt sein«, sagte Françoise und fing die Unterhaltung bei den Guermantes von der Rue de la Chaise wieder an, so wie man ein Stück beim Andante wieder aufnimmt. »Ich weiß nicht mehr, wer mir gesagt hat, dass einer von denen eine Cousine vom Herzog geheiratet hat. Auf jeden Fall ist es dieselbe ›Verwandtenschaft‹. Das ist eine große Familie, diese Guermantes!« fügte sie respektvoll hinzu, wobei sie die Größe dieser Familie zugleich auf die Anzahl ihrer Mitglieder wie auf den Glanz ihres Ruhmes gründete, so wie Pascal* die Wahrheit der Religion auf die Vernunft wie auch auf die Autorität der Heiligen Schrift. Denn da sie nur dieses eine Wort »groß« für beide Dinge hatte, kam es ihr so vor, als seien sie nur ein einziges, womit ihr [28] Vokabular, wie manche Edelsteine, stellenweise Fehler aufwies, deren Trübung auf das Denken von Françoise abfärbte.
»Ich frage mich, sind das nicht ›disse‹*, die ihr Schloss in Guermantes haben, zehn Meilen von Combray, dann müssen die auch mit ihrer Cousine aus Algier verwandt sein.« Wir fragten uns lange, meine Mutter und ich, wer diese Cousine aus Algier sein mochte, und fanden schließlich heraus, dass Françoise mit dem Namen Algier die Stadt Angers* meinte. Was in der Ferne liegt, kann uns vertrauter sein als das in der Nähe. Françoise, der der Name Algier wegen abscheulicher Datteln bekannt war, die wir zum Neujahrstag erhielten, kannte nicht den Namen Angers. Ihre Sprache, wie die französische Sprache überhaupt, und insbesondere ihr geographischer Begriffsapparat, wimmelte von Fehlern. »Ich wollte darüber schon mal mit ihrem Butler sprechen. – Wie redet man den an?« unterbrach sie sich, als stellte sie sich eine Frage des Protokolls; und antwortete sich selber: »Ah ja!, Antoine redet man den an«, als ob Antoine ein Titel sei. »Der müsste mir das sagen können, aber der ist eine richtige Herrschaft, ein schlimmer Pedant, man könnte denken, man hat ihm die Zunge abgeschnitten, oder dass er vergessen hat, das Sprechen zu lernen. Der erteilt einem nicht einmal Antwort, wenn man mit ihm spricht«, fügte Françoise hinzu, die »Antwort erteilen«* sagte wie Madame de Sévigné. »Aber«, fügte sie unaufrichtig hinzu, »sobald ich weiß, was in meinem eigenen Topf köchelt, kümmer’ ich mich nicht um den von anderen. So oder so, das ist alles nicht ganz koscher. Und dann ist das auch kein beherzter Mann (diese Würdigung könnte den Anschein erwecken, Françoise hätte ihre Meinung über Tapferkeit geändert, die nach ihren Worten, in Combray, Männer zu wilden Tieren herabwürdigte, aber mitnichten. »Beherzt« bedeutete nur »tatkräftig«*). Man sagt auch, dass er klaut wie ein Rabe, aber man muss nicht immer dem Getratsche glauben. Hier hauen alle [29] Hausangestellten ab, wegen dem Pförtner, die Hausmeistersleute sind neidisch und hetzen die Herzogin auf. Aber man kann schon ruhig sagen, dass das ein richtiger Faulpelz ist, dieser Antoine, und seine ›Antoinesse‹ taugt auch nicht mehr als er«, fügte Françoise hinzu, bei deren grammatischer Neuschöpfung auf der Suche nach einem Femininum zu Antoine, mit dem sie die Frau des Butlers bezeichnen könnte, zweifellos eine unbewusste Erinnerung an Chanoine und Chanoinesse wieder hochkam. Und damit lag sie nicht schlecht. Es gibt in der Nähe von Notre-Dame noch eine Straße mit dem Namen Rue Chanoinesse*, ein Name, der ihr (da sie nur von Chanoines bewohnt wurde) von den Franzosen von einst gegeben wurde, deren Zeitgenosse Françoise im Grunde genommen war. Übrigens gab es unmittelbar darauf ein weiteres Beispiel für diese Art, feminine Formen zu bilden, denn Françoise fügte hinzu: »Aber todsicher ist das die Herzogin von dem Schloss von Guermantes. Und in der Gegend ist sie Madame la Mairesse*. Das ist schon was.« – »Das seh’ ich auch so, das ist schon was«, sagte der Laufbursche mit voller Überzeugung, denn er hatte die Ironie nicht mitbekommen.
»Meinst du, mein Jungchen, dass das was ist? aber für Leute wie ›disse‹ ist Maire oder Mairesse sein nichts und dreimal nichts. Ah!, wenn das Schloss von Guermantes meins wäre, dann sähe man mich nicht oft in Paris. Wie kann das nur angehn, dass sich Herrschaften, Leute, die’s dicke haben wie Monsieur und Madame, in den Kopf setzen, in dieser elenden Stadt zu bleiben, statt nicht* sofort nach Combray zu fahren in dem Augenblick, wo sie frei sind und wo niemand sie zurückhält. Worauf warten die, um sich zur Ruhe zu setzen, wo sie doch alles haben; dass sie tot sind? Ah!, wenn ich nur trocken Brot zu essen und im Winter Holz zum Heizen hätte, dann wäre ich aber schleunigst wieder daheim in dem kleinen Haus von meinem Bruder in Combray. Da unten merkt [30] man wenigstens noch, dass man lebt, man hat nicht all diese Häuser vor der Nase, und es ist so still, dass man nachts zwei Meilen weit die Frösche quaken hört.«
»Das muss wirklich schön sein, Madame«, rief der junge Laufbursche begeistert, als sei dieses Merkmal ebenso charakteristisch für Combray wie das Leben in Gondeln für Venedig. Da er übrigens noch neuer im Haus war als der Kammerdiener, sprach er mit Françoise über Themen, die nicht für ihn interessant waren, sondern für sie. Und Françoise, die das Gesicht verzog, wenn man sie als Köchin bezeichnete, bezeugte dem Laufburschen, der von ihr als »der Haushälterin« sprach, jenes besondere Wohlwollen, das gewisse Fürsten zweiter Klasse gegenüber jungen Leuten an den Tag legen, die sie guten Glaubens mit »Hoheit«* anreden.
»Wenigstens weiß man, was man tut und welche Jahreszeit draußen ist. Nicht wie hier, wo es zum heiligen Osterfest ebenso wenig auch nur ein schäbiges Butterblümchen gibt wie zu Weihnachten, und wo ich nicht einmal ein kleines Angelusläuten* höre, wenn ich meine müden Knochen erhebe. Da unten, da hört man jede Stunde, es ist nur ein armseliges Glöcklein, aber du sagst dir: »Da, jetzt kommt mein Bruder vom Feld«, du siehst, wie der Tag zur Neige geht, man läutet um die Gaben der Erde*, du hast Zeit, dich umzudrehen, bevor du deine Lampe anmachst. Hier wird es Tag, es wird Nacht, man geht zu Bett, und man könnte ebenso wenig sagen wie die Tiere des Feldes, was man überhaupt gemacht hat.«
»Es scheint, dass Méséglise auch recht hübsch ist, Madame«, unterbrach der junge Laufbursche, für dessen Geschmack die Unterhaltung eine etwas zu abstrakte Wendung nahm und der sich zufällig daran erinnerte, wie wir bei Tisch von Méséglise geredet hatten.
»Oh!, Méséglise«, sagte Françoise mit dem breiten Lächeln, das [31] man stets auf ihre Lippen zauberte, wenn man die Namen Méséglise, Combray, Tansonville aussprach. Sie waren so sehr Bestandteil ihres eigenen Daseins, dass sie, wenn sie ihnen in der Fremde begegnete, sie in einer Unterhaltung hörte, eine Heiterkeit ähnlich der empfand, die ein Lehrer in seiner Klasse auslöst, wenn er auf irgendeine zeitgenössische Persönlichkeit anspielt, von der seine Schüler nie geglaubt hätten, dass ihr Name jemals von der Höhe des Katheders herab geäußert werden könnte. Ihr Vergnügen entsprang auch dem Gefühl, dass jene Gegenden für sie etwas waren, was sie für die anderen nicht waren, alte Kameraden, mit denen man schon so manches durchgemacht hat; und sie lächelte ihnen zu, als finde sie Geist in ihnen, denn sie fand in ihnen viel von sich selbst. »Ja, das kannst du wohl sagen, mein Junge, das ist schon ziemlich hübsch, Méséglise«, fuhr sie mit einem kennerischen Lachen fort; »aber wie kommt es denn, dass du davon gehört hast, von Méséglise?«
»Wieso ich von Méséglise gehört habe? Aber das ist doch sehr bekannt; man hat mir davon erzählt, sogar oft davon erzählt«, antwortete er mit dieser kriminellen Ungenauigkeit des Informanten, die es uns jedesmal, wenn wir uns klar darüber werden wollen, welche objektive Bedeutung eine Angelegenheit, die uns betrifft, für andere haben mag, unmöglich macht, dies zu erreichen. – »Ah!, ich sage euch, dort unter den Kirschbäumen ist’s besser als am Küchenherd.«
Sogar von Eulalie erzählte sie ihnen wie von einer netten Person. Denn seit Eulalie tot war, hatte Françoise völlig vergessen, dass sie sie zu Lebzeiten wenig gemocht hatte, wie sie überhaupt jedermann wenig mochte, der nichts zu beißen hatte, der »am Hungertuch nagte« und sich dann, wie ein rechter Taugenichts, dank der Güte der Reichen auch noch »aufspielte«. Sie litt nicht mehr darunter, dass Eulalie es so gut verstanden hatte, jede Woche [32] etwas bei meiner Tante »abzustauben«. Und auf diese nun sang Françoise nie endende Lobeshymnen.
»Das war aber in Combray selbst, bei einer Cousine von Madame, wo Sie damals waren?« fragte der junge Laufbursche. – »Ja, bei Madame Octave, ah!, eine wirklich fromme Frau, meine Lieben, und wo immer alles da war, und zwar vom Besten und vom Feinsten, eine gute Frau, das könnt ihr weitersagen, die weder Rebhühner beklagte noch Fasanen, gar nichts, bei der man zu fünft, zu sechst zum Essen kommen konnte, da war das Fleisch nicht zu knapp, und erste Qualität außerdem, und Weißwein, und Rotwein, halt alles, was es braucht.« (Françoise benutzte das Verb »beklagen«* im gleichen Sinne wie La Bruyère*.) »Immer alles ihre eigenen Aufwendungen, auch wenn die Familie Monate blieb, Jah-re.« (Diese Bemerkung hatte nichts Verletzendes für uns, denn Françoise stammte aus einer Zeit, in der »Aufwendungen« noch nicht für den juristischen Sprachgebrauch reserviert war und einfach Aufwand* bedeutete.) »Ah!, ich sage euch, da ging man nicht hungrig wieder fort. Wie es uns der Herr Pfarrer mehr als einmal unterstrichen hat, wenn es eine Frau gibt, die damit rechnen kann, geradenwegs zum lieben Gott zu kommen, aber sicher und gewiss, dann ist sie das. Arme Madame, ich höre noch, wie sie mir mit ihrer dünnen Stimme sagte: »Françoise, Sie wissen ja, ich esse nichts, aber ich möchte, dass es für alle so gut gibt, als ob ich mitessen würde.« Allerdings war das nichts für sie. Ihr hättet sie sehen sollen, sie wog nicht mehr als eine Tüte Kirschen; es war nichts mehr dran. Sie wollte mir nicht glauben, sie wollte nie zum Arzt gehen. Ah!, da unten, da würde man nichts so auf die Schnelle essen. Sie wollte, dass ihre Dienstboten anständig genährt sind. Aber hier, wir haben ja heute morgen schon wieder nicht mal die Zeit gehabt, uns auch nur einen Happen in die Backe zu schieben. Alles eine einzige Hetzjagd.«
[33]Sie war vor allem über den Zwieback aus geröstetem Brot erbittert, den mein Vater aß. Sie war überzeugt, dass er das nur aus Wichtigtuerei tat und um sie »tanzen« zu lassen. »Das kann ich Ihnen sagen«, stimmte der junge Laufbursche zu, »sowas hab ich noch nie gesehn!« Er sagte das, als habe er schon alles gesehen und als ob sich bei ihm das gesammelte Wissen aus einer tausendjährigen Erfahrung über alle Länder und ihre Gebräuche erstreckte, unter denen absolut nirgendwo der des Brotröstens vorkam. »Ja, ja«, murmelte der Butler, »aber das möchte schon noch anders kommen, die Arbeiter sollen einen Streik machen in Kanada und der Minister hat neulich abend zu Monsieur gesagt, dass er dafür zweihunderttausend Franc eingestrichen hat.« Der Butler war weit davon entfernt, ihm das zum Vorwurf zu machen, nicht etwa, weil er selbst nicht ganz ehrlich wäre, doch da er alle Politiker für unredlich hielt, erschien ihm die Straftat der Vorteilsannahme als weniger schwerwiegend denn das geringfügigste Diebstahlsdelikt. Er fragte sich nicht einmal, ob er diese historische Äußerung überhaupt richtig verstanden hatte, und war auch von der Unwahrscheinlichkeit nicht weiter verunsichert, dass der Schuldige selbst das zu meinem Vater gesagt haben sollte, ohne dass dieser ihn vor die Tür gesetzt hätte. Aber die Philosophie von Combray hinderte Françoise daran, hoffen zu dürfen, die Streiks in Kanada würden Rückwirkungen auf die Nutzung von Zwieback haben: »Solange noch die Welt besteht, wisst ihr«, sagte sie, »wird es Herren geben, um uns auf Trab zu halten, und uns Dienstboten, um nach ihrer Pfeife zu tanzen.« Ungeachtet dieser Theorie vom ewigen Trab sagte meine Mutter, die möglicherweise zur Bestimmung der Dauer von Françoises Mittagspause nicht die gleichen Maßstäbe benutzte wie diese, schon seit einer Viertelstunde: »Aber was machen die denn bloß, jetzt sind sie schon über zwei Stunden bei Tisch.« Und sie klingelte drei- oder viermal schüchtern. Françoise, ihr [34] Laufbursche, der Butler verstanden die Klingelzeichen keineswegs als Aufforderung, noch dachten sie auch nur daran, zu kommen, sondern vernahmen sie vielmehr wie die ersten Klänge der Instrumente, die gestimmt werden, bevor ein Konzert wieder beginnt, und an denen man merkt, dass nur noch wenige Minuten Pause bleiben. Als daher die Klingelzeichen begannen, sich zu wiederholen und beharrlicher zu werden, ließen sich unsere Dienstboten schließlich herbei, sie zur Kenntnis zu nehmen, und unter dem Eindruck, dass sie wohl nicht mehr viel Zeit vor sich hätten und die Wiederaufnahme der Arbeit nahe bevorstehe, stießen sie bei einem Glockenläuten, das ein wenig eindringlicher war als die anderen, einen Seufzer aus, sie ergaben sich in ihr Los, der Laufbursche ging nach unten und rauchte vor der Tür eine Zigarette, Françoise stieg, nach einigen Betrachtungen über uns, wie etwa »das sind ja die reinsten Zappelphilipps«, in ihren Sechsten hinauf, um ihre Sachen aufzuräumen, und der Butler, der sich Briefpapier aus meinem Zimmer geholt hatte, erledigte rasch seine Privatkorrespondenz.
Trotz der hochnäsigen Miene des Butlers der Guermantes hatte mich Françoise schon in den ersten Tagen darüber aufklären können, dass diese ihr Palais keineswegs aufgrund eines unvordenklich alten Rechts bewohnten, sondern eines ziemlich neuen Mietvertrags, und dass der Garten, auf den es an jener Seite hinausging, die ich nicht kannte, reichlich klein war und genau so wie die benachbarten Gärten; und ich erfuhr schließlich auch, dass es dort weder einen Femgerichtsgalgen noch eine befestigte Mühle zu sehen gab, keinen Fischteich, kein Taubenhaus auf Pfeilern, keinen Gemeindebackofen, keine Hallenscheune, kein Vorwerk, keine festen Brücken oder Zugbrücken, nicht einmal Fährbrücken, geschweige denn Mautner, keine Burgtürmchen, Mauerrechtsinschriften oder Siegesmale. Aber so wie Elstir der Bucht von Balbec, als sie ihr Geheimnis verloren hatte und für mich zu einem beliebigen, gegen [35] alle anderen austauschbaren Teil der salzigen Wassermassen des Globus geworden war, plötzlich eine neue Individualität verliehen hatte, indem er mir sagte, dass sie der opalene Golf in Whistlers blausilbernen Harmonien* sei, genauso hatte der Name Guermantes schon das letzte aus ihm hervorgegangene Gemäuer unter den Schlägen von Françoise dahingehen sehen, als uns ein alter Freund meines Vaters eines Tages sagte, als er auf die Herzogin zu sprechen kam: »Sie nimmt die höchste Stellung im Faubourg Saint-Germain* ein, sie führt das allererste Haus des Faubourg Saint-Germain.« Zweifellos stellte der führende Salon, das führende Haus im Faubourg Saint-Germain herzlich wenig neben den anderen Wohnsitzen dar, die ich mir im Laufe der Zeit erträumt hatte. Aber schließlich hatte dieser, und er musste ja der letzte sein, immer noch irgendetwas, sei es auch noch so Bescheidenes, das über seine eigene bloße Stofflichkeit hinausging, ein geheimes Unterscheidungsmerkmal.
Und für mich war es umso unerlässlicher, in einem »Salon« der Madame de Guermantes, in ihren Freunden das Geheimnis ihres Namens suchen zu können, als ich es nicht mehr in ihrer Person fand, wenn ich sie am Vormittag zu Fuß oder am Nachmittag im Wagen das Haus verlassen sah. Gewiss, sie war mir schon in der Kirche von Combray im grellen Blitz einer Metamorphose mit unnachgiebigen, für die Farbe des Namens Guermantes und der Nachmittage am Ufer der Vivonne undurchdringlichen Wangen anstelle meines zerschmetterten Traumes erschienen, wie ein Schwan oder eine Weide*, in die sich ein Gott oder eine Nymphe verwandelt hat, die, fortan den Gesetzen der Natur unterworfen, über das Wasser gleiten oder sich im Winde wiegen werden. Doch kaum war ich nicht mehr in ihrer Nähe, so hatten sich diese zerstobenen Spiegelungen, wie die rosa und grünen Spiegelungen der untergehenden Sonne hinter dem Ruder, das sie zerbrochen hat, [36] neu zusammengefügt, und in der Abgeschiedenheit meines Denkens hatte sich der Name eilends die Erinnerung des Gesichtes zu eigen gemacht. Aber jetzt sah ich sie oft an ihrem Fenster, im Hof, auf der Straße; und ich zumindest legte es, wenn es mir nicht gelang, sie mit diesem Namen Guermantes in Einklang zu bringen, zu denken, dass sie Madame de Guermantes war, der Unfähigkeit meines Geistes zur Last, bei der Tat, die ich von ihm verlangte, bis zum Ziel vorzustoßen; doch sie, unsere Nachbarin, schien den gleichen Fehler zu begehen; ihn obendrein ohne Bedenken, ohne irgendwelche meiner Gewissensbisse zu begehen, ohne auch nur den Verdacht, dass es ein Fehler sein könnte. So bewies Madame de Guermantes in ihren Kleidern ein Bemühen, der Mode zu folgen, als strebe sie in dem Glauben, eine Frau wie jede andere geworden zu sein, nach jener Eleganz der Toilette, in der jede x-beliebige Frau ihr gleichkommen, sie womöglich gar übertreffen könnte; ich hatte auf der Straße gesehen, wie sie eine gutgekleidete Schauspielerin mit Bewunderung betrachtete; und am Vormittag, wenn sie zu Fuß ausging, konnte ich sie – als sei die Meinung der Passanten, deren Gewöhnlichkeit sie erst richtig deutlich werden ließ, indem sie ihr unerreichbares Dasein unbeschwert unter ihnen spazierenführte, für sie maßgeblich – vor ihrem Spiegel erblicken, wie sie mit einer Hingabe, die jeglicher Verstellung und Ironie entbehrte, wie eine Königin, die sich bereit erklärt hat, in einer Komödie bei Hofe eine Kammerzofe darzustellen, mit Leidenschaft, Verdruss und Eitelkeit diese ihrer so unwürdige Rolle der eleganten Frau spielte; und in dem mythologischen Vergessen ihrer eigentlichen Größe überprüfte sie, ob ihr Schleier richtig saß, glättete sie ihre Ärmel und zupfte sie ihren Mantel zurecht, so wie der göttliche Schwan alle Bewegungen seiner tierischen Art ausführt, seine wie aufgemalten Augen zu beiden Seiten des Schnabels offen hält, ohne einen Blick hineinzulegen, und sich [37] unvermittelt auf einen Knopf oder einen Regenschirm stürzt, ganz Schwan, ohne Erinnerung daran, dass er ein Gott ist. Aber wie der Reisende, der vom ersten Anblick einer Stadt enttäuscht ist und sich sagt, dass er sich vielleicht ihren Reiz erschließen wird, indem er ihre Museen besucht, Bekanntschaft mit dem Volk schließt, in den Bibliotheken arbeitet, so sagte ich mir, dass ich, wenn ich erst einmal von Madame de Guermantes empfangen worden wäre, wenn ich einer ihrer Freunde wäre, wenn ich in ihr Dasein eingedrungen wäre, erkennen würde, was ihr Name unter seiner orangefarben glänzenden Hülle wirklich und objektiv für andere enthielt, denn schließlich hatte der Freund meines Vaters gesagt, dass das Milieu der Guermantes eine Sache für sich im Faubourg Saint-Germain sei.
Das Leben, das meiner Vermutung nach dort geführt wurde, leitete sich aus einer von der Erfahrung so gänzlich verschiedenen Quelle her und schien mir etwas so Besonderes sein zu müssen, dass ich mir die Anwesenheit von Personen, mit denen ich von früher bekannt war, von wirklichen Personen, auf Empfängen der Herzogin gar nicht hätte vorstellen können. Denn da sie nicht schlagartig ihr Wesen ändern konnten, hätten sie dort ganz ähnliche Reden geführt wie die, die ich kannte; ihre Geprächspartner hätten sich vielleicht so weit herabgelassen, ihnen in der gleichen menschlichen Sprache zu antworten; und es würde während eines Empfangs im führenden Salon des Faubourg Saint-Germain Augenblicke gegeben haben, die völlig identisch wären mit Augenblicken, die ich schon erlebt hatte: was unmöglich war. Zugegebenermaßen hatte mein Geist mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen, und die Anwesenheit des Leibes Jesu Christi in der Hostie erschien mir als kein dunkleres Geheimnis denn dieser führende Salon des Faubourg, der am rechten Ufer* lag und von dem ich in meinem Zimmer hören konnte, wie am Morgen die Möbel [38] ausgeklopft wurden. Aber die Demarkationslinie, die mich vom Faubourg Saint-Germain trennte, erschien mir, obwohl lediglich ideeller Natur, nur allzu wirklich; ich spürte deutlich, dass der Fußabtreter der Guermantes, der sich auf der anderen Seite dieses Äquators hinbreitete und von dem meine Mutter zu sagen gewagt hatte, er sei in ziemlich schlechtem Zustand, als sie ihn eines Tages, an dem die Tür offen stand, nicht anders als ich zu sehen bekam, dass das schon der Faubourg war. Außerdem, wie hätte ihr Speisezimmer, ihre dunkle Galerie mit den roten Plüschmöbeln, die ich manchmal aus unserem Küchenfenster sehen konnte, für mich denn nicht den geheimnisvollen Zauber des Faubourg Saint-Germain besitzen sollen, in essentieller Weise ein Teil davon sein, geographisch darin gelegen sein sollen, wo doch in diesem Speisesaal empfangen zu werden bedeutete, in den Faubourg Saint-Germain einzutreten, seine Atmosphäre einzuatmen, wo doch diejenigen, die sich, bevor man zu Tisch ging, neben Madame de Guermantes auf das lederne Sofa in der Galerie setzten, allesamt aus dem Faubourg Saint-Germain waren? Gewiss, auch außerhalb des Faubourg konnte man bei manchen Empfängen gelegentlich, majestätisch unter den gewöhnlichen Leuten thronend, elegante Erscheinungen sehen, einen dieser Männer, die nur aus Namen bestehen und die abwechselnd, wenn man versucht, sie sich vorzustellen, das Aussehen eines Ritterturniers und eines herrschaftlichen Waldes annehmen. Aber hier, im führenden Salon des Faubourg Saint-Germain, in der dunklen Galerie, gab es nur solche. Sie waren die Säulen aus kostbarem Material, die den Tempel trugen.* Selbst für ein zwangloses Beisammensein konnte Madame de Guermantes ihre Gäste nur unter ihnen auswählen, und bei Abendessen für zwölf Personen glichen sie, wenn sie um den gedeckten Tisch versammelt waren, den goldenen Apostelstatuen der Sainte-Chapelle, symbolische Pfeiler und Weihende* vor dem Tisch des Herrn. Und [39] was das kleine Stückchen Garten betraf, das hinter dem Palais zwischen hohen Mauern lag und in dem Madame de Guermantes im Sommer nach dem Abendessen Likör und Orangeade servieren ließ, wie hätte ich nicht denken sollen, dass es ebenso unmöglich sei, sich dort zwischen neun und elf Uhr am Abend auf die Eisenstühle – die mit nicht minderer Macht begabt waren als das Ledersofa – zu setzen, ohne die besondere Brise des Faubourg Saint-Germain zu verspüren, wie eine Siesta in der Oase von Figuig* zu halten, ohne damit auch in Afrika zu sein? Nichts kann wie die Einbildungskraft und der Glaube gewisse Gegenstände, gewisse Wesen von anderen absetzen und eine Atmosphäre schaffen. Doch ach!, es würde mir wohl niemals gegeben sein, meinen Schritt zwischen diese malerischen Stätten, diese Naturwunder, diese landschaftlichen Sehenswürdigkeiten, diese Kunstbauten des Faubourg Saint-Germain zu setzen. Und ich begnügte mich damit zu erschauern, wenn ich vom offenen Meer aus (und ohne Hoffnung, jemals anzulanden), wie ein vorgeschobenes Minarett, wie eine erste Palme, wie die Ankündigung menschlicher Tätigkeit und exotischer Vegetation, den abgenutzten Fußabtreter des Ufers liegen sah.
Doch während für mich das Palais der Guermantes an der Tür zu seiner Diele begann, schienen sich die dazugehörigen Gebiete sehr viel weiter zu erstrecken, jedenfalls nach Auffassung des Herzogs, der die Mieter insgesamt für Bauern, Lümmel, Usurpatoren nationaler Güter ansah, deren Meinung nicht zählt, der sich am Morgen im Nachthemd an seinem Fenster rasierte, der, je nachdem wie warm es war, in Hemdsärmeln, im Pyjama, in flauschigen schottischen Jacketts von ausgefallener Farbe, in kleinen hellen Mäntelchen, die kürzer waren als seine Weste, in den Hof hinunterkam und irgendein neues Pferd, das er gekauft hatte, an der Hand eines seiner Stallburschen vor sich her traben ließ. Mehr als [40] einmal ramponierte das Pferd die Auslage Jupiens, der den Herzog in Empörung versetzte, als er von ihm Ersatz des Schadens verlangte. »Schon allein wenn man an all die Wohltaten denkt, die die Frau Herzogin dem Haus und der Pfarrgemeinde erweist«, sagte Monsieur de Guermantes, »ist es eine Frechheit von diesem Individuum, etwas von uns zu verlangen.« Aber Jupien hatte nicht nachgegeben und schien auch beim besten Willen nicht zu wissen, welche »Wohltaten« die Herzogin jemals erwiesen hatte. Sie hatte das zwar, doch da man diese nicht auf jedermann ausweiten kann, ist die Erinnerung daran, sie über dem einen ausgeschüttet zu haben, Grund genug, einem anderen gegenüber darauf zu verzichten, bei dem man dann nur noch mehr Unzufriedenheit erregt. Im übrigen erschien dem Herzog über den Gesichtspunkt der Wohltätigkeit hinaus das Viertel – und zwar über eine große Distanz – bloß wie eine Weiterführung seines Hofes, ein verlängerter Auslauf für seine Pferde. Nachdem er gesehen hatte, wie ein neues Pferd an der Hand trabte, ließ er es anspannen und durch sämtliche benachbarten Straßen fahren, wobei der Stallbursche neben dem Wagen herlief, die Zügel hielt und ihn wieder und wieder am Herzog vorbeiführte, der aufrecht, hünenhaft, massig, hell gekleidet, Zigarre im Mund, mit hocherhobenem Kopf und Monokel im Anschlag auf dem Fußweg stand bis zu dem Augenblick, da er auf den Sitz sprang, selbst die Zügel des Pferdes übernahm, um es zu erproben, und mit seinem neuen Gespann davonfuhr zu einem Rendezvous mit seiner Mätresse in den Champs-Élysées. Monsieur de Guermantes grüßte im Hof zwei Paare, die mehr oder weniger seiner Welt zugehörten: eine Verbindung zwischen einer seiner Cousinen und einem seiner Cousins, die wie in einer Arbeiterfamilie beide nie zu Hause waren, um die Kinder zu versorgen, denn am Morgen ging die Frau in die »Schola«, um Kontrapunkt und Fuge zu studieren, und der Mann in sein Atelier, um Holzschnitzereien und [41] gepunzte Lederarbeiten herzustellen; sowie den Baron und die Baronin von Norpois, die stets in Schwarz gekleidet waren, die Frau wie eine Stuhlvermieterin und der Ehemann wie ein Leichenträger, und mehrmals am Tag erschienen, um in die Kirche zu gehen. Sie waren Neffe und Nichte des alten Botschafters, den wir kannten und den mein Vater kürzlich auf dem Treppenabsatz getroffen hatte, ohne recht zu verstehen, woher er kam; denn mein Vater dachte, dass eine so gewichtige Persönlichkeit, die mit den bedeutendsten Männern von ganz Europa in Verbindung gestanden hatte und wahrscheinlich völlig gleichgültig gegenüber den eitlen Hierarchien der Aristokratie war, schwerlich Umgang mit diesen obskuren, klerikalen und bornierten Adligen haben könnte. Sie wohnten erst seit kurzem im Haus; Jupien war gerade, als der Gatte Monsieur de Guermantes begrüßen wollte, dazugekommen, um ihm etwas zu sagen, und hatte ihn, da er seinen Namen nicht genau kannte, »Monsieur Norpois« genannt. »Ah!, Monsieur Norpois, ah!, das ist wahrhaft gelungen! Nur Geduld, bald wird Sie diese Person Bürger Norpois nennen!« rief Monsieur de Guermantes zum Baron gewendet aus. Endlich konnte er seinem Groll gegen Jupien Luft machen, der nur »Monsieur« zu ihm sagte und nicht »Monsieur le Duc«.
Als Monsieur de Guermantes eines Tages eine Auskunft brauchte, die mit dem Beruf meines Vaters zusammenhing, hatte er sich ihm selbst mit großer Liebenswürdigkeit vorgestellt. Seitdem hatte er öfter den einen oder anderen nachbarschaftlichen Dienst von ihm zu erbitten, und sobald er ihn die Treppe hinunterkommen sah, in Gedanken mit irgendeiner Arbeit beschäftigt und nur darauf aus, jede Begegnung zu vermeiden, verließ der Herzog seine Pferdeknechte, ging über den Hof zu meinem Vater, rückte ihm mit der angeborenen Dienstfertigkeit einstiger Kammerdiener von Königen den Kragen seines Mantels zurecht, nahm seine Hand [42]


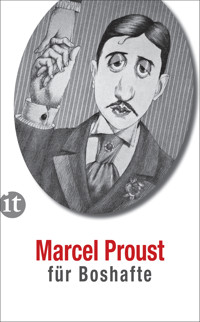

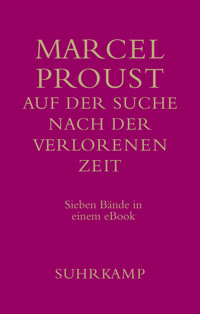
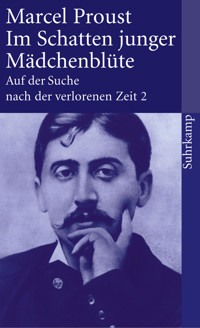

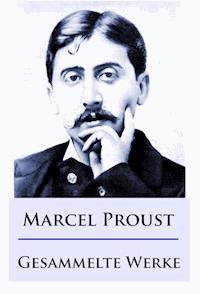


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)


















