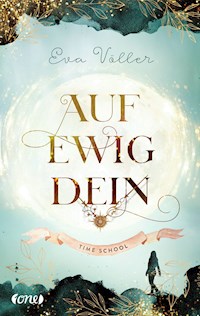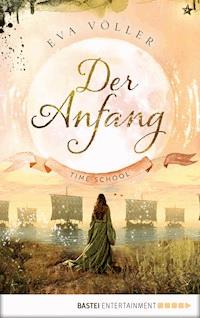9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Time School
- Sprache: Deutsch
Neue Herausforderungen für Anna und Sebastiano! Ein Unbekannter hat die Zeitmaschine gestohlen und im Jahr 1873 rund um die Welt neue Portale geschaffen. Menschen aus der Zukunft drohen so, für immer in der Kolonialzeit zu stranden.
Der Fremde verstrickt Anna gegen ihren Willen in ein teuflisches Spiel, bei dem sie und ihre Freunde von der Time School eine historische Reise rund um die Welt machen und die Portale schließen müssen - in achtzig Tagen! Gewinnen sie, bekommen sie die Zeitmaschine zurück. Scheitern sie, ist nicht nur das Spiel verloren. Denn dann erwartet auch Sebastiano ein schreckliches Schicksal ...
Der zweite Band der erfolgreichen Jugendbuch-Reihe von Eva Völler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatTeil 1Venedig, 1786Venedig, Gegenwart1873Teil 2Teil 3Hongkong, 1873Chinesisches Meer und Pazifik, 1873Teil 4New York, GegenwartNew York, 1873DanachÜber dieses Buch
In achtzig Tagen um die Welt – sieh zu, dass du nicht zu langsam bist. Willst du gewinnen? Dann mach keinen Fehler. Scheiterst du? Dann wird es kein Entrinnen geben. Neue Herausforderungen für Anna und Sebastiano! Ein Unbekannter hat die Zeitmaschine entwendet und droht, die ganze Menschheit ins Chaos zu stürzen. Rund um die Welt entstehen plötzlich Zeitdurchgänge. Diese führen aber nur in die Vergangenheit und nicht ohne Weiteres zurück – unzählige Menschen drohen so, für immer in der Kolonialzeit zu stranden! Während Anna und Sebastiano noch versuchen, diese Durchgänge zu versiegeln, stellt sich Anna ein unheimlicher Mann in den Weg. Er fordert sie zu einem Spiel auf, für das Anna und ihre Freunde von der Time School eine historische Reise rund um die Welt machen müssen. In achtzig Tagen! Gewinnen sie, bekommen sie die Zeitmaschine zurück. Scheitern sie, ist nicht nur das Spiel verloren. Dann muss auch Sebastiano sterben … Der zweite Band der erfolgreichen Jugendbuch-Reihe von Eva Völler.
Über die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.« Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
Eva Völler
Time School
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2018 Eva Völler
Copyright Deutsche Originalausgabe © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München, unter Verwendung von Motiven von © Kanate/shutterstock; Shukaylova Zinaida/shutterstock; fractal-an/shutterstock; Saibarakova Ilona/shutterstock; Eisfrei/shutterstock; motion_dmitriy/shutterstock; Anastasiia Veretennikova/shutterstock; Banana Oil/shutterstock; Allgusak/shutterstock; xpixel/shutterstock; Anastasiia Veretennikova/shutterstock; Discovod/shutterstock
E-Book-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5702-8
one-verlag.de
luebbe.de
Für Leonie
Die Zeit mag, was noch dunkel ist, erhellen.Heim bringen steuerlos manch Boot die Wellen.
(William Shakespeare, Cymbeline)
Teil 1
Venedig, 1786
Ich finde, er sieht viel besser aus«, sagte Fatima. »Und jünger.«
»Jünger und besser als wer?«, wollte Ole wissen.
»Als er selbst natürlich.«
»Wie kann jemand jünger und besser aussehen als er selbst?«
»Er sieht jünger und besser aus als er selbst auf dem Bild«, gab Fatima ungeduldig zurück.
»Pst!«, mischte ich mich ein. »Ihr fallt mit eurem Gerede schon auf!«
Tatsächlich hatten sich bereits einige Köpfe in unsere Richtung gewandt. Fatima und Ole störten eindeutig die feierliche Stimmung, und das war gar nicht gut. Denn es gehörte zu unserem Job als Zeitwächter, bei unseren Einsätzen nicht aufzufallen. Wenn wir auffielen, konnte alles Mögliche schiefgehen. Und da wir bei diesem Einsatz im Jahr 1786 keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe persönlich das Leben retten mussten, konnten wir gar nicht vorsichtig genug sein.
Der Festakt, den wir gerade beobachteten, war ein sehenswertes Ereignis mit einem Aufzug aller möglichen venezianischen Würdenträger in historischen Gewändern. Gefeiert wurde eine siegreiche Seeschlacht gegen die Türken, mit denen Venedig über Jahrhunderte hinweg im Krieg gelegen hatte.
»Ich finde nicht, dass er besonders beeindruckend und berühmt aussieht«, fuhr Ole fort, ohne auf meine Ermahnung zu achten. »Nicht halb so eindrucksvoll wie zum Beispiel der da.« Er zeigte auf eine prunkvolle Barke, die im Kanal vor der Kirche angelegt hatte. Der da war der Doge höchstpersönlich, der soeben über eine mit Teppichen ausgelegte Brücke an Land schritt. Umhüllt von einem schleppenverzierten Talar und mit der goldenen, wie ein nach hinten wachsendes Horn geformten Kappe auf dem Kopf stach er tatsächlich ins Auge, genauso wie die vielen Adligen mit ihren pompösen bodenlangen Gewändern und den wallenden blonden Lockenperücken. Gemessenen Schrittes zogen sie der Reihe nach zur Kirche.
»Diese Männer sehen wahrlich prächtig aus«, erklärte Ole mit Bewunderung in der Stimme.
»Das zeigt nur wieder, wie unterentwickelt dein Modegeschmack ist«, kritisierte Fatima.
Insgeheim stimmte ich ihr zwar zu, aber es war weder der richtige Ort noch die passende Zeit, um über Mode zu streiten, zumal die beiden sich bei diesem Thema sowieso nicht einig werden konnten. Als waschechter Wikinger aus dem zehnten Jahrhundert stellte Ole keine großen Anforderungen an sein Outfit. Hauptsache, die Sachen waren bequem und rochen gut. Dagegen besaß Fatima, die aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammte, ein unbestechliches Auge für guten Stil. Sie hatte sich nach ihrem Wechsel in die Gegenwart blitzschnell den aktuellen Modeströmungen angepasst und kannte sich mit allen angesagten Looks und coolen Accessoires bestens aus, während man bei Ole aufpassen musste, dass er nicht aus Versehen mit seinem alten Lederharnisch und der Streitaxt am Gürtel aus dem Haus ging.
An diesem Tag trug er einen etwas zu engen Gehrock und dazu ein Paar grobe Stiefel, die mindestens zweihundert Jahre zu alt für diese Zeit waren. Die feineren Schnallenschuhe, die ich ihm für den heutigen Einsatz herausgesucht hatte, waren ihm suspekt, seiner Ansicht nach zogen so etwas nur Frauen an.
»Dieser Job ist langweilig«, beschwerte sich Fatima, die mit ihrem federgeschmückten Hütchen und dem figurbetonten Seidenkleid aussah, als sei sie gerade dem schicksten Modejournal des ausgehenden Rokokos entstiegen. »Es passiert überhaupt nichts. Wir stehen die ganze Zeit nur herum.«
Wir standen tatsächlich schon seit über einer halben Stunde hier auf dem Vorplatz der Kirche und warteten. Das Dumme war – es konnte noch länger dauern. Im ungünstigsten Fall mussten wir bis zum Ende des Tages an der Sache dranbleiben. Oder vielmehr: an unserer Zielperson Goethe.
Der Dichterfürst stand ganz in unserer Nähe und betrachtete mit interessierter Miene die Prozession der Würdenträger. Ab und zu machte er sich Notizen. Wie ich aus den für diesen Einsatz zusammengestellten Unterlagen wusste, hatte er über seine gesamte erste Italienreise der Jahre 1786 bis 1788 akribisch Buch geführt, auch über den heutigen Tag. Dummerweise hatte die Zeit genau an der Stelle einen Knick (eine Falte, eine Krümmung, eine falsche Abzweigung, ganz egal, wie man es sich vorstellt), die ihn das Leben kosten konnte. Es war unsere Aufgabe, diese gefährliche Alternativentwicklung zu verhindern. Allerdings hatten wir aus den Bildern unseres magischen Weissagungsspiegels nur den ungefähren Zeitraum des schädlichen Ereignisses herauslesen können, nicht die exakte Uhrzeit. Manchmal funktionierte es eben nicht genauer.
Sebastiano schob sich quer durch die Menge der Zuschauer und trat neben mich. Bei seinem Anblick weitete sich meine Brust, und ich spürte meinen Herzschlag. Obwohl wir uns schon so lange kannten, konnte ich gegen diese Reaktion nicht das Geringste ausrichten – und wollte es auch gar nicht, denn es zeigte mir, dass unsere Liebe viel stärker war als die Zeit. Zwischen uns gab es nichts Flüchtiges und Vergängliches. Sebastiano bildete in meinem Leben die Basis, er war der Anker, an dem sich alles festmachte – mein Alltag, meine Gefühle, meine Hoffnungen. Und das Gute war, dass es ihm genauso erging.
Bei uns beiden hätte wirklich alles perfekt sein können, wenn es nicht diese Schatten gegeben hätte, die auf unserer gemeinsamen Zukunft lagen. Wir wussten, dass im Hintergrund Feinde lauerten, die nur auf ihre Gelegenheit warteten, und einige von ihnen hatten es auf uns persönlich abgesehen. Wir hatten keine andere Wahl, als extrem vorsichtig zu bleiben.
Doch an diesem sonnigen Herbsttag im Venedig des Jahres 1786 mussten wir einfach nur unseren Job erledigen und uns um Goethe kümmern, damit der Faust und andere bahnbrechende Werke noch das Licht der Welt erblicken konnten.
Was Goethe genau passieren würde, wussten wir nicht – der Spiegel hatte uns nur verraten, dass es ein Sturz sein würde, den es zu verhindern galt.
Sebastiano hatte die Umgebung des Platzes gecheckt und nichts Ungewöhnliches entdeckt. Er beugte sich zu mir und flüsterte es mir ins Ohr, und bei der Gelegenheit küsste er mich auch unauffällig auf den Hals. »Hab ich dir schon gesagt, dass du in diesem blauen Samtkleid toll aussiehst?«, raunte er.
Das hatte er, aber ich hörte es mir gerne noch mal an. Er selbst sah auch toll aus, aber das tat er sowieso fast immer. Über seinem dunkelgrünen Brokatwams trug er einen leichten Mantel und ein seidenes Halstuch, dazu eine perfekt sitzende Kniebundhose, feine Strickstrümpfe und elegante Schuhe. Ganz der Venezianer von Welt – der er ja auch war, schließlich war Venedig seine Heimatstadt, nur dass er genau wie ich im zwanzigsten Jahrhundert geboren war.
Ole wandte sich zu uns um. »Fatima und ich haben uns was überlegt«, sagte er. »Damit der Einsatz nicht so langweilig ist.«
»Ich bin für jeden Vorschlag dankbar«, versicherte ich. »Außer, es hat was mit einem Einkaufsbummel zu tun.« Eigentlich hatte ich Shopping gesagt, aber die Sprachumwandlung, die bei allen Zeitreisen in die Vergangenheit aktiv wird, hatte es in ein passenderes Wort abgeändert. Das geschah immer, wenn Einheimische in der Nähe waren, die unsere Unterhaltungen aufschnappten.
»Gute Idee«, sagte Fatima. »Aber eigentlich haben wir uns überlegt, diesen Goethe kennenzulernen und den Tag mit ihm zu verbringen. Dabei können wir gleichzeitig auf ihn aufpassen.«
»Es wäre auch deutlich praktischer, als ständig hinter ihm herzutrotten«, führte Ole aus. »Zumal es ihm sonst irgendwann komisch vorkommen muss, wenn wir dauernd an ihm kleben. Da können wir auch genauso gut mit ihm gemeinsam um die Häuser ziehen und gleichzeitig viel besser verhindern, dass es passiert. In dem Moment, wenn wir mit dem Einsatz fertig sind und zurückspringen, sind wir sowieso aus seinem Gedächtnis gelöscht.«
»Hm«, machte Sebastiano. »Das hat was für sich. Klingt sinnvoll. Was denkst du, Anna?«
Ich nickte begeistert, denn ich fand den Vorschlag nicht bloß sinnvoll, sondern fantastisch. Ich meine – Johann Wolfgang von Goethe! Höchstpersönlich!
Sebastiano sah mich scharf an. »Vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Du hyperventilierst.«
»Kein Stück!« Ich schüttelte atemlos den Kopf. »Ehrlich, ich schwöre, dass ich kein Sterbenswörtchen über den Faust sage!«
»Und auch nicht über Götz von Berlichingen«, verlangte Sebastiano.
»Aber der ist doch schon erschienen«, widersprach ich. Eifrig fügte ich hinzu: »Was ist mit dem Werther? Den kennt jeder! Und Goethe würde sich doch hinterher auch gar nicht mehr dran erinnern!«
»Kein Wort, oder wir lassen es.«
Was sollte ich machen?
Tatsächlich war Goethe hocherfreut, uns kennenzulernen. Er hatte uns schon bemerkt und sich gefragt, woher wir wohl kamen, und als Fatima ihm scheinbar aus Versehen ein Taschentuch vor die Füße fallen ließ, das er aufhob und ihr reichte, war das Eis sofort gebrochen. Einem gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt stand nichts mehr im Wege.
Bei der gegenseitigen Bekanntmachung hielten wir uns an unsere abgestimmte Legende – wir legten uns vor unseren Zeitreisen immer einen passenden persönlichen Background zurecht. Sebastiano spielte einen venezianischen Seidenhändler und ich seine treusorgende Gattin. Ole war Sohn und Erbe eines norwegischen Pelzhändlers, der sich schon vor Jahren in Venedig angesiedelt hatte. Fatima war die Tochter eines hiesigen Patriziers und zugleich meine Cousine.
Vor dem Einsatz hatte es Streit über Fatimas Rolle gegeben, sie wollte lieber eine berühmte Tänzerin sein oder eine illegitime Zarentochter. Aber auffallende Rollen mussten die Ausnahme bleiben, und für diesen Fall konnten wir keine brauchen.
Goethe war ein lebhafter, humorvoller Zeitgenosse, er sprühte nur so vor geistreichen Gesprächsbeiträgen und stellte viele kluge und interessierte Fragen, bei deren Beantwortung wir allerdings manchmal improvisieren mussten, nämlich immer da, wo wir unsere Legende vorher nicht allzu detailliert ausgearbeitet hatten und deshalb aus dem Stand einiges hinzuerfinden mussten. Aber Fatima und Ole machten ihre Sache sehr gut, ich war richtig stolz auf meine Schüler.
Wir selbst fragten Goethe kaum etwas. Das meiste wussten wir ja sowieso schon, wozu gab es schließlich Wikipedia. Er hatte in Deutschland auf der Höhe seines Erfolgs alles hinter sich gelassen und war überstürzt nach Italien abgehauen – ein ziemlich klarer Fall von Burnout.
Die erste Zeit seiner zweijährigen Italienreise hatte er inkognito verbracht, weil er seine Ruhe haben wollte, aber je länger er unterwegs war, desto einsamer war es um ihn geworden. Hier in Venedig kannte er praktisch niemanden. Als er von zu Hause aufgebrochen war, um zu seiner früheren Kreativität zurückzufinden, hatte er in einem dichterischen Tief festgesteckt, das er aber inzwischen längst hinter sich gelassen hatte. Wenn er nach Hause zurückkehrte, würde er mit neuer Schaffensfreude wunderbare Werke vollenden.
Wir unterhielten uns auf Italienisch – das heißt, Goethe sprach Italienisch; er hatte es schon als Kind gelernt und beherrschte es sehr gut, während wir anderen in unserer jeweiligen Muttersprache redeten, ohne dass er es merkte. Wie immer funktionierte die automatische Sprachumwandlung perfekt.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen – Goethe bestand darauf, uns einzuladen – bummelten wir durch San Marco. Rund um den Dogenpalast herrschte ein reges Treiben. Zahllose Menschen spazierten in ihrem Sonntagsstaat von der Riva degli Schiavoni zum Markusplatz, wo sie die Kaffeehäuser bevölkerten und unter den Arkaden der Prokuratien flanierten.
Goethe verstrickte mich in eine anregende Unterhaltung über ein Theaterstück, das er am Vorabend besucht hatte. »Leider war es über alle Maßen langweilig«, berichtete er. »Gewisse Versformen eignen sich einfach nicht für die italienische Sprache.«
»Die elfsilbigen Jamben sind für Deklamationen sehr unbequem«, stimmte ich zu.
Goethe musterte mich verdutzt. »Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen! Tatsächlich hatte ich es mir sogar bereits mit ebendiesen Worten notiert!« Ein Strahlen verklärte sein Gesicht. »Wie wohltuend, in der Fremde auf einen verwandten Geist zu stoßen! Diese Ähnlichkeit der Gedanken, diese Übereinstimmung der Meinung! Sie sind fürwahr eine äußerst bemerkenswerte junge Dame, Signora Anna!«
Oh, oh! Schwerer Fehler. Sebastianos verärgertes Räuspern sprach Bände, ihm war es auch nicht entgangen. Ich hatte zufällig genau die Stelle wiedergegeben, die Goethe als Kommentar zu diesem Theaterstück in sein Reisetagebuch geschrieben hatte. Welches mir natürlich in allen Einzelheiten bekannt war. Ich musste schlucken und konnte mich nur damit trösten, dass er es sowieso vergessen würde. Zeitreisende blieben nur Eingeweihten im Gedächtnis.
Für Goethe gab es jetzt kein Halten mehr, er meinte, in mir eine Seelenverwandte gefunden zu haben und wollte über die Feinheiten des jambischen Versmaßes reden. »Gestatten Sie, Signor«, sagte er zu Sebastiano, dann hakte er mich unter und setzte sein Gespräch mit mir voller Begeisterung fort. Gefolgt von Sebastiano und unseren beiden Schülern schlenderten wir in Richtung Mole. Zahlreiche Gondeln tanzten dort an der Anlegestelle. Die Sonne blitzte auf dem Wasser und tauchte die Silhouetten von San Giorgio Maggiore und Santa Maria della Salute in ein durchscheinend helles Licht. Ich rief den Inhalt von diversen Vorlesungen ab (wozu hatte ich Literatur mit Schwerpunkt Lyrik studiert – wie praktisch, dass ich es jetzt wenigstens mal anwenden konnte) und glänzte mit allen möglichen Basics zu diversen Versformen. Aber mein Spaß an unserem Auftrag änderte sich schlagartig, als wir die Mole fast erreicht hatten. In meinem Nacken breitete sich der Anflug eines Juckens aus, ein ganz schlechtes Zeichen. Mein Nacken juckt nämlich nur bei bevorstehender Gefahr. Es war so weit. Besorgt wandte ich mich zu Sebastiano um.
Goethe kam unterdessen enthusiastisch auf den gereimten Fünfheber mit Zäsur nach der vierten Silbe zu sprechen und suchte nach Beispielen. Mir fiel spontan eins ein, das ich zitieren konnte, während das Kribbeln in meinem Nacken immer deutlicher wurde. Wir standen jetzt dicht am Kai, wo man von der Piazzetta aus den schönsten Blick über die Einfahrt zum Canal Grande hatte.
»Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n, im dunkeln Laub die Goldorangen glüh’n«, deklamierte ich mechanisch. »Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht …« Ich brach ab und schlug mir die Hand vor den Mund.
Goethe hatte mich losgelassen und zerrte sein Notizbuch aus der Tasche seines Umhangs. »Wo habe ich nur den vermaledeiten Stift?«, rief er. »Diese Worte – was für eine wundersame Schönheit ihnen innewohnt! In der Tat gleichen sie jenen, die mir schon selbst durch den Sinn gingen! Welchem Gedicht haben Sie dieses Beispiel entnommen? Können Sie es zu Ende rezitieren?«
Natürlich hätte ich das gekonnt, und kein Wunder, dass er das Gedicht toll fand, denn er hatte es selbst geschrieben. Nur würde es dummerweise bis zur Veröffentlichung noch etliche Jahre dauern.
Ungeduldig trat Goethe einen Schritt zurück, um mehr Armfreiheit für die Suche nach seinem Stift zu gewinnen. Dabei übersah er eine Frau, die gerade in eine Gondel steigen wollte. Sie hatte ein Hündchen unterm Arm und war tief verschleiert, weshalb sie vermutlich auch nicht bemerkte, dass Goethe direkt hinter ihr stand. Und der sah wiederum sie nicht, weil er in seinen Taschen wühlte.
Im nächsten Moment war es auch schon passiert, es ging alles unglaublich schnell. Der Hund sprang der Frau vom Arm und geriet Goethe zwischen die Beine. Er stolperte, versuchte sich irgendwo festzuhalten und erwischte den Schleier der Frau. Der bot ihm aber keinen Halt, sondern riss unter seinem Griff entzwei, worauf die entrüstete Frau ihm einen heftigen Schubs versetzte, der ihn geradewegs über die Mole in das dunkle, tiefe Wasser des Bacino di San Marco beförderte.
»Das glaube ich jetzt nicht«, sagte Sebastiano zutiefst entnervt. Doch er zögerte keine Sekunde, sondern sprang dem versinkenden Dichter sofort hinterher. Ich konnte nur hilflos dabei zusehen, wie er mit einem eleganten Kopfsprung in den schmutzigen Fluten verschwand.
»Das war also der Sturz«, sagte Ole, während er neben mich trat. Erstaunt schüttelte er den Kopf. »Wer hätte das gedacht! Ich jedenfalls nicht.«
Ich auch nicht. Die Symbolik des Spiegels war manchmal vertrackt, man konnte bei der Deutung der gezeigten Ereignisse Fehler begehen und Abläufe falsch einschätzen. Wir hatten zwar gewusst, dass das gefährliche Ereignis ein Sturz sein würde, denn auf den Bildern hatten wir Goethe fallen sehen. Doch mangels Tiefenschärfe war keine Umgebung zu erkennen gewesen – wir waren einfach alle davon ausgegangen, dass er aus einem Fenster oder von einem Gebäude stürzen würde. Stattdessen sank er jetzt dem Grund der Lagune entgegen. Und mit ihm Sebastiano.
Ich konnte vor Entsetzen kaum atmen. Sebastiano war ein guter Schwimmer und konnte prima tauchen. Fragte sich nur, wie tief. Das Jucken in meinem Nacken hatte kein bisschen nachgelassen.
Fatima drängte sich zwischen ein paar sensationslüsternen Gaffern durch, die sich am Rand der Mole versammelt hatten und sehen wollten, was los war. Die aufgeregten Rufe der Umstehenden übertönten ihre Stimme, aber ich verstand sie trotzdem.
»Du hast das Ereignis herbeigeführt!«, sagte sie mit großen Augen zu mir. »Du hast etwas zu ihm gesagt, das ihn zu diesem ungeschickten Verhalten gebracht hat!«
Zu meinem Schrecken hatte sie völlig recht! Ich war drauf und dran, Sebastiano hinterherzuspringen, um ihn da rauszuholen. Wenn der arme Goethe ertrank, war das entsetzlich, und ich wusste jetzt schon, dass ich mir das nie verzeihen würde. Aber ich konnte nicht ohne Sebastiano leben. Lieber starb ich selbst bei dem Versuch, ihn zu retten.
Gerade, als ich zum Sprung ansetzen wollte, durchstießen nacheinander zwei Köpfe die dunkle Wasseroberfläche – zuerst tauchte Goethe auf, dann Sebastiano.
Ich brach vor Erleichterung in Tränen aus. Ringsum erhob sich Jubel, die Leute klatschten Beifall.
»Bravo!«, riefen sie. »Bravissimo!«
Goethe wurde in ein Boot und von dort an Land gehievt. Wasserspuckend und hustend rang er nach Luft und fluchte zwischendurch über den venezianischen Müll, der aus allen Kanälen in die Lagune geschwemmt werde und das Wasser eintrübe, sodass man, wenn man einmal hinein- und unter die Oberfläche geraten sei, das Oben nicht vom Unten unterscheiden könne. Alles in allem schien er das unfreiwillige Bad jedoch ohne besondere Beeinträchtigungen überstanden zu haben.
Ich warf mich Sebastiano in die Arme, nachdem er von helfenden Händen ebenfalls auf den Kai gezogen worden war. »Es tut mir so leid!«, stammelte ich.
Er trat einen Schritt zurück und wischte sich mit beiden Händen die stinkenden Algen aus dem Gesicht. »Warum? Du kannst doch nichts dafür.«
Da war ich mir nicht so sicher. Von José, dem Chef unserer Crew und Mitgründer der Zeitreise-Akademie, hatte ich zwar gelernt, dass manche Einsätze zwangsläufig von einer Art Self-fulfilling-Prophecy-Phänomen begleitet sind (was in etwa bedeutet, dass gewisse Ereignisse, die man verhindern will, überhaupt erst dadurch stattfinden, dass man es versucht), und er hatte auch schon mehrmals beteuert, dass das einen Einsatz nicht weniger wichtig mache. Das anzuzweifeln sei völlig sinnlos, so unergiebig wie die Frage, was zuerst da war – die Henne oder das Ei.
Dennoch ließ sich das nagende Gefühl, durch eigene Fehler ein Eingreifen erst nötig gemacht zu haben, mit dieser Logik schlecht wegdiskutieren.
»Wenigstens ist der Einsatz jetzt vorbei«, sagte Ole. »Dieses Gerede über Gedichte war die reinste Folter. Wie können Verse Füße haben?«
Zum Glück hatte Goethe das nicht gehört. Wir begleiteten ihn auf schnellstem Weg in sein Hotel, wo er sich umzog und seine nassen Sachen in die Wäscherei gab. Sebastiano kaufte einem Hoteldiener, der in etwa seine Größe hatte, einen Satz Männerkleidung ab und ließ ihm dafür seine durchweichte Kluft da.
In seinem überschwänglichen Dank wollte Goethe zum Abschied von uns wissen, wo wir wohnten, weil er sich unbedingt noch erkenntlich zeigen wolle. Sebastiano nannte ihm eine Fantasieadresse, die Goethe sich so leicht merken konnte, dass er sie sich nicht notieren musste.
Sobald wir in unsere eigene Zeit zurücksprangen, würde er uns und den Sturz ins Wasser vergessen. Er würde sich ein wenig ausruhen, seine Eindrücke von der Dogenprozession niederschreiben und danach auf die Giudecca übersetzen, um sich bei Nacht den Tasso anzuhören, den traditionellen Gesang venezianischer Schiffsleute und Gondolieri.
Und irgendwann würde er das Gedicht über die Zitronen und Orangen schreiben, das berühmte Mignon-Lied – womit sich unweigerlich wieder die Frage nach der Henne und dem Ei erhob. Goethe konnte das Gedicht nicht von mir haben, da ich es von ihm hatte. Außerdem konnte ich überhaupt nicht dichten. Und er hatte mich und unsere ganze Begegnung längst vergessen. Ich sollte einfach aufhören, darüber nachzudenken.
Venedig, Gegenwart
José holte uns an der vereinbarten Stelle mit der Zeitmaschine ab. Wir landeten im Garten unseres Hauses in Castello, einmal mehr froh, dass wir die Reise durch die Zeit alle heil und unbeschadet überstanden hatten.
Unsere Zeitreise-Akademie war in einem alten Palazzo untergebracht. Von außen ziemlich verwittert und stark in die Jahre gekommen, bot er im Inneren ein malerisches Ambiente aus allen möglichen Stilrichtungen, hauptsächlich einen Mix aus Möbeln eines bekannten schwedischen Einrichtungshauses und Frühbarock. Die polierten Marmorsäulen im Portego waren noch original erhalten, ebenso wie Teile des Deckenstucks, aber der Rest war im Laufe der Jahrhunderte modernisiert und saniert worden.
Offiziell beherbergte der Palazzo natürlich keine Zeitreiseschule, sondern eine Theaterakademie mit ambitionierten Schülern aus aller Welt und einer kleinen Truppe von Lehrern, die es sich auf die Fahnen geschrieben hatten, ihre Vorstellungen von einem individualistischen Rollenstudium in die Tat umzusetzen. Letzteres war gar nicht mal so danebengegriffen, denn tatsächlich wies ein großer Teil der Ausbildung an der Akademie schauspielerische Bezüge auf. Als Zeitwächter wurde man nur erfolgreich, wenn man sich zu einem Meister im Täuschen, Tricksen und Improvisieren entwickelte. Es war im Grunde Method Acting in Reinkultur.
Daneben lernten unsere Zöglinge natürlich auch eine Menge nützlicher und handfester Dinge. Das reichte vom richtigen Gebrauch eines Floretts über Erste Hilfe bis hin zur Herstellung von Zahnpasta. Vor allem aber bekamen sie ein detailliertes Wissen über die unterschiedlichen Epochen vermittelt – mit anderen Worten, sie paukten Geschichte.
Aktuell hatten wir drei Schüler an der Akademie. Einer davon war Walter, ein Junge aus der Tudorzeit, mit seinen fünfzehn Jahren unser jüngster Kandidat. Bücher waren sein ganzes Leben, er verschlang eins nach dem anderen und brauchte ständig Nachschub. Wenn er nicht gerade las, schrieb er lange Einträge in sein Tagebuch, für das er dauernd neue Verstecke suchte, weil Fatima die lästige Angewohnheit hatte, darin herumzuschnüffeln. Momentan war Walter von der praktischen Ausbildung befreit, denn er ging wieder zur Schule – wir waren übereinstimmend der Meinung, dass er Abi machen und studieren sollte, genauso wie Jerry, der aus dem Jahr 1813 stammte und ungefähr im selben Alter wie Walter in unsere Gegenwart übergewechselt war. Jerry hatte seinen Collegeabschluss gemacht und anschließend Physik studiert. Er saß gerade an seiner Doktorarbeit und tüftelte nebenher an technischen Verbesserungen für die Zeitmaschine.
Fatima und Ole hatten keine Lust, noch mal die reguläre Schulbank zu drücken, den beiden reichte bereits, was Sebastiano und ich ihnen an Unterricht zumuteten. Inzwischen konnten sie immerhin lesen und schreiben und machten Fortschritte beim Rechnen; vor allem Ole schien eine natürliche Begabung für alles Mathematische zu haben und las sich zu dem Thema mittlerweile sogar im Internet schlau. Aber davon abgesehen erforschte er lieber neue Computerspiele – er behauptete, in dem Bereich hätte er tausend Jahre nachzuholen. Daneben galt sein ganzes Interesse der Waffenkunst, antiker wie moderner, und seine restliche Freizeit verbrachte er am liebsten auf der Hantelbank. Er war ein ein Meter neunzig großes Kraftpaket und ließ sich nicht viel sagen.
Fatima hatte sich auf Mode spezialisiert. Sie führte sogar ihren eigenen Blog, den sie mit selbst geschossenen Fotos bestückte, Aufnahmen von professioneller Qualität. Inzwischen hatte sie so viele Follower, dass schon die ersten Angebote von Werbefirmen bei ihr eingegangen waren. Daneben besaß die glutäugige Haremsschönheit auch eine durchaus kriegerische Ader. Mindestens einmal am Tag ging sie in den großen Trainingsraum und warf lange, scharfe Messer auf eine Zielscheibe. Sie traf fast immer ins Schwarze.
Diesem Talent hatte ich mein Leben zu verdanken. Ein perfekt gezielter Wurf mit einem ihrer Dolche hatte mich davor bewahrt, einem alten Feind zum Opfer zu fallen.
Die Bezeichnung alt war in dem Zusammenhang nicht einfach nur eine Floskel, sondern erfasste genau den Kern der Aussage. Mein Widersacher Mr Fitzjohn, den Fatima mit ihrem Dolch ins Jenseits befördert hatte, war sehr alt gewesen, viel älter als alle Normalsterblichen. Genauso wie José entstammte er einem längst untergegangenen Sternenvolk. Ein paar Dutzend dieser Rasse hatten es einst geschafft, sich aus den Tiefen ihrer untergegangenen Galaxie bis zur Erde durchzuschlagen und sich in unserer Welt mehr oder weniger häuslich einzurichten. Sie hatten sich kreuz und quer über die Jahrhunderte verteilt und betrachteten die Zeit als eine Art überdimensionales Spielbrett, auf dem sie eigene Regeln aufstellen und Menschen wie beliebige Figuren herumschieben konnten. Einige dieser Alten waren ziemlich skrupellos und gingen über Leichen, um sich ein Stück aus der Zeit herausschneiden und sich darin als Herrscher aufspielen zu können. Anderen ging es nur um das Spiel an sich und darum, sich gegenseitig auszumanövrieren, aber sie hielten sich wenigstens an die von ihnen konzipierten Regeln. Wieder andere – zu denen gehörte José – spielten auf der guten Seite der Macht. Als Meister des Fairplay taten sie alles, um das Gefüge der Zeit für die Menschen zu erhalten. Traten irgendwo Anzeichen einer drohenden Entropie auf (was so viel wie die finale Katastrophe bedeutete), machte José die Zeitmaschine klar und sorgte für Ordnung.
Es gab noch mehr besonnene Alte wie ihn. Sie nannten sich Bewahrer und agierten in allen zugänglichen Epochen, wo sie die schlimmsten Spieler im Zaum hielten.
Leute wie Sebastiano und ich halfen ihnen dabei.
Wir waren Zeitwächter, auch Beschützer genannt. Mittlerweile waren wir außerdem zu Lehrern avanciert, eine Idee von José, der es für sinnvoll hielt, mehr Nachwuchs auszubilden. Ursprünglich hatte ich die Idee einer eigenen Zeitreise-Akademie gar nicht übel gefunden, aber mittlerweile machte ich ein paar Abstriche. Das Unterrichten an sich machte mir zwar Spaß, aber bei Ole und Fatima stieß man ständig an seine pädagogischen Grenzen – sie hatten einfach ihren eigenen Kopf. Außerdem waren sie nicht viel jünger als wir. Fatima war gerade achtzehn geworden, Ole war fast zwanzig. Sie waren erwachsen und dickköpfig, das machte es oft schwierig, ihnen mit der nötigen Autorität gegenüberzutreten.
Wahnsinnig machte mich leider dabei, dass es allen anderen nicht so schwerzufallen schien. Vor Sebastiano hatten die zwei deutlich mehr Respekt. Auch Jerrys Anweisungen folgten sie meist bereitwillig, und José behandelten sie regelrecht ehrfürchtig. Es wäre ihnen nicht im Traum eingefallen, sich in seiner Gegenwart patzig oder überheblich aufzuführen. Nur ich kriegte es irgendwie nicht auf die Reihe.
Nachdem wir von dem denkwürdigen Einsatz im Jahr 1786 in unsere eigene Zeit zurückgekehrt waren, tauschten wir die historische Kleidung gegen unsere Alltagsklamotten und trafen uns zum Essen im Portego. Wir versammelten uns um den großen Tisch und erzählten, wie der Einsatz gelaufen war. Jerry fiel vor Lachen fast vom Stuhl, als er die Einzelheiten meines Gesprächs mit Goethe erfuhr, vor allem an der Stelle, als ich das Gedicht aufgesagt hatte und der Hund ins Spiel gekommen war. Fatima konnte ein Kichern nicht unterdrücken, obwohl sie die Geschichte schon kannte, und auch Walter prustete verstohlen in seine Serviette. Ich selbst fand es mit der Zeit auch ein bisschen lustiger als vorher, was aber teilweise daran lag, dass ich auf nüchternen Magen einen Aperitif getrunken hatte. Barnaby hatte ihn serviert und darauf bestanden, dass wir ihn probierten, weil es eine von ihm selbst gemixte Kreation war. Er stand mit unserer Köchin Renata in der angrenzenden offenen Küche und kümmerte sich hingebungsvoll um das Abendessen. Was das Kulinarische anging, waren die beiden das reinste Dreamteam.
Wo Renata herkam, wusste kein Mensch, aber irgendwas stimmte nicht mit ihr, denn sie summte und kicherte in einem fort, und zwar ohne erkennbaren Grund. Keiner von uns hatte sie je ein vernünftiges Wort reden hören. Aber von gutem Essen verstand sie was. Dasselbe konnte man auch von Barnaby sagen, nur dass wir bei ihm ganz genau wussten, was mit ihm nicht stimmte. Er war nämlich ein niederer Dämon aus dem siebten Kreis der Hölle – jedenfalls behauptete er das. Wobei es durchaus glaubhaft war, denn unter seiner Kappe, die er ständig trug, hatte er spitze Hörner. Außerdem verbargen sich unter seiner Jacke ledrige Rückenschwingen, und in seinen übergroßen Stiefeln steckten Hufe. Als ich das bei unserem letzten Londoner Einsatz im Jahr 1540 zum ersten Mal gesehen hatte, war ich vor Schreck in Ohnmacht gefallen.
Die Umstände hatten es dann ergeben, dass er seinen Posten als Hofnarr von Heinrich dem Achten hingeworfen hatte und aus der Tudorzeit mit uns in die Gegenwart gezogen war.
Barnaby reichte mir ungefähr bis zur Hüfte und hatte ein verknautschtes, von Warzen übersätes Gesicht. Aber seine Hässlichkeit konnte nicht über seinen Sinn für Lebensart und feine Küche hinwegtäuschen. Einen kunstsinnigeren und kultivierteren Dämon konnte man sich kaum vorstellen – wobei er allerdings der einzige Dämon war, den ich bisher genauer kennengelernt hatte; alle anderen hatte er zum Glück eliminiert, bevor sie näher als ein paar Schritte an mich herankommen konnten. Barnaby war nämlich mein persönlicher Beschützer und bewahrte mich vor allen dämonischen Gefahren.
Dass es außer den von uns benutzten normalen Zeitreisetoren auch geheime Portale in eine nach Schwefel stinkende Dämonenwelt gab, wussten wir noch nicht so lange, und die Tatsache hatte uns ziemlich erschüttert. Inzwischen hatten José und Jerry diese Tore versiegelt und damit hoffentlich sämtliche Übertritte für alle Zeiten unmöglich gemacht.
José saß am Kopfende des Tisches und hatte uns alle im Blick. Dass ihm dafür nur ein Auge zur Verfügung stand, weil er das andere vor Jahrhunderten im Duell gegen einen feindseligen Alten verloren hatte, spielte keine Rolle – ihm entging so gut wie nichts. Manchmal glaubte ich, dass er sogar Gedanken lesen konnte. Jedenfalls beeinträchtigte die schwarze Augenklappe seinen messerscharfen Durchblick nicht im Mindesten. Er sah aus wie ein magerer älterer Mann, in Ehren ergraut und körperlich lädiert, aber der harmlose Eindruck täuschte gewaltig. Mit dem Degen war er immer noch schneller als Sebastiano, obwohl mein Freund im Laufe der Zeit stark aufgeholt hatte.
Das Essen, gemischte Antipasti di verdure, danach hauchdünne Ravioli mit einer Trüffelfüllung, war wieder mal unbeschreiblich köstlich, es schmeckte wie aus dem angesagtesten Gourmettempel, das musste sogar Ole anerkennen, der Barnaby ständig übernatürlicher Listen verdächtigte und felsenfest davon überzeugt war, dass der kleine Dämon nur auf eine günstige Gelegenheit wartete, uns alle niederzumeucheln. Oder, schlimmer noch, dass er seinen Kumpels aus der Dämonenwelt ein Tor aufmachte und sie zu uns rüberholte. Ole traute Barnaby keinen Hufbreit über den Weg und verfolgte jeden seiner Schritte mit Argwohn.
Barnaby servierte uns das Dessert und beobachtete mich erwartungsvoll. Ich probierte das luftige Gebilde aus Schokoschaum und schloss verzückt die Augen. »Es ist grandios!«
»Ich hätte noch zwei andere zur Auswahl. Eins mit Vanille, eins mit Früchten.«
»Das hier ist es, glaub mir.«
»Ich würde die anderen auch noch testen«, bot Ole sich an. Er hatte seinen Nachtisch binnen Sekunden verdrückt und machte den Eindruck, als könnte er noch eine Schüssel davon vertragen.
Barnaby und Renata kochten seit ein paar Tagen verschiedene Probegerichte für Sebastianos und meine Hochzeit. Der Termin stand jetzt fest, also mussten wir auch allmählich die Speisenfolge planen.
Nach dem Essen blieben wir noch eine Weile zusammen am Tisch sitzen, dann zog sich jeder in seinen privaten Bereich zurück. Unsere Wohn- und Schlafräume befanden sich im Stockwerk über dem Portego.
Sebastiano und ich standen eng aneinandergeschmiegt vor dem Fenster und blickten auf den dunklen, stillen Kanal hinunter. Man hörte das sachte Plätschern des Wassers an der Hauswand, und in der spiegelnden Oberfläche war der Umriss des zunehmenden Mondes zu erkennen. Ich spürte Sebastianos Herzschlag und wusste, dass er dasselbe dachte wie ich: Wann?
Wann würde unser Leben jene Wendung nehmen, vor der wir uns so fürchteten und die wir gleichzeitig sehnlichst herbeiwünschten? Wann mussten wir damit beginnen, uns nach allen Seiten abzusichern, um die lauernden Bedrohungen fernzuhalten?
Der Spiegel hatte uns unsere kleine Tochter gezeigt, die wir in nicht allzu ferner Zeit bekommen würden. Dieses Wissen erfüllte uns mit unfassbarem Glück, aber auch mit Sorge – um das Kind, um uns, um die Zukunft.
Sebastiano drehte mich in seinen Armen herum und küsste mich. »Es wird alles gut«, sagte er leise, als wüsste er, wie sehr ich genau diese Worte in genau diesem Augenblick brauchte. Ich hoffte es so sehr. Das Geschehen heute an der Mole hatte mir wieder einmal klargemacht, wie schnell das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten über uns hereinbrechen konnte. Die Angst um Sebastiano war so würgend, so existenziell gewesen, dass ich noch immer eine Gänsehaut bekam, wenn ich daran dachte.
Sebastiano schien zu spüren, was in mir vorging. »Anna, nicht so viel denken, ja?«
Ich musste lachen und schlang meine Arme noch fester um ihn. »Na gut. Ich versuch mich abzulenken.« Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste ihn.
Leider suchte sich Jerry genau diesen Moment aus, um an die Tür zu klopfen.
»Wir haben einen Vorfall«, sagte er ohne Umschweife. »Im Jahr 1873 gibt es größere Interferenzen. Scheint so, als würden sich an mehreren Stellen Durchgänge auftun, wo keine hingehören. José und ich müssen uns das ansehen.«
»Sollen wir mitkommen?«, fragte Sebastiano.
»Nein, nicht nötig. Wir wissen ja noch gar nicht, woran es liegt und was es bedeutet. Sobald wir das herausgefunden haben, machen wir einen Einsatzplan. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass José und ich für ein paar Stunden weg sind. Spätestens zum Frühstück sind wir wieder zurück.«
»Viel Erfolg«, sagte Sebastiano.
»Von mir auch«, fügte ich hinzu.
Wir machten uns beide keine großen Gedanken über die Sache. José und Jerry waren oft auf solchen Kontrolleinsätzen unterwegs. Sie checkten nur die Lage und waren dann meist schnell wieder da.
Doch zum Frühstück tauchten die beiden nicht auf, ebenso wenig zum Mittagessen. Als sie am Abend immer noch nicht zurück waren, fingen wir allmählich an, uns Sorgen zu machen, und tags darauf waren wir ernstlich beunruhigt.
José weihte uns nicht immer in seine Pläne ein, aber dass hier etwas nicht stimmte, lag auf der Hand, zumal er Jerry in der Zeitmaschine dabeihatte. Sebastiano überlegte, ob wir ein reguläres Tor benutzen und den beiden ins Jahr 1873 folgen sollten, um herauszufinden, was mit ihnen geschehen war. Aber das war frühestens in zwei Tagen möglich, weil die Zeitportale nur bei einem Mondwechsel benutzt werden konnten. Solange waren wir zum Warten verdammt, etwas, das ich schlecht ertragen konnte. Ich tigerte im Haus herum, machte alle anderen so nervös, wie ich mich fühlte, und brachte keinen Bissen mehr herunter. Sebastiano versuchte sein Bestes, um mich abzulenken, obwohl ich wusste, dass seine Sorge um José und Jerry genauso drängend war wie meine. Gemeinsam recherchierten wir einige Hintergründe zum Jahr 1873 – denn je mehr wir wussten, desto besser konnten wir unvorhergesehenen Ereignissen begegnen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir nicht, wie vermessen es war, uns mit ein paar Geschichts-Arbeitsblättern auf das vorbereiten zu wollen, was auf uns zukam.
Den Nachmittag verbrachte ich in der Bibliothek. Eigentlich hatte ich vorgehabt, in einem Schuhsalon in San Marco ein paar Pumps anzuprobieren, die zu meinem Hochzeitskleid passten, aber nach dem Verschwinden von José und Jerry hatte ich dafür keinen Kopf. Ich hatte die wichtigsten Ereignisse von 1873 notiert, darunter einen Börsencrash an der Wiener Börse, das Erscheinen eines Jules-Verne-Romans und die Ausgrabung des Priamos-Schatzes durch Heinrich Schliemann, doch das half mir bei der Frage, warum José und Jerry nicht zurückkamen, auch nicht weiter.
Frustriert packte ich meine Sachen zusammen und war gerade auf dem Heimweg, als ich es merkte.
Jemand folgte mir!
Der Kerl war mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen, aber da hatte ich mir nichts dabei gedacht – in Venedig war es keine Seltenheit, dass einem Leute, die in der Nähe wohnten, öfter über den Weg liefen. Die Stadtviertel waren zwar durch die vielen verschachtelten Gassen und Brücken unübersichtlich, aber im Grunde genommen wie ein Dorf.
Doch diesmal war es eindeutig keine zufällige Begegnung, denn der Mann blieb mir auf den Fersen. Ich versuchte, ihn durch mehrmaliges schnelles Abbiegen loszuwerden, aber er ließ sich nicht abschütteln. Mittlerweile kannte ich mich in Venedig ziemlich gut aus und wusste, wie man über versteckte kleine Hinterhöfe zur nächsten Gasse gelangte und welche Brücken man benutzen musste, um den Weg in einen anderen Stadtteil abzukürzen. Ich gab mir wirklich alle Mühe, aber der Kerl hing an mir wie ein Schatten – und je länger das ging, umso panischer wurde ich.
Mein Herz raste zum Zerspringen, ich bekam es ernstlich mit der Angst zu tun. Mein Nacken juckte zwar nicht, doch das musste nicht bedeuten, dass mir keine Gefahr drohte. Bei Dämonen funktionierte mein Warnsystem nämlich nicht, und man konnte sich auch nicht vor ihnen verstecken. In dem Fall konnte mir nur Barnaby helfen. Kurz entschlossen aktivierte ich eine spezielle App auf meinem Handy. Ein Klick genügte, und mein Standort wurde durchgegeben und löste Alarm aus. Sebastiano rief mich sofort zurück. Sorge klang aus seiner Stimme. »Anna?«
»Ich werde von einem Typen verfolgt. Ich kann ihn nicht abschütteln.«
»Wie sieht er aus?«
Ich rannte über eine kleine Brücke, während ich ihm die Beschreibung durchgab. »Ungefähr in deinem Alter, normale Statur, braune Haare, Sonnenbrille, Jeansjacke. Auf der Brusttasche ist ein Aufnäher, irgendwas in Rot, wahrscheinlich ein Fußballemblem.«
»Bleib in Bewegung. Wir bekommen deinen Standort angezeigt. Am besten nimmst du die Riva degli Schiavoni in Richtung Arsenal. Barnaby und ich sind schon unterwegs, wir müssten in Höhe der Calle del Forno auf dich treffen.«
Kurz darauf sah ich sie auch schon im Laufschritt näher kommen.
»Alles in Ordnung?« Sebastiano umarmte mich und drückte mich an sich. Ich blickte über die Schulter zurück und stellte fest, dass der Typ sich unauffällig den Auslagen eines kleinen Tabacci widmete. Bevor er mitbekommen konnte, dass ich Verstärkung gerufen hatte, war Barnaby schon bei ihm. Dafür, dass er so kurze und krumme Beine hatte, konnte er sich erstaunlich flink fortbewegen. Wenn er die Schwingen ausbreitete und flog, war er noch schneller, aber das kam hier in Venedig natürlich nicht infrage, schon gar nicht am helllichten Tag.
Barnaby zerrte am Arm des Mannes und hinderte ihn am Abhauen, bis Sebastiano ebenfalls zur Stelle war. Er packte den Typen beim Kragen und schob ihn in die nächste Gasse, ein Stück abseits von den Menschenströmen auf dem Kai.
»Normaler Mensch«, sagte Barnaby zu mir.
Das war mir inzwischen auch klar, denn sonst wäre der Typ jetzt nicht mehr da. Barnaby verfügte nämlich über eine spezielle Methode, mit Dämonen fertigzuwerden – er verkleinerte sie. Sobald er sie richtig zu fassen kriegte, schrumpften sie im Bruchteil einer Sekunde auf die Größe einer Mikrobe zusammen. Inmitten des ganzen Touristengewimmels wäre so ein plötzliches Verschwinden vermutlich nicht mal jemandem aufgefallen. Und wenn doch, hätte der Betreffende ganz sicher angenommen, sich verguckt zu haben.
Sebastianos Gesicht war starr vor Zorn. Er fasste den Typen bei den Aufschlägen der Jeansjacke und stieß ihn gegen die Hauswand. »Was willst du von ihr? Du antwortest mir sofort, oder du lernst mich kennen!«
»Ich will nichts von ihr, ich habe sie observiert«, brachte der Typ mit erstickter Stimme hervor. »Ich habe einen amtlichen Auftrag! Wenn Sie aufhören, mir die Luft abzudrücken, kann ich Ihnen meinen Dienstausweis zeigen!«
Zögernd ließ Sebastiano ihn los. »Her damit.«
Der Fremde kramte einen behördlichen Ausweis hervor und zeigte ihn Sebastiano. Der musterte ihn stirnrunzelnd. »Interpol? Was soll das?« Er warf einen weiteren Blick auf den Ausweis und setzte hinzu: »Mister Fox.« Es klang ein wenig höflicher, aber nicht viel. »Wieso haben Sie meine Verlobte beschattet?«
Der Mann, der offenbar Fox hieß, strich sich die Jacke glatt. »Vielleicht können Sie sich das selbst denken.«
Ich hatte die ganze Zeit fassungslos zugehört. Das Herz klopfte mir bis zum Hals. Die Behörden waren uns auf den Fersen!
»Nein, das kann ich mir nicht denken«, sagte Sebastiano kalt.
»Gut, dann sage ich es Ihnen. Wir bei Interpol glauben nicht, dass sie in Ihrem Palazzo eine Theaterakademie betreiben. Dafür reisen Sie ein bisschen zu viel. Seltsamerweise aber nicht zu Theatervorführungen, sondern einfach – irgendwohin. Ihre Handys und PCs sind auf besondere Weise verschlüsselt, mit einer Technik, die sogar die NSA vor Herausforderungen stellt. Über Ihre Schüler gibt es keine amtlichen Unterlagen, die älter sind als ein Jahr. Sie scheinen aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Haben Sie dafür vielleicht eine Erklärung?«
»Nein«, sagte Sebastiano mit derselben kühlen Stimme wie zuvor. »Haben Sie einen Haftbefehl oder so was?«
Fox schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.«
Sebastiano wandte sich wortlos von ihm ab. Er legte den Arm um mich und zog mich aus der Gasse. »Wir gehen.«
Diesmal machte Fox keine Anstalten, uns zu folgen. Aber als wir um die Ecke bogen, rief er uns nach: »Ich krieg euch!«
»Arschloch«, murmelte Sebastiano.
»Da kommen wohl Probleme auf uns zu«, sagte Barnaby. Es klang besorgt. »Und ausgerechnet jetzt ist José nicht da. Dumme Sache, wirklich sehr dumm!«
Mir war ganz übel vor Schreck, denn mit dem, was da gerade passiert war, hatte ich in der Form nie gerechnet: Unsere Tarnung war aufgeflogen.
Sebastiano marschierte fluchend im Portego auf und ab, beide Hände in den Hosentaschen und immer noch außer sich vor Ärger über den penetranten Interpolagenten Fox. Gleich bei unserer Rückkehr hatten wir die anderen zusammengerufen, um die Lage zu besprechen. Leider waren José und Jerry immer noch nicht zurückgekehrt, was unsere Anspannung nur noch verstärkte.
»Mit welchem Recht schnüffelt Interpol hinter uns her?«, regte sich Sebastiano auf. »Wenn dieser Fox hier auftaucht, schmeiße ich ihn in den Kanal!«
Das fand ich etwas drastisch. »Dann hätte er uns wirklich was vorzuwerfen. Im Gegensatz zu jetzt. Denn auch, wenn er hier rumschnüffelt – was haben die denn gegen uns in der Hand? Wir haben nicht gegen das Gesetz verstoßen!«
»Im Zweifel werden sie ein Steuergesetz aus dem Hut ziehen«, sagte Barnaby. »Ihr ahnt nicht, wie viele Strafvorschriften sich in Steuergesetzen verbergen! Sogar in der Dämonenwelt gibt es Steuern. Ob die Zeitmaschine der Vergnügungssteuer unterfällt? Oder vielleicht eher der Grunderwerbs- oder Zweitwohnsitzsteuer?«
»Blödsinn«, sagte ich.
»Ich wollte es nur erwähnt haben. Und … ähm, wenn dieses Interpol mich auffordert, die Kappe abzunehmen, könnte das viele Fragen aufwerfen. Nun ja, in dem Fall würde ich mich einfach schnell verstecken, was meint ihr?«
»Vielleicht sollten wir auch die Waffensammlung in Sicherheit bringen«, warf Walter ein. »Damit uns niemand fälschlicherweise einen Hang zu Gewalttaten unterstellen kann.«
»Dieser Fox soll bloß herkommen«, sagte Ole. Er ließ vernehmlich seine Handknöchel knacken. »Dann zeige ich ihm, wo er sich seine Nachforschungen hinstecken kann.«
»Ich könnte ihn unter einem Vorwand auf mein Zimmer locken«, schlug Fatima vor. »Einer von euch macht Fotos, und dann drohen wir ihm, sie an seine Frau oder seine Freundin zu schicken, wenn er uns nicht in Ruhe lässt.«
Oles Augen verengten sich. »Du willst dich vor diesem Kerl entkleiden? Das ist nicht nötig. Ich töte ihn einfach. Das ist die wirksamste Lösung.«
Zum Glück ließ Fox sich an diesem und auch am nächsten Tag nicht blicken, aber unsere Unruhe legte sich keineswegs, denn wir wussten ja, dass er irgendwo im Hintergrund seine Fäden spann. Außerdem wuchs unsere Sorge um José und Jerry von Stunde zu Stunde. Als die Zeit des Mondaufgangs näher rückte, debattierten wir erneut darüber, ob wir durch das Portal von Santo Stefano ins Jahr 1873 zurückspringen sollten, und wir kamen ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass es dazu keine Alternative gab, wenn wir nicht wochenlang bis zum nächsten Mondwechsel warten wollten. Das würde viel zu lange dauern, diese Ungewissheit hielt keiner von uns aus.
Wir entschieden, alle zusammen aufzubrechen, denn für mich war es völlig undenkbar, Sebastiano allein losziehen zu lassen (sein Vorschlag) oder gemeinsam mit Ole und seiner Streitaxt (Oles Vorschlag), und ebenso wenig wollte ich Walter und Fatima allein zurücklassen. Barnaby musste meiner Ansicht nach auch unbedingt mit, schon für den Fall, dass irgendwelche Dämonen unseren Weg kreuzten.
In ziemlicher Hast erledigten wir die Vorbereitungen. Die Auswahl passender Kleidung, das Ausarbeiten unserer Hintergrundgeschichten und das ganze übrige Programm reduzierten wir aufs Nötigste und waren nach Einbruch der Dunkelheit einsatzbereit. Wir warteten gerade im Portego auf Fatima, die mal wieder am längsten zum Packen brauchte, als von draußen ein Hilferuf ertönte.
Wir rannten auf die Loggia hinaus. Auf dem Kanal glitt eine Gondel in der Dämmerung heran. Nieselregen und feuchter Nebel umwehten das Gefährt wie ein Schleier. Der Gondoliere stand mit stoischer Miene auf der Abdeckung und tat so, als ginge ihn das Ganze nichts an. In der Gondel saß Jerry und stützte José, der sich offenbar nicht allein aufrecht halten konnte.
Jerry winkte zu uns herauf.
»Schnell!«, rief er. »Helft uns! José ist verletzt!«
Wir liefen nach unten, und die Männer hoben Josés schlaffen Körper aus dem Boot. »Er braucht einen Arzt!«, rief ich entsetzt, als ich den blutigen Verband um seinen Kopf sah.
»Später«, sagte José mit schwacher Stimme. »Zuerst müssen wir … Plan …«
Ole trug ihn vorsichtig nach oben in den Portego, während Jerry mit dem Gondoliere das Finanzielle klarmachte. Ich sah, wie mehrere Hunderter den Besitzer wechselten.
»Jemand hat José niedergeschlagen und die Zeitmaschine gestohlen«, sagte Jerry grimmig, als er anschließend zu uns stieß. »Wenn ihr mich fragt, war das ein klassischer Hinterhalt. Wir wurden schon erwartet.«
»Von wem?« Sebastiano beugte sich besorgt über José. Ole hatte ihn auf ein Sofa gelegt. Ich hatte ein feuchtes Tuch geholt und tupfte ihm behutsam das Blut ab.
»Moretti«, brachte er mühselig hervor. »Lorgnon. Ihr müsst … finden.«
»Was meint er?«, fragte ich.
Jerry zog ein Glas aus der Tasche. »Das hier. Der Typ, der José angriff, hat es fallen lassen.«
Sebastiano nahm das Glas und betrachtete es von allen Seiten. »Aufwendig gearbeitet. Sieht sehr wertvoll aus. Der Griff ist aus Elfenbein, die Fassung aus Gold und mit Rubinen besetzt. Eine echte Rarität.«
»Was ist ein Lorgnon?«, fragte Ole.
»Eine Brille, aber mit nur einem Glas und am Stiel«, sagte Barnaby.
»Dich habe ich nicht gefragt, du Besserwisser«, blaffte Ole ihn an, doch Barnaby verzog keine Miene. Das war immer noch die beste Methode, Ole auflaufen zu lassen.
»José muss in ein Krankenhaus«, sagte ich entschieden. »Ich rufe jetzt sofort den Notarzt an.«
»Nein, warte«, unterbrach José mich mit schwacher Stimme. Mit kaum hörbarer Stimme befahl er Jerry, uns Bericht zu erstatten, und so erfuhren wir, was bei dem Einsatz schiefgegangen war. José und Jerry waren die ganze Zeit in Venedig gewesen, und zwar wie geplant im Jahr 1873, wo sich eine der Interferenzen befand, die sie überprüfen wollten. Für die Landung hatten sie sich den Innenhof eines zu der Zeit nicht benutzten Klostergebäudes ausgesucht und sich anschließend auf den Weg zu der fraglichen Stelle gemacht, als sich aus einer dunklen Ecke eine Gestalt auf José gestürzt und ihn hinterrücks niedergeschlagen hatte.
»Ich war in dem Moment abgelenkt, denn der Wind hatte meine Laterne ausgeblasen«, berichtete Jerry. »Ich wollte sie gerade wieder anstecken, aber im nächsten Augenblick trat mir jemand ins Kreuz. Ich landete der Länge nach im Dreck, und als ich mich wieder hochgerappelt hatte, war der Kerl auch schon mit der Zeitmaschine über alle Berge.« Wütend schüttelte er den Kopf. »Ich hab’s vermasselt. Ich hätte besser aufpassen müssen.« Seine Sommersprossen hoben sich dunkel vor seiner blassen Haut ab, und sein rotes Haar war nass vom Regen.
»Unsinn«, murmelte José. »Nicht deine … Schuld.«
»Wir haben uns zwei Tage versteckt und sind dann bei Mondaufgang durch das Tor in Santo Stefano zurück«, fuhr Jerry fort. »Ich habe José zur nächstbesten Gondel geschleppt und dem Bootsführer einen Haufen Geld versprochen, wenn er uns herbringt und die Klappe hält.«
Ich war entsetzt. »Wenn José schon seit zwei Tagen in diesem Zustand ist, muss er unbedingt sofort ins Krankenhaus!«
»Weib, rede nicht dauernd dazwischen«, befahl Ole mir. »Wenn er zwei Tage durchgehalten hat, wird eine weitere Stunde ihn nicht umbringen!«
Mir fiel die Kinnlade herab, aber niemand machte Anstalten, ihm zu widersprechen. Genau das war die Art von Situation, die ich mit nicht auf die Reihe kriegen meinte. Leider konnte ich nicht mit einer passenden Beleidigung auf Weib kontern. In der Historie waren herablassende Bemerkungen einer Frau gegenüber einem Mann rar gesät. Trotzdem wollte ich es nicht einfach unwidersprochen stehen lassen. »Du sollst mich nicht immer Weib nennen, das ist total unhöflich! Kapierst du das vielleicht mal irgendwann?«
»Der doch nicht«, sagte Fatima halblaut. »Dazu müsste er mehr Verstand haben.«
Ole reckte sich angriffslustig. »Willst du damit etwa behaupten, ich hätte …«
Jerry schnitt ihm das Wort ab. »Leute, es gibt jetzt Wichtigeres, als zu streiten. Walter und ich kümmern uns darum, dass José versorgt wird. Ihr anderen müsst so schnell wie möglich ins Jahr 1873. Packt das Nötigste zusammen.«
»Ist schon erledigt«, sagte Sebastiano. »Wir waren gerade im Aufbruch, als ihr kamt. Was sollen wir dort genau machen?«
»Spielen«, sagte Jerry lakonisch.
»Das ist ein Witz, oder?«, meinte ich.
»Nein«, sagte Jerry sachlich. »José war in den letzten beiden Tagen nie lange genug bei Bewusstsein, um mir die Zusammenhänge zu erklären, aber offenbar ist Moretti ein Alter. Er hat José herausgefordert. Falls ihr dieses Spiel, von dem wir noch nicht mal wissen, woraus es besteht, nicht gewinnen solltet, sind wir alle erledigt.«
Sebastiano ging unruhig auf und ab. »Wo finden wir diesen Alten?«
»Keine Ahnung. Das ist anscheinend schon der erste Teil des Spiels. Den einzigen Hinweis, den wir auf Moretti haben, ist das Lorgnon.«
Ich beugte mich abermals über José, aber er konnte uns keine näheren Erläuterungen mehr geben. Er hatte in der Zwischenzeit wieder das Bewusstsein verloren.
Jetzt zögerte ich nicht länger. Ich holte mein Handy hervor und rief den Notruf.
Während wir auf die Sanitäter warteten, tauschten wir hastig die nötigsten Informationen aus. Sebastiano berichtete Jerry über die Interpol-Ermittlungen. Jerry nahm die Nachricht über Fox’ Auftauchen relativ gelassen auf. Er erklärte, dass José für solche Fälle immer einen Plan B in der Tasche hatte.
»Ach, und wieso weiß ich nichts davon?«, wollte Sebastiano stirnrunzelnd wissen.
»Wahrscheinlich hast du ihn nie danach gefragt.«
»Und wie sieht dieser Plan B aus?«
»José nimmt in solchen Fällen kleinere Korrekturen in der Vergangenheit vor. Verschwundene polizeiliche Anzeigen, verschwundene dienstliche Anweisungen, verschwundene Berichte – die meisten Akten werden über kurz oder lang geschlossen, wenn nichts Neues mehr dazukommt. In ganz hartnäckigen Fällen kann es auch so ablaufen, dass jemand wie Fox sich nach der Schule für einen anderen Beruf entscheidet, also beispielsweise für eine Laufbahn als Lehrer statt als Kriminalbeamter.«
»Du meinst, das ist schon öfter vorgekommen?«, mischte ich mich ein.
Jerry zuckte mit den Schultern. »Ein paarmal auf jeden Fall.«
»Sag José, er soll diesen Fox zum Polarforscher machen«, schlug ich spontan vor.
Sebastiano nickte grimmig. »Gute Idee. Dann gerät der Bursche uns wenigstens nicht mehr zwischen die Füße.«
»Polarforscher? Ich richte es José aus, sobald er wieder fit ist!« Jerry grinste schief. Er zog Sebastiano in eine kumpelhafte Umarmung. »Ihr schafft das mit dem Spiel, klar?« Dann kam er zu mir und nahm mich ebenfalls kurz in den Arm. »Du kriegst das hin, Anna.«
Auch die anderen verabschiedeten sich. Unten vor dem Haus leuchtete bereits das Signallicht des Krankenboots. Sanitäter kamen ins Haus gerannt, und wenig später atmete ich erleichtert auf, als ich sah, dass der immer noch besinnungslose José endlich in professionellen Händen war. Bevor er auf der Trage weggebracht wurde, drückte ich noch einmal verstohlen seine Hand, bis Sebastiano mich von ihm wegzog. Erst jetzt merkte ich, dass ich zitterte.
»Er wird bestimmt schnell wieder gesund«, raunte Sebastiano mir zu. Er nahm mich in die Arme und hielt mich fest.
Ich nickte an seiner Schulter. »Ja«, sagte ich, denn ich wünschte es mir sehnlich und wollte daran glauben. Ich straffte mich. »Und wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.«
Ole, Fatima und Barnaby waren bereit zum Aufbruch. Während sich das Krankenboot entfernte, machten wir uns auf den Weg nach Santo Stefano – das nächste Zeitreiseportal für unseren Sprung ins Jahr 1873.
Mittlerweile war es dunkel, und der Regen war stärker geworden. Wir hatten zwar Schirme dabei, aber es war windig, deshalb waren wir ziemlich durchnässt, als wir den Campo Santo Stefano erreichten.