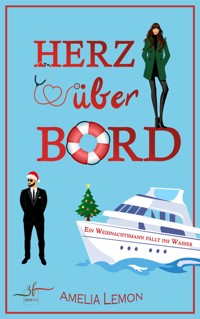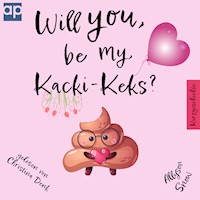4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vor der Trauung sterben, um ein Vampir zu werden? Das hebt den Begriff ‚toxische Beziehung‘ auf ein völlig neues Level.
Wenn es nach Jeremy ginge, würde Linett, so wie die Hochzeitsvorbereitungen, in den letzten Zügen liegen. In den letzten Atemzügen. Denn Linett soll ein Vampir werden – wie er.
Leider schwankt Linett gehörig zwischen ihrem menschlichen Leben und der Liebe zu Jeremy. Dabei ist das Leben als Vampir doch gar nicht so übel. Zumindest wenn man nicht auf Linetts Pro- und Kontra-Liste nachsieht. Aber es wird noch besser (oder schlechter – je nachdem, wie man es betrachtet): Ausgerechnet Linetts erklärter Todfeind Lorenzo Sivori taucht bei ihnen auf und bittet um Unterschlupf.
Jeremy weiß zwar nicht, wie Linetts Nemesis bei ihnen zwischen Kindererziehung, Familienalltag, Wandlungsängsten und Hochzeitsvorbereitungen noch ins Programm passen soll, aber in einem ist er sich todsicher: Ab jetzt kann es nur noch schiefgehen!
Auch der siebte Band der witzig-skurrilen Erfolgsreihe ›Verflixt und zugebissen‹ ist in sich abgeschlossen. Egal ob du die anderen Bände kennst oder nicht, bei diesem Roman bleibt vor Lachen kein Auge trocken – und auch der ein oder andere Blutstropfen könnte dabei fließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Auf schlimmer und ewig
Verflixt und zugebissen 7
Allyson Snow
© Copyright: 2023 - Allyson Snow
Cover created by © T.K.A-CoverDesign / [email protected]
// http://tka-coverdesign.weebly.com/font-copyrights.htmlInnengrafik: pixabay.comLektorat, Korrektorat: Juno Dean, Mathew Snow
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Kapitel 1
Alles eine Frage der Argumente
Linett betrachtete das Papier. Sie wusste nicht, wie viele solcher Listen sie schon geschrieben hatte. Es waren unzählige. Sie schrieb sie zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit – trotzdem kam sie zu keinem Ergebnis. Wie so oft ging sie auch jetzt im Geiste alles durch, was sie über Vampire wusste, was gab es da noch? Ach ja, man konnte nicht sterben. Es sei denn, man wurde gepfählt, geköpft, ausgeblutet, nahm ein Sonnenbad ohne Sonnenschutztrank oder ertränkte sich in einem Weihwasserbecken, weil man Jason nicht mehr ertragen konnte. Jede Möglichkeit davon war ekelig und tat mit Sicherheit ziemlich weh.
Linett hasste Schmerzen. Da erlag sie lieber einem Schlaganfall.
Ach, das brachte nichts. Linett zerknüllte den Zettel und pfefferte ihn ins Leere, ohne hinzuschauen.
»Hé«, beschwerte sich eine weibliche Stimme. Ups. Sie hatte Helen getroffen. Diese saß an ihrem Schreibtisch, nur wenige Meter von dem Linetts entfernt und rieb sich die Stirn. Vor ihr lag das Papierknäuel, und ehe Linett aufspringen und es an sich reißen konnte, faltete Helen es auseinander. Mit gerunzelter Stirn überflog sie Linetts Notizen.
Schweigend und den Blick noch auf das Papier gerichtet, knautschte sie es wieder zusammen und warf es in ihren Papierkorb. Erst dann sah sie zu Linett und hob die linke Augenbraue. »Seien wir ehrlich – du willst kein Vampir werden.«
»Doch«, widersprach Linett. »Also, na ja, vielleicht. Es hat Vorteile.«
»Die du allesamt mit lauen Ausreden ausgleichst.«
»Die sind nicht lau«, protestierte Linett. »Wer will denn ewiges Leben? Um live dabei sein zu können, wie sich die Menschen gegenseitig vernichten? Um die Atombomben nicht zu verpassen, die uns eines Tages um die Ohren fliegen werden?«
»Als Vampir hast du bessere Chancen, nicht von der Strahlung beeinträchtigt zu sein. Sofern wir uns nicht alle in der Kernexplosion auflösen.« Helen sagte das so trocken, dass sich Linett dezent verarscht vorkam.
Gut möglich, dass Linetts Blick ihr mehr oder weniger die Pest an den Hals gewünscht hatte, Helens Züge wurden sanfter. »Liegt es daran, dass du als Vampir Blut trinken und womöglich auch Menschen töten musst? Ich weiß, wie schwer du dich tust, wenn es darum geht, jemanden umzubringen. Du verprügelst zwar alle und versteckst dich hinter deiner großen Klappe, aber im Herzen bist du ein …«
»Ja?«, fragte Linett lauernd, und Helen grinste.
»Ein Weichei.«
»Ich wollte es dir längst sagen, und jetzt ist endlich eine gute Gelegenheit dafür – ich kann dich nicht leiden«, fauchte Linett, und Helen lachte.
»Ich kann mich eben sehr gut an deine Anfänge hier erinnern.« Helen strich sich durch das Haar und zwinkerte Linett zu. »Du hast alles beschützt, was Jason am liebsten beseitigt hätte.«
Linett verschränkte die Arme vor der Brust. Sie hätte Helen liebend gern gesagt, dass sie sich irrte, blöderweise hatte sie recht. Linett prügelte sich zwar durch ganze Reihen von Vampiren, Polizisten und Mafiosi, aber einen Menschen töten – davor schreckte sie tatsächlich zurück. Würde sie das zugeben? Niemals!
»Darum geht es nicht«, sagte sie unwirsch. »Wer will auf ein paar freie Tage zusätzlich verzichten, indem man eine Erkrankung erfindet? Wenn Jason weiß, dass ich ein Vampir bin, lässt der mir das nie wieder durchgehen.«
»Er lässt es dir nicht mal jetzt durchgehen«, erwiderte Helen lakonisch.
»Nur weil er meine neue Handynummer rausgefunden hat und mich anschließend aus Prinzip jede Viertelstunde anrufen würde, um sich zu erkundigen, ob es mir inzwischen besser geht oder er wegen der Behandlung vorbeikommen soll. Ich will nicht von ihm ›behandelt‹ werden, und vor allem will ich mir nicht mal vorstellen müssen, was er damit meint. Das ist echt spooky, ich bin die Verlobte seines besten Freundes. «
»Und genau deswegen bin ich um dein Wohl besorgt.« Das sagte übrigens nicht Helen, sondern blöderweise Jason, der die Tür zu seinem Büro geöffnet hatte und eintrat. Sein Haar war nass, aus seiner Hose tröpfelte es auf den Boden, und seine Schuhe hinterließen feuchte Spuren auf dem Parkettboden. Sie quietschten, als er sich auf einen Besucherstuhl setzte. Stoisch erwiderte er Helens und Linetts Blicke. »Ich habe mein neues Projekt – ein Boot – vielleicht nicht ganz so gut unter Kontrolle, wie ich es gern hätte.«
Aha.
Er deutete auf die Tür. »Schreib noch ›unkompliziertes Lauschen‹ auf deine Liste.«
»Kontra: Man hört Sachen, die einen überhaupt nichts angehen«, murrte Linett.
»Du lauschst ständig«, behauptete Jason.
»Weil du mir nie die wichtigen Dinge erzählst!«
»Zum Beispiel, dass du seit einer halben Stunde bei der Anprobe deines Brautkleides sein solltest?«, spottete Jason.
Linett öffnete gerade den Mund, um die Erwiderung auszusprechen, sobald ihr eine gute einfiel, da erstarrte sie. Ihr Blick huschte zu der Wanduhr, und ups, Jason hatte recht. Sie war zu spät!
Sie krallte sich ihre Tasche, sprang so eilig auf, dass sie sich das Knie an der Tischplatte stieß, und wetzte um den Tisch herum. Nur, um auch noch gegen die Kante zu stoßen. »Aua!«, beschwerte sie sich und trat gegen das Tischbein. Au verflixt, sie hatte vergessen, dass sie Sandaletten trug.
Zischend vor Schmerz hüpfte sie auf dem unversehrten Fuß herum.
»Schnelle Selbstheilung sollte der ausschlaggebende Punkt auf deiner Liste sein.« Jason grinste sie an und wühlte in seiner Sakkotasche, als suche er dort Mary Poppins‘ Stehlampe. »Na, wie ist da dein Einwand?«
»Fick dich«, fauchte sie.
»Dass du immer unsachlich werden musst, wenn du keine Argumente mehr hast«, stichelte der Vampir, und am liebsten hätte sie ihm sein blödes Grinsen aus dem Gesicht geohrfeigt.
»Lass den Brieföffner liegen«, mahnte er sie, als sie die Hand danach ausstreckte. »Und geh jetzt brav dein Kleid anprobieren. Das ist eine Dienstanweisung, sonst kürz ich dir das Gehalt.«
»Hast du nicht was anderes für mich zu tun? Jemanden beschatten?« Die Worte purzelten schneller aus ihrem Mund, als ihr lieb war. Blöder Mist. Sie war hin und her gerissen. Eigentlich wollte sie heiraten, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie wollte sie ein Vampir werden, aber irgendwie auch nicht!
Jasons Lächeln schaffte es ernsthaft, noch breiter zu werden. Wenn der so weiter machte, war selbst der Joker beeindruckt. Und ach, verflucht, er hatte ja recht. Das Brautkleid passte sich nicht von allein an. Egal, wie nervig es war, das Gequassel der Schneiderin zu ertragen. Linett humpelte also lieber zur Tür hinaus. Sie zog sie hinter sich ins Schloss, als sie Jasons Worte hörte, die er garantiert nicht an Linett richtete, sondern an Helen.
»Geht es nur mir so oder hast du ebenfalls das Gefühl, dass sie die Hochzeit und die Wandlung mit allen Mitteln torpediert?«
»Das stimmt überhaupt nicht«, rief Linett und stieß die Tür abermals auf.
Jason stand vor Helens Schreibtisch, eine Tüte mit seinem geliebten Kraut in der Hand, und drehte sich zu ihr um. »Willst du das etwa leugnen?«
»Ja!« Linett trat einen Schritt ins Büro.
»Dann versuchst du also nicht gerade, mühsam einen Streit vom Zaun zu brechen, damit du einen Grund hast, nicht zur Anprobe zu gehen?«
»Ja! Äh, halt, nein!«
»Geh jetzt zur Anprobe«, sagte Jason langsam, als wäre sie nicht ganz dicht. »Sonst schleife ich dich an den Haaren hin. Du bist noch kein Vampir, somit bin ich stärker als du.«
»Ha!«, entfuhr es Helen und Linett gleichzeitig.
Linett klopfte auf ihre Tasche, unter dem Stoff klang es metallisch, und sie spürte die Umrisse ihrer Pfanne. »Lass es doch auf einen Versuch ankommen«, schlug sie mit einem lieblichen Lächeln vor.
Jason schnaubte amüsiert und fing an, sich einen Joint zu drehen, wobei er ein bisschen Kraut auf den Boden krümelte. »Ich dachte, über den Punkt, dass du dich mit mir prügeln willst, sind wir langsam hinaus.«
»Die nächste Gehaltserhöhung steht an«, säuselte Linett. »Und ich hätte gern mehr Urlaub.«
»Mach einfach weniger krank, dann denke ich fünf Minuten darüber nach, bevor ich mit einem Nein antworte.«
»Das letzte Mal war ich vor einem halben Jahr krank«, verteidigte sich Linett.
»Du hattest erst vor zwei Wochen angeblich Migräne«, schoss Jason unbeirrt zurück, und Linett stöhnte innerlich. Mist, das hatte sie völlig vergessen. »Du hättest mir einfach sagen können, dass Raphael auf dem Schulhof mit Süßigkeiten gedealt hat, weil die an seiner Schule verboten sind.«
»Sehe ich aus, als hätte ich den Rest meines Verstandes verloren?«, platzte Linett heraus. »Du hättest ihm Tipps gegeben, wie er das nächste Mal nicht erwischt wird.«
Jason lachte so laut, dass er sich an Helens Schreibtisch anlehnen musste, und diese wiederum lächelte ebenso amüsiert. Immerhin zwei, die das lustig fanden! Wenn Linett nicht schon spät dran wäre, würde sie ihrem Chef dafür den Kopf abreißen! Aber ihr fiel ein, dass ihr zu allem Überfluss auch die Ausreden ausgingen. Also rannte sie die Stufen hinunter. Auf dem Absatz hatte sie so viel Schwung, dass sie gegen die Wand prallte und beim Zurücktaumeln beinahe den Rest der Treppe hinuntergepurzelt wäre. Sollte sie sich jetzt spontan das Genick brechen, hätte sie zumindest zwei Entscheidungen weniger zu treffen – ob sie ein Vampir werden wollte und ob die Bindungsängste, die aufkeimten, sobald jemand das Wort ›Hochzeit‹ erwähnte, therapiebedürftig waren.
Herrgott noch eins, sie hatte mit Jeremy ein Kind gezeugt, das mittlerweile in die Schule ging. Man konnte sagen, dass die Ehe die logische Konsequenz war.
Sie liebte Jeremy.
Er machte sie zwar wahnsinnig, aber man zeige ihr einen Mann, der das nicht schaffte! Über kurz oder lang wollte man alle an die Wand tackern. Die Frage war nur, ob man sie irgendwann auch wieder runterholen wollte.
Linett wankte auf die Straße und holte tief Luft. Das Pochen ihres Herzens ließ ihren gesamten Brustkorb vibrieren, bis zum Hals hinauf. Wie war es wohl, wenn man das nicht mehr spürte? Wenn man gestorben war, um dann als Vampir aufzuwachen?
Jeremy hatte behauptet, eine Wandlung würde nicht wehtun, wenn sie absichtlich herbeigeführt wurde. Er würde Linetts Blut trinken, bis sie an Blutverlust und dem zusammenbrechenden Kreislauf starb. Allerdings war Jeremy als Vampir geboren worden, weil seine Eltern zum Zeitpunkt seiner Zeugung bereits Vampire gewesen waren. Seine Erfahrung war also keine Referenz.
Jason meinte hingegen, sterben sei wie einschlafen, aber mal ehrlich – Jason glaubte sie genauso wenig wie Jeremy. Er war damals bei einem Autounfall verunglückt und hatte lang genug überlebt, um noch ins Krankenhaus transportiert zu werden. Dort hatte ein vampirischer Arzt den Komapatienten anscheinend so attraktiv gefunden, dass er ihm das Leben nach dem Tode schenkte. Wieso hatte sie Jason eigentlich nie gefragt, ob der sich bei seinem ›Gönner‹ mit einem ordentlichen Blowjob bedankt hatte? Das musste sie unbedingt nachholen.
Alle anderen Vampire, die sie kannte, waren mit Gewalt getötet worden – logischerweise gegen ihren Willen –, und wenn man sie darauf ansprach, lächelten sie nur säuerlich und wechselten abrupt das Thema. Keiner konnte ihr einreden, dass eine Wandlung nicht traumatisierend war. Es sei denn, man hieß Jason Harris und kiffte sich anschließend das untote Gehirn weg. In ihre Gedanken versunken trottete Linett die Straße entlang. Sie wollte zur Bushaltestelle und achtete kaum auf das Geschehen auf der Fahrbahn. Bis sie bemerkte, dass ein Smart auffallend langsam über die Straße tuckerte, immer auf ihrer Höhe. Zu allem Überfluss fing das Ding auch noch an zu pfeifen wie ein Bauarbeiter und rief ihren Namen.
»Linett Roux. Bitte steigen Sie ein. Der Fahrservice von Jason Harris wird Sie zu Ihrem Zielort bringen«, blökte es, und Linett blieb stehen. Sie war von Jason und seinen Nuckelpinnen ja einiges gewohnt, aber dass die einen jetzt schon auf offener Straße verfolgten, war neu.
Linett trat näher an den Smart heran. Es stand nun im Halteverbot und schaltete den Warnblinker an. Sie schaute durch das Fenster. Niemand saß hinter dem Steuer.
Die hintere Tür des Viertürers schwang einladend auf und hätte beinahe einen Fahrradfahrer von seinem Gefährt geschlagen.
»Pass doch auf«, grölte dieser, als er sich nach einem Schlenker wieder fing.
»Benutzen Sie den Fahrradweg!«, maulte der Smart zurück. »Und Mademoiselle Roux steigt bitte ein!«
»Und wenn ich nicht will?«, fragte sie.
»Automatischer Entführungsmodus aktiviert«, verkündete die Karre und öffnete die Klappe zum Kofferraum. Okay, sie wollte nicht rausfinden, wie der Smart sie da reinzerren wollte. Sie traute Jason ohne Weiteres zu, wirklich einen Entführungsmodus eingebaut zu haben. Samt Kamera, um ihr ungläubiges Gesicht direkt auf die Monitore im Büro übertragen zu lassen, wenn sie in dem Kofferraum lag.
»Mach die Fahrertür auf«, verlangte Linett von dem Smart.
»Die Einnahme des Fahrersitzes ist unnötig. Der Service auf der Rückbank ist besser.«
»Und wer fährt?«
»Ich.«
Was fragte sie überhaupt? »Du kannst nicht fahren.« Okay, das war das dämlichste Statement aller Zeiten. Linett hatte schließlich gesehen, wie der Smart fahrerlos neben ihr her getuckert war. Wenn Jason keinen Hamster dressiert hatte, der Gas und Bremse bediente und nebenbei von unten lenkte, hatte er sein Auto wohl auf den autonomen Modus umgebaut. Zu einem der Dinger, die ständig in den Schlagzeilen auftauchten, weil sie einen Unfall gebaut hatten.
»Ich fahre«, gab sich Linett störrisch. »Oder ich steige nicht ein.«
»Entführungsmodus aktiviert.«
»Wehe!« Linett packte den Riemen ihrer Tasche fester. »Ich hau dir mit meiner Pfanne solche Dellen in den Lack, dass die niemand mehr ausbeulen kann.«
»Gefährlichkeitsanalyse abgeschlossen, Linett Roux‘ Pfanne als Waffe bestätigt. Ergebnis der Analyse: Fahrenlassen von Mademoiselle Roux ist das kleinere Übel.« Das Auto schloss die Tür zur Rückbank und ließ die Fahrertür aufschwingen.
Linett wollte dem Auto ein ›geht doch‹ reindrücken, als ein Polizist auf sie zusteuerte.
»Das Fahrzeug steht im Halteverbot!«
»Stellen Sie ihm den Strafzettel aus«, gab Linett zurück und zeigte auf den Smart. »Es hat selber dort geparkt.«
»Sind Sie die Halterin?«
»Nein.«
Der Polizist blähte die Nasenflügel, als müsste er sich verkneifen, tief Luft zu holen. »Die Fahrerin?«
»Nein, es will selbst fahren.«
»Linett Roux hat darauf bestanden, zu fahren«, verpfiff der Smart sie.
»Hé, gerade noch wolltest du fahren.«
»Mir wurde Sachbeschädigung angedroht«, lamentierte der Smart. »Ich möchte Anzeige erstatten, Monsieur.«
Der Streifenpolizist, der das Auto bis dahin fasziniert betrachtet hatte, schien langsam den Spaß an der Sache zu verlieren. »Wie funktioniert das? Über einen Lautsprecher? Das ist Beamtenbeleidigung.«
»Niemand hat Sie beleidigt«, protestierte Linett.
»Sehr wohl, indem Sie versuchen, sich über mich lustig zu machen«, fauchte der Polizist.
Linett verdrehte so auffällig wie möglich die Augen. »Schicken Sie das Knöllchen einfach an Jason Harris. Wenn Sie halb so intelligent sind, wie Sie glauben, finden Sie dessen Adresse raus.« Linett warf sich hinter das Lenkrad und schlug die Tür zu. Noch im gleichen Augenblick fuhr das Auto an, schnippte zwischen die anderen Vehikel auf die Fahrbahn und mogelte sich in jede Lücke, um schnell die Spuren zu wechseln. Linett versuchte zu lenken, doch das Lenkrad reagierte nicht.
»Lass mich steuern«, verlangte sie.
»Anschnallen«, blaffte dieses verkappte Domina-Auto zurück. Erst als Linett den Sicherheitsgurt anlegte, ertönte ein Klicken, als wäre etwas entsichert worden, und sie konnte lenken!
Ja, verflucht, so fühlte sich Autofahren perfekt an. »Danke«, strahlte Linett. »Nichts für ungut, aber ich trau nur mir selbst.«
»Ich freue mich, Sie an Bord begrüßen zu dürfen«, flunkerte die Schrottschüssel schamlos. »Bitte lehnen Sie sich zurück. Ihre aktuelle Stimmung wird analysiert und das Bordsystem automatisch darauf eingestellt.« Sie erreichten die nächste Kreuzung, da verkündete das Auto: »Stimmung auf unterem Niveau. Schokolade und Alkohol werden bereitgestellt.«
»Es ist neun Uhr«, protestierte Linett.
»Gras?«
»Nein!«, rief Linett. »Gib mir nur die Schokolade.« Mit einem ›Fump‹ knallte ihr eine Tafel Schokolade gegen die Stirn. Sie steckte sich die ersten Stücke in den Mund, als ihr Telefon klingelte. Sie hatte kaum angenommen, da schallte ihr die schnarrende Stimme von Raphaels Schuldirektor entgegen. »Kommen Sie bitte Ihren Sohn abholen, Madame Roux.«
»Wieso? Er hat noch fünf Stunden.«
»Er ist für heute suspendiert. Ich bin mir bloß noch nicht einig, ob das auch für den Rest seines Lebens gilt.«
Die Ampel schaltete auf Grün, und der Smart war selbst losgefahren, weil sie reglos verharrt hatte, da stieg Linett so kräftig auf das Bremspedal, dass die Klapperkiste aufkreischte. »Mein Heck, oh Gott, mein Heck. Ich hab’s doch kürzlich erst ausbeulen lassen!«
»Krieg dich wieder ein, der Wagen hinter uns hat genug Abstand gehalten«, motzte Linett.
»Ähm, Madame Roux?«, tönte Monsieur Flandin aus dem Telefon.
»Sie waren nicht gemeint. Wobei Sie sich ebenfalls mal mit Ihrem Hinterteil beschäftigen sollten. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war es nicht so stramm, wie es hätte sein können.«
Es war erstaunlich, wie ruhig es in einem Auto inmitten einer Großstadt und dem empörten Gehupe der Wartenden hinter einem werden konnte, wenn man etwas sehr Falsches gesagt hatte. Im Hintergrund des Telefonats hörte Linett jemanden prusten, und sie wusste ganz genau, dass es Raphael war.
»Humorlevel wurde berechnet«, trötete das Auto. »Jason Harris vergibt fünf Sterne.«
»Ich nur einen«, gab Raphaels Schulleiter seinen Senf dazu.
Gott im Himmel. Bei dem war sie unten durch. Wie sollte sie ihn jetzt dazu bringen, Raphael nicht von der Schule zu werfen? Linett ließ die Stirn auf die Hupe sinken, und nun trötete das Auto wirklich. Der langgezogene Ton wehte über die Straße.
»Bitte legen Sie Ihren Kopf woanders ab, ich möchte nicht wegen Lärmbelästigung belangt werden«, schnauzte die Blechkiste.
»Ich bin gleich da«, sagte Linett schwach und legte auf. Erst dann hob sie den Kopf und tippte gegen die Mittelkonsole. »Los, gib mir den Alkohol. Du darfst auch fahren.«
Kapitel 2
Mafiosi sind gute Foodblogger
›Das Hähnchen und die Rosmarin-Kartoffeln waren außerordentlich köstlich. Das Restaurant und den Koch kann ich weiterempfehlen.‹
Carlos‘ Nachricht blinkte in Jeremys Handydisplay auf, und Jeremy musste sie nicht mal öffnen, um zu wissen, dass in dem angehängten Bild ein Pfannengericht zu sehen war. Es war immer ein Pfannengericht. Eben wegen der Pfanne. Dass Linett weder mit einem Messer noch mit einer Pistole umgehen konnte, sondern ihre Gegner mit einer Pfanne niederknüppelte, sorgte seit Jahren für Spott unter Jeremys Berufskollegen. Es waren notorische Schwerverbrecher, Auftragsmörder, Geldeintreiber oder schlichtweg Drogendealer – aber jeder Einzelne lachte darüber, dass sich Linett für eine Pfanne entschieden hatte. Wirklich schade, dass Jeremy nicht jedem von denen die Wirbelsäule in Splittern aus dem Fleisch ziehen konnte. Nicht, dass er es nicht versucht hatte. Beim ersten Mal war es noch befriedigend, beim zweiten Mal schon langwieriger und hatte seine Geduld auf die Probe gestellt. Beim fünften Mal war es dann geradezu öde gewesen. Als Linett anschließend behauptet hatte, Jeremy sei viel zu empfindlich wegen des Spottes, hatte er damit aufgehört. Und ja, er hatte geschmollt! Zwei Wochen lang. Danach hatte Linett sich ja mit einem amerikanischen Möchtegern-Al-Capone anlegen müssen. Was hatte Jeremy daraus gelernt? Man konnte nicht schmollen, wenn man die Frau, die man liebte, retten musste. Sich in Linett zu verlieben, war der blödeste, äh, schönste Fehler seines Lebens gewesen.
Und jetzt wollten sie heiraten. Jippie.
›Wäre das nicht was für deine Frau?‹
Die nächste Nachricht von Carlos wurde eingeblendet, samt einem Bild von einem Schaufenster eines Haushaltswarenladens. Man rate, was darin ausgestellt war. Richtig. Pfannen. In allen Größen und Varianten. Die Ladenbeschriftung klang italienisch. Wahrscheinlich war Carlos irgendwo in Rom unterwegs. Carlos mochte einst ein guter Freund gewesen sein, aber seitdem dieser Bastard für Lorenzo Sivori arbeitete und Jeremy nur noch solche dämlichen Botschaften schickte, hatte er nicht übel Lust, ihn einfach vom Angesicht der Erde zu tilgen. Jason hätte mit Sicherheit nichts dagegen. Dass Carlos zu dem italienischen Mafiapaten und Jasons Lieblingsfeind Lorenzo gewechselt war, nahm ihm Jason bestimmt genauso übel wie Jeremy.
›Fick dich‹, tippte Jeremy also zurück. ›Und bete zu Gott, dass du mir nie über den Weg läufst.‹ Er hatte es kaum abgeschickt, da sah er im Messenger unter Carlos‘ Namen den Vermerk ›schreibt …‹. Auch wenn Jeremy ursprünglich anderes zu tun hatte und aus purem Stolz das Handy wegstecken und erst Stunden später die Nachricht lesen wollte, blieb er trotzdem vor dem Haus stehen, in dem Jason sein Büro hatte, und wartete auf die verflixte Antwort.
›Eigentlich mache ich genau das Gegenteil‹, schrieb Carlos. ›Ich habe Probleme und brauche Hilfe.‹
›Mit Lorenzo angelegt?‹
›Lass es mich persönlich erklären.‹
Also schien Carlos herkommen zu wollen. Vielleicht verschob Jeremy den gepflegten Mord an ihm nach hinten und wartete erst ab, was sein einstiger Freund zu sagen hatte. Er war sang- und klanglos verschwunden, und das Einzige, was Jeremy bisher von ihm gehört hatte, waren diese nervtötenden Nachrichten, und in einer hatte gestanden, dass er bei Lorenzo sei.
›Sobald du in der Stadt bist, komm zu unserer neuen Wohnung, dann bereitet dir Linett ein richtiges Pfannengericht‹, tippte Jeremy.
›Fein, ich freu mich drauf.‹
Hä? Jeremy runzelte die Stirn. Carlos wusste ganz genau, dass Linett nicht kochen konnte. Wenn man anbot, dass Linett für einen kochte, sollte man schnellstmöglich die Beine in die Hand nehmen. Es handelte sich nämlich um eine höflich formulierte Morddrohung. Und das sollte Carlos eigentlich klar sein. Wusste der Teufel, was der für Probleme hatte. Wahrscheinlich war er in Eile. So eine Antwort war absolut nicht typisch für ihn, nur hatte Jeremy momentan nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Er musste seine abtrünnige zukünftige Frau suchen, bevor ihn die Schneiderin zum zwölften Mal anrief und fragte, wo zum Kuckuck Linett blieb. Und das nur, weil diese sich weigerte, ihre neue Telefonnummer rauszurücken. Was zum Henker hatte er mit ihrem Kleid zu tun? Und warum hatte nicht mal er die Handynummer seiner Braut? Wenn Jason sie inzwischen rausgefunden hatte, aber ihm nichts verriet, häkelte er ihm aus Stacheldraht neue Gedärme und setzte sie ihm mit Gewalt ein.
Mittlerweile presste Jeremy dermaßen die Zähne aufeinander, dass das Knirschen jedes andere Geräusch übertönte, sogar das seiner Schritte, als er die Treppe nach oben stieg. Schmerz schoss durch seinen Kiefer, diesmal knirschte es anders. Jeremy lockerte seine Gesichtsmuskulatur und tastete nach seinem Eckzahn. In den letzten zwei Wochen war er ihm fünfmal abgebrochen, weil die Vorbereitungen der Hochzeit ihn einfach nur fertigmachten. Was sprach dagegen, zum Standesamt zu gehen, eine Unterschrift unter eine Urkunde zu setzen und in die Flitterwochen abzuhauen? Sie mussten ja nicht mal den Standesbeamten umbringen, wenn Linett nicht wollte (und Jeremy gerade keinen Hunger hatte).
Im ersten Stock riss er die Tür zu Jasons Büro auf. Durch die hohen Fenster fiel das Sonnenlicht hinein, zwei Schreibtische teilten sich den Raum mit mehreren Aktenschränken. Hinter einem davon saß Helen, hinter dem anderen hockte nicht wie erwartet Linett, sondern Jason – die Beine auf dem Tisch, ein Arm hinter den Kopf gelegt und in der freien Hand eine dampfende Tasse Kaffee.
»Sonnenschein«, begrüßte ihn Jason so fröhlich, dass es an blanken Hohn grenzte. »Wie schön, dich zu sehen.«
»Wo ist sie?«, blaffte Jeremy.
Jason hob die Augenbrauen, sein Grinsen blieb. Es sank allerdings ein wenig in sich zusammen, nur einen Hauch, aber Jeremy kannte Jason gut genug, um es zu bemerken.
»Was ist jetzt wieder los?«, knurrte Jeremy. »Hast du sie zu einem Auftrag geschickt? Hat sie endlich jemanden mit dieser verflixten Pfanne umgebracht? Oder hat sie kalte Füße bekommen und ist abgehauen?«
»Nein. Nein. Ich weiß es nicht«, beantwortete Jason seine Fragenlitanei. »Sie ist vor einer Stunde hier losgefahren. Sie müsste längst bei der Schneiderin sein.«
»Ist sie aber nicht!« Jeremy verschränkte die Arme vor der Brust und spannte seine Muskeln so sehr an, dass er nicht nur spürte, wie sie den Stoff seines Hemdes dehnten, sondern auch noch schmerzten. »Wenn ich ihre alte Handynummer anrufe, geht eine tattrige Oma ran und erzählt mir, dass sie auf diese Betrugsanrufe nicht hereinfiele, und wenn ich bei ihr vorbeisehen will, um sie persönlich über den Tisch zu ziehen, soll ich ihr die aktuelle Fernsehzeitschrift mitbringen und ihr beim Suchen ihrer Dritten helfen, weil sie die verlegt hat.«
Jason lachte dermaßen, dass der Kaffee aus der Tasse auf seine Hose schwappte. Erst recht, als Jeremy mit einem schnellen Schritt bei Jason war, ihn am Kragen packte und nicht sonderlich sanft aus dem Stuhl zerrte, bis sich ihre Nasen berührten. »Wo ist meine Frau?«, knurrte Jeremy.
»Deine Verlobte«, korrigierte Jason.
»Ist mir völlig egal, wie du sie nennst. Ich weiß, dass du ihr Handy orten kannst.«
»Ihr Handy liegt in eurer Wohnung. Da sie selten ohne Smartphone vor die Tür geht, vermute ich, sie hat sich ein neues Telefon mit einer neuen Nummer zugelegt.«
»Was?«
Jason zuckte die Schultern. »Man kann nicht sagen, dass sie in Sachen Vorbereitung nicht zweigleisig fährt. Apropos Fahren, sie ist mit einem meiner Fahrzeuge unterwegs, und so blöd, das zu klauen, wenn sie durchbrennt, wird sie nun nicht sein.«
»Hast du sie eben dumm genannt?«
»Würde mir nie einfallen«, behauptete Jason. »Höchstens zeitweise ein bisschen unterbelichtet.«
Jeremy knurrte so bedrohlich, dass er damit einen Säbelzahntiger verscheucht hätte, doch Jason lachte nur dämlich. Er mochte ja Jeremys bester Freund sein, es gab allerdings Momente, da konnte er Jason nicht leiden. Trotzdem ließ er ihn los, als Jason seine Hände umfasste und sich aus seinem Griff riss. Immerhin behielt Jeremy ein Stück seines blütenweißen Kragens zwischen den Fingern. Eine tiefe Befriedigung, wenigstens etwas kaputt gemacht zu haben, machte sich in ihm breit.
Jason stellte sich hinter Helen und forderte sie auf, das Programm aufzurufen, mit dem er seine Fahrzeuge orten konnte. Zwar hätte Jeremy liebend gern noch mehr zerstört, aber man konnte bekanntlich nicht alles haben. Also begnügte er sich damit, vier Sekunden einzuatmen und sieben Sekunden lang aus. Und während dieser elf Sekunden verfluchte er Linett, Jason und alle, die ihm spontan einfielen. Aber vor allem Linett und Jason.
Erst dann lehnte er sich hinter Helen und Jason an die Wand. Auf dem Monitor wurde eine Karte von Frankreich angezeigt, mit vielen kleinen, lilafarbenen Punkten, die allesamt für eines von Jasons Autos standen. Manche standen nur bereit, falls sie jemand brauchte, andere wurden von seinen Mitarbeitern regelmäßig genutzt.
Jason gab ein Kennzeichen in das Suchfeld ein, und die Karte zoomte näher an Paris heran, wurde immer detaillierter, bis die D’or Castex International School Paris genau über dem Punkt lag, der das Auto kennzeichnete, mit dem Linett unterwegs sein sollte.
»Sie ist in Raphaels Schule«, sagte Jeremy verblüfft.
»Bei allem Gemecker scheint sie euren vorlauten Nachwuchs ausreichend zu mögen, um ihn beim Abhauen mitzunehmen«, stellte Jason fest.
»Wenn du nicht den Mund hältst, näh ich ihn dir zu. So viel handwerkliches Geschick habe ich gerade noch«, brüllte Jeremy.
»Jason mag dich zwar sehr unsanft mit der Nase draufstoßen zu wollen, unrecht hat er jedoch nicht«, mischte sich Helen ein. »Linett hat Muffensausen – vor der Hochzeit und umso mehr vor der Wandlung zum Vampir.«
»Ich habe ihr tausendmal gesagt, dass es nicht wehtut«, rief Jeremy.
»Und du hast erwartet, dass sie dir glaubt?«, stichelte Jason. »Weil du ja so unfassbar viel Erfahrung im Sterben hast?«
»Aber du, oder was? Du warst im Koma und hast nichts mitbekommen«, fauchte Jeremy.
»Also bitte, ich hatte die Schmerzen in meinen zerdrückten Innereien und zerschmetterten Knochen, bevor ich ins Koma gefallen bin«, maulte Jason. »Ich verstehe durchaus, dass Linett lieber andere zu dem Thema befragt hat. Nur hat ihr Amélies Bericht, wie es ist, stranguliert zu werden, meiner bescheidenen Meinung nach nicht geholfen.«
Jeremy stöhnte. »Warum erzählt deine Frau meiner Braut so was? Ich habe nicht vor, Linett zu erhängen.«
»Ich glaube, Amélie musste da etwas aufarbeiten. Sie hat sogar angefangen zu weinen.« Jason hob entschuldigend die Schultern.
»Amélie ist nun mal schwanger, das weiß auch Linett«, erwiderte Helen. »Sie heult bei jeder Gelegenheit. Diese Schwangerschaft setzt ihr mehr zu als die ersten beiden.«
»Eleyne hat einen Entwicklungsschub und ist anhänglicher als sonst«, erzählte Jason. »Sie verweigert jegliche Form von Nahrung, es sei denn, unser Babysitter hält ihr seinen Finger hin, damit sie ihre Zähne hineinrammen kann …«
So gern sich Jeremy sonst in diesem Büro herumtrieb, heute war es schlichtweg zu viel für seine Nerven. Wenn hier nur noch einer – Jason – einen blöden Spruch von sich gab, war Jeremy innerhalb weniger Minuten arbeitslos, weil er Jason die Kehle herausriss und ihn ausbluten ließ und allen anderen Mafiabossen und der ganzen französischen Polizei damit sogar noch einen Gefallen tat!
Er stapfte aus dem Büro und warf die Tür hinter sich zu. Immerhin hatte die den Anstand, aus den gebrochenen Angeln zu fallen.
Zu allem Überfluss hatte Carlos in der Zwischenzeit eine weitere Nachricht geschickt. ›Ich komme morgen. Ich muss untertauchen.‹
Na herrlich. Jeremy wusste zwar nicht, wie ein zu Lorenzo Sivori übergelaufener Ex-Mitarbeiter bei ihm zwischen Kindererziehung, Familienalltag, Wandlungsängsten und Hochzeitsvorbereitungen noch ins Programm passen sollte, aber vielleicht ergriffen sie dann ja alle gemeinsam die Flucht. In verschiedene Richtungen.
Kapitel 3
Konfliktkreativ im Elterngespräch
Jeremy hatte immens schlechte Laune, als er auf die Straße trat. Was immer Linett in Raphaels Schule trieb, es würde bestimmt nicht zu seiner Erheiterung beitragen. Seit der alte Monsieur Hébras in Rente gegangen war, bekam Raphael wegen der nichtigsten Vergehen einen Rüffel. Hébras hatte Jeremy einen Gefallen geschuldet, und nur dank ihm hatte Raphael den Platz in der Eliteschule bekommen. Aus irgendwelchen Gründen war es Linett wichtig gewesen, Raphael eine gute Bildung zukommen zu lassen. Mit dem Satz ›Ich möchte nicht, dass er mal so wird wie ihr, nur weil ihm niemand die Alternativen aufgezeigt hat‹ hatte sie im gleichen Atemzug Jeremy, Jason, Helen und auch die komplette Mafia beleidigt. Sie waren eine gute Branche! Reich an Geld und Einfluss. Als ob man bei einem Auftragsmörder als Vater und einer Mafia-Assistentin, die generell eine Pfanne in der Handtasche mit sich herumtrug, erwarten konnte, dass Raphael eines Tages den Nobelpreis für Physik erhielt. Es sei denn, er fand heraus, wie man aus fünf Kilometern Entfernung einen Mann in einem vorbeirasenden Zug mit einer einzelnen Kugel tötete. Das hatte Jeremy letztens in einem Film gesehen, und er konnte bestätigen: Man traf alles, nur nicht das geplante Opfer.
Jeremy bewegte sich fort von der Hauptstraße, suchte sich seinen Weg in möglichst wenig besuchten Seitenstraßen. Wenn niemand in Sicht war, rannte er los, und die Umgebung raste an ihm vorbei. Es war lästig, bei Tageslicht durch Paris zu rennen und aufpassen zu müssen, dass ihn niemand sah. Zumindest ersparte er sich damit den Berufsverkehr und eine von Jasons aufsässigen Blechkarren.
Raphaels Schule lag nur ein paar Kilometer von Jasons Büro entfernt, in einem der nobleren Gegenden von Paris. Es handelte sich um eine alte Villa im neugotischen Stil. In die Fassade aus hellem Stein waren rote Ziegelsteine als Akzente eingesetzt worden, und um die Fenster zogen sich Stuckverzierungen. Das Gelände wurde von einem hohen gusseisernen Zaun umgeben, dessen Tor offen stand. Ein Stück weiter parkte Jasons Smart.
Es war gerade Unterricht. Durch die offenen Fenster im Erdgeschoss sah er Schüler, die sich entweder über ihre Hefte beugten oder alle in die gleiche Richtung, wohl zur Tafel, sahen. Der Schulhof war leer, als Jeremy ihn überquerte, und auch in den Gängen begegnete ihm niemand.
Da er nicht wusste, wo sich Linett aufhielt, ging Jeremy die Treppe hinauf in den dritten Stock. Dorthin, wo sich das Büro des neuen Schuldirektors Èmeric Flandin befand. Die Mauern des Flurs waren weiß verputzt, unter der Decke säumten Deckenfriese die Wände. Sollte sich Jeremy gefragt haben, ob er an der richtigen Stelle nach seiner Verlobten suchte, bestätigte ihre schrille Stimme seine Vermutung. Sie drang ihm schon entgegen, da war er noch mehrere Meter vom Schuldirektorbüro entfernt. Gut, für normale Menschen wäre ihr Gezeter nicht so durchdringend zu hören, aber sein Vampirgehör verschaffte ihm einen Vorteil – er konnte ohne Mühe lauschen.
»Sie bringen den Kindern doch bei, dass sie ihre Zeit nicht mit Spielen vergeuden, sondern lieber eine Firma gründen sollen«, keifte Linett.
»Wir haben lediglich im Wirtschaftsunterricht aufgezeigt, wie eine Firmengründung funktioniert«, brummte eine männliche Stimme. Sie war tief, ausdrucksstark und klang immens erbost.
»Er hat eine Firma gegründet«, gab Linett zurück. »Ich habe gestern seinen Gewerbeschein gesehen. Ich glaube, Raphael hat sich sogar beim Finanzamt angemeldet.«
»Damit sie mich nicht wegen Steuerhinterziehung dran bekommen, so wie Al Capone«, verkündigte die eher piepsige Stimme seines Sohnes.
»Al Capone war ein Verbrecher«, schnarrte Monsieur Flandin.
»Mein Patenonkel sagt, dass er nur die Gesetze zu seinem Vorteil zu interpretieren wusste«, verkündete Raphael. »Und eben seine Steuererklärung nicht richtig ausgefüllt hat.«
»Al Capone hat wenigstens Alkohol verkauft«, blaffte der Direktor. »Du verkaufst ein Fantasiegespinst.«
»Im Internet werden NFT’s bei offiziellen Handelsbörsen getradet«, gab Raphael zurück, und Jeremy vernahm ein synchrones Stöhnen aus einer männlichen und einer weiblichen Kehle.
»Nicht der Vortrag wieder«, seufzte Linett, aber Raphael ließ sich nicht abhalten.
»Für non-fungible Token, kurz NFT, gibt es seit letztem Jahr einen rasant wachsenden Markt«, dozierte Raphael. »Es ist ein Kryptowert, der einen bestimmten Gegenstand symbolisiert, wie beispielsweise ein Gemälde. Letzens wurde ein Gemälde des britischen Straßenkünstlers Banksy von einer Gruppe Investoren als NFT dargestellt und das Original verbrannt. Das wird über kurz oder lang andere, ebenso berühmte Kunstwerke treffen. Aber auch moderne und unbekannte Künstler wie ich können sich daran beteiligen, solange ihre Kunst digital verfügbar ist und nicht dupliziert wird. Man kann sie überall anbieten, am besten natürlich über lizenzierte Plattformen, und dort werden Höchstpreise erzielt!«
»Ich bezweifle, dass das mit Al Capone vergleichbar ist«, wandte Linett ein.
»Ist es«, beharrte Raphael.
»Ist es nicht«, gab der Direktor zurück.
»Doch«, bestand Raphael. »Al Capone hätte seine Waschsalons in das Metaverse verlegt, wenn er in der heutigen Zeit leben würde.«
»Nein.«
»Doch.«
»Warum habe ich nicht mehr getrunken?«, fragte Linett. »Ist das Ihre geheime Bar? Diesen Wein können Sie wegschütten, der schmeckt nach Essig und taugt nicht mal für Salat. Oh, Rum, sehr gute Wahl. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie über so viel Geschmack verfügen.«
»Madame Roux, lassen Sie die Finger von meinem Rum. Außerdem … füllen Sie ein Weinglas ernsthaft bis zum Rand?«
»Tu ich nicht«, gab Linett zurück. »Das sieht nur so aus.«
»Es sieht nicht nur so aus«, verpetzte Raphael seine Mutter. »Damit hält sie sich nur davon ab, Ihnen eine Pfanne über den Kopf zu ziehen. Obwohl ich das wahnsinnig gern sehen würde und Alkohol sowieso ungesund ist. Also pflichte ich Ihnen bei: Maman, stell das Glas weg, oder ich sag es Papa!«
An dieser Stelle beeilte sich Jeremy, die Tür aufzureißen. Linett würde Raphael zwar kein Haar krümmen, aber der Bengel hätte es drauf, sie dazu zu bringen, dass sie dem Direktor tatsächlich ihre Pfanne auf den Schädel schlug.
Die drei standen sich inmitten cremeweißer Sessel gegenüber. Raphael steckte in seiner Schuluniform, die an den Beinen zu kurz war, weil der Junge schneller wuchs als Efeu mit Turbo-Dünger. Er reckte sich nach oben und versuchte, das Glas zu erreichen, das Linett weit über ihren Kopf hochhielt. Der Rum lief bei jedem Rütteln von Raphael an seiner Mutter über den Rand – es war wirklich ein Weinglas –, tropfte auf Linetts schwarzes Kleid mit Spitzenärmeln und Silberschnallen an der Taille. Sie streckte die Zunge raus und fing einfach mit dem Mund auf, was aus dem Glas schwappte.
Direktor Flandin hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte auf die beiden, als könne er sie nur mit seinem Blick dazu bewegen, sich in Luft aufzulösen. Ein aussichtsloses Unterfangen, selbst wenn er sich als Magier herausstellen sollte. Linett bekam man nicht los, und Raphael, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, sowieso nicht.
»Hallo, Papa«, strahlte ihn Raphael an, reckte sich ein wenig mehr und schrammte mit den Fingerkuppen immerhin am Fuß des Weinglases entlang. »Ich will Maman davon abhalten, zu trinken.«
»Du meinst, du willst vom Thema ablenken«, bellte der Direktor und wandte sich Jeremy zu. »Sind Sie der Vater?«
Jeremy konnte spontan nachvollziehen, warum weder Linett noch Raphael ihn zu mögen schienen. Er legte einen Tonfall an den Tag, der üblicherweise in Kasernen herrschte und in Jeremy zuverlässig die blanke Mordlust hochkochen ließ.
»Zu Ihrem Glück ja«, schnurrte Jeremy. »Sie haben zwanzig Sekunden, um mir zu erklären, was der Aufstand soll.«
»Das dauert keine zwanzig Sekunden«, fauchte Monsieur Flandin zurück. Er deutete anklagend auf Raphael. Der Junge war davon so abgelenkt, dass er nicht mitbekam, wie Linett das Glas senkte und sich einen großen Schluck genehmigte. Einen sehr großen. Genau genommen setzte sie erst ab, als das Glas beinahe leer war und drückte anschließend die Hand gegen die Lippen, um das Rülpsen zu unterdrücken. Selbst Jason holte beim Scotchtrinken öfter Luft. »Er hat den anderen Kindern imaginäre Haustiere verkauft und dafür jeweils hundertfünfzig Euro kassiert«, behauptete Direktor Flandin unterdessen.
»Es sind keine imaginären Haustiere«, widersprach Raphael. »Es sind digitale Haustiere.«
Raphael hielt Jeremy sein Handy unter die Nase. Ihn grinste eine Reihe selbstgezeichneter Monster an, bei denen man stellenweise nicht mal sagen konnte, ob sie Gliedmaßen besaßen und wenn ja, wozu die gut sein sollten.
»Jeder NFT enthält eine URL zu der Bilddatei«, referierte Raphael, als Jeremy nichts sagte.
»Hat dich Jason auf diese Idee gebracht?«, fragte Jeremy.
»Nein.« Raphael drückte die Brust raus. »Aber er fand es klasse und hat gesagt, ich solle es unbedingt machen.«
»Ich bring ihn um«, knurrte Jeremy.
»Denk dran, dass er hundert Prozent unseres Einkommens bezahlt«, wandte Linett ein. Ihr Glas war inzwischen leer, und allein mit ihrer Fahne konnte sie ein Soldatenbataillon flachlegen, indem sie es nur anhauchte. In der anderen, zitternden Hand hielt sie ihr eigenes Handy und tippte darauf herum. Am liebsten hätte Jeremy es ihr entrissen, um herauszufinden, wie ihre verfluchte neue Nummer war und wem sie schrieb. Wenn Jason recht hatte und sie ihre Flucht vor der Hochzeit vorbereitete, konnte sich ganz Paris warm anziehen. Jeremy würde die Stadt noch gründlicher auf ihre Grundmauern niederbrennen, als es damals Nero mit Rom gelungen war.
»Er wird mindestens zwei Wochen Nachsitzen«, platzte Monsieur Flandin dazwischen.
»Wieso?«, fragte Linett. »Es ist offensichtlich legal.« Sie schwenkte ihr Handy. »Ich hab’s gegoogelt. Ich versteh zwar nur die Hälfte, aber nirgends steht, es sei verboten.«
»Es entspricht nicht der Schulordnung …«
»Nach welchem Paragrafen?«, fragte Linett.
»Es gibt keinen passenden Paragrafen, ich habe vorher nachgesehen«, verkündete Raphael. Linett bot ihrem Sohn die Hand mit dem Handy zum Highfive, und der Direktor, der seine einzige Hoffnung ausgerechnet in Jeremy zu sehen schien, wandte sich ihm zu und besaß immerhin den Anstand, nicht die Augen zu verdrehen.
»Er hat den Kindern gesagt, diese schiefen Monster folgen ihnen überall hin und sie könnten sich auf die anderen Schüler stürzen, wenn sie Probleme machen würden.«
»So habe ich das Problem mit Léopold Jauffre gelöst«, rief Raphael triumphierend. »Er verprügelt Kinder, wenn sie ihm nicht ihr Essensgeld geben.«
Linett runzelte die Stirn. »Der lässt sich von einem Monsterbild abschrecken? Sei mir nicht böse, ma puce, außergewöhnliche Kunst ist das nun nicht.«
Raphael schob die Unterlippe vor. »Ich habe mir Mühe gegeben«, verteidigte er sich. »Aber nein, er hat sich nicht davon beeindrucken lassen.«
»Und was hast du dann getan?«, flüsterte Linett.
»Ich habe ihn abgepasst und ihm ordentlich eine reingehauen.«
»Das ist mein Sohn!«, quietschte Linett.
»Ich hab’s mir anders überlegt, er wird nicht nachsitzen«, mischte sich Monsieur Flandin ein, und Linett strahlte ihn an.
»Sehr schön, Sie sind doch ein Mann mit Verstand.«
»Er ist zwei Wochen lang vom Unterricht suspendiert.«
»Was?«, kreischte Linett so laut, dass sogar Jeremy zurückzuckte. Genauso wie Raphael. Nur Monsieur Flandin besaß entweder kein Trommelfell mehr oder er war hysterische Mütter gewohnt. Er wich nicht ein Stück zurück.
»Sie haben mich richtig verstanden«, erwiderte er hämisch. »Zwei Wochen Schulverweis.«
»Sie stellen ihn zwei Wochen von der Schule frei?«, fragte Linett pikiert. »Ich dachte, sie wollen ihn bestrafen und nicht uns?«
»Zur Hölle, können Sie sich nicht wie erwachsene, verantwortungsbewusste Eltern verhalten?«
»Ich bin verantwortungsbewusst.« Sie straffte die Schultern. »Raphael, warte vor der Tür.«
»Ich will sehen, wie du ihm eine drüberhaust!«, protestierte Raphael. Er wandte sich dem Direktor zu. »Nichts für ungut.«
»Raus!«, donnerte Monsieur Flandin. »Ich will dich die nächsten zwei Wochen nicht mehr hier haben. Nichts für ungut.«
Jeremy legte Raphael die Hand in den Rücken. »Hör auf deine Mutter«, befahl er ihm, und mit einer Schmolllippe stapfte Raphael tatsächlich nach draußen.
Monsieur Flandin kniff die Augen zusammen und taxierte sie. Er hörte sogar auf seinen Instinkt, der ihm offenbar zur Flucht riet, dass er sich zumindest hinter seinen Schreibtisch zurückzog. Aber Jeremy war mit einem raschen Satz bei ihm und zerrte ihn wieder hervor. Er gab sich keine Mühe, seine vor Wut rot glühenden Iriden zu verbergen. Monsieur Flandin gehörte eindeutig zur starrsinnigen Sorte Mensch. Doch selbst die größten Sturköpfe wurden kleinlaut, wenn sie in die Augen eines wütenden Vampirs sahen. Es sei denn, sie hießen Linett und zimmerten einem aus dem toten Winkel eine Pfanne über. An der riss gerade Linett, fuchtelte mit dem Stiel herum, während am Rest ihre Handtasche hing. Endlich gelang es ihr, diese abzuschütteln und dabei nicht vom Alkohol benebelt umzufallen.
»Ich bin bereit«, rief sie.
Jeremy drehte den erstarrten Direktor mit dem Rücken zu sich, packte ihn vorn an der Kehle und drückte dessen rechten Arm auf die Schreibtischplatte, sodass er die Hand stillhalten musste.
»Sie wird Ihnen jetzt jeden Finger zertrümmern, wenn Sie das mit dem Schulverweis nicht unverzüglich zurücknehmen.«
»In ein paar Tagen findet meine Hochzeit statt«, schimpfte Linett. »Ich kann nicht gebrauchen, dass mein Sohn zu Hause ist und mir Vorträge darüber hält, was ich alles anders machen soll.« Sie hielt inne und schob sinnierend die Unterlippe vor. »Kann es sein, dass wir als Eltern versagt haben?«
»Nein«, erwiderte Jeremy. »Dafür, dass Jason einen enormen Einfluss auf den Jungen hat, können wir uns glücklich schätzen, dass er noch nicht den Eiffelturm eingeschmolzen hat.«
Monsieur Flandin schluckte, Jeremy spürte es unter seinen Fingern. Würde er nicht so fest zudrücken, hätte man auch die Worte verstehen können, die der Direktor in diesem Moment herauswürgen wollte.
Linett stemmte sich mit den Händen und der Pfanne auf den Tisch und beugte sich zu ihm. Monsieur Flandin versuchte zurückzuweichen und drückte sich dabei gegen Jeremy. Er gab ein leises ›Bah‹ von sich.
»Haben Sie einen Kommentar abzugeben?«, forschte sie lauernd, und Jeremy lockerte seinen Griff um den Hals von Monsieur Flandin.
»Einige«, presste er heraus. »Sie stinken wie eine Destillerie, und statt Ihre Konflikte konstruktiv anzugehen, reagieren Sie mit Trinkerei und Gewalt. Ihr Sohn ist verzogen, kennt keine Grenzen, handelt ohne Rücksicht auf Verluste, neigt zur Gewalttätigkeit, stört permanent den Unterricht, und seine Noten sind schlecht. Aber das ist nicht das Schlimmste.«
»Ach, nein?«, fragte Linett verdutzt. »Was kann denn für einen Kirschkernkacker wie Sie noch schlimmer sein?«
»Dass Raphael ein heller und wissbegieriger Kopf ist, der nur lernen müsste, seine Energien in gewinnbringende und moralisch vertretbare Bahnen zu bringen. In Bahnen, die auch der Gesellschaft etwas nutzen und nicht zwei kleinkriminellen Elternteilen, die nur eines tun werden – ihn in den Abgrund zu ziehen. Sein Leben ist vorbestimmt, und es wird gewiss nicht auf der legalen Seite des Gesetzes stattfinden.«
»Hat der uns gerade kleinkriminell genannt?«, empörte sich Linett. »Wir arbeiten für Jason Harris. Der ist bestimmt vieles – irrsinnig, ständig bekifft, psychopathisch, aber keine kleine Nummer.«
Jeremy schwante so einiges. Wenn sie so weitermachten, stand bald das Jugendamt vor ihrer Tür. Das würde sie wieder eine Menge Bestechungsgeld und Mühe beim Vertuschen kosten.
Linett starrte den Schuldirektor an, als wäre er ein verschwommener Geist. Bis sie mit dem Kopf schüttelte. »Geht es nur mir so, oder hast du auch den Eindruck, dass er lebensmüde ist?«, fragte Linett ratlos. »Bin ich nicht einschüchternd genug? Er sieht doch die Pfanne, oder?«
»Vielleicht hat ihm Monsieur Hébras ein paar Kleinigkeiten über uns erzählt?«, erwiderte Jeremy.
Sie sahen beide fragend Monsieur Flandin an. Der besaß in seiner Position wirklich noch die Stirn, die Augen zu verdrehen. »Er hat jedenfalls einiges erwähnt«, knurrte er. »Umso schlimmer, dass sich seine Prognose bewahrheitet – dass die Schule Raphael nur Rechnen und Schreiben beibringt, damit er das Schutzgeld zusammenrechnen und nachlesen kann, welche Paragrafen er bricht.«
»Das ist nicht wahr!«, protestierte Linett. »Was ist denn mit Biologie, hé?«
»Also ich wüsste da was«, mischte sich Jeremy ein, und der Kerl verdrehte schon wieder die Augäpfel.
»Man muss immer wissen, wo man jemandem am meisten wehtun kann«, gab Monsieur Flandin von sich.
»Guter Einwand«, nuschelte Linett. »Physik?«
»Schussbahnberechnung.«
»Äh«, machte Linett und sprach Jeremy damit aus dem Herzen. Was zum Teufel trieben sie hier eigentlich? Wenn Jason mitbekam, dass Monsieur Flandin seinen Unterricht auf diese Art auslegte, hatte der schneller eine Schule für angehende Schwerverbrecher gegründet – mit Monsieur Flandin als Direktor –, als sie alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen konnten.
»Kunst!«, rief Linett.
»Schätzung des Wertes gestohlener Gemälde«, schoss Monsieur Flandin zurück.
»Sport!« Sie hob die Hand, samt Pfanne. »Warten Sie, da komm ich auch selbst drauf. Wobei Raphael nicht sonderlich sportlich ist.«
»Dann haben Sie Ihren Sohn nicht erlebt, wenn er aus dem Fenster klettert, um anschließend in der Schulküche den Herd mit Feuerwerkskörpern zu sprengen.«
»Das wäre wohl ein Fall für Chemie«, murmelte Linett.
»Seid ihr fertig?«, fragte Jeremy gereizt dazwischen. »Kann ich ihn jetzt umbringen?«
»Du kannst ihn nicht umbringen«, protestierte Linett. »Er ist Raphaels Schuldirektor. Wie sollen wir eine andere Schule für ihn finden, wenn du ihn tötest?«
»Gar nicht. Er bleibt einfach hier, mit einem neuen Direktor«, gab Jeremy zurück.
»Du rührst ihn nicht an«, befahl Linett. »Ich, äh, ich mag ihn ganz gern.«
»Obwohl Ihnen mein Hintern nicht gefällt?«, ätzte Monsieur Flandin, und Linetts Wangen färbten sich rot.
»Er ist nicht sonderlich schlau«, stellte Linett fest.
»Er nimmt uns nicht ernst«, verpetzte ihn Jeremy ungeniert. »Vor allem dich nicht.«
Linett starrte den Direktor finster an, dann in Richtung ihrer Pfanne und schien zu überlegen. Monsieur Flandin versuchte, sich aus Jeremys Griff zu winden. Überflüssig zu erwähnen, dass es nicht gelang. Seinem Blick nach zu urteilen wünschte er sie allesamt in die Hölle. Damit war er nicht der Einzige, nur war er einer der wenigen, der vorerst überleben würde. Spurlos verschwundene Direktoren, die irgendwann als aufgequollene Wasserleiche im Nebenarm der Seine auftauchten, hatten bedauerlicherweise die lästige Angewohnheit, schnüffelnde Polizisten hinter sich herzuziehen. Und langsam hatten sie niemanden mehr, den sie mit besagten Schnüfflern verkuppeln konnten, damit die Ruhe gaben. Was sehnte sich Jeremy nach der Zeit, als er sie noch einfach hatte umbringen dürfen. Es war nur eine Mahlzeit im Vorbeigehen gewesen, eine kleine Hetzjagd, die das Ganze amüsanter machte. Doch jetzt musste er diesen sturen Bock von Direktor am Leben lassen, weil Linett mal wieder beschlossen hatte, dass hier niemand umgebracht wurde. Wenn sie jemanden mit einer Pfanne niederschlug, war es in Ordnung, aber wehe, er beging einen kleinen Mord.
Immerhin, so störrisch wie sich Monsieur Flandin auch gab, er hatte Angst. Seine Körperreaktionen konnte er vor einem Vampir nicht verstecken. Sein Herz arbeitete auf Hochtouren. Das Pochen seines Pulses hallte in Jeremys Ohren, und der Duft von Blut war so präsent, dass Jeremy nicht widerstehen konnte. Er biss ihn in den Hals und spürte, wie sich der Körper des Mannes versteifte. Das Blut umgarnte seine Sinne, es berauschte ihn, und nur mit Mühe konnte sich Jeremy davon abhalten, weiter zu trinken, bis nichts mehr übrig war.
Jeremy löste seinen Biss und setzte Flandin auf seinem Stuhl ab. An seinem Hals sickerten zwei Tropfen Blut aus den Einstichstellen von Jeremys Zähnen.
Linett winkte mit der Hand vor den starrenden Augen des Direktors herum. »Ich fürchte, sein Vorgänger hat ihm vorenthalten, dass Raphaels Vater ein Vampir ist. Sonst hätte er sicherlich Eisenkraut genommen.«
»Nun weiß er es.« Jeremy umfasste das Kinn von Monsieur Flandin, bis der ihm in die Augen sah. »Kein Schulverweis, sonst wird der nächste Biss das Letzte sein, was Sie in diesem Leben noch fühlen werden«, knurrte Jeremy und ließ ihn abrupt los.
Würde dieser Kerl den Schulverweis durchziehen, wäre das mit einem ›Ich möchte nicht mehr leben und trau mich nicht, mir selbst die Kugel zu geben‹-Statement gleichzusetzen.
Linett rieb sich über die Stirn und schließlich über die Augen, sodass sie ihre Mascara verschmierte. »Ich weiß nicht, ob das die Art von Konfliktlösung ist, die wir Raphael vorleben sollten.«
»Er hat es ja nicht gesehen.«
»Vielleicht hat Monsieur Flandin recht …« Linetts Stimme klang ratloser als zuvor.
»Du schlägst regelmäßig Mafiosi mit deiner Pfanne nieder, willst du da jetzt wirklich moralische Zweifel entwickeln?«
»Es geht nicht um mich, es geht um Raphael«, rief Linett. »Er soll es doch guthaben.«
»Er hat es gut.«
»Aber auch zukünftig. Ohne Schießereien und Prügeleien und ohne Betrug und, und, und …« Sie warf frustriert die Hände in die Luft und ließ dabei die Pfanne fallen, die mit einem Klong aufs Parkett knallte. »Wenn es nach dir ginge, hätte Raphael schon seinen ersten Mord hinter sich.«
»Das ist überhaupt nicht wahr. Er ist nur ein halber Vampir, er muss nicht töten, wenn er nicht will«, widersprach Jeremy. »Wenn du aber ein Vampir bist und erneut schwanger werden solltest, würdest du einen Vampir gebären, und dieses Kind bräuchte tatsächlich Blut. Raphael stopft sich ja lieber mit Cornflakes voll.«
»Ich weiß nicht, welcher Teil der Vorstellung mich beinahe vor Angst kreischen lässt«, murmelte Linett. Sie wandte sich abrupt ab und marschierte zum Ausgang. Jeremy hob ihre Pfanne auf und holte sie ein, als sie gerade die Tür öffnete. Er drückte diese wieder zu.
»Ist nicht weniger Raphael das Problem, als eher die Tatsache, dass du nicht heiraten willst?«, fragte er.
Linett verzog den Mund, als überlege sie. »Nein.«
Okay, so ungeschönt hatte sie ihn auch noch nie angelogen. Er kannte sie jetzt verdammt lange, er wusste, wann sie schwindelte. Dann klopfte ihr Herz immer einen Vierteltakt schneller. Als sie die Tür erneut aufzog, packte er sie am Arm und presste sie an sich. Nun schlug ihr Herz nicht nur einen Vierteltakt, sondern viele Takte schneller. Ihr Atem beschleunigte sich, er legte die Hand auf ihre Wange und küsste sie. Ihre Lippen waren weich, schmeckten nach Schokolade und dem Rum, und nur Gott allein wusste, wie gern er sie berauscht von dem Snack des fremden Blutes in die nächste stille Ecke gezogen hätte, um sie zu lieben und auch ihr Blut zu kosten.
Aber das Erzeugnis eines ähnlichen Überfalls auf Linett stand nur ein paar Meter von ihnen entfernt im Flur, die Hände hinter dem Rücken verschränkt wie ein Inspektor und sah angestrengt nach draußen.
Kapitel 4
Einbrechen lohnt sich nicht
Für die Anprobe war es inzwischen zu spät, und Linett hielt es für besser, wenn Direktor Flandin ihren Sohn heute nicht mehr zu sehen bekam. Eine Nacht zum Nachdenken würde dem armen Kerl guttun und in ihm den Entschluss festigen, dass er auf keinen Fall Raphael von der Schule werfen würde. Jedenfalls war das Linetts Hoffnung. Also hatten sie beschlossen, Raphael mit nach Hause zu nehmen.
Dass sich Linetts Kopf anfühlte, als wäre ihr Geist in Watte gepackt worden, war nicht gerade hilfreich, wenn es darum ging, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. War ihr das Trinken noch vor einer halben Stunde wie ein Rettungsanker erschienen, verfluchte sie sich nun umso mehr dafür. Sie hasste Gefühlschaos. Das letzte Mal hatte sie sich so gefühlt, als sie vor Jeremy auf der Flucht gewesen war und sie sich entscheiden musste, ob sie die Assistentin eines Berufsverbrechers werden wollte. Bisher hatte sie diese Entscheidung nicht sonderlich bereut. Sie liebte Jeremy, bei Jason kam nie Langeweile auf, nur waren sie eben allesamt bis unter den Haaransatz kriminell. Und Linett wurde die Ahnung nicht los, dass Raphael keinen Deut anders werden würde, wenn sie nicht schleunigst die Kurve bekamen.